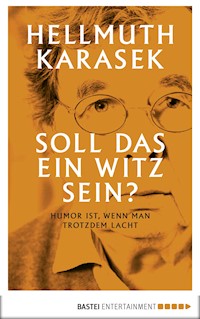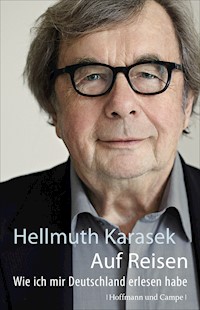10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Satire, Ironie, tiefere Bedeutung: Karaseks kleines Welttheater unserer Zeit schert sich um kein Tabu. Es heißt, das Leben schreibe die besten Geschichten - nur kann das Leben halt nicht schreiben. Es braucht einen wie Hellmuth Karasek, der mit scharfem Blick und sprachlicher Eleganz die großen und die kleinen Ereignisse liebevoll und scharfzüngig festhält. Er erzählt von starken Frauen, die auch nur Männer sind, wie es schon in alten Mythen steht, von Bunga Bunga in mediterranen Lotterbetten, von Kuckucksuhren und Pleitegeiern, von Deutschen, die immer Vorfahrt und immer recht haben, von liberalen Doktorspielen und vom Einmarsch der Plagiatoren, von der falsch verstandenen Toleranz der Weichspüler in deutschen Feuilletons, von den Plackereien des Alterns und den Tücken der Reisen mit der Bahn. Dabei fühlt sich Karasek oft wie ein einarmiger Bandit, trifft aber stets den Nagel auf den Kopf. Seine pointierten Glossen zeugen von gnadenloser Beobachtungsgabe, Selbstironie und der Erkenntnis, dass wir gern über das lachen, wovor wir Angst haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hellmuth Karasek
Frauen sind auch nur Männer
Glossen
Hoffmann und Campe Verlag
Statt eines Vorworts
Rechenwärmer kriechen
Normalerweise reden wir, »wie uns der Schnabel gewachsen ist«, wir nehmen dabei »kein Blatt vor den Mund« – während wir offiziell bei Feiern, Reden, Ansprachen »nach der Schrift« reden, sogenanntes »Schriftdeutsch«. Manchmal heißt es auch, dass wir »wie gedruckt« lügen.
Jetzt geht’s einmal nicht »hochdeutsch« zu, also rechtschreiberisch rechthaberisch, nicht dudenmäßig, sondern phonetisch, gebabbelt, genuschelt, gequatscht, gesabbert. Wie der Volksmund spricht.
Die folgende Geschichte sollte am besten laut gelesen werden, mit allen Tücken und Weichheiten der sächsischen Sprache: Da bestellte eine Frau telefonisch ein Flugticket von Leipzig nach Porto. Und bekam ein Ticket nach Bordeaux. Bordeaux in Südfrankreich, Porto in Portugal. Oder war’s umgekehrt, sie wollte nach Bordeaux und bekam eins nach Porto? Ist ja egal, gehupft wie gesprungen, denn offenbar sprach sie Bordeaux oder Porto gleich aus, als Bordo, eben sächsisch. Und da saß sie nun mit ihrem falschen »Ticket«, respektive »Digged«, und bekam es nicht getauscht. Ein Schicksal aus Sachsen, wo harte Männer im Liebesrausch schon mal stöhnen: »Gib mir wilde Diernamen, nenn misch Buma!« Auf Hochdeutsch: Puma.
In Sachsen hat der Satz »Rechenwärmer kriechen« zweierlei Bedeutung. Er kann biologisch sein: »Regenwürmer kriechen«. Oder meteorologisch: »Regen werden wir kriegen.« Je nachdem. Ähnlich beinlos weichtierhaft wie in der sächsischen Artikulation geht es nur noch im Hessischen zu, wo Goethe im »Faust« »Ach neige, du Schmerzensreiche« dichtet: »Ach neiche«, sagt Gretschen im Gebet. Damit es sich auf die »schmerzensreiche« Himmelskönigin reime. Oder Goethes berühmte letzte Worte: »Mehr Licht!«, soll der Olympier gesagt haben. Aber sagen wollte er: »Mer licht hier schlescht.« Man liegt hier schlecht; da fuhr ihm der Tod in die Parade.
Auch der »Struwwelpeter«-Autor Dr. Heinrich Hoffmann babbelte eindeutig hessisch weich und dichtete über den fliegenden Robert: »Hui, wie pfeift der Sturm und keucht – dass der Baum sich niederbeugt.« Was sich auf Hessisch tatsächlich reimt.
In Sachsen gibt es die Geschichte vom Zoologie-Professor, der angeblich alle Studenten nur über Würmer examinierte. Also lernten sie nur über diese Griechdiere. Er fragt den Ersten, oh, Schreck!, überraschend nach den Elefanten. Der sagt: »Der Elefant ist groß und hat einen Rüssel. Der Rüssel ist wie ein Wurm. Die Würmer zerfallen in die Faden-, Band- und Spulwürmer …«, und dann rasselt und kellerasselt es nur so. Den Zweiten fragt er nach den Löwen. Der antwortet erschrocken: »Der Löwe lebt in Afrika. In Afrika ist es wärmer. Die Wärmer zerfallen in die Faden-, Band- und Spulwärmer …«
So kommt es, dass man in Sachsen statt nach Bordeaux nach Porto fliegt. In beiden Orten ist es jedenfalls wärmer.
Manches Gesprochene, besonders in Sachsen, lässt sich nur schwer geschrieben wiedergeben. Dabei hat doch Luther, der die Sächsische Kanzleisprache ebenso beherrschte wie die der Eislebener Gegend, die Bibel, also die »Heilige Schrift«, auf der Wartburg ins Deutsche übersetzt, und dabei, wie er sagt, »dem Volk aufs Maul geschaut« und so unsere hochdeutsche Sprache geschaffen.
22. November 2010
Armani-Schnäppchen an der Autobahn
Bauernfängertricks mit unwiderstehlichen Angeboten – und wie »Mario, der Kellner« einmal dreißig Euro geschenkt bekam.
»Autobahn-Gold« lautete die Überschrift des Artikels, und er handelte von ausländischen Banden, meist Kosovaren, die mit einem Bauernfängertrick andere parkende Autofahrer reinlegten. Sie gaben vor, ihre Kreditkarten verloren zu haben, sodass sie nicht tanken konnten, und boten Hilfsbereiten ein scheinbar unwiderstehliches Schnäppchen an: Goldschmuck, den sie in ihrer Not den Helfenden als übergroßen Gegenwert überlassen wollten.
Sie appellierten also mehr an den Schnäppchen-Instinkt als an den Willen zu helfen; indem sie Leute schamlos übers Ohr hauten, gaben sie denen das Gefühl, sie übers Ohr zu hauen. Statt falschem Gold boten sie auch Armani-Jacken, billige – Fälschungen natürlich.
Dazu kann ich eine Stadtvariante beitragen, als Fußgänger, die mir heute noch die Schamröte über meine Dummheit, Feigheit und Eitelkeit ins Gesicht treibt. Sei’s drum!
Ich kam vom Sport, um die Mittagszeit, als mich auf dem Weg zur U-Bahn ein parkender Autofahrer in einem blitzblanken BMW-Kombi zu erkennen schien, aus dem Auto sprang und mich herzlich wie einen verlorenen Freund begrüßte: »Professore! Dottore! Karasek! Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Mario! Der Ober aus dem Restaurant, wo Sie immer gegessen haben.«
Ich erinnerte mich weder an ihn noch an das Restaurant, sagte aber: »Ah ja! Natürlich!« Er wollte mir etwas schenken. Dann zeigte er mir eine elegante Lederjacke. Und noch eine. Aus Dankbarkeit! Da sei aber noch eine Kleinigkeit. Seine Frau und er hätten sich selbstständig gemacht, in Venedig, ich solle sie in ihrem Restaurant besuchen. Jetzt habe er leider seine Kreditkarten verloren und müsse tanken. Ich hatte dreißig Euro bei mir, die ich ihm anbot. Mario schüttelte den Kopf. »Mit dreißig Euro bis Venedig!«
Dann ließ ich mich überreden, von zu Hause meine Scheckkarte zu holen, um ihm zweihundert Euro zu besorgen. Er kutschierte mich zur Bank. Erst im Kassenraum wurde ich misstrauisch. Dachte, dass er ein Hehler eines Einbruchs bei Armani sein könnte. Ich ging raus und sagte, mein Konto sei offenbar nicht in Ordnung. Außerdem wolle ich seine Geschenke nicht. Er fuhr eilig weg. Mit nur dreißig Euro. Ich kam mir wie ein Idiot vor, dem es recht geschieht. Später erfuhr ich von italienischen Obern, die ich wirklich kannte, in Lokalen, in denen ich wirklich öfter aß, dass »Mario« diesen Trick schon öfter praktiziert hatte.
Von einem goldenen Ring, der aus Messing war, kann ich ein andermal erzählen.
29. November 2010
Erben und erben lassen
Joop, Bismarck, Neven DuMont – überall Krach in deutschen Dynastien. Und Shakespeare hat alles schon früh geahnt.
Als Shakespeare-Student in den fünfziger Jahren hatte ich neben Professoren, die Shakespeares Dramen tiefschichtig und weitschweifig interpretieren konnten, einen handfesten englischen Lektor, der die Inhalte der Dramen des Größten zu kurzen und beherzigenswerten Lebensweisheiten verknappte; Sprichwörter des gesunden Menschenverstands.
Also etwa »Romeo und Julia«: »Heirate nicht zu jung!« Oder »Hamlet«: »Denk nicht zu viel nach!« Oder »Othello«: »Heirate keinen Gastarbeiter!« »König Lear« hieß: »Guck dir deine Erben genau an!« und »Vererbe nichts zu Lebzeiten!«.
Wie wahr! »König Lear« wird zurzeit in vielen betuchten und edlen Dynastien gespielt. Bis zu dem dem Stück innewohnenden Wahnsinn am Ende. Bei Joops zum Beispiel. Wo Tochter Jette, dem Muster der bösen Lear-Tochter Goneril folgend, dem Vater die Schlösser auswechselte, auf dass er vor verschlossenen Türen stünde und dem Wahnsinn verfalle. Verkaufte er deshalb all seine Möbel, und wird er künftig auf der Heide vor Potsdam umherirren?
Nehmen wir die Bismarcks, die Familie des Reichsgründers und Eisernen Kanzlers, der nebenbei noch den Bismarck-Hering, die Bismarck-Quelle und den Bismarck-Korn in die Welt gesetzt hat. Da tobt ein Erbfolgekrieg, wobei der nach Amerika verbannte Sohn Carl und die eigene Mutter so sehr aneinandergeraten sein sollen, dass die gerufene Polizei wieder für Ruhe in Friedrichsruh sorgen musste.
Der »Hamlet« unter den Erben ist zweifelsohne Konstantin aus dem Hause Neven DuMont, Erbe einer Kölner Verlagsdynastie, der sich vor der Welt unter dem Namen (so steht es am Klingelschild) »K. Mustermann« verschanzte und der sich in Blogs eines Medienjournalisten »Kopf Schüttel«, »Schlauberger«, »Hans Wurrst« oder »Das wird man wohl noch sagen dürfen« nannte.
»Ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode«, möchte man da Shakespeare zitieren. Konstantin Neven DuMonts greiser 83-jähriger Vater, schlauer als Lear, kehrte vom Altenteil zurück und warf den Sohn aus sämtlichen Zeitungsbetrieben. In vieren allein war Konstantin Herausgeber.
Nun klagt der Sohn in einem ergreifenden Monolog: »Warum ist das so in diesem Land, dass man keine Schwäche zeigen darf, ohne dass man gleich abrasiert wird?«
Nach dem Motto: »Etwas ist faul im Staate Dänemark!« Er aber hat nicht zur Flinte gegriffen, sondern dieselbe ins Korn geworfen.
27. Dezember 2010
Auf Weihnachtsreise mit Mozart
Aus gegebenem Anlass eine Erinnerung an alte Zeiten: »Kein warmes Zimmer, verfrieren wie ein Hund, alles, was ich nur berühre, ist Eys.«
Das Folgende erzähle ich zum Trost und von wegen der guten alten Zeit: Am 24. Dezember 1762 bestieg die Familie Mozart, mit den beiden Wunderkindern Nannerl und Wolfgang, in Preßburg die Postkutsche, um nach Wien zu reisen – und brauchte für die etwa siebzig Kilometer zwölf Stunden, also sechs Kilometer pro Stunde!
Das lag am furchtbaren Zustand der Straßen. Fürs Übernachten in den primitiven Wirtshäusern mussten die Reisenden ihre Betten mitbringen. Unfälle und Räuber drohten auf der Strecke, vor jeder Fahrt machte man wohlweislich sein Testament. Mit sieben Jahren, man schrieb das Jahr 1763, fuhr der kleine Wolfgang mit Schwester und Eltern von Salzburg nach München. Am ersten Reisetag brach ein Rad, das man nur durch ein geborgtes kleineres ersetzen konnte. Der Vater und der Diener, Sebastian Winter, legten die fünfundsechzig Kilometer bis Wasserburg zu Fuß zurück, um die windschiefe Kutsche zu schonen. Wolfgang Amadeus stützte sich, um den wunden Po zu schonen, während der Fahrt auf beide Hände, mit denen er anschließend musikalische Wunder zu vollbringen hatte.
Im Dezember 1769 überquerten die Mozarts den Brenner für eine Florenzreise. Vater Leopold schrieb nach Hause: »Kein warmes Zimmer, verfrieren wie ein Hund, alles, was ich nur berühre, ist Eys!« »Eys« schrieb sich das Eis in der angeblich so guten alten Zeit. Mozarts Gesicht und Hände waren so gerötet von der Kälte und von den Feuerstellen, denen er sich auf der Suche nach etwas Wärme zu sehr genähert hatte, dass er sie allabendlich mit einer Salbe einrieb, die ihm eine mildtätige Mantuanerin geschenkt hatte.
Mozart musste reisen, um als Wunderkind seine Familie zu ernähren und Fürsten und Bischöfe mit seinem Klavierspiel zu ergötzen. Das Wasser in den frostigen Herbergen war übrigens so dreckig (heute würden wir sagen: kontaminiert), dass es nur mit Wein zu genießen war, krank wurde man trotzdem meistens.
Wer das liest, verzeiht der Bahn gerne, dass sie wegen ein paar verwehter Weichen vom Reisen abrät. Sie hat ja so recht! Und auch fliegen ist ja nicht schöner, wenn es stürmt, blitzeist und schneit.
Ich denke, wer kein Wunderkind ist, sollte es mit Ringelnatz und seinem Ameisenpaar halten: »In Hamburg lebten zwei Ameisen,/die wollten nach Australien reisen./Bei Altona auf der Chaussee,/da taten ihnen die Beine weh./Und da verzichteten sie weise/auf den letzten Teil der Reise.« Und Ringelnatzens Quintessenz: »So will man oft und kann doch nicht/und leistet dann recht gern Verzicht.«
3. Januar 2011
Die guten schlechten Zeiten
Vergangene Jahre sind wie alte Handschuhe – zum Wegwerfen eigentlich zu schade
Kaum ist das alte Jahr vorbei, da wünschen sich die Menschen schon ein neues. Rücksichtslos, pietätlos. Statt das alte Jahr zu behalten, in die Reinigung zu bringen oder in die Änderungsschneiderei, zum Kunststopfen nicht nur der Finanzlöcher, böllern sie sich ein neues Jahr herbei, als ob sie nicht wüssten, dass es bestimmt nicht besser als das alte ist, sondern von einem gewissen Alter (für Männer ab achtundzwanzig, für Frauen ab neunundzwanzig) nur noch abwärtsgeht.
Jedes neue Jahr wird schlechter als das alte, bestenfalls nimmt man an Gewicht zu, was man an Intelligenz einbüßt, und gewinnt an Lebensweisheit, was man an Lebensfreude verliert. Dabei wäre es doch schön, dem alten Jahr nachzuhängen und es zu bewahren. Vielleicht geht der hartnäckige Fleck von der Weihnachtsgans aus der Krawatte raus. Vielleicht wird aus Westerwelle, wenn wir ihn zum Änderungsschneider bringen, doch noch ein beliebter Außenminister.
Denn Westerwelle hatte offensichtlich Kleidersorgen, als er ex officio in die Türkei reiste und zur Sicherheit erklärte: »Ich bin hier nicht als Tourist in kurzen Hosen unterwegs, sondern als deutscher Außenminister. Das, was ich sage, zählt.« Inzwischen ist die Zahl drei Prozent das Einzige, was er zählen muss, und gezählt sind seine Tage im Amt. Und die FDP versucht ihn gern und vergeblich zu entsorgen wie Berlusconi den Müll von Neapel.
Alle wollen das Alte wegwerfen, als wäre es ein Dreck. Da mir in diesem Jahr und im letzten aus gegebenem Anlass immer Ringelnatz eingefallen ist, will ich das neue Jahr mit einer Warnung vor dem Wegwerfen des Alten beginnen. Ringelnatz hat bekanntlich, ebenso wie Schiller, eine Ballade vom Handschuh und vom Wegwerfen desselben geschrieben. »Als ich den einen verlor,/Da warf ich den andern ins Feuer/Und kam mir wie ein Verarmter vor./Schweinslederne sind so teuer.//Als ich den ersten wiederfand:/Shake hands, du ledernes Luder!/Dein eingeäscherter Bruder/Und du und ich –: im Dreiverband,/Da waren wir reich und mächtig,/Jetzt sind wir niederträchtig.«
Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten von Ringelnatz leider nichts gelernt. Verbrannte Erde! Verbrannte Handschuhe! Jetzt stehe ich da mit einer Kollektion diverser rechter und linker, verschieden aussehender, verschiedenfarbiger Handschuhe, teils aus Wild-, teils aus Schweinsleder, und komme mir vor wie ein einarmiger Bandit. Alles Gute!
8. Januar 2011
Das Schweigen der Wahl-Lämmer
Den Liberalismus in seinem Lauf halten weder Trittin noch Gysi auf. Oder: Wie die FDP ihr Problem zum Tabu macht
Ich habe mir, von Berufs wegen und auch sonst, den Dreikönigstag der Freien Demokraten in Stuttgart live im Fernsehen zugeführt – was tut man nicht alles, wenn man auf der Suche nach einer Glosse ist?
Ich will hier jetzt nicht den Redestil von Herrn Westerwelle mit dem von seinem Generalsekretär Christian Lindner vergleichen und wer besser war und tosenderen Beifall bekommen hat. Ich gebe zu, dass ich mich über die vorauseilende Überschrift in der »FAZ« gefreut habe, die da hieß: »Westerwelle in der entscheidenden Phrase«, und so habe ich geduldig zugehört. Und es wurde ja auch viel Kluges, Beherzigenswertes und Vernünftiges gesagt, so wenn beispielsweise der Stuttgarter Spitzenkandidat Ulrich Goll in einer Spitze gegen die Grünen sagte, sie wollten ihre Wähler mitnehmen, und fragte: »Hätten Sie es gern, wenn Ihr Kind auf der Straße mitgenommen würde« – womöglich von einem fremden Mitschnacker?
Und mir ist dann auch noch das ebenso grüne Wort eingefallen, man wolle die Wähler »abholen«, wobei mir als altem Mann bei den Begriffen »abholen« und »mitnehmen« immer eher die Gestapo oder die Stasi einfallen, die einen bei Nacht und Nebel mitgenommen oder abgeholt haben. Sei’s drum. Vor Claudia Roth hätte ich auch um Mitternacht keine Angst, wenn sie als rotblonder Leuchtturm auftauchte, um mich zu einer Diskussion abzuholen.
Nein. Mir ist, als ich Westerwelle und Co. lauschte, einmal ein Sprichwort eingefallen, und das heißt: »Im Haus des Gehenkten spricht man nicht vom Strick.« Und zweitens ein Interview-Ausspruch von Kubicki, den in einem »Spiegel«-Gespräch der Zustand der FDP um die Weihnachtszeit an das Ende der DDR erinnerte. Sie erinnern sich? »Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.« Jetzt: Den Liberalismus in seinem Lauf halten weder Trittin noch Gysi auf. Obwohl wir wochenlang mit dem Dilemma konfrontiert sind, dass die FDP um die vier Prozent dahinsiecht, und das ausdrücklich wegen Westerwelle.
Die Umfragekurven sehen aus wie aus einer Arztserie (»Dr. House« etwa), wo nach heftigem Auf-und-ab-Schwingen die Linie endgültig lang am Boden flach dahinläuft. Exitus, denken die Ärzte, und der Chefarzt versucht sich zur Mund-zu-Mund-Beatmung mit seiner Assistentin zu retten, weil der Patient ohnehin schon tot ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Nicht einmal Thema der Rede war dieses Alarmsignal. Nicht einmal auch nur andeutungsweise, dass der Vorsitzende das Problem der Partei sein könne. Es war der perfekte Double-Speech, ohne dass ein Gorbatschow dazwischenrief: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.«
15. Januar 2011
Auf nach Kötzschenbroda
»Ist hier noch Platz in diesem Zug?« Eine vielbesungene Expressfahrt ins sächsische Posemuckel und die Bahnprobleme von heute
Über den spektakulären Mauersprung Udo Lindenbergs gibt es jetzt ein Musical. Fast wäre die Reise nach Ostberlin im Jahr ’83 geplatzt, weil Lindenberg vorher den »Sonderzug nach Pankow« geschrieben und gesungen hat, in dem er Honecker als »Honi« besingt. Die Melodie geht auf den Glenn-Miller-Titel »Chattanooga Choo Choo« aus den vierziger Jahren zurück, allerdings vermute ich – und bin mir dabei ziemlich sicher –, dass Lindenberg sein Lied dem Kötzschenbroda-Express als aktuelle DDR-Version nachempfunden hat. Der »Kötzschenbroda-Express« ist von 1947 und geht so: »›Verzeihn Sie, mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda?‹/›Er schafft’s vielleicht, wenn’s mit der Kohle noch reicht.‹/›Ist hier noch Platz in diesem Zug nach Kötzschenbroda?‹/›Das ist nicht schwer, wer nicht mehr stehn kann, liegt quer.‹/Ja, für Geübte ist das Reisen heute gar kein Problem./Auf dem Puffer oder Trittbrett steht man bequem./Und dich trifft kein Fußtritt, fährst du auf dem Dach mit./Obendrein bekommst du dort noch frische Luft mit!/Morgens fährt der Zug an Papestraße vorbei,/Mittags ist die Fahrt nach Halensee noch nicht frei./Nachts in Wusterhausen lässt du dich entlausen/und verlierst die Koffer auch noch leider dabei./So fährt man heut von Groß-Berlin nach Kötzschenbroda/Und dann und wann kommt man auch wirklich dort an./Nun stehn wir da, der schöne Traum vom Reisen ist jetzt aus./Glück auf nach Kötzschenbroda – aber ich bleib zu Haus.«
Kötzschenbroda ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dresden, also eine Art sächsisches »Hinterposemuckel«, das schon Fontane und Tucholsky als Name eines tiefsten Provinznestes reizte. Hinzu kommt, dass es in sächsischer Aussprache »Götschenprodö«, also mit weichem k und hartem b, gesprochen wird und da doch sehr possierlich klingt. Kötzschenbroda lag in der Ostzone. In Kötzschenbroda hat Karl May gelebt, die Stadt wurde mit Radebeul vereint, und in Radebeul ist das Karl-May-Museum. Gut möglich, dass Udo Lindenberg »Honi« wegen dieses Karl-May-Bezugs in seinem Pankow-Lied als »Oberindianer« bezeichnet hat.
Mich frappiert aber mehr, dass das Lied heutige Bahnverhältnisse geradezu perfekt widerspiegelt. Es erinnert mich an heute, besonders was die S-Bahn-Strecke in Berlin anlangt, für die Bully Buhlan (damals der deutsche Sinatra meiner Kindheit) einen Tag gebraucht hat. Damals waren die Feinde des Bahnverkehrs die Kriegsverwüstungen, die Zerstörungen und Demontage der Gleise, der kaputte Maschinenpark und die Besatzungszeit, Strommangel und Energieausfall. Die Leute hingen sich an Züge, um zum Ährenstoppeln oder Kohlenklauen das Nötigste zu besorgen.
Heute sind die Volksfeinde, die von der Deutschen Bahn benannt werden, vier, nämlich: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der innere Feind sitzt im Management und in der Politik und hat wegen des Börsengangs die Bahn so gut wie kaputt gespart. Bessere Argumente für eine Kapitalismus-Kritik können auch der Vorsitzenden der Linkspartei Gesine Lötzsch nicht einfallen. Statt Planwirtschaft Fahrplanwirtschaft.
Heute ist ganz Berlin Kötzschenbroda, jedenfalls ebenso abenteuerlich zu erreichen. Wer es sich leisten kann, singt: Glück auf nach Kötzschenbroda, ich bleib lieber zu Haus.
22. Januar 2011
Das Raubtier in mir
Jetzt stehen wir Fleischfresser wieder am Pranger, seit man Dioxin in Hühnereiern, Putenschnitzeln und Schweinefüßen aufgespürt hat
Jetzt sitzen wir wieder auf der Anklage-, um nicht zu sagen Schlachtbank, weil wir Raubtiere mit Messer und Gabel sind, die die Profitgier der Massentierhaltung und der Futtermittel-Mafia in Schwung halten.
Bald werden wir gejagt werden wie aufgescheuchte freilaufende Hühner. Nach den Rauchern geht es uns an den Kragen. Die Vegetarier aller Länder vereinen sich gegen uns, manchmal geraten wir sogar ins Pfeil-und-Bogen-Visier der Veganer, die Erdbeeren nur essen, wenn sie ihnen überreif von den Bäumen ins Maul fallen. Bloß nicht schütteln oder dran rühren!
Ich muss ein Geständnis aus der guten alten Zeit ablegen. Vor Jahrzehnten war ich in der Vorosterzeit in Zürich im Italienerviertel und aß in einem kleinen italienischen Lokal frisches Pyrenäen-Zickleinfleisch. Goldgelb gebraten von einer Wirtin, die eine richtige italienische Mama war. Die armen unschuldigen Tiere mundeten mir vorzüglich. Außen kross und innen zart schmeckten sie nach Stall, das talgige Fett klebte sich wohlig an Gaumen und Lippen. Zurückgereist nach Hamburg, hatte ich nur eine Sehnsucht: Zicklein, ohne Rücksicht darauf, dass die zarten Tiere schon in Grimms Märchen (»Der Wolf und die sieben Geißlein«) sozusagen den Zusammenhang tierischer Unschuld und wölfischer Raubgier darstellten.
Ich ging also in meine Fleischerei oder Schlachterei (in Österreich auch martialisch »Fleischhauerei«), in das vorösterliche Gedränge der Kunden, die schlimmstenfalls Lamm bestellten, und fragte laut: »Haben Sie Zicklein?«
In dem Moment hätte man in dem Laden eine Stecknadel fallen hören können. Alle starrten mich an, als wäre ich der gesuchte Täter aus dem vortäglichen »Aktenzeichen XY