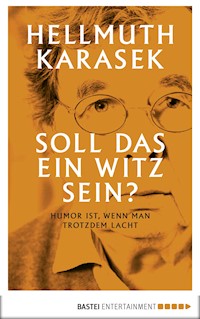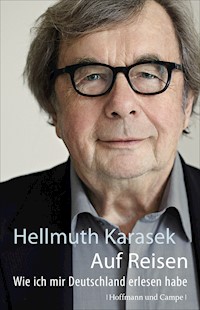
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hellmuth Karasek unterwegs in Deutschland: Aug in Auge mit seinen Lesern ... Hellmuth Karasek erzählt von phantastischen und skurrilen Erlebnissen - und nimmt uns mit auf seine Reisen quer durch die Republik. Als einigermaßen bekannter Autor muss man mit allem rechnen, sagt Hellmuth Karasek: dass einen der Schaffner für den Nobelpreisträger Günter Grass hält, zum Beispiel, und, wenn man den Irrtum aufklärt, mit "Herr Kasarek" anredet; oder dass die Dame an der Hotelrezeption einen unverdrossen "Karadzic" nennt, wie den Kriegsverbrecher. Da ist man nach zwölf Lesungen in einem Monat schon glücklich, wenn man kein Handy verloren, keine Kreditkarte verschusselt, keinen Mantel hat hängen lassen und auf die Frage: "Was ist Ihr größter Fehler" nur noch antwortet: "Mit neuen Schuhen zu verreisen." Trotzdem wird er es wieder tun, sozusagen als unverbesserlicher und leidenschaftlicher Wiederholungstäter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hellmuth Karasek
Auf Reisen
Wie ich mir Deutschland erlesen habe
Hoffmann und Campe
Du mußt aus deiner Gegend alles holen, denn auch von Reisen kommst du leer zurück.
Melancholie, Gottfried Benn
Lesereisen
Was unterscheidet Buchlesungen aus dem eigenen Buch vom Schreiben dieses Buchs? Als Antwort drängt sich mir unabweislich eine nicht ernstgemeinte, aber ernstzunehmende Frage auf, die da heißt: Was ist der Unterschied zwischen Onanie und Beischlaf, zwischen Selbstbefriedigung und Geschlechtsverkehr? Die Antwort: Beim Geschlechtsverkehr lernt man mehr Menschen kennen.
Auch bei Lesungen lernt man mehr Menschen kennen. Leser. Die eigenen Leser. Leser, die man gewinnen und überzeugen will. Die man zu überwältigen und zu überzeugen sucht wie in einem Liebesakt. Dem Leser, den man sich beim Schreiben nur in der Phantasie ausmalt, steht man dann Aug in Auge gegenüber. Allerdings ist er nicht nur als Leser hier, sondern auch als Zuhörer. Und wenn man Glück hat, sind es nicht nur wenige, Einzelne, sondern viele, beglückend viele. Man sieht sie sitzen, voller Erwartung. Jetzt muss man sie nur noch gewinnen, sodass man sie nachher wie ein eitler Liebhaber fragen kann: War ich gut? Bin ich gut? Hab ich dir Spaß gemacht? Habe ich dich unterhalten und gewonnen?
Das ist eine typische und eitel-blöde Macho-Frage: Wie war ich? Es gibt den Witz, in dem der Schizophrene danach fragt. Er fragt nicht: »Wie war ich?« Er fragt: »Wer war ich?« Der Autor, der als Erzählender, als Erzähler, »Ich« heißt, sich »Ich« nennt, kann sich hinter einem »Er« verstecken. Kann meinen, ehrlich glauben, dass er ein »Er« ist und kein »Ich«. Und so gaukelt er dem Publikum, das ihm zuhört – hoffentlich gebannt und gut unterhalten, gerührt, bewegt, zum Lachen gebracht –, vor, dass er bei seinen Kapriolen nichts mehr will als den vor ihm Sitzenden gewinnen. Als »Ich« und als »Er«. Entweder oder? Oder als beide. Hier liest sozusagen ein Schizophrener. Er liest, als wäre er mit dem Publikum allein. Mit jedem Einzelnen. Deshalb bestehe ich darauf, so gut ich kann und mich durchsetze, dass ich, selbst wenn ich auf einer Bühne sitze, nicht wie auf einer Bühne sitze, sondern mit jedem Zuhörer Aug in Auge, in ständig möglichem Blickkontakt. Ich will auch beim intimsten Miteinander alles sehenden Auges erleben. Gleichheit der Waffen. Keine Scheinwerfer, die mich blenden und mir die Zuhörer wegnehmen, sie ausblenden. Ich will auch nicht in eine schummrige Dunkelheit hineinlesen. Ich suche Wohlwollen, Bereitschaft, Entgegenkommen. Meist bleibe ich an einer Frau hängen, an ihrem wohlwollenden, erwartungsvollen Lächeln. Werde ich das aufrechterhalten können, werde ich mir das verdienen? Drohe ich in dem Blick zu ertrinken, suche ich erschrocken das Weite, zumindest die Distanz, und finde doch immer wieder zurück.
Manchmal habe ich mit meiner Blickkontaktsuche Pech. Da war doch so ein freundlicher Herr neben seiner Frau – wahrscheinlich war es seine Frau – in der dritten Reihe rechts, und er hatte, als ich zu lesen anfing, den Kopf zur Seite geneigt, sodass er mir wie ein »geneigter Leser« vorkam, der als geneigter Zuhörer hierhergekommen war. Und so las ich eine Zeitlang für ihn, schweifte dann mit dem Blick zur anderen Seite, und als ich mich wieder auf ihn einstellen wollte, da war er eingeschlafen. Er war leicht nach vorn gesunken, der Mund hatte sich geöffnet und gab dem Mann einen irgendwie leidenden Gesichtsausdruck, so als wäre er unter meinem Lesen erschlafft, und ich war erschrocken und hatte Mitleid mit ihm. Und dann sah ich neben ihm seine Frau, die mir mit wach funkelnden Augen zuhörte – war es überhaupt seine Frau? Und so erfasste mich eine schier sadistische Schadenfreude: Du verschläfst jetzt den Augenblick, in dem sich deine Frau völlig von dir abgewandt hat und mir bedingungslos zugewandt ist, und ich las nur noch für sie, jedenfalls eine Weile. Und in meine Bemühung um sie mischte sich die Angst, dass ich viele im Publikum inzwischen eingeschläfert hätte. Und ich dachte, sie hat den Armen mit in die Lesung geschleift, nachdem er müde vom Büro nach Hause gekommen und nur ihr zuliebe mitgegangen war, er säße jetzt viel lieber vor dem Fernseher …
Aber dann, später, beim Signieren im Foyer, kam er mit seiner Frau, schob mir mein Buch rüber, sie stand zustimmend lächelnd neben ihm. »Was soll ich schreiben?«, fragte ich, und er sagte: »Schreiben Sie: ›Für Günter und Anna‹.« Und ich fragte: »Günter mit oder ohne h?« Und er sagte: »Ohne h.« Und während ich schrieb und ihn wenigstens in der Reihenfolge korrigierte: »Für Anna und Günter ohne h«, sagte er: »Es hat uns sehr gut gefallen.« Und sie nickte.
Einmal, das ist auch schon viele Jahre her, saß ein abenteuerlich schönes junges Mädchen in der ersten Reihe und hörte mir gebannt zu. Und war nachher als eine der ersten mit dem Buch am Signiertisch. Und als ich sie fragte, wie sie denn heiße, sagte sie: »Barbara.« »Barbara?«, fragte ich. Und dann, während ich wie besinnungslos murmelte: »Barbara, das ist aber ein schöner Name!«, schrieb ich: »Barbara saß nah am Abhang!« Und sagte, etwas blöde: »Lauter A’s! Wie in Barbara.« Und ich traute mich nicht, sie noch einmal anzuschauen, so idiotisch kam ich mir vor. Und dann war sie weg.
Wochen später bekam ich über den Verlag einen Brief von ihr, und sie schrieb mit schöner Schulmädchenschrift: »Lieber Herr Karasek …«, und dass sie und ihr Verlobter – ja, sie schrieb »Verlobter« – lange gegrübelt hätten, was es wohl mit meiner Widmung »Barbara saß nah am Abhang« auf sich hätte. Was ich wohl damit gemeint hätte. Und ich antwortete ihr wahrheitsgemäß und doch gleichzeitig verlogen: Ich hätte das aus dem Kleinen Hey zitiert, der Kleine Hey sei das Buch, mit dem Schauspieler das A aussprechen lernten, offen und klar: »Barbara saß nah am Abhang.« Es klinge fast italienisch, so vokalklar. Und dann habe ich nie wieder von dieser Barbara gehört, sie auch nie wiedergesehen, ihr Bild aus meinem Gedächtnis verloren, mich nur noch erinnert, dass sie schön war und jung und für mich ganz Ohr und Blick. Und dass ich deshalb den »Abhang« assoziiert hatte. Einen Abhang zwischen der Lesebühne und der ersten Reihe, in der sie saß. Und dass ich mir ein Rutschen den Abhang hinunter vorgestellt hatte, da war kein Halten mehr, nur die Schwerkraft, die uns aufeinander zurutschen ließ, mit der Naturkraft einer Lawine.
Jetzt aber übertreibe ich, dachte ich, als ich das bei der Beantwortung ihres Briefes im Sinn hatte, aber nicht schrieb. Und als ich so dasaß, kam mir aus meiner Kindheit ein Schlager in den Sinn, den Willy Berking komponiert hatte und der so ging:
Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika,
Wo die kleinen Negerlein noch tanzen Ringelreihn.
Barbara, Barbara, kennst du noch nicht Afrika?
Dann wird es die höchste Zeit,
Komm mit, es ist nicht weit.
Dort, wo der Urwald ist, der schon so uralt ist,
Und wo die Affen gaffen, wenn sich zwei verstehn,
Dort schleicht die Boa sich zu ihrem Boarich,
Was es dort gibt, wie man dort liebt, das musst du sehn.
Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika,
Wo der Swing geboren ist und wo man schwarz nur küsst.
Als ich also das alles im Brief nicht schrieb, war ich kein Affe mehr, sondern ein, wie sagt man, gesetzter Mann, und statt in Afrika habe ich Barbara, wenn ich nicht irre, im Wandsbeker Quarree gesehen, in der Buchhandlung Weiland. Und es sollte noch Jahre dauern, bis ich nach Afrika reiste, auf einer Kreuzfahrt, und Afrika wirklich so war, wie ich es mir am Abhang vorgestellt hatte, nur dass ich mit meiner Schwester und meiner Frau im sicheren Jeep saß und unsere englische Touristenführerin, die groß, blond, hoch gewachsen war, eine Flinte in der Hand hielt und, während sie uns beschützte, erzählte, dass sie Englischlehrerin in Kapstadt sei.
Herr, Hund, Mensch und Handy
Jeder Mensch funktioniert in seinen Tätigkeiten wie eine Maschine – moderner würden wir sagen: wie ein Computer. Das Fließband war der erste Ausdruck dieses Maschinenzeitalters, der Modern Times. Chaplin hat es in seinem Film, der Fließbandtragikomödie, auf atemberaubende, gleichzeitig »chaplineske« und »kafkaeske« Weise vorgeführt.
Läuft das Fließband, lässt es sich bis zur Grenze der maschinellen und menschlichen Kräfte ausbeuten; gerät ein Teilchen aus der Ordnung, entsteht eine Kettenreaktion aus Fehlern: In der Ordnung lauert das Chaos, das die Unordnung genauso beschleunigt wie im Normalfall die Produktivität. Auch im Chaos potenziert sich die Kraft. Chaplin zeigt, wie die Ordnung »außer Rand und Band« gerät. Ein Bestandteil der modernen Komik ist, dass sie zeigt, wie die Ordnung in Unordnung umschlägt. Fehler, Fehlleistungen, Unachtsamkeiten sind dann nicht wiedergutzumachen. Die Unordnung bringt die Ordnung aus ihrem Lauf, sobald ein Steinchen ins Getriebe gerät, ein Fehler sich unerbittlich im Ablauf potenziert. Chaplin führt das am Fließband wie an der Ess- und Fütterungsmaschine vor.
Natürlich erfährt das auch derjenige, der nach Fahrplan reisen muss. Und dabei gibt es zwei Fehlerquellen: den Fahrplan und den Reisenden, den Menschen und die Maschine, das Subjekt und die Tücke des Objekts (die übrigens auch im Subjekt lauern kann). Dem geraden Weg stellt sich etwas in die Quere. Manchmal. Öfter. Meistens.
Früher habe ich in kleinen Flugzeugen Gelegenheit gehabt, dem Piloten und dem Copiloten beim Start durch die geöffnete Kabinentür über die Schulter zu schauen. Wie sie alle Vorgänge nach einer Anleitungsliste abchecken, laut und vernehmlich. Und wie sie dabei Schalter umlegen, sodass aus roten Lämpchen grüne werden und aus nach unten geschalteten Hebeln nach oben gerichtete. Es ist wie ein Blick in ein Gehirn, beim Packen, bevor die Reise losgeht. Wie eine Zwiesprache im Monolog.
Habe ich genug Socken, Unterhemden, Hemden und Unterhosen eingepackt? Bin ich zwei oder drei Tage unterwegs? Habe ich (das gilt für ältere Reisende wie für chronisch Kranke) genug Pillen, Tabletten und Salben für drei Tage? Habe ich das Ladegerät für mein Handy? Genug Klingen für meinen Rasierer? Patronen für meinen Füller oder Schreibstift? Habe ich meinen Ausweis, Führerschein? Brauche ich meinen Ausweis, meinen Führerschein? Fliege ich und habe die Schere aus Versehen ins Handgepäck gesteckt? Werde ich beim Einchecken ins Flugzeug also wieder eine Nagelschere und ein Toilettenwasser einbüßen? Habe ich die Kreditkarte, die Bahncard? Die Miles-&-More-Karte? Habe ich mein Notizbuch, meinen Taschenkalender mit Terminen und Adressen?
Da ich nach vielen Reisen so gut wie alle möglichen Fehler gemacht habe, bin ich inzwischen gewappnet. Der Mensch lernt aus seinen Fehlern, das stimmt! Aber warum so langsam? Und warum nicht immer? Durch Schaden wird man klug. Viele Hindernisse kann man antizipieren. Stauzeiten bei Zugfahrten. Wichtige Papiere und Utensilien wie Wohnungsschlüssel oder Geldbörsen nicht mehr im Mantel lassen, weil sie bei Übergangszeiten vom Herbst in den Winter zum Beispiel scheinbar verlorengehen. Übergangszeiten sind Sand im Getriebe.
Einmal habe ich im Proust-Fragebogen, als ihn die FAZ in ihrem noch vorhandenen Magazin abdruckte und am Freitag beilegte, auf die Frage »Was ist Ihr größter Fehler?« geantwortet: »Mit neuen Schuhen verreisen.« Das war das Resultat einer besonders schmerzlichen Erfahrung. Am ersten Tag scheuerten sich die Füße, vor allem die Fersen, blutig wund. Am nächsten Morgen kam ich nicht mehr, trotz Pflastern, in die Schuhe hinein. Die Abreise verzögerte sich, weil ich humpelnd in einer fremden Stadt nach Turnschuhen Ausschau halten musste. Gott sei Dank war wenigstens nicht Sonntag. Wie einst beim Literarischen Quartett.
Es war im August. Ich hatte mit meiner Familie am Wörthersee in Maria Wörth Urlaub gemacht. Am Samstag fuhr meine Frau mit unseren beiden Kindern zurück nach Hamburg. Sie nahm das meiste Gepäck mit, ich sollte noch nur für einen Tag nach Salzburg fahren, verstaute also ein sauberes Hemd, saubere Unterwäsche sowie Anzug und Krawatte in meinem Handkoffer. Am folgenden Abend war in Salzburg beim ORF die Live-Sendung. Am Montagmorgen würde ich nach Hamburg zurückfliegen. Ich hatte alles bei mir. Alles. Die Romane, die auf unserem Programm standen. Den Rasierapparat, der mir ein menschliches Antlitz garantieren würde, das eines zivilisierten Literaturkritikers. Tempo-Taschentücher. Deodorant. Denn es war heiß. Sehr heiß. Unterwäsche reichlich. Alles. Fast alles.
Als meine Frau abgefahren war, hatte ich noch Tennis gespielt. Auf einem wunderschönen Grandplatz. Auch da war es heiß. Ich war brav in die Stoppstellungen gerutscht, roter Grand war aufgewirbelt. Ich hatte geschwitzt, geduscht, mit bloßen Füßen zu Abend gegessen. Dann war ich zu Bett gegangen, nicht ohne die verschmutzte Wäsche und die Tennisschuhe in meine Tennistasche gepackt zu haben.
Am Sonntagmorgen wollte ich dann gut gelaunt, weil aufgeregt, nach Salzburg fahren. Ich stand auf, duschte, rasierte mich – und wollte mich anziehen. Alles, alles fand sich – nur: Ich hatte keine Socken. Mir brach der Angstschweiß aus, der Blutdruck schnellte spürbar hoch. Das Herz schlug bis zum Hals. In der Tennistasche waren nur drei Paar Tennissocken. Weiß und kurz, mit blauroten Rändern. Vor der Tür wartete schon das Taxi zum Bahnhof. Bis Salzburg kommst du noch auf Tennissocken, dachte ich. Niemand wird dir auf die Beine, gar auf die Füße gucken. Aber dann! Im Quartett!
Stein des Anstoßes der damals noch relativ jungen Sendung waren nicht etwa hitzige Auseinandersetzungen um Sexszenen bei Elfriede Jelinek, nicht aufeinanderprallende Meinungen bei Günter Grass, Martin Walser oder Peter Handke gewesen – sondern die Socken der Herren. Wir saßen ja damals gesittet in gepolsterten Ledersesseln, zwei Herren, eine Dame, die zu der Zeit noch ausschließlich Sigrid Löffler hieß, und ein Gast beziehungsweise eine Gästin. Die Beine hatten wir übereinandergeschlagen, in Ruhestellung, bei der Kampfhaltung stemmten wir sie in den Boden und beugten uns, mit den Armen heftig rudernd oder die Zeigefinger anklagend erhebend, vor. Bei uns Männern rutschten in der Rücklage die Hosenbeine hoch. Und es galt damals als Höhepunkt der Ungehörigkeit, ja der Obszönität, wenn dabei ein Stück blankes Bein, wenn der Unterschenkel über dem Knöchel bleich und eventuell behaart sichtbar wurde. Dass Reich-Ranicki etwa verbal einen Beischlaf als prinzipiell nichts anderes beschrieb als das Einschieben eines Bleistifts in ein Futteral, erregte nicht den Zorn der Zuschauer, der sich in Zuschauerbriefen niederschlug, auch dass Sigrid Löffler und ich kühl und leidenschaftslos wie Anatomie-Ärzte in der Pathologie die vulgärsten Bezeichnungen für primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale in den Mund nahmen, erzeugte nur die übliche Erregungssteigerung im Pegel der Reaktionen. Aber dass einmal Marcel Reich-Ranicki einen guten Teil seines blanken Unterschenkels in die Kamera hielt, ein andermal, ich weiß es noch wie heute, Jochen Hieber mehrere Male von der Kamera mit nackter Wade erwischt und dem Publikum ausgeliefert worden war, sorgte für die größte Erregung der Zuschauer, die mehr Dezenz von uns Männern einforderten. Ich konnte das gut nachempfinden. Ebenso sehr, wie wohlgeformte, elegant übereinandergeschlagene weibliche Beine im Zeitalter der Miniröcke tiefe Einblicke gewährten, erwecken nackte Männerbeine, noch dazu mit Brombeerhaaren, einen ästhetischen Widerwillen.
Ich weiß übrigens, dass Rudolf Bayr, ORF-Chef in Salzburg von 1975 bis 1984 (der übrigens antike Dramen übersetzt hatte, die, vielgespielt, damals die Bühne mit edel sprechenden und edel fühlenden Sandalenträgern füllte, die Namen wie Orest, Oedipus oder Jason trugen, aber dafür keine Beinkleider), mir damals gestand, dass er während der Festspielzeit mit Vorliebe auf deutsche Touristen in der Getreidegasse, vor Mozarts Geburtshaus, zustürzte, sie anherrschte und zu einer anständigeren Kleiderordnung aufforderte, wenn sie mit bloßen Männerbeinen in Sandalen und kurzen Hosen durch das brütend heiße Salzburg stampften und stolperten, meist das Übergewicht der österreichischen Küche (Salzburger Nockerln, Schweinebraten, Knödel, Gulasch und Kraut) so mit ihren strammen Oberschenkeln zur Schau stellend. Dabei war allerdings der Höhepunkt der Geschmacklosigkeit nicht nur für den Herrn Intendanten, der zwischen Griechen auf der Bühne und Piefkes auf Salzburgs Straßen wohl zu unterscheiden wusste, dass die Touristen in ihren Sandalen auch noch Socken anhatten. »So sind Sie hier nicht willkommen!«, herrschte Bayr sie an. Das Wort »unerwünscht« vermied er aus historisch verständlichen Gründen. Schließlich war er ja Redakteur beim Völkischen Beobachter gewesen, bei dem »Juden unerwünscht« zum selbstverständlichen Vokabular gehörte. Man kann aus vielen Gründen unerwünscht sein. Nicht immer ist es die falsche Lederhose, die falsche Figur.
Ich war, damals in Salzburg, in der schrecklichen Gefahr, mit weißen Socken über die neuesten Romane der Saison ein Geschmacksurteil abgeben zu müssen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Kritik (war es in Pardon, war es in der Titanic?), in der zu lesen stand, Kritikern, die wie ich unpassende Krawatten zu falschen Hemden trügen, wären ihre ästhetischen Urteile nur schwer abzunehmen. Kann man jemandem, der eine scheußliche grelle Krawatte zu einem schrillen Hemd trägt, glauben, dass er in der Lage ist, einen neuen Roman mit den richtigen ästhetischen Maßstäben zu messen und sie glaubhaft zu begründen?
So viel stand fest: In weißen Tennissocken, noch dazu von einem rostroten Schmutzrand als getragen ausgewiesen, würde ich in einer Quartett-Sendung nicht auftreten können. Eher barfuß in der Hölle. Ich wohnte damals im Hotel Bristol, an einem Platz mit einem Mozart-Haus. Makartplatz heißt er, nach einem ziemlich schwülstigen, den Geschmack des Wiener Fin de Siècle als »Malerfürst« prägenden Künstler benannt, der inzwischen viele Aufwertungen und Abwertungen erfahren hat, in einer Zeit, die »Kitsch« und »Camp« und »Schwulst« auf das Schild des hohen Geschmacks hievt. Ich fürchte, weiße Tennissocken waren nicht dabei – obwohl Woody Allen inzwischen in Tennisschuhen den »Oscar« entgegengenommen hat und Joschka Fischer im Jahr 1985 sich ebenfalls in Tennisschuhen zum hessischen Minister hat vereidigen lassen.
All das hatte ich weder vor Augen noch im Hinterkopf, als ich mich am Sonntag zu einem peinlichen Bittgang durch die ersten Hotels der Stadt aufmachte. Überall fragte ich den Pförtner hinter vorgehaltener Hand: »Entschuldigung, hat einer Ihrer Gäste bei der Abreise dunkle weinrote oder eventuell schwarze Seidensocken vergessen, die Sie inzwischen vielleicht gewaschen haben und ihm nachsenden wollen?« Im dritten Hotel, im Goldenen Hirschen (er verfügt über eine exzellente Küche, Flusskrebse, Eierschwammerln, Tafelspitz), wurde ich fündig. Ja, man habe ein Paar Herrensocken. Frisch gewaschen. Man wolle sie dem Gast, auf Anforderung, nachsenden.
Ob ich sie mir kaufen könne?
Nein, das gehe leider nicht. Man wisse nicht, sagte der Portier mit einer gewissen gnädigen Herablassung, wie man einen solchen Fall handhaben solle. Es gebe kein Beispiel. Aber, fuhr er fort, ehe ich antworten konnte, man würde mir die Socken gern leihweise zur Verfügung stellen.
Ich versicherte, dass ich das großartig und großzügig fände. Ich würde (innerlich schwor ich darauf tausend Eide) die Socken mit nach Hamburg fliegen, vielleicht sogar in den Socken bleiben. Sie dann waschen und alsbald dem Hotel zurücksenden. Diesen Vorschlag akzeptierte der Portier. Ich hatte nichts zu zahlen. Natürlich gab ich ihm, damals wie heute von der Aura der Salzburger Festspiele eingeschüchtert, ja gedemütigt, ein Trinkgeld, das für drei Paar nagelneue Socken gereicht hätte. Trotzdem plagte mich eine Zeitlang das schlechte Gewissen, weil ich die Socken nie gewaschen zurückgeschickt habe. Wenn man bedenkt, wie viele Sockenpaare in Waschmaschinen getrennt werden, wie aus Zwillingen wertlose Einzel-Loser werden, ein geringes Vergehen.
Wenn ich mich recht erinnere, hat Louis B. Mayer (oder war es sein Vater?) als armer mittelloser Einwanderer sein erstes Vermögen in den USA damit gemacht, dass er Sockenpaare en masse beim Einschiffen in Europa in Einzelsocken trennte, um sie getrennt zu zwei verschiedenen Häfen in der Neuen Welt zu verschicken. Sagen wir, die Häfen waren Boston und Baltimore oder New York. Dort kaufte er die vereinzelten Strümpfe als Ramschware auf, fügte sie in seinem Lager wieder zusammen – was die Strumpfindustrie zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen – und verkaufte sie zum vollen Preis. Auch ein Geschäft, das an der Wiege Hollywoods stand.
Das stumme Abgleichen der Checkliste zwischen Ich und Über-Ich vor Antritt der Reise hat drei neuralgische Punkte: Wo ist der Hausschlüssel? Wo ist das Handy? Und vor allem: Wo ist die Brille, mit der man im Notfall sowohl das Handy wie den Hausschlüssel suchen könnte. Das Suchen selbst ist ein kritisches Moment. Wird es so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass die Abreise sich von einer geplanten in eine gestresste verwandelt, wo man den Zug respektive das Flugzeug in buchstäblich letzter Minute erreicht oder, noch schlimmer, verpasst? Erreicht man ihn, braucht man eine lange Fahrtstrecke, um das aufgeregte Nervensystem wieder herunterzufahren. Das Über-Ich ist die Mutter, die einen fragt, ob man auf die Klassenreise auch alles mitgenommen hat.
Da ich noch in einer analogen Welt aufgewachsen bin, habe ich in der ersten Schulklasse drei Grundregeln der praktischen Vernunft aufgenommen, die im Prinzip auch im digitalen Zeitalter und in der Postmoderne ihre Gültigkeit behalten haben. Die erste gilt für die gesamte Lebensplanung und lautet: »Spare, lerne, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du was!« Ihr schöner Aufbau, der die Reihenfolge der nötigen Anstrengungen in einen klaren Bezug zu den dadurch zu erreichenden Vorteilen setzt, fasziniert mich bis heute: Man hat was, wenn man was spart. Man kann was, wenn man was lernt, und man ist was, wenn man was leistet. Im Prinzip stimmt diese Regel nach wie vor, obwohl das mit dem Sparen im 20. Jahrhundert so eine Sache war. Mehrere Staatsbankrotte, Währungsreformen, Inflationen, verlorene Kriege, Weltwirtschaftskrisen und politische Systemwechsel haben die Sicherheit, die im Sparen lag, längst zerstört, ebenso die mit »Sparen« einhergehende Ausführungsbestimmung, nämlich die: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« Verfolgen wir die Gültigkeit der Maxime daher nicht weiter, fürs Reisen bringt sie ohnehin nichts.
Eher schon die zweite: »Tu jedes Ding an seinen Ort – wenn du es suchst, dann findst du’s dort.« Ich befolge diese Regel in der Regel, habe also die Schlüssel am Schlüsselbrett, die Kreditkarten in der entsprechenden Schublade und das Handy, das im Unterschied zum guten alten Telefon springlebendig geworden ist und sich gerne versteckt oder verläuft oder verlorengeht, das Handy ist meist bei seiner häuslich fest installierten Ladestation. Meist. Denn wie bei jeder Maxime gilt auch die sophistische mathematische Spitzfindigkeit aus der Grundschule: »Ausnahmen bestätigen die Regel.« Und hier beginnt mein Problem.
Reisen sind Ausnahmesituationen, bei mir aber so etwas wie der Regelfall. Also droht auch immer der unvorhergesehene Alarm. Warum ist der Schlüssel jetzt, wo das Taxi schon vor der Tür wartet, nicht am Schlüsselbord? Die Ausnahme Nummer eins lautet: Weil ich vor der Reise mit dem Schlüssel schon aufgeregt hin und her gerannt bin, weil ich schon mal draußen war, was vergessen hatte. Oder weil ich gar nicht von zu Hause abreise, sondern nach Hause zurück und im Hotel das Schlüsselbrett durch die Schreibtischplatte oder den Nachttischschrank ersetzt habe. Der Schlüssel ist nicht das Schlimmste. Notfalls gibt es Schlüsseldienste, die zwar teuer sind, aber dann unersetzbar, wenn die Nachbarn, bei denen man nach schmerzlichen Erfahrungen einen Zweitschlüssel deponiert hat, gerade auch verreist sind.
Schlimmer ist das Handy, von dem ich, als ich die Regel erlernte, dass man jedes Ding nur dann fände, wenn man es an seinem bestimmten Ort deponierte, noch nicht mal zu träumen vermochte. Jahrzehntelang habe ich Reisen ohne Handy unternommen, und es fehlte mir nicht, weil ich von ihm so wenig wusste wie vom Leben auf dem Mars. Weil es das Handy nicht gab, brauchte ich es nicht. Inzwischen hat es mich versklavt, vor allem als Reisenden. Ich bin ihm hörig, bin ohne das Mobiltelefon kommunikationsunfähig, aufgeschmissen, wie amputiert, bewegungsunfähig. Ich weiß nichts mehr von den Wohnorten, Arbeitsplätzen meiner Freunde, Verwandten, meiner Kollegen, ich kann meine Vertragspartner, meine Geschäftsfreunde, meine Arbeitsziele nicht mehr ausmachen. Und wenn ich es doch könnte, weil ich durch Notizen und Papier vorgesorgt habe, kann ich trotzdem auf keinen Zwischenfall, der mich auf der Reise aus der geregelten Bahn wirft, anders reagieren als mit hilfloser Ohnmacht.
Tu jedes Ding an seinen Ort. Das Problem des iPhones, des Smartphones mit Touchscreen, das die stinknormalen Handys längst abgelöst hat, ist, dass es ebenso unbehaust ist wie sein Besitzer, es folgt ihm in das bewegte Leben. Zwar könnte man, wäre man beispielsweise ein Verdächtiger oder gar ein Terrorist, jederzeit geortet werden, weshalb bin Laden in den letzten Jahren in seinen Kommunikationsmöglichkeiten in die Steinzeit zurückfiel und sich reitender Boten bedienen musste, die allerdings auch mit den Pferdestärken von Geländewagen unterwegs waren. Inzwischen wirbt ein Smartphone für Normalverbraucher mit dem Slogan »Wo ist mein Bruder?« und erklärt, dass wir jederzeit den Freund, die Freundin, den Bruder, die Schwester aufspüren könnten, sie »ausfindig« zu machen in der Lage wären – das Einverständnis der Vermissten, zumindest Gesuchten voraussetzend und, zweite Voraussetzung, dass er sein Smartphone nicht verloren oder ausgeschaltet hat.
Bei meinem Normalfall, bei dem ich das Handy zu Hause an seiner festen Stelle antreffen könnte, wenn ich es nicht unachtsam irgendwo auf meinen unruhigen Wanderwegen durch die Wohnung bei den Reisevorbereitungen abgelegt hätte, kann ich es dann herbeirufen wie einen entlaufenen Hund. Ich rufe es vom Festnetz an und lausche, woher das Klingelzeichen kommt, benehme mich wie ein Späher im Wald und lasse es möglichst nur kurz klingeln, weil es ja sonst auf Anrufbeantworter schaltet, der mir mit seiner blöden ortlosen Auskunft nicht weiterhilft, sondern nur Zeit stiehlt. Lieber rufe ich es im Notfall öfter an, weil mich sein Klang oft auf die falsche Fährte lockt. Bis ich es unter dem verrutschten Kissen oder unter einer aufgeschlagenen Zeitung, in einem Wust Wäsche oder gar im Koffer entdecke, im Bad, im Bücherregal, im Kühlschrank (erst ein Mal!), bin ich angespannt auf der Pirsch. Nie und nimmer schalte ich es zu Hause aus, und ich versuche tunlichst zu vermeiden, dass es mit leerer Batterie verendet. Hier hat die Erstklässler-Einsicht »Durch Schaden wird man klug« gegriffen, nachdem ich seit Beginn des Handy-Zeitalters zwei Telefone auf Nimmerwiedersehen verloren habe, vielleicht liegt eines davon irgendwo hinter Bücherrücken oder hinter einer Waschmaschine, längst gestorben und technisch veraltet, in einem unbekannten Grab und hat seine Seele ausgehaucht, weil sein Plättchen gelöscht werden musste.
Harald Martenstein, der ähnliche Probleme mit elektronischen Geräten hat, schrieb darüber im Tagesspiegel: »Im Büro sagten sie: Hellmuth Karasek, als er noch bei uns arbeitete, hat jede Woche sein Handy verloren. Das machte ihm gar nichts aus, im Gegenteil: Er hat sofort ein Buch darüber geschrieben.«
Einmal, als ich in der Anfangszeit noch viele Leichtsinnsverluste erlebte, hatte ich ein Erfolgserlebnis. Ich betrat die Wohnung und bemerkte ziemlich schnell, dass mir mein Handy im Taxi, wie ich rekonstruieren konnte, aus der Tasche gerutscht sein musste. Drei Anrufe waren nötig. Über die Taxizentrale und meine Quittung eruierte ich die Telefonnummer des Taxifahrers, rief ihn im Wagen an und annoncierte ihm, dass mein abhandengekommenes Handy entweder auf dem Rücksitz liegen müsste oder auf dem Boden davor. Dann rief ich es an, sprach über mein Handy mit dem Fahrer, und schwupp!, kam er angefahren und brachte es mir wie einen entlaufenen Hund.