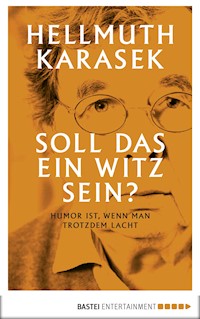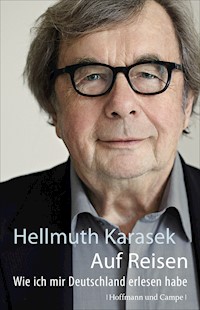9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karasek macht den Versuch, dem Alter die Altersmilde zu nehmen, und zeigt in autobiografischen und generationsbiografischen Geschichten, dass das Leben komisch ist, gerade dann, wenn das Lachen bestenfalls sardonisch sein kann. Er erzählt von der Liebe und der Erinnerung daran, von der Wohltat und dem Schrecken des Vergessens und von der Zukunft. Komisch, poetisch, bewegend. Wer alt wird, hat Glück - schon allein weil er erlebt und erkennt, welches Unglück das Alter ist: Ein Fluch, den man zum Segen erklären muss; nichts anderes bleibt einem übrig. Wie will man auch unabwendbarem Verfall und unaufhaltsamer Zerstörung anders begegnen als mit Trotz? Oder ist der glücklicher, dem das Alter erspart bleibt? Und was ist mit den Jungen, denen eine stetig wachsende Zahl von Alten im Weg steht? Hellmuth Karasek, der "publizistische Turbokarpfen im Teich der grauen Hechte" (Gerhard Stadelmaier), sieht das Leben als Fallbeispiel - jedenfalls solange man noch aufstehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hellmuth Karasek
Süßer Vogel Jugend
oder Der Abend wirft längere Schatten
Hoffmann und Campe Verlag
Alter ist immer noch das einzige Mittel, das man entdeckt hat, um lange leben zu können.
José Ortega y Gasset
Das Zirpen der Grillen
Wer Grillen jagt,
wird Grillen fangen.
Deutsches Sprichwort
Früher hieß es von den Alten, dass sie »Grillen« haben, »Grillen fangen«, was so viel bedeuten sollte wie Marotten haben, wunderlich werden und versponnen, zu fixen Ideen neigen.
Ich bin den Grillen bei einer gründlichen Untersuchung, einem sogenannten »Check-up«, begegnet, bei dem sich Apparate über uns hermachen, die immer genauer, immer bunter, mit immer phantasiereicheren Bildern und Symbolen unser Innerstes nach außen bringen, in teils naturgetreuen, sozusagen in der Körperlandschaft abfotografierten Bildern, teils in Bildern, übersetzt aus Daten vom pulsierenden Pumpen in der Aorta, von der Ausdehnung der Leber, der Füllung der Blase. Ultraschall heißt das. Und die Bilder, die produziert werden, haben die gleiche Entwicklung durchlaufen wie der Film und das Fernsehen: Sie werden immer bunter, können Töne absondern und werden von Computern gesteuert. So habe ich meine Kinder bereits im Mutterleib sehen können, damals noch als primitive schwarz-weiß schraffierte Strichzeichnung, wenn auch bewegt. Und der Arzt fragte: »Wollen Sie wissen, was es wird?« Und wir, die künftige Mutter und ich, haben »Nein« gesagt. Und er hat zu seinem Glück gesagt, er wisse es auch nicht. Zu seinem Glück! Denn wenn er etwas gesehen hätte, hätte er bloß etwas sehen können, was nur ein Junge hat. Logisch! Der Mehrwert! Das Plus! Selbst Tomographen sind Chauvis! Es wurde ein Mädchen.
Inzwischen zeichnen die Geräte die Babys in Utero als hinreißende Technicolor-Bilder auf. Der Fortschritt lässt sich auch hier nicht aufhalten. Und das Alter bleibt auch hier hoffnungslos zurück.
Eines Tages werde ich traurig sagen: »Ich gehöre noch zu der Generation, die ihre Babys nur unscharf schwarz-weiß im Bauch der Mutter gesehen haben!« Und meine Tochter wird sagen: »Ich habe mein Baby farbig gesehen. Farbig, scharf gestochen. Wie im richtigen Leben!«
Alles ist viel genauer. Und so hat die Assistentin mir alles auf dem Bildschirm des Ultraschallgeräts gezeigt, wirklich alles, nachdem sie lange gebraucht hatte, das neue Gerät zu verstehen. Sie musste erst mit ihrer Kollegin telefonieren. Und hat dann immer »Aha« gesagt. »Aha!« und eine Taste bedient. »Aha! Ja so!« – »Ich muss mich entschuldigen«, sagte sie zu mir, »ich war länger im Urlaub, und in der Zeit haben wir einen neuen Sonographen bekommen. Elektronisch!« – Ich sah also blaue und rote Blutströme ums Herz und aus dem Herzen pulsieren, manchmal schaltete die Assistentin auf Momentaufnahme, und das Bild blieb stehen, und mir stockte der Atem unwillkürlich, als wäre mein Herz über den Stillstand so erschrocken, dass es stillestehen wollte. Doch dann, Gott sei Dank, setzte sie das Herz wieder in Gang, ich atmete durch. Sie konnte es auch klopfen lassen. Und dann schlug es laut, regelmäßig, aber schleppend, fast ein wenig schmatzend. Und ich war meinem eigenen Herzen noch nie so fremd gewesen – außer bei einer Gemeinheit, wo ich es auch laut schlagen hörte, wenn auch nicht so laut.
Einmal habe ich auch schon in mein Herz gesehen. Nicht nur sonogrammatisch übersetzt, sondern wirklich. Tief ins Herz. Durch eine Kanüle, die Bilder senden konnte. Aus dem Herzen und seiner Finsternis. »Das Herz ist ein Muskel, Maske«, heißt es bei Carl Sternheim in der »Hose«. Aber was für einer!
Dass ich in mein Herz blicken durfte, hing damals schon, es ist zehn Jahre her, mit dem Alter zusammen! Ich war früh ins Büro gekommen, noch vor den Sekretärinnen, und hatte mir so ungeschickt die Post und einen Stapel neuer, unausgepackter Bücher unter den Arm geklemmt, dass mich bald darauf ein ziehender Schmerz im linken Arm und in der Brust plagte. Das heißt, er plagte mich nicht, weil er leise war, er beunruhigte mich, weil ich mit meinem in den Illustrierten angelesenen medizinischen Halbwissen (Halbwissen ist noch geprahlt, Deziwissen wäre besser, auch eher ein Fluch als ein Vorteil der Informationsgesellschaft) dachte, Achtung!, das habe ich doch neulich im »Stern«, oder war es in der »Bunten«, egal, gelesen: So kündigt sich ein Herzinfarkt an. Allerdings nur, wenn er mit einem tiefen unerklärlichen Angstgefühl verbunden ist.
Ich hatte kein unerklärliches dumpfes Angstgefühl, bekam es aber sofort, als ich mich angesichts des langsam wachsenden Schmerzes an die Lektüre des »Stern« oder der »Bunten« erinnerte. Unsinn, dachte ich und wollte den Gedanken an den Schmerz beiseiteschieben, als die Sekretärin hereinkam, mich begrüßte und mir irgendetwas von einem Anruf sagte und dass ich dringend zurückrufen solle. War es, weil diese Mitteilung mich an die Nervensäge erinnerte, die sich hinter dem Namen zu dem Rückruf verbarg, war es, weil ich beim Herumdrehen zu der Sekretärin wieder auf meinen Schmerz aufmerksam wurde, jedenfalls machte ich offenbar eine übertriebene Leidensmiene, vielleicht auch um mich vor weiteren unangenehmen Terminankündigungen meiner Sekretärin zu schützen!
Sie sah mich an und fragte erschrocken: »Fehlt Ihnen was? Haben Sie Schmerzen?«
»Ach, es ist nichts«, sagte ich scheinbar beschwichtigend, aber in Wahrheit hypochondrisch aufwiegelnd. »Ich hab nur so einen momentanen Schmerz in der Brust« – ich zeigte auf meine Herzgegend – »der zieht sich in den linken Arm hier!« Ich folgte mit dem rechten Zeigefinger dem unsichtbaren Aderverlauf im linken Arm herab bis zum Handteller.
»Damit soll man nicht scherzen«, sagte die Sekretärin. »Vor allem nicht in Ihrem Alter.«
Offenbar hatte sie auch den Artikel im »Stern« oder in der »Bunten« gelesen. Oder eine entsprechende Gesundheitssendung im Fernsehen gesehen. Oder die Apothekerzeitschrift mitgenommen, als sie sich Aspirin besorgte oder Zahnseide.
Ich zuckte die Achseln. Das heißt, ich wollte die Achseln zucken, was aber nur den Schmerz im Arm verstärkte.
»Damit soll man nicht spaßen!«, wiederholte die Sekretärin.
»Ich weiß«, sagte ich, »vor allem nicht in meinem Alter.«
»Soll ich einen Arzt rufen?«, fragte sie.
»Geben Sie mir noch eine halbe Stunde«, bat ich sie. »Wenn es dann nicht besser wird …«
»Also gut«, sagte sie, »eine halbe Stunde … wenn es dann nicht zu spät ist …«
Sie hat dann aber gleich den Notarzt angerufen. Sie war eine Aushilfssekretärin, und ich war wirklich nicht mehr der Jüngste. Von einem gewissen Alter an, so steht es in der »Apothekerrundschau«, im »Stern« und in der »Bunten«, ist man dauernd in Gefahr.
Dann kam mit Blaulicht ein Notarztwagen. Und zwei Männer maßen meinen Blutdruck, fühlten meinen Puls, schnallten mich auf eine Trage und fuhren mich im Lift hinunter. Die Menschen in dem Bürohaus, die mich sahen, blickten mich mitleidig an, ließen ihre Augen besorgt meiner Trage folgen. Und dann ging es ins Krankenhaus. Dort wartete ich zwei Stunden, da aber mein Schmerz nicht nachließ, wartete ich geduldig. Und alles wurde wieder gemessen und wieder nichts festgestellt. Ich wurde in einen Flur gelegt, und ein Arzt mit einem jugoslawischen Namen auf dem Namensschild sah meinen tschechischen Namen auf dem Bettschild und fragte: »Du krank? Was fehlen?«
Und das trotz meines Alters! Daraufhin hat ihm die Schwester, die neben ihm stand, etwas ins Ohr geflüstert. Und er ist gegangen. Später kam er zurück und sagte fließend, die Schwester kenne mich aus dem »Literarischen Kabarett«. Ob das sein könne. Dann wollte der Chefarzt einen Buchtipp von mir, nachdem er mir gesagt hatte, dass mir nichts fehle. Trotzdem wolle er mich zur Beobachtung dabehalten. Ich musste aus der Klinik flüchten, weil ich in München eine Lesung hatte.
Zurück in Hamburg, hatte ich wieder das schmerzliche Ziehen in der Brust. Und als ich einen befreundeten Oberarzt des gleichen Krankenhauses bei einer Abendveranstaltung traf, sagte auch er: »Damit soll man nicht scherzen! Lass uns auf Nummer sicher gehen.« Und holte mich nächtens wieder ins Krankenhaus.
Und dann wurde ich für eine Computertomographie in eine Trommel geworfen. Und dann stellte sich heraus, dass es nicht das Herz, sondern ein eingeklemmter Nerv war.
Also wurde ich zu einem anderen Arzt geschickt, der sich mein Röntgenbild ansah und »Hmm!« sagte.
Und dann erzählte er mir, dass unser Rückgrat nicht für den aufrechten Gang geschaffen sei. Wir Menschen! Wir Steppentiere! Zuerst Jäger, Sammler und Aasgeier auf allen vieren. Mit dieser falschen Wirbelsäule, das könne nicht funktionieren! Erst recht nicht, seit wir über dreißig Jahre alt würden.
Ich lächelte geschmerzt.
Mein Nerv habe sich in der Wirbelsäule verklemmt, weil ein Wirbel … Und dann empfahl er mir eine gymnastische Therapie.
Mein Schmerz verflog aber schon auf dem Heimweg. Wahrscheinlich hatte sich der Nerv aus Angst vor der gymnastischen Therapie selbst aus der Verklemmung im Rückenmarksgelenk befreit. Und ich konnte, obwohl längst über dreißig, beim aufrechten Gang bleiben. Ohne Gymnastik und ohne Gesundheitsschuhe.
Doch zurück zu meinem Check-up 2006 und den Grillen des Alters. Als nämlich der Arzt das Ergebnis vom Ultraschall in Technicolor in Händen hielt, sagte er mir, eigentlich sei alles in Ordnung: EKG, Belastungs-EKG, Ultraschall. Nur die eine Herzklappe, die gebe am unteren Ende ein wenig nach, aber es sei so wenig, dass es den Bluteintritt in die Herzkammer nur unwesentlich beeinflusse. Eigentlich überhaupt nicht. Und bis vor ein paar Jahren hätte das mit einem Ultraschallgerät noch gar nicht festgestellt werden können. Und so solle ich mich darum – seine Betonung lag auf »darum« – gar nicht kümmern.
Und ich sagte, ich hätte vor Jahren auch nicht schon vorher wissen wollen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
Der Arzt sah mich verwirrt an, als er aus meinem Dossier den Kopf hob.
Nicht bei mir, sagte ich. Bei meiner Frau.
Immer noch blickte der Arzt konsterniert.
Ich sagte: Als sie schwanger war.
Jetzt war er beruhigt und blickte wieder in seine Papiere, in die vorliegenden Resultate des Check-up, natürlich fehlten noch die Werte der Blutproben, der Urinproben, der Kotproben – was der Körper so alles hergibt, um den elektronischen Detektiven Material für die ausgefeiltesten Befunde zu geben –, auch das gab es, als ich jünger war, noch nicht, längst noch nicht.
Mich hatte die ganze Zeit schon eine Unruhe befallen, eine Art Prüfungsangst, kurz bevor die Resultate verlesen werden. Dabei wurde nicht nach meinem Wissen gefragt, sondern nach meinem Zustand, also nach meiner Perspektive für den freien Fall der nächsten Jahre, der vorletzten Jahre, der letzten. Dabei hatte ich doch, während die Prüfung ablief, gar nichts geleistet, sieht man mal ab vom Belastungs-EKG, von den Lungenüberprüfungen beim Atmen, den zusammengekniffenen Augen beim Buchstabenlesen, den gespitzten Ohren (soweit sie unter Kopfhörern als gespitzt bezeichnet werden können), den Reaktionen der Nerven.
Diese Angst, die meinen Puls beschleunigte, meinen Mund trocken werden ließ, war nicht etwa nur die Angst vor einem Urteilsspruch, der für die Zukunft Schmerzen, Leiden, Entbehrungen, Verzichte, Behinderungen bedeuten könnte. Das sicher auch.
Ein solcher Check-up, eine solche Generaluntersuchung ist aber immer auch ein Urteil darüber, wie ich gelebt habe. Im strengsten Sinn des Wortes also ein moralisches, ja sogar ein theologisches Urteil. »Was hast du mit deinem Leben angefangen, Jedermann?«, fragt der Arzt, wenn er die Antworten vorliest. Wie hast du es geführt? Wie mit dem Pfund gewuchert, das du mitbekommen hast? Wie hast du deine gesundheitlichen Talente gepflegt, verpfuscht, verschleudert, wie bist du mit dir umgegangen?
Ich muss mich also nicht nur darum sorgen, ob es mir künftig gut gehen wird. Ich habe auch die Verantwortung für meine Taten und meine Unterlassungen. Ich stehe vor dem Arzt wie vor einem Sozialgericht und werde im Namen meiner Nation mit Fragen bedrängt, die da lauten: Musstest du deine Muskeln so verweichlichen lassen, dass sie deine müden Knochen nicht mehr auf Trab bringen? Musstest du dir die ungesunden Fettwerte anfressen, die schlechten Leberwerte ansaufen? Musstest du so viel rauchen, bis du kurzatmig geworden bist, so leichtsinnig Auto fahren, dass du deinen Ellbogen zerstört hast? Oder deine Hüfte? Und überhaupt.
Eine ärztliche Untersuchung über sich ergehen lassen heißt, um Ibsen zu zitieren, Gerichtstag halten über sich selbst. Den Gesundheitszustand ermittelt ein Arzt wie ein Staatsanwalt und Richter in einer Person. Er baut Indizienketten gegen Patienten auf. »Schuldig«, sagt er, und das klingt fast so bedrohlich wie einst das »Mens sana in corpore sano«. Heute sind Raucher potenzielle Verbrecher. Nicht nur für die Passivraucher, sondern weil sie die Kassensysteme belasten, die Pflegeversicherung verteuern. Die Völlerei ist wieder ein Laster wie im Mittelalter. Schon allein die Altersstatistik macht uns zu potenziellen Altlasten.
Die Unschuld ist verloren. Während meiner Studentenzeit gab es den Witz von dem Mann, dem der Arzt sagt, nachdem er ihn untersucht hat: Mein lieber Mann, Ihr Magen ist schwer angegriffen, Ihre Nieren sind überlastet, Ihre Leber ist geschwollen. Sie trinken zu viel. Wie stellen Sie sich das weiter vor? Worauf der Mann antwortet: Jetzt, Herr Doktor, dann sauf i noch a bissle auf der Milz rum!
Das war damals Galgenhumor. Und ist heute nicht mal mehr für den Karneval ein Witz. Die fortgeschrittene Diagnostik mit ihren filigranen Befunden ist ein Segen. Aber sie nützt auch einem Schnüffelsystem für die Krankenversicherung.
Mein Richter, mein Doktor, zeigte sich milde. Ich habe Glück gehabt, weitgehend. Gute Gene! Eine robuste Natur! Was er vorlas, versah er meistens mit dem Zusatz: »Ihrem Alter entsprechend!« Dass ich die hundert Meter nicht mehr in 11,9 laufe, ist »meinem Alter entsprechend«. Dass ich sie nie besser als 14,0 lief, war meine Schuld. Zu wenig Training, zu wenig Ehrgeiz, zu bequem. Aber das ist verjährt. Jetzt achte ich auf meine Gesundheit. Wie einer, der ins Kloster geht, weil es nirgendwo anders mehr geht. Innere Einkehr. Ich bin trotz meiner Vita, meines Lebenswandels, aufgenommen in den Kreis der sozial verträglichen Gesunden. Auch bei der Gesundheit geht Glück vor Leistung: Bis jetzt ist es ja gut gegangen, sagt der vom Hochhaus Stürzende auf seiner Bahn.
Der Arzt blätterte in den Unterlagen. »Die Lungenleistung«, sagte er, »gut! Ihrem Alter entsprechend!« Ich dachte an die Qualen, die mir die Freuden des Rauchens bereitet haben. Wie ich des Nachts Kippen wieder anzündete. Mich anzog, wenn ich keine Zigarette hatte, manchmal sogar bewusst, um es mir abzugewöhnen. Wie ich um ein Uhr nachts auf leeren Straßen nach Passanten suchte, Betrunkene höflich anrempelte, sie bat, mir doch einen Zehnmarkschein oder ein Fünfmarkstück zu wechseln, für den Zigarettenautomaten. Tempi passati. Die Lunge wenigstens hat mir verziehen. Selbst die zahllosen Detektiv-Aufnahmen von der Lunge durch die Computertomographie weisen Teer, Rauch und Nikotin, wenn überhaupt, als Narben einer leichten Lungenentzündung aus.
»Die haben Sie wahrscheinlich überhaupt nicht bemerkt«, sagte der Arzt.
»Nein, die habe ich nicht bemerkt«, sagte ich, schuldbewusst über meine Ahnungslosigkeit.
»Das war früher so«, beruhigte mich der Arzt. Und ich ergänzte in Gedanken: Man starb früher, ohne zu wissen, warum. Man lebte weiter, früher, ohne zu wissen, warum. Was die Gesundheit anlangte, war das Leben ein Ritt über den Bodensee.
Der Arzt blickte weiter in die Papiere. Zahlenkolonnen, deren Exaktheit sich immer durch Bruchstellen hinter dem Komma erweist und die mit dem mathematischen Zeichen für »größer« und »kleiner« in Relation zum Normalfall gesetzt werden. Die Geräte rechnen uns in Zahlen um, die sich durch größere oder geringere Abweichung von der Norm ergeben. Je geringer wir von ihr abweichen, desto gesünder sind wir. »Alles im grünen Bereich«, heißt die entsprechende Redensart. Keine Warnlämpchen gehen an. Die medizinischen Maschinen prüfen den Patienten, als wäre er ihresgleichen. Öldruck, Luftdruck, Blutdruck, Oktangehalt im Treibstoff. Abnutzungserscheinungen des Materials.
Ich bin froh, dass das so ist. Früher, als mein Vater, schon alt und schwer krank, zum Arzt kam, musste er sich »oben frei« machen, wurde abgehorcht und abgeklopft. Dann sagte der Arzt: »Sie sollten aufhören zu rauchen! Und keinen Alkohol! Jedenfalls möglichst wenig!« Mein Vater hatte in seinem langen Leben nie geraucht und so gut wie nie getrunken. Ein Glas Wein zu einem runden Geburtstag kam schon einer Orgie, kam einem Exzess gleich. Und dann ließ er es auch noch halb voll stehen. »Es schmeckt mir nicht!«, sagte er entschuldigend und zuckte die Achseln. Ich wollte, ich hätte die Achseln so zucken können. Aber Söhne lernen von Vätern nix. Höchstens das Gegenteil. Er war gewandert, war Bergsteiger, Skifahrer, Langläufer. Beim Schwimmen hatten er und seine jungen Freunde sich darauf beschränkt, junge Mädchen, die dazu halb ängstlich, halb freudig kreischten, ins Wasser zu werfen wie zappelnde Fische. Backfische. Das war wie für meine Kinder die Disco. Nur nicht so laut.
»Was das Gehör betrifft«, sagte der Arzt. »Sie haben Schwierigkeiten im Bereich der ganz hohen Töne!« Aber auch hier beschwichtigte er mich gleich wieder. »Was in Ihrem Alter eher normal ist!«
»Was heißt das?«, fragte ich.
»Das heißt«, sagte der Arzt und lächelte fein und milde, »dass Sie beispielsweise keine Grillen mehr hören können. Wenn Sie nach Italien oder Griechenland fahren!«
Mir fuhr die Erinnerung durch den Kopf, wie ich das erste Mal, es war in Spanien an der Costa Brava, des Abends vom rhythmischen Geschrei der Grillen und Zikaden überfallen wurde. Es war ein Lärm in der Stille, fast ein Aufruhr in der beginnenden Dunkelheit.
»Das also auch nicht mehr«, sagte ich. Und es sollte leicht und ironisch klingen, so als könnte ich auf die Grillen besonders unbekümmert verzichten. Weg mit Schaden. Während ich mir vorzustellen versuchte, welche Segmente von Konzerten künftig jenseits meiner Hörschwelle liegen würden, ich also von ihnen abgeschnitten wäre, sagte der Arzt, und er meinte es begütigend und wohltuend ungenau: »Es bleibt ja noch so viel!«
Einmal, das mag jetzt auch schon acht, neun Jahre her sein, hatte ich im Sommer mein Gehör so gut wie ganz verloren. Wir waren, wie seit vielen Sommern, mit den Kindern während der Schulferien nach Mariawörth am Wörthersee gefahren. Es war die Zeit, als uns die Tochter und der Sohn das Nachtleben erst allmählich, dann weitgehend abgenommen hatten. Wir saßen am Abend nach dem Essen zusammen, spielten Skat oder Tabu, wobei Skat das einzige Spiel war, bei dem ich den Triumph erlebte, dass sich meine Kinder rückhaltlos und rücksichtslos mit mir gegen ihre Mutter verbündeten: Ihr wurde die Rolle der Verliererin zugewiesen, die sie getreulich erfüllte. Sie wusste, dass sie mich tagsüber beim Wasserskifahren, wie übrigens in den Winterferien beim Skifahren, längst abgehängt hatte. So gönnte sie mir großzügig diese Momente des Triumphs, in denen ich, von starken, aufstrebenden Kindern flankiert, noch einmal auf einem Nebenkriegsschauplatz, beim Skat, die Rolle des Rudelführers und des Leitpavians spielen konnte. Doch waren diese Triumphe kurz, denn in Wahrheit drängte es die beiden nach Velden in die Disco, wo sie mit altersgleichen Jugendlichen aus dem Hotel hinzogen, während wir zurückblieben, ich noch ein Weilchen bei einem Glas Wein auf den See blickte, um dann in der Hotelbar nach erwachsenen Skatspielern Ausschau zu halten oder mich gleich zu meiner Frau mit einem Buch zurückzuziehen. Das alles im lange besonnten Abendglanz, dessen Schimmer später, Abend für Abend, das Mondlicht silbern übernahm. Dieser Abendglanz, dieser Mondschimmer sind schon starke, wenn auch wehmütige Argumente für das Älterwerden.
Manchmal zog auch ein Gewitter auf, ein gewaltiges Spektakel, dem die Bäume in der folgenden Stille noch eine Zeit lang weinend nachtropften. Auch diese Aufgeregtheiten überlässt man, stellvertretend, gern der Natur.
An diesem Abend aber blieb es schön, und der nächste Morgen stieg wie frisch gewaschen aus dem See. Es war früh, sehr früh, und das Licht drängte sich durch die Ritzen der zugezogenen Gardinen. Ob mich das Licht wach gemacht hatte oder die präsenile Bettflucht oder beides – egal. Meist wachte ich beim ersten Licht (oder auch ohne das erste Licht) auf, weil ich mir Sorgen machte, die bei Licht betrachtet keine waren. Ich sah auf die Uhr, es war kurz nach fünf, und ich überlegte einen Augenblick, ob »die Kinder« schon aus Velden oder Pörtschach zurückgekehrt wären, und wie immer drückte mich eine leichte Angst davor, dass sie auf dem Heimweg mit jemandem mitgefahren wären, der zu viel getrunken hatte.
Auf einmal merkte ich: Etwas war anders an diesem Morgen. Etwas, das ich noch nicht ausmachen konnte und das mich aber mehr und mehr in Unruhe versetzte. Es war, allmählich begriff ich es in der absoluten Stille: die absolute Stille. Ich hörte nichts. Nichts. Absolut nichts. Obwohl die Balkontür leicht geöffnet war, ab und zu blähte sich der Vorhang auf, auch er machte dabei kein Geräusch, war nicht zu hören.
Es war Hochsommer, und ich wusste auf einmal, was ich an dem beginnenden Tag unbedingt hätte hören müssen: Vögel. Sie, die jeden Morgen tschirpend, zwitschernd, tirilierend, kreischend, mit mahnenden Zwischenrufen oder albernen Dialogen die frische Helle begrüßten als ihre Tageszeit, sie waren verstummt.
Sonst, wenn ich um die gleiche Zeit, jäh aus dem Schlaf fahrend, ihr Gekreische, ihr Flöten, ihr vielstimmiges Geschrei gehört hatte, war mir eingefallen, wie ich früher oft dem Morgen entgegengeschlichen bin. Und dass mir mit meinem dumpfen Kopf in früher Luft wie ein Programmpunkt stets die Brecht-Zeilen eingefallen sind, die diese Morgenkaterstimmung wiedergeben:
Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen
und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien.
Ob das jetzt meinen Kindern einfiel? Meinem Sohn eher als meiner Tochter. Ob ich ihnen das Gedicht schon einmal vorgelesen hatte? Ob ich, wenn nicht, das bald nachholen sollte? Nur um beim Aufwachen nicht darüber nachzugrübeln?
Jetzt aber: nichts. Jedenfalls kein Geräusch. Ich drehte mich zu meiner Frau, sah sie ruhig atmen, hörte es aber nicht. Auch ihr tiefer Schlafatem war nicht zu hören. Zuerst blieb ich ziemlich steif und reglos liegen. Doch unterbrach ich diese Ruhelage durch aufgeregte, unkoordinierte Bewegungen, mit denen ich aber meine Frau nicht unnötig wach machen wollte. Ich kratzte mit dem Fingernagel über die Bettdecke, mit dem Finger vorsichtig auf dem Bettrand, auf dem Nachtkästchen. Nichts.
Meine Frau fuhr aus dem Schlaf.
»Was machst du denn schon wieder?«, fragte sie.
»Ich höre nichts!«, sagte ich. »Hörst du was?«
»Ja, dass du wieder Krach machst im Bett!«, sagte sie. »Du hast mich geweckt.«
»Hörst du die Vögel?«, fragte ich.
»Jetzt ja!«, sagte meine Frau. »Du hast mich ja geweckt.«
»Ich aber höre sie nicht«, sagte ich. »Und dich höre ich wie durch Watte.«
»Was ist denn das schon wieder?«, sagte meine Frau.
»Ich höre nichts!«, sagte ich. »Ich habe mein Gehör verloren! Wie der späte Beethoven!«
Je heller es wurde, desto deutlicher geriet ich in Panik, weil ich immer mehr von der Furcht befallen war, über Nacht taub geworden zu sein. Meine Frau hatte gemeint, dass ich wahrscheinlich nur Wasser im Ohr hätte. Vom Schwimmen. Ich hüpfte daraufhin abwechselnd auf dem rechten und dem linken Bein herum, wobei ich den Kopf neigte und mir den Zeigefinger in das jeweils gesenkte Ohr steckte oder mit der flachen Hand gegen die passende Schläfe schlug. Nichts. Ich sagte meiner Frau, dass ich nicht das Gefühl hätte, Wasser im Ohr zu haben.
»Wahrscheinlich bin ich taub«, sagte ich dumpf. »Ich bin wahrscheinlich taub.« Nach einer Pause: »So ist das im Alter! Es überfällt einen! Über Nacht! Nie mehr die Vögel hören!«
Es war Sonntagmorgen. Sechs Uhr. Ich habe mir dann bei der verschlafenen jungen Frau an der Rezeption ein Taxi bestellt. Ehe es kam, es brauchte von Klagenfurt eine Weile, bin ich vor dem Hotel auf und ab gelaufen, habe mit den Füßen aufgestampft, mein Fußstampfen nicht gehört. Ich habe den Kopf gegen den See geneigt. Weder hörte ich sein Platschen und Schmatzen, noch hörte ich Menschen- oder Tierstimmen. Auch die vielleicht fünfhundert Meter entfernte Bundesstraße schwieg wie ausgestorben.
Taub! Taub! Taub!, dachte ich. Taub, das ist ein Wort für alt, morsch, unfruchtbar. Für dumm! Du taube Nuss!, hat man in Tübingen geflucht. Und in der Studentenkneipe murmelte einer einem Mädchen hinterher, nachdem sie ihn betrunken, nach seinem fünften Bier, einfach hatte sitzen lassen: »Diu taube Sau! Diu, mittelhochdeutsch! Diu taube Sau!« Taub wie dumm, wie saudumm, wie hohl, wie eine taube Nuss. In meiner kreisenden Verzweiflung fiel mir der Spruch ein: »Die Taube im Bett ist besser als die Schwerhörige auf dem Dach!«, aber da war glücklicherweise das Taxi schon da.
Ich ließ mich zum Landeskrankenhaus fahren. Das Taxi war ein alter Diesel. Ich hörte ihn nicht. Ich fuhr wie auf Watte. Ich hörte wie durch Watte. So muss es sich in einem Rolls-Royce fahren, dachte ich. Wo das lauteste Geräusch das Ticken der Uhr ist! Und selbst das, dachte ich mit bitterer Genugtuung, würde ich wohl kaum gehört haben.
Beethoven, hat einmal David Hockney gesagt, der selbst schwerhörig ist, Beethoven war so taub, dass er dachte, er wäre Maler. Ich war weder Beethoven noch Maler. Ich war einfach alt und taub.
Auch beim langen Warten in der Notaufnahme – alle anderen Patienten hatten nur zerschnittene Arme, Platzwunden am Kopf, blutunterlaufene Augen, kurz, die Folgen wunderbarer Erlebnisse junger Menschen in einer lauen Sommernacht – prüfte ich immer wieder mit Schritten auf dem Steinboden meine beklagenswerte Lage. Sie schien mir hoffnungslos. Auch diese Schritte hörte ich nicht. Ich war Peter Schlemihl, ohne akustischen Schatten. Ohne Echo. Ich war eine taube Nuss.
Die Ärztin hat mir dann nicht nur das Leben, sondern einen zweiten Frühling wiedergeschenkt. Mein Ohr sei hoffnungslos verstopft, sagte sie, und nachdem ich geniert gesagt hatte, dass ich sie immer mit Wattestäbchen säubern würde, erklärte sie mir, dass genau das der Fehler sei. Man schiebe das Ohrenschmalz auf diese Weise immer fester und kompakter zu einem Klumpen zusammen. Während unseres Gesprächs hatte sie sich schon eine Spritze präparieren lassen, mit der sie beide Ohren ausspülte, von ihrer dumpfen Taubheit befreite. Mit einem Mal drang der Lärm der Welt wieder in mich. Ich hörte, wie meine Schritte auf dem Steinboden hallten, ich hörte das Taxi knatternd und laut röhrend zurückfahren. Ich war wie Münchhausen, der das eingefrorene Posthorn im sibirisch kalten Russland erst hört, wenn es am Kachelofen behaglich auftaut. Die Vögel waren inzwischen weitgehend zur Ruhe gekommen. Der menschliche Lärm hatte die Lufthoheit erobert.
»Du bist eben ein Hypochonder«, sagte meine Frau.
»Was heißt hier Hypochonder. Ich möchte dich sehen, wenn du nichts mehr hörst.«
Jetzt fällt mir ein, dass ich die Grillen beim Check-up vielleicht aus dem gleichen Grund nicht gehört hatte. Obwohl ich keine Wattestäbchen mehr benutze. Das ist meine letzte Hoffnung.
Die Wut über den verlorenen Groschen
Ja, ja, lang leben will halt alles,
aber alt werden will kein Mensch.
Nestroy
Gott, was habe ich mich über den älteren Herrn geärgert, neulich beim Bäcker! Wie er umständlich in Taschen und im Portemonnaie nach den Cents fingerte, die er immer noch Pfennige nannte: »Ich glaube, ich hab es passend! Ach nein, das is ’n Sechser! Ich meine, ein Fünfer! Hahaha! Mein Großvater hat den Fünfer noch Sechser genannt, damals war das Geld noch nicht dezimal …« Wieder lacht er mit einem leichten Hüsteln, weil er merkt, dass er geschwätzig zu werden droht. »Egal! Schrecklich, das neue Geld! So schwer auseinanderzuhalten! Wie soll man sich daran gewöhnen!«
Wie er mit der jungen Verkäuferin zu flirten versuchte. Irgendwas von knackig und frisch in Bezug auf Brötchen sagte und sie dabei angrinste. Wenn er sie wenigstens wirklich angegrinst hätte, aber er lächelte so spitz, als wollte er gleich pfeifen. O Gott! Lächelte sie zurück? Gequält? Und als er merkte, dass er etwas vergessen hatte, und mit gespielter Selbstironie sagte: »Wo hab ich bloß wieder meine Gedanken!« Fast hätte er gesagt: »Was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Beinen haben, ha, ha!« Aber das murmelte er, was noch schrecklicher war, nur vor sich hin, weil er noch rechtzeitig begriff, dass er überhaupt noch nicht aus dem Laden gegangen war, er brauchte sich ja bloß noch einmal umzuwenden. Nichts musste er in den Beinen haben! Aber alles im Kopf.
Verdrehten die anderen Kunden, die zwei kleine Schlangen vor den Verkäuferinnen bildeten, die Augen hinter seinem Rücken? Er vermeinte das im Blick und Gesichtsausdruck der Verkäuferin zu sehen.
Diese älteren Leute, dachte ich schon, aber da merkte ich, dass ich es war, über den ich mich geärgert hatte und den der Jüngere in mir (der Junggebliebene will ich nicht sagen) beiseiteschubsen wollte. »Nun mach mal, Alter! Sonst ist bald Weihnachten.«
So ist das mit dem Altwerden, dem Älterwerden, das ein Altsein ist: Immer guckt ein Jüngerer zu: dem Alter Ego ein altes Ego. Im Spiegel, beim Rasieren, schau ich mich an, während ich das grüne Gel auf der Backe zu weißem Schaum verreibe, und denke: Ich seh aus wie mein Vater! Nur dass der einen Rasierpinsel hatte, Dachshaar, sagte er stolz.
Wir ähneln uns schon verdammt sehr, denke ich, und so war er, als er zehn Jahre jünger war, als ich es jetzt bin, und dass er damals zehn Jahre älter ausgesehen hat als ich jetzt. Und ein bisschen traurig-schadenfroh denke ich: Das kommt davon, dass er Sport getrieben hat, immer. Und nicht erst so spät wie ich! Immer Sport getrieben – und nie was getrunken. Wie hat er immer gesagt: »Mein Vater (also sein Vater, mein Großvater) hat gesagt, ein Vater kann vier Söhne ernähren. Und vier Söhne können keinen Vater ernähren!« Das stimmt. Aber ich habe nur drei Söhne. Und mein Vater hatte auch nur drei Söhne. Und sein Vater auch, vier Kinder, drei Söhne!
Jetzt hat die Verkäuferin zu dem Alten, als wollte sie ihn aus dem Laden schieben, »junger Mann!« gesagt! Junger Mann! Die hat’s nötig. Ausgerechnet die. Die neulich, am Sonntag vor einer Woche, als ich drei Zeitungen, ein Baguette, zwei Kümmelstangen und zwei Brezeln gekauft hatte, zur Kasse ging, die von ihrer Kollegin offen gelassen worden war. Sie schob die Kasse zu. Und die andere, auch eine junge Türkin oder so, hatte noch nicht bonniert. Und da sagte meine Verkäuferin: Du hast nicht bonniert. Und dann suchte sie einen Kugelschreiber, fand ihn, suchte einen Zettel, fand auch den. Und begann die Zahlen hinzuschreiben. Erst nebeneinander, dann untereinander. Zwei Brezeln, das macht … Die »Welt am Sonntag«, das macht … Sie schrieb Zahlen untereinander, blies sich die Haare, die sehr dunkel glänzend beim Beugen des Kopfes nach vorn gefallen waren, aus dem Gesicht, kritzelte sinnlos Zahlen, warf den Kugelschreiber hin, rief in die Backstube: »Mirko, hast du ein’ Taschenrechner?« Und um ein Haar hätte ich gesagt: Fünf schreib hin! Eins im Sinn! Aber da hatte der nun wirklich »junge Mann« mit dem Dreitagebart schon den Taschenrechner gebracht, und so konnte ich mein Wissen aus der guten alten Zeit, meine Altersweisheit »Fünf schreib hin! Eins im Sinn!« nicht anbringen. Stattdessen hatte ich mich gefragt: Heißt das wirklich noch Kugelschreiber? Oder einfach Stift! Und seit wann hat der Kugelschreiber keine Kugel mehr? Und dann hatte ich gedacht: Ist ja auch egal. Und war hinausgegangen aus der Bäckerei auf die Straße.
Und während ich jetzt die Bäckerei verlasse, höre ich die Verkäuferin mir nachrufen: »Junger Mann …« Junger Mann! Das klingt nicht einmal mehr wie Hohn. »Junger Mann … Ihr Schuh ist offen. Sie werden hinfallen!« Ich drehe mich mit einem verlegen dankbaren Lächeln um. »Ich weiß«, sage ich, gehe aber weiter. »Sie werden hinfallen!« »Ich weiß!«, sage ich. »Ich pass schon auf!« Und ich gehe weiter, als wäre nichts passiert.
Ich gehe weiter, spähe nach einem Mäuerchen, einem Zaun, Gitter, Haus, suche am Straßenrand ein Auto mit geeigneter Stoßstange, ein Gebäude mit geeignetem Treppeneingang. Ich will mich nicht vornüberbeugen, mit verzerrtem Gesicht, in das feuerrot das Blut schießt. Ich will auch keine Kniebeuge versuchen. Zwar komme ich, das wäre ja gelacht, noch leicht bis zum Boden. Ich kann einen Groschen aufheben (Groschen!), wenn er mir runterfällt. Bückt sich ein anderer, sage ich: »Lassen Sie’s liegen, tritt sich fest!« Wie ich, will mir jemand in den Mantel helfen, sage: »Danke! Geht alleine schwer genug!« Oder mit ebenso gestanzter Schlagfertigkeit: »Danke! (Lachen, gequältes Lachen.) Erst nach dem zweiten Schlaganfall!«
Ich könnte mich also zum Schuhzubinden bücken. Leicht. Aber wie würde ich dabei ächzen, welche Figur abgeben, wie würde ich aussehen, wenn mir beim Aufrichten jemand in das vor Anstrengung verzerrte Gesicht blicken würde. Lieber nicht. Vor allem aber, kurz bücken, das ginge ja noch! Aber einen Schuh zubinden. Wo ich schon von oben sehe, dass das eine Schuhbandende inzwischen so kurz geworden ist, dass ich erst das andere lockern müsste, indem ich von unten die Spannung zwischen den Löchern lockerte, erst in der zweiten Reihe und so weiter bis zur untersten, um dann den Schnürsenkel justierend nachzuziehen. Bis beide Enden etwa gleich lang aus den obersten Ösen hingen. Das würde dauern. Und die ganze Zeit würde sich das Blut im Kopf stauen.
Lieber nicht! Also gehe ich weiter und schaue vorsichtig nach, wie weit das längere Schuhband beim Gehen peitschend ausschlägt. Um nicht draufzutreten und doch zu stolpern oder, wie es mir die Verkäuferin vorausgesagt hat, gar hinzustürzen, lasse ich das Bein mit dem Schuh, aus dem das offene Band bei jedem Schritt um sich schlägt, vom Körper wegschwingen. Es sieht behindert aus, wie ein bei jedem Schritt nach außen kreisendes steifes Bein, ich weiß, aber immer noch besser, als wenn ich jetzt ächzend über den Boden gekrümmt an meinem Schuh herumfingern würde.
Wahrscheinlich habe ich einen zu hohen Blutdruck und zu ungeschickte Finger. Und ein zu steifes Rückgrat! Und einen hinderlichen Bauch. Aber warum habe ich nie gelernt, eine richtige Schuhschleife zu binden? Beziehungsweise: Warum habe ich es gelernt und bin zu ungeduldig, meine Mutter sagte, zu »schlampig«, um mir den Schuh »richtig« zu binden?
Binde dir den Schuh doch gleich richtig zu! Das ist einer der kategorischen Imperative des Alters, die man nie einhält. Ich mache einen Umweg zu einer Bank. Hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann stehen bleiben und den Fuß mit dem offenen Schuh auf die Bank stellen. Wenn schon jemand da sitzt, mache ich das nicht, denn das wird nicht gern gesehen. Es droht der Dialog:
»Machen Sie das zu Hause auch so?«
»Was?«
»Den Schuh auf die Bank stellen, auf der andere sitzen!«
»Ich habe zu Hause keine Bank.«
»Aber einen Stuhl.«
»Ja!«
»Und stellen Sie den Schuh, wenn Sie damit schmutzig von der Straße kommen, auf Ihren Polsterstuhl?«
»Nein, da ziehe ich ihn vorher aus. Ich möchte ja auch meine Wohnung nicht dreckig machen.«
»Na, sehen Sie!«
»Was heißt ›Na, sehen Sie!‹? Soll ich hier vielleicht auch den Schuh ausziehen und mit den Socken durch den Dreck laufen?«
»Aber andere Menschen sollen sich in Ihren Schmutz setzen!«
»Sie sitzen ja schon!«
»Aber wenn ich nicht säße und später kommen würde, würde ich mich genau in den Dreck setzen, den Sie hier rücksichtslos …«
Derjenige, der schon auf der Bank säße, wäre auch schon alt. Alte Leute sind rechthaberisch. Und streitsüchtig. Weil sie den Kampf ums Dasein schon aus der Defensive führen. Wer im Rückzug ist, ist besonders aggressiv. Streitsüchtig. Er schlägt um sich, mit Worten, weil die Kraft zu nichts anderem mehr reicht.
Da ich diesen Dialog vermeiden will, setze ich mich auf die Bank. Auch wenn sie leer ist. Auch wenn das Wetter schön und der Weg trocken ist. Ich setze mich, ziehe den Fuß mit dem offenen Schnürsenkel hoch; auch dabei muss ich ächzen, aber mein Gesicht wird nicht hochrot. Elegant sieht das auch nicht aus. Mir fällt ein, dass ich, als ich schon sechzig war, auf einer Liege an einem Pool den großen Zeh beim Sitzen noch in den Mund stecken konnte. Auf einer anderen Liege war ein Baby, das seine kurzen, kugeligen Beine aus den knisternden Windeln streckte. Dann steckte es einen Fuß, der wie eine kleine rote Semmel aussah, in den Mund und krähte vor Stolz.
»Guck mal!«, sagte meine Frau. »Was das Baby kann!«
»Das kann ich auch«, sagte ich. »Glaube ich jedenfalls.« Ich zog den Fuß über den Schneidersitz nach oben, während ich ihm den Rücken entgegenkrümmte und den Kopf entgegenbeugte. Mein Gott, zog und knackte das. Aber es gelang. Während ich dachte, nie wieder, sonst brichst du auseinander, oder dein Zeh bleibt dir ewig im Mund stecken, sagte die Mutter des Babys: »Bravo!«
Ich hatte es für sie gemacht, aber ich krähte nicht.
Ich dachte nur: »Süßer Vogel Jugend«!
Heute würde ich mich vor keinem Baby der Welt, und hätte es noch so rosige Beinchen und noch so knisternde Windeln und krähte es noch so lustig seine hübsche Mutter im Bikini an, mit dem Versuch abstrampeln, meinen großen Zeh zum Mund zu führen. Ich weiß noch, dass auf einer anderen Liege ein junger Mann (der wirklich jung war und deshalb auch von niemandem so angeredet wurde) erst den rechten Zeh in den Mund steckte, dann den linken. Und seine Übung dadurch steigerte, dass er seinen Fuß hinter den Kopf in den Nacken zog.
Meine Frau sagte: »Bravo!«
Er wiederholte das Gleiche mit dem anderen Bein.
Meine Frau sagte wieder: »Bravo!« Die Mutter im Bikini lachte. Das Baby hatte das Interesse an seinen Zehen verloren und knisterte mit den Windeln. Das war im August 93. Am Wörthersee. Das Hotel ist inzwischen ein Seniorenheim. Oder eine Managertagungsstätte. Eine der gehobenen Art. Managertagungsstätten sind die Vorstufe zu Seniorenheimen oder die Nachstufe. Je nachdem, wer eher Pleite gemacht hat.
Ich habe den Schuh jetzt zugebunden. Ich prüfe. Richtig fest sitzt die Schleife nicht. Es liegt daran, dass ich den Finger der einen Hand nicht fest genug auf das übereinandergezogene Band gepresst habe, während ich mit der anderen Hand versucht habe, die Schleife zu vollenden. Als Kind dachte ich, dass man eigentlich zum Schuhzubinden drei Hände bräuchte. Eine Hand, die die beiden Bänder an ihrer Kreuzstelle festhält, zwei Hände, um die Schleife gleichzeitig zu legen. Als meine Mutter einmal meinte, ich hätte zwei linke Hände, vergaß ich schnell den Wunsch nach der dritten. Dass ich ein unterdrückter Linkshänder bin, wurde mir erst klar, als es zu spät war. Daran hat es schon immer gelegen. Jetzt, wo ich das alles weiß, es mir jedenfalls, sobald der Schuh aufgegangen ist, ins Bewusstsein rufen kann, bin ich zu faul und empfinde es als zu lästig, die Schleife noch einmal zu lösen, um sie dann neu, diesmal straffer, zu binden. Sie würde sich spätestens in fünf Minuten wieder lösen. Da ich in weniger als fünf Minuten zu Hause sein werde, lasse ich es dabei bewenden. Ich ließe es auch auf sich beruhen, wenn mein Weg länger wäre. Nur würde ich dann wieder strategisch und fluchend Ausschau nach einem Sockel, einer kleinen Mauer, einem niedrigen Zaun, einer Treppe, einer Stoßstange halten. Und bis ich die gefunden hätte, würde ich missgelaunt denken, dass die Turnschuhe, die ich bei diesem Wetter zum Laufen trage, zu lange Schuhbänder haben. Und dass sie daher, würden sie durch den Dreck und um meine Beine peitschen, die Jeans total versauen würden. Die würden dann den Teppich in der Wohnung … Für mich und meine Schuhbandprobleme hat Deutschland meist das falsche Wetter. Aber was soll ich machen, der Arzt hat mir geraten, mich zu bewegen. Gehen! Laufen! Angehen, anlaufen gegen das Alter.
Früher konnte ich sogar Seemannsknoten knüpfen, die man für Schuhe naturgemäß nicht braucht. Früher wusste ich noch nicht, das war aber viel früher, dass das Schuhband Schnürsenkel heißt. Als ich Kind war, gab es keine Schnürsenkel, nur Schuhbandel. Wenn das Blechende kaputt war, fransten die Schnürsenkel, die noch Schuhbandel hießen, aus, sie sahen aus wie Pinsel, und ließen sich nicht durch Schuhlöcher ziehen, sosehr man auch versuchte, sie mit Spucke zusammenzudrehen. Auch für ein Kind ist das Leben mit Schuhen schon schwierig. Allerdings konnte ich damals den Zeigefinger, wenn ich die Schuhe der Einfachheit halber beim Ausziehen zugebunden ließ (oder lassen musste, weil aus der Schleife ein Knoten geworden war), als Schuhlöffel benutzen. Das tat weh, aber es ging. Es wurde nur der Finger, nicht der Kopf, rot.
Inzwischen brauche ich lange Schuhlöffel. Mir fällt das Sprichwort ein: »Wer mit dem Teufel essen will, muss einen langen Löffel haben.« Passt das? Im Alter braucht man einen längeren Schuhlöffel. »Wenn die Sonne tiefer steht, werfen auch Zwerge längere Schatten.« Das ist von Karl Kraus und passt auf jeden Fall.
Mit fünfzig habe ich mir in ein Schmierheft notiert: Ich bin jetzt fünfzig und kann mir immer noch nicht richtig die Schuhe zubinden. Ich werde es wohl nicht mehr lernen. Ich habe inzwischen gelernt, dass Kinder und Alte die gleichen Schwierigkeiten mit dem Schuhzubinden haben.
Für beide wurde der Klettverschluss erfunden. Und der Reißverschluss. Kinder sind unmündig. Sobald ich mir die Schuhe nicht mehr allein zubinden kann, möchte ich nicht mehr leben. Wir werden sehen. Ich habe so was Ähnliches schon oft gesagt und wollte dann doch leben, weiterleben, als ob von der Länge des Schuhlöffels die Seligkeit abhinge. Aber Schuhe mit Klettverschluss oder Reißverschluss, die werde ich nie, nie, nie tragen. Behaupte ich trotzig. Ich unterscheide Menschen zwischen alt und jung danach, ob sie Schuhe mit oder ohne Klettverschluss tragen. Tragen können. Tragen müssen. Behaupte ich bockig. Ich bedaure Menschen, die Gesundheitsschuhe tragen müssen. Das ist hochmütig, ja hochfahrend, denn ich weiß, dass das Alter viele Risse und defekte Stellen findet, durch die es in uns eindringen kann. Wir sind eine belagerte Festung, die von der Zeit mürbe geschossen wird. Auch im Schuhwerk steckt unsere Achillesferse.
Wachtraum: Ödel sei der Mensch, hilfreich und gut
Ein älterer Patient kommt zum Arzt.
»Herr Doktor, ich kann mir gar nichts mehr merken. Ich vergesse sofort alles.«
Arzt: »Seit wann haben Sie denn das?«
Patient: »Was?«
Neulich, etwa zehn Tage nachdem ich an einem Wochenende in der Toskana mit Professor Stölzl zusammen im Dom von Siena war, den er mir sachkundig erklärte, neulich also wachte ich auf und dachte – wie heißt Christoph Stölzl?
Das heißt, so dachte ich nicht. Ich dachte: Wie heißt der Mann, von dem ich vergessen hatte, dass er Christoph Stölzl heißt.
Oder noch genauer: Ich dachte, als ich am Morgen um halb sechs aufwachte, dass ich so etwas früher »präsenile Bettflucht« genannt hatte, um mich mit einer höhnischen Bemerkung über meine Zukunftsaussichten beim Schlafen zu trösten (vorbeugendes Pfeifen im Walde), und dass ich jetzt, meinem Alter entsprechend, diese Phase erreicht hatte, die man nicht mehr ironisch, sondern zu Recht so nennt. Wie denn anders, wenn ich immer, Nacht für Nacht, Morgen für Morgen, um fünf Uhr oder halb sechs aufwache. Ich dachte also, während ich noch im Halbschlaf oder halb wach war, jetzt wirst du gleich wach sein und aufs Klo gehen und einen Schluck Wasser trinken und noch einen und noch einen großen Schluck, mehr, als du Durst hast, weil du gelernt hast, dass dir Wasser bekommt, dass es gesund ist, und weiter dachte ich, dass ich abends leider immer wieder vergesse, dass ich weiß oder zu wissen glaube oder mir einbilde, dass Wasser gesund ist und dass ich viel davon trinken soll und kaum was davon trinke, jedenfalls abends …
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: