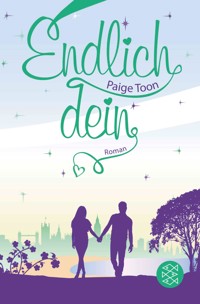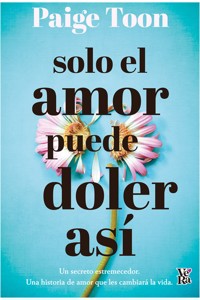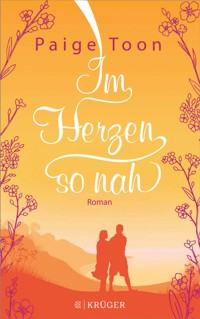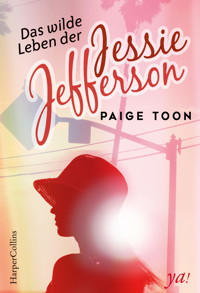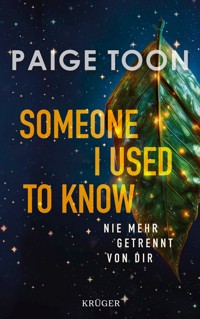
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So viel kann sich in ein paar Jahren ändern ... Eine Second-Chance-Romance mit berührendem Geheimnis. Als Jugendliche sind Leah, George und Theo unzertrennlich. Bis George eines Tages spurlos verschwindet ... Jahre später kehrt Leah mit ihrer kleinen Tochter zurück in ihr Elternhaus in Yorkshire. Ohne Theo, den Vater ihres Kindes. Als George dann überraschend wieder auftaucht, steht Leahs Gefühlswelt Kopf. Warum ist er damals verschwunden? Was ist zwischen Leah und Theo passiert? Und kann aus alten Verletzungen neue Liebe entstehen? »Eine herzzerreißende und wunderschöne Geschichte über Liebe, Familie, Verlust und das, was uns verbindet« Dani Atkins Noch mehr glückliche Lesestunden mit Paige Toon: Lucy in the Sky Du bist mein Stern Einmal rund ums Glück Immer wieder du Diesmal für immer Ohne dich fehlt mir was Sommer für immer Endlich dein Wer, wenn nicht du? Nur in dich verliebt Alles Liebe zu Weihnachten Dein Platz in meinem Herzen Im Herzen so nah Du schenkst mir die Welt Am Ende gibt es nur uns Ich in deinen Augen Sieben Sommer Someone I Used to Know
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Paige Toon
Someone I Used to Know
Nie mehr getrennt von dir
Über dieses Buch
Leah, George und Theo lernen sich als Teenager kennen. Der wütende und traumatisierte George wird von Leahs Eltern in Pflege genommen und bald sucht auch der reiche, aber von seinen Eltern vernachlässigte Theo Leas und Georges Freundschaft. Die drei schwören sich, dass sie sich von nichts und niemandem auseinanderbringen lassen. Doch eines Tages verschwindet George spurlos.
Jahre später kehrt Leah als junge Frau und Mutter in ihr Elternhaus nach Yorkshire zurück. Ohne Theo, den Vater von Leahs kleiner Tochter. Dann taucht George überraschend wieder auf. Warum ist er damals verschwunden? Weshalb ist Leahs und Theos Beziehung zerbrochen? Und kann aus alten Wunden etwas Neues entstehen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paige Toon ist eine internationale Bestsellerautorin, ihre Bücher haben sich weltweit knapp 2 Millionen Mal verkauft. Sie schreibt dramatische und emotionale Liebesgeschichten mit unvergesslichen Figuren und Settings, die ihre Leserinnen auf einzigartige Reisen mitnehmen. Ihre Liebesromane behandeln oft große Themen, die nachdenklich stimmen, und laden immer zum Träumen ein. Lachend und weinend wird man Teil einer neuen Familie. Paige Toon lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Cambridgeshire. Auf TikTok, Instagram und Facebook ist sie unter @paigetoonauthor zu finden.
Andrea Fischer hat Literaturübersetzen studiert und überträgt seit über fünfundzwanzig Jahren Bücher aus dem britischen und amerikanischen Englisch ins Deutsche, unter anderem die von Lori Nelson Spielman, Michael Chabon und Mary Kay Andrews. Sie lebt und arbeitet im Sauerland.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Weder damals noch jetzt, sondern irgendwann dazwischen
1. Kapitel
Jetzt
2. Kapitel
Damals
3. Kapitel
Jetzt
4. Kapitel
Damals
5. Kapitel
Jetzt
6. Kapitel
Damals
7. Kapitel
Jetzt
8. Kapitel
Damals
9. Kapitel
Jetzt
10. Kapitel
Damals
11. Kapitel
Jetzt
12. Kapitel
Damals
13. Kapitel
Jetzt
14. Kapitel
Damals
15. Kapitel
Jetzt
16. Kapitel
Damals
17. Kapitel
Jetzt
18. Kapitel
Damals
19. Kapitel
Jetzt
20. Kapitel
Damals
21. Kapitel
Jetzt
22. Kapitel
Damals
23. Kapitel
Jetzt
24. Kapitel
Damals
25. Kapitel
Jetzt
26. Kapitel
Damals
27. Kapitel
Jetzt
28. Kapitel
Jetzt
29. Kapitel
Jetzt
30. Kapitel
Jetzt
31. Kapitel
Jetzt
32. Kapitel
Jetzt
Epilog
Weder damals noch jetzt, sondern irgendwann in der Zukunft
Danksagung
Für alle Kinder in Pflege und die Menschen, die sich um sie kümmern …
Und für Ian und Helga Toon, die mir schon über die Hälfte meines Lebens die Juwelen Yorkshires zeigen.
Ich hätte mir keine besseren Schwiegereltern wünschen können.
Prolog
Weder damals noch jetzt, sondern irgendwann dazwischen
Kaum erreicht das Taxi die Hügelkuppe, kommt der Hof in Sicht.
»Gleich sind wir da«, sage ich zum Fahrer.
»Schwer zu verfehlen«, erwidert er freundlich.
Als ich um halb sechs dort aufbrach, war es noch hell, doch jetzt, um kurz vor acht, breitet sich Dunkelheit über die Felder, nur hier und da sieht man ein erleuchtetes Fenster in den benachbarten Bauernhäusern. Unser Haus dagegen strahlt wie ein riesiger Weihnachtsbaum.
An den Lichterketten hat Jamie wirklich nicht gespart, denke ich mit einer Mischung aus Schuldgefühl und Neid.
Eigentlich hätte ich ihm gerne mehr bei den Vorbereitungen geholfen. Heute ist die große Party zu Mums siebzigsten Geburtstag und zur Pensionierung meiner Eltern, und ich habe es nicht mal geschafft, die ganze Zeit dortzubleiben. Um drei Uhr ging es los, aber nach nur zweieinhalb Stunden musste ich Emilie in unser Airbnb nach Harrogate bringen, und sie brauchte Ewigkeiten, um zur Ruhe zu kommen. Hoffentlich schläft sie durch, bis wir wieder da sind. Katy, die Babysitterin, macht einen kompetenten Eindruck, dennoch weiß ich nicht, wie sie damit zurechtkommen würde, wenn unsere fünfzehnmonatige Tochter so richtig zu schreien anfängt.
Mir fällt etwas ein. »Könnten Sie später noch mal wiederkommen und mich und meinen Mann abholen?«, frage ich den Fahrer.
»Leider nicht, ich habe jetzt Feierabend. Aber mein Kollege könnte die Tour wahrscheinlich übernehmen. Wann wäre das denn?«
»Um zwölf? Könnte er dann anschließend auch unsere Babysitterin nach Hause bringen? Sie wohnt nur wenige Minuten von uns entfernt.«
Ich warte, bis er die Rückfahrt organisiert hat, dann erst steige ich aus. Ich zögere, denn ich will mit meinen schwarzen High Heels nicht in den Dreck treten. Zum Glück steht der Wagen so, dass ich die Schuhe in den Kies setzen kann, und mir fällt wieder ein, was heute Nachmittag erzählt wurde: Jamie war den ganzen Morgen draußen und hat den Hof und die Einfahrt gefegt.
Jamie, Jamie, Jamie …
Mein Bruder, der, so kommt es mir oft vor, meinen Eltern deutlich nähersteht als ich, obwohl er nicht blutsverwandt mit uns ist.
Nachdem ich das Taxi bezahlt habe und ausgestiegen bin, muss ich gestehen, dass Jamie sich wirklich selbst übertroffen hat. Das Gehöft sah noch nie schöner aus.
Kreuz und quer über den Hof sind die vielen Lichterketten gespannt, die sich in den dunklen Scheiben der Fenster im ersten Stock spiegeln. Sie werfen einen warmen Schein auf die Sandsteinmauern von Wohngebäude und Scheunen. Teelichter in Laternen flackern auf pastellfarben gestrichenen Metalltischen, bunte Girlanden baumeln über den Köpfen im aufsteigenden Qualm der Zigaretten.
Ich lasse den Blick über die Gäste schweifen und stelle fest, dass sich meine Eltern mit ihren Bekannten ins Haus zurückgezogen haben. Sie haben noch nie zu denen gehört, die sich der jüngeren Generation zwanghaft aufdrängen.
Mein Blick bleibt an Theo hängen, der mit Jamie und einer mir nicht bekannten jungen Frau an einem himmelblauen Tisch sitzt. Sein dunkles Haar reicht nicht ganz bis zum Kragen seines schwarzen Hemds. Zwischen seinen langen, schlanken Fingern wippt eine qualmende Zigarette, ein nur allzu vertrauter Anblick. Er führt sie an die Lippen und inhaliert tief, kurz leuchtet sein Gesicht auf, und man erkennt seinen markanten Kiefer und die absolut gerade Nase.
Das Taxi wendet, ich trete zur Seite und verfolge, wie die Scheinwerfer über das Feld schweifen und auf das kleine Wäldchen an der unteren Weide fallen. Der weiße Stamm der einsamen Birke dort blitzt auf wie ein Leuchtturm, bevor der Baum wieder in der Dunkelheit verschwindet.
Aus den Außenboxen erklingen Synthesizer und Schlagzeug, und »Repeat« von Cid Rim feat. Samantha Urbani ertönt.
Die Musik hat Jamie sicher auch ausgesucht. Lächelnd gehe ich in den Innenhof.
Jamie entdeckt mich als Erster. Er springt auf und stößt sich fast den Kopf am Heizpilz. Mit seinen knapp eins achtzig ist er schon ziemlich groß, doch seine schwarzen Haare, an den Seiten kurz, oben wild und lockig, lassen ihn noch mal mindestens fünf Zentimeter größer erscheinen.
Mit weit ausgestreckten Armen, ein breites Grinsen im Gesicht, ruft er aus vollem Halse: »SCHNEEWITTCHEN!«
Den Spitznamen hat er mir vor vielen Jahren einmal im Winter verpasst, als mein Gesicht zugegebenermaßen wirklich blass war – besonders im Vergleich zu seinem warmen braunen Hautton. Mehr Ähnlichkeit mit der Märchenprinzessin habe ich allerdings nicht: Meine langen Haare waren damals hellbraun, nicht schwarz wie Ebenholz, und meine Augen sind graugrün statt braun. Bevor ich mir damals eine Erwiderung einfallen lassen konnte, mahnte er mich mit todernstem Gesicht: »Hey, keine rassistischen Sprüche!«
Theos Kopf schnellt zu mir herum – so wie alle anderen Köpfe draußen im Hof –, hastig drückt er seine Zigarette aus. Als ich mich ihm nähere, grinst er mich frech und gleichzeitig schuldbewusst an.
»Ich habe aufgehört! Diesmal wirklich. Hundertprozentig!«, zitiere ich sein Versprechen, das er mir noch vor wenigen Monaten gegeben hat.
»Das war nur die eine«, entgegnet er mit rauerer Stimme als sonst.
»Klar«, sage ich trocken.
»Okay, vielleicht die zweite.« Er lächelt mich an und setzt seinen besten beschwichtigenden Welpenblick auf. »Du warst ewig weg!«
Ich lasse mich auf den Themenwechsel ein. »Ich weiß«, brumme ich.
Die junge Frau am Tisch stutzt demonstrativ und sieht mich mit großen leuchtenden Augen unter einem dichten kupferfarbenen Pony an. »Leah?!«, fragt sie.
Unvermittelt habe ich sie in jüngeren Jahren vor Augen, allerdings unscheinbarer und pummeliger.
»Hallo!«, sage ich, und sie springt auf, um mich in den Arm zu nehmen.
Mir will ihr Name einfach nicht einfallen.
»Danielle«, artikuliert Jamie lautlos hinter ihr.
Wie konnte ich das vergessen?
»Danielle!«, rufe ich und halte sie auf Armeslänge Abstand, um sie näher zu betrachten. Theo zieht einen rosafarbenen Stuhl an den Tisch. »Ich muss was trinken«, murmele ich vielsagend.
»Ich hol dir was«, bietet er an.
»Warum hast du denn so lange gebraucht?«, erkundigt sich Jamie, als ich mich hinsetze.
»Emilie war total aufgedreht. Als hätte sie ein ganzes Kilo Zucker gegessen.«
»Sie hat heute Nachmittag zwei Stück von der Geburtstagstorte gehabt, außerdem den restlichen Zuckerguss von deinem Vater«, erklärt er belustigt.
»Verdammt nochmal! Warum hat er das erlaubt?«
»Ich glaube, er hat’s gar nicht gemerkt.«
»Warum hast du nichts dagegen getan?«, frage ich.
»Sie war so glücklich«, erwidert Jamie fröhlich und hebt kapitulierend die Hände.
Leidgeprüft verdrehe ich die Augen und lächele Danielle an. »Wie geht’s dir denn?«
Danielle, Jamie und viele andere Gäste im Alter zwischen zwanzig und vierzig, die heute hier sind, waren früher mal Pflegekinder meiner Eltern. Ich bin mit achtzehn zum Studieren nach London gegangen und habe die Hauptstadt zu meiner neuen Heimat gemacht, deshalb sind auch Ehemalige dabei, die ich noch nie gesehen habe. Andere sind mir vertrauter, so wie Shauna, die zwei Jahre bei uns war und noch immer in der Nähe wohnt.
Manche lebten nur kurz bei uns: Danielle blieb lediglich wenige Monate, solange ihre Mutter im Entzug war. Genau wie George, der dennoch eine Narbe in meinem Herzen hinterließ, an die ich auch heute noch manchmal erinnert werde, obwohl ich ihn eigentlich nur kurze Zeit kannte.
Jamie hingegen rauschte mit dreizehn Jahren in unser Leben, um zu bleiben. Vor kurzem ist er dreißig geworden, und obwohl er schon seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Hof lebt, schaut er doch fast jeden Tag bei meinen Eltern vorbei. Ohne ihn wären sie ziemlich aufgeschmissen.
Mum und Dad sind nun endlich im Ruhestand, ihre Erziehungskompetenz werden sie aber nie verlieren, und so sehen sie sich auch in Bezug auf alle jungen Menschen, die jemals bei ihnen lebten: als Eltern. Die, die bei ihnen in Pflege waren, verließen das Haus irgendwann mit dem guten Gefühl, dass die Tür immer für sie offen stehen würde. Pflegekinder zu haben war für meine Eltern kein Beruf, sondern eine Berufung. Das ist auch der Grund, warum sie mit so vielen ehemaligen Schützlingen noch Kontakt haben und warum sich so viele die Mühe gemacht haben, heute herzukommen.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen.
»Ich schaue mal nach Mum und Dad«, sage ich zu Theo, als er mir mein Getränk bringt.
Sie sitzen im Wohnzimmer, umringt von Freundinnen und Freunden. Meine Eltern sind fit, gesund und aktiv, allerdings wirken sie nicht gerade jung für ihr Alter. Dad hält den Kopf gesenkt, in ein Gespräch mit einem anderen Standinhaber vom Markt in Masham vertieft. Sein Haar ist inzwischen vollkommen weiß und so unbändig wie immer. Mom wirkt gepflegter mit ihrem adretten hellbraunen Bob, der mit Clips gebändigt ist, und ihrem noch nicht verblassten Make-up. Seit Jahren färbt sie sich die Haare, doch die Fältchen um die Augen und um den Mund verraten ihr wahres Alter. In den wenigen Monaten, seitdem ich Mum zuletzt gesehen habe, scheinen es noch mal mehr geworden zu sein.
Sie unterhält sich gerade mit Veronica, unserer nächsten Nachbarin und der Mutter von Becky, meiner alten Schulfreundin.
»Bist du jetzt erst zurückgekommen?«, fragt sie verwundert.
Ich nicke bekümmert und halte ihr und Veronica das Glas zum Anstoßen entgegen, dann trinke ich einen Schluck.
Mum hatte mich überreden wollen, Emilie in ihrem Schlafzimmer hinzulegen, doch die Vorstellung, ein zahnendes Kleinkind mitten in der Nacht aufzuwecken und von ihm zu erwarten, zwanzig Minuten im Taxi nach Hause zu fahren … Emilie hätte uns stundenlang wach gehalten.
Wir hätten natürlich auch hier übernachten können, aber ein schönes abgeschiedenes Airbnb gegen ein volles Haus – keine Frage. Die Ruhe ist mir die zusätzliche Hin- und Rückfahrt wert.
»Egal, Hauptsache, du bist da.« Mum tätschelt meinen Arm.
Da sie Supermum ist, würde sie mir niemals ein triumphierendes »Hab ich’s doch gesagt« reindrücken.
Und das mit der Supermum ist mein voller Ernst.
Während mein Vater sich bei seinen Freunden entschuldigt und zu uns kommt, sagt Veronica: »Ich habe gehört, ihr wollt nach Australien ziehen?«
»Ja, haben wir vor«, bestätige ich lächelnd. Dad legt mir den Arm um die Schultern.
»Solange die beiden keine Vorstrafen kassieren, bevor sie ihren Visumsantrag stellen«, neckt er mich, ein Witz, den er von Theo hat.
Mein Vater drückt mir einen Kuss auf die Schläfe, ich rieche den Whisky in seinem Atem. Das Gewicht seines Arms ist vertraut und tröstlich.
Seltsamerweise fehlt er mir, obwohl er direkt neben mir steht. Ist das vorweggenommenes Heimweh?
»Wie geht es Becky?«, frage ich Veronica voller Schuldgefühle, weil ich nicht richtig Kontakt gehalten habe.
»Wirklich gut«, antwortet sie. Dad lässt mich los. Ich lächele ihn an, hoffe, dass er nicht wieder geht. »Wusstest du, dass sie schwanger ist?«
»Nein!« Meine Ahnungslosigkeit versetzt mir einen Stich. »Wann ist es so weit?«
»Ende August, das heißt, der oder die Kleine wird irgendwann das jüngste Kind im Jahrgang sein, oder das älteste, falls es sich entscheidet, uns erst im September zu beehren. Becky ist es egal; sie ist bloß froh, dass es nicht Weihnachten kommt.«
»Kann ich mir vorstellen«, sage ich lachend.
Beckys eigener Geburtstag steht immer im Schatten des Weihnachtsfests. Auch Emilie wurde im Dezember geboren. Wir hatten das mit ihr nicht geplant und so auch keinen Einfluss auf ihr Geburtsdatum genommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei Becky und ihrem Mann war.
»Sie war so traurig, dass sie heute nicht hier sein kann«, erzählt Veronica weiter. »Sie hätte dich wirklich gern wiedergesehen, aber sie ist mit Robin auf der Hochzeit seiner Schwester in Kanada. Ich habe die schreckliche Ahnung, dass es ihr dort so gut gefallen könnte, dass sie auch noch auswandert.«
»O nein, das macht sie nicht«, beschwichtigt Mum ihre alte Freundin.
Ich bekomme ein schlechtes Gewissen; meine Eltern sind am Boden zerstört, weil wir ins Ausland ziehen.
»Ich hätte sie auch gerne wiedergesehen«, sage ich und meine es auch so. Früher waren meine beste Freundin und ich unzertrennlich, jetzt kann schon mal ein ganzes Jahr vergehen, ohne dass wir miteinander zu tun haben. Wir haben uns nicht absichtlich auseinandergelebt, es ist einfach passiert.
»Becky und Robin haben eine ganz liebe Karte geschickt.« Mum weist auf den überfüllten Gabentisch.
»Jamie hat eben alle Karten vorgelesen«, erklärt Veronica.
»Du hast die Telegramme verpasst!«, bemerkt Mum.
Ich sehe sie an, und sie besitzt den Anstand, ein zerknirschtes Gesicht zu machen.
Also hat Jamie nicht nur alle Grußbotschaften derer vorgelesen, die es heute nicht hergeschafft haben – was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre –, nein, ich war noch nicht mal dabei, um sie mir anzuhören. Ist überhaupt jemandem aufgefallen, dass ich fort war?
»George hat auch was geschickt«, ergänzt Mum, und sofort weicht meine Eifersucht einem anderen Gefühl, das ich nicht mal ansatzweise beschreiben kann.
»George Thompson?«, frage ich mit kaum verhohlener Ungläubigkeit.
Mum nickt, nicht ahnend, was diese Nachricht bei mir auslöst.
Benommen gehe ich zum Gabentisch und lese eine Karte nach der anderen, bis ich eine in der Hand halte, deren Schrift mir sofort bekannt vorkommt. Ich erkenne die akkuraten, nach links geneigten kleinen Buchstaben.
Liebe Carrie, lieber Ivan,
in der Zeitung habe ich den Artikel über euch gelesen und wollte euch unbedingt schreiben. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mir ist es aber wichtig, mich für all das zu bedanken, was ihr für mich getan habt. Im Laufe der Jahre habe ich oft an euch gedacht. Es geht mir gut, ich hoffe, euch auch. Auf dem Foto wirkt es zumindest so.
Ich wünsche euch beiden einen fröhlichen Geburtstag und einen (hoffentlich) erholsamen Ruhestand.
George Thompson
Seine Schrift hat sich in fast dreizehn Jahren kaum verändert, doch er klingt völlig fremd.
Ich habe ihn deutlich vor Augen: die langen Beine, die hohen Wangenknochen, die rotbraunen Locken, die dunklen Augen …
Alle Härchen an meinem Körper richten sich auf.
George hat den Artikel gelesen?
Die örtliche Zeitung brachte eine Geschichte über meine Eltern, die dann von einer landesweiten Zeitung aufgegriffen wurde. Bloß wo hat George die Meldung gelesen: in der örtlichen oder der landesweiten Presse? Vielleicht auch im Internet? Wo ist er?
Auf der Suche nach einem Absender drehe ich die Karte um, finde aber nichts.
»Hey!«
Theos Stimme lässt mich herumschnellen. Sein Blick fällt auf die Karte, dann auf mich mit meinem ertappten Gesichtsausdruck, wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
»Ah«, sagt er ausdruckslos. »Die hat Jamie eben vorgelesen.«
»Schon gehört.« Mit zitternder Hand lege ich die Karte auf den Tisch zurück.
»Ich dachte, er wäre über alle Berge.« Theos leise Stimme verrät Unbehagen.
»Dachte ich auch.« Ich muss schlucken, dann drehe ich mich zu meinem Mann um.
»Theo Whittington!«
Wir fahren zusammen. Alfred, ein älterer Bauer aus der Gegend, steht mit anderen Bekannten einige Meter weiter. Er kommt zu uns herüber, will uns begrüßen und merkt natürlich nicht, was gerade zwischen uns vorgeht.
»Na, so was! Wie geht’s dir, Junge? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du mehr Ähnlichkeit mit deinem Vater.«
»Hallo!«, antwortet Theo. Es gelingt ihm, fröhlich zu klingen.
Ich trete an seine Seite und nehme seine kalte Hand in meine. Alfred redet weiter auf ihn ein.
Wenn es irgendwas gibt, das Theo hasst, dann ist es der Vergleich mit seinem Vater.
Ich drücke seine Hand, kräftig.
Später im Taxi setze ich mich in die Mitte, um meinem Mann nahe zu sein.
Er steigt auf der anderen Seite ein, lässt sich neben mich sinken und schnallt sich an. Während wir die Partylichter hinter uns lassen, schiebt er den Arm um meine Taille.
Solange wir die eindrucksvollen steinernen Torpfosten seines ehemaligen Elternhauses noch nicht passiert haben, ist er unruhig, doch sobald wir sie hinter uns lassen, entspannt er sich und zieht mich an sich.
»Du siehst so schön aus heute«, murmelt er mir ins Ohr. »Mir gefällt dieses Kleid an dir.«
Es ist schwarz und hat lange Ärmel, der Saum umspielt meine Knie.
Ich schaue ihn an, und er neigt den Kopf und gibt mir einen sanften Kuss. Ich recke mich ihm entgegen, will mehr, und Theo enttäuscht mich nicht. Bei unserem innigen Kuss schmecke ich die Zigaretten, doch es stört mich nicht so wie beim letzten Mal, als Theo wieder anfing zu rauchen. Vielleicht liegt es an den nostalgischen Gefühlen, die der Abend ausgelöst hat. Die Vergangenheit erscheint irgendwie näher, als wäre sie greifbarer, in unmittelbarer Reichweite.
Berauscht fahre ich durch Theos dunkles Haar. In dem Versuch, die verlorene Zeit aufzuholen, habe ich in den letzten zwei Stunden so viel Wein getrunken, dass ich ziemlich betrunken bin.
Theos Hände gleiten über meine runden Hüften, mich durchfährt ein Schauder, ich halte die Luft an.
Das Auto bricht nach links, dann nach rechts aus, und der Fahrer versucht, es wieder unter Kontrolle zu bringen.
Theo erstarrt und lässt mich los. Finster blickt er in den Rückspiegel. Er zieht seinen Arm hinter mir hervor und legt mir die Hand aufs Knie.
Ich nehme an, damit hat unsere Knutscherei erst mal ein Ende. Diese gewundenen Landstraßen sind zu gefährlich, auch ohne dass unser voyeuristischer Fahrer abgelenkt ist.
Wir wohnen wenige Meilen entfernt am Stadtrand von Harrogate. Den ganzen Abend musste ich immer wieder aufs Handy schauen, aber Katy hat mir mehrmals Nachrichten geschickt, dass alles gut sei. Ich schreibe ihr, dass wir auf dem Rückweg sind, und als wir vorsichtig klopfen, öffnet sie sofort die Tür.
»Hallo!«, flüstert sie und tritt zur Seite. Ihre langen blonden Haare schwingen in einem hoch angesetzten Pferdeschwanz. »Hattet ihr einen schönen Abend?«
»Ja, danke. Wie war es?«
»Vollkommen ruhig«, erwidert Katy zu meiner Erleichterung und hüpft auf einem Fuß herum, um ihren Sneaker anzuziehen. »Sie hat keinen Mucks von sich gegeben. Hab trotzdem ein paarmal nach ihr geguckt«, fügt sie schnell hinzu, während sie mit dem Fuß in den anderen Schuh schlüpft.
»Danke.«
Theo drückt ihr das Bündel Scheine in die Hand, das wir schon auf der Rückfahrt abgezählt haben. »Ich bringe dich zum Taxi«, sagt er. »Wir haben schon bezahlt.«
Während er die Babysitterin zum wartenden Auto begleitet, schleudere ich meine High Heels zur Seite und schaue nach Emilie. Unsere Tochter schläft tief und fest auf dem Rücken, alle viere von sich gestreckt wie ein Seestern. Es ist warm im Zimmer – wir haben erst März, die Heizung ist zu hoch eingestellt. Ein paar Strähnen von Emilies dunkelblonden Haaren kleben ihr an der Stirn. Ich kann mir nicht verkneifen, sie vorsichtig zur Seite zu schieben. Als die Kleine sich rührt, halte ich die Luft an. Doch sie schläft weiter, und ich öffne das Fenster einen Spaltbreit, um ein bisschen kalte Nachtluft hereinzulassen, dann verlasse ich lautlos das Zimmer.
Theo steht innen vor der Haustür und wirkt unentschlossen.
»Alles in Ordnung?«, frage ich.
»Ja, doch«, wiegelt er ab.
»Was ist denn?«
Er zögert, tritt von einem Fuß auf den anderen. »Der Taxifahrer hat mir nicht gefallen.«
»Warum nicht? Weil er uns beobachtet hat?«
»Nein, nicht nur deshalb. Ich habe einfach kein gutes Gefühl bei ihm.«
»Machst du dir Sorgen um Katy?« Jetzt bin ich ebenfalls beunruhigt. Theos Bauchgefühl trifft meistens zu. Er kann zwar auch übertreiben, aber Katy ist erst siebzehn. Die Vorstellung, dass ihr irgendwas zustößt …
Er runzelt die Stirn und zuckt mit den Schultern. »Ist bestimmt alles in Ordnung. Ich habe sie extra laut gebeten, uns zu schreiben, sobald sie zu Hause ist, also weiß er, dass wir aufpassen.«
»Gute Idee.«
»Alles okay mit Emilie?«
»Schläft tief und fest.«
Theo lächelt schwach, die dunklen Wimpern umrahmen seine dämmrigen Augen.
Meine Hände gleiten hoch, über seine kräftige Brust bis zu seinen Schultern. Ich muss mich mehr strecken als sonst – er hat noch seine Schuhe an. Ich bin eins zweisundsiebzig groß, und Theo ist etwas über eins achtzig, deshalb haben wir fast dieselbe Größe, wenn ich Absätze trage.
Er beugt sich vor, um mich zu küssen.
George war noch größer …
Ich verdränge den Gedanken und konzentriere mich darauf, wie Theos Hände meine Taille umfassen. Unser Kuss wird tiefer, er drückt mich an sich, und ich will ihn, wie ich ihn ewig nicht gewollt habe. Ich ziehe ihm das Hemd aus der Hose, doch plötzlich hält er meine Hände fest.
»Warten wir noch, bis Katy sich gemeldet hat.«
Ich seufze, nicke aber und lehne den Kopf an seine Schulter. Es gefällt mir, dass er sich sorgt. Als ich ihn kennenlernte, machte er den Eindruck, als sei ihm alles und jeder egal, aber mit der Einschätzung lag ich völlig daneben. Eben weil er so feinfühlig ist, musste er eine schützende Mauer um sich errichten.
Mein Herz schmerzt beim Gedanken an den Jungen, der Theo einst war. Und sie ziehen weiter zu dem anderen Jungen und dem Leid, das er mit sich herumtrug …
»Alles in Ordnung?«, fragt Theo, als er meine veränderte Stimmung spürt.
»Doch, doch«, versichere ich, schaue hoch und weise auf seine Tasche. »Schon was gekommen?«
Stirnrunzelnd zieht er sein Handy heraus, um nachzusehen. »Nein. Aber wahrscheinlich schreibt sie eher dir, oder?«
Ich hole mein Smartphone aus der Handtasche, doch auch da ist nichts eingegangen.
»Noch was trinken?«, fragt Theo.
Ich lächele ihn an. »Ich glaube, ich brauche nichts mehr. Du?«
»Tee?«
»Ja, bitte. Du kommst mir nicht so betrunken vor«, bemerke ich, während ich ihm in die Küche folge.
»Bin ich auch nicht. Als du wieder da warst, habe ich es langsamer angehen lassen. Tut mir leid mit der Zigarette.« Theo wirft mir einen entschuldigenden Blick zu, lässt den Wasserkessel volllaufen und stellt ihn an. »Ich fang nicht wieder an zu rauchen.«
»Du hast es diesmal so lange ohne geschafft«, sage ich aufmunternd.
»Ich weiß.« Er lehnt sich gegen den Schrank, sieht mich an. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.«
»Du siehst heute echt super aus«, murmelt er und schiebt mir eine Locke hinters Ohr. »Tut mir leid, dass du einen Teil der Party verpasst hast. Ich hätte Emilie auch gern hergebracht.«
»Weiß ich. Danke.«
Ich habe es übernommen, weil sie meistens schneller einschläft, wenn ich sie ins Bett bringe. Ich wollte nicht, dass sie beim ersten Abend unter Aufsicht eines Babysitters verunsichert ist.
Der Wasserkessel kocht, Theo macht uns Tee, doch unsere Besorgnis will nicht schwinden.
Wieder sieht er auf die Uhr. »Katy müsste längst zu Hause sein«, brummt er. »Sie muss doch nur nach Killinghall.«
Das Dorf ist keine zwei Meilen von uns entfernt.
»Ich schreibe ihr«, sage ich und tue es umgehend.
Wir warten, doch es kommt keine Antwort, auch keine Bestätigung, dass meine Nachricht eingegangen ist.
»Vielleicht hat sie keinen Empfang«, überlegt Theo.
Ich wähle ihre Nummer. »Es klingelt«, sage ich und warte, wie auf heißen Kohlen.
Das Klingeln verstummt, die Mailbox geht an.
»Scheiße«, flucht Theo mit wachsender Ungeduld. »Was ist mit der Nummer ihrer Eltern? Kannst du deinen Vater danach fragen?«
Katy ist die Tochter eines Marktstandbetreibers, mit dem mein Vater befreundet ist.
»Ihre Eltern sind doch nicht da«, erinnere ich meinen Mann. »Sonst wären sie heute Abend auf der Party gewesen.«
»Aber du könntest ihn nach ihrer Festnetznummer fragen«, beharrt Theo.
»Und das ganze Haus aufwecken? Die Oma ist gerade da, sie passt auf Katys jüngere Brüder auf.«
Theo sieht mich hilflos an. »Besser das als die Alternative«, sagt er nur.
Widerstrebend klingele ich bei meinem Vater durch, doch er geht nicht dran. Ich versuche es auf dem Festnetz, aber auch da meldet sich niemand. Die Party war noch in vollem Gange, als wir aufbrachen, weshalb ich bezweifele, dass jemand das Klingeln hört.
»Wahrscheinlich hat sie nur vergessen, sich zu melden«, überlege ich laut, während Theo noch einmal bei Katy anruft.
Er schüttelt den Kopf, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst. »Ich fahre zu ihr rüber«, sagt er schließlich.
»Theo, das geht nicht!«, rufe ich entsetzt. »Du hast was getrunken!«
»Ich bin okay«, beharrt er. »Sind doch nur ein paar Minuten. Vielleicht hast du recht, und sie hat es vergessen, aber ich würde es mir nie verzeihen, wenn ihr irgendwas zustoßen würde.«
»Warte, ich rufe noch mal bei Dad an«, sage ich schnell, doch Theo greift bereits nach den Autoschlüsseln.
»Bin gleich wieder da«, sagt er nur und gibt mir einen Kuss.
»Warte, Theo!« Ich will ihn am Handgelenk festhalten.
»Ehrlich, Leah, ich bin so gut wie nüchtern!« Er lacht lässig und entzieht sich mir, um die Tür zu öffnen. »Ehe du dich versiehst, bin ich zurück.«
Das Letzte, was ich von ihm höre, ist die Tür, die hinter ihm ins Schloss fällt.
1.
Jetzt
»Du musst aber ganz still sitzen, ja?«, flüstere ich Emilie zu.
»Wo ist Opa?«, fragt sie mit so zartem Stimmchen, dass mein bereits gebrochenes Herz in Scherben zerbricht.
»In dem Sarg da vorn, Schätzchen«, erkläre ich ihr zum wiederholten Male und putze mir mit einem schon benutzten Taschentuch die Nase.
Emilie schaut angestrengt in den vorderen Teil der Kirche. »In dem braunen Kasten?«, fragt sie und sieht mich mit ihren großen grünbraunen Augen von der Seite an.
»Ja, Schatz.« Ich nehme ihre Hand, während der Pfarrer das Wort ergreift.
Mum drückt meine andere Hand. Sie zittert.
Emilie rutscht auf der Bank herum, schaut zu den hellen Steinbögen und hohen Eichenbalken unter der Decke empor.
Vielleicht war es ein Fehler, die Dreieinhalbjährige mit zur Beerdigung zu nehmen, aber die Vorstellung, meine Tochter heute zu Hause zu lassen, war mir unerträglich. In gewisser Weise hilft mir die Ablenkung. Sie zwingt mich, mich zusammenzureißen.
»Ist das ein Drache?«, fragt Emilie. Ihr helles Stimmchen ist trotz der feierlichen Ansprache des Pfarrers gut vernehmbar.
»Pssst, Mäuschen!«, flehe ich sie an.
»Guck mal!« Sie weist an meiner Schulter vorbei zur linken Seite der Kirche.
Ich tue ihr den Gefallen und folge ihrem Blick zu dem Bleiglasfenster, das in der Tat einen großen goldroten Drachen zeigt, der vom heiligen Georg getötet wird. Bevor ich meiner Tochter recht geben kann, entdecke ich ihn:
Meinen George.
Vor Schreck zieht sich alles in mir zusammen.
Obwohl er den Kopf gesenkt hat, erkenne ich ihn sofort. Den ausdrucksstarken Kiefer, die hohen Wangenknochen, sein gelocktes goldbraunes Haar.
Mum lässt meine Hand los, ich schaue schnell nach vorn. Das Herz klopft wild in meiner Brust. Verdutzt registriere ich, dass Mum aufsteht, alle anderen auch. Hastig tue ich es ihr nach, und meine Finger nesteln am Begleitheft herum, während der Organist die ersten Akkorde von »Jerusalem« anschlägt.
Die versammelte Gemeinde beginnt zu singen, nur ich kann den Text nicht finden, bis Mum mir die richtige Seite vor die Nase hält.
Ihre Stimme ist schwach, zittrig und gefühlvoll. Das Lied ist einer von Dads bevorzugten Chorälen, und ich möchte ihm gerne gerecht werden – dem Lied wie meinem Vater –, doch ich bekomme keine Luft.
Emilie klettert auf die Bank, und ich muss aufpassen, dass sie nicht hinunterfällt. Plötzlich überwältigt mich eine geradezu erdrückende Sehnsucht nach Theo. Ich habe mich daran gewöhnt, allein klarzukommen, aber es gibt Zeiten, in denen ich ihn wirklich brauche könnte, und jetzt ist so ein Moment.
George ist hier. Die Erkenntnis trifft mich mit aller Wucht.
Nach so vielen Jahren.
Seine Anwesenheit löst ein Kribbeln auf meiner Haut aus. Er sitzt zwei Reihen hinter mir, und es fällt mir schwer, mich nicht umzudrehen.
Hast du mich gesehen, George? Hast du Emilie bemerkt? Weißt du von ihr, von Theo?
Gerade spricht Jamie. Ich wurde auch gefragt, ob ich etwas sagen wolle, aber ich konnte mir unmöglich vorstellen, in dieser Verfassung aufzustehen und öffentlich zu reden. Keine Ahnung, wie Jamie das schafft. Er ist so stark, so gefasst. Ich zwinge mich zur Konzentration.
»Nie erhob er die Stimme, immer war er liebevoll. Er blieb am Ball, wenn es schwierig wurde, hatte ein offenes, mitfühlendes Ohr. Er vermittelte so vielen Kindern und jungen Menschen Beständigkeit und Verlässlichkeit, aber vor allem schenkte er ihnen seine Liebe. Ohne ihn wäre ich nicht der, der ich heute bin.«
Jamie spricht weiter, doch meine Gedanken schweifen ab. Ein leises Lachen durchbricht die Trauer der Gemeinde, aber ich habe nicht mitbekommen, was Jamie gesagt hat. Ich bin betäubt, stehe unter Schock, nicht nur weil mein geliebter Vater einen tödlichen Herzinfarkt draußen auf dem Feld erlitt. Wie konnte er ganz allein sterben, nachdem er sein Leben lang für andere da war?
Bei dem Gedanken übermannt mich der Kummer. Mum drückt wieder meine Hand, ihr Körper erbebt unter abgehackten Schluchzern. Emilie klettert auf meinen Schoß und schlingt ihre weichen Ärmchen um meinen Hals.
Oben am Stehpult fängt Jamie meinen Blick auf, und sein Gesicht verzieht sich. Er bricht ab, sieht nach unten, und auf einmal ist es, als würde die ganze Gemeinde mit uns die Fassung verlieren.
Der Empfang nach der Beerdigung findet in Dads Lieblingspub neben der Kirche in Masham statt, wo er an den beiden wöchentlichen Markttagen mit seinen Freunden immer ein Glas Bier trank: mittwochs ein Theakston’s Old Peculier und samstags ein Black Sheep Bitter. Er mochte sich nicht zwischen den beiden Brauereien der Stadt entscheiden, wollte nichts und niemanden begünstigen, nicht mal, wenn es um Bier ging.
Heute sind noch mehr Menschen da als auf Mums und Dads Party vor zwei Jahren, nur von George fehlt jede Spur. Schon als Jamie und die anderen Sargträger Dad in den Boden hinabließen, konnte ich ihn nirgendwo entdecken. Vielleicht hielt er sich aber auch nur im Hintergrund.
Ich frage mich, woher er von der Beerdigung wusste.
Ich gehe mit Emilie zur Toilette, und während sie sich die Hände wäscht, werfe ich einen kurzen Blick auf mein trauriges Spiegelbild über dem Waschbecken. Als ich vor wenigen Wochen beim Friseur war, war ich sehr zufrieden mit meinem Haar – ich fühlte mich wieder wie ein Mensch –, doch jetzt wirkt der hellere Ton zu blass im Vergleich zu meinem verquollenen roten Gesicht, und durch die neue Länge scheinen die nun zwischen Kinn und Schultern endenden Haare schlaff. Zum ersten Mal seit über zwei Jahren trage ich wieder schwarz – dasselbe Kleid, das ich an jenem Abend anhatte, den ich am liebsten für immer vergessen würde. Damals sagte Theo, ich sähe super darin aus. Ich konnte mich einfach nicht überwinden, es wegzuwerfen.
Ich fühle mich alles andere als schön. Der Stoff hängt an mir herab, in bin in jeder Hinsicht geschrumpft, nicht nur körperlich.
Ich wende den Blick vom Spiegel ab, trockne meiner Tochter flüchtig die Hände und führe sie aus dem Toilettenraum.
»… betrunken einen Unfall gehabt«, sagt eine Frauenstimme.
Schlagartig bleibe ich stehen.
An der Theke stehen drei Freundinnen, ungefähr in meinem Alter. Sie haben die Köpfe zusammengesteckt, Tratschtanten, wie sie im Buche stehen.
»Er hat nur fünf Jahre bekommen«, sagt eine.
»Das ist ja unfassbar! Fünf Jahre für zwei Menschenleben?«
»Drei, wenn man das ungeborene Kind der schwangeren Mutter dazuzählt«, meldet sich die dritte Frau zu Wort.
»Offensichtlich kann er schon in zweieinhalb Jahren raus …«
Sie empören sich heftig, dann verstellt mir Jamie die Sicht auf die drei. Er dreht sich um und ruft ihnen zu: »He! Das gehört hier heute nicht hin, ja?«
Das kleine Grüppchen verstummt. Eine Frau späht an meinem Ziehbruder vorbei und macht große Augen. Jetzt erkenne ich sie – wir sind zusammen zur Schule gegangen, waren aber nicht näher befreundet.
»Entschuldigung«, murmelt sie.
Sie und ihre Freundinnen nehmen ihre Gläser und Handtaschen und verziehen sich nach draußen auf die Terrasse.
»Alles in Ordnung?«, fragt Jamie und legt mir die Hand auf die Wange.
Ich nicke zitternd.
»Darf ich auf deinen Arm, Onkel Jamie?«, fragt Emilie zuckersüß.
»Soll ich dich wirklich hochheben?«, gibt er mit gespieltem Erstaunen zurück. »Soll ich dich hochheben und mir dabei den Rücken brechen?«
Sie nickt eifrig und strahlt.
»Du bist schon so groß! Ich weiß nicht, ob ich das noch kann.« Er bückt sich stöhnend, als sei es eine enorme Anstrengung, meine Tochter auf den Arm zu nehmen. Dann tut er so, als ließe er sie fallen, Emilie kreischt lachend, und der Schmerz lockert ein wenig seinen Griff um mein Herz.
Plötzlich sieht Jamie an mir vorbei und zieht die Augenbrauen hoch. Ich schaue mich über die Schulter um und entdecke George, der sich unter der Eingangstür hindurchduckt und den Pub betritt. Er richtet sich auf, sein Blick hält meinen fest, dann verschwimmt alles um mich herum.
Ich fand ihn früher schon groß, aber damals war er im Jugendalter, und jetzt ist er ein Mann, mindestens eins neunzig groß, mit einem perfekten Körperbau, langen Gliedmaßen und breiten Schultern in einem gut sitzenden dunkelgrauen Anzug.
»George!«, grüßt Jamie, und Georges dunkle Augen wandern zu meinem Ziehbruder hinüber.
»Jamie«, sagt er mit schwerer, tiefer Stimme, die noch schwerer und tiefer als früher wirkt. Er streckt die Hand aus.
Jamie ergreift sie. »Schön, dich zu sehen.«
George nickt und sieht mich wieder an.
»Hallo, Leah.« Seine Worte bringen meinen gesamten Körper zum Summen.
Ich schlucke und starre ihn an, doch nach all den Jahren, nach allem, was ich sagen wollte, finde ich keine Worte.
»Und das ist Emilie«, füllt Jamie das Schweigen. »Das ist George«, sagt er mit hoher Stimme zu meiner Tochter. »George hat mit uns bei Gramps und Nanna gewohnt.«
Jamie war damals schon fast achtzehn, kurz davor, aus dem Pflegesystem entlassen zu werden. Und eigentlich war das Haus viel zu voll: zwei kleine Schwestern und die dreizehnjährige Joanne teilten sich ein Zimmer, dazu Preston mit seinen vierzehn Jahren und Jamie in dem anderen Zimmer. Ich war natürlich auch noch da, in meinem winzigen Raum nur für mich, um den mich Joanne beneidete. Sie hasste es, sich ein Zimmer mit anderen zu teilen.
Es war wirklich kein Platz für George, aber die Sozialarbeiterin hatte sich keinen anderen Rat mehr gewusst, hörte ich Dad zu Mum sagen.
»Sie hat gefragt, ob er nicht im Büro schlafen kann, bis Prestons Bett frei wird.«
»Hast du ihr nicht gesagt, wir hätten gerne eine längere Übergangszeit für Preston?«
Der Junge würde bald zu seiner Mutter zurückkehren, doch meine Eltern waren alles andere als überzeugt, dass das langfristig gutgehen würde.
»Habe ich, und dann hat sie gefragt, wie es mit Jamie weitergeht«, erwiderte Dad. »Ich habe ihr gesagt: ›Auch wenn er bald achtzehn wird, heißt das trotzdem nicht, dass wir ihn rauswerfen.‹«
»Wie alt ist George?«, fragte Mum.
»Fünfzehn. Er wäre in Leahs Jahrgang.«
»Hm, nicht ideal.«
»Wir wären schon seine vierte Pflegestelle«, fügte Dad hinzu. »Die Sozialarbeiterin meint, es wäre gut für ihn, wenn er aus der Stadt rauskäme.«
Ich marschierte in die Küche. »Sagt ihm bloß nicht wegen mir ab«, blaffte ich und holte eine Tüte Mikrowellen-Popcorn aus der Speisekammer. »Was macht schon einer mehr?«
Meine Eltern schwiegen, bis ich wieder draußen war.
Kurze Zeit später ging ich zu Becky. Es war der letzte Tag der Osterferien, wir hatten einen Tag länger frei, weil die Lehrer eine Fortbildung hatten, was uns erst an dem Tag wieder einfiel. Es war auch der letzte Tag in meinem Leben ohne George. Meine Eltern gaben, wie zu erwarten, dem Druck seiner Sozialarbeiterin nach, und als ich abends nach Hause kam, war er bereits da.
Ich hatte keine Vorstellung, wie wichtig er noch für mich werden würde. In den darauffolgenden Monaten sollte ich ihm mein Herz schenken, und er sollte es brechen.
Jetzt ist er wieder da, und ich fühle mich so offen, so verletzlich und ungeschützt wie damals, als er verschwand.
2.
Damals
»Wir sehen uns im Bus!«, rufe ich Becky zu, die mir von ihrem Zimmerfenster aus nachwinkt.
»Tschüs!«, ruft sie zurück und grinst. Wie immer wartet sie, bis ich durch das Feldtor gegangen bin, bevor sie sich an die Hausaufgaben macht.
Es ist ein wunderschöner Morgen. Wir zwei wurden in der Morgendämmerung vom Gesang der Vögel geweckt. Sie waren so laut, dass es klang, als seien sie bei uns im Zimmer. Tatsächlich haben sie auch allen Grund zur Freude: Der Himmel ist kornblumenblau, die tief stehende Aprilsonne wirft meinen Schatten vier Stockwerke hoch auf die überfrorenen Hänge. Die Wettervorhersage hat für heute zweiundzwanzig Grad angekündigt. Nach dem verregneten Osterfest habe ich blendende Laune. Wochenlang hatten wir nichts als grauen Himmel und Nieselregen.
Am Vorabend hatten wir enorm viel Spaß. Es war das erste Mal, dass ich während der Schulzeit auswärts geschlafen habe. Eigentlich hatte Mum mir eine Nachricht geschickt und mich gebeten, früher nach Hause zu kommen – sie hätten sich entschieden, den Jungen aufzunehmen, von dem sie schon gesprochen hätten, sie wolle etwas Besonderes kochen.
»Himmel nochmal!«, hatte Becky gerufen, als die Nachricht eintraf. »Bei euch gibt es ständig Willkommensessen!«
Ich wollte bei Becky bleiben. Ich wusste, zu Hause wären alle nervös; der Neuankömmling würde wahrscheinlich mit Sachen um sich werfen, irgendwas kaputt machen oder gar nichts essen wollen. Mit Sicherheit wäre die Stimmung im Haus schrecklich.
Ich gab nach und rief Mum an. »Kann ich nicht hierbleiben? Ich würde die Osterferien gerne mit etwas Schönem abschließen.«
Nicht mit irgendwelchem Ärger, der zu Hause auf mich wartete.
Den Satz verkniff ich mir, dennoch hörte Mum ihn laut und deutlich heraus.
Sie gab nach – es war eine bescheidene Bitte –, und ich versuchte den Rest des Abends, die leise Enttäuschung in ihrer Stimme zu vergessen.
Es ist nicht so, als hätte ich nichts für meine Ziehgeschwister übrig, aber manchmal, nur hin und wieder, würde ich auch gern mal an erster Stelle stehen.
In meinen Gummistiefeln stapfe ich über die gefrorene Wiese, vorbei an auftauenden Kuhfladen und durch sumpfige Mulden, wo zu viele Tiere gestanden haben. Beckys Familie gehört die benachbarte Rinderfarm, und deren Herde richtet auf den Feldern deutlich mehr Schaden an als unsere.
Als wir vor acht Jahren von London nach North Yorkshire zogen, legten sich meine Eltern sieben Alpakas zu. Inzwischen ist die Herde auf sechsundzwanzig angewachsen, doch die weichen, gepolsterten Klauen der Tiere und ihre Neigung, sich immer an derselben Stelle zu erleichtern, schont die Böden.
Ich sehe, dass einige Alpakas auf der oberen Weide grasen. Auf der anderen Seite des Hofs sind die Jungs – selbst meine Eltern können sich nicht überwinden, sie Hengste oder machos zu nennen, wie sie auf Spanisch heißen. Für uns sind es Jungs und Mädels, nur ihren Fohlen geben wir die richtige Bezeichnung: cria.
Liebevoll lächele ich zu unseren Mädels hinüber. Sie sind so hübsch. Ich verstehe nie, warum manche Leute den Aufwand betreiben, Alpakawolle zu färben. Ihre natürlichen Farben sind wunderschön: weiß, beige, hellbraun, dunkelbraun, grau, schwarz und alle Töne dazwischen.
Margerite tollt mit Mistel herum, ihr schneeweißes Fell leuchtet in der Sonne und setzt sich stark vom glänzenden Schwarz ihrer Spielkameradin ab. Die beiden wurden im vergangenen Juni geboren, zusammen mit dem violettgrauen Majoran. Er steht inzwischen bei den anderen Jungs und scheint sich gut einzuleben. Männchen und Weibchen müssen ab einem gewissen Alter getrennt gehalten werden, um ungewollte Paarungen zu verhindern, auch wenn ich es immer furchtbar finde, wenn die Kleinen von ihren Müttern getrennt werden.
Ich betrete unser Grundstück und schaue hinauf zum Hügel in der Ferne, wo das grüne Gras unserer Felder einem schrofferen, felsigeren Gelände weicht. Wir wohnen an den Ausläufern der Brimham Rocks in North Yorkshire, einem »Gebiet von außerordentlicher natürlicher Schönheit«, wie mein Dad nie müde wird zu betonen. Die größte Felsformation ist etwas weiter entfernt, aber mir ist das Randgebiet eh lieber, abseits der Touristen. Manchmal wandere ich dort hoch, um meine Ruhe zu haben.
»Bin wieder da!«, rufe ich, als ich durch die Küchentür ins Haus komme, auch wenn ich bezweifele, dass mich bei Nias Geschrei jemand hört. Ich nehme an, dass sie es ist, die so laut brüllt, nicht ihre ältere Schwester. Ashlee ist drei, aber sie ist ein zurückhaltendes, stilles Mäuschen. Ich mag nicht daran denken, warum sie so wurde. Meine Eltern ersparen mir die genauen Umstände, und meiner geistigen Gesundheit zuliebe frage ich meistens auch nicht nach.
Ich laufe nach oben in der Hoffnung, dass das Badezimmer, das ich mir mit den anderen Mädchen teile, leer ist, denn ich muss mir wirklich dringend die Haare waschen. Natürlich ist es besetzt.
»Dauert es noch lange?«, rufe ich durch die Tür.
Es kommt keine Antwort, oder ich kann sie nicht hören, weil Nia so laut heult.
»Joanne!«, rufe ich, weil ich davon ausgehe, dass die Dreizehnjährige das Bad in Beschlag nimmt. »Wie lange brauchst du denn? Ich muss mir vor der Schule noch die Haare waschen!«
»Ich wasche mir die Haare«, schreit sie wütend zurück.
Mit Sicherheit benutzt sie mein Lieblingsshampoo. Und mit Sicherheit gibt es kein heißes Wasser mehr, wenn ich endlich dran bin.
Ich hätte bei Becky duschen sollen. Die älteren Brüder meiner Freundin sind beide schon aus dem Haus, sie hat ein Badezimmer für sich allein. Dafür würde ich morden.
»Geh in unser Bad«, mischt Mum sich ein, die mit Nia auf dem Arm in der Tür zum Zimmer der drei Mädchen erscheint. Beruhigend massiert sie den Rücken des acht Monate alten Babys, und das Schreien scheint ein wenig nachzulassen.
Ich stapfe in mein Zimmer und hole meine Sachen samt Handtuch. Glücklicherweise habe ich mir längst angewöhnt, alles bei mir aufzubewahren. Dann gehe ich zum Schlafzimmer meiner Eltern.
»Freut mich auch, dich zu sehen«, brumme ich vor mich hin. »Ich hatte einen schönen Tag, danke der Nachfrage.«
Als ich endlich nach unten komme, bin ich spät dran, zu spät fürs Frühstück. Ich hatte auch keine Zeit mehr, meine langen Haare zu föhnen, bevor ich sie geflochten habe. Von den hellbraunen Spitzen tropft es auf meine Jacke.
In der Küche herrscht Chaos, Lunchpakete werden vorbereitet, Schultaschen ausgeleert und neu gepackt. Joanne und Preston streiten sich um die letzte Chipstüte mit Essiggeschmack, und mittendrin streicht mein Vater Butter auf Sandwiches und versucht, den Streit zu schlichten, bevor er eskaliert. Jamie sitzt mit der jetzt lachenden Nia da und wippt sie auf den Knien. Gleichzeitig ermuntert er Ashlee, ihren Porridge zu essen. Ich suche Mum und entdecke sie auf Knien nebenan im Wohnzimmer.
»Es tut mir leid, George«, sagt sie. »Du bist eben viel größer als Jamie. Wir kaufen dir heute Nachmittag was Neues.«
Sie steht auf. »Alle fertig?«, ruft sie und marschiert in die Küche. »Der Bus kommt in einer Minute! Ab nach draußen!«
»Leah, hast du was gegessen?«, fragt Dad. Zwei Sandwichscheiben springen aus dem Toaster, Jamie gibt Nia an Mum weiter.
»Nein, aber macht nichts.«
»Schnell, nimm das hier!« Rasch streicht er Butter und selbstgemachte Brombeermarmelade auf eine Brotscheibe.
»Danke, Dad«, sage ich erleichtert und stelle den Rucksack auf die überfüllte Arbeitsfläche, während die älteren Kinder lärmend aus der Küche auf den Hof laufen. Mit dem Toast zwischen den Zähnen stopfe ich meine Butterbrotdose und die Wasserflasche in den Rucksack, ziehe den Reißverschluss zu und schwinge ihn mir mit einer Drehung auf den Rücken.
Ein großer schmaler Junge steht in der Küche.
»Brauchst du Hilfe bei deiner Krawatte?«, fragt Dad ihn.
Sie hängt ihm um den Hals, noch nicht gebunden.
George schüttelt den Kopf.
Mein Vater stopft ein Sandwich, eine Dose Cola und eine Chipspackung in eine weiße Papiertüte und hält sie George hin. »Falls du keine Lust auf die Schulkantine hast«, sagt er.
Als George die Tüte entgegennimmt, sehe ich nach unten, und da wird mir klar, warum Mum eben im Wohnzimmer auf den Knien herumgerutscht ist: George trägt Jamies zweite Schuluniform, und die Hosenbeine sind mindestens sieben Zentimeter zu kurz, obwohl Jamie fast drei Jahre älter ist als der Neue. Mum hat den Saum herausgelassen, trotzdem hat George Hochwasser und jetzt zusätzlich eine Falte rundherum.
Als ich wieder hochschaue, starrt George mich an. Er wirkt wütend. Sein Kiefer ist vorgeschoben, in seinen dunklen Augen flackert Hass.
Mir rutscht das Herz in die Hose.
»Ach, George, das ist Leah!«, ruft Mum und schaukelt Nia auf ihrer Hüfte. »Los mit euch beiden, ihr könnt euch im Bus unterhalten.«
Mit diesen Worten schiebt sie mich nach draußen.
Ich werfe George einen Seitenblick zu, doch der marschiert vor, den anderen hinterher.
Der Bus biegt um die Ecke, ich stopfe mir schnell den restlichen Toast in den Mund und lege einen Schritt zu. Ich steige als Letzte ein, weil ich weiß, dass Becky mir einen Platz frei hält. Grinsend winkt sie mir zu; ich stapfe hinter George her. Er nimmt den ersten freien Platz, der sich ihm bietet, direkt in der Reihe vor meiner Freundin. Im Vorbeigehen versuche ich, seinen Blick aufzufangen, um ihm ein freundliches Lächeln zuzuwerfen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich vorher auf seine kurze Hose gestarrt habe, doch er hat sich schon zum Fenster gewendet und schaut hinaus.
Seufzend lasse ich mich auf den Sitz neben Becky fallen.
»Ein Neuer?«, flüstert sie.
»Pst!«, zische ich.
»Ganz schön heiß.«
Ich sehe sie von der Seite an, die Augen mahnend weit aufgerissen.
Becky kichert. »Was ist? Tut mir leid, aber ist er nun mal.«
»Er ist sauer«, flüstere ich.
»Nichts Neues.«
»Nee«, bestätige ich trocken.
»Alles klar, er hört Musik«, bemerkt Becky, und durch den Spalt zwischen den Sitzen vor uns erkennen wir eine weiße Kopfhörerschnur, die zu Georges Ohren führt.
»Was hat er denn Schlimmes erlebt?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
Seit unserem siebten Lebensjahr sind Becky Norton und ich beste Freundinnen, als ich mit meinen Eltern von London nach North Yorkshire zog. Damals war sie eine kleine Rabaukin, immer von Kopf bis zu den Füßen schmutzig. Wir schlossen Freundschaft in den Sommerferien, als sie sich tagelang nicht kämmte. Ihre Haare waren so lang wie jetzt, schokoladenbraun, dick und unbändig. Im Verlauf der Ferien wurden sie immer wilder und zerzauster, weshalb ich Becky kaum wiedererkannte, als sie zum Schulbeginn mit glatten, gepflegten Haaren im Bus saß.
Beckys Eltern, Veronica und William, gehörten zu den wenigen Familien im Ort, die uns freundlich aufnahmen, als wir herzogen. Meine Eltern hatten bereits für einen kleinen Aufruhr gesorgt, weil sie die Schafe verkauft hatten, die zum Hof gehörten, und sich stattdessen Alpakas zulegten. Was die örtlichen Bauern betraf, waren wir nicht ernst zu nehmende Hobbyfarmer. Ehrlich gesagt belächelten sie uns, doch die Stimmung wurde noch mal deutlich schlechter, als meine Eltern die ersten Pflegekinder aufnahmen. Ich erinnere mich noch, dass Mum sagte, es wäre so gut wie unmöglich, einen Babysitter zu finden. Es gab nicht viele Kinder, die mit mir spielten oder mich zu ihrem Geburtstag einluden.
Dass es sich bei den Kindern, die meine Eltern aufnahmen, fast ausnahmslos um aggressive, problembeladene Jugendliche handelte, war auch nicht gerade hilfreich. Durch die Erfahrungen in diesem Bereich – Mum war früher Sozialarbeiterin, Dad Angestellter am Familiengericht – wussten sie, dass jüngere Teenager am schwersten unterzubringen sind. Leichter geht es bei älteren Kindern, die bald aus dem Pflegesystem entlassen werden, und bei kleinen, die im Allgemeinen als händelbarer angesehen werden. Es gibt einen eklatanten Mangel an Pflegefamilien, die bereit sind, jüngere Heranwachsende mit ihren Ängsten und ihrem außer Kontrolle geratenen Hormonhaushalt aufzunehmen, ganz zu schweigen von ihren Gefühlsausbrüchen. Von den unvorstellbaren emotionalen Traumata, unter denen diese Jugendlichen leiden, will ich gar nicht anfangen. Die seelischen Verletzungen schlagen sich natürlich in unvorhersagbarem Verhalten nieder, mit dem viele Pflegeeltern Probleme haben, was dazu führt, dass unzählige junge Menschen weitergeschoben werden und schließlich im Kinderheim landen.
Meine Eltern wollten sich auf speziell diese Kinder konzentrieren. Sie waren fest entschlossen, ihnen ein langfristiges, zuverlässiges Heim zu bieten, das nicht bei der ersten Hürde in sich zusammenfiel.
Ich bewundere sie für ihre Entscheidung und respektiere sie, aber es gibt auch Zeiten, in denen ich es ihnen wirklich übel nehme.
Die Jugendlichen, die zu uns kommen, brauchen meine Eltern mehr als ich. Das ist so. Aber manchmal brauche ich sie auch, und dann sind sie nicht immer emotional verfügbar. Es ist schwer, sie zu teilen.
»Hat der Bus ein Problem?«, fragt Becky verwirrt, als wir vor einem Torhaus halten, das wir vom Sehen kennen, zurückgesetzt zwischen großen Lorbeerbüschen und einem hohen schmiedeeisernen Zaun. Ich beuge mich an Becky vorbei und erhasche einen Blick auf die hohen weißen steinernen Torpfosten.
Wenn man durch das Tor geht und der sich windenden Straße ungefähr eine halbe Meile folgt, vorbei an wogenden grünen Feldern, in denen hier und da alte Eichen stehen und Rotwild äst, gelangt man zu einem der schönsten Landhäuser in dieser Gegend. Das weiß ich, weil ich mit meinen Eltern einmal dort war.
Die Bustüren öffnen sich mit einem Zischen, und ehe wir verstehen, was los ist, taucht ein Junge in unserer Schuluniform auf.
Seine kinnlangen Haare sind fast schwarz, die Augenbrauen gleichen dunklen Strichen in seinem blassen, kantigen Gesicht. Die Augen haben das tiefe Blau des Ozeans.
»Ja, wer hätte das gedacht?«, flüstert Becky mir zu, als der Junge dem Fahrer seine Busfahrkarte zeigt und den Gang hinunterkommt.
Meine Freundin ist nicht die Einzige, die sich fragt, was der reiche, hochnäsige Internatszögling Theo Whittington in unserem staatlichen Schulbus zu suchen hat.
Theo ignoriert das Getuschel und lässt seine schmale Gestalt auf den leeren Sitz direkt vor mir sinken. Warum er sich ausgerechnet dort hinpflanzt, ist mir schleierhaft – George neben ihm vermittelt mit seiner Körpersprache sehr deutlich, dass er nicht gestört werden will.
Der Bus fährt wieder an, das Geschnatter steigt um mehrere Dezibel.
»He!«, ruft jemand von hinten. »He, du da!«
»Und es geht los«, seufzt Becky.
»He, Schnösel!«, erschallt der nächste Ruf.
Zwischen den Sitzen kann ich sehen, dass George Theo Whittington einen fragenden Blick zuwirft, der jedoch starrt ungerührt geradeaus.
»Was hast du in unserem Bus zu suchen?«, ruft jemand.
»Hör auf, Pete!«, höre ich Jamies genervte Stimme.
»Was stimmt nicht mit dir?«, fragt Pete. »Ich will nur wissen, warum der eingebildete Fatzke mit unserem Bus fährt!«
»Geht dich ja wohl nichts an, oder?«, gibt Jamie zurück.
Da hält Pete den Mund.
Vorerst.
Theo will als Erster raus. Er steht auf und läuft im Bus nach vorn, noch ehe der die Haltestelle erreicht hat und zum Stehen gekommen ist. Der Fahrer murrt, aber Theo sagt kein Wort der Entschuldigung, sondern wartet nur, dass die Türen sich öffnen. Ich beobachte durchs Fenster, wie er auf das Schulgebäude zumarschiert. Ich bin so abgelenkt, dass ich von hinten gegen George pralle, der aus seiner Sitzreihe rutscht.
Er erstarrt.
»’tschuldigung!«, stoße ich erschrocken aus.
»Nach dir«, sagt er mit übertriebener Höflichkeit, ja sarkastisch.
»Nein, geh du vor.«
Meine Stimme ist ausdruckslos, aber ich werde mich auf gar keinen Fall vor ihm in Bewegung setzen. Vielleicht spürt er meine Entschlossenheit, denn er richtet seinen langen Körper auf, ohne noch etwas zu sagen, und reckt sich. Sein Blazer ist auch an den Armen zu kurz, darum müssen sich meine Eltern wirklich schnell kümmern.
Mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern springt George aus dem Bus. Einige Schritte weiter bleibt er stehen und betrachtet das breite flache Gebäude, das sich vor uns erstreckt, dunkelgrau vor dem leuchtend grünen Gras des Hügels dahinter.
Ich bleibe neben ihm stehen. »Ich kann dich zum Sekretariat bringen«, biete ich an.
»Brauchst mir nur die Richtung zu zeigen«, brummt er, ohne mich anzusehen.
»Ich bringe dich hin«, beharre ich in Hoffnung auf einen Neuanfang zwischen uns. »Hier entlang.« Ich steuere auf den Empfang zu und gehe davon aus, dass er mir folgt. »Sagst du Mr. Balls Bescheid, dass ich mich um ihn kümmere?«, rufe ich Becky über die Schulter zu.
»Mach ich«, erwidert sie.
George grinst höhnisch.
»Egal, was für einen Spruch du auf der Zunge hast, er hat sie alle schon gehört.«
»Armer Kerl.«
»Warte ab, ob er dir immer noch leidtut, wenn er dich in Geschichte volllabert.«
Den Rest des Weges legen wir schweigend zurück, doch nach unserem kleinen Austausch fühle ich mich schon ein wenig besser.
Theo wartet auch bereits am Empfang. Ich will George bei ihm lassen, da entdeckt mich Miss Chopra, die Schulleiterin. »Ah, Leah!«, ruft sie erfreut. »Könntest du Theo zu Mr. Balls mitnehmen?«
»Klar«, antworte ich und schaue zu Theo in der Hoffnung, dass er ebenso auf den Namen unseres Klassenlehrers anspringt wie George. Doch mir schlägt nichts als kühle Ablehnung entgegen.