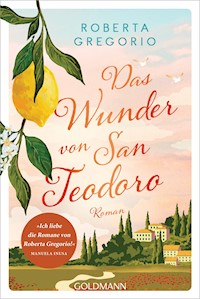6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Romane für den Sommer und Urlaub
- Sprache: Deutsch
Tosca liebt ihr Leben in Mareblu, einem alten Fischerdorf in Süditalien. Jeden Morgen sammelt sie am Strand die schönsten Beutestücke für ihre kleinen Kunstwerke, die sie in die ganze Welt verschickt. Ihr Häuschen am Meer ist dafür einfach perfekt gelegen. Und was könnte schöner sein, als ihrer wunderbaren Tochter Ioio beim Aufwachsen zuzusehen? Erst als nebenan der geheimnisvolle Moreno einzieht, wird Tosca schmerzhaft bewusst, dass ihr idyllisches Dasein vielleicht doch ein bisschen einsam ist ...
Turbulent, warmherzig und voller Lebensweisheiten - die perfekte Urlaubslektüre für alle Italien-Fans.
Alle Geschichten dieser Reihe zaubern dir den Sommer ins Herz und bringen dir den Urlaub nach Hause. Die Romane sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Postkarten aus Mareblu
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagramund Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Tosca liebt ihr Leben in Mareblu, einem alten Fischerdorf in Süditalien. Jeden Morgen sammelt sie am Strand die schönsten Beutestücke für ihre kleinen Kunstwerke, die sie in die ganze Welt verschickt. Ihr Häuschen am Meer ist dafür einfach perfekt gelegen. Und was könnte schöner sein, als ihrer wunderbaren Tochter Ioio beim Aufwachsen zuzusehen? Erst als nebenan der geheimnisvolle Moreno einzieht, wird Tosca schmerzhaft bewusst, dass ihr idyllisches Dasein vielleicht doch ein bisschen einsam ist …
Roberta Gregorio
Sommer in Mareblu
Verbringe ein paar Wochen in einem ruhigen Strandhaus!
Kapitel 1
Tosca hatte miserabel geschlafen. Sie bekam ihre Augen kaum auf. Richtig geschwollen fühlten sie sich an, und sie wollte gar nicht wissen, wie sie nach der endlos langen Nacht aussah, die sie damit verbracht hatte, sich im Bett hin und her zu wälzen. Wie ein Stück Fleisch auf dem Rost, überlegte sie und verschluckte sich. Weil ihr kein Lachen aus der Kehle steigen wollte. Da half auch Ironie nicht. Und Sarkasmus erst recht nicht. Jedenfalls heute nicht. Denn sogar der Himmel war seltsam verhangen; der kurze Blick durchs Fenster hatte ihre Befürchtung bestätigt.
Diesig.
Passend zur Laune.
Wo kam diese schlechte Laune überhaupt her? Wie hatte sie sich in ihr Bett geschlichen? Und wieso? Tosca hatte sie nicht hereingebeten. Schon gar nicht erwartet. Gestern war noch alles gut gewesen. Sie seufzte müde, überlegte, den Kopf wieder unter das Kissen zu stecken, so lange, bis die Welt um sie herum ein freundlicheres Gesicht machte. Aber es brachte ja nichts. Wahrscheinlich würde sie gerade jetzt in den heiß ersehnten Schlaf fallen und vollkommen die Kontrolle über Tag und Nacht und ihr Leben allgemein verlieren. Da konnte sie genauso gut aufstehen.
Mit vorgetäuschtem Elan warf sie die Decke zurück. Die Mobiles, die über ihrem Bett hingen, bewegten sich im dabei erzeugten Luftzug und schienen ihr klappernd einen guten Tag wünschen zu wollen. Auf unerklärliche Weise tröstete sie dieses vertraute Geräusch. Wenngleich sie sich gar nicht bewusst gewesen war, überhaupt Trost zu brauchen.
Sie zog mit knackenden Gelenken eine leichte Wolljacke über, stieg in ihre Flip-Flops, die schon mal bessere Tage erlebt hatten, und schlurfte durch den Flur zur Küche. Flop-flop machten ihre Schritte dabei, obwohl die Sohlen vom vielen Tragen schon ganz dünn waren. 27 Schritte legte sie zurück. Sie zählte sie manchmal. Das half beim Wachwerden. Oder in diesem Fall beim Wachbleiben.
Durch die große Fensterfront in ihrer hellen Küche konnte sie direkt auf den angrenzenden Strand und das Meer blicken. Sie liebte den Ausblick. Weil er jeden Tag anders war. Das Meer zeigte sich mal ruhig, mal wild, mal blau, mal grün. Wie in einem Gemälde, das sich jeden Tag neu zusammensetzte. Und doch empfand sie, egal wie das Meer sich präsentierte, immer das gleiche Gefühl, wenn sie es betrachtete: Hoffnung. Endlose, unerschöpfliche Hoffnung.
Am Abend zuvor hatten sich die Wellen noch überschlagen. Jetzt war es schon viel sanfter. Der Mond hatte bestimmt seine magische Kraft eingesetzt, um die Wogen zu glätten. Was auch erklären würde, warum sie kein Auge zugetan hatte. Ja. Sie war so ein Mensch, der sich vom Mond beeinflussen ließ. Aber auch von der Sonne, dem Wind, dem Regen. Ihre Mutter hatte sie deshalb früher oft strega, also Hexe, genannt. Und, nein, das hatte ihre Mutter nicht nett gemeint …
Tosca wickelte die Strickjacke noch enger um ihre Taille – ihr fröstelte immer, wenn sie an ihre Mutter dachte – und ging zur Hintertür, um ins Freie zu gelangen. Es fühlte sich an diesem Morgen ein bisschen wie eine Flucht an. Eine Flucht vor ihren Gedanken, die nun plötzlich um ihre Mutter kreisten. Ihre Mutter besaß die Macht, in ihr eine schlimme Klaustrophobie zu wecken. Selbst auf Distanz. In Wirklichkeit aber vollendete Tosca auch heute nur wieder ihr morgendliches Ritual. Denn am Gartentürchen hing ihr blauer Eimer, der bereits auf sie zu warten schien. Ihr Freund und Begleiter. Und damit machte sie sich auf den Weg. Dem Meer entgegen, das sie wie ein Magnet anzog.
Ein paar Minuten nur, höchstens ein halbes Stündchen. Nicht viel länger wollte sie bleiben. Denn erstens hatte sie im Hinterkopf, dass sie in der Früh noch etwas zu erledigen hatte – wenn ihr auch nicht einfallen wollte, was. Und zweitens war Frühsommer. Da kamen ab und an schon vereinzelte Touristen an ihren einsamen, abgelegenen Strand. Und sie wollte nicht unbedingt zwischen Badehandtüchern Slalom laufen. Das war nicht ihre beste Disziplin.
Obwohl es etwas früher war als sonst, ertappte sie sich dabei, sich an der frischen Luft zu erfreuen, die unverkennbar nach Algen, Wasser, Fisch, Unendlichkeit, Salz und Sand roch. Diese magische Mischung, die besser war als jede Medizin. Sie konnte sich glücklich schätzen, hier zu leben und zu arbeiten. Meistens war sie das auch. Nur manchmal, da verspürte sie Nostalgie. Als gäbe es da ein parallel entwickeltes Leben, eine bessere Version ihrer selbst, nach der sie sich sehnte. Je nach Wetter eben. Tosca schüttelte den Kopf, weil sie ihrer Mutter mit dieser Erkenntnis indirekt recht gab. Was ihr gar nicht passte.
Warum ihre Mutter heute so präsent in ihren Gedanken war, auch darüber wollte sie sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Sie hatte nämlich alle Hände voll damit zu tun, ihr langes Haar hinter die Ohren zu stecken, das der Wind wieder und wieder zerzauste, wie in einer endlosen, vertrauten Neckerei zwischen Freunden.
Die erste Muschel entdeckte sie trotzdem schon von Weitem. Dann die zweite und die dritte. Sie sammelte sie alle auf, rieb vorsichtig den Sand weg und legte sie in den Eimer. An guten Tagen fand sie an die zwanzig Muscheln. Damit konnte sie dann ihren Schmuck herstellen. Oder Einrichtungsgegenstände verschönern. Das kam ganz darauf an, wohin ihre Kreativität sie leitete. Oft spuckte das Meer aber auch wundervolles Treibholz aus. Was für ein Fest, wenn sie mal knorrige Wurzeln fand! Manchmal so große, dass sie Hocker oder Tische draus machen konnte. Sie suchte den Strand ab – vergaß dabei komplett die Zeit –, hoffte, fand aber nur kleine Stöcke, die sie trotzdem alle in den Eimer legte. Nach und nach. In mühsamer Kleinarbeit. Diese Kleinarbeit erlaubte ihr, wie immer, sich völlig zu verlieren. Sich ein bisschen in Wind zu verwandeln. Oder in Sand. Sich dem Umfeld anzupassen. Die Grenzen aufzulösen. Sie liebte diesen Zustand der Schwerelosigkeit, ja, fast Unsichtbarkeit. Wer wäre nicht gern unsichtbar, wenn das Meer in seiner Unendlichkeit neben ihm erstrahlte?
»Ma!«
Eine wohlbekannte Stimme erreichte sie schwach – die einzige, die Tosca immer und überall erreichen würde. Denn diese Stimme trotzte sogar Wind und Meer.
Tosca blickte zum Haus zurück, wo sie ihren Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt entdeckte: Iolanda, ihre Tochter.
Tosca winkte ihr zu. Iolanda stand an der Tür, stapfte mit dem Fuß auf. Zeigte demonstrativ auf ihre Armbanduhr, woraufhin Tosca vor Schreck beinahe den fast komplett gefüllten Eimer fallen ließ. Sie hatte es verpasst, ihre Tochter rechtzeitig zu wecken, oder? Und Iolanda hatte am Vorabend noch extra darum gebeten, weil sie früher als sonst rausmusste!
»Komme!«, rief sie und eilte los. Gegen den Wind, in ergebener Erwartung der ersten Standpauke des Tages.
»Ma-aaaaaa! Weißt du, wie spät es ist?«, erkundigte sich ihre Tochter auch gleich vorwurfsvoll, als Tosca das Haus erreichte. Atemlos, aufgewühlt. Noch immer gegen den Wind und gleichzeitig irgendwie gegen sich selbst kämpfend.
Nein. Das wusste sie nicht. Eben noch war es weit vor 7.00 Uhr gewesen … keine Ahnung. Sie trug nie eine Uhr und hatte ein miserables Zeitgefühl. Doch sie war trotzdem ganz unpassend stolz auf sich, weil sie vor dem Spaziergang zumindest eine vage Erinnerung daran gehabt hatte, dass sie in der Früh etwas zu erledigen hatte. Nun, jetzt wusste sie auch, was: Iolanda wecken, weil sie heute – am ersten Tag der Sommerferien – extra früh zum Babysitten musste. Tja, das hatte sich offenbar von selbst erledigt …
»Morgen, mein Schatz!« Sie versuchte es mit einem netten Gruß. Aber Iolanda verdrehte nur theatralisch die Augen und eilte ins Haus.
»Ich mache uns schnell Frühstück«, schlug sie vor und stolperte ihrer Tochter hinterher. Wahrscheinlich katapultierte sie dabei wieder eine ganze Ladung Sand mit ins Haus. So war es immer. Sie war sich sicher, dass der Sand irgendwann ganz Besitz von ihrem Haus nehmen würde. Und dann würde jemand in hundert Jahren beim Baden eine Burg bauen und bei ihr im Schlafzimmer landen.
»Dazu ist es zu spät!«, schrie Iolanda und sperrte sich ins Bad. Nicht, ohne vorher die Tür zugeknallt zu haben. Das machte Tosca nichts aus. Der Tür auch nicht – nicht mehr. Inzwischen hatten sich nämlich das Holz, die Angel und die ganze Wand an Iolandas pubertär bedingte Türschließtechnik gewöhnt. Gezwungenermaßen. Der Putz hielt sich jedenfalls. Daumen hoch für die stabile Bauweise!
Tosca seufzte und überlegte, dass sie offenbar fast eine Stunde am Strand gewesen war. Sie musste das mit dem Zeitgefühl endlich mal in den Griff bekommen. Und sich vor allem aufschreiben, wann sie mit Wecken dran war.
»Ioio, ich fahr dich nach Mareblu, okay?«, bot sie an.
Aus dem Bad kam eine gemurmelte Antwort, die sie einfach mal als ein Ja deuten wollte. Gleich darauf öffnete Iolanda die Tür. Wunderhübsch war ihre Tochter, mit ihren vierzehn Jahren und diesem grimmigen Blick, den sie schon damals als Neugeborenes unvergleichlich gut draufgehabt hatte. Sie liebte dieses Mädchen so, so sehr, und nicht selten fühlte sie sich Iolanda kaum würdig. Sie war einfach kein mütterlicher Typ, wie sehr sie sich auch anstrengte.
»Denk nicht so viel nach, Ma. Ist schon in Ordnung. Wenn du mich fährst, bekommen wir das hin. Zum Bus müsste ich nämlich jetzt echt fliegen. Außerdem ist es meine Schuld, wenn ich verschlafe. Immerhin bin ich vierzehn und ich besitze genügend Wecker.«
»Ja, aber ich bin deine Mutter, und ich sollte verlässlicher sein.«
»Bist du doch. Na, meistens jedenfalls. Los, zieh dich an und lass uns aufbrechen.«
Tosca blickte an sich herunter. Sie trug noch immer ihren Pyjama. Der aber auch als Jogginganzug durchgehen konnte. Vielleicht war es sogar einer gewesen. So genau wusste sie das nicht mehr. Und genau genommen war sie noch nicht mal auf dem Klo gewesen.
Alles egal. Hauptsache, Iolanda kam rechtzeitig zu ihrem Sommerjob.
»Passt schon so. Ich steige eh nicht aus dem Auto.«
Iolanda zog die Schultern hoch. »Von mir aus …«
Sie gingen eilig zur Haustür.
»Ma …«
»Ja?«
»Das Geld für den Fahrschein zum Heimfahren später.«
»Oh, verdammt!« Tosca schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, wobei sich ihre vielen Armbänder klimpernd mitbewegten, und eilte zurück in die Küche. Das Haushaltsgeld befand sich in einem großen Keramikbehälter, der mal als Keksdose fungiert hatte und jetzt ein Revival als bunt dekorierte Spardose erlebte. Sie wühlte etwas Kleingeld heraus und reichte es ihrer Tochter, die erneut mit den Augen rollte. So perfekt, dass die Iris beinahe verschwand. Das hatte sie nicht von ihr …
»Bis später, Ioio«, rief sie ihrer Tochter nach rasanter Fahrt, Nichtbeachtung sämtlicher Verkehrsregeln und einer quietschenden Bremsung, die vermutlich ganze Schichten ihrer Autoreifen an den Asphalt weitergegeben hatte, nach. Aber ihr Kind war in Windeseile weg, hatte sich schon in die unnahbare junge Frau verwandelt, die sie vor den Augen ihrer Mitmenschen wohl sein wollte. Wie ein menschliches Chamäleon war sie perfekt dem neutralen Umfeld angepasst. Schade, fand Tosca immer wieder, denn Iolanda hatte das Zeug, um zu glänzen.
Tosca lehnte sich einen Augenblick lang gegen das Kopfteil ihres Autositzes. Plötzlich fühlte sie sich wahnsinnig erschöpft. Die schlaflose Nacht hatte Spuren hinterlassen. Sie schloss die Augen kurz, schreckte aber sofort hoch, als sie ein Klopfen vernahm. Direkt gegen ihre Autoscheibe. Sie erkannte die Verrückte, die für das Klopfen verantwortlich war, sofort. Adriana. Ihre beste Freundin. Tosca ließ die Scheibe runter.
»Hat sie schon wieder verschlafen?«, fragte ihre Freundin ohne Umschweife. Sie hinterließ dabei eine Duftnote, die Tosca rasant durch die Nase ins Gehirn schoss und geradezu benebelte. Adriana liebte teures Parfüm. Sie liebte auch teure Schminke. Was aber nicht hieß, dass sie damit umgehen konnte. Denn das konnte sie definitiv nicht. Linien mit dem Eyeliner waren bei ihr so gerade wie eine Herzfrequenz beim EKG von anderen – durchaus lebendigen – Menschen. Lippenstift landete immer auf den Zähnen – rein aus Prinzip, hatte Tosca manchmal den Eindruck. Und Rouge war für sie erst Rouge, wenn sie damit an Heidi erinnerte. Trotzdem mochte sie Adriana wie keine andere. Sie war nämlich di buon cuore, so bezeichnete Tosca sie oft. Also ein Mensch mit gutem Herzen. Und das – nur das – zählte.
»Ja … fast. Wir haben es aber rechtzeitig geschafft. Wie immer.«
»Das sehe ich.« Adriana warf einen bedeutungsschweren Blick auf ihren Pyjama.
»Das ist ein Jogginganzug.«
»Klar.«
»Ich schwöre!«
Adriana nickte übertrieben und zeigte damit, dass sie ihr kein Wort glaubte.
»Musst du nicht los?«, erkundigte sich Tosca scheinheilig. Sie wusste, dass ihre Freundin erst um 8:15 Uhr ihren Dienst bei der Post antreten musste. Und so weit war es noch nicht. Das erkannte sie daran, dass die Kirchenglocke laut bimmelte. Das tat sie immer zur vollen Stunde.
Sie befanden sich parallel zur Strandpromenade des ehemaligen kleinen Fischerdorfs Mareblu. Hier standen die Kirche, das Schulgebäude und knapp daneben die Post. Alles keine wirklich schönen Gebäude, musste Tosca zugeben, obwohl zumindest die Schulleitung versucht hatte, die Außenwände bunt und einladend zu gestalten … irgendwann vor Jahrzehnten wahrscheinlich.
Im Juni waren erst wenige Touristen unterwegs. Die Sommerzeit stand bevor, man konnte sie quasi schon riechen. Dennoch schienen die Urlauber auf ein verstecktes Zeichen zu warten, um dann alle auf einmal die Strände, Straßen und Gassen des kleinen Ortes in Beschlag zu nehmen. Als trauten sie sich nicht so recht. Als müssten sie sich gegenseitig anstacheln, um dann gemeinsam ihren Erfolg zu feiern und sich zu brüsten, es geschafft zu haben, auf den August zu warten. Wie Helden, denen es aber entging, dass sie sich gegenseitig das Leben – oder zumindest den Urlaub – schwer machten. Mareblu konnte herrlich, anstrengend oder deprimierend sein. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtete. Tosca hatte sich an alle Schattierungen gewöhnt, und sie mochte jede einzelne. Sie fand Mareblu meistens nur schön. Trotzdem hatte sie eine ganze Weile den Stiefel bereist, mal hier, mal da gewohnt, bis Iolanda zur Welt kam. Das war für sie der Anlass gewesen, ihre nomadische Ader zu unterdrücken. Dank ihrer Großeltern, die ihr das Ferienhäuschen am Meer vermacht hatten, hatte sie keine Probleme gehabt, hier sesshaft zu werden. Und ihr Leben war gut. Jetzt war es gut.
Adriana antwortete gespielt pikiert auf ihre Frage, ob sie nicht zur Arbeit müsse. »Nein. Ich muss noch nicht los. Willst du auf einen Saft mit zur Bar?«
»Im Pyjama?«
»Ha. Wusste ich es doch!«
Tosca ließ resigniert die Stirn auf das Lenkrad sinken. »Adri, lass mich einfach in Ruhe, okay?«
Ihre Freundin lachte schallend und zeigte eine satte Lippenstiftspur auf ihrem rechten Eckzahn. Der stand ganz leicht hervor und bekam das meiste ab. Immer. Armer Kerl. »Fahr schon. Und zieh dich endlich vernünftig an. Aber vergiss nicht, dass wir heute Abend ins Theater wollen.«
»Schon gut. Ich habe es mir aufgeschrieben.«
»Dann bis später, du Pyjamaheldin.«
Tosca fuhr die Scheibe wortlos hoch und startete den Motor. Sie musste inzwischen wirklich dringend aufs Klo. Wirklich, wirklich dringend.
*
Er fuhr nun schon das dritte Mal exakt denselben Weg entlang. Was war er genervt! Sein Navi mindestens ebenso sehr wie er, das konnte er förmlich spüren. Und es war vielleicht das erste Mal, dass er das Gerät wirklich ratlos erlebte. Was war das hier überhaupt für ein verdammtes Kaff? Kein einziges Schild war in irgendeiner Weise hilfreich. Und er verfluchte den Tag, an dem er sich auf diesen vollkommen bescheuerten Pakt eingelassen hatte.
Zum wiederholten Mal landete er an der Strandpromenade und hielt kurzerhand an. Er musste wohl oder übel nach dem richtigen Weg fragen, sah aber gerade keine Passanten in unmittelbarer Nähe. Deshalb stieg er aus und ging auf die erstbeste Bar zu, weil fett APERTO auf einem Schild stand, das an der Tür hing. Wie eine stille Einladung. Und so einen winzigen Hoffnungsschimmer brauchte er jetzt. Er senkte den Kopf, um sich vor dem leichten Wind zu schützen, da er seine Jacke im Auto liegen gelassen hatte und nur ein sommerliches T-Shirt trug. Dabei stieß er mit einer Frau zusammen, die nur kurz abwesend ein scusi murmelte und schon davoneilte. Er verstand ja nicht viel von Make-up. Dass die Frau aber ordentlich danebengelangt hatte, schien allzu offensichtlich. Er schüttelte kurz den Kopf, hätte wahrscheinlich innerlich gelacht, wenn er gute Laune gehabt hätte, und betrat die Bar, wo ein junges Mädchen ihn strahlend empfing.
»Buongiorno!«, rief es aus seiner Position hinter der Theke. »Caffè?«, erkundigte es sich gleich.
Er war zuerst überrascht. Hatte eigentlich nicht vorgehabt, etwas zu trinken. Dann nickte er aber. Konnte ja nicht schaden. Immerhin war er mitten in der Nacht losgefahren und nun schon viel zu lange auf den Beinen.
Das Mädchen reichte ihm, noch immer lächelnd, ein Tässchen, aus dem sich Dampf und Duft erhoben, die ihm sofort in die Nase stiegen. Das fühlte sich unerwartet gut an, und er entspannte ein wenig, lehnte sich sogar auf die helle Marmorplatte, mit der die Theke ausgestattet war. Sie war eiskalt. Er erschauderte leicht, blickte sich um. Sah, dass der Laden hübsch eingerichtet war. Wie es sich für eine Bar direkt an der Strandpromenade gehörte, fand er. Viel Weiß. Rote Akzente. Nein, korrigierte er sich, korallenrote Akzente. Originell. Schön. Und nach dem eher negativen ersten Eindruck von Mareblu dann endlich versöhnlich.
»Zucchero?«, bot das Mädchen an.
»Sì, grazie.« Er trank seinen Kaffee tatsächlich nur süß. Manchmal sogar mit Milch. Weichei!, hörte er eine Stimme in seinem Kopf. Er schüttelte sich leicht. Wollte diese Stimme gerade wirklich nicht hören.
»Scusi, Signorina, kennen Sie sich im Ort ein bisschen aus?«, fragte er nun das Mädchen.
»Klar. Mareblu ist übersichtlich«, berichtete es erfreut.
»Das ist schön. Dann können Sie mir sicher sagen, wo …«, er nahm die gefaltete Buchungsbestätigung aus seiner Hosentasche, »sich diese Casa Lucianina befindet.«
»Hm …«, das Mädchen blickte angestrengt in die Luft, »Der Name sagt mir gerade nicht viel. Haben Sie denn keine Adresse?«
Er sah noch mal aufs Blatt. »Doch. Hier steht Marinella-Strand.«
»Ach so. Na klar. Der liegt etwas außerhalb. Ist aber gar nicht schwer zu finden. Ich erkläre es Ihnen!«
Er sah dabei zu, wie das Mädchen ihm den Weg sehr, sehr detailliert auf die Rückseite der Buchungsbestätigung skizzierte, merkte am Ende aber, dass er nicht wirklich viel verstanden hatte. Er bedankte sich trotzdem und verließ die Bar.
Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass das Mädchen den Weg tatsächlich hervorragend erklärt hatte. Ohne weitere Probleme fand er das gebuchte Haus. Wie vereinbart war der Schlüssel unter dem Teppich am Eingang versteckt. Seiner Meinung nach war das absolut und total unprofessionell, von niemandem empfangen zu werden. Aber was sollte er tun? Er hatte das Ding ja nicht gebucht.
Er beschloss, sich nicht zu beklagen – bei wem auch? Immerhin war das Haus wirklich toll, direkt am Strand. Und einsam. Das war der Pakt.
Er ging kurz durch die Zimmer, sah erfreut, dass das Haus nicht übertrieben groß war. Schön war auch die Tatsache, dass die gesamte Frontseite mit großen Fenstern versehen war, die einen ungestörten Blick auf das Meer ermöglichten. Er mochte das Meer. Etwas weniger vielleicht mochte er die Einsamkeit, aber das würde schon in Ordnung gehen. Er musste es zumindest versuchen.
Erneut verließ er das Haus, um sein Gepäck aus dem Auto zu holen. Dann stellte er den Koffer ab und hob die Tasche auf den einfachen Küchentisch. Er öffnete den Reißverschluss und griff zielsicher hinein. Die Mappe, die er suchte, fand er sofort und zog sie vorsichtig heraus. Auch die Mappe öffnete er. Das Blatt, das er brauchte, befand sich gleich an oberster Stelle. Das Herz zog sich ihm plötzlich und unerwartet zusammen, als sein Blick sich auf die vertraute Schrift konzentrierte. Er griff ein weiteres Mal in die Tasche, holte jetzt einen Kugelschreiber hervor.
Vorsichtig, fast ehrfürchtig, setzte er mit dem Kugelschreiber an. Holte tief Luft. Zog den Kugelschreiber über die erste Zeile des Geschriebenen. Dann atmete er wieder aus.
Gut.
Das war nicht schwer gewesen.
Er hatte es geschafft. Der erste Punkt der Liste war erledigt.
Das fühlte sich nicht schlecht an. Ganz im Gegenteil.
Schade, dass die Liste nicht nur aus einem Punkt bestand. Wirklich schade.
Lege dich in den Sand und schaue in den nächtlichen Himmel. So lange, bis die Sterne zu tanzen beginnen.
Kapitel 2
»Hattest du nichts … Eleganteres im Kleiderschrank?«, wollte Adriana wissen. Sie klang dabei so, als würde sie sich über eine eklige, ansteckende Krankheit auslassen. Und sie zog die Lippen ganz seltsam zurück, sodass sie kurz einem Hund glich, der nicht so recht wusste, ob er bellen, beißen oder lächeln wollte. Der Eckzahn mitsamt dreier Nachbarn zeigte sich natürlich gewohnt und obligatorisch angemalt. Darauf war Verlass.
Tosca blickte an sich herab. Rote Bluse, schwarze Hose, schwarze Pumps. Was war daran nicht elegant? Ihre Freundin, die ein langes Kleid trug, das eher zu einer Prämiere an der Scala statt zu einer simplen, dilettantischen Aufführung in einem simplen, dilettantischen Provinztheater passte, schnalzte tadelnd mit der Zunge. Um die Szene perfekt zu machen, warf sie sich gleich darauf ein Ende ihrer Stola divenhaft über die Schulter. An Dramatik und schauspielerischem Talent fehlte es der Guten nicht.
Tosca stöhnte. Aber nur innerlich. Sie war gut darin geworden, Adrianas Eigenarten kommentarlos wegzustecken. Die Alternative wäre ohnehin nur die gewesen, sich auf eine Diskussion einzulassen. Daran bestand aber wirklich kein Bedarf bei Tosca. Mit Adri diskutieren war ungefähr so sinnvoll, wie einem zweijährigen Kind erklären zu wollen, warum es gut war, Spinat zu essen.
»Ioio, wir sind dann weg!«, rief sie also stattdessen und nahm ihre Handtasche vom Wohnzimmertisch.
»Okay, Ma. Viel Spaß!«, wünschte ihnen Iolanda, ohne sich auch nur eine Sekunde blicken zu lassen.
Tosca hielt kurz inne. Aus einem Impuls heraus beschloss sie, zu ihrer Tochter ins Zimmer zu gehen.
Iolanda lag auf ihrem Bett. Irgendwie total unbequem auf dem Bauch, mit angewinkelten Beinen. Tosca tat nur vom Zusehen das Kreuz weh. Iolanda starrte auf ihr Handy, tippte etwas ein, starrte weiter. So konzentriert, dass sie noch nicht mal aufblickte, als Tosca sich zu ihr aufs Bett setzte. Ich sollte ihr Handyverbot erteilen, überlegte sie, schüttelte den Gedanken aber weg. Sie wollte nicht streng sein. Sie wollte keine Verbote aufstellen. Sie wollte … so wenig wie möglich wie ihre eigene Mutter sein.
»Du kommst auch wirklich zurecht?«, versuchte Tosca sanft eine Konversation einzuleiten.
»Ma, du bist doch nur kurz im Theater und nicht auf Weltreise. Sei unbesorgt, okay?«
Tosca schluckte. Machte sie mit ihrer Tochter wirklich alles richtig? Diese Frage fraß schon seit Ewigkeiten regelrecht Höhlen in ihre Brust. Aber sie sagte nichts. Fuhr mit der Hand kurz über Iolandas Rücken, erhob sich schließlich.
»Gut … dann … bis später!«
Ihre Tochter drehte sich plötzlich um. Sprang auf. Warf sich ihr an den Hals. Drückte ihr einen feuchten Kuss auf die Wange. So überschwänglich, dass Tosca fast fiel. Mit dem überschäumenden Enthusiasmus eines Teenies eben. Dann ließ sie ebenso abrupt wieder von ihr ab und verließ das Zimmer, wahrscheinlich um in die Küche zu gehen und irgendein ungesundes Zeug zu verschlingen. Tosca blieb kurz zurück, fuhr mit den Fingern über die feuchte Stelle, wo Iolandas Lippen ihre Haut berührt hatten. Sie trocknete sich nicht ab, sondern nahm die Stelle einfach mit. Stolz wie ein Pfau. Iolandas Küsse waren zu rarer Ware geworden und daher kostbar.
»Fahren wir mit deinem oder mit meinem?«, erkundigte sich Tosca, als sie gemeinsam mit Adriana das Haus verlassen hatte. Der Sand, der sich so nahe am Strand praktisch überall befand, knirschte unter ihren Schuhsohlen. Adriana sah zu ihr. Die untergehende Sonne erhellte kurz das Gesicht ihrer Freundin und zeigte, wie hübsch diese eigentlich war. Unter den Make-up-Schichten.
»Mit deinem. Dann kann ich wenigstens etwas trinken«, erwiderte Adriana.
»Wir gehen aber schon ins Theater und nicht in irgendeine Kneipe, oder?«
Ihre Freundin nickte geschäftig und ging um Toscas Auto herum, wobei sie tänzelnde, kleine Schritte machte mit ihren hochhackigen Sandalen. Sie sah beinahe niedlich dabei aus. Wenn auch nicht auf herkömmliche Weise. »Dein Sarkasmus zeigt sich heute ja schon sehr früh«, stellte sie fest und setzte sich ins Auto.
»Es ist nie zu früh für Sarkasmus«, fand Tosca.
»Wie auch immer …« Adriana knallte die Beifahrertür zu, drehte das Autoradio an und holte einen Lippenstift aus ihrer Tasche. Sie fuhr sich die Lippen nach. Ohne Spiegel natürlich. »Wie findest du die Farbe?«
Tosca konzentrierte sich auf den Mund ihrer Freundin.
Ein Desaster.
Die Farbe war in Ordnung. Pink? Das war aber auch schon alles, was man irgendwie positiv bewerten konnte.
»Passt zum Nagellack.« Das entsprach kein bisschen der Wahrheit. Der war nämlich orange.
Adriana blickte entzückt auf ihre Nägel. »Stimmt!«, rief sie begeistert und drehte das Radio noch lauter.
Sie war so leicht glücklich zu machen. So, so leicht. Deshalb liebte Tosca ihre Freundin ja auch.
»Sollen wir hier Wurzeln schlagen?«, erkundigte Adriana sich gespielt ernst.
Tosca konnte nicht anders, als zu lachen. Adriana konnte zwar nerven, aber sie versprühte gleichzeitig gute Laune. Immer. Und sie schaffte es auch, dass sie sich ebenso überschäumend enthusiastisch fühlte wie ihre Tochter. Adriana sang, kicherte, lästerte, beklagte sich, freute sich. Alles zusammen. Alles getrennt. Wie es gerade passte. Diese totale Gefühlsanarchie färbte meistens auf sie ab. Zum Glück. Anders war ihre Freundin manchmal kaum zu ertragen.
Die Stimmung war dann auch total ausgelassen, als sie endlich den Parkplatz des Theaters erreichten, das sich im nächsten Provinzstädtchen befand. Tosca musste ein paarmal herumfahren, weil alle Plätze besetzt zu sein schienen.
»Wieso waren wir hier eigentlich noch nie?«, wunderte sie sich und zog die Handbremse an, als sie endlich eine Lücke ausfindig gemacht hatte und das Auto stand.
Adriana zog die Schultern hoch. »Weil die Post bisher keine Karten spendiert hat?«, konterte sie mit einer Gegenfrage.
Ja, die Post hatte ihren Mitarbeitern Karten geschenkt. Und Adriana hatte natürlich Tosca mitgenommen. Wen auch sonst?
Sie stiegen aus. Adriana summte dabei heiter vor sich hin. Das hörte Tosca ganz deutlich.
»Ist was, Adri? So gut drauf warst du schon seit Ewigkeiten nicht mehr.« Irgendetwas am Verhalten der Freundin machte sie plötzlich stutzig, wenn sie auch nicht zu fassen bekam, was.
»Nein, nein …«, stritt ihre Freundin ab und tänzelte wieder nicht sehr graziös auf den erleuchteten Eingang zu.
Hm.
Mit dieser Antwort hatte Adriana sie kein bisschen überzeugt. Sie kannte ihre Freundin schließlich lange genug.
»Huhu!«, rief diese nun schon und hob winkend einen Arm.
Mit Schrecken sah Tosca, dass vom Eingang her zwei Menschen zurückwinkten.
Zwei Männer, wohlgemerkt.
»Ach, merda, Adri. Du hast es schon wieder getan?!« Tosca wusste nicht, ob sie schreien oder heulen wollte. Am ehesten noch beides zusammen. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Noch nicht nahe genug, um die Männer mit Sicherheit zu identifizieren. Adriana hielt eher widerwillig an.
»Keine Frau, die etwas auf sich hält, geht ohne männliche Begleitung ins Theater.«
»Sag bitte, dass das nicht Pompeo und Renzo sind …«
Tosca wurde schlecht.
»Hast du etwa eine Alternative? Hm? Ja? Dann bitte immer her damit!«, forderte Adriana eingeschnappt.
»Jedes gottverdammte männliche Wesen des gesamten Universums wäre eine würdige Alternative zu den beiden Witzfiguren!«
»Du bist viel zu wählerisch.«
War sie gar nicht. Wirklich. Überhaupt nicht. Sie war nur einfach nicht an der gleichen Männer-Obsession erkrankt, an der Adriana seit Ewigkeiten litt.
»Pompeo hat Mundgeruch!«, protestierte sie schwach.
»Dann halt dir die Nase zu!« Adriana rollte mit den Augen. Schließlich seufzte sie ergeben, wobei sie die Schultern hängen ließ, was die Stola unschön rutschen ließ und ihr die traurige Ausstrahlung einer verwelkten Diva verlieh. »Komm schon! Renzo, der ist richtig witzig. Das weißt du. Und wenn du magst, setze ich mich neben Pompeo. Das wird lustig. Und wir müssen sie schließlich nicht heiraten. Einfach nur einen netten Abend haben. Das wollen wir schließlich beide, nicht?«
Ja. Tosca wollte einen netten Abend haben. Und Renzo war … na ja, das kleinere Übel. Ein paarmal waren sie ja schon alle gemeinsam weggewesen – natürlich ohne ihre Einwilligung, von Adriana organisiert.
Sie seufzte. Mit etwas Anstrengung würde sie die nächsten paar Stunden bestimmt überleben.
»Na schön. Aber das ist das letzte Mal, dass ich bei so was mitmache.«
Adriana nickte übertrieben und geheuchelt unterwürfig.
»Ich meine es ernst, Adri. Und jetzt lass uns schon rein in dieses bescheuerte Theater!«
Das Theaterstück – »Zeig’s ihm, Ludovico!«, hieß es – erwies sich als ziemlich unterhaltsam. Anscheinend aber nur für Tosca. Ihr Sitznachbar Renzo war anderer Meinung. Und ihre Freundin hatte eh nur Augen für Pompeo. Auf tragisch-komische Weise fühlte Tosca sich zurückversetzt in ihre Teeniezeit. Nur dummerweise in die weniger schönen Momente dieser Phase. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie sich während der Kinobesuche mit den Jungen aus ihrer Klasse ähnlich unwohl gefühlt hatte. Ihre Klassenkameraden waren allesamt richtige Doofis gewesen.
»Was war daran bitte lustig?«, hörte sie Renzo fragen.
Sie versuchte so zu tun, als sei die Frage nicht an sie gerichtet. Ihr Sitznachbar ignorierte ihr Schweigen.
»Die Kunst, einen Witz so zu erzählen, dass er die Menschen zum Lachen bringt, ist nicht jedem gegeben«, sinnierte er weiter und rieb sich das Kinn. Glücklicherweise starrte er dabei trotzdem auf die Bühne, sodass Tosca ihn ihrerseits ignorieren konnte.
Neben ihr kicherte Adriana die ganze Zeit. Ein paar Leute fingen an, sich genervt nach ihr umzublicken. Tosca rutschte etwas tiefer in ihren Sitz.
»Unbequem? Magst du auf meinen Schoß?«
Lieber wollte sie ein Klo putzen. Nach Benutzung durch einen Durchfallerkrankten. Also schüttelte sie den Kopf, hoffte, das möge ausreichen, um ihn davon abzuhalten, sich weiter mit ihr zu befassen.
Weit gefehlt.
»Magst du mal einen richtig guten Witz hören?«, flüsterte er ihr zu und beugte sich sehr, sehr zuversichtlich, um nicht zu sagen aufdringlich, zu ihr.
Nein, nein, nein, flimmerte es wiederholt vor ihrem inneren Auge auf. Renzos Frage entpuppte sich aber ohnehin als rhetorisch.
»Eine Frau so: ›Herr Doktor, meine Spirale ist im Arsch!‹ Der Arzt: ›Da gehört die aber auch nicht hin!‹« Er lachte schallend. An einer ausnahmsweise ernsten Stelle des Theaterstücks. Pssst, zischte man ihnen zu, und Tosca wollte sterben. Was für ein Albtraum!
*
Er schrak hoch, rieb sich die Augen, blickte verwirrt auf seine Armbanduhr. In einen traumfreien Tiefschlaf war er gefallen. Aber hatte er wirklich ganze zwei Stunden geschlafen? Wie war das möglich? Leise stöhnend erhob er sich aus dem Sessel, wobei ihm das Buch aus der Hand fiel, das er zuvor ohne großen Enthusiasmus angefangen hatte durchzublättern. Er nahm es vom Boden, stöhnte noch lauter und erlaubte der Gewissheit, dass er miserable Laune hatte, ihn mit aller Wucht zu erreichen. Eigentlich war er ein umgänglicher Mensch, hatte gelernt, so zu sein. Oder hatte vielleicht das Leben ihn gelehrt, umgänglich zu sein? Genervt über seinen beinahe philosophischen Gedanken ging er hinüber zur Küche, wo er – wohl eher aus Gewohnheit – den Kühlschrank öffnete. Das Licht darin störte ihn, weil es die Leere so gnadenlos deutlich unterstrich. Er war noch nicht einkaufen gewesen. Er hatte nicht einmal richtig ausgepackt. Er … nun, wenn er ehrlich war, war er gar nicht richtig angekommen. Die letzten Stunden hatte er mit der Inspektion des Hauses, des Strandes und mit Lesen verbracht. Und eigentlich wollte er nur nach Hause. Dringend.
Ein leises Schaben lenkte ihn ab. Von sich selbst. Von seiner Sehnsucht. Es fiel ihm schwer, das Geräusch einzuordnen. Erst als ein Jaulen ertönte, begriff er, dass offenbar ein Tier an seiner Tür kratzte.
Er öffnete. Vor ihm saß ein Hund. Klein und dick. Eigentlich nicht sehr hübsch. Eher sogar das Gegenteil. Vielleicht ein Boxer-Mischling. Der Hund trug kein Halsband, wie er sofort erkannte, also auch keine Marke. Dafür wusste das Tier aber umso genauer, was es wollte. Es spazierte gemächlich an ihm vorbei, direkt ins Wohnzimmer, wo es sich vor den Kamin legte, in dem kein Feuer brannte.
»Ähm …«, setzte er an. Dann aber fiel ihm nichts ein, was er zu einem Hund hätte sagen können. Er schloss also die Tür, ging die paar Schritte rüber und setzte sich wieder auf den Sessel, den er erst vor ein paar Minuten verlassen hatte. Überlegte. Die Sitzfläche war noch warm. »Ich nehme nicht an, dass du mir verraten willst, wie du heißt …«
Der Hund hob müde die Augenbrauen, sah ihn an. Recht aufmerksam sogar.
»Dachte ich mir schon … Na, vielleicht interessiert dich andersherum mein Name. Gestatten, ich bin Moreno.«
Nun gähnte der Hund. Ausgiebig. Dann schloss er die Augen. Moreno lehnte sich zurück und merkte, wie seine Schultern sich entspannten. Dass sie angespannt gewesen waren, wurde ihm erst jetzt bewusst. Er fuhr sich durchs Haar und war sich so fremd wie vielleicht noch nie in seinem Leben. Hätte ihm vor einer Woche noch jemand gesagt, dass er sich schon bald mit einem seltsamen Hund als einzigen Begleiter in einem einsamen Strandhäuschen wiederfinden würde, er hätte schallend gelacht. So richtig laut. Jetzt hingegen umgab ihn eine Stille, die ihm fast ein bisschen Angst machte. Tatsächlich war nicht viel mehr zu hören als das allzu menschliche Schnarchen des Hundes. Der fühlte sich im Gegensatz zu ihm ja offenbar wohl.
Mit vorgeheuchelter Entschlossenheit ging er erneut in die Küche, wo er eine Tragetasche abgestellt hatte, in der sich ein paar belegte panini befanden. Die hatte er auf dem Weg nach Mareblu an einer Raststätte gekauft und zuvor schon ein, zwei Bissen davon genommen. Er griff sich eines heraus, sah sich den Schinken an, der inzwischen nicht gerade appetitlich wirkte, und beobachtete den Hund, wie der in aller Ruhe auf ihn zutrottete – ganz so, als hätte er vor ein paar Augenblicken gar nicht wirklich geschlafen. Moreno blieben jedenfalls Zweifel.
»So müde warst du also gar nicht, du Schuft!«, bemerkte er und warf ihm den Schinken zu, den der Hund erstaunlich wendig aufschnappte.
Was sollte er bloß mit dem Tier anfangen? Irgendwem musste es doch gehören …
Moreno schob den Gedanken beiseite. Er würde sich später drum kümmern. Es war schon Abend. Zu dieser Uhrzeit würde er niemanden finden, der ihm bei der Suche nach dem Zuhause des Hundes behilflich sein könnte. Und, wenn er ehrlich sein sollte, dann fand er es gar nicht so unangenehm, seine Einsamkeit mit jemandem zu teilen. Wenn auch mit jemandem, der nicht gerade taufrisch roch. Moreno rümpfte die Nase und erschrak fast ein bisschen beim Klang seines eigenen Lachens. Er erkannte diesen Klang kaum. Lachte er hier in Mareblu anders als sonst, oder lag es daran, dass er meist nicht darauf achtete?
Das Brot war trocken. Er musste mit Wasser nachspülen, das er direkt vom Wasserhahn trank. Der Hunger war ihm vergangen. Also ging er zurück zum Sessel, vertiefte sich noch mal in der Lektüre und merkte irgendwann, dass seine Augen brannten.
Überrascht stellte er fest, dass es stockdunkel draußen war. Und er spürte gleichzeitig, dass er bereit war. Bereit für den zweiten Punkt der Liste. Als hätte sein Unterbewusstsein die ganze Zeit darauf gewartet.
»Kommst du mit raus?«, fragte er den Hund.
Als Moreno sich wenig später in den weichen Sand setzte, kuschelte sich der Hund eng an ihn. Er hatte noch nie ein Haustier gehabt, auch kein zugelaufenes. Plötzlich bereute er das sehr, denn die Dankbarkeit, die ihn durchströmte, war wärmer als jede menschliche Umarmung jemals sein könnte.
Moreno legte sich hin, entspannte die Muskeln. Der Himmel war so klar wie seine Gedanken.
Sterne.
Pling, pling, pling.
Sie waren unglaublich schön, hell und funkelnd, sodass Moreno beinahe glaubte, sie aufpoppen zu hören mit einem unbeschreiblichen Klang.
»Wie Popcorn …«, überlegte er laut. Dieser Gedanke amüsierte ihn. Und ganz automatisch legte er die Hand auf den dicken Kopf des Hundes. Begann ihn zu kraulen, bis dieser wohlige Geräusche von sich gab.
Lange lag er einfach nur so da. Er fühlte sich schwerelos. Gestaltlos. Vielleicht verwandelte er sich selbst in einen Stern. Vielleicht schwebte er zu ihnen in die Unendlichkeit. Vielleicht poppte auch er gerade auf. Ja. An dieser kaum greifbaren Idee hielt er fest, denn er war sich sicher, dass sich hinter dem Schleier der Metapher eine unleugbare Wahrheit versteckte. Wenn ihm auch noch nicht klar war, wie sie genau aussah.
»Was meinst du? Wollen wir wieder rein?«, fragte Moreno den Hund, als dieser anfing, unruhig zu werden. Früher hatte er Menschen, die ständig mit ihren Hunden redeten, lächerlich gefunden. Jetzt konnte er kaum noch nachvollziehen, warum das so gewesen sein mochte. In diesem Moment empfand er es als vollkommen logisch, mit dem Hund nicht nur zu sprechen, sondern ihn auch nach seiner Meinung zu fragen.
Dessen verhaltenes Schwanzwedeln, das er als Zusage deuten konnte, bestätigte ihn. Also richtete auch er sich auf und merkte erst dabei, dass die Feuchtigkeit, die vom Meer und aus dem Sand in seine Knochen gekrochen war, ihn wenig gelenkig gemacht hatte.
Ein Glas Wein wäre jetzt nicht schlecht, überlegte er und ging, dicht gefolgt von seinem neuen Freund, auf das Haus zu. Und zum ersten Mal überhaupt sah er es sich richtig an, sein vorläufiges Zuhause. Er hatte das Licht nicht gelöscht, bevor er es verlassen hatte. Es schien nun durch die Fenster und verlieh dem kleinen Gebäude etwas Heimeliges. Auch der hellblaue Anstrich der holzverkleideten Außenwände wirkte einladend, obwohl die Farbe in der fast kompletten Dunkelheit nur zu erahnen war. Moreno beschloss spontan, Frieden zu schließen. Mit dem Haus, mit der Situation, vielleicht sogar mit sich selbst. Und mit neuem Mut betrat er es. Was sich schon gleich viel besser anfühlte. Er bedauerte es trotzdem, keinen Wein mitgenommen zu haben. Bei ihm in der Küche, in seiner Wohnung im Zentrum von Bologna, standen immer ein paar Flaschen bereit. Moreno liebte Wein, zumindest den roten. Er fand immer, dass bei Rotwein bereits die Farbe ein Genuss war. Weißwein akzeptierte er nur in den seltensten Fällen. Er schnalzte mit der Zunge. Fast so, als hätte er gerade einen samtigen Merlot die Kehle heruntergeschickt.
»Magst du Wein?«, erkundigte er sich beim Hund. Der lief aber nur an ihm vorbei, wieder direkt vor den Kamin, wo er sich zusammenrollte auf dem hellen Teppich, der mit seinen Farben ein bisschen an das Meer erinnerte.
Moreno nutzte die Zeit, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Eine ziemlich ungewohnte Tätigkeit für ihn. Wenn er es sich recht überlegte, dann hatte er das zuletzt … hm … irgendwann vor Jahren getan. Inzwischen brauchte er sich nicht mehr darum kümmern. Dazu hatte er Pierina, seine Haushälterin. Natürlich schaffte er es trotzdem, die paar Dinge aufzuschreiben, die er in den nächsten Tagen brauchen würde. Es war ja nicht viel. Schließlich war er allein. Er überlegte kurz, setzte Hundefutter mit auf die Liste. Noch wusste er nicht, was aus dem Tier werden würde.
Und dann widmete er sich gleich auch einer weiteren Liste. Punkt 2 strich er durch. Dann packte er sie wieder weg.
Ihm fiel das Buch ein, das er angefangen hatte zu lesen. Auch das stand auf der Liste.
Lies! Lies ganz, ganz viel. So viele Bücher, wie du tragen kannst!
Kapitel 3
Tosca blickte auf den gedeckten Frühstückstisch. Es war alles da. Brötchen – frisch aus dem Ofen. Marmelade – natürlich Erdbeere. Schokoaufstrich – nun, sie würden das Glas auslöffeln müssen, denn viel war nicht mehr drin. Saft – ja, aber nicht frisch gepresst. Milch. Tee. Kaffee. Fehlte nur noch Iolanda, die sie – oh Wunder – rechtzeitig geweckt hatte. Und der morgendliche Spaziergang am Meer mit ihrem geliebten Eimer, der konnte heute mal warten, fand Tosca.
»Feiern wir etwas?«, erkundigte sich Iolanda, als sie bereits fertig angezogen in die Küche kam und sich auf den Stuhl gleiten ließ. Ihr volles, lockiges Haar berührte dabei den Tisch und hinterließ einen süßen Duft nach Mandelmilchshampoo.
»Wir feiern, dass wir uns haben!«, antwortete Tosca spontan. Denn das war wahrlich ein Grund zum Feiern. Ja, eigentlich sollten sie ihre Zweisamkeit dauernd feiern. Und nicht zu knapp.
Iolanda rollte mit den Augen – mal wieder. Das Funkeln darin zeigte Tosca aber, dass ihr so dahingesagter Satz vielleicht gar nicht so banal gewesen war.
»Wie war das Theater?«, erkundigte sich ihre Tochter, während sie sich ein Brot strich.
Tosca verschluckte sich beinahe am Tee. »Frag nicht!« Der Abend war – natürlich – mit ihrem Versuch geendet, Renzos Avancen abzuwehren. Sie würde mit Adriana, die – natürlich – nur allzu gerne Pompeos Annäherungsversuchen nachgegeben hatte, noch ein Hühnchen rupfen.
»So scheiße?« Iolanda hob interessiert die Augenbrauen.
Tosca winkte ab, wobei ihre Armbänder empört klimperten. Muscheln, Steine, Glas, Glöckchen schlugen gegeneinander. Eigentlich liebte Tosca diesen Klang. Nur jetzt irgendwie nicht. Also legte sie ihren Arm vorsichtig auf den Tisch.
»Ma, ich fände es okay … ich meine … wenn du mal wieder mit einem Mann antanzen würdest.«
»Oh, glaub mir, das wird nicht passieren. Dazu fehlt ein wichtiges Puzzlestückchen, nämlich der Mann.«
»Du musst doch … also, nach der Sache mit meinem Erzeuger … da musst du doch … du kannst nicht leben wie eine Nonne, Ma.«