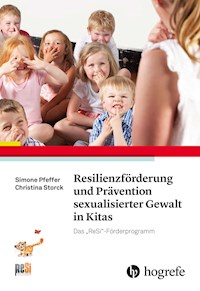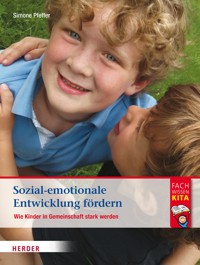
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Was sind emotionale und soziale Kompetenzen und warum ist ihre Förderung wichtig? Welche Unterstützung benötigen Kinder zwischen 2 und 6 von Erzieherinnen und Eltern, damit sie ihren Platz in der Gruppe finden und sich zu selbstbewussten und sozial kompetenten Persönlichkeiten entwickeln? Das Buch bietet konkrete Hilfen für den Umgang mit Konflikten und Bedürfnissen und zeigt, wie die Kinder altersgerecht und individuell gefördert werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Pfeffer
Sozial-emotionale Entwicklung fördern
Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden
Impressum
Titel der Originalausgabe: Sozial-emotionale Entwicklung fördern
Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Schwarzwaldmädel, Simonswald
Umschlagfoto: © stephanie phillips – iStockphoto
Fotos innen: Hartmut W. Schmidt, Freiburg
E-Book-Konvertierung: epublius GmbH, Berlin
ISBN (E-Book): 978-3-451-80472-4
ISBN (Buch): 978-3-451-32383-6
Inhalt
Impressum
Einleitung
1. Was sind emotionale und soziale Kompetenzen?
1.1 Der Fähigkeitsbereich Emotionale Kompetenz
1.2 Der Fähigkeitsbereich Soziale Kompetenz
1.3 Sozial-emotionale Kompetenzen – weitreichende Bedeutung für alle Lebensbereiche
1.4 Die Entwicklung von sozial-emotionalen Fähigkeiten als lebenslanger Prozess
1.5 Einflussfaktoren in der Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenz
2. Sprache – Ausdrucksmittel von Gefühlen
2.1 Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt
2.2 Unsicherheit im Ausdruck zeigt sich auch im Sozialverhalten
Praxis-Anregungen zur Förderung
3. Empathie – sich in andere einfühlen können
3.1 Was ist Empathie?
3.2 Empathie in Elternhaus und Kindertageseinrichtung
Praxis-Anregungen zur Förderung
4. Streiten – unterschiedliche Interessen verhandeln
4.1 Verschiedene Sichtweisen auf Konflikte
4.2 Neun Stufen der Konflikteskalation und mögliche Lösungswege
Praxis-Anregungen zur Förderung
5. Freundschaft – ein Grundbedürfnis des Menschen
5.1 Positive und negative Erfahrungs-Kreisläufe
5.2 Voneinander und miteinander lernen
Praxis-Anregungen zur Förderung
6. Ängstliches Verhalten – auf der Suche nach Sicherheit und Geborgenheit
6.1 Angst als Entwicklungsaufgabe
6.2 Angststörungen bei Kindern
Praxis-Anregungen zur Förderung
7. Aggressives Verhalten – eine Aufforderung an die Lebensumwelt
7.1 Erklärungen für aggressives Verhalten aus psychologischer und soziologischer Perspektive
7.2 Entwicklungsverlauf und geschlechtstypische Unterschiede
Praxis-Anregungen zur Förderung
8. Emotionsregulation – Strategien und Möglichkeiten in der frühen Kindheit
8.1 Emotionsentstehung nach dem integrativen Prozessmodell
8.2 Strategien zur Emotionsregulation
Praxis-Anregungen zur Förderung
9. Förderprogramme – eine Auswahl
Literatur
Einleitung
Für Kinder wie Erwachsene gilt gleichermaßen: Freude, Liebe, Wut, Trauer, Glück – all diese und viele weitere Gefühle machen unseren Alltag lebendig und gestalten unsere Beziehungen. Wenn Gefühle außer Kontrolle geraten und uns überfluten, werden der Kontakt zu anderen und die Alltagsbewältigung problematisch. Dies gilt ebenso, wenn Gefühle kaum entwickelt und zu flach ausgeprägt sind.
Gefühle sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und der Umgang mit ihnen ist eine alltägliche Herausforderung. Obgleich es eine »emotionale Grundausstattung« gibt, hängen unser gefühlsmäßiges Erleben und unser Umgang mit Gefühlen in starkem Maße davon ab, was wir von klein auf in unserer Umgebung erfahren und gelernt haben.
Besonders wichtig für Kinder sind die ersten Bezugspersonen, zumeist die Eltern und andere Familienangehörige. Aber auch andere Menschen wie ErzieherInnen, LehrerInnen, Nachbarn und Freunde begleiten die Kinder beim Aufwachsen und beeinflussen durch ihr Verhalten deren Entwicklung. Sie sind Vorbilder sowohl im Umgang mit den eigenen Gefühlen als auch in der Beziehungsgestaltung zu anderen.
Darüber hinaus leben wir in einer bestimmten Kultur, die über Werte und Normen den Gefühlsausdruck und soziale Umgangsformen prägt. Hierbei spielen unterschiedliche regionale und ethnische Hintergründe eine wichtige Rolle, was deutlich wird, wenn man zum Beispiel Vorstellungen über den Ausdruck von Gefühlen und über angemessenes Sozialverhalten bei Menschen vergleicht, die im asiatischen Raum oder im nordeuropäischen Raum leben. Eine Kultur steht immer in einem bestimmten gesellschaftlichen, politischen und zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Mittelalterliche Umgangsformen unterscheiden sich etwa deutlich von heutigen kulturellen Praktiken.
Daher dürfen der Umgang mit Gefühlen und das Sozialverhalten nicht nur individuell betrachtet und einer einzelnen Person zugeschrieben werden, sondern auch die Lebensbedingungen und Ideale einer Zeit und Gesellschaft formen den Umgang miteinander. Unsere heutige Gesellschaft basiert auf demokratischen Idealen von Menschenwürde, gegenseitigem Respekt und Toleranz. Verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander bestehen, eine friedliche Konfliktlösung ist die Norm, Schwächere werden per Gesetz geschützt. Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, moralisches Urteilsvermögen, Verantwortungsgefühl und kommunikative Fähigkeiten sollen entwickelt werden. Diese Fähigkeiten werden für ein demokratisches Miteinander benötigt.
Die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen in der Kindheit stellt dafür eine wichtige Grundlage dar.
1
Was sind emotionale und soziale Kompetenzen?
Wegen des engen Zusammenhangs von emotionalen und sozialen Fähigkeiten wird häufig auch von sozial-emotionalen oder sozio-emotionalen Kompetenzen gesprochen (vgl. Petermann u.a. 2008). Zum genaueren Verständnis sollen zunächst aber die Fähigkeitsbereiche einzeln beleuchtet werden.
1.1 Der Fähigkeitsbereich Emotionale Kompetenz
Allgemein gesprochen bezeichnet emotionale Kompetenz die Fähigkeit, mit Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können – für sich allein und im Zusammensein mit anderen.
Emotional kompetente Kinder können – in altersentsprechener Ausprägung – vielfältige Gefühle unterscheiden; sie können ihre Gefühle angemessen ausdrücken und regulieren und die Gefühle anderer Menschen erkennen und verstehen. Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln, gehören nach Franz Petermann und Silvia Wiedebusch (2008, S.14)
der eigene mimische Emotionsausdruck
das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
der sprachliche Emotionsausdruck
das Emotionswissen und
-verständnis
die selbstgesteuerte Emotionsregulation.
Was beinhaltet ein »kompetenter Umgang« mit Gefühlen?
Welche Fähigkeiten müssen für einen »kompetenten Umgang« mit Gefühlen entwickelt werden? Carolyn Saarni benennt in ihrem Modell der emotionalen Kompetenz acht Schlüsselfähigkeiten, die von Kindern im Lebensverlauf entwickelt werden. Sie begreift ihr Modell als unabgeschlossen, das heißt, es kann durch weitere Fähigkeiten ergänzt werden (Saarni 2002; Petermann/Wiedebusch 2008).
Schlüsselfähigkeiten der Emotionalen Kompetenz (nach Saarni)
1. Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und einordnen
Körpersignale spüren und zuordnen Gefühle voneinander unterscheiden
Achtsam in Bezug auf die eigenen Empfindungen sein
Bewusst über den eigenen emotionalen Zustand sein.
2. Den mimischen und gestischen Gefühlsausdruck von anderen Menschen erkennen
Den Gefühlsausdruck eines anderen Kindes oder eines Erwachsenen einordnen
Verschiedene Ausdrucksformen und Intensitäten der aktuellen Gefühlslage wahrnehmen
Achtsam mit anderen sein
Körpersprachliche Signale im Rahmen der bekannten Kultur »lesen«
3. Gefühle nonverbal und verbal ausdrücken
Die eigenen Gefühle nach außen angemessen mitteilen
Über mimische und gestische Ausdrucksformen verfügen
Über sprachliche Ausdrucksformen wie ein umfassendes Emotionsvokabular verfügen
Ausdrucksregeln der eigenen Kultur kennen
In Bezug auf interkulturelles Lernen: Ausdrucksregeln von anderen Kulturen kennen.
4. Die Fähigkeit zur Empathie
Die Perspektive eines anderen Kindes oder Erwachsenen übernehmen
Sich in die Situation eines anderen Kindes oder Erwachsenen einfühlen
Mitgefühl empfinden.
5. Zwischen innerem Erleben und äußerem Ausdruck eines Gefühls unterscheiden
Wissen, dass der äußere Ausdruck eines Gefühls nicht mit dem tatsächlich empfundenen Gefühl übereinstimmen muss
Gefühle verbergen können
Gefühlsausdruck gezielt steuern.
6. Mit negativen Emotionen und Stress umgehen, Emotionen selbstgesteuert regulieren
Wissen, dass Gefühle veränderbar sind
Gefühle hervorrufen und aufrechterhalten können
Deren Intensität und Dauer kontrollieren können
Impulskontrolle entwickeln
Sich beruhigen können
Wut, Angst, Trauer und Stress bewältigen
Sich entspannen können
Ressourcen zur Verfügung haben.
7. Bewusstsein darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden
Erkenntnis, dass Gefühle je nach Interaktionspartner unterschiedlich mitgeteilt werden
Wissen, dass die Mitteilung der eigenen Gefühle interpersonale Konsequenzen hat
Verschiedene Arten von Beziehungen unterscheiden (Freund, Mutter, Vater, Erzieherin …)
Die emotionale Kommunikation darauf abstimmen.
8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit
Das eigene emotionale Erleben wird akzeptiert
Negative Emotionen wie Wut oder Angst werden toleriert, aber nicht als überwältigend erfahren
Aktives Bemühen, eine problematische Situation zu lösen
Die Kinder gehen davon aus, eine Situation gestalten zu können
Sie haben das Gefühl einer relativen Kontrolle über das eigene emotionale Erleben in dem Sinne, dass sie es meistern und sich selbst dabei achten
Die Kinder haben ein gutes Selbstwertgefühl.
An dieser Darstellung der Schlüsselfähigkeiten wird deutlich, dass der Fokus zwar auf dem Gefühlsbereich liegt, es aber zugleich häufig um Interaktionen mit und Beziehungen zu anderen Menschen geht. Emotionale Fähigkeiten spielen im Kontakt zu anderen und daher auch bei der sozialen Kompetenz eine bedeutsame Rolle.
1.2 Der Fähigkeitsbereich Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz ist eng verwoben mit der emotionalen Kompetenz. Der Umgang mit den eigenen und den Gefühlen anderer bildet die Grundlage für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Wenn die emotionalen Fähigkeiten auf hohem Niveau entwickelt sind, sind auch die Wahrnehmung von und der Umgang mit gegenseitigen Befindlichkeiten und Bedürfnissen im Zusammensein mit anderen eher von Achtsamkeit geprägt.
Bei der Sozialen Kompetenz kommen aber auch noch weitere Fähigkeiten in den Blick – zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Ein weiterer Aspekt ist die Identitätsentwicklung, die im Austausch mit anderen stattfindet und mit der Entwicklung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit gepaart ist. Hierbei geht es darum, das eigene »Ich« im Kontakt mit anderen herauszubilden. Auch die Auseinandersetzung mit Regeln, Normen und Werten, die moralische Verhaltensmaßstäbe einer Gemeinschaft darstellen, ist Teil sozialer Bildungsprozesse.
Was beinhaltet der Begriff »Soziale Kompetenz«?
Soziale Kompetenz wird seit langem in verschiedenen Forschungsfeldern untersucht und umfasst ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Nach der Definition von Rüdiger Hinsch und Ulrich Pfingsten (zit. nach Kanning 2002) verhält sich eine Person sozial kompetent, wenn sie in der Lage ist, in Interaktionen mit anderen Menschen die eigenen Interessen erfolgreich zu verwirklichen. In dieser Definition steht die Durchsetzungsfähigkeit der Person im Vordergrund.
Einen anderen Schwerpunkt setzen David DuBois und Robert Felner (zit. nach Kanning 2002). Aus ihrer Sicht ist ein Mensch sozial kompetent, wenn er es versteht, sich an die sozialen Bedingungen seiner Umwelt anzupassen. Diese Definition betont die Anpassung des Individuums an Normen und Werte des Umfeldes.
Uwe Kanning (2002) bietet eine Definition an, die beide Aspekte berücksichtigt. Er beschreibt ein Verhalten als sozial kompetent, das versucht, einen Ausgleich der Interessen der beteiligten Parteien herzustellen. Im günstigsten Fall trägt sozial kompetentes Verhalten dazu bei, dass alle Beteiligten ihre Interessen in gleichem Maße verwirklichen können. In dieser Definition geht es darum, die Durchsetzung der eigenen Interessen mit der Anpassung an die soziale Umgebung zu vereinbaren. Beide Aspekte werden verbunden in der Bemühung, einen sozial verträglichen Ausgleich zu schaffen, der langfristige Beziehungen und Kooperation ermöglicht.
Sozial kompetentes Verhalten – abhängig von Situation und Kultur
Folgt man der Definition von Kanning, so ist nachvollziehbar, dass sozial kompetentes Verhalten immer auch von der Situation und den beteiligten Personen mitbestimmt wird. Das bedeutet: Es gibt kein sozial kompetentes Verhalten an sich. Was als sozial kompetent bewertet wird, hängt immer auch von den Interessen der Personen in einer bestimmten Situation und – aus einer allgemeineren Perspektive – von den jeweils herrschenden Maßstäben (Normen und Werten) einer Umgebung ab. Die Umgebung ist die Kultur, die Gesellschaft, aber auch die kleinere soziale Gruppe, in der Kinder aufwachsen. Vor diesem Hintergrund wird klarer, warum es so vielfältige Definitionen von Sozialer Kompetenz gibt, von denen hier nur eine kleine Auswahl beleuchtet wurde.
Übersichtlich und für Vor- und Grundschulkinder sinnvoll erscheint das Modell von Paul Caldarella und Kenneth Merrell, in dem die folgenden Fähigkeitsbereiche der Sozialen Kompetenz beschrieben werden:
Modell der Sozialen Kompetenz (nach Caldarella und Merrell)
Fähigkeitsbereiche
Beispiele
1. Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu anderen
Fähigkeiten der Perspektivenübernahme
Andere wahrnehmen
Anderen helfen
Andere loben
2. Selbstmanagement-Kompetenzen
Die eigene Gefühlslage »managen«
Ärger kontrollieren
Konflikte bewältigen
3. Kognitive Kompetenzen
Der Anweisung der Erzieherin, der Eltern oder der Lehrkraft folgen können
Zusammenhänge verstehen
Um Hilfe bitten
4. Kooperative Kompetenzen
Normen in einer Gemeinschaft erkennen
Soziale Regeln anerkennen
Angemessen auf konstruktive Kritik reagieren
5. Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten
Ein Gespräch beginnen
Ein Bedürfnis äußern
Darauf bestehen, dass man gehört wird Freundschaften schließen
(vgl. Caldarella und Merrell 1997, zit. nach Petermann u.a. 2008 und Kanning 2002)
Ein Kind, das über ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügt, könnte man auf der Basis der in unserer Gesellschaft gängigen Werte und Normen folgendermaßen beschreiben: Das Kind wird von Gleichaltrigen gemocht und kann Einfluss auf sie nehmen. Es hat keine soziale Angst, sondern kann leicht Kontakte aufbauen und auch in laufende Spielsituationen einsteigen, sich »hineinspielen«. Das Kind kann soziale Situationen gut einschätzen, sich in andere einfühlen. Es fühlt sich zu einer oder mehreren Gruppen zugehörig und hat ein gutes Selbstwertgefühl. Das Kind kann seine Gefühle angemessen kontrollieren und verfügt über Strategien zur Konfliktbewältigung, es kann sich mit anderen auseinandersetzen und verhandeln. Auch an diesem Modell wird deutlich, wie eng emotionale und soziale Fähigkeiten verwoben sind, und dass Emotionswissen und Emotionsregulation die Grundlage für die Gestaltung von Beziehungen bilden.
1.3 Sozial-emotionale Kompetenzen – weitreichende Bedeutung für alle Lebensbereiche
In welcher Qualität die sozial-emotionalen Fähigkeiten ausgebildet sind, ist in den verschiedensten Lebensbereichen von großer Bedeutung – sowohl aus der Perspektive des Einzelnen als auch aus gesellschaftlicher Sicht. Zunächst sind sozial-emotionale Fähigkeiten wichtig für die einzelne Person; davon hängt ab, in welcher Qualität ein Kind oder ein Erwachsener Beziehungen zu anderen Menschen erleben und gestalten kann. Das ist im privaten Bereich von Familie und Freundschaft wichtig, aber auch im Kindergarten, in der Schule und später im Berufsleben.
Inwieweit wir die Gefühle von anderen Menschen erkennen und verstehen können, bestimmt die Kommunikation. Werden Gefühle von anderen nicht erkannt oder anders als von ihnen gemeint interpretiert, kommt es häufig zu Missverständnissen und Konflikten – man kann sich nicht sinnvoll aufeinander beziehen, redet oder handelt aneinander vorbei. Auch Grenzen müssen wahrgenommen und respektiert werden. Geschieht dies nicht, können schnell Aggressionen entstehen.
Der Gefühlszustand bestimmt die Art und Weise, sich zu verhalten und wie eigene Möglichkeiten genutzt werden. Ist ein Kind häufig unsicher oder ängstlich, wird es seine kreativen Fähigkeiten weniger gut für ein bestimmtes Ziel einsetzen können, sondern viel Energie darauf verwenden müssen, um für seine eigene gefühlsmäßige Sicherheit zu sorgen. Ein Kind dagegen, das selbstbewusst ist und sich sicher fühlt, wird seiner Umwelt weitaus neugieriger und aufnahmebereiter begegnen und dadurch mit deutlich mehr Erfolg Neues lernen können.
Dies spiegelt sich auch in verschiedenen Untersuchungen wider, die gezeigt haben, dass eine hohe sozial-emotionale Kompetenz mit einer positiven schulischen Entwicklung einhergeht. Umgekehrt stellt eine geringere emotionale Kompetenz einen Risikofaktor in Bezug auf schulische Leistungen, Verhaltensauffälligkeiten und Suchtverhalten dar. Auch treten vermehrt zwischenmenschliche Schwierigkeiten auf. Emotional wenig kompetente Kinder sind in der Regel meist unbeliebter und verhalten sich aggressiver als andere (Petermann/Wiedebusch 2008, S.23ff.).
Der Zusammenhang von mangelnder sozial-emotionaler Kompetenz und Schulproblemen wird auch aus folgender Grafik deutlich:
(aus: Petermann/Wiedebusch 2008, S.28)
In unserer heutigen Gesellschaft wird Bildung sehr hoch bewertet. Schulerfolg bzw. -misserfolg haben für den Lebensverlauf des Einzelnen und darüber hinaus in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht weitreichende Konsequenzen. Menschen ohne oder mit niedrigem Schulabschluss sind zum Beispiel viel häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als diejenigen mit hohem Bildungsabschluss. Eine frühzeitige Förderung sozial-emotionaler Kompetenz ist so auch in langfristiger Perspektive sowohl für den Einzelnen als auch gesamtgesellschaftlich mit positiven Wirkungen verbunden.
Daneben ist es in unserer heutigen Welt zwingend notwendig, permanent aus einem Angebot an Möglichkeiten auszuwählen. Das kann ganz banal die Entscheidung für ein bestimmtes Mittagessen, die Art der Kleidung oder eine Internetseite sein. Aber auch biografisch relevante Entscheidungen müssen selbstständig getroffen werden – dazu gehören zum Beispiel der Berufsweg, die Partnerwahl, der Zeitpunkt einer möglichen Familiengründung. In unserem Leben gibt es nicht nur vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten, sondern auch Entscheidungszwänge. Um Entscheidungen treffen zu können, ist es notwendig, die eigene Befindlichkeit und die eigenen Bedürfnisse klar zu spüren. Dieses »Gespür« ist die Basis, um Kriterien für Entscheidungen herausbilden zu können, die nicht nur von außen bestimmt sind.