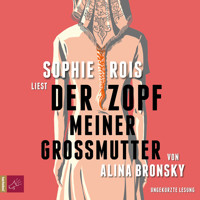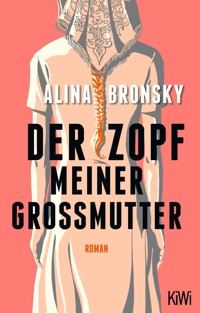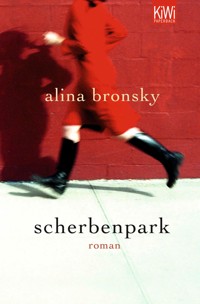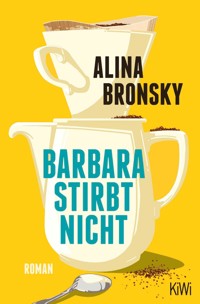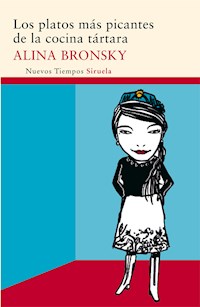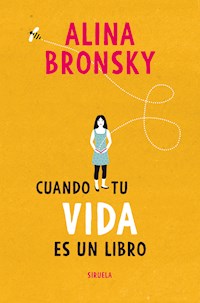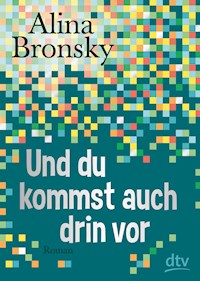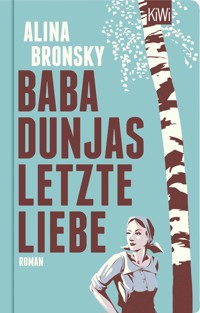11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Spiegelkind - Spiegelriss
- Sprache: Deutsch
Provokant, schonungslos, stark: Der neue Jugendroman von Alina Bronsky. Wie viel Zerstörung erträgt eine Gesellschaft, eine Familie, ein junger Mensch? Sie sagen, der Wald ist verboten Sie fürchten, er rückt immer näher Aber du tust alles, um hineinzukommen Sie nennen sich das Rudel und keiner traut dem anderen. Doch Juli ist froh, dass die abgerissenen Gestalten, die am Rand der Normalität leben, sie überhaupt aufgenommen haben. Nachdem ihr der Zugang zur Welt der Pheen verwehrt wird, hat sie keine Heimat mehr. Schlimmer noch, innerhalb der Normalität wird sie als letzte lebende Phee und gefährliche Mörderin gejagt. Verzweifelt versucht Juli, die Brücken zu ihrem früheren Leben wiederherzustellen. Doch bald muss sie erkennen, dass die Freunde von einst zu Feinden geworden sind und Verrat in der neuen Welt an der Tagesordnung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Titel
Alina Bronsky
Spiegelriss
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2013© 2013 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80196-4www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.dewww.spiegel-trilogie.de
Babyfuß
Ich sehe das Feuer nicht, aber ich spüre seine Nähe.
Das Rudel hat sich um die Feuerstelle versammelt. Ich halte mich abseits, ich mag keine Ellbogen an meinen Rippen und keine Füße in meinem Gesicht. Ich will nicht, dass jemand mir seinen Kopf auf die Schulter oder auf die Oberschenkel legt, wie es hier alle tun, um sich aneinander zu wärmen. Tief in mir drin weiß ich, dass es vielleicht langsam ganz gut wäre, wenn ich näher an die anderen rücken, mich geselliger und aufgeschlossener zeigen würde. Aber ich kann das nicht.
Mehr als einmal habe ich schon ein verächtliches Zischen hinter meinem Rücken gehört – dass ich seltsam und eingebildet sei. Dabei gibt es nichts, worauf ich mir etwas einbilden könnte. Niemand hier ist so hilflos und unwissend wie ich. Ich bin dem Rudel dankbar dafür, dass es mich aufgenommen hat. Ohne sie alle wäre ich längst verhungert und erfroren. Aber ich kann mich auch nach Monaten noch nicht dazu überwinden, so zu tun, als wäre ich eine von ihnen.
Ich liege zusammengerollt auf der Seite, die Knie berühren das Kinn, meine Arme sind um meine Beine geschlungen. Ich höre das Knacken des Brennholzes, der Wind weht den Rauch zu mir rüber.
Es ist Nacht. Das Rudel ist hungrig. Das ist immer so. Mit leerem Magen kann man schwer einschlafen, deswegen versuchen alle, sich mit Gruselgeschichten von der Leere im Bauch abzulenken. Abwechselnd schrauben sich Stimmen hoch, erkämpfen sich das Rederecht, das sie dann mit blutrünstigen Details verteidigen. Wenn die Spannung nachlässt, wird sofort gemeutert und der abgewürgte Erzähler muss dem nächsten Platz machen.
»Und dann beschlossen die Pheen, sich an der Normalität zu rächen.«
Ich lege mir die Hand aufs Ohr, kriege aber trotzdem die Stimme mit, die der Wind zusammen mit dem Rauch von der Feuerstelle zu mir rüberweht. Ich kann das alles nicht mehr hören. Fast alle Gruselgeschichten drehen sich um Pheen. Wenn ich nicht so hungrig und durchgefroren wäre, hätte ich vielleicht noch die Kraft gefunden, darüber zu grinsen. Die Ängste der anderen kommen mir albern vor. Sie wissen nicht, woher der eigentliche Schrecken kommt. Wenn sie wüssten, wo ich bis vor Kurzem noch gewesen bin, würden sie mich garantiert mit etwas mehr Interesse ansehen.
»Uuuuuuhhhh«, kommt es in einem vielstimmigen Chor. »Nicht immer das Gleiche.«
Genau, denke ich, drücke die Hand fester auf die Ohrmuschel. Obwohl ich meine Finger schon kaum spüre, scheint das Ohr noch viel kälter zu sein, jedenfalls fühlt es sich an, als würde es gar nicht zu mir gehören.
»Es ist überhaupt nicht das Gleiche«, verteidigt sich der heisere Erzähler, den ich nicht sehen kann.
Ich nehme die Hand von meinem Ohr und drehe mich auf die andere Seite. In der Geschichte, die gestern erzählt wurde, haben die Pheen normalen Männern die Herzen geklaut und gegessen. Das kam gut an: Das Rudel lauschte konzentriert wie nie. Ich hatte mein Gesicht versteckt, damit niemand die Grimassen mitbekam, die ich mir nicht verkneifen konnte. In der Geschichte von vorgestern ging es darum, wie die Pheen den Männern Küchenschaben ins rechte Ohr pflanzen. Die merke man dann am Kribbeln im Kopf, erzählte die dünne Stimme und schwor, es von der eigenen Großmutter gehört zu haben, die es persönlich beobachtet habe. Die Küchenschaben würden sich vermehren, das Regiment übernehmen über den Körper und den Normalen von innen auffressen. Bleibt nur die Hülle übrig, verlassen sie den Körper durch den Mund.
Ich musste kurz würgen, während die anderen zustimmend nickten und sagten, so etwas hätten sie schon gesehen: tote Leute, denen etwas aus dem Mund kroch.
»Die Pheen hassen die Normalen«, sagt jetzt eine piepsige Stimme ganz nah bei mir. »Deswegen klauen sie ihnen ihre Seelen.«
»Die Normalen hassen die Pheen«, korrigiert jemand von links.
»Klappe!«, schreien einige andere. Sie wollen nun doch weiter hören, wie genau sich die Pheen an der Normalität rächen wollten.
Der Erzähler fährt also fort.
»Sie wollen sich für das Dementio rächen. Für ihre Schwester, die dort eingesperrt wurde und nie wieder herauskam.« Die Stimme wird kraftvoller und geschmeidiger. Entweder der Erzähler ist noch nicht lange dabei oder er raucht weniger Spot als die anderen.
»Das Dementio ist eine alte Idee, so alt wie die Normalität. Damals wusste niemand davon, es war sehr geheim. Die Normalen bauten es und sicherten es mit Stacheldraht, bewaffneten Soldaten und abgerichteten Hunden. Alle Pheen sollten dahin kommen. Aber die Pheen spürten die Gefahr und zogen sich in den Wald zurück. Nur eine einzige, sehr junge Phee wurde gefangen und ins Dementio gebracht. Sie war unerfahren und leichtsinnig und hatte vor nichts Angst. Und sie erwartete ein Kind. Vielleicht war es das, was die Phee so anfällig machte. Ein riesiges, großes, bewachtes Dementio für eine einzige, junge, schwangere Phee.
Die Nachbarn erzählten damals, dass sie das Weinen und Schreien der Phee nächtelang hörten. Sie kratzte an den Wänden und trommelte gegen die Fenster, bis man sie fesselte und knebelte, damit sie endlich still war. Trotzdem gelang es ihr, auch mit Knebel im Mund so laut zu sein, dass es den Nachbarn durch Mark und Bein ging. Selbst wenn sie sich die Ohren zuhielten, hörten sie die anklagende Stimme der jungen Phee, die sie wütend verfluchte.
Mein Kind wird euch zerstören, an seinen Flügeln werdet ihr es erkennen, hörten sie – es vibrierte nicht nur in ihren Ohren, sondern in ihrem ganzen Körper, ging ihnen unter die Haut, durch Mark und Bein.
Für einen Augenblick vergesse ich, wo ich bin. Ich spüre nicht mehr die kalte Erde unter mir, ich richte mich auf und versuche zu erkennen, wer da gerade erzählt, aber er ist verborgen in dem dichten Ring aus aneinandergedrückten Rücken und Gliedmaßen. Das Feuer knistert und das Rudel hält die Luft an.
Ich lege mir die Hand auf die Brust. Mein Herz schlägt so schnell, ich habe Angst, dass es mir gleich aus der Brust springt und davonhüpft.
Früher weckte mich der Juckreiz auf meinen Schulterblättern. Jetzt wache ich auf, weil meine Füße frieren. Das unterscheidet mich von den anderen in unserem Rudel: Alle scheinen sich an die nächtliche Kälte längst gewöhnt zu haben. Sie tragen nicht mehr am Leib als ich, übergroße Jacken aus den Müllcontainern über zerschlissenen Pullovern, abgerissene Ärmel unbrauchbar gewordener Hemden um die Beine gewickelt. Die Haut ihrer Sohlen ist bereits braun und hart, während meine unter der Schmutzschicht noch rosa und leider immer noch sehr empfindlich ist. Als hätte ich gerade erst meine Lederschuhe ausgezogen, von denen ich früher mehrere identische Paare im Schrank stehen hatte, natürlich blank poliert.
Nicht zufällig werden die Neulinge hier auch so genannt – Babyfüße. Ich bin ein Babyfuß, das heißt, ich bekomme als Letzte zu essen und kriege öfter als andere einen Ellbogen in die Magengrube, manchmal gönnerhaft, öfter rüpelhaft-gehässig. Sie erklären mir die Welt und ich höre zu. Ich brauche dieses Rudel, denn allein wäre ich längst verloren. Also nicke ich, stelle dumme Fragen, ziehe meine blau angelaufenen Zehen ein, kratze mit den schmutzigen, langen Nägeln an den Narben auf meinem Rücken herum.
Wegen meiner Ticks gelte ich als durchgeknallt, aber das wundert hier niemanden. Aus der Normalität herauszufallen, verursacht einen mittleren Dachschaden; manchmal ist es auch genau umgekehrt, der Dachschaden führt den Absturz herbei. Mein Schweigen über meine Vorgeschichte, meine Weigerung, mein Gesicht zu waschen, meine Unbeholfenheit in praktischen Dingen – das ist, so komisch es auch klingt, in meiner Situation das Normalste der Welt. Der Schmutz in meinem Gesicht ist mein wichtigster Schutz: Niemand aus meinem früheren Leben würde mich jetzt wiedererkennen. Ich bin ein Babyfuß ohne Namen. Mir ist es recht, als Babyfuß angesprochen zu werden, denn mein richtiger Name würde mich umbringen.
Es kommt selten vor, dass wir alle zusammen durch die Straßen ziehen. Immerhin sind wir, wenn das Rudel komplett ist, fast zwei Dutzend unterschiedlich gestörte, aber gleichermaßen zerlumpte Wesen. Weit würden wir zusammen nicht kommen. Mehr als drei Jugendliche, die gemeinsam unterwegs sind, gelten der Normalität als verdächtig, insbesondere dann, wenn es sich um Jugendliche mit fleckigen Gesichtern und vor Schmutz steifen Haaren in allen Regenbogenfarben handelt. Ich weiß nicht einmal genau, wer in unserem Rudel Mädchen und wer Junge ist. Ich verberge mein Gesicht, aber genauso wenig versuche ich, anderen in die Augen zu schauen und mir ihre Gesichtszüge zu merken.
Was sich dagegen nicht vermeiden lässt, sind die Stimmen, die sich einbrennen. Heiser sind fast alle, vor Kälte und Spot, aber trotzdem kann ich das Krächzen der Krähe vom hysterischen Geschrei der Hyäne unterscheiden, den Husten des Kojoten vom Kläffen des Feneks. Mir gefallen die Tiernamen in meinem Rudel, aber ich habe mir noch keinen eigenen verdient. Ich bleibe ein Babyfuß ohne Namen und ich muss dankbar sein, dass man mich durchfüttert, obwohl ich bis jetzt nicht wirklich von Nutzen war.
Meine Aufgabe ist denkbar einfach: rumzulaufen und möglichst unauffällig nach Essen zu suchen. Das Rudel nennt es Futter. Ich nenne es Abfall, aber ich habe gelernt, mein Gesicht dabei nicht mehr so angewidert zu verziehen. Früher, kichert die Hyäne abends am Feuer, war es einfacher. Überhaupt war alles einfacher. Man konnte in den Mülltonnen vor den Restaurants wühlen. Dann kamen die Schlösser an die Deckel der Mülltonnen. Irgendwann wurden sie sogar bewacht. Es war die Zeit, in der die kleineren Abfalleimer der kommunalen Straßen in den Blickpunkt des dauerhungrigen Rudels rückten, aber dort gab es nie viel zu holen, höchstens Zitronencreme- und Schokoladenspuren an der Verpackung von Vitaminriegeln, abgeknabberte Gehäuse von Äpfeln und Birnen, Mandarinenschalen, nicht ganz ausgekratzte Joghurtbecher.
Ich bin immer noch nicht hungrig genug, um irgendwas davon in die Hände zu nehmen, geschweige denn in den Mund. Dafür habe ich auch gelernt, welche Blätter und Beeren der städtischen Hecken essbar sind, wobei sich auch das rasch verändert: Was gestern noch genießbar war, wird heute mit Abwehrsprays gespritzt, von denen wir niesen und husten müssen und uns die Augen anschwellen. In der kurzen Zeit, die ich dabei bin, habe ich schon einige neue Sträucher entdeckt an Stellen, die am Vortag noch völlig kahl waren.
Die Idee hatte, wie immer, der Kojote: nicht mehr die Abfalleimer in Parks oder an öffentlichen Haltestellen durchsuchen, sondern vor Schulen. Wir gehen zum Lyzeum, sagt er an diesem Morgen. Dort würden die Müllkörbe überquellen vor angebissenen Sandwiches, fast kompletten Vitaminriegeln und höchstens zu einem Drittel geleerten Traubenzuckerpäckchen. Am Lyzeum studiert das Geld, flüstern die heiseren Stimmen in unserem Rudel. Die Lyzeisten holen sich an ihren Automaten und in der Kantine mehr Essen, als sie brauchen, schließlich ist alles bereits von ihren Eltern bezahlt. Sie haben aber selten Hunger und stopfen ihre schicken Taschen lieber mit Drogen voll als mit übrig gebliebenen Essensresten.
Die Vorstellung lässt die matten Gesichter im Rudel aufleuchten. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Gespräche darüber aufschnappe: Die Lyzeums-Tour gilt als die leichteste und ergiebigste und alle wollen dahin. Dürfen aber selten. Das Lyzeum ist bewacht und in seiner Nähe fällt man schnell auf. Ich bin die Einzige, die sich noch nie freiwillig für diese Tour gemeldet hat, und ich schüttele auch jetzt den Kopf, als Kojote mit seinem blauschwarzen Fingernagel auf mich zeigt.
»Babyfuß, du hast blaue Lippen. Du gehst heute zum Lyzeum. Bring was mit und futter dich selber auch mal satt.«
»Nein«, sage ich und alle schauen auf. Ich sage selten was. Ich lehne nie etwas ab. Und ich widerspreche nicht – schon gar nicht dem Kojoten. Die Ratte und der Lurch, das Pony und die Kröte verdauen es kurz und stimmen mir dann lautstark zu.
»Babyfuß ist doch total unfähig.«
»Babyfuß hat keine Ahnung.«
»Wieso darf er? Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr am Lyzeum.«
»Ruck, zuck hat er uns in die Scheiße geritten.«
Ich zucke immer noch zusammen, wenn ich Kraftausdrücke höre. An schmutzige Nägel und dauerknurrenden Magen habe ich mich gewöhnt, an Schimpfworte immer noch nicht.
»Siehst du nicht, wie daneben er ist, Kojote?«
Kojote wäre nicht Kojote, wenn er nicht alle mit einer Handbewegung zum Schweigen bringen könnte. Ich schau zwischen den Haarsträhnen, die mir ins Gesicht hängen, aus der Hocke zu ihm auf. Er sieht auf mich herunter, ich wende mich wie gewohnt ab. Zurückzustarren hieße, den Kampf herauszufordern, und ich könnte gerade nicht mal mit einer Katze kämpfen. Allerdings will ich auf keinen Fall zum Lyzeum. Das scheint Kojote als Einziger von ihnen zu kapieren und vermutlich sagt er exakt aus diesem Grund so leise, dass alle die Luft anhalten, um ihn hören zu können:
»Babyfuß geht zum Lyzeum. Damit er uns nicht in die Scheiße reitet, komme ich mit und passe auf.« Dabei krümmen sich seine Lippen ganz leicht, als er das Wörtchen er ausspricht. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass er das extra sagt, weil ihm sehr wohl bewusst ist, dass ich eigentlich eine sie bin – als wären Babyfüße nicht geschlechtslose Wesen, die sich allesamt zum Verwechseln ähnlich in ihrer Hilflosigkeit und ihrem Dauerfrieren sind.
Darauf sagt keiner mehr etwas. Ich habe in der kurzen Zeit, die ich im Rudel bin, nicht herausfinden können, warum hier niemand dem Kojoten widerspricht. Es gibt Jungs, die deutlich größer und vermutlich auch älter sind – so genau kann man es nie sagen. Kojote ist eher schmächtig als kräftig. Seine Lumpen unterscheiden sich kein bisschen von denen der anderen. Seine Füße sind schwarz.
Das Einzige, was an ihm auffällt, sind die hellsten Augen, die ich je gesehen habe. Ein Graublau fast an der Grenze zu Weiß. Wenn er seine Pupillen auf mich richtet, fühle ich mich wie aufgespießt. Wahrscheinlich geht es anderen auch so. Ich habe ihn selten die Stimme erheben hören. Meist spricht er leise und ist erstaunlich höflich.
Vor vier Tagen habe ich erlebt, wie er zugeschlagen hat. Von der Vorgeschichte hatte ich nichts mitbekommen, wie immer in eigene Gedanken vertieft, und habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie seine Faust plötzlich mitten in Hyänes Gesicht flog, wie Hyäne gleich darauf zurücktaumelte, einen blutigen Zahn ausspuckte und sich winselnd unter einen Haufen alter Zeitungen grub. Das kann ich nicht vergessen. Dass Kojote ausgerechnet ein Mädchen geschlagen hat, lässt mir die Perspektive, zum ersten Mal mit ihm allein unterwegs zu sein, nicht gerade rosig erscheinen.
»Willst du mir was sagen, Babyfuß?« Die fast farblosen Augen mit je einem schwarzen Punkt in der Mitte, spitz wie Stecknadelköpfe, bohren sich in meinen Blick. Ich fühle mich bedrängt, spüre Panik aufsteigen. Aus beinahe selbstmörderischem Trotz schiebe ich den fettigen Haarvorhang vor meinen Augen beiseite und starre gegen jede Vorsicht zurück. Manchmal habe ich solche Momente, obwohl ich sonst sehr vorsichtig bin, denn ich weiß, dass ich überleben muss.
Um uns herum wird es so still, wie es nur sein kann, wenn ein Dutzend verstopfte Nasen gleichzeitig die Luft anhalten. Ich höre deutlich, wie es in den chronisch verkühlten Atemwegen um mich herum rasselt. Sekunden dehnen sich endlos. Kojote wendet sich nicht ab und ich auch nicht. Ich lasse es jetzt drauf ankommen. Was habe ich schon zu verlieren?
Und dann kapiere ich es plötzlich.
Er weiß, wer ich bin.
Wenn er mich einfach ins Gesicht geschlagen hätte, wäre ich jetzt weniger erschrocken. Ich reiße den Kopf nach unten, Haare fallen mir wieder in die Augen, Tränen quellen hervor, ich wische mit der Faust drüber.
Kojote grinst. »Dann ist ja alles klar.« So eine raue Stimme, so ein sanfter Tonfall.
Lyzeum
Wir laufen Seite an Seite durch das Stadtzentrum. Der Weg ist elend lang und es wird wieder Abend werden, bis wir zurück sind. Früher bin ich solche Strecken nie gelaufen. Ich schaue auf meine Füße und könnte heulen vor Mitgefühl, das ich für jede einzelne meiner Zehen empfinde. Ich versuche, nicht vor Selbstmitleid zu zerfließen.
Meinen Blick halte ich aus mehreren Gründen gesenkt. So muss ich mich nicht damit beschäftigen, ob und wie Kojote mich anschaut und warum er es auf genau die Art und Weise tut, wie er es tut. Zweitens kann ich so am besten mein Gesicht verbergen. Das reduziert das Risiko, dass ich von jemandem erkannt werde.
Drittens: Es ist die einzige Möglichkeit zu ertragen, durch die Straßen zu laufen, über die mich einmal der gut gefederte Schulbus geschaukelt hat. Genauso einer wie der, der gerade vorbeifährt. Ich halte die Augen gesenkt, kann aber das vertraute zischende Geräusch nicht ausblenden, mit dem die kindsgroßen Busreifen an einer Ampel abbremsen.
Es hat nichts mehr mit mir zu tun, wiederhole ich mein neues Mantra, das mich jetzt am Leben halten muss. Das Mädchen, das mit diesem Bus gefahren ist, das bin nicht mehr ich. Das ist irgendwo in der Vergangenheit abgeblieben, ich habe sie verloren, nein, man hat sie mir weggenommen. Ich will sie nicht wiedersehen, ich habe nichts mehr mit ihr gemein.
Ich lüge mich selbst an.
Ich versuche, über etwas anderes nachzudenken. Zum Beispiel darüber, dass ich Glück habe: Es ist immerhin ein ungewöhnlich warmer Oktober. Ich mag es mir nicht ausmalen, wie es sich anfühlt, wenn es schneit und sich Eisspitzen in die nackten Sohlen bohren.
Ich könnte Kojote fragen.
»Was macht ihr eigentlich im Winter?«
»Wir fliegen in den Süden.«
Ich schaue zu ihm auf. »Im Ernst jetzt?«
»Nein.«
Ich senke den Blick wieder auf die Risse im Asphalt. Daraus drängen sich irgendwelche Gräser ans Tageslicht. Habe ich zu selten vor meine Füße geschaut oder war der Bürgersteig früher anders? Hat sich der Zustand der Straßen verschlechtert oder kommt es mir nur so vor? Kojote will mir nicht sagen, wie das Rudel barfuß im Winter überlebt.
Ich habe es nicht anders verdient. Ich rede mit niemandem, also kann ich auch nicht erwarten, dass irgendjemand mir helfen will. Schon gar nicht Kojote.
Wir sind jetzt da und können von der gegenüberliegenden Straßenseite das gusseiserne, herrlich altmodische Lyzeumstor sehen, so vertraut, dass der Anblick mir einen Stich versetzt. Neu ist die Bewachung. Wir haben alle mitbekommen, dass die Sicherheitsbranche floriert. Über jedem Blumenbeet hängt eine Überwachungskamera und vor jedem Bäcker steht jemand in grüner Uniform. Die privaten Dienste versuchen, sich im Farbton den Jacken und Helmen der Polizei anzunähern – dabei ist das patentierte Mintgrün der öffentlichen Sicherheit vorbehalten.
Das Lyzeum wird natürlich von der Polizei bewacht. Vier Männer in Mintgrün flankieren den Eingang, ich sehe neidisch auf ihre schweren, glänzenden Stiefel. Was würde ich jetzt alles dafür geben. Die Polizisten haben uns sofort entdeckt, sie bewegen sich aufeinander zu und unterhalten sich, wobei sie immer wieder auf uns deuten.
Ich trete automatisch hinter Kojotes Rücken.
»Siehst du sie, Babyfuß?«, sagt er leise.
»Natürlich sehe ich sie«, murmele ich. »Ich bin nicht blind.«
Dann begreife ich, dass er im Gegensatz zu mir nicht die Polizei meint, sondern die Mülltonnen. Aber das kann nicht sein Ernst sein. Die mintgrünen runden Eimer sind keine zwei Meter von den mintgrünen Uniformen entfernt. Die Eimer, in die ich selber unzählige Male Bonbonpapiere und Papierservietten versenkt habe.
»Wir können da nicht hin, Kojote.« Meine Stimme bekommt einen schrillen, bettelnden Unterton. »Siehst doch selbst, sie beobachten uns.«
»Jetzt mach dir nicht ins Hemd. Wir sind harmlos. Hast du Angst, dass du zurück nach Hause gebracht wirst?«
Ich bin so verblüfft, dass ich die Wachmänner für einen Moment vergesse. »Wohin?«, frage ich, schiebe mir die Haare aus dem Gesicht, blicke in Kojotes blaugraue Augen. »Sehe ich aus, als hätte ich ein Zuhause?«
»Halte die anderen nicht für zu dumm, Babyfuß.« Seine Hand schnellt nach vorn, packt meinen Unterarm. Ich versuche, mich aus seinem Griff zu winden, aber seine Finger sind unnachgiebig. Er schiebt den übergroßen Ärmel zur Seite und hält mir mein eigenes Handgelenk unter die Nase.
»Was ist das da?«
Ich muss seiner Aufmerksamkeit Respekt zollen: Der schmale weiße Streifen auf meiner Haut ist kaum zu erkennen. Aber er ist da, wenn man genau hinschaut, sieht man die Grenze zwischen der leichten Bräunung und der helleren Spur. Der Spur meines ID-Armbands.
»Lass mich los.« Ich zappele in seinem Griff. Er hält mich immer noch fest.
»Verrat mir, woher du kommst, Babyfuß.«
Ich schüttele den Kopf.
»Soll ich dir auf die Sprünge helfen?«
Ich halte still und blinzele ihn an.
»Okay, ich sag es dir. Du bist eine Normale, weil du ein Armband getragen hast. Das ist doch kein Staatsgeheimnis. Hör auf zu flennen, du bist nicht die einzige.« Endlich lässt er mich los.
»Ich war eine Normale«, sage ich und reibe mir das Handgelenk, auf dem sich die Spuren seiner Finger abzeichnen.
»Und was ist mit dir passiert?«, fragt er, aber es klingt nicht sonderlich interessiert.
»Meine Eltern haben sich getrennt.«
»Normale trennen sich nicht.«
»Das war vermutlich auch das Ende unserer Normalität. Mein Vater ist nicht gut damit zurechtgekommen und ziemlich schnell gestorben. Aber schon davor ging alles den Bach herunter.«
»Und deine Mutter?«
Ich schließe die Augen. Ich darf jetzt nicht an sie denken. Nicht daran, was passiert ist.
»Ist deine Mutter damit auch nicht zurechtgekommen?«, bohrt er nach.
Ich öffne ein Auge, plötzlich sehr erleichtert. Er weiß eigentlich gar nichts über mich, denke ich. Ich bin in Sicherheit, vorerst.
»Doch«, sage ich. »Sie ist bestens damit zurechtgekommen.«
»Also?«
Warum ist er so neugierig, denke ich wieder alarmiert, das passt doch gar nicht zu ihm. Der kurze Moment der Erleichterung ist vorbei. Ich zucke möglichst gleichgültig mit den Schultern. Das scheint ihm vielsagend genug zu sein, denn er lässt mich endlich in Ruhe.
Und ich atme aus. Was für ein Glück, dass er nicht weiß, wer der hilflose Babyfuß an seiner Seite in Wirklichkeit ist.
Vielleicht mache ich mir zu viele Sorgen, entdeckt zu werden. Immer wieder denke ich, dass ich mit meinem ungelenken, hilflosen Verhalten jedem sofort ins Auge springen muss. Ich weiß aber auch selber, dass hier ein Denkfehler ist. Verstörte Kinder und Jugendliche gehören neuerdings zum Stadtbild dazu wie die blau gestreiften Tulpen im Frühling in die Parks. Wohlstandskinder, die ihr Zuhause verloren haben, wundern niemanden mehr. Jeder einzelne dieser Teenager sieht aus, als wäre er gerade gegen eine Laterne gelaufen.
Ich kann es selber kaum fassen, dass es inzwischen so viele sind. Meine ersten Tage im Rudel liegen zwar nur drei Monate zurück, aber ich habe das Gefühl, seitdem ist eine Ewigkeit vergangen. Ich kann selber nicht sagen, ob es an meiner anfangs getrübten Wahrnehmung liegt oder ob sich die Welt um mich herum wirklich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Anfangs fiel mir noch jedes einzelne Straßenkind auf, dem man die frühere Normalität noch ansah: ein Haarschnitt, der herauszuwachsen begann, Kleider, die sicher noch von zu Hause stammten und langsam die ersten Risse bekamen. Als es dann so viele wurden, hörte ich auf, ihnen hinterherzustarren und mich zu fragen, was sie von mir unterschied.
Meistens macht das Rudel einen großen Bogen um diese Kids – weil sie als unzurechnungsfähig und als Klotz am Bein gelten. Keine Ahnung, warum sie für mich eine Ausnahme gemacht haben.
Manchmal lese ich alte Zeitungen, in die wir uns in den Nächten wickeln, weil die wenigen Decken nicht reichen, schon gar nicht für Babyfüße wie mich. Bibbernd vor Kälte lese ich Artikel über schreckliche Dinge, die neuerdings in normalen Haushalten geschehen. Ich sauge alles gierig in mich hinein, weil es mir eine abartige Erleichterung verschafft zu erfahren, dass ich nicht die Einzige bin, deren Welt zerbrochen ist.
Inzwischen habe ich das Gefühl, dass jedes dritte Wort in der Zeitung Phee lautet. Wenn Familien auseinandergehen, Vermögen dahinschmelzen, ehemals wohlerzogene Kinder durchdrehen, dann hat immer eine Phee ihre Finger im Spiel. Wenn die Aktienkurse abstürzen, Lebensmittel mit Krankheitserregern infiziert sind, selbst wenn ein arbeitsloser Ex-normaler Amok läuft: Es waren die Pheen.
Wie würde Kojote reagieren, wenn ich ihm meine Familiengeschichte erzählen würde? Zumindest den kleinen Teil, den ich kenne?
Kojote, meine Mutter ist eine Phee, formen meine Lippen, aber lautlos, und es ist nicht Kojotes Art, die Ohren zu spitzen, um das Gestammel eines dummen Babyfußes mitzukriegen. Ihr haltet mich für harmlos und hilflos. Wenn ihr wüsstet, wer ich wirklich bin, was würdet ihr dann mit mir tun?
»Was murmelst du da?«
»Nichts«, sage ich. »Lass uns um die Ecke gehen, dort ist noch eine Tür, die lässt sich nur von innen öffnen. An den Mülleimer davor kommen wir vielleicht leichter.«
»Deine alte Schule?«, fragt er scharfsinnig.
Wieder zucke ich zusammen, suche für den Bruchteil einer Sekunde seinen hellen Blick. »Und wennschon?«
Seine Hand streckt sich erneut in meine Richtung, ich will mich wegdrehen, aber er fasst mir nur unters Kinn und kitzelt mich kurz mit seinem Zeigefinger, als wäre ich ein Welpe, den man gern tätschelt. »Das macht mir gar nichts, Babyfuß. Es braucht dir nicht peinlich zu sein.«
Ich warte ab, bis seine Finger mich wieder loslassen, aber nun nimmt er mich an der Hand und zieht mich sanft mit.
»Dann zeig mir die besten Stellen, so als Ehemalige.«
Wir überqueren die Straße unter dem aufmerksamen Blick der Wachleute, nähern uns der Absperrung, laufen an dem hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zaun entlang. Das ist nicht verboten, denke ich, wir sind weniger als drei, wir randalieren nicht, wir sind ganz friedlich. Wir können nicht verhaftet werden wie letzte Woche die fünf minderjährigen Freaks, die sich zu laut unterhalten hatten. Darüber hatte ich ebenfalls in der Zeitung gelesen. Doch die Gänsehaut auf meinem Rücken kommt nicht von der Kälte, sondern von meiner Panik.
»Hast noch viele Freunde da?«, fragt Kojote, sein Tonfall ist distanziert und amüsiert zugleich. Seine Art, mich zu beobachten und zu kommentieren, verunsichert mich enorm. Ich verstehe nicht, warum er sich überhaupt mit mir abgibt, warum er nicht ausflippt vor Ungeduld über meine Langsamkeit, mich nicht verhöhnt und einfach stehen lässt, wie es jeder andere in dem Rudel sofort tun würde. Ich bin weniger als ein Niemand, ich zähle nicht, ich bin verachtenswert und abstoßend.
Ich sollte mich jetzt auf den Abfalleimer konzentrieren, mache jedoch den Fehler, zur Seite zu schauen. Mein Blick bleibt an einer Plakatwand hängen, sie ist beklebt mit Werbung für nervenstärkende Pillen ganz ohne Nebenwirkungen und natürlich wieder mit Pheen-Warnungen.
Und mit meinem Gesicht, das gleich dreifach zu sehen ist, weil ein Exemplar dieses Fahndungsplakates offenbar nicht gereicht hat. »Minderjährige Phee – allgemeingefährlich« steht direkt über meinem Scheitel, ironischerweise ist es ein Bild aus dem Jahrbuch des vergangenen Jahres, das mich mit erschrockenen, aufgerissenen Augen, einem mit einer Haarklammer zurückgesteckten Pony und Grübchen auf den noch ziemlich runden Wangen zeigt.
Ich muss wider meinen Willen lachen, denn die schreienden roten Buchstaben passen zu diesem kindlichen Gesicht ungefähr wie Maniküre zu Kojote. Für einen Moment wird mir schwindlig, aber ich zwinge mich, im Hier und Jetzt zu bleiben, nicht abzudriften in die Erinnerung von etwas, was für mich vermutlich unwiederbringlich verloren ist. Und während Kojote auf einen Mülleimer zusteuert, mache ich einen Schritt auf die Plakatwand zu und reiße blitzschnell eines meiner Gesichter mit den dazugehörigen Buchstaben herunter. Ich rolle das zerfranste Papier zusammen und stecke es in meinen Ärmel.
Danach ruiniere ich leider den ganzen Trip, denn als ich Kojote an einem aufgeklappten angebissenen Sandwich schnuppern sehe, übergebe ich mich direkt in die Mülltonne.
Gefährlich für die Allgemeinheit
Am Abend warte ich nicht auf die Strafe. Geprügelt wird selten; meist schicken sie den Schuldigen einfach vom Feuer weg und geben ihm nichts vom gesammelten Essen ab. Während sich das Rudel um die Flammen versammelt, ziehe ich mich lieber von selbst zurück. Ich entdecke ein Stück alte Wolldecke, die offenbar gerade niemand für sich beansprucht, und wickele sie um meine Füße. Ich bin es gewohnt, am ganzen Körper zu zittern und dem Klappern der eigenen Zähne zuzuhören. Das Knistern des Feuers weckt Sehnsucht in mir, nach Wärme und noch viel mehr, aber ich verbiete es mir, dem nachzuhängen.
Ich darf nicht an das Feuer denken. Wenn ich ihm erlaube, in meine Gedanken einzudringen, dann wird mir sofort heiß. Ich spüre, wie es mit einem Funken in meinem Innern beginnt, wie es meine Haarspitzen versengt, wie meine Wangen sich röten, wie mir der Schweiß ausbricht. Ich könnte das Feuer in meiner Erinnerung willkommen heißen, aber lieber friere ich mich freiwillig zu Tode. Ich will nicht die Zweige der Baumkronen in der Hitze knacken hören, das verzweifelte Rufen der Waldtiere mitkriegen und dabei wieder das Gesicht meiner Mutter vor Augen haben. Meine eigene Stimme: »Auch du hast mich immer angelogen! Ich will mit dir und deinem Wald nichts zu tun haben, du Phee!« Die Stimme meiner Mutter, die mich bittet, nichts von dem zu tun, was ich da gerade tue. Als wüsste ich, was gerade passiert, als könnte ich irgendwas kontrollieren. Ich spüre Flammen der Wut in meiner Brust lodern, ich habe das Gefühl, dass das Feuer mit den Worten meinen Mund verlässt und auf alles überspringt, was mich umgibt.
Ich schlage mir die Hände vors Gesicht, kühle mit den eisigen Handflächen die erhitzten Augenlider.
Das abgerissene Flugblatt raschelt in meinem Ärmel, ich ziehe es raus und streiche es auf meinem Knie glatt.
Gesucht: Juliane Rettemi, minderjährige Phee, allgemein gefährlich.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich darauf stoße. Die Plakate hängen überall in der Stadt herum. Ich sollte mich längst daran gewöhnt haben, trotzdem muss ich mich jedes Mal zügeln, um nicht empört zu protestieren oder loszulachen oder sie wütend herunterzureißen. Die Buchstaben setzen sich zu Worten zusammen, die aus den Krimis stammen könnten, die mein Vater so geliebt hat.
Nachdem die Phee heimtückisch ihren Vater, den Normalen Dr. Rudolf Rettemi, ermordet hat, fehlt von ihr jede Spur.
Ich kenne diesen Text auswendig, in manchen Nächten spreche ich ihn nach, um mich daran zu gewöhnen, dass das inzwischen mein Leben ist: Ich bin eine gesuchte Verbrecherin, eine gefährliche Unperson. Für Hinweise, die zu meiner Verhaftung führen, ist eine saftige Belohnung ausgesetzt. Unter anderen Umständen fände ich die Summe fast schon schmeichelhaft. Ich bin es nicht gewohnt, so wichtig zu sein, meinen Namen in den Artikeln zu lesen, die sich mit der Pheengefahr beschäftigen. Kein Beitrag, in dem ich nicht als Beispiel angeführt würde für das Risiko, eine Ehe mit der Phee einzugehen und mit ihr Nachwuchs zu bekommen.
Ich falte das Blatt mit meinem Gesicht zusammen und beginne, es in Fetzen zu reißen. Jemand schubst mich mit dem Fuß an, ich sehe hoch. Kojote steht neben mir und hält mir ein gepelltes und angebissenes Ei hin.
»Du musst was essen, Babyfuß. Du hättest nicht wegrennen brauchen. Ich bin nicht sauer, dass du mich vollgekotzt hast.«
»Ich will das Ei nicht«, lüge ich. Dabei knurrt mein Magen lauter, als meine Zähne klappern. Die Leere in meinem Bauch saugt alle Gedanken in sich hinein. Ich habe das Gefühl, innen ganz hohl zu sein.
Kojote beugt sich zu mir herunter, fasst mir mit der Hand ins Haar, zieht meinen Kopf zurück und stopft mir das Ei gewaltsam zwischen die Zähne. Ich schlage mit dem Fuß gegen seine Wade und spucke sofort wieder aus.
»Was fällt dir ein!«
Die Ei-Reste liegen zwischen meinen Knien auf dem Boden. Ich sehe den weißen und gelben Krümeln bedauernd hinterher. Hätte ich ein wenig länger nachgedacht, hätte ich das Ganze doch lieber runtergeschluckt.
Kojote schüttelt den Kopf. »Du bist der verrückteste Babyfuß, den ich je gesehen habe.«
Ich spüre, wie ein schiefes Grinsen ganz gegen meinen Willen mein Gesicht verzerrt.
»Was hast du da?«, fragt er plötzlich.
Ich reagiere zu langsam, denn schon reißt er mir die Fetzen des Faltblattes aus der Hand. Ich stopfe alles, was er nicht gekriegt hat, eilig in meinen Ärmel zurück. Er hat einige erwischt und dreht sie jetzt um. Auf dem einen Stück ist ein wenig von meiner Wange zu sehen, meine frühere Wange, wohlgemerkt, pausbäckig wie bei einem Kleinkind, sanft gerötet und mit einem niedlichen Grübchen gekrönt. Kein Vergleich zu meinem jetzigen hohlwangigen Gesicht. Auf dem anderen Papierfetzen ist ein Teil des Haaransatzes zu sehen, mit der Spange, die mit einem hellblauen Blümchen verziert ist.
Während Kojote sie betrachtet, hole ich die übrig gebliebenen Papierreste wieder hervor und reiße sie in noch kleinere Stücke. Gut, dass er keinen Ausriss mit einem Auge erwischt hat, denke ich. An den Augen könnte er mich noch erkennen. Ich muss noch vorsichtiger sein, mein Kopfgeld ist einfach zu hoch. Im Rudel gibt es niemanden, der sich in den letzten Monaten satt gegessen hätte.
»Wo hab ich das schon mal gesehen?«, überlegt Kojote laut und steckt zu meinem Entsetzen die beiden Papierstücke unter sein Hemd.
Er geht zurück zum Feuer, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen. Ich sammele das zerkrümelte Eigelb vom Boden auf und stopfe es hastig in den Mund, bevor eine der fetten aggressiven Tauben, die den Vergiftungskommandos der Stadtverwaltung bis jetzt entkommen sind, mich mit ihrem krummen Schnabel und ihren Flügeln beiseitedrängt und alles aufpickt.
In dieser Nacht erlaube ich mir das erste Mal seit längerer Zeit zu weinen. Das Rudel ist am Feuer enger zusammengerückt. Die Jungs und Mädchen, die Seite an Seite kauern, sich aufeinander abstützen, sehen mit ihren ineinander verkeilten Gliedmaßen und gerundeten Rücken wirklich wie Tiere aus. Die Haare stehen ab wie zerrupftes buntes Gefieder. Alle im Rudel haben Freakfrisuren. Der einzige Akt der Körperpflege, der hier nicht vernachlässigt wird, ist das regelmäßige Buntmachen der Haare mithilfe von Sprühfarben aus Metalldosen.
In den ersten Tagen hatte ich mich noch gefragt, was mit ihren Eltern passiert ist. Dann schnappte ich Gespräche auf, die sich um versoffene Väter drehten und um Mütter, die den Überblick über die Namen und die Anzahl ihrer Kinder verloren haben. Es ist genau das albtraumhafte Bild der Freaks, das ich als Kind eingebläut bekommen hatte. So etwas passiert eben, wenn man nicht normal ist. Und genau das ist jetzt auch mir passiert.
Da ich Berührungen nicht ertragen kann, bleibe ich abseits, bin niemals Teil der kuschelnden, im Einklang atmenden Meute. Ich wende mich vom Feuer ab, weil ich Sorge habe, dass ein Funke auf meine Gedanken überspringt und dann alles wieder losgeht. Ich habe schon genug kaputt gemacht, deswegen friere ich lieber, bis in den Schlaf und darüber hinaus.
Die heisere Stimme des unsichtbaren Erzählers schwebt über dem atmenden Rudel, dem erlöschenden Feuer, er darf die Geschichte des Vorabends weitererzählen, die Geschichte, die mich in einen Zustand seltsamer Unruhe versetzt.
»Das Kind der jungen Phee wurde im Dementio geboren. Es ist ein Kind, das als der größte Störfall in den Zeiten der Normalität in die geheimen Geschichtsbücher einging. Es war schrecklich verunstaltet und alle, die es sahen, bekamen furchtbare Angst und hatten nächtelang Albträume. Insbesondere dann, wenn sie die Flüche der Phee noch in den Ohren hatten. Mit diesem Kind musste etwas passieren, wenn die Normalität eine Chance haben sollte.
Experten hatten versucht, die schlimmsten Verunstaltungen zu operieren, um dem Kind wenigstens einen Hauch normales Leben zu ermöglichen. Sie nahmen es der Phee weg und ihre Schreie flogen über der Stadt, sodass nicht nur die Nachbarschaft des Dementio, sondern auch die zentralen Viertel keinen Schlaf mehr fanden.
Und eines Morgens war plötzlich alles still. Nicht nur über der Stadt, sondern auch im Dementio. Die Phee und ihr frisch operiertes Kind waren verschwunden. Die Anstalt stand verlassen und schwarz da und die diensthabenden Experten schauten mit leeren Augen den Wald an, der das Dementio umgab.«
Razzia
Als ich aufwache, stelle ich überrascht fest, dass ich nicht mehr auf dem Boden zusammengerollt liege, sondern auf beiden Beinen stehe, wobei sie immer wieder einknicken. Die Arme, die mich am Umfallen hindern, gehören Kojote, der mich kräftig durchrüttelt und dafür sorgt, dass ich in der Senkrechten bleibe. Ich reiße die verklebten Lider auseinander. Hinter Kojotes Rücken herrschen Gerenne und Geschrei, jemand tritt mit bloßen Füßen das Feuer aus, ein anderer klaubt die Decken zusammen und zwei gebückte Gestalten stopfen sich hastig die Reste der mageren Rudelvorräte in den Mund.
»Razzia, Babyfuß«, brüllt Kojote in mein Ohr und schlägt mich mit der flachen Hand auf die Wange. Obwohl die Bewegung so leicht und fast zärtlich aussieht, habe ich das Gefühl, dass mein Kopf wegfliegt. Dafür bin ich sofort wach.
Ich weiß, dass ich jetzt losrennen muss, genau wie alle anderen, die in unterschiedliche Richtungen davonschießen wie Strahlen von einer Lichtquelle. Doch das Geratter der nahenden Polizeimotorräder lähmt meine Beine. Die Erinnerung ist plötzlich wieder so nah und lebendig, als wäre es gerade erst passiert. Sie kommen, um mich zu holen, denke ich.