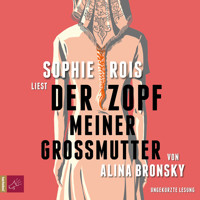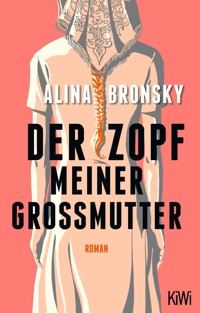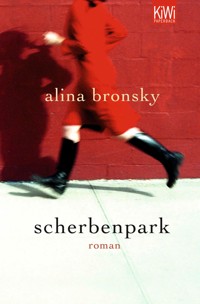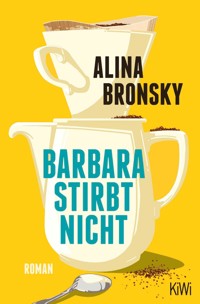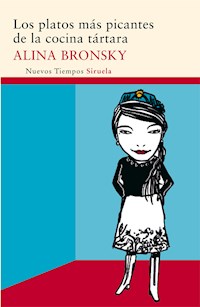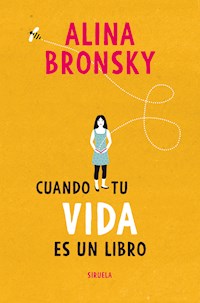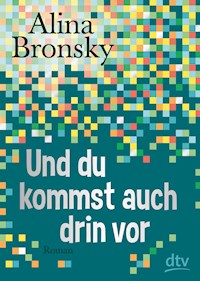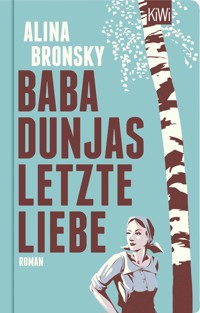8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alina Bronsky erzählt vom Aufbruch aus der Isolation, von der Hoffnung auf Verständnis, von der Sehnsucht, als der erkannt zu werden, der man wirklich ist – und damit von allem, was das Erwachsenwerden ausmacht. Rasend komisch und herzzerreißend traurig, niemals weinerlich, aber immer wieder herrlich böse. Marek traut seinen Augen nicht, als er den Gruppenraum im Familienbildungszentrum betritt: ein Stuhlkreis mit sechs versehrten Jugendlichen, geleitet von einem unrasierten Guru mit sanfter Stimme und langem Haar. Ausgerechnet eine Selbsthilfegruppe! Marek dachte, er würde eine Lerngruppe fürs externe Abitur besuchen, und will mit der »Krüppeltruppe« nichts zu tun haben – doch schon ist er mittendrin und sein Leben steht Kopf. In Alina Bronskys drittem Roman geht es erneut so rasant zu, dass man nicht weiß, ob man gerade lachen oder weinen soll. Ihr jugendlicher Held hat eine Kampfhund-Attacke auf sein Gesicht hinter sich, will mit dem Leben nichts mehr zu tun haben und das Leben nichts mehr mit ihm. Die Nummer seiner Freundin hat Marek auf immer und ewig gelöscht. Auf die Straße traut er sich nur im Dunkeln, und auch dann nur mit Sonnenbrille. Was als ultimative Demütigung beginnt – von seiner alleinerziehenden Mutter in die falsche Gruppe gelockt worden zu sein –, erweist sich bald als große Chance. Eine zickige Schönheit im Rollstuhl, eine zarte Liebe, eine gemeinsame Gruppenfreizeit und ein plötzlicher Todesfall lassen Marek seinen Weltschmerz für immer vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alina Bronsky
Nenn mich einfach Superheld
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alina Bronsky
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alina Bronsky
Alina Bronsky, geboren 1978 in Jekaterinburg/Russland, verbrachte ihre Kindheit auf der asiatischen Seite des Ural-Gebirges und ihre Jugend in Marburg und Darmstadt. Nach abgebrochenem Medizinstudium arbeitete sie als Werbetexterin und als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Sie lebt in Berlin. Ihr Debütroman »Scherbenpark« erhielt großes Kritikerlob und wurde zum Bestseller, Alina Bronsky zur »aufregendsten Newcomerin der Saison« (Der Spiegel). Ihr zweiter Roman »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche« erschien 2011 und war ebenfalls ein Kritikererfolg und Bestseller. »Scherbenpark« ist inzwischen beliebte Lektüre im Deutschunterricht und wurde für das Kino verfilmt. Die Rechte an Alina Bronskys Romanen wurden in 15 Länder verkauft.
Mit »Spiegelkind« und »Spiegelriss» hat sie sich in den letzten Jahren auch erfolgreich als Jugendbuchautorin etabliert.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Alina Bronsky erzählt vom Aufbruch aus der Isolation, von der Hoffnung auf Verständnis, von der Sehnsucht, als der erkannt zu werden, der man wirklich ist – und damit von allem, was das Erwachsenwerden ausmacht.
Dabei geht es so rasant zu, dass man nicht weiß, ob man gerade lachen oder weinen soll. Ihr jugendlicher Held hat eine Kampfhund-Attacke auf sein Gesicht hinter sich, will mit dem Leben nichts mehr zu tun haben und das Leben nichts mehr mit ihm. Die Nummer seiner Freundin hat Marek auf immer und ewig gelöscht. Auf die Straße traut er sich nur im Dunkeln, und auch dann nur mit Sonnenbrille.
Was als ultimative Demütigung beginnt – von seiner alleinerziehenden Mutter in eine Selbsthilfegruppe gelockt zu werden –, erweist sich schnell als große Chance. Eine zickige Schönheit im Rollstuhl, eine zarte Liebe, eine gemeinsame Gruppenfreizeit und ein plötzlicher Todesfall lassen Marek seinen Weltschmerz für immer vergessen. Rasend komisch, herzzerreißend traurig und immer wieder herrlich böse.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Nenn mich einfach Superheld
Leseprobe »Pi mal Daumen«
Für F., L. & S.
Mir war sofort klar, dass man mich reingelegt hatte. Ich schob mir den Hut in die Stirn, warf den Zettel mit der Adresse, den mir Claudia zugesteckt hatte (Familienbildungszentrum, Meditationsraum), zusammengeknüllt vor meine Füße und wollte mich schon umdrehen und wieder nach Hause fahren, als ich dieses Mädchen sah. Sie schaute mich kurz an und wandte sich sofort ab. Ich nahm es ihr nicht übel. Meine eigene Mutter hatte wochenlang üben müssen, mir ins Gesicht zu gucken, und dieses Mädchen kannte mich noch gar nicht. Ich rechnete es ihr hoch an, dass sie nicht sofort kotzte.
Anstatt also gleich umzukehren, blieb ich in der Tür stehen, schob den Hut wieder ein bisschen zurück und starrte wie ein Hornochse. Und begriff langsam, dass ich hier nicht weggehen würde. Nicht jetzt und am liebsten überhaupt nie mehr. Ich würde mich auf den letzten freien Stuhl setzen, der in dieser Runde stand und auf mich zu warten schien, und ich würde dieses Mädchen anschauen. Ich hatte noch nie eine derart märchenhafte Schönheit gesehen, mit solch grünen Augen, rabenschwarzen Haaren – und so traurig. Sie trug ein sehr langes Kleid mit feinen roten Blumen auf weißem Hintergrund, das ihre Beine bedeckte. Von mir aus hätte es auch kurz sein dürfen. In den Speichen ihres Rollstuhls leuchteten bunte Reflektoren, die wie Schmetterlinge und Butterblumen geformt waren.
Also hob ich den Zettel mit der Adresse wieder auf und stopfte ihn in die Hosentasche. Dann rückte ich die Sonnenbrille zurecht und ging unter den feindseligen Blicken der anderen auf den letzten leeren Stuhl zu.
Wir waren zu sechst. Außer diesem Mädchen und mir waren es: ein langhaariger Typ mit einer Beinprothese, ein schwammiges, teigiges Etwas mit rötlichem Flaum auf dem Kopf und ohne sichtbare Behinderungen, eine sehr langbeinige Tunte mit nervös umherirrendem Blick und ein arrogant dreinblickender Schönling, der wie ich eine Sonnenbrille trug. Meine war allerdings teurer. Er hatte sein Gesicht als Einziger nicht in meine Richtung gedreht.
Wir sollten jeder eine Bongo-Trommel auf den Schoß nehmen und einen Rhythmus vortrommeln, der unsere Persönlichkeit beschrieb, sagte der Guru und schleppte einen Haufen kürbisartiger Gebilde in die Mitte unseres Stuhlkreises. Und jetzt!
Als sich keiner rührte, dachte ich zum ersten Mal, dass ich hier vielleicht doch ganz richtig war.
Der Guru ließ sich nicht entmutigen. Er drehte sich im Kreis, um jedem von uns einzeln ins Gesicht zu schauen. Bei mir tat er es erwartungsgemäß sehr kurz, bei dem Mädchen genau umgekehrt. Ich konnte ihn verstehen. Ich wusste auch nicht, was man hier überhaupt tun sollte, außer sie anzuschauen. Trommeln etwa?
Wie hält sie es bloß aus, dachte ich. So schön und das einzige Mädchen unter lauter Jungs. Muss sie hier sein, weil sie im Rollstuhl sitzt und sich deswegen keiner dafür interessiert, was sie wirklich will? Haben ihre Eltern sie gezwungen? Wurde sie angelogen, genau wie ich?
Das Mädchen zuckte, ohne meinen Blick zu erwidern, mit der linken Schulter. Ich tat ihr den Gefallen und schaute zu den anderen. Die begannen unruhig auf ihren Stühlen hin und her zu rutschen.
Ich seufzte und richtete den Blick auf den Herrn der Trommeln.
Der Guru hatte, und das war peinlich genug, genau wie ich einen Hut auf. Deswegen war mein erster Impuls, mir meinen eigenen herunterzureißen. Andererseits war ich schon lange nicht mehr beim Friseur gewesen, und das Mädchen hatte mit meinem Anblick auch so schon genug zu tun.
Unter seinem Hut trug der Guru ein Gesicht unendlicher Güte. Er hatte etwas von einem alten Mädchen, das einmal sehr niedlich gewesen sein musste, Kulleraugen, die im Laufe der Jahre etwas verblasst waren, und viele kleine Falten um Mund und Augen. Seine Fröhlichkeit schien mir angesichts unserer düsteren Gesichter vollkommen deplatziert.
»Dann mach ich das eben für euch«, sagte er mit unerträglicher Sanftheit. »Ich fang mit dir an, Janne.«
So erfuhr ich, wie sie hieß.
Ich hatte schon den Verdacht gehabt, dass sie sehr stolz war, als ich ihre schmalen grünen Augen gesehen hatte. Er bestätigte sich, als sie dem Guru ins Wort fiel.
»Lassen Sie das«, sagte sie. »Was wissen Sie schon über mich.«
»Dann mach’s doch selber, Zuckerschnecke«, sagte der Guru und trommelte etwas Heiteres mit den Fingerknöcheln vor. Dabei lächelte er so, dass sie rot wurde.
»Ich fange an«, sagte ich, um sie zu erlösen. Aber ich war zu spät.
Der Streber mit der billigen Sonnenbrille war mir zuvorgekommen. Er hatte seinen Arm in die Höhe gestreckt und mit den Fingern geschnippt.
Er heiße Marlon, teilte er uns gnädig mit. Die erste Silbe zog er unendlich in die Länge. Ich schaute besorgt zu ihm rüber. Wenigstens meinen Vornamen wollte ich für mich allein haben – aber es stimmten zum Glück nur die ersten drei Buchstaben überein. Seine Stimme war ruhig und etwas schleppend, als wollte er mit jedem Ton ausdrücken, wie unglaublich lässig er war und wie furchtbar ihn unsere Gesellschaft langweilte. Er war seit seinem siebten Lebensjahr blind, mehr erfuhren wir nicht. Eine degenerative Netzhauterkrankung, dachte ich sofort, schlechte Gene, man kann da nicht wählerisch genug sein. Seine Familie besaß zwei Hunde, so groß und so groß – er hielt die Hände ganz schön weit überm Boden. Ich zuckte zusammen. Für einen Moment rutschten die abgeschabten Dielen des Meditationsraums unter meinen Füßen weg.
»Blindenhunde?« fragte der Guru mit diesem Ich-höre-euch-aktiv-zu-Gesicht.
Marlon machte eine Bewegung mit dem Kinn, die ganz entfernt mit Kopfschütteln zu tun hatte.
Er sei sehr geruchsempfindlich, sagte er und setzte eine bedeutungsvolle Pause. Seine Nase sei unglaublich fein, er könne riechen, was jeder Einzelne hier gestern zum Frühstück gegessen habe. Er bitte, darauf Rücksicht zu nehmen und verstärkt auf die Hygiene zu achten. Und genau aus diesem Grund werde er sich jetzt woanders hinsetzen.
Das teigige Wesen neben ihm atmete geräuschvoll aus und lief rot an. Ich hätte Mitleid mit ihm gehabt, wenn ich mich nicht selbst so vor ihm geekelt hätte.
Alle sahen schweigend zu, wie Marlon sich erhob, mit Leichtigkeit seinen Stuhl nahm und ihn an Jannes Seite trug. Dass hier schon die nervöse Tunte saß, schien ihn nicht zu stören. Er konnte sie ja angeblich nicht sehen. Sie faltete sich zusammen und rutschte mit ihrem Stuhl unter Marlon hindurch und in den Kreis hinein. Marlon stellte seinen Stuhl auf den frei gewordenen Platz, setzte sich hin, das Gesicht zu Janne gewandt, und atmete tief ein. Seine Nasenflügel bebten.
Janne hob die Hand. Ich dachte, dass sie ihm jetzt eine knallen würde. Ich hätte es jedenfalls gut gefunden. Stattdessen fuchtelte sie mit ihren langen, zarten Fingern vor Marlons Sonnenbrille herum.
»Und du siehst wirklich gar nichts?«
Er fing ihre Hand in der Luft. »Mach keinen Wind«, sagte er und legte sie an seine Wange.
Ich beschloss, doch nicht mehr hierherzukommen. Obwohl ich zum ersten Mal sah, wie Janne lächelte.
Irgendwann schlug der Guru einen Gong. Wir starrten ihn an, unschlüssig, was er uns damit sagen wollte.
»Wir sind fertig für heute«, sagte er. In seinen verkrampften Mundwinkeln verbarg sich aufrichtige Erleichterung.
Bis auf Janne und den Blinden standen alle wie in Zeitlupe auf, als wären sie unsicher, ob sie jetzt wirklich gehen durften. Dann eilten sie auf den Ausgang zu. Ich ließ den Typen mit der Beinprothese vor, ich hatte Angst, ihn umzurennen. Er war erstaunlich flott, obwohl die Prothese kürzer zu sein schien als sein richtiges Bein. Vielleicht war er einer von denen, die für die Paralympics trainierten. Er hieß Richard, aber es gab für mich nicht den geringsten Grund, mir seinen Namen zu merken.
In der Tür stieß ich mit dem Teigigen zusammen. Er fühlte sich wie eine Qualle an. Es hätte mich durchaus interessiert, welche Behinderung er hatte. Das war nicht zur Sprache gekommen. Eigentlich war, von unseren Vornamen abgesehen, gar nichts zur Sprache gekommen, weil die nervöse Tunte den Rest der Stunde geweint und gezittert hatte. Der Guru hatte versucht, sie zu trösten. Schließlich hatte sie sich schluchzend in die Ecke gesetzt.
»Ich bin ein Psycho, achtet nicht auf mich«, hatte sie gesagt. Wir anderen hatten schweigend zugeguckt, wie der Guru mit einem Glas Leitungswasser, Rescue-Tropfen und einer Packung Taschentücher um sie herum tanzte. Daraufhin hatte ich in seinem Gesicht erstmals so etwas wie Verunsicherung entdeckt. Das hast du jetzt davon, hatte ich schadenfroh gedacht. Hättest doch lieber eine Yogalehrerausbildung gemacht oder irgendwas mit schamanischen Reisen.
Der Teigige hatte ein intaktes Gesicht, Arme und Beine und konnte sehen, hören und sprechen. Sein Name war Friedrich.
Ich wich zurück, um ihn vorzulassen, damit er endlich heimging und ich ihn nicht mehr sehen musste. Aber er tat das Gleiche und lächelte mich von unten an. Das fand ich schon wieder tapfer.
»Was ist Marek für ein Name?« fragte er.
»Polnisch.«
»Bist du Pole?«
»Nein. Das einzige Osteuropäische an mir ist die neue Frau meines Vaters.«
»Und wer war das?« Er deutete erst auf mein Gesicht, dann auf meine Hand.
»Ein Rottweiler«, sagte ich.
»Aber sehen kannst du?«
»Nein«, sagte ich und guckte an ihm vorbei.
Dann wandte ich mich rasch ab, damit er nicht auf die Idee kam, dass sich hier irgendjemand mit ihm unterhalten wollte, ging durch die verdammte Tür und rannte über den Flur.
Eine noch nicht alte, etwas puppenhafte Frau, die mir merkwürdig bekannt vorkam, lief auf mich zu. Als sie mich durch den Gang rennen sah, ließ sie ihre Handtasche fallen und versuchte, mir auszuweichen. Da ich das Gleiche vorhatte, stießen wir zusammen. Mein Hut glitt herunter. Ich fing ihn auf und hörte sie vor Schreck quietschen.
»Entschuldigen Sie bitte, ich bin heute so tollpatschig«, sagte sie und lächelte an mir vorbei. Ihr Kinn zitterte ein wenig.
Ich wollte etwas Böses erwidern. Aber dann begriff ich, warum sie mir so bekannt vorkam. Sie hatte Jannes Gesicht, wie es in zwanzig, dreißig Jahren aussehen würde. Ich sagte gar nichts und rannte weiter.
In der S-Bahn setzte ich mich ans Fenster und zog den Hut tiefer ins Gesicht. Der Waggon füllte sich schnell. Ich blieb wie immer allein auf dem Viererplatz.
Ich hatte den Eindruck, beim Einsteigen hinter all den Rücken Friedrichs rötlichen Schopf gesehen zu haben. Dann war er wieder verschwunden, und ich suchte nicht nach ihm. Sollten wir uns zufällig irgendwo begegnen, hatte ich nicht vor, ihn zu grüßen. Als ob ich noch in Fußgängerzonen ging oder in Parks oder in Museen oder in Clubs oder in Sportstudios.
Ich wollte ausnahmsweise nicht sofort wieder nach Hause. Ich fuhr zu Claudia in die Kanzlei. Ich wollte ihr im Gegenzug den Tag versauen.
Vorher musste ich an Marietta vorbei, die Claudia immer als ihre rechte Hand bezeichnete. Dabei war sie wie ich Linkshänderin. Marietta erhob sich, als ich reinkam, und umfasste ganz fest die Tischkante, als bräuchte sie jetzt extra Halt.
»Marek.« Sie sah zu mir hoch, und ihre volle knallrote Unterlippe zitterte ein bisschen. Ich überlegte kurz, wie es sich anfühlen würde, sich daran festzubeißen. Seit dem Rottweiler hatte ich niemanden mehr geküsst. Schon dafür gehörten alle Rottweiler dieser Welt bei lebendigem Leibe gehäutet.
Ich seufzte und guckte kurz in Mariettas Ausschnitt. Ich mochte sie schon dafür, dass sie aufgehört hatte, mich zu duzen, als ich dreizehn geworden war. Und dass sie mich so behandelte, als würde sie auch von mir bezahlt. Außerdem schimmerte ein Hauch roter Spitze unter der nicht ganz blickdichten weißen Bluse durch.
»Schön, dass Sie uns besuchen. Ihre Mutter ist gerade im Gespräch. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Ich hab’s eilig«, sagte ich. Sie stellte sich mir entschlossen in den Weg. Ich schob sie vorsichtig, aber ebenso entschlossen beiseite. Ich wollte ihr nicht wehtun.
»Claudia!« rief ich laut.
Die Kanzlei war hässlich, und ich fragte mich immer, ob Claudia sie so eingerichtet hatte, um zu demonstrieren, dass es hier nur um Kompetenz und nicht um Schnickschnack ging. Der Flur war lang und schmal wie eine Darmschlinge, der Boden mit einem gräulichen Teppichboden ausgelegt, links und rechts dämmerten geschlossene Milchglastüren. Dazwischen hingen gerahmte Rechtecke voller düsterer Kleckse.
Hinter einer der Türen donnerte Claudias Stimme. Komischerweise musste ich lächeln. Ein godzillaartiger Schatten fiel auf die Tür, dann sprang sie auf, und schon rauschte Claudia heraus, im maßgeschneiderten Kostüm mit einem für eine Fünfzigjährige viel zu kurzen Rock. Ihr etwas unordentlich geschminkter Mund war zusammengekniffen, und die Augen sprühten Funken.
»Haben wir ein Problem?«
»Ich nicht. Du. Du hast mich angelogen.« Ich kümmerte mich nicht darum, ob der Klient mich hören konnte. »Es ist überhaupt keine Privatgruppe für ein externes Abitur. Es ist eine gottverdammte Selbsthilfegruppe für Krüppel mit einem armseligen Alleinunterhalter an der Spitze.«
»Dann bist du da ja genau richtig.« Sie stemmte die flache Hand gegen meine Brust und schob mich weg von der angelehnten Tür. Dahinter herrschte betretenes Schweigen. Was Claudia aber keineswegs dazu veranlasste, die Stimme zu senken. »Ich habe einen Klienten, also ist es keine gute Zeit, hysterisch zu werden. Nimm deine Medikamente und beruhig dich.«
»Ich habe diese Medikamente nur eine Woche lang genommen, und auch nur, weil es hieß, sie seien gegen die Schmerzen. Und das ist jetzt ein Jahr her!« Ich wurde noch einen Tick lauter. Der Klient sollte nicht angestrengt lauschen müssen.
»Ach ja, richtig. Dann lass dir von Marietta einen Kaffee kochen und fahr nach Hause.«
»Warum hast du mich angelogen?«
»Warum hast du mich angelogen, warum hast du mich angelogen! Wieso wiederholst du das immer?«
»Also warum?«
»Wärest du sonst hingegangen?«
Ich hatte mich inzwischen zu der abgeschirmten Sitzgruppe schieben lassen, dem quadratischen Tisch mit kleinen glitzernden Mineralwasserflaschen und den ordentlich gestapelten Fachzeitschriften für Jäger. Ich ließ mich auf einen der Stühle neben einer Kiste mit speckigen Bauklötzen fallen, der daraufhin kläglich ächzte.
»Ich gehe auch nicht mehr hin, nur dass du es weißt.«
»Ist recht. Versaure zu Hause.«
Sie zog mir schmerzhaft an dem heil gebliebenen Ohr und verschwand hinter dem Milchglas. Die Tür, geräuschvoll zugezogen, vibrierte klirrend, und die benachbarten Türen stimmten mit ein. Claudias Entschuldigung hallte durch den Flur.
Ich nahm den Kaffee, den mir Marietta mit einem verständnisvollen Lächeln hinhielt, und verschüttete beim Trinken die Hälfte auf meine Hose. Ich konnte immer noch nicht richtig zurücklächeln, die Lippe tat weh, und die Haut spannte über der ganzen Wange, als wäre sie zu eng vernäht.
Im Auto hielt sie die Hand mit der Zigarette aus dem Fenster und schnippte die Asche in den Wind. Der Wind blies sie zurück, auf Claudias Ärmel sah sie aus wie Schuppen. Ich wartete darauf, dass sie mich über die Krüppel-Gruppe ausfragen würde. Dass sie sich für Behinderungen der anderen Teilnehmer interessieren und mir dann sagen würde, ich solle mich glücklich schätzen: Ich könne schließlich laufen, sehen und hören, mir stünde die Welt weiter offen. Sie hatte mir das alles schon länger nicht mehr gesagt.
»Claudia«, sagte ich. Sie schaute, von meinem Tonfall überrascht, zu mir rüber. »Wenn du ein Mädchen wärest: Würdest du schreiend vor mir wegrennen?«
»Ich bin ein Mädchen.« Sie schaltete das Radio aus und schob eine CD in den Schlitz am Armaturenbrett.
»Deswegen frage ich.«
»Du kennst doch dieses Märchen.« Es musste eine ihrer Yoga-CDs sein, das Auto füllte sich mit einem merkwürdigen Stöhnen. Claudia drehte die Lautstärke herunter, bis nur noch ein leises Summen zu hören war.
»Welches Märchen?«
»Die Schöne und das Biest.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, bis es salzig schmeckte, und spürte immer noch nichts. Es hatte eine Zeit gegeben, in der Claudia oft wiederholt hatte, dass ich gar nicht schlimm aussähe, dass ich fast so schön wäre wie früher, dass ich mich nicht zu verstecken brauchte. Dass meine Probleme nur im Kopf säßen: Ich hätte mir eingebildet, entstellt zu sein. »Guck dich doch mal im Spiegel an, du bist gar nicht hässlich«, hatte sie wiederholt und meinen Kopf festgehalten, weil ich mich von meinem Spiegelbild weggedreht hatte. »Das Leben ist wegen der paar Narben noch nicht vorbei, Marek.« Sie hatte es so oft abgespult, dass ich schon gedacht hatte: Wenn sie es noch zehn Mal sagt, glaube ich es ihr. Oder noch fünfzehn Mal. Oder hundert.
Und jetzt sagte sie: Die Schöne und das Biest. Ich schaute schweigend aus dem Fenster. Draußen war Nacht. Ich hatte in der Ecke über eine Jägerzeitschrift gebeugt gewartet, bis es dunkel geworden war. Marietta war längst nach Hause gegangen, und Claudia hätte mich beinahe in der Kanzlei eingeschlossen. Sie hatte eine Weile nach Luft geschnappt und sich die linke Brust gehalten, als ich sie von meinem Platz hinter dem Paravent gerufen hatte.
»Nimm wenigstens jetzt die verdammte Sonnenbrille ab.« Sie warf die Zigarette weg und schloss per Knopfdruck das Fenster. »Nicht, dass du dir auch noch die Augen verdirbst.«
Am nächsten Donnerstag war ich überrascht, dass sie alle wieder da waren. Bis auf Marlon und den Guru jedenfalls, und die vermisste ich nicht. Janne wurde von der Frau begleitet, die wie ihre ältere Kopie aussah. Nur eben mit Beinen. Sie schob Jannes Rollstuhl den langen Flur entlang, und die alten Dielen des Familienbildungszentrums quietschten unter den Rädern.
»Hallo, Janne«, sagte ich, als ich sie beide überholte.
»Hallo, Mark.« Sie sah flüchtig zu mir hoch und dann starr nach vorn. Ihre Mutter schielte schon ganz aufgeregt.
»Ich kann den Rollstuhl schieben«, sagte ich.
»Das ist sehr nett von Ihnen.« Jannes Mutter klammerte sich fester an die Griffe, als hätte sie Angst, dass ich ihr die Tochter entreißen wollte.
»Verpiss dich«, sagte Janne, ohne den Kopf zu drehen.
Ich zuckte mit den Schultern und ließ sie vor.
Die selbst ernannte Psycho-Tunte hatte sich ein besticktes Kissen mitgebracht, auf dem sie jetzt thronte. Ihr Name fiel mir wieder ein: Kevin. Ihr Lippenstift erinnerte mich an Claudias, war aber großflächiger und vor allem ordentlicher aufgetragen. Friedrich strahlte, als er mich sah, sodass ich mir spontan das Gesicht abtastete. Es war aber noch alles wie vorher. Richard mit der Prothese hatte seine beiden Beine, das echte und das künstliche, auf den benachbarten Stuhl gelegt und guckte teilnahmslos aus dem Fenster.
Ich hatte den Raum nach Janne betreten. Ihr waren die Begrüßungen nur so entgegengeflogen. Bei mir vergaßen sie es ganz. Ich verzichtete ebenfalls darauf.
»Tschüss, Mama«, sagte Janne eisern zur Frau, die sich aufgeregt umschaute, von einem zum anderen, und dabei ihre kleine Handtasche knetete. Janne rollte an den Rand des Kreises, den die anderen mit ihren Stühlen gebildet hatten. Für sie war ein Platz frei gelassen worden, daneben stand ein Stuhl. Ich bewegte mich auf ihn zu, wurde aber jäh von Jannes Blick gestoppt. Du nicht, sagte dieser Blick, und ich drehte eine Pirouette und wechselte die Richtung, als wäre ich gerade gegen eine Glaswand gelaufen. Was aber niemand komisch fand.
Richard nahm, ohne mich anzusehen, seine Extremitäten vom zweiten freien Stuhl. Dabei sah er so genervt aus, als ob ich darum gebettelt hätte, neben ihm sitzen zu dürfen.
Der Guru verspätete sich. Wir saßen schweigend da. Janne hatte einen Punkt an der Wand fixiert und sah wie versteinert aus. Richard las die Süddeutsche. Kevin und Friedrich schauten nach Blickkontakt gierend in die Runde.
Die Tür flog auf. Bis auf Richard sahen alle auf.
Es war aber nur Marlon, den ich bereits vollkommen verdrängt hatte.
Jetzt nahm ich ihm eher ab, dass er blind war. Er stand in der Tür und wiegte sich auf den Fußballen. Seine Stirn war gerunzelt, und die Nasenflügel bebten. Ich fragte mich, wie seine Augen unter der Brille aussahen. Ob auch er etwas zu verbergen hatte. Oder ob ihm einfach jemand gesagt hatte, mit Brille würde er so cool aussehen wie Agent K aus »Men in Black«. Seine Freundin vielleicht. Er sah aus wie jemand, der regelmäßig Sex hatte.
»Hier ist frei«, sagte Janne leise. Er drehte den Kopf in ihre Richtung. Mit unsicheren Schritten ging er auf Janne zu, stolperte über ihren Rollstuhl und verlor fast das Gleichgewicht. Ihre Hand schnellte ihm entgegen, um ihn zu stützen, aber da stand er schon wieder. Jede Wette, dass er das absichtlich gemacht hatte. Dann ertastete er den freien Stuhl und ließ sich fallen. Er streckte seine Hand in Jannes Richtung, erreichte sie aber nicht. Und sie kam ihm diesmal auch nicht entgegen.
Ich fragte mich, ob Marlon ahnte, dass ihn gerade alle ansahen. Blinde spürten ja so etwas angeblich. Janne jedenfalls wusste genau, dass sie angestarrt wurde, als wären wir eine Proletenfamilie und sie unsere Glotze. Aber es schien ihr nichts auszumachen. Vielleicht genoss sie es sogar.
»Sind wir komplett?« fragte Marlon Janne. Sie zuckte mit den Schultern und sah kurz in die Runde.
»Der Guru fehlt«, sagte Richard. »Wahrscheinlich braucht er dringend ein neues Chinesisch-Lehrbuch.«
»Wieso Chinesisch?« fragte Friedrich.
»Weil ich mich eigentlich für einen Chinesisch-Crashkurs angemeldet habe.« Richard sah wehmütig aus dem Fenster.
»Ich glaube nicht, dass das hier so ein Kurs ist.« Friedrich klang verunsichert.
»Denkst du, ich glaube das?« Richard rollte die Zeitung zusammen, holte aus und schlug gegen die Wand. Kevin zuckte zusammen. Etwas Winziges, Schwarzes fiel auf den Boden. Hätte ich nicht das Knacken eines Panzers gehört, hätte ich es für eine Stubenfliege gehalten.
»Und du, Janne?« fragte Friedrich. »Warum bist du hier?«
Sie ignorierte die Frage. Schaute ihn nicht einmal an.
Wir hörten, wie jemand über den Flur rannte. Dann stand der Guru nach Luft schnappend in der Tür.
»Keinen Parkplatz gefunden?« fragte Kevin besorgt.
Der Guru hielt sich keuchend die Brust und lehnte sich gegen den Türrahmen. Er sah nicht nur völlig fertig, sondern auch sehr erstaunt aus.
»Ihr seid ja alle da.«
»Wo sind eigentlich die Trommeln?« fragte Kevin mit dünner Stimme.
Friedrich war der Einzige, der sich angemeldet hatte, um, wie er sagte, Kontakt zu anderen Behinderten zu bekommen. Der Guru schaukelte auf den Hinterbeinen seines Stuhls und ließ ihn erzählen. Beim Sprechen ließ Friedrich seine kleinen braunen Augen ausgerechnet auf mir ruhen. Ich schlug die Beine übereinander, nahm den Hut ab, setzte ihn auf das Knie und strich mir die Haare glatt. Sie waren nicht nur seit einer Ewigkeit nicht mehr geschnitten worden, sondern auch seit einer halben Ewigkeit ungekämmt. Meine Finger verfingen sich in den verfilzten Strähnen. Als Friedrich zu beschreiben begann, wie seine inneren Organe sich aufgrund einer Autoimmunerkrankung auflösten und dass er nicht mehr lange zu leben habe, wurde mir übel.
Friedrich zählte freudig die Medikamente auf, die er täglich nahm. Sie hatten komplizierte, poetische Namen, die er sichtlich gern aussprach.
»Hör auf«, sagte Janne, als er beim vierten angekommen war. »Das interessiert hier keinen.«
Friedrich verschluckte sich. Er vergaß, den Mund zu schließen, und kaute noch eine Weile an der Luft herum.
»Wir sind doch zum Reden da.«
»Aber doch nicht mit dir«, sagte Marlon.
Kevin begann schon wieder zu zittern.
Der Guru räusperte sich und drehte sich plötzlich zu mir.
»Sag mal, Mark.«
»Marek.«
»Sag mal, Marek. Vor einem Jahr war doch diese Geschichte mit dem Kampfhund in der Zeitung, der einen Jungen angegriffen hat.«
»Echt?« sagte ich. Zum ersten Mal schaute mich Janne länger als eine Viertelsekunde an. Für eine weitere Viertelsekunde hätte ich mir vermutlich das Ohr ganz abbeißen lassen müssen.
»Ja bitte?« sagte ich in ihre Richtung.
»Ich frag mich nur …«, sagte der Guru. Alle schienen zu lauschen, seine Stimme hallte durch die atemlose Stille, und mir kribbelte der Rücken. Ich wollte nicht, dass sie mich anstarrten. Das taten sowieso alle, aber hier sah ich es nicht ein. Selbst der blinde Marlon hatte sich mit seinem linken Ohr zu mir gedreht und wirkte plötzlich hoch konzentriert.
»… ob du uns davon erzählen möchtest«, sagte der Guru.
Ich war auf so viel Dreistigkeit nicht vorbereitet gewesen.
»Ich erinnere mich auch«, sagte Richard. »Das war so groß in den Zeitungen, und sie hatten auch ein Foto von ihm abgedruckt.«
»Welches Foto? Davor oder danach?« fragte Marlon.
Ich musste irgendwas tun, mich irgendwie ablenken, um nicht den Stuhl unter ihm wegzureißen. Also stand ich auf und verließ den Raum, und es war mir egal, ob Janne mich dabei endlich etwas länger anschaute.
Ich ging über die Straße, an all den beleuchteten Einzelhändlern und Kneipen vorbei, und in meinen Augen brannte es. Das tat es häufiger, und es war lästig. Ich wischte mit den Fingern unter der Sonnenbrille, aber das Brennen ließ nicht nach. Ich hätte mir die Brille abnehmen müssen, um mir mit einem Papiertaschentuch das Gesicht abzutrocknen, aber überall waren Menschen. Eine Grundschulklasse zog lachend und schnatternd an mir vorüber. Die meisten von ihnen gingen mir bis zum Bauchnabel.
Sie sahen mich nicht an, weil ich mich außerhalb ihres Blickwinkels und damit auch ihrer Welt befand, aber ich spürte es schon.
Wenn ich irgendwo auftauchte, änderten die Leute ihre Wege. Je voller es war, desto klarer wurden die Muster. Wo vorher Chaos geherrscht hatte, gab es auf einmal geregelte Bahnen, die alle nach einem sternartigen Schema das Ziel hatten, möglichst unbeschadet und mit maximalem Abstand an mir vorbeizukommen. Ich fühlte mich wie eine Knoblauchzehe auf einer Ameisenstraße. Wahrscheinlich bekamen die Leute das alles nicht richtig mit – ihr Unterbewusstsein veränderte ihre Umlaufbahn so nervenschonend, dass sie nie erfuhren, was ihre innere Unruhe ausgelöst hatte und welcher Gefahr sie entgangen waren.
Ich änderte meinen Kurs ebenfalls. Ich ging ins erste Eiscafé, das ich sah. Ich hatte noch nie gern Eis gegessen, aber gleich am Eingang war die Toilette. Ich glitt hinein und schloss ab. Ich machte das Licht aus und nahm die Sonnenbrille ab. Ertastete mit der Hand das Waschbecken. Dachte an Marlon und an seine Frage. Davor oder danach?
Ich hatte mich auf das Waschbecken gestützt, und die Tränen tropften auf meine Hände. Weinen war völlig unsinnig; aber wenn meine Augen so juckten und brannten, floss es von alleine. Ich fand den Wasserhahn und drehte ihn auf, spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Jemand klopfte an die Tür.
»Gleich«, brüllte ich und ließ mich auf den Klodeckel fallen.
Ein Auge juckte mehr als das andere. Wahrscheinlich hatten sie mir aus Versehen auch noch den Tränenkanal zugenäht. Claudia hatte am Anfang viel geheult, immer wenn sie gedacht hatte, dass ich es nicht mitkriege. Aber natürlich hatte ich alles mitbekommen. Sie war mit aufgedunsenem, fleckigem Gesicht umhergelaufen, mit zu Schlitzen verengten Augen, dazwischen Inseln ungleichmäßig aufgetragenen Abdeckstifts, und hatte gedacht, dass das keiner merkt.
Und dann war sie plötzlich wieder fröhlich geworden. Einfach so, ich hatte gar nicht bemerkt, wann es genau passiert war. Als wäre ein Schalter umgelegt worden. Sie hatte sich an alles gewöhnt, viel schneller, als ich erwartet hatte. Sie konnte mir ins Gesicht sehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Am Anfang hatte sie die Narben noch oft mit den Fingerspitzen berührt, gefragt, ob es wehtue, und beteuert, ich sei überhaupt nicht hässlich. Das machte sie inzwischen auch nicht mehr.
Die Klotür zitterte unter den Faustschlägen.
Ich stand auf, schob mir die Sonnenbrille in die Stirn und riss die Tür auf. Sah einen jungen Kellner mit schwarzer Hose, Weste und Fliege. Sein Mund öffnete sich in einem lautlosen Schrei, aber an der Rundung stimmte etwas nicht. Lippen- und Zungenschwäche, dachte ich. Hätte als Kind zum Logopäden gehen müssen. Bestimmt nuschelt er jetzt.
»Buh!« sagte ich und ging an ihm vorbei ins Freie.
Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass jemand meinen Pschyrembel genommen hatte.
Es war mein eigener, ich hatte ihn mir vor einem halben Jahr gekauft, in einer ordentlichen medizinischen Fachbuchhandlung. Er stand in meinem Buchregal zwischen einem anatomischen Atlas, einem von Großvater geerbten Lehrbuch der Gynäkologie und Geburtshilfe vom Beginn des letzten Jahrhunderts und einem ebenso historischen, jedoch absolut unnützen Wälzer mit dem romantischen Namen »Die Kunst zu heilen«, den nur sein schöner Umschlag vor dem Altpapier gerettet hatte. Den hatte mir Claudia vor zwei Monaten zum Geburtstag geschenkt, in der Hoffnung, dass mein neues Interesse für medizinische Nachschlagewerke irgendwas Gutes für meine Zukunft und unser Zusammenleben bedeutete.
»Siehst du«, hatte sie anerkennend gesagt, nachdem ich das Buch ausgepackt hatte. »Es ist völlig normal, dass man nach gravierenden Einschnitten neue Horizonte für sich entdeckt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schöner.«
»Amen«, hatte ich gesagt und das Geschenkpapier ordentlich zusammengefaltet. Ein kurzes Durchblättern des Wälzers bestätigte die Vermutung, dass Claudia auch mit diesem Geschenk völlig danebenlag. Ich interessierte mich nicht für die Geschichte der Medizin. Und ich wollte auch niemandem helfen. »Danke für das schöne Buch«, sagte ich. »Du darfst es dir jederzeit gern ausleihen, zum Beispiel, wenn du einen Briefbeschwerer brauchst.« Sie zuckte mit keiner Wimper.
Die Geschichte der Heilkunst stand noch da. Die Gynäkologie und Geburtshilfe ebenfalls. »Plastische Chirurgie: Band I Grundlagen Prinzipien Techniken«, Kostenpunkt 229 Euro, alles an seinem Platz.
Der Pschyrembel war weg.
Ich raste hinunter in die Küche und zog den Stecker des Staubsaugers, dessen Schlauch in den Händen unserer Putzfrau zuckte. Frau Hermann war eine hochgradig kurzsichtige und auch sonst schwer kranke Person. Früher einmal musste sie fitter gewesen sein, aber daran konnte ich mich nicht erinnern. Vorgestern war mir eine Spinnwebe von der Küchenlampe in die Minestrone gefallen.
Frau Hermann wandte sich zu mir um. Sie war sehr klapprig, und die wenigen grauweißen Fusselhaare standen von ihrem Kopf ab, zusammengehalten von einer Haarklammer wie bei einem Chihuahua.
»Möchten Sie einen Kaffee?« fragte ich. Ihr Blick streifte gleichgültig über mein Gesicht. Sie hatte ganz andere Probleme, deswegen fühlte ich mich in ihrer Gegenwart entspannt.
»Ja, vielleicht«, sagte sie.
»Kommt.« Ich malte mit den Händen ein Rechteck in die Luft. »Haben Sie mein dickes grünes Buch gesehen?«
»Das mit den Schweinereien?«
»Nein, das andere. Aber auch nicht lecker.«
»Grün?«
Ich nickte.
»Bei Mama auf dem Nachttisch«, sagte sie und drehte mir den Rücken zu. Dabei machte sie eine Geste mit zwei ausgestreckten Fingern. Ich verstand und stöpselte das Staubsaugerkabel wieder ein.
Ich hatte Claudias Schlafzimmer nicht mehr betreten, seit Dirk hier Einzug gehalten hatte. In letzter Zeit sprach ich mit niemandem; tagsüber ließ ich die Rollläden unten, döste oder blätterte in meinem Pschyrembel, und nachts ging ich spazieren, manchmal sogar ohne Sonnenbrille, und spürte die kühle samtige Luft an der Haut.
Claudia schien es nicht zu stören. Morgens hatte sie es eilig, und abends war Dirk da. Dazwischen arbeitete sie wie ein Tier. Dirk war mindestens zehn Jahre jünger als sie, ein Mann, der leicht debil aussah, aber laut Claudia hochbegabt war. Ich fragte mich, was ein Erwachsener mit seiner Hochbegabung anfangen sollte. Ob da nicht andere Werte langsam wichtiger wären, eine geräumige Wohnung mit Parkett und Kamin zum Beispiel. Ich fragte Claudia. Claudia sagte, ich müsse mir um Dirk keine Sorgen zu machen.
Das war unser vorerst letztes Gespräch zu diesem Thema gewesen.
»Mein Sohn hat schlechte Laune«, hatte Claudia an unserem ersten Abend zu dritt einen Tick zu laut zu Dirk gesagt. Dirk hatte zurückgefragt, was ich gegen meine Depressionen täte. Ich hatte meine Zimmertür zugeschlagen. Sollte er ruhig denken, dass ich nicht nur depressiv, sondern auch gewalttätig war.
Der Pschyrembel lag auf Claudias Nachttisch neben einem dicken Buch, das eine Frau mit hochgestecktem Haar und schönem Hals zeigte. Unter dem Pschyrembel lag noch ein dünnes, ich nahm es in die Hand. Es ging um die posttraumatische Belastungsstörung bei Jugendlichen. Ich legte es zurück. Dann überprüfte ich, ob meine Lesezeichen im Pschyrembel noch am richtigen Platz waren. Es war nicht Claudias Art, ungefragt in meinen Sachen zu stöbern. Ich war bereit, so großzügig zu sein: Vielleicht wollte sie einfach nur nachschlagen, ob eines ihrer Muttermale wie ein Melanom aussah.
Ich stellte den Pschyrembel zurück in mein Regal und googelte den Guru. Ich hätte seinen Namen gern vergessen, aber er hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt, also googelte ich ihn. Ich wollte sehen, ob er nicht zufällig ein Kindermörder war, nach dem seit Jahren gefahndet wurde. Ich fand aber keine Hinweise darauf. Er hatte bei einem freien Theater den gestiefelten Kater gespielt und ein Buch über Erleuchtung beim Wandern geschrieben. In der Kurzbiografie zum Buch stand, dass er Kindergärtner gewesen war und eine tödliche Krankheit besiegt hatte. Sein Facebook-Profil war nicht öffentlich. Als Kursleiter war er auch noch nicht groß in Erscheinung getreten, selbst unsere kleine Selbsthilfegruppe konnte ich in keinem Verzeichnis des Familienbildungszentrums finden.
Ich gab JANNE in die Suchmaske ein. Klickte auf Videos. Und blieb bis zum Abend vor dem Bildschirm hängen.
Als es am nächsten Freitagmittag klingelte, lag ich ausgestreckt auf meinem Bett und rührte mich nicht. Ich sah den Fischen im Aquarium zu und stellte mir vor, ich wäre einer von ihnen, zum Beispiel dieser fette, hässliche Wels, dessen ganzer Lebensinhalt es war, einen runden Stein abzulutschen. Er war so beschäftigt, dass er vor lauter Lutschen auch den Weltuntergang nicht mitgekriegt hätte. Darum beneidete ich ihn.
Claudia war in der Kanzlei. Ob Dirk auch Arbeit hatte, hatte ich noch nicht herausgefunden. Jedenfalls schlich er gerade einmal nicht durch unser Haus. Briefträgern öffnete ich grundsätzlich nicht. Claudias Post ging meist ans Büro, und mir schrieb längst keiner mehr. Dafür hatte ich nicht einmal etwas Besonders tun müssen, außer die Annahme der unzähligen Beileidsbriefe und Genesungskarten zu verweigern, die der Postbote vor einem Jahr in großen Stapeln aus seiner Tasche geholt hatte.
Es klingelte Sturm.
Ich schob die Füße in die Pantoffeln und ging runter, um die Klingel abzuschalten. Hinter dem Milchglas der Eingangstür bewegten sich mehrere Schatten.
Zeugen Jehovas, dachte ich, angetreten zur Gruppenvergewaltigung.
Jetzt schlugen sie auch noch an die Tür.
»Ich ruf gleich die Polizei«, brüllte ich. »Man merkt doch, dass keiner zu Hause ist.«
Jemand presste seine Nase gegen das Glas. Sah aus wie eine Schweineschnauze, grotesk verzerrt und vergrößert. Die Faustschläge hallten dumpf durch das ganze Haus.
Okay, dachte ich. Ihr habt es so gewollt.
Ich ging abgewandt am Flurspiegel vorbei, legte die Hand auf die Türklinke. Schloss mit der anderen Hand auf. Riss die Tür auf und trat in die Sonne.
Wie erwartet, wich einer von ihnen zurück und stolperte über seine eigenen Füße. Der andere rührte sich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er mich durch seine Sonnenbrille mit den Augen löcherte. Es dauerte, bis ich ihn erkannte.
Es war Marlon, und er lächelte. Hinter ihm rappelte sich Friedrich auf. Er hielt sich die Hand vor die Augen. Meine Sonnenbrille war im Haus. Ich war so viel Tageslicht nicht mehr gewohnt.
Ich erbarmte mich und drehte Friedrich den Rücken zu.
»Können wir reinkommen?« fragte Marlon.
»Hab ich euch eingeladen?« Ich stand immer noch mit dem Rücken zu ihnen. »Woher habt ihr meine Adresse?«
»Teilnehmerliste«, piepste Friedrich.
Auf der Kommode im Flur lag eine meiner Brillen. Ich setzte sie auf und drehte mich zu ihnen.
»Was wollt ihr?«
»Du bist gestern nicht zum Treffen gekommen«, sagte Marlon.
»Natürlich nicht.«
»Du fehlst aber.«
Ich dachte, ich hätte mich verhört. Es konnte nicht sein, dass Marlon das tatsächlich gesagt hatte. Also wartete ich, dass er noch etwas hinzufügte. Aber er schwieg, und es war klar, dass er nicht vorhatte, damit einfach so aufzuhören. Ich verlor als Erster die Geduld.
»Wem? Dir? Oder etwa dir, Friedrich?«
Marlon machte wieder diese knappe Kinnbewegung, die mehr sagte als tausend Worte. Muss ich mir merken, dachte ich.
»Der Gruppe. Jetzt mach kein Theater und lass uns rein.«
Ich konnte kaum glauben, dass sie wirklich da waren. Es waren schon so lange keine Leute mehr da gewesen. Die letzten 389 Tage fühlten sich nicht nach einem Jahr und einem Monat an, auch nicht nach zehn Jahren. 389 Tage waren eine Zeit irgendwo zwischen einem Wimpernschlag und der Unendlichkeit.
Ich hatte niemanden vermisst, und die beiden erst recht nicht. Sie saßen jetzt trotzdem an unserem Küchentisch, und Friedrich glotzte sich die Kulleraugen aus dem Kopf. Fast konnte ich hören, wie es in seinem Kopf ratterte. Er registrierte alles, den Gasherd, das Muster der Geschirrhandtücher, Claudias abartige Pflanzen in den Töpfen mit Hydrokultur, das Regal mit den aufgereihten Gewürzen und die kostbaren antiquarischen Teedosen, die aussahen, als wären sie vom Sperrmüll. Am liebsten hätte ich einen Vorhang vor all das gezogen. Oder, noch lieber, die beiden rausgeworfen.
Genau wie Claudia fingen sie zuerst mit Lügen an, und genau wie sie konnten sie es nicht lange durchhalten. Keine Ahnung, warum so viele Menschen das für eine gute Strategie hielten. Sie erzählten etwas von einem besonderen Projekt, das der Guru mit uns vorhatte. Ohne mich ginge es angeblich überhaupt nicht.