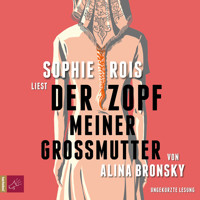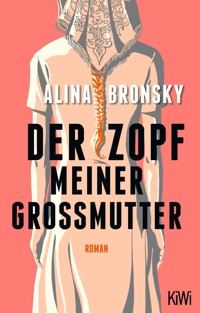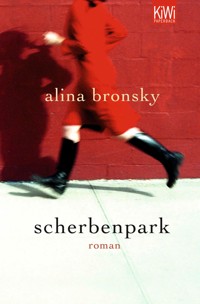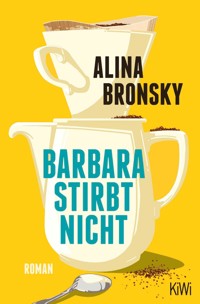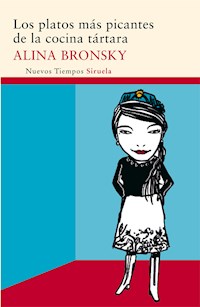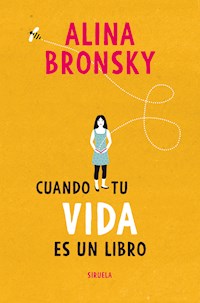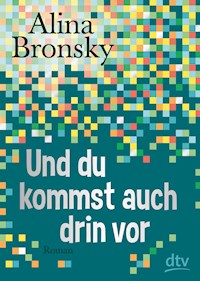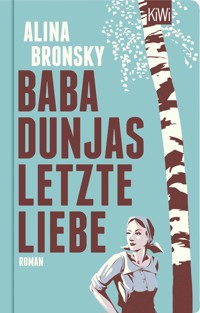19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet als Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen 2024 Bestseller-Autorin Alina Bronsky legt eine Komödie über zwei Menschen vor, die aus unterschiedlichen Welten stammen – und am Ende nicht mehr ohne einander sein wollen. Warmherzig, rasant und höchst unterhaltsam. Sie begegnen sich zum ersten Mal in einer Vorlesung: Der hochbegabte Oscar ist 16, hat einen Adelstitel und ist noch nie mit der U-Bahn gefahren. Moni Kosinsky hat drei Enkel, mehrere Nebenjobs und liebt knalligen Lippenstift und hohe Absätze. Sie ist fest entschlossen, sich heimlich den Traum von einem Mathe-Studium zu erfüllen. Doch im Hörsaal wird Moni für eine Putzfrau gehalten und belächelt. Wie kommt sie dazu, sich für eines der schwierigsten Fächer überhaupt einzuschreiben? Und woher kennt sie den berühmtesten Professor der Uni? Bald muss nicht nur Oscar feststellen, dass Monis Verstand und Beharrlichkeit größer sind als ihre Wissenslücken. Denn Mathematik schert sich nicht um Fragen der Herkunft, des Alters und des Aussehens. Oscar dagegen kämpft mit dem Alltag und findet ausgerechnet in der warmherzigen Moni eine Vertraute, die seinem Leben eine entscheidende Wendung gibt. Bald verbindet die beiden Außenseiter eine Freundschaft, die niemand für möglich gehalten hätte. Ein leichtfüßiger, raffinierter, tragikomischer Roman über eine schillernde Heldin und eine ungewöhnliche Freundschaft, die weit über Fragen nach der vierten Dimension und schlechtes Mensa-Essen hinaus durchs Studium und Leben trägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alina Bronsky
Pi mal Daumen
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alina Bronsky
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alina Bronsky
Alina Bronsky, geboren 1978 in Jekaterinburg/Russland, lebt seit den Neunzigerjahren in Deutschland. Ihr Debütroman »Scherbenpark« wurde zum Bestseller und fürs Kino verfilmt. »Baba Dunjas letzte Liebe« wurde für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert und ein großer Publikumserfolg. 2019 erschien ihr Roman »Der Zopf meiner Großmutter«, der ebenfalls wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Bestseller-Autorin Alina Bronsky legt eine Komödie über zwei Menschen vor, die aus unterschiedlichen Welten stammen – und am Ende nicht mehr ohne einander sein wollen. Warmherzig, rasant und höchst unterhaltsam.
Sie begegnen sich zum ersten Mal in einer Vorlesung: Der hochbegabte Oscar ist 16, hat einen Adelstitel und ist noch nie mit der U-Bahn gefahren. Moni Kosinsky hat drei Enkel, mehrere Nebenjobs und liebt knalligen Lippenstift und hohe Absätze. Sie ist fest entschlossen, sich heimlich den Traum von einem Mathe-Studium zu erfüllen.
Doch im Hörsaal wird Moni für eine Putzfrau gehalten und belächelt. Wie kommt sie dazu, sich für eines der schwierigsten Fächer überhaupt einzuschreiben? Und woher kennt sie den berühmtesten Professor der Uni?
Bald muss nicht nur Oscar feststellen, dass Monis Verstand und Beharrlichkeit größer sind als ihre Wissenslücken. Denn Mathematik schert sich nicht um Fragen der Herkunft, des Alters und des Aussehens. Oscar dagegen kämpft mit dem Alltag und findet ausgerechnet in der warmherzigen Moni eine Vertraute, die seinem Leben eine entscheidende Wendung gibt. Bald verbindet die beiden Außenseiter eine Freundschaft, die niemand für möglich gehalten hätte.
Ein leichtfüßiger, raffinierter, tragikomischer Roman über eine schillernde Heldin und eine ungewöhnliche Freundschaft, die weit über Fragen nach der vierten Dimension und schlechtes Mensa-Essen hinaus durchs Studium und Leben trägt.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/stammbaum-pi-mal-daumen
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Der Lauch und der Stiefel
Mittwoch mal Mittwoch
Der berühmteste Mathematiker Deutschlands
Dreiundzwanzig Geburtstage
Erst Yoga, dann Fechten
Wilder Abend
Frau Kosinsky hat das Wort
Wer ist Moni Kosinsky?
Hilf mir
Die Zauberzahl
Sie haben einen wunderbaren Jungen
Die Lücke im Stammbaum
Wer hat Angst vor der vierten Dimension?
Secret Santa
Wo ist Moni Kosinsky?
Mülltonne im Kopf
Monis Mängel
3,14 Euro
James Dean der Mathematik
Schnee von gestern
Happy Birthday I
Besessen
Gebrochene Existenz
Happy Birthday II
Das Herz des Herrn Kosinsky
Die blaue Pyramide
Der große Klau
Der Abschluss
Epilog
Der Lauch und der Stiefel
Als ich Moni Kosinsky zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder für eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte. Ich wunderte mich noch, wie man sich derart verirren konnte: Die Mensa befand sich einen zehnminütigen Fußweg entfernt. Die erste Vorlesung in Analysis hatte vor einer Viertelstunde begonnen, und Moni stand in der Tür, die jämmerlich gequietscht und dadurch alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie trug einen roten Kunstlederrock und eine tief ausgeschnittene Bluse mit Leopardenmuster. Über ihrer Schulter hing eine blaue, knallvolle Ikea-Tasche.
Professor Zschau hielt mitten im Satz inne, die Hand mit der Kreide in der Luft.
»Tschuldigung«, flüsterte Moni durchdringend und raschelte mit ihrer Tüte den Gang entlang. Sie blieb vor mir stehen. »Ist der Sitz hier noch frei, Kleiner? Rückst du ein Stück?«
Ich wurde rot und nickte.
Ich gab ihr nicht die geringste Chance.
Am Anfang des Semesters waren die Vorlesungen noch voll, die Leute mussten auf der Heizung oder auf dem Boden sitzen. Die Hälfte der Professoren hatte osteuropäische Namen. Sie waren besonders gefürchtet, weil sie den Stoff des ersten Uni-Semesters bereits in der neunten Klasse auf ihren spezialisierten Schulen gelernt und wenig Verständnis für das Schneckentempo in Deutschland hatten.
»Warten Sie ein paar Wochen«, hatte der Studiendekan Professor Orlov bei der Begrüßungsveranstaltung gesagt. »Dann sind wir wieder unter uns. Nach der ersten Woche geht jeder Zweite von Ihnen. Nach vierzehn Tagen bleibt ein Fünftel übrig. Nach der ersten Klausur weinen Sie alle bis auf zwei, drei Leute, die wirklich hierhergehören.«
Ich wusste, dass ich zu den wenigen Bleibenden gehören würde. Ich ließ den Blick über die Köpfe schweifen, um aufgrund des Erscheinungsbildes abzuschätzen, wer wie lange durchhalten würde. Es waren ein paar Ältere dabei, mit gestressten Gesichtern und silbrigem Haaransatz, die Mathelehrer werden wollten. Sie waren unangenehm überrascht davon, dass sie in den ersten Semestern dieselben Veranstaltungen wie richtige Mathematiker besuchen mussten. Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Sie wollten einen sicheren Arbeitsplatz und ihre Ruhe.
Von Mister Brown wusste ich, dass sie die Ersten waren, die sich über zu viele Übungsblätter und zu schwierige Klausuren beschweren würden. Sie würden die Dozenten sofort über die Anzahl und das Alter ihrer Kinder unterrichten, auf den Brotjob verweisen, der ihre Großfamilie nur notdürftig ernährte, und nach der ersten Woche versuchen, zu Germanistik oder Sonderpädagogik zu wechseln. Sie kamen mir wie Heiratsschwindler vor: Ich war der Meinung, dass nur Menschen, die es mit der Mathematik ernst meinten, dieses Fach studieren durften.
Moni saß neben mir, nachdem sie ihre Ikea-Tasche in den Gang gestellt hatte. Daraus lugten ein kleiner, bunter Gummistiefel und mehrere Stangen Lauch hervor. Ich konnte ihr Alter nicht schätzen. Ihre ausladende Figur erinnerte mich an unsere Haushälterin Frau Berger, ihre gelben Haare an die alten Puppen meiner Schwester Lou, ihre Kleider an die amerikanischen Pin-up-Plakate aus den Sechzigerjahren, die in unserem Billardzimmer hingen.
Während ich Moni verstohlen musterte, holte sie einen Stift heraus und begann, sich Notizen zu machen. Sie schrieb langsam, konzentriert, mit großen runden Buchstaben. Niemand würde es in diesem Tempo durchhalten. Mathematiker schrieben klein, schnell und unleserlich. Ich trainierte es seit der fünften Klasse.
Sie hatte mich schon in den ersten Minuten so abgelenkt, dass ich kurz vergessen hatte, der Vorlesung zu folgen. Als ich wieder nach vorn schaute, war eine der beiden Tafeln bereits vollgeschrieben und wurde hinter die andere geschoben.
»Mach dir nichts draus, Kleiner«, sagte Moni, als sie meine Panik bemerkte. »Du kannst bei mir abschreiben.«
Ich war es nicht gewohnt, dass fremde Menschen nach dem Erstkontakt weiter mit mir sprachen. Schon meine erste Reaktion war für mein Gegenüber meist so erschöpfend, dass kein weiterer Bedarf bestand. Nahezu alle Ausnahmen von dieser Regel erwiesen sich als Freaks. Monis wiederholter Redebedarf versetzte mich daher in Alarmbereitschaft.
Ich musste sie ganz schnell abschütteln. Sie hatte von nichts eine Ahnung. Zwar hatte sie einen handgeschriebenen und gefalteten Stundenplan dabei, der auf den ersten Blick auf dem Vorlesungsverzeichnis aus dem Vorjahr aufbaute. Dafür besaß sie nicht den blassesten Schimmer, wo die Mensa und wo die Bib waren und wie man sich für anwesenheitspflichtige Tutorien anmeldete. Ich fragte mich, wie sie es geschafft hatte, sich überhaupt zu immatrikulieren. Ihrem Smartphone-Modell nach zu urteilen musste sie noch älter sein, als ich gedacht hatte.
»Dreiundfünfzig«, sagte sie, obwohl ich sie gezielt nicht gefragt hatte. »Ich bin dreiundfünfzig. Guck nicht so schockiert. Und du, du siehst aus wie vierzehn.«
Das hörte ich nicht zum ersten Mal. »Ich werde bald siebzehn.«
»Ach du Schreck. Was machst du dann schon hier?«
»Früh eingeschult und eine Klasse übersprungen.«
»Wow«, sagte sie. »Wie konnten dich deine Eltern in die schlimme Großstadt ziehen lassen?«
»Es blieb ihnen nichts anders übrig.«
»Du bist ein ganz Schlauer, ja?«
»Ja«, sagte ich.
In Monis grünen Augen lag etwas, das wie eine Mischung aus Trauer und Mitgefühl aussah. »Dann bleib mal schön in meiner Nähe. Ich bin allerdings nicht so schlau. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man den Durchschnitt aus den IQs seiner beiden Kinder bildet, kommt ein normaler Mensch heraus.«
Ich hatte noch nie gehört, dass jemand sich bereitwillig als dumm bezeichnete. Vor lauter Verblüffung (und vermutlich unbewusst geprägt durch die karitative Tätigkeit meiner Familie) bot ich Moni an, ihr die Mensa, die Bib und das elektronische Campus-System zu zeigen.
»Was wäre ich nur ohne dich«, sagte sie.
Was für eine Verschwendung von Steuergeldern, dachte ich, als ich sie zu einem Automaten führte, aus dem sie die kleine Plastikkarte holen und wo sie diese auch aufladen konnte. »Damit können Sie Bahn fahren, sich als Studierende ausweisen und in der Mensa bezahlen.«
Sie trug die Karte ehrfürchtig auf der Handfläche wie einen Schmetterling, bis wir am Kaffeeautomaten standen. »Ich lad dich ein, Kleiner. Was willst du trinken? Ein Glas Milch?«
Ich winkte ab. »Sie müssen mir nichts ausgeben.«
»Lass mich doch. Zum Dank. Ohne dich wäre ich verloren.«
Weil sie recht hatte, erlaubte ich ihr, meinen Kamillentee zu bezahlen. Sie selbst drückte einen Knopf auf der Kaffeemaschine und balancierte einen Cappuccino auf einem Tablett zu einem Tisch am Fenster. Ich setzte mich neben sie, ernüchtert von der Bilanz: Ich hatte hier bislang keinen einzigen normalen Menschen kennengelernt.
»Ich fass es nicht.« Moni leckte den Milchschaum vom Löffel. »Ich trinke einfach so Cappuccino in der Uni-Mensa. Wie klingt das?«
»Absurd«, sagte ich höflich. Und dann dachte ich: Was soll’s? Ich war schließlich nicht hierhergekommen, um Freundschaften zu schließen. Ich wollte meinen Bachelor unter der Regelstudienzeit machen – fünf Semester[1] sollten reichen. Für den Master wollte ich ins europäische Ausland, für die Promotion in die USA.
Mister Brown hatte mir gesagt, dass Mathematik ein Mannschaftssport sei. Ich solle eine Lerngruppe finden, gemeinsam die wöchentlichen Übungszettel lösen, alles ausdiskutieren. Allein könne hier niemand bestehen. Aber ich war sicher, dass er sich zumindest darin irrte. Bislang hatte ich immer alles allein geschafft und war damit am weitesten gekommen. Hätte der geniale Andrew Wiles den Großen Satz von Fermat jemals lösen können, wenn er seine Teilergebnisse anderen geschenkt hätte? Hätte der geniale Autodidakt Srinivasa Ramanujan das Wort Teamarbeit buchstabieren können?
»In Analysis und linearer Algebra müssen wir unsere Lösungen in Zweiergruppen abgeben«, sagte ich. Eine Forderung, die mich bekümmerte, seit ich in der Orientierungswoche davon gehört hatte. Ich hatte extra die Hand gehoben, um zu fragen, ob ich auch allein abgeben dürfe.
»Trauen Sie sich ruhig, andere Menschen kennenzulernen«, hatte der Studiendekan Orlov geantwortet.
»Sie können mich nicht zwingen.«
Er hatte wie ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film gelächelt. »Wenn Sie bestehen wollen, schon.«
»Wir können eine Zweiergruppe bilden«, sagte ich daher zu Moni.
Ich sparte mir die Frage, ob sie vielleicht bereits einen anderen Partner hatte. Es war klar, dass niemand etwas mit ihr zu tun haben wollte.
Sie strich sich eine gelbblonde Locke aus dem Gesicht. »Ich will dich doch nicht runterziehen. Such dir lieber jemanden, der gut ist.«
»Gut bin ich selber«, sagte ich.
»Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich überhaupt für das Studium haben werde. Meine Tochter hat drei Kinder, und Keanu zahnt gerade.«
»Ihr Meerschweinchen?«, fragte ich höflich.
»Mein Enkel.« Sie lächelte. »Das ist der jüngste. Püppi schläft kaum, und ich helfe ihr immer. Püppi ist meine Tochter. Keanu ist der Enkel.«
»Ich kann die Aufgaben notfalls auch allein lösen«, sagte ich schnell, bevor sie noch auf die Idee kam, Fotos zu zeigen. »Machen Sie sich keinen Kopf. Ich schreibe einfach nur Ihren Namen auf das Blatt, weil wir eine Zweiergruppe bilden müssen. Sie kriegen die benötigten Punkte quasi umsonst von mir geschenkt.«
»Ich will dich nicht ausnutzen.«
»Ich arbeite sowieso am liebsten allein.«
»Sobald ich Zeit habe, mache ich zum Ausgleich mehr«, versprach sie, als ob sie mich nicht verstanden hätte. Und als ob sie mehr als zwei Wochen an der Universität sein würde. »Abgemacht? Ich geb dir meine Nummer.«
So war Moni Kosinsky der erste Telefonkontakt, den ich während meines Studiums einspeicherte. Nach minutenlangem Herumfuchteln hatte auch sie mich ihrem Adressbuch hinzugefügt.
»Oscar«, sagte ich, als sie die Nummer eingetippt hatte und mich fragend ansah.
»Und weiter?«
»Oscar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorff.« Ich buchstabierte.
»Hilfe«, sagte Moni. »Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?«
Mittwoch mal Mittwoch
Ich hatte bereits in der Grundschule angefangen, mich auf das Studium der Mathematik vorzubereiten. Mister Brown hatte mich zwar vorgewarnt, dass ich nichts, was es in der Schule zu lernen gab, an der Uni brauchen würde. Nicht das Einmaleins, nicht die binomischen Formeln, nicht die p-q-Formel, von stumpfsinnigen Freunden des Auswendiglernens auch Mitternachtsformel[2] genannt. Alles, was man brauche, müsse man neu lernen, hatte Mister Brown gesagt. Man müsse bereit sein, seinen Kopf neu zu formatieren. Im Mathestudium mit Schulwissen anzukommen war, als wollte man mit einer Sandkastenschaufel versuchen, einen See auszugraben. Man begriff, dass man in all den Schuljahren um das richtige Werkzeug betrogen worden war, und wollte am liebsten die Schule abfackeln.
Ich war also vorgewarnt. Trotzdem hatte ich meine Sandkastenschaufel ebenso dabei wie meinen programmierbaren Taschenrechner, das Geodreieck, den Zirkel und die Formelsammlung. Es konnte nicht schaden. Außerdem war mir alles präsent, was ich jemals im Mathematik-Unterricht, im Mathematik-Plus-Unterricht, in der Schüler-Sommeruni sowie in meinen eigenen Studien gelernt hatte. Ich ahnte, dass ich damit zu den Ausnahmen gehören würde. Es sollte sich herausstellen, dass ich das staatliche Bildungssystem dabei immer noch um Längen überschätzt hatte.
Nach einer Woche hatte ich immer noch mit niemandem aus meinem Studiengang gesprochen. Moni zählte nicht, ich betrachtete sie als Element null. Ich hatte in Analysis zweimal die Hand gehoben, als Professor Zschau eine extrem einfache Verständnisfrage zu den Inhalten der Vorlesung gestellt hatte. Außer meiner Hand waren noch zwei weitere in die Höhe gegangen.
Einige Tage war Moni nirgends zu sehen. Bald fragte ich mich, ob ich sie mir nur eingebildet hatte. Wie gut, dass ich meinen Eltern noch nichts von ihr erzählt hatte.
In der zweiten Woche war Moni wieder da. »Bist bisschen blass um die Nase. Was habe ich verpasst, Kleiner?«
»Nichts«, sagte ich, aufs Neue überrascht von ihrer chaotischen Erscheinung. Zwar hatte ich ihren Namen wie vereinbart auf die Abgabezettel der wöchentlichen Übungszettel geschrieben, aber nicht mehr mit ihr gerechnet.
»Ich hab mich zuerst zum Falschen gesetzt«, flüsterte sie. »Außer dir haben noch zwei andere blaue Haare.«
»Der eine hat einen Grünstich und der zweite eine Art rosa Rand«, sagte ich gekränkt. »Vielleicht sollten Sie Ihr Sehvermögen kontrollieren lassen?«
Monis Tasche vibrierte. Sie angelte ihr Handy heraus und drückte es ans Ohr. »Püppi? Was ist los, Kleines?«
Mehrere Leute kicherten.
Professor Newman betrat den Raum. Obwohl der Oktober ziemlich kühl war, trug er kurze Hosen und Sandalen ohne Socken. Am linken Ohrläppchen baumelte eine lange Kette, die aussah, als hätte sie ein Kleinkind aus Büroklammern gebastelt.
»Püppi, Süße, ich bin bei der Arbeit«, flüsterte Moni neben mir. »Ich kann jetzt nicht sprechen. Der Prof…, äh, der Chef ist gerade reingekommen. Ich melde mich.« Sie schickte Kusslaute durch den Lautsprecher, versenkte das Handy in der Tasche und drehte sich wieder zur Tafel. »Dass der nicht friert?«, murmelte sie.
Wahrscheinlich war das hier eine besonders raffinierte Art des Sozialbetrugs. Sie schlich sich in den Hörsaal und tat gegenüber anderen so, als würde sie in Wirklichkeit arbeiten. Vielleicht musste sie sich einfach irgendwo aufwärmen. Ich musste nicht alles verstehen, es war schließlich keine Matheaufgabe. Mathe musste ich dagegen verstehen, sonst war ich nicht ich selbst. Gerade zum Beispiel verstand ich nur Bahnhof, wenn ich zur Tafel blickte. Das machte mich wütend.
An mir konnte es nicht liegen. Die Vorlesung Mathematik im Zusammenhang war eine wirre Mischung aus Geometrie, Gruppentheorie und historischen Anekdoten. Sie hatte keinen richtigen Anfang und keine erkennbare Struktur. Ich hasste so etwas.
Ich schielte zu Moni. Sie hörte dem Professor mit offenem Mund zu. Ich sah zurück zur Tafel. Newman fragte gerade, was Mittwoch multipliziert mit Mittwoch ergeben würde. Moni hob die Hand. »Dienstag«, sagte sie. Das Gelächter erstarb, als der Professor nickte.
Ich schaute auf Monis Blatt. Sie hatte eine Art Multiplikationstabelle aus Wochentagen aufgemalt. Was passierte da? In welchen Schwachsinn war ich hineingeraten? Moni schubste mich an. »Guck, wie lustig. Man kann aus allem einen Zahlenkörper machen und damit herumrechnen. Das ist wie Zauberei.«
Mir wurde übel.
»Ich muss mal aufs Klo«, sagte ich. Als Moni mit ihrem ganzen Hab und Gut unter Geraschel und entschuldigendem Murmeln aufstand, um mich rauszulassen, griff die Aufmerksamkeit des Hörsaals mit ihren Tentakeln nach mir. Es war nicht die Aufmerksamkeit, die ich mir gewünscht und auf die ich mich mein bisheriges Leben lang vorbereitet hatte. Ich stolperte hinaus.
Im Vorraum befanden sich einige Tische und Stühle, daneben ein Kaffeeautomat und eine Art Apothekenschrank mit Schließfächern der Tutoren. Hier sollten wöchentlich unsere Hausaufgaben eingeworfen werden, als wäre das Internet noch nicht erfunden worden. Zum Glück war der Raum gerade leer. Zur späteren Stunde saßen hier oft blasse Gestalten, mal die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, mal mit verkehrt herum angezogenem Pullover. Sie hatten die Finger im Haar vergraben und starrten ein Blatt Papier an, manchmal hackten sie auch auf eine Laptoptastatur ein.
Ich lehnte mich gegen die Wand und rutschte langsam an ihr hinunter. Mein Herz klopfte im Hals, und die Luft sperrte sich dagegen, in meine Lungen eingezogen zu werden.
Die Tür quietschte erneut. Ich starrte auf den Fußboden, auf den jemand einen Zigarettenfilter geworfen hatte. Daneben zuckte eine Staubfluse im Durchzug. Wurde hier nicht regelmäßig geputzt? Wie sollte ich hier jemals lernen?
Jemand klackerte auf mich zu, und ein Stöckelschuh schob sich in mein Blickfeld.
»Was ist los? Bauchweh?«
Statt des Sauerstoffs hatte ich jetzt Monis Parfumwolke in der Nase, die einen biochemischen Anschlag auf meinen olfaktorischen Kortex verübte. Ich schüttelte den Kopf, um mich aus der imaginären Fliederhecke zu befreien, und duckte mich unter Monis Hand weg. Ich war schließlich kein Pudel, dem jedermann über den Kopf streicheln durfte.
»Steh mal auf, Kleiner. Setz dich mal schön auf den Stuhl.«
Irgendwie schaffte sie es, mir aufzuhelfen, praktisch ohne mich zu berühren. Sie beugte sich über mich und fühlte mit einer flüchtigen Bewegung meine Stirn.
»Ich bin okay.« Ich schob sie mit dem Ellbogen von mir.
»Hast du heute überhaupt gefrühstückt?«
Ich zuckte mit den Schultern. So aufdringlich war nicht einmal unsere Kinderfrau gewesen.
Moni klackerte einige Schritte auf ihren Schuhen davon, raschelte und klimperte. Der Automat brummte, und nun roch ich minderwertigen Kaffee, spürte den Plastikrand des Einwegbechers an meinen Lippen. Ich nahm große Schlucke, die gleichzeitig fade und bitter waren. Moni packte in der Zwischenzeit eine riesige Brotdose aus, Salami zwischen zwei Toastscheiben, Tierkekse in einem Extrafach, eine Handvoll Trauben und Apfelschnitze.
»Ich ernähre mich vegan«, würgte ich an der Salami vorbei, die sich in meinen Mund schob.
»Deswegen bist du bleich wie ein Gespenst«, sagte Moni. »Genau wie mein Justin.«
»Wer ist schon wieder Justin?«
»Mein Ältester. Also Enkel. Warte, ich zeig ihn dir.«
Ich schloss die Augen.
»Okay«, sagte Moni. »Ein andermal.«
Mein Unterkiefer machte sich selbstständig und mahlte auf allem herum, was sie mir in den Mund schob. Immer noch in der blühenden Fliederhecke stehend, schluckte ich die Salami hinunter, den Toast, die Kekse und zwei der Apfelschnitze. Plötzlich war die Luft wieder da. Mein Brustkorb dehnte sich, ich kostete die Atemzüge aus. Dann kippte ich, todesmutig eine Tachykardie riskierend, den Rest des Kaffees hinunter und guckte in die Brotdose, auf deren Deckel der Spiderman abblätterte.
»Sorry, ich hab Ihren Lunch aufgegessen.« Dann kapierte ich. »Das ist gar nicht Ihrer. Das ist für Ihren Kevin.«
»Quentin«, korrigierte Moni. »Der Mittlere. Für nach der Schule. Er isst nichts in der Schulkantine. Mach dir keinen Kopf, ich kauf ihm ein Schokocroissant. Die liebt er.«
Für einen Moment dachte ich daran, ihr zum Dank Geld anzubieten. Man hatte mir schließlich beigebracht, armen Leuten bis auf einen Anstandsbissen nichts wegzuessen, egal, wie unterzuckert man war. Vielleicht konnte sie sich jetzt wegen der Extraausgaben keine Zigaretten mehr leisten. Deswegen hielt ich mich wenigstens bei den Trauben zurück, auch wenn sie durchaus ansprechend aussahen.
»Es ist einfach alles zu viel, Kleiner«, sagte Moni. »Die Stadt ist brutal. In den Vorlesungen kapiert man nix. Man kennt niemanden. Jedes Übungsblatt dauert mindestens sieben Stunden, und es sind drei Stück pro Woche abzugeben. Das Wetter ist scheiße. Die erste Vorlesung beginnt um acht Uhr morgens. Wie soll man es schaffen, sich vorher etwas Vernünftiges zu essen zu machen?«
»Es tut mir leid, dass es so schwer für Sie ist«, würgte ich.
»Mir geht’s super«, sagte Moni. »Ich meine dich.«
Wir kehrten nicht in den Hörsaal zurück. Ich zeigte Moni die Übungsblätter in linearer Algebra, die ich am Vortag im Tutorium korrigiert zurückbekommen hatte. Ich hatte die volle Punktzahl erreicht, es waren einfache Einstiegsaufgaben gewesen.
Moni guckte zwischen mir und dem Blatt hin und her. »Was sind das für Pfeile?«
»Vektoren.«
»Nie gehört«, sagte Moni.
»Das lernt man in der Oberstufe.«
»Ich nicht«, sagte Moni.
»Im Mittelalter hat man nicht mal Brüche in der Schule gelernt«, sagte ich verständnisvoll.
»Kann man das irgendwo nachlesen?«, fragte Moni bekümmert.
»Die Brüche?«, fragte ich.
»Witzbold. Diese Pfeile.«
»Im Vorlesungsskript«, sagte ich. »Und in Lehrbüchern. Die können Sie mit Ihrem Studierendenausweis ausleihen oder auch kostenlos runterladen.«
»Kostenlos runterladen?« Sie sah mich an, als wäre ich der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Zometool[3]. »Alle Bücher einfach so runterladen?«
»Vielleicht nicht alle. Aber zumindest die wichtigen.«
Ihr verschlug es die Sprache. Um sie aus der Glücksstarre herauszuholen, erklärte ich ihr schnell meine Lösungen. Was eigentlich nicht meine Art war. Schon in der Schule hatte ich es gehasst, wenn ich dazu verdonnert wurde, anderen Menschen etwas beizubringen. Oscar, wenn du dich langweilst, hilf doch bitte den anderen. Versuche, deinen Lösungsweg so zu erklären, dass auch die anderen ihn verstehen. Ich war kein Lehrer. Meine Erklärungen halfen auch niemandem weiter. Wenn die Leute doof waren, konnte ich nichts tun. Wie sollte man auch offensichtliche Dinge erklären?
»Verstehe«, sagte Moni, als ich fertig war.
»Was?«, fragte ich misstrauisch.
»Alles«, sagte sie.
»Sicher?«
»Du erklärst gut«, sagte sie.
Es waren natürlich Grundlagen, die auch ein Grundschüler verstanden hätte. Vektoren addieren, subtrahieren, das Skalar- und das Kreuzprodukt. Eigentlich war das ganze Übungsblatt unverschämt einfach.
»So easy wird es nicht bleiben«, warnte ich.
Moni hob entschuldigend die Hand und griff in ihre schon wieder vibrierende Tasche.
»Püppi?«, sagte sie. »Oh nein. Nicht weinen, Kleines. Ich mach mich auf den Weg.«
Sie drückte das Telefon an die Brust.
»Was jetzt?«, fragte ich.
»Quentin hat in der Schule gekotzt.«
»Igitt«, sagte ich.
Moni warf hastig ihre Notizen in die Tasche.
»Sie können jetzt nicht einfach gehen«, sagte ich. »Gleich ist die nächste Vorlesung. Ich kann Ihnen nicht jedes Mal alles persönlich erklären.«
»Diese Woche versuche ich mich selbst an den Aufgaben«, sagte sie. »Du musst nicht immer meinen Arsch retten.« Und schon klackerte sie auf ihren Absätzen davon.
Der berühmteste Mathematiker Deutschlands
Wenn ich am Tag zu wenig Eiweiß zu mir nahm, träumte ich nachts von Gauß. Einem Gauß, der sich beschwerte, dass wir die Normalkurve nicht mehr auf den Geldscheinen hatten, seit die D-Mark abgeschafft worden war und niemand mehr mit den schönen alten Zehnern bezahlte. In meinen Träumen hatte er eine hohe, fast mädchenhafte Stimme, kicherte und war sehr von sich überzeugt. Er erzählte immer wieder diese abgedroschene Anekdote, wie ein Lehrer ihn in der Grundschule dazu verdonnert hatte, die Zahlen von Eins bis Hundert zu addieren, um ihn eine Weile beschäftigt zu halten. »Ich habe einfach Zahlenpaare gebildet und hunderteins mal fünfzig genommen«, kicherte Gauß mit enervierender Selbstzufriedenheit. »Ich war praktisch in einer Minute fertig. Da hat der Büttner ganz schön dumm geguckt. Seitdem heißt die Reihe kleiner Gauß.«
»Was ist jetzt daran genial?«, fragte ich zurück. »Wie soll man das auch sonst rechnen?«
»Aber ich war erst neun!«, prahlte Gauß.
»Ich war schon mit sieben so weit!«, konterte ich, und Gauß, ausgerechnet, bescheinigte mir schlechte Erziehung und mangelnde Bescheidenheit. Dabei war ich selbst im Traum zu gut erzogen, um ihn darauf hinzuweisen, dass seine damals so genialen Erkenntnisse inzwischen jeder mittelbegabte Abiturient routinemäßig anwandte. Die Menschheit hatte sich weiterentwickelt. Ein Genie musste heute etwas mehr leisten als noch vor hundert Jahren.
Draußen schüttete es. Ich trank zwei Tassen Tee und zog meine Regenklamotten an. Dachte an den bevorstehenden Tag, das Mensa-Essen, zog mich wieder aus und machte mir einen Toast mit Margarine und Johannisbeergelee, das mir die Hausmeisterin Frau Horn zum Einzug hingestellt hatte. Zur mathematischen Fakultät brauchte ich zu Fuß sieben Minuten. Von meinem Balkon hatte ich einen guten Blick auf die Menschenströme, die morgens aus der U-Bahn in Richtung der Universität quollen und nachmittags wieder zurück. In den regennassen Hecken im Garten sprangen kleine Vögel herum und pickten an den roten Beeren.
Die Analysis-Vorlesung begann in aller Frühe mit einem kleinen Test. Wir mussten innerhalb von zehn Minuten eine Aufgabe lösen. Wer weniger als die Hälfte schaffte, durfte am Ende des Semesters nicht an der Klausur teilnehmen, egal, wie gut er bei den wöchentlichen Hausaufgaben abschnitt.
Ich hasste Zeitdruck. In der Schule hatte ich Zusatzzeit als Nachteilsausgleich bekommen, was mir die nötige Ruhe gab, um fast immer als Erster abzugeben. Wettbewerbe, bei denen eine Uhr lief, hatte ich nur mit Tabletten überstanden, die präzise dosiert werden mussten, damit ich nicht mittendrin einschlief. Erst als Mister Brown anfing, mich zu begleiten, vertraute ich irgendwann seiner Einschätzung, dass von einer falsch gelösten Aufgabe nicht die Welt unterging. Ich hätte viel dafür gegeben, seine leicht gebeugte Gestalt jetzt neben dem Kaffeeautomaten zu entdecken.
Ich hatte gerade eine halbe Tablette genommen und war nicht sicher, ob es reichte. Ein Blick in den Hörsaal verriet mir, dass es nicht nur mir so ging. Schon in der zweiten Woche sahen die meisten Leute abgekämpft aus. Sie saßen mit aufgeregten Gesichtern und bereitgelegten Kugelschreibern vor einem Blatt Papier, trommelten mit den Fingern und starrten zur Tafel in Erwartung der Aufgabe.
Tja, Moni, dachte ich. An dieser Stelle kam meine Wohltätigkeit für Witwen und Waisen an ihre Grenzen. Wir konnten vielleicht so tun, als würde sie die Übungsblätter tatsächlich bearbeiten. Einen Test musste jeder allein durchstehen. Manche scheiterten schon daran, pünktlich am Prüfungsort zu erscheinen.
Moni kam in letzter Minute, mit tropfendem Regenschirm und verschmierter Wimperntusche. Sie trug etwas Unförmiges, Schweres und ebenfalls Triefendes. Als sie sich auf den Sitz fallen ließ, stellte ich entsetzt fest, dass das Bündel in ihren Armen mich mit zwei dunklen Augen anstarrte.
Sie hatte ein Kind dabei. Ein echtes Kind, mit Rotznase und Daumen im Mund. Ein Kind, an dem sie sofort mit irgendwelchen Tüchern zu wischen begann.
Ich rückte einen Sitz weiter, mit meinem aufgeschlagenen Block und meinem Stift.
»Bleib hier, wir haben genug Platz«, flüsterte Moni.
Teils neugierige, teils schadenfrohe Blicke richteten sich auf das Kind. In manchen erkannte ich meine eigene Panik wieder. Ein paar Leute lächelten allerdings wohlwollend. Es waren vor allem die Älteren, die bereits angefangen hatten, in Tutorien über Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit zu diskutieren und um Abgabefristen zu feilschen.
Wenn man sie lässt, werden die alle nächstes Mal ihre Kinder, Enkel und Neffen mitbringen, dachte ich. Außerdem Hunde, Hamster und Schildkröten.
Ich warf einen flehenden Blick nach vorn, wo Professor Zschau und irgendein jüngerer Mensch, wahrscheinlich sein Assistent, gemeinsam mit der Technik kämpften. Das Kind neben mir nieste. Moni suchte raschelnd nach einem sauberen Taschentuch. Eine winzige Menschenpfote tastete sich wie eine dickbeinige Spinne in Richtung meines Stifts.
»Und los«, sagte Zschau. »Die Zeit läuft.«
Ein riesiger Timer wurde an die Tafel projiziert. Der Puls pochte in meinen Ohren. Ich las die Aufgabe durch. Sie hatte nichts mit der Vorlesung zu tun, sondern präsentierte drei Geradengleichungen in unterschiedlichen Schreibweisen. Zwei von ihnen beschrieben die gleiche Gerade, was sofort ins Auge sprang und genau die benötigte Antwort ergab.
»Hä?«, sagte jemand hinter mir. »Ich raff es nicht.«
Ich fühlte mich in die Schulzeit zurückversetzt. Die Einfachheit der Frage war beleidigend. Ich begann zu schreiben, während Moni unter dem Pult nach einem runtergefallenen Stift suchte. Ich hatte meine Lösung komplett fertig und noch acht Minuten übrig. Zur Sicherheit schrieb ich noch eine zweite, anders formulierte Variante meiner Begründung auf. Noch fünf Minuten.
»Hä«, rief eine andere Stimme, »wie ist die Aufgabe gemeint?«
»Steht alles da«, sagte der Assistent.
Wenn das Kind neben mir nicht wäre, hätte ich mich jetzt gelangweilt. Ich sah seine winzige laufende Nase und musste würgen. Ich kritzelte meinen Namen und meine Matrikelnummer auf das Lösungsblatt und stand auf. Um mich herauszulassen, musste Moni samt Bagage ebenfalls aufstehen. Sie kroch unter dem Tisch hervor, wo sie immer noch nach dem Stift suchte.
»Hier.« Ich steckte ihr meinen zu, gab mein ausgefülltes Blatt dem Assistenten und verließ den Hörsaal.
Ich setzte mich neben den Kaffeeautomaten und begann zu googeln, wo ich mich beschweren konnte. Ich sah mich nicht in der Lage zu studieren, wenn jemand neben mir sabberte, am Daumen lutschte oder meine Stifte zu befingern drohte. Aber die Universität schien keine Anlaufstelle für Diskriminierung wegen zu viel Familienfreundlichkeit zu haben.
Die Hörsaaltür quietschte, und Moni schob sich samt brüllendem Kind, Tasche und tropfendem Regenschirm heraus. Meine Hände wanderten automatisch zu meinen Ohren. Monis Stimme drang trotzdem durch.
»Bin rausgeschmissen worden. Der Kleine ist zu laut. Da haben sich welche beschwert.«
»Ernsthaft?« Ich hätte mich das auch trauen sollen.
»Ja, die konnten sich wohl nicht so gut konzentrieren. Haben gesagt, sie würden sonst meinetwegen den Test nicht bestehen.«
Obwohl ich die Empörung grundsätzlich teilte, fühlte ich mich noch mehr der Wahrheit verpflichtet. »Wer diese Aufgabe nicht lösen kann, sollte sich sofort exmatrikulieren und es nicht auf Ihren Kevin schieben.«
Moni drückte das Kind an sich.
»Er ist krank«, sagte sie. »Ich wollte wegen des Tests trotzdem kommen. Die werden ja im Laufe des Semesters immer schwieriger.« Sie tastete nach der Stirn des Kindes und holte eine Trinkflasche hervor.
Ich rückte mit meinem Stuhl zur Seite. Ich wollte mich nicht anstecken. Mir gefiel auch nicht, mit welcher Begeisterung das Kind auf meinen Kopf deutete.
»Schöne Haare hat Oscar, oder?«, sagte Moni zärtlich. »Wir fahren gleich nach Hause.«
»Gute Besserung und angenehme Heimreise.« Ich vergrößerte die Entfernung um einen weiteren Meter.
»Gleich. Noch nicht. Lass uns erst mal verschnaufen.«
Sie ließ das Kind auf den Boden. Es rappelte sich auf und machte sich auf den Weg zum nächsten Papierkorb. Anstatt einzugreifen, lehnte sich Moni zurück und schloss die Augen. Ihr Gesicht war mit einer dicken Puderschicht überdeckt, der rot angemalte Mund erinnerte an eine Geisha. Ich hatte noch nie eine so müde Person gesehen.
Das Kind fischte einen zusammengeknüllten Zettel aus dem Papierkorb und machte sich brabbelnd auf den Weg in den angrenzenden Flur. Es rannte gegen ein paar Beine und plumpste auf den Windelhintern.
Ich schaute kurz hin und richtete mich sofort auf. Ich hatte gewusst, dass dieser Moment eines Tages kommen würde. Ich war darauf eingestellt gewesen, viel länger zu warten – Monate oder, wenn es sein musste, Jahre. Dass es bereits jetzt passieren würde, hätte ich nicht zu träumen gewagt.
Der Mann, der gerade um die Ecke gebogen war, machte einen großen Schritt über das Kind hinweg und stand damit direkt vor mir. Er blickte sich suchend um, als müsste er sich erinnern, wohin er wollte.
Er hatte, wie mir längst von den Fotos bekannt war, lange, zum Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Er trug die Cowboystiefel, die in allen Artikeln über ihn beschrieben worden waren. Es hatte, als er die Fields-Medaille gewonnen hatte, ziemlich viele Reportagen über ihn gegeben. Vor ihm hatte nur ein Deutscher diese Auszeichnung bekommen. Kein Journalist war in der Lage gewesen, sein Interessensgebiet halbwegs korrekt zu beschreiben. Weil es um Dimensionen ging, wurden sofort Vergleiche mit Science-Fiction bemüht, die mit der tatsächlichen Forschung nichts gemein hatten. Dabei war die n-te Dimension genauso real wie die Tatsache, dass die meisten von uns zwei Daumen hatten.
Sein Gesicht hatte ich mir jünger vorgestellt. Als Preisträger war er fünfunddreißig Jahre und zehn Monate alt gewesen. All die Fotos, die es online von ihm gab, schienen aus dieser Zeit zu stammen. Danach war es still um ihn geworden. Ich hatte gelesen, dass er über zehn Jahre in den USA und Australien geforscht hatte. Erst im vergangenen Jahr war er nach Deutschland zurückgekehrt, und zwar an die Universität, an der er schon als Schüler seine ersten Vorlesungen gehört hatte. Sekunden nach dieser Nachricht hatte ich gewusst, wo ich mich immatrikulieren würde.
Das Geräusch der Cowboystiefel-Absätze hatte Moni aus ihrem Sekundenschlaf gerissen. Sie öffnete die Augen und schaute sich nach dem Kind um. Dann entdeckte sie den Mann.
»Oh«, sagte sie. »Hallo, Daniel.«
Der Mann sah sie an. Sie stand auf und richtete ihre Kleidung. Was auch immer sie gerade im Gesicht hatte: Es war nicht ihr Lächeln, sie hatte es irgendwo geklaut. Das Schweigen dehnte sich.
Dann hörte ich zum ersten Mal live die Stimme von Daniel Johannsen, dem berühmtesten lebenden Mathematiker Deutschlands.
»Hi there«, sagte er. »Geht’s hier irgendwo zum Raum 102?«
»Im ersten Stock«, sagte ich.
»Logisch! Danke.« Seine Augen waren immer noch auf Monis Gesicht geheftet. Dann hob er die Hand zum Abschiedsgruß und verschwand wieder im Flur, aus dem er gekommen war.
»Wem gehört das Kind?«, schallte es von dort. »Kann es jemand nehmen?«
Moni stürzte hinterher und kam mit dem Baby zurück. Selbst die Puderschicht konnte die roten Flecken in ihrem Gesicht nicht verbergen.
»Sie kennen Daniel Johannsen?«, fragte ich.
»Wer kennt ihn nicht«, sagte Moni. »Tschüss, Kleiner, ich hab Püppi versprochen, noch beim Kinderarzt vorbeizuschauen.«
Ich hätte selbstverständlich an jeder Universität in Deutschland studieren können. Das sagte allerdings mehr über die akademische Landschaft als über meine Fähigkeiten aus. Mathematik hatte keinen Numerus clausus, weswegen in der Einführungswoche in den Hörsälen und Seminarräumen Menschen saßen, die zum Zählen ihre Finger nahmen. Die mathematischen Fachbereiche akzeptierten jeden Bewerber und zogen es vor, in den ersten Wochen ein Blutbad zu veranstalten, anstatt die Ahnungslosen vorab auf Eignung zu prüfen.
Ich hätte natürlich auch an die renommiertesten Universitäten der Welt gehen können. Aber ich hatte einen Grund, genau hier zu sein.
Seit mein Google-Alert mich über Daniel Johannsens Rückkehr nach Deutschland informiert hatte, hatte ich mir vorgenommen, meine Abschlussarbeit bei ihm zu schreiben.
Auf diese Chance hatte ich lange warten müssen. Seit der Verleihung der Fields-Medaille an Johannsen waren achtzehn Jahre vergangen. Die erste Berichterstattung darüber datierte vor meiner Geburt. Als ich von meinen Eltern die Privilegien der Online-Recherche bekam, waren die meisten Artikel bereits wieder aus den frei zugänglichen Internet-Archiven verschwunden. Die vereinzelten Treffer führten zu Fehlermeldungen. Meine Mutter fuhr mit mir zu Verlagshäusern und trank Kaffee mit dem Chefredakteur, während ich im Archiv Kopien der Reportagen und Porträts erstellte, die sich in Nebensächlichkeiten verloren: Daniel Johannsens Lieblingsbücher und -Whiskeysorten, sein Fitnessprogramm. Seine internationale Forschung schien dagegen streng geheim, so gründlich ich auch nach Hinweisen auf deren Inhalte suchte.
Johannsens neue Professur in Deutschland war der überregionalen Presse, wenn überhaupt, nur eine kleine Meldung wert gewesen. Mir war es recht: Ich war schon immer ein Anhänger des exklusiven Wissens.
Ich hatte mein Studium genau geplant. Mir ging es nicht darum, genügend Punkte bei den Hausaufgaben zu sammeln und die Klausuren zu bestehen. Das verstand sich von selbst.
Ich hatte ein anderes Ziel.