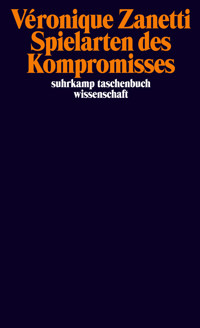
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kompromisse sind nicht beliebt, aber im Alltag so unentbehrlich wie in der Politik. Das liegt daran, dass konfligierende Interessen und Überzeugungen oft prinzipiell nicht zur Deckung gebracht werden können. Dann ist es vernünftig, sich auf eine gewaltfrei und gemeinschaftlich ausgehandelte »zweitbeste Lösung« einzulassen – auf einen Kompromiss. Véronique Zanetti zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie sich verschiedene Spielarten des Kompromisses in individuellen und sozialen Entscheidungsprozessen, in Politik, Moral und Recht je anders gestalten. Eine philosophische Reise durch die Welt der Kompromisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
3Véronique Zanetti
Spielarten des Kompromisses
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2374.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77293-5
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
I
. Einleitung
1. Ambiguität von Kompromissen
2. Minimale Kriterien und Regeln
3. Spielarten des Kompromisses
II
. Was verstehen wir unter einem Kompromiss, und wann ist er gut?
1. Begriffsklärung
2. Allgemeine Merkmale des Kompromisses
3. Formen des Kompromisses
4. Kompromisse und Abwägungen
5. Notwendige Bedingungen eines Kompromisses qua Kompromiss
6. Gute Kompromisse
7. Faule Kompromisse
8. Kompromisse mit sich selbst
III
. Moralische Dilemmata, schmutzige Hände und Kompromisse
1. Moralische Konflikte, Kompromisse und schmutzige Hände
2. Dilemmata und andere moralische Konflikte
3. Dilemmata
4. Verantwortung ohne Schuld
5. Schlussfolgerung
IV
. Toleranz und Kompromissbereitschaft: Eine begriffliche Unterscheidung
1. Tolerante Haltung
2. Die Paradoxie der Toleranz
3. Unterschiede zwischen Toleranz und Kompromiss
4. Weshalb sollten wir tolerant oder kompromissbereit sein?
V
. Abtreibungskompromiss: Müssen moralische Kompromisse prinzipiengeleitet sein?
1. Der Abtreibungskompromiss
2. Gründe für den Abtreibungskompromiss
3. Was sind moralische Kompromisse?
4. Dworkin, Checkerboard-Statute und interne Kompromisse
5. Zusammenfassung
VI
. Verhältnismäßigkeit und Kompromisse
1. Verhältnismäßigkeit als eine Art von Kompromiss
2. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Kompromiss
3. Kompromisse zwischen Richtern
4. Zusammenfassung
VII
. Demokratische Kompromisse am Beispiel Hans Kelsen
1. Politischer Pluralismus
2. Demokratie
als
Kompromiss: Demokratie als zweitbeste Lösung
3. Demokratie als Ort des Kompromisses: Produktivkraft des Kompromisses
4. Institutionelle Bedingungen diskursiver Demokratie
5. Unzulänglichkeiten des Kompromisses
VIII
. Moralische Kompromisse. Eine kleine Kartographie
1. Moralische Konventionen und Verträge am Beispiel von Harman und Gauthier
2. Diskurstheorie der Moral an den Beispielen Habermas und Apel
3. Der ethische Pluralismus
4. Der ethische Partikularismus
5. Zusammenfassung: Kompromisse in der Moral
IX
. Fallbeispiel: Wahrheitskommission und Kompromiss am Beispiel Südafrika
1. Übergangsgerechtigkeit und das südafrikanische Kompromissgesetz
2. Gegenstände des Kompromisses
3. Zur staatlichen Pflicht zur Ausübung der Strafgerechtigkeit
4. Die Pflicht des Staates, den sozialen Frieden zu sichern
5. Individuelle Amnestie als Kompromisslösung: Wie gerecht war die Lösung?
X
. Im Rückblick: Ein Plädoyer für den Kompromiss
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
287
9Vorwort
Schon lange hat mich die Frage umgetrieben, warum eine im Alltag, im privaten wie im öffentlichen Leben so vertraute intersubjektive Praxis wie das Schließen von Kompromissen nie wirklich als eines der philosophisch relevanten Probleme anerkannt worden ist. Während Kompromisse als Mittel politischer Praxis und alltäglicher Verständigung unter Personen anerkannter Brauch sind, scheint die Philosophie sie zu beargwöhnen. Wer moralische Kompromisse schließt oder nur duldet, mache sich verdächtig, zu lavieren und vom geraden Pfad zielstrebigen Handelns aus begründeter Überzeugung abzuweichen. Dabei sind Kompromisse bei rechtlichen Entscheidungen und im Alltag geradezu unumgänglich. Warum sind sie trotzdem so unbeliebt? Sind sie nicht Zeichen friedliebender Gesinnung und der Bereitschaft, auf ursprüngliche Wünsche zu verzichten? Andererseits: Was geschieht jemandem, der/die sich auf eine einvernehmliche Lösung einlässt und zugleich eine andere für richtig hält?
Die VW-Stiftung ließ sich von meiner Neugierde anstecken und machte es durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung im Rahmen der Opus-Magnum-Förderung möglich, dass ich mich vier Semester lang gänzlich der Erforschung und Analyse der Spielarten des Kompromisses widmen konnte. Ich möchte mich bei denjenigen, die durch ihre Förderung ihr Vertrauen in die Bearbeitungswürdigkeit eines weitgehend unerforschten Themas ausgedrückt haben, ganz besonders bedanken.
Ohne die Mithilfe einer ganzen Reihe von Personen wäre dieses Buch nicht zustande gekommen. An erster Stelle denke ich an meinen Mann, Manfred Frank, auf dessen Schreibtisch meine französisch gefärbten und sprachlich verbesserungsbedürftigen Texte unbarmherzig landeten. Ihm sei für seine unermüdliche Hilfe und Ermutigung von Herzen gedankt. Ich danke Rüdiger Bittner für die intensiven Streitgespräche, die wir unter anderem im Rahmen eines gemeinsamen Seminars und einer gemeinsam organisierten Tagung zum Thema Kompromiss geführt haben. Wir waren uns in der Sache fast nie einig; es ist aber wunderbar ergiebig, mit ihm zu streiten. André Georgi und Angelika Epple waren/sind ständig 10anregende Gedankenbegleiter und -ermutiger. Es ist ein Geschenk, sie als Freunde zu haben.
Während der langen Arbeitszeit an diesem Buch hatte ich vielfach Gelegenheit, meine Ideen vorzutragen und zu diskutieren. Dabei habe ich von der Abteilung für Philosophie der Uni Bielefeld, von ihrer unersetzlichen Institution, dem »Club«, und vom Forschungskolloquium praktische Philosophie, in denen eigene Forschung intensiv und kontrovers debattiert wird, entscheidend profitiert. Allen Kolleginnen und Kollegen, Studentinnen und Studenten, die sich die Zeit genommen haben, meine Texte zu lesen und zu kommentieren, bin ich in Dank verbunden. Gemeinsam mit Fabian Wendt hatte ich das Glück, im ZiF einen Workshop zum Thema »Compromise and Moral Conflict« zu organisieren, aus dem wertvolle neue Anregungen hervorgegangen sind. Ich durfte einige Kapitel im Rahmen der Lahngespräche vorstellen, die gemeinsam von den Instituten für Philosophie in Gießen und Marburg veranstaltet werden. Ich bedanke mich bei den Teilnehmer:innen für die lebendige Diskussion, die anregenden Fragen und konstruktiven Kritiken. Bob Goodin sei Dank, dass ich im Rahmen der VW-Förderung ein Semester als Visiting Fellow an der ANU in Canberra verbringen durfte. Zoe Dubois möchte ich zuletzt nicht unerwähnt lassen, die das Manuskript auf Tipp- und Zitierfehler durchgegangen ist.
Schließlich danke ich Eva Gilmer und Jan-Erik Strasser für ihre kritischen Kommentare, ihr aufmerksames Lektorat und für die Aufnahme des Buchs ins Programm der Reihe stw.
Bielefeld, November 2021
11I. Einleitung
Wenn es dessen bedurfte, ist die durch Covid-19 ausgelöste Krise eine ausgezeichnete Illustration der Tatsache, wie sehr Kompromisse den Kern unserer politischen, rechtlichen und moralischen Entscheidungen bilden, ja unsere alltäglichen Konflikte prägen. Seitdem feststand, dass die Welt von einer Pandemie heimgesucht wird, war klar, dass lokale oder nationalstaatliche Maßnahmen nicht ausreichen, um die Herausforderung zu meistern. Idealerweise hätte es genügt, einen generellen Lockdown über den Planeten zu verhängen, um das Virus in kurzer Zeit loszuwerden. Doch in der Realität war das nicht durchsetzbar. Die erkrankten Personen mussten behandelt werden, das behandelnde Personal war auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen, die Menschen mussten sich weiterhin ernähren, die Kette der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln musste aufrechterhalten werden usw. Mehr oder weniger harte Kompromisse zwischen gegenläufigen Erfordernissen waren einzugehen, Sicherheitsrücksichten konkurrierten mit Grundbedürfnissen. Im Deutschen kam eine neue Kategorie auf, die unentbehrliche berufliche Verpflichtungen von solchen abhob, die auch von zuhause aus verrichtet werden können: »strukturrelevant«. Den Trennstrich zu ziehen, fiel der Wirtschaft zu: Ihre Leistungen galten als unentbehrlich. Dem Rechtssektor wiederum fiel die Aufgabe zu, alle Formen von Einschränkungen individueller Freiheit zu rechtfertigen: die Einschränkung der individuellen Bewegung, Kontaktverbote, Abstandsgebote usw. Auf der einen Waagschale lagen die bürgerlichen Freiheiten und lebensweltliche Normalität, auf der anderen das Leben besonders vom Virus gefährdeter Personen und das Gesundheitssystem, das leistungsfähig gehalten werden musste. Die Wäge-Metapher ist im Ausdruck »Abwägung« erhalten. Aber ließen sich die Güter auf beiden Seiten tatsächlich miteinander vergleichen?
Man darf sich die Sache, um die es geht, nicht schönreden: Das Leben von Personen lässt sich nicht an wirtschaftlichem Nutzen messen, auch wenn Ökonomen uns das gerne glauben machen wollen. Gibt es nicht, wie auf der Waage, ein gemeinsames Maß für die gegeneinander abzuwägenden Güter, werden sie unvergleichbar, 12und die Metapher des Abwägens lässt uns im Stich. In Wirklichkeit wird nicht im strengen Sinne abgewogen, sondern es werden Kompromisse geschlossen, und das heißt: Keine Lösung ist optimal, Verzichte und Verluste sind allemal in Kauf zu nehmen. Wenn Kompromiss-Schließungen nicht zu umgehen sind, müssen einige Personen oder Kategorien von Personen einen höheren Preis zahlen als andere. Verfassungsrechtler haben für diesen Notfall ein Mittel zur Hand: Tiefgreifende Einschränkungen müssen verhältnismäßig sein. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist ein bekanntes Instrument rechtlicher Schlichtung. Es wird angewendet, wenn Rechte zugunsten anderer mit ihnen konfligierender Rechte oder öffentlicher Güter eingeschränkt werden. Es dient dazu auszuloten, ob die Einschränkung gerechtfertigt ist. Nun treffen Entscheidungen auf Situationen, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass die »Gewinne« hinsichtlich des verfolgten öffentlichen Gutes die Verluste aufwiegen, die durch die Einschränkung des Rechts entstehen. Der Lockdown trifft arme Personen, die beengt wohnen, viel härter als reiche; und sie bezahlen dafür mit einer bedeutenden Zunahme von häuslicher Gewalt, mit Depressionen, ja sogar mit dem Verlust ihrer Lebensgrundlage. In Krankenhäusern werden tragische Entscheidungen unvermeidlich. Wenn Beatmungsgeräte knapp werden, muss sich die Medizinethik Triage-Kriterien ausdenken, um diejenigen, deren Intubation sich noch »lohnt«, von den Übrigen zu trennen. Sowohl innerhalb der Medizin als auch zwischen den verschiedenen Kräften der Gesellschaft entstehen dilemmatische Situationen. Das sind solche, in denen Konflikte zwischen moralischen Prinzipien unlösbar erscheinen: Egal, was man tut, man macht schließlich etwas Falsches. Der den Opfern zugefügte Schaden darf nicht mit gutem Gewissen als »angemessen« verkauft werden. Muss der über achtzig Jahre alte Patient extubiert werden, um das Leben einer jüngeren Person zu retten, deren Heilungsaussichten besser sind, muss also eine »Triage« zwischen Personen stattfinden, so kann dies bloß gerechtfertigt oder entschuldigt werden, gut ist es nicht. Ich nenne diese Lösung eine Kompromisslösung, weil sie nicht diejenige ist, die man für richtig hält. Man hält die drastische Einschränkung der Rechte der betroffenen Person (auf freie Bewegung oder auf medizinische Versorgung) für falsch, unter den gegebenen Umständen jedoch für unausweichlich und angemessen. Kompromisse bedeuten immer einen Verzicht, und bei existentiellen Entscheidungen tun sie weh.
131. Ambiguität von Kompromissen
Im Alltag, in der Politik, in moralischen Entscheidungen schließen wir tagein, tagaus Kompromisse. Dabei ist alles andere als klar, was ein Kompromiss genau ist. Haben die Akteure einen Deal ausgehandelt? Haben sie sich die Hände gereicht oder einem Druck nachgegeben – aus Furcht, alles zu verlieren, oder um ihr Gesicht zu wahren? Schließt ein Kompromiss notwendig eine Verhandlung zwischen mehreren Personen ein, oder kann auch eine einzelne Person einen Kompromiss mit sich selbst schließen, wenn sie vor unzumutbare Handlungsalternativen, vor unlösbare innere Konflikte gestellt ist?
Was den philosophischen Status des Kompromisses betrifft, so ist es um ihn nicht weniger problematisch bestellt, nähert er sich doch der Kasuistik, dem konkreten Umgang mit praktischen Konflikten, dem Abwägen von Fall zu Fall. Er ähnelt der Verhandlung, und man kann sich fragen, was er dann in der Philosophie zu suchen hat. Ist es nicht Sache des Diplomaten oder der Verhandlungsführerin, ein Abkommen zu formulieren, das die Widersacher zufriedenstellt und dazu bringt, die Waffen niederzulegen? Ist es nicht Sache der Rechtsanwältin, Paare oder Nachbarn, die nicht mehr zivilisiert miteinander reden können, dazu zu bringen, eine Ebene der Verständigung zu finden? Des Politikers oder der Politikerin, mögliche Koalitionen mit Mitgliedern anderer Parteien zu suchen?[1]
Ist eine Ethik des Kompromisses denkbar? Oder ist dieses Ansinnen selbstwidersprüchlich, eine contradictio in adjecto, weil man sich nur dann nach einem Kompromiss umsieht, wenn es den Streitenden nicht gelingt, eine gemeinsame Plattform zu finden, auf der sich ihre Interessen, ihre Forderungen, die Prinzipien, die sie vertreten, zum Ausgleich bringen lassen? Bleiben die Forderungen unverträglich, muss sich eine Ethik des Kompromisses auf eine Theorie gründen, die sich von einer besonderen Konzeption von Werten, Prinzipien oder Gut-Böse-Unterscheidungen freimacht und doch ein Instrument an die Hand gibt, mit dem sich begründbare Entscheidungen fällen lassen.
Können wir aber jemals Kompromisse schließen, wenn es um ethische Prinzipien geht, ohne unsere Integrität zu gefährden? 14Macht man sich nicht käuflich? Wer einen Kompromiss schließt, vollzieht eine zutiefst zwiespältige Handlung. Man tut, was man nicht tun will, und doch ist es oft löblich, dass man es sich antut, über den eigenen Schatten zu springen. Kompromissbereitschaft ist schätzenswert. Sie kann eine Tugend sein, ein Merkmal moralischer Stärke. Kompromissbereite Personen versteifen sich nicht auf eine fixe Position, sie können andere Personen auf deren Terrain begegnen und zeigen, dass Friede und Kooperation ihnen unter bestimmten Umständen wichtiger sind als Rechthaberei.
Gleichwohl ist es schwer zu leugnen, dass zahlreiche große soziale Veränderungen wie die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung des Frauenwahlrechts oder der gleichgeschlechtlichen Ehe, aber auch wissenschaftliche Fortschritte oder große Kunstwerke durch Männer und Frauen möglich geworden sind, die sich kompromisslos für eine Sache eingesetzt haben, die sie um jeden Preis vorantreiben wollten: häufig auf Kosten ihres Lebens, ihrer Gesundheit oder ihres sozialen Status. Die heldenhaften Gestalten der Literatur oder der Geschichte sind diejenigen, die nicht den Rücken beugen, egal, was geschieht. Sie stehen aufrecht, weil sie in wesentlichen Fragen des Lebens nicht bereit sind, Zugeständnisse zu machen, koste es, was es wolle. Es gibt mindestens zwei Gründe dafür, diese Haltung tendenziell für die richtige zu halten: Der erste ist, dass man von einem Freund, einer bewunderten Person oder einem Menschen, mit dem man in wichtigen Angelegenheiten zu tun hat, moralische Integrität erwartet. Man erwartet von solchen Personen, dass sie sich an Ziele, die sie sich gesetzt haben, oder an Versprechen, die sie anderen gegeben haben, auch unter für sie ungünstig gewordenen Bedingungen halten. Hat der Freund versprochen, einen nicht zu verraten, erwartet man von ihm, dass er es nicht tut, auch wenn er daraus einen bedeutenden finanziellen Profit ziehen könnte. Der zweite Grund ist epistemologischer Natur: Haben wir moralische Überzeugungen, das heißt, halten wir bestimmte Prinzipien für moralisch richtig, sollten wir ihnen entsprechend handeln. Handeln wir ohne äußeren Zwang anders, leiden wir entweder an geistiger Verwirrung oder an Willensschwäche. Kompromisse riskieren außerdem, »lau« zu sein: von der Art jener Halbherzigen, von denen Jesus sagt, sie seien weder warm noch kalt und er werde sie ausspeien aus seinem Munde (Offenbarung 3,15f.).
Ein Kompromiss steht nicht nur im Ruch, lau zu sein, er ist 15auch manipulierbar. Das Problem ist, dass die Suche nach einem Mittelweg von den jeweiligen Positionen abhängt. Eine der Parteien kann zum Beispiel im Prozess des Abwägens ihre Präferenzen übertreiben, um das Resultat zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Wie ein Verkäufer, der zuerst einen zu hohen Preis verlangt und ihn hernach etwas absenkt, so dass der niedrigere Preis nun wie ein vorteilhafter Kompromiss aussieht, so kann auch ein Verteidiger des Rechts auf Abtreibung zunächst auf einem unbegrenzten Recht auf Schwangerschaftsabbruch bis hin zur Geburt bestehen, um endlich eine Maximalfrist herauszuschlagen. Diese Praxis schafft unglückliche Anreize, indem sie Personen dazu ermutigt, das Gewicht ihrer Überzeugungen oder Wünsche zu übertreiben und so ihre Gegner zu übervorteilen.
Die Überbietung ist freilich eine gefährliche Strategie. Wie ein Pokerspieler alles verlieren kann, wenn er zu hoch blufft, so kann ein Stratege seine Glaubwürdigkeit einbüßen und von der Verhandlung ausgeschlossen werden, wenn seine Forderung maßlos ist oder zu Resultaten führt, die kein Beteiligter wünschen kann.
»Agree to disagree« heißt die Formel, die das Wesen des Kompromisses auf den Punkt bringt und sein Janusgesicht aufdeckt: Die eine Seite zeigt die Differenz und zwingt die Parteien zu einer unbehaglichen Entscheidung; die andere Seite deutet auf die Grenzen der Spannung und geleitet die Opponenten in einen Raum der Versöhnung. Ein zu enger Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe wird die Mitglieder zum Konformismus treiben. Gegensätzliche Auffassungen können, indem sie die Suche nach einem Kompromiss nötig machen, auch zum Stimulans werden, auf neue Ideen bringen, dazu bewegen, neue Informationen zu beschaffen. Wollen beide Seiten einen Kompromiss schließen, müssen sie einander zuhören und sich verständigen.
Die Bereitschaft zur Suche und zur Annahme eines Kompromisses belegt also schon per se eine Reihe von Tugenden: den guten Willen, mit dem die Parteien aufeinander zugehen; den Vorrang, den sie der Suche nach einer friedlichen Lösung zuerkennen; den Respekt, den sie der abweichenden Position zollen. Das sind Tugenden, die in der Politik über einen Stil entscheiden, einer Politik, die nach Stabilität strebt und Streit beilegt. Sie sind nicht minder wichtig für die Gesetzgebung und die Moral. Aber die bloße Tatsache, dass der Kompromiss aus Uneinigkeit und Verhandlung her16vorgeht, dass er selbst weder notwendig prinzipienorientiert noch regelgeleitet ist, sondern wie eine Boje von wechselnden Strömungen hin- und hergeworfen wird, diese Tatsache macht ihn durchaus suspekt. Darum ist es keineswegs verwunderlich, dass der Kompromiss in der Ideengeschichte als hoch umstritten galt, wie der von Alin Fumurescu angestellte Rückblick glänzend belegt.[2]
Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass der Kompromiss in einer Krise immer die wünschenswerte Antwort darstellt. Es sind Fälle denkbar, in denen der Mittelweg die schlimmste aller denkbaren Lösungen bietet, in anderen ist er einfach abwegig. Wenn die Einwohner einer Gemeinde sich beispielsweise über die Verwendung eines Kredits streiten und eine Gruppe einen neuen Fußballplatz und eine nicht minder starke Gruppe einen neuen Konzertsaal wünscht, wären die politischen Autoritäten schlecht beraten, die Summe zu teilen, denn weder die Fußballarena noch der Konzertsaal kämen so zustande. Ein Kompromiss kann auch zu einer moralisch abwegigen Lösung führen. Ronald Dworkin gibt das berühmte Beispiel der Bevölkerung von Oklahoma, von der sich herausstelle, dass sie zur Hälfte rassistisch ist und dass diese Hälfte sich eine Rassentrennung wünscht, die andere Hälfte aber nicht.[3] Es wäre absurd, darauf mit folgendem Kompromiss zu reagieren: Rassentrennung wird in Bussen und Schulen praktiziert, aber an öffentlichen Plätzen untersagt. Die Einführung einer solchen Regel wäre ein Beweis von Inkohärenz, ja von Faulheit, in einer Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ich werde das Beispiel im Kapitel über den Abtreibungskompromiss wieder aufgreifen. Es ist besonders fruchtbar, weil es die Grundsatzfrage aufwirft, ob Kompromisse prinzipiengeleitet sein müssen oder nicht, um positiv bewertet werden zu können.
2. Minimale Kriterien und Regeln
Bei Weitem nicht alle Philosoph:innen sind bereit zuzugeben, dass es überhaupt unlösbare epistemische oder moralische Konflikte gibt. Wollen wir ernsthaft annehmen, dass Personen über eine Grundsatzfrage uneinig bleiben können, obwohl sie sich gründlich 17über den Streitgegenstand informiert, alle Argumente ausgetauscht und so unvoreingenommen wie nur denkbar um wechselseitiges Verständnis bemüht haben? Wer das allerdings bestreitet, spricht dem Kompromiss seinen Platz auf dem Feld der rationalen Entscheidung ab. Einen Kompromiss unterschreiben heißt letztlich zugeben, dass Dissense unseren Alltag bestimmen; und wenn sie sich nicht durch Dialog und guten Willen beilegen lassen, bedeutet das nicht notwendig, dass eine Partei auf dem Holzweg ist, sich blenden lässt, sich im Irrtum befindet oder uneinsichtig ist. Und doch erfordern gelungene Kompromisse – das ist der rote Faden, der sich durch das ganze Buch ziehen wird – ein Minimum an Kriterien und Regeln, um sich von erpresserischen Verhandlungen oder täuschenden Einigungsstrategien zu unterscheiden. Ohne diese Kriterien lässt sich außerdem kein normativ relevanter Unterschied in der Qualität von Kompromissen feststellen; es lässt sich nicht einmal sagen, ob ein Kompromiss fair oder faul ist. Welche Kriterien? Sind es nicht gerade sie, die von und in Konflikten in Frage gestellt werden?
Eines scheint mir jedenfalls ausgemacht: Es kann keinen Kompromiss geben über das zu wählende Verfahren. Andernfalls gerieten wir in einen infiniten Regress. Darauf bestehe ich in allem, was folgt. Der Kompromiss verlangt eine minimale Vorverständigung über die Form. Man kann von einer vorgängigen Verständigung über die Spielregeln sprechen, obschon wir nicht die Wahl haben, aus dem Spiel auszusteigen. Eine unter Gewaltandrohung oder missbräuchlich oder trügerisch erzielte Einigung ist kein Kompromiss, ebenso wenig eine solche, die nur von einer Seite getragen wird. Den Opponenten ist mithin nicht alles erlaubt. Die Diskurstheorie hat, wie ich zeigen werde, recht, die prozeduralen Regeln der Verhandlung als formale Bedingung einer für alle tragbaren und akzeptierbaren Lösung zu sehen. Wenn die Geltung unserer Argumente nicht unter Verweis auf eine von uns allen als objektiv anerkannte und unabhängige Quelle von Wahrheiten begründet werden kann, müssen wir uns mit prozeduralen Bedingungen begnügen, die wenigstens die Fairness der Verhandlungsführung sicherstellen. Diese sind allerdings nicht ihrerseits Ergebnis eines Kompromisses, sondern bilden sein normatives Rückgrat oder die Fairness-Bedingung, die über sein Zustandekommen wacht. Wir werden dieser regulativen Voraussetzung immer wieder begegnen.
18Wohlgemerkt: Eine minimale normative Verständigung über den Inhalt ist nicht unabdingbar für die Rede von einem Kompromiss als Kompromiss. Auch »faule« Kompromisse sind möglich. Es ist jedoch unerlässlich, sich über Minimalkriterien zu verständigen, die festlegen, wann eine Übereinkunft »faul«, unmoralisch oder jedenfalls zu vermeiden ist. Ob es mithin um Form oder Inhalt geht, der Kompromiss appelliert an einen Minimalkonsens. Ich glaube in der Tat an einen minimalen Kern universeller Werte, die nicht verhandelbar sind (siehe VIII.4). Diese universalisierbaren Werte lassen sich leichter negativ – durch das, was nicht akzeptiert werden kann – als positiv bestimmen (also durch das, was man als ihren Kern ansieht). So kann man weder Gewalt gegen unschuldige Personen noch Vertrauensmissbrauch noch Betrug akzeptieren. Der Konsens ist jedenfalls kleiner als der, den etwa Rawls den »overlapping consent« nennt. Die These von der Unvergleichbarkeit der Werte erscheint mir jedoch übertrieben, ja unhaltbar. Auf diese Fragen werde ich in Kapitel VIII zu sprechen kommen.
3. Spielarten des Kompromisses
Mir liegt es fern, eine Ethik des Kompromisses vorzuschlagen. Es geht mir um seine multiplen Facetten. Denn gerade die Komplexität des Gegenstandes hat es mir angetan, seine Vielgestaltigkeit, die sich entfaltet, je nachdem, ob man den Kompromiss als politisches oder juristisches Instrument oder gar als ein spezifisches Verfahren der Lösung von moralischen Konflikten betrachtet. Auch schien mir unumgänglich, den Kompromiss mit Phänomenen parallel zu führen bzw. zu kontrastieren, die ihm nahestehen – das moralische Dilemma, die schmutzigen Hände oder die Toleranz etwa. Doch bewegen mich die kategorialen, aber vor allem die normativen Fragen, die schon erwähnt wurden, und ich werde sie systematisch behandeln: begrifflich, moralisch, rechtlich und politisch. Ich hoffe, dass die folgenden Kapitel ein zwiespältiges Phänomen Stück um Stück auf kohärente Weise erschließen. Diejenigen, die das wünschen, mögen die Kapitel gerne auch einzeln lesen, denn ein jedes geht auf eine besondere Dimension des Kompromisses ein.
Die Literatur über Kompromisse ist noch schütter, auch wenn das Interesse an der Frage zunimmt. Die meisten Monographien 19konzentrieren sich auf die politische Dimension des Kompromisses, auf den politischen Kompromiss der Lebensformen und auf seine Konsequenzen für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Dimension spielt auch im folgenden Text eine wichtige Rolle, sie steht aber nicht im Zentrum meiner Untersuchung. Ich wollte andere Perspektiven eröffnen. Künftige Forscher:innen mögen entscheiden, ob sich der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung dadurch besser und genauer erkennen lässt.
Einen Hinweis möchte ich noch anbringen. Oft wird von »Kompromiss« in banalen Situationen gesprochen, so etwa, wenn man auf Französisch sagt, »couper la poire en deux« oder auf Englisch, »splitting the difference«. Solche Redensarten machen sinnfällig, dass es um die rechte Mitte geht und dass jeder um der Billigkeit willen ein Zugeständnis macht. Das ist treffend, aber nicht sehr interessant. Jedes Feilschen auf einem Basar liefe dann auf einen Kompromiss hinaus. Kompromiss, Abwägung und Konsens würden sich, so betrachtet, nicht grundlegend unterscheiden: Die Parteien trennen sich mit dem beiderseitigen Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben, das Für und Wider gut erwogen zu haben und auf ihre Kosten gekommen zu sein. Ich werde mich lieber auf Situationen beziehen, in denen es darum geht, dass ein Kompromiss nicht ohne ein gewisses Bedauern geschlossen wird und dass dieses Bedauern begründet ist, und zwar nicht nur in einem psychologischen Sinn. Der Kompromiss steht für einen unbefriedigenden Handel, selbst wenn sich unter den jeweiligen Umständen nichts Besseres herausholen ließ. Ein »echter« Kompromiss wird geschlossen, wenn eine Einigung nicht in Aussicht steht. Dennoch, so meine These, erfordert jeder Kompromiss eine minimale Verständigung zwischen den Opponenten. Die These ist nicht so banal, wie sie auf Anhieb klingt, denn der Kompromiss bietet sozusagen die Möglichkeit einer letzten Zuflucht. Dort, wo der Streit sich nicht auflösen lässt, kann man losen, die Mehrheit entscheiden lassen oder eben: sich auf einen Kompromiss verständigen.
20II. Was verstehen wir unter einem Kompromiss, und wann ist er gut?
1. Begriffsklärung
Kompromisse gehören neben Mediationen zum Instrumentarium der Konfliktlösung. Sie sind die letzte Zuflucht, wenn trotz der Bemühungen der Beteiligten, ihre Position zu vermitteln und rational annehmbar zu verteidigen, jeder bei seiner Ausgangsüberzeugung bleibt und gleichzeitig eine Entscheidung getroffen werden muss. Kompromisse kommen also unter Handlungsdruck zustande.
Das Wort »Kompromiss« hat seine Wurzeln im lateinischen Kompositum compromissum, compromittere (»sich gegenseitig versprechen, eine Entscheidung dem Schiedsrichter zu überlassen«).[1] Die römische Rechtsprechung bestätigt diese Wortgeschichte: Sie verstand das Compromissum als ein wechselseitiges Versprechen zweier Konfliktparteien oder mehrerer Personen, den Schiedsspruch eines von ihnen gewählten Schiedsrichters (compromissarius) zu akzeptieren.[2] Diese Deutung entspricht allerdings nicht dem aktuellen Verständnis des Wortes, welches eine direkte Verhandlung zwischen Betroffenen bezeichnet. Die Deutung des Kompromisses als eine pragmatische Vereinbarung zwischen streitenden Parteien, die nicht mehr an den Schiedsspruch eines Dritten gebunden sind, findet sich zum Beispiel Anfang des 17. Jahrhunderts im Oxford Englisch Dictionary (OED): Der Kompromiss ist »eine Übereinkunft (coming to terms) oder Beilegung eines Streits, durch Zugeständnisse beider Seiten; unter teilweiser Aufgabe der eigenen Posi21tion, um eine Einigung zu erzielen; in das Zugeständnis oder die Bedingungen willigen beide Seiten ein«.[3]
In beiden Deutungen steckt der Kerngedanke, dass die Parteien, um eine Kooperation möglich zu machen, ihre Zielverwirklichung durch Teilverzicht zugunsten einer für alle akzeptablen Lösung preisgeben. Die zweite suggeriert außerdem, dass die betroffenen Seiten eine Lösung nur dann anerkennen und an ihr festhalten, wenn und weil es sich um eine Lösung handelt, die sie selbst ausgehandelt und vereinbart haben.
Ich schlage vor, allen weiteren Überlegungen/Ausführungen die folgende Definition zugrunde zu legen, um die verschiedenen Kontexte zu analysieren, in denen Verhandlungspartner sich eines Kompromisses bedienen, um ihren Konflikt zu lösen:
Ein Kompromiss bezeichnet den Prozess oder das Ergebnis einer Entscheidung oder einer Verhandlung, bei denen die beteiligten Parteien das Ziel ihrer Handlung oder ihre Handlung selbst im Hinblick auf divergierende und unversöhnliche Überzeugungen in einer für alle Parteien annehmbaren, aber von keiner als optimal angesehenen Richtung modifizieren.
Mit Prozess ist nicht die Dauer gemeint, die für die Verhandlung in Anspruch genommen wird, sondern eine Technik, eine Methode. Sie legt die Weise fest, wie eine Handlung durch abwechselndes Geben und Nehmen, stets im Blick auf die jeweiligen Interessen der Parteien, zur Ausführung kommt. So verstanden, stellt der Kompromiss qua Kompromiss ein neutrales Verfahren dar. Das Verfahren muss zwar minimale Bedingungen erfüllen, um sich unter anderem von gewalttätigen Auseinandersetzungen zu unterscheiden. Es unterliegt jedoch weder der Notwendigkeit ausgewogener Kräfte (zum Beispiel einer Machtsymmetrie), noch verlangt es eine besondere Einstellung der Protagonisten. Bargaining, Taktieren, Pokern gehören ebenso zu den möglichen Techniken der Beteiligten, die am Verhandlungstisch versuchen, so viel wie möglich für sich herauszuholen, wie das Bemühen, dem Partner mit Rücksicht und Respekt zu begegnen und seinem Anliegen so weit als möglich entgegenzukommen.
22Die Definition lässt dennoch nicht alle Formen von kommunikativen Verzerrungen zu, wie gleich deutlich werden soll.
2. Allgemeine Merkmale des Kompromisses
Zu Kompromissen kommt es dann, wenn trotz aller Bemühungen der Beteiligten, ihre Position wechselseitig zu vermitteln und rational annehmbar zu verteidigen, jeder bei seinem Standpunkt oder Wunsch bleibt und gleichzeitig eine zeitlich unaufschiebbare Entscheidung getroffen werden muss. Das bedeutet, dass die Parteien einer Option zustimmen, von der sie nicht im letzten Grunde ihres Herzens überzeugt sind. Sie schlucken die »bittere Pille«, weil sie keine andere Wahl haben: Entweder weil eine Partei damit erhofft, den Opponenten von einer Position abzubringen, die noch weniger annehmbar wäre als die durch Kompromiss verhandelte, oder weil beide Parteien wissen, dass der Preis, den sie bezahlen müssten, wenn sie auf ihrer Position beharrten, höher ist als der Preis eines Zugeständnisses an den andern. Lässt sich allerdings nur eine der beiden Seiten auf Zugeständnisse ein, kann meiner Meinung nach von einem »Kompromiss« nicht die Rede sein. Ein Kompromiss zeugt also von der Bereitschaft jeder Partei, auf die Verwirklichung ihres Interesses teilweise zu verzichten, auch wenn dieser Verzicht nicht notwendig auf beiden Seiten gleich groß ausfallen muss.
Kompromisse sind kein Selbstzweck. Sie sind nicht das, was man primär erreichen möchte. Sie treten an die Stelle einer optimalen Lösung, die sich unter den gegebenen Umständen nicht durchsetzen ließ. Insofern unterscheiden sie sich von einem Konsens. Bei einem Konsens kommen mehrere Akteure, die zuvor divergierende Positionen vertreten hatten, in ihren Überzeugungen überein. Ein Konsens kann durchaus einschließen, dass eine oder mehrere Parteien (oder sogar alle) ihre Positionen verändern. Sie tun es dann aber im Hinblick auf eine nunmehr gemeinsam anerkannte Überzeugung. Wenn diese jedoch nicht besteht, wenn Parteien sich über die Lösung eines Konflikts oder über politische Maßnahmen uneinig sind und es auch im Verlauf einer fairen und friedlichen Auseinandersetzung bleiben, bleibt ihnen – vorausgesetzt, sie wollen in Frieden miteinander leben – nichts anderes übrig, als Kompromisse zu schließen. Ein Kompromiss wird ausgehandelt, ein Konsens, da 23er auf Einsicht beruht, nicht. Kompromisslösungen kennen Grade, Konsense nicht.
Die Parteien, die mittels einer Verhandlung eine Einigung suchen, meinen jeweils, dass die Position, die die gegnerische Partei vertritt, nicht richtig oder nicht berechtigt sei. Hingegen haben sie keine Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Position oder an der Berechtigung des eigenen Anspruches. Es ist deshalb, wie schon gesagt, ein wesentliches Merkmal des Kompromisses – im Unterschied zum Konsens –, dass die Beteiligten bei ihrer Überzeugung oder bei ihrem Wunsch bleiben. Insofern befinden sich die Individuen in einer Form von kognitiver Dissonanz, denn sie stimmen einer Sache zu, die nach ihrem Ermessen falsch (oder wenigstens nicht wünschenswert) ist. Kompromisse sind insofern eine zweite Wahl. Darum ist es ein notwendiges Merkmal von Kompromissen, dass sie für beide Partner mit einer nicht aufgelösten Unbefriedigung enden; beide sehen die erzielte Lösung als suboptimal und dennoch als die zweitbeste an.
Eine kognitive Dissonanz kann natürlich den Konfliktpartnern nicht als erstrebenswertes Ziel vor Augen stehen. Unter gewissen Umständen kann es jedoch richtig sein, das unter anderen Umständen für falsch Gehaltene zu tun. In der überschaubaren Literatur zum Kompromiss wird entsprechend die scheinbare kognitive Dissonanz wie folgt aufgelöst: Beim Akt der Kompromissschließung handelt es sich um einen Akt zweiter Stufe.[4] Auf der ersten Stufe werden die moralischen Grundsätze eines Menschen ausgebreitet, die in Bezug auf moralische Gründe oder Werte bevorzugt werden, und in eine hierarchische Ordnung gebracht. Da diese Grundsätze sich wegen ihrer Inkompatibilität mit denen der anderen Partei nicht realisieren lassen, überlegt die Person, ob sie bei ihren Überzeugungen bleibt oder sie denen der anderen Partei zum Teil unterordnet. Auf beiden Seiten sind Zugeständnisse erforderlich. Entsprechend bieten Kompromisse eine zweitbeste Lösung an. Auf einer zweiten Stufe wird überlegt, ob man bereit ist, sich auf Grundsätze zweiter Ordnung einzulassen, nämlich diejenigen, die sich ersatzweise angesichts des Dissenses empfehlen. Moralisch 24zweitbeste Lösungen sind nicht unbedingt schlecht, sie sind nur moralisch weniger gut.[5]
Es mag hilfreich sein, Gründe für mündliche Zurechtweisung (oral correction) als Gründe erster Ordnung zu verstehen, die die Vorzüge einer Position betreffen. Gründe für moralische Kompromisse sollte man entsprechend als Gründe zweiter Ordnung verstehen; es sind Gründe dafür, wie sehr man an einer Position erster Ordnung festhalten sollte, wenn man sich mit der anderen Partei nicht einigen kann.[6]
Kurz: Auf der ersten Stufe geht es um die eigene Überzeugung oder Präferenz. Auf der zweiten Stufe geht es darum, ob diese eigenen Überzeugungen, angesichts ihrer Unversöhnlichkeit mit den Präferenzen, die andere Personen gelten lassen wollen, gänzlich oder nur zum Teil beibehalten oder untergeordnet werden sollen. Werden sie gänzlich beibehalten, wird die Verhandlung abgebrochen. Werden sie untergeordnet oder zum Teil beibehalten, haben wir es mit einem Kompromiss zu tun, der beiden Seiten Zugeständnisse abverlangt. Die »moralisch besten2« Grundsätze sind Ergebnisse von Zugeständnissen.
Bin ich zum Beispiel eine überzeugte Katholikin und glaube, dass Föten Personen sind, wird mein Glaube sich nicht ändern, weil ich einer anderen Person gegenüberstehe, die genauso fest überzeugt ist, dass Frauen frei entscheiden dürfen, ob sie Mutter werden wollen oder nicht. Nicht die Überzeugung selbst wird durch den Kompromiss modifiziert, sondern bloß die Haltung, die jede Partei ihrer eigenen Position und der Position der anderen Beteiligten gegenüber einnimmt.[7] Ändert man die eigene theoretische, morali25sche oder ästhetische Überzeugung aufgrund einer neuen Einsicht, revidiert man seine Position. Man übt eine Korrektur aus, und dies entweder aufgrund einer empirischen oder einer theoretischen Evidenz, einer moralischen Einsicht oder einer Geschmacksänderung. Hat man keinen Grund für eine solche Korrektur, kann man entweder bei der vertretenen Position bleiben oder sie in den Hintergrund treten lassen, sie zurückdrängen.
Obwohl es trivial erscheinen mag, sollte betont werden, dass wir keine Kompromisse schließen, wenn es um theoretische (also um Wissensurteile) oder um ästhetische Urteile geht. Wenn zwei Astrophysiker unterschiedliche Theorien über die Entstehung und das Wesen schwarzer Löcher im All entwerfen, die inkompatibel sind, wäre es absurd, eine dritte Theorie zu konstruieren, die entweder auf jede Kenntnis der beiden sich bekämpfenden Theorien verzichtet oder die gleich viele Theoriestücke der ersten und der zweiten kombiniert. Ähnlich absurd schiene uns die Haltung einer Person zu sein, die beschlösse, Mozarts Sonaten zu mögen, nur weil sie nicht entscheiden kann, ob ihr Beethovens oder Schuberts Sonaten besser gefallen. Kompromisse sind weder eine Sache des Wissens noch des Geschmacks.
Es gibt vielerlei Gründe für eine Unterordnung der eigenen Wertschätzungen oder Präferenzen: Manchmal ist es ratsam nachzugeben, sich tolerant zu zeigen, auf andere einzugehen. Es kann strategisch klüger sein, sich mit weniger zufriedenzugeben, als zu riskieren, alles zu verlieren. Insofern können Kompromisse sich durchaus an Prinzipien orientieren (wie dem friedlichen Miteinander-Auskommen oder dem Respekt vor der Überzeugung anderer). Sie können aber auch aus einer harten Verhandlung resultieren, in der jede Partei taktisch versucht, das Maximum für sich herauszuholen.
Kompromisse stellen eine Form von Verhandlung dar. Manche Autor:innen unterscheiden diese Form grundsätzlich von einem bargaining, bei dem jeder Protagonist rücksichtslos versucht, sein eigenes Interesse so weit als möglich zu befördern. Demgegenüber unterstellen sie dem Sich-Einlassen auf eine Kompromissverhandlung eine intrinsische Bereitschaft der Beteiligten, die Verhandlungspartner als moralische Personen zu betrachten und ihre Ansprüche respektvoll zu behandeln.
26Obwohl das Finden von Kompromissen für Interessenkonflikte in mancher Hinsicht dem Verhandeln (bargaining) ähnelt – denn in beiden Fällen geht es um Vorschläge bzw. den Versuch, eine Übereinstimmung sicherzustellen, und gegenseitige Zugeständnisse –, gibt es doch auch einen Unterschied, denn Kompromissfindung schließt Rücksicht auf die Interessen der Gegenseite sowie den Versuch ein, eine faire Einigung zu finden.[8]
Reines bargaining als schonungslose Taktik im beidseitigen Eigeninteresse darf nach ihrer Meinung nicht mit dem Versuch einer Kompromisslösung verwechselt werden.[9]
Diese Unterscheidung scheint aber höchstens dann sinnvoll, wenn man an ideale Kompromisse denkt und darunter faire oder gerechte versteht. Der Begriff verliert die nötige Präzision, wenn man gleich im ersten Schritt versucht, ihn anders als rein formal zu bestimmen. Man schränkt dabei das Wortfeld zu sehr ein, denn Kompromisse können sehr wohl faul, unfair oder ungerecht sein. Der Begriff als solcher darf nicht durch vorgefasste, wenn auch verbreitete Idealisierungen eingeschränkt werden, die faktisch gar nicht bestehen (müssen).
273. Formen des Kompromisses
Das erforderliche Zugeständnis aller Seiten kennt vielerlei Realisierungsformen. Eine davon ist das »Sich in der Mitte treffen«.
Bei Gegenständen, die sich beliebig teilen oder durch ein materielles oder wirtschaftliches Äquivalent ersetzen lassen, kann der Kompromiss bildlich als die Mitte auf der Skala zwischen den ursprünglichen Ansprüchen verstanden werden.[10] Entsprechend wird im normalen Sprachgebrauch von Kompromiss gesprochen, wenn man sich bei den Zugeständnissen, die man einander macht, »in der Mitte« trifft. Wie die räumliche Metapher verrät, rekurriert die Idee einer gerechten Teilung, durch die wechselseitige Zugeständnisse möglich werden, auf einer ökonomischen Präsumtion der Quantifizier- und Austauschbarkeit der Gegenstände der Welt. Legt man eine utilitaristische Ethik zugrunde, sind auch Interessen quantifizierbar und werden gegeneinander abgewogen. Quantifizierbare Gegenstände können nicht nur ausgetauscht oder geteilt werden; ihr Verlust oder ein Teilverzicht kann außerdem kompensiert werden. Margalit spricht diesbezüglich von anämischen Kompromissen: »Ein blutleerer Kompromiß zwischen Ihnen und mir über ein beliebiges X ist jede Übereinkunft zwischen uns, die sich innerhalb der Spanne dessen, was X Ihnen wert ist, und dessen, was X mir wert ist, bewegt.«[11]
Beispielsweise: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind sich über einen Tarifvertrag uneinig. Die Arbeitnehmer wollen streiken, wenn der Arbeitgeber nicht in eine Lohnerhöhung von 5% einwilligt. Der Arbeitgeber findet diese Summe zu hoch und behauptet, dass eine solche Erhöhung mehr oder weniger langfristig zu einem Zusammenbruch der Aufträge und, folglich, zu bedrohlichen Verlusten für das Unternehmen führen würde. In diesem Fall würden alle Parteien verlieren. Einigen sich beide Parteien auf eine Lohnerhö28hung von 2,5%, haben sie einen Kompromiss über den Gegenstand ihrer Ansprüche geschlossen. Wir würden aber auch von einem Kompromiss sprechen, wenn sie sich auf 2%, 3%, 4% oder sogar 4,5% einigen würden. Je asymmetrischer die Lösung, desto weniger fair scheint sie der Tendenz nach allerdings zu sein.
Beziehen sich Kompromisse auf Sachverhalte, die nicht messbar oder teilbar sind – oder von denen man voraussetzt, dass sie es nicht seien –, ist die Rede von einem »sich in die Mitte treffen« problematisch und höchstens metaphorisch zu verstehen. In diesen Fällen lässt sich ja nicht berechnen, in welchem Verhältnis der Verzicht einer Partei zum Verzicht der anderen Parteien steht. Ein Vergleich lässt sich nur uneigentlich und ungefähr durchführen, denn die Instanz der Gerechtigkeit oder vielmehr der Billigkeit, die das Abrücken der Partner von ihren ursprünglichen Präferenzen irgendwie messbar macht, fällt hier aus. Das ist vor allem bei Konflikten der Fall, die Rechte oder moralische Werte tangieren. Die Schwierigkeit entspringt nicht nur daraus, dass Rechte, vor allem Grundrechte, nicht gegeneinander verrechenbar oder – und sei’s teilweise – gegeneinander abwägbar sind,[12] sondern beruht auch auf der Tatsache, dass moralische Prinzipien nicht teilbar sind. Eine »kleine« Lüge bleibt eine Lüge, und selbst »ein bisschen« lügen, wenn die Wahrheit weh täte, bleibt moralisch verpönt, insofern man die Meinung vertritt, dass moralische Überzeugungen auf nicht verhandelbaren Prinzipien oder Werten beruhen. Diese Meinung wird allerdings nicht von allen Moraltheoretiker:innen vertreten, und es wird interessant, sich die Frage zu stellen, ob die Moral in dem Fall ein offeneres Ohr für Kompromiss findet und ihn nicht als Kompromittierung verdächtigt. Werte gehen außerdem die moralische Integrität einer Person, ihre Identität direkt an.[13] Ich werde auf diesen Aspekt bei verschiedenen Gelegenheiten zurückkommen. Die Schwierigkeit ist unter anderem Richter:innen wohl bekannt, die 29nach einem Verbrechen oder einem schweren Verlust dem Opfer oder seiner Familie eine Kompensation anzubieten versuchen. Wie soll eine Entschädigung nach einer Vergewaltigung oder nach dem Tod eines Familienvaters bei einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Fahrer aussehen? Auch die Strafe kann als eine Form von Kompromiss verstanden werden. Der Schaden wird nicht behoben, die Strafe macht nichts wieder gut, und die Kompensation bietet keinen Ersatz, und dennoch ist sie besser als nichts. Sie bietet eben eine zweitbeste Lösung an. Die beste wäre eine vollkommen ausgleichende Wiedergutmachung.
»Sich auf halbem Wege treffen« (»splitting the difference«[14] ) ist jedoch nur eine Weise, auf die ein wechselseitiger Verzicht abverlangt wird. Wenn der Deal mehrere Gegenstände enthält, können die Parteien sich auf einen Tausch von einem oder mehreren Gegenständen aus der Menge einigen, die für die jeweiligen Parteien eine unterschiedliche Bedeutung in der Werte-Hierarchie haben. Verfeindete Parteien, die sich über ein Friedensabkommen uneinig sind, können beispielsweise die Freilassung einiger Gefangenen gegen einen Abzug aus einem Teil des eroberten Gebiets vereinbaren.
Das Alternieren zwischen Optionen, das Sich-auf-eine-dritte-Option -Einigen oder das Losen sind andere mögliche Kompromissoptionen. Wenn zwei Freundinnen gemeinsam auswärts essen möchten, sich aber nicht auf ein Restaurant einigen können (die eine zieht es Richtung Steakhaus, während die andere ein vegetarisches Restaurant vorzieht), können sie zuhause bleiben, damit jede kocht, was sie will; sie können aber auch diesmal ins Steakhaus und das nächste Mal in ein vegetarisches Restaurant gehen oder sich für den Italiener ums Eck entscheiden, und schließlich können sie auch noch losen. Entscheidend ist die Gemeinsamkeit ihrer Verständigung auf einen Teilverzicht.
Selbst das Mehrheitsprinzip wird zuweilen als Kompromisslösung interpretiert. So zum Beispiel von Hans Kelsen, für den die Mehrheitsentscheidung »die relativ größte Annäherung an die Idee der Freiheit« bedeutet.[15] Sie biete die größte Chance für jedes Individuum, die Politik implementiert zu sehen, die es sich von seiner Gemeinschaft wünscht. Und doch muss jeder Einzelne das Risiko 30in Kauf nehmen, sich in der Minderheit zu befinden und eine Politik zu akzeptieren, die er nicht wollte.[16] Mehrheiten selbst sind das Produkt von Kompromissen und können jederzeit in die Position der Unterlegenheit geraten.
Ich werde mich auf die Typen von Kompromissen konzentrieren, für die es keine leicht zu findende Lösung gibt. Bei ihnen geht es um Werte oder Präferenzen, die man nicht so leicht zurückstellen will oder kann, weil sie entweder einen hohen moralischen Rang einnehmen oder für die Parteien gleichermaßen identitätsrelevant sind. Sie ergeben sich aus Situationen, aus denen es kein Entrinnen gibt und wo eindeutige optimale Lösungen zwischen auseinanderstrebenden Verpflichtungen, denen die Betroffenen ausgesetzt sind, nicht zu finden sind. Als erstes Fallbeispiel wähle ich die Abtreibung und den gesellschaftlichen Kompromiss über eine Fristenlösung. Der Fall veranschaulicht einen Konflikt an der Schnittstelle von Moral, Recht und Politik. Der Schwangerschaftsabbruch spaltet die Gesellschaft tief. Für die einen ist er Mord, für die anderen ein Recht. Wenn die Politik oder die Rechtsprechung sich nicht für eine der beiden Seiten – religiös oder ultraliberal – entscheiden will, wird sie einen Kompromiss eingehen, der aber keine für alle zufriedenstellende Lösung bieten kann. Dieses Beispiel wird sich als roter Faden durch den ganzen Text ziehen. Es wird mir ermöglichen, die verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen, die dem Kompromiss seine Vielfalt geben.
Kompromisse sind tendenziell instabil, weil man dazu neigt, sie bei wechselnden diskursiven Konstellationen oder veränderten Machtverhältnissen neu zu verhandeln. Man darf dennoch ihre tatsächliche Stabilität insgesamt nicht unterschätzen. Die Fristenlösung bei der Abtreibungsproblematik wurde beispielsweise insgesamt als mehr oder weniger bittere Pille von den Protagonisten geschluckt. Dennoch gibt es keinen ernsthaften politischen Versuch, sie abzuschaffen, obwohl Kritiken immer wieder laut werden, die sogar ihre rechtliche und moralische Kohärenz in Frage stellen.[17] Man kann auch an die Schweiz denken. Wenn sich dort eine politische Disziplin zur Kunstform gesteigert hat, so ist es die Heuristik 31der Kompromissfindung. Die Minderheiten, die zusammen eine Mehrheit bilden, der tief verankerte Föderalismus und die über allem schwebende Referendumsdrohung haben hier im Gegensatz zu Ländern mit parlamentarisch abgesicherten Regierungskoalitionen nie ein Durchregieren zugelassen. Und doch sind in diesem Staatswesen erstaunliche Entscheidungen rechtskräftig geworden.
4. Kompromisse und Abwägungen
Ich möchte noch eine wichtige Klarstellung anbringen: Kompromisse sollten meiner Meinung nach von Abwägungen unterschieden werden. Die Unterscheidung fällt nicht leicht, denn Abwägungen tun einen ersten und unersetzlichen Schritt zu wohlüberlegten Kompromissen. Selbst wenn es wahr ist, dass es keinen ausgewogenen Kompromiss ohne Abwägung gibt, lassen sich beide Prozeduren nicht aufeinander reduzieren.
Der Begriff »Abwägung« legt nahe, man habe es mit einer Waage zu tun, deren Schalen ungleichartige Gegenstände tragen, die sich aber über ihr Gewicht dennoch vergleichen, eben gegeneinander abwägen lassen. Verkündet der Zeiger ein Ungleichgewicht, weil die »Kosten« höher als der »Gewinn« sind, sollte man von dem Handel Abstand nehmen. Rechnet man hingegen mit einer positiven Bilanz, gibt die Abwägung den Weg frei zum Handeln.
Wie die Metapher es andeutet, lassen sich die Waren auf beiden Seiten mehr oder weniger gut vergleichen und messen, so dass da ein Ersatz oder ein Ausgleich gefunden werden kann, wo eine Seite zu kurz kommt, oder eine Kompensation als Ausgleich für zugefügte Schäden angeboten werden kann. Die Abwägung soll darauf achten, dass die Vorteile durch das Erfüllen des verfolgten Ziels die dabei entstehenden Verluste für alle beteiligten Parteien überwiegen.
Nun lassen sich nicht alle Güter wie auf einer Waage auf ein gemeinsames Maß bringen und vergleichen. Das Leben von Personen etwa lässt sich nicht an wirtschaftlichem Nutzen messen, auch wenn Ökonomen uns das gern glauben machen wollen.[18] 32Außerdem, und das ist entscheidend, wiegen bei Kompromissen die »Gewinne« hinsichtlich des verfolgten Zieles nicht die Verluste auf, wie man das von einer gelungenen Abwägung erwartet. Wir haben gesehen: Kompromisse bedeuten immer auch einen Verlust: Jeder bleibt bei seiner Position, seiner Überzeugung oder seinem ursprünglichen Wunsch und nimmt die Kompromissposition nur mehr oder weniger zähneknirschend in Kauf. Ebendarin unterscheiden sich Kompromisse von Konsensen, die zu einer von allen gleichermaßen und ohne Zugeständnis geteilten Überzeugung führen. Und sie unterscheiden sich auch von einer gelungenen Abwägung, an deren Ende eine alles in allem richtige Lösung gefunden wird. In beiden Fällen (dem Konsens und der Abwägung) gibt es keine rationalen Gründe, das Ergebnis zu bedauern. Anders beim Kompromiss. Hier entscheidet die Zustimmung zum Zweitbesten als dem Maximum dessen, was unter den gegebenen Umständen zu erreichen war. Man wird möglicherweise die gefällte Entscheidung bedauern, obgleich man sie unter denselben Umständen erneut so fällen würde.
Eine Abwägung der Vor- und Nachteile eines Tuns sollte zwar die Entscheidung begleiten, ob ein Kompromiss zumutbar ist oder nicht, und wenn ja, wie er aussehen sollte. Am Ende bleibt dennoch etwas auf der Strecke, unter Umständen sogar die moralische Integrität der Person; denn sie hält ja an ihrem Lebensziel oder ihrer moralischen Überzeugung fest und betrachtet sie weiterhin als richtig. Dieser Verlust, der sich an dem weiterhin geltenden Standpunkt bemisst, stellt einen rationalen Grund zum Bedauern dar, und das ist bei einer gelungenen Abwägung nicht der Fall.
Kurz: Wurde die befriedigende Gleichgewichtsmarke gefunden und wurde sie von allen Beteiligten anerkannt, sollte man nicht von Kompromiss sprechen, auch wenn alle von ihrem ursprünglichen Wunschziel etwas zurücktreten mussten. Der bittere Geschmack fehlt, der sich bei zweitbesten Lösungen einstellt, die man eigentlich nicht wollte und die man unter anderen Umständen sogar als falsch abgelehnt hätte. Es ist nach meiner Auffassung ein Wesensmerkmal des Kompromisses, dass er von einem grundsätzlichen Gefühl des Bedauerns begleitet ist. Es ist das Bedauern, dass das, wofür man sich einsetzt, was man für richtig hält oder das man jedenfalls bevorzugt hätte, sich in der Verhandlung nicht hat durchsetzen lassen.
33Ich werde an Scharnierstellen meiner Untersuchung, nämlich bei der Diskussion unterschiedlicher Konstellationen oder Kontexte der Kompromissfindung, auf den Aspekt des Bedauerns zurückkommen.[19] Hier nur dies vorweg: Das Gefühl drückt nicht die Erkenntnis aus, dass die Entscheidung falsch war. Es ist auch nicht Ausdruck einer Reue. Es bringt die Tatsache zum Ausdruck, dass man, obschon man die Entscheidung für unter den Umständen richtig hält und sie wiederholen würde, sie nicht für an sich richtig hält. Unter anderen Umständen hätte man eine andere Entscheidung vorgezogen.[20] Dies trifft vor allem da zu, wo Personen aus moralischen, pragmatischen oder welchen Gründen auch immer sich über die Verbindlichkeit moralischer Grundsätze hinwegsetzen, zu denen sie eigentlich selbst stehen. Wählt beispielsweise ein praktizierender Christ, der die Zerstörung eines Embryos für Mord hält, eine Partei, die für eine Fristenlösung eintritt, weil diese Lösung ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben ermöglicht, wird diese Wahl von einem Gefühl des Bedauerns begleitet sein. Dieses Bedauern ist keineswegs als irrational oder unangemessen zu disqualifizieren, denn es handelt sich hier nicht um einen faulen Kompromiss. Kann man zu ihm stehen, muss es keineswegs widersprüchlich sein, mit dem Gefühl eines Bedauerns darauf zu reagieren, dass Prinzipien aufgegeben werden mussten, zu denen man weiterhin steht.[21]
Welches sind die weiteren notwendigen Bedingungen eines Kompromisses qua Kompromiss, und wann sprechen wir von einem guten, wann von einem schlechten, wann gar von einem faulen Kompromiss? Ich möchte mich auf diese beiden Fragen konzentrieren, bevor ich mich dann einem letzten Aspekt zuwende, nämlich der Frage, ob wir Kompromisse mit uns selbst schließen können.
345. Notwendige Bedingungen eines Kompromisses qua Kompromiss
Real existierende Kompromisse werden oft dann geschlossen, wenn die Beteiligten sich über die Kriterien dessen, was sie für richtig, gut oder gerecht halten, uneinig sind. So weit kommen noch keine normativen Regeln der Kompromissbildung ins Spiel. Die Aufmerksamkeit richtet sich vorderhand vor allem auf die Verhandlungsprozedur, die allein der Hoffnung entspringt, einen Weg aus dem Konflikt zu finden. Will man vermeiden, dass ein Lösungsansatz allen Parteien von außen – von Schiedsrichtern oder Vermittlern – aufgezwungen wird, muss die Aushandlung der Regeln selbst Gegenstand einer Verhandlung sein.
Wenn die Regeln einer Prozedur nicht festgelegt sind, sondern aus der Prozedur selbst erst hervorgehen sollen, scheint die Gefahr eines unendlichen Regresses unabwendbar. Denn wenn die Parteien sich nicht einmal darüber einig sind, wer sich überhaupt an der Erstellung der Regeln beteiligen darf und wer befugt ist, darüber zu entscheiden, nach welchem Verfahren überhaupt entschieden wird (ob durch einfache oder Dreiviertelmehrheit, ob durch Turnus oder Losziehen usw.), stecken wir mitten in einem Regelaufsuchungs-Regress.
Ich gehe insofern davon aus, dass die Regeln pragmatisch dem Prozess selbst entspringen. Denjenigen, die sie ablehnen, steht nämlich vor Augen, dass sie jederzeit aus der Verhandlung ausgeschlossen werden können. Wenn beiden Protagonisten die Kosten einer ergebnislosen Verhandlung teurer vorkommen als der (und sei es unfaire) Kompromiss, werden sie dazu neigen, über ihren Schatten zu springen und miteinander weiter zu verhandeln.
In einem regelfreien Spiel sind theoretisch alle »Züge« zugelassen, Gewaltanwendung, Täuschung, Betrug usw. eingeschlossen. Es wird allerdings gleich einsichtig, dass wir in dem Fall nicht von Verhandlungen sprechen werden, sondern von der Fortdauer eines Konflikts. Damit verhandelt werden kann, ist unabdingbar, dass der gewalttätige Konflikt endet und die Parteien sich an den Verhandlungstisch setzen. Sie müssen mindestens eine Einigung suchen und die nackte Konfrontation aufgeben.
Dieser Übergang vom regelfreien gewalttätigen Konflikt zur Verhandlung legt die ersten Bedingungen des neutral bzw. wertfrei 35definierten Kompromisses fest: Er beendet die Streitigkeiten nicht, aber transformiert sie in einen Begegnungsmodus, in dem die Parteien sich bereit erklären, auf Gewalt zu verzichten und sich auf minimale Regeln der weiteren Interaktion, ja eine Weise der Kooperation zu verständigen. Das schließt die Bereitschaft ein, sich an Grundregeln des Umgangs zu halten, die wenigstens für die Dauer der Verhandlung in Kraft bleiben müssen.
So ist die erste notwendige Bedingung des Kompromisses qua Kompromiss die Abwesenheit von Gewalt. Wird ein Versprechen durch Gewaltandrohung oder -ausübung erzwungen, ist es rechtlich nichtig. Gibt man dem Dieb seinen Geldbeutel, damit er nicht mit dem Messer zusticht, hat man mit ihm keinen Kompromiss geschlossen, auch wenn die Abgabe des Geldbeutels immer noch besser als der Verlust des Lebens ist und sich in der Situation als zweitbeste Lösung darstellt.
Damit geht einher, dass eine minimale Akzeptanz der Ansprüche, die jede Partei geltend macht, im Voraus gegeben sein muss. Das ist allerdings sehr wenig. Tiere, die ihr Revier markieren, legen Spuren auf einem Territorium, das sie mit anderen teilen müssen. Sie tun das, weil sie wissen, dass sie mit anderen um dasselbe Territorium konkurrieren. Die Reviermarkierung setzt eine minimale Kenntnisnahme des Bedrohungspotentials durch die Konkurrenten voraus.
Mit anderen Worten: Nach dem Gewaltverzicht ist der zweite notwendige Schritt zur Anbahnung einer Verhandlung die wechselseitige Anerkennung der Parteien als künftige Verhandlungspartner. Zu Recht sagt Margalit, dieser Schritt impliziere selbst gelegentlich schon einen Kompromiss, weil man sich damit abfinden muss, den Feind als Partner am Verhandlungstisch zu dulden. Man macht einen Kompromiss »auf dem Weg zur Verhandlung«:
Manchmal ist es schwerer, die andere Seite als legitimen Verhandlungspartner anzuerkennen, als dann tatsächlich zu einer Übereinkunft zu gelangen. Die Anerkennung der bewaffneten baskischen Separatisten (ETA) durch Spanien oder des Leuchtenden Pfades durch die Regierung Perus oder der Kurdischen Arbeiterpartei durch die Türkei als legitime Verhandlungspartner ist für Spanien, Peru oder die Türkei ein ebenso schwieriges Problem wie jedes Zugeständnis, das sie eventuell machen müssen, um zu einer Übereinkunft zu gelangen.[22]
36





























