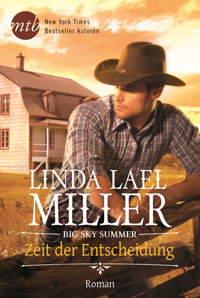4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Im Westen wartet die Liebe
- Sprache: Deutsch
Er erobert ihr Herz, aber sie ist einem anderen versprochen ...
USA, 1870. Nach dem Tod ihres Mannes sieht Evangeline nur einen Ausweg, ein neues Leben zu beginnen: Sie zieht mit ihrer Tochter nach Springwater, Montana - einen Ort, den sie nicht kennt, um einen fremden Mann zu heiraten. Sie wird von einem attraktiven Rancher empfangen - doch es ist nicht ihr Verlobter John, sondern dessen Partner Scully Wainwright. Bis zur Rückkehr von John sind die beiden ganz allein auf der Ranch. Ein ungebührliches Arrangement - und ein verführerisches ...
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Wenn das Glück dich erwählt" erschienen.
Mehr romantische Liebesgeschichten aus dem abgelegenen Örtchen in den Bergen Montanas gibt es in Band 2 der Western-Romance-Reihe: "Springwater - Wo Träume dich verführen".
Über die Reihe: USA, 19. Jahrhundert. Sechs ganz unterschiedliche junge Frauen brechen nach Springwater auf, um in dem abgelegenen Dorf in den Bergen Montanas einen Neuanfang zu wagen. Der gestaltet sich bei allen ganz anders als erwartet - doch schließlich finden sie ihr Glück, denn: Im Westen wartet die Liebe ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Springwater – Im Westen wartet die Liebe
Band 2: Wo Träume dich verführen
Band 3: Wo Küsse dich bedecken
Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt
Die McKettrick-Saga
Band 1: Frei wie der Wind
Band 2: Weit wie der Himmel
Band 3: Wild wie ein Mustang
Die Corbin-Saga
Band 1: Paradies der Liebe
Band 2: Zauber der Herzen
Band 3: Lächeln des Glücks
Über dieses Buch
Er erobert ihr Herz, aber sie ist einem anderen versprochen …
USA, 1870. Nach dem Tod ihres Mannes sieht Evangeline nur einen Ausweg, ein neues Leben zu beginnen: Sie zieht mit ihrer Tochter nach Springwater, Montana – einen Ort, den sie nicht kennt, um einen fremden Mann zu heiraten. Sie wird von einem attraktiven Rancher empfangen – doch es ist nicht ihr Verlobter John, sondern dessen Partner Scully Wainwright. Bis zur Rückkehr von John sind die beiden ganz allein auf der Ranch. Ein ungebührliches Arrangement – und ein verführerisches …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.
Linda Lael Miller
Springwater – Wo das Glück dich erwählt
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Springwater“
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1999/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Wenn das Glück dich erwählt“
Lektorat: Martina Sahler / Katharina Woicke
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Lotus_studio; © AdobeStock: Fotomicar; © Period Images; © thinkstock: inarik
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6877-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Montana, 1870
Niemals in ihrem Leben würde Evangeline jenen ersten Blick auf ihn vergessen, als er durch den frisch gefallenen hohen Schnee geritten kam. Jenen wundervollen, goldenen Moment, in dem sie ihn für jemanden gehalten hatte, der er gar nicht war.
Abigail, ihre sechsjährige Tochter, stand neben ihr am Fenster auf einer umgedrehten Obstkiste und spähte durch die von ihrem Atem beschlagene Fensterscheibe. »Siehst du, Mama, er ist gekommen, um uns abzuholen! Ich habe dir ja gesagt, dass er uns holen würde... Ist er nicht ein schöner Mann?«
Evangeline Keating biss sich auf die Unterlippe und versuchte, die unbändige Freude und Angst zugleich, die in ihr aufstiegen, zu ignorieren. Der Reiter war in der Tat »ein schöner Mann«, – zumindest, was seinen Körperbau betraf; seine Schultern wirkten breit und muskulös unter der dicken Schaffelljacke, und seine Beine waren lang und schlank. Er führte mit einer Leichtigkeit die Zügel, die bewies, dass er sich mit Pferden auskannte. Sie konnte weder seine Gesichtszüge erkennen noch die Farbe seines Haars, denn er trug einen alten Hut, den er zum Schutz gegen die Kälte dieses Morgens, der mit unerwartet starkem Schneetreiben begonnen hatte, tief in die Stirn gezogen hatte.
Sie brauchte ihn aber auch gar nicht richtig zu sehen, weil sie ein Bild von ihm besaß und es immer wieder angesehen hatte auf der Reise. »Ein Bild von einem Mann«, bestätigte Evangeline schließlich ihrer Tochter. Sie dachte an das, was nach der Trauung von ihr erwartet werden würde, und bereute fast ein bisschen ihren Entschluss, nach Westen gekommen zu sein, um Mr. John Keating, den wohlhabenden Cousin ihres verstorbenen Mannes, zu heiraten. Obwohl ihr eigentlich gar keine andere Wahl geblieben war. Charles hatte sie mittellos zurückgelassen und sowohl die Farm wie auch alle anderen Vermögenswerte Mott hinterlassen, seinem Sohn aus der Ehe mit seiner ersten Frau, Clara, die er vergöttert hatte.
Mott hatte offenbar damit gerechnet, neben dem Landbesitz und Geld seines Vaters auch Evangeline zu erben, eine Vorstellung, die sie nach wie vor erschaudern ließ, wann immer ihr dieser Gedanke kam. Heiratsfähige Männer waren Mangelware in ihrer kleinen Stadt in Pennsylvania, genau wie in der näheren Umgebung, was auf die verheerenden Verluste während des erst kürzlich beendeten tragischen Kriegs zurückzuführen war. Evangeline, für die es keine Möglichkeit gab, sich mit Anstand ihren Lebensunterhalt zu verdienen, blieb nichts anderes übrig, als zu heiraten.
Als sie schon begonnen hatte zu befürchten, sie müsse schließlich doch nachgeben und Mott Keating als Ehepartner akzeptieren – sein Vater war wenigstens ein ruhiger, beherrschter Mann gewesen, wenn auch nicht gerade gütig –, war der Brief gekommen. Mr. John Keating, ein einsamer, aber wohlhabender Rancher, schrieb, um seine Anteilnahme zu bezeigen. Er hatte ein etwas unscharfes Bild von sich dazugelegt und eine nicht unbeträchtliche Bankanweisung, die auf Evangelines Namen ausgestellt war.
Falls sie die beschwerliche Reise nach Westen auf sich nehmen wolle, schrieb er, würde er sie heiraten und ihre Tochter als seine eigene aufziehen. Er sei ein umgänglicher, gottesfürchtiger Mann mit bescheidenen Wünschen und Erwartungen, beschrieb er sich. Er sei unter den ersten gewesen, die Vieh von Texas nach Montana getrieben hatten, und besitze ein schönes, solides Haus auf seinem Land, ein Haus, das jedem Wetter standhielt. Er habe einen netten, zuverlässigen Partner, der sich die meiste Zeit im Haus nicht blicken ließe. Die Arbeit sei hart, gestand er, die Ranch liege sehr einsam, und es arbeiteten nicht viele Menschen dort. Es gebe sozusagen keine Frauen dort, auch keine Schulen oder Kirchen, obwohl Mr. Jacob McCaffrey, der mit seiner Frau die etwa zehn Kilometer entfernte Postkutschenstation »Springwater« leitete, sich hin und wieder überreden ließe, für die anderen zu predigen.
Evangeline hatte ihren und Abigails geringen persönlichen Besitz in eine einzige Reisetruhe gepackt und war mit der Eisenbahn von Philadelphia nach St. Paul gefahren, wo sie die erste von zahlreichen Postkutschen bestiegen hatten, um Nebraska und Montana zu durchqueren. Die Reise hatte Wochen gedauert und eine Menge Willenskraft, Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit von Evangeline erfordert. Wenige Stunden nach dem Schneesturm, der in der Nacht getobt hatte, hatten Mutter und Tochter erschöpft, hungrig und bis auf die Knochen durchgefroren, endlich die Springwater-Station erreicht, wo die McCaffreys sie sehr freundlich aufgenommen hatten.
Der Reiter war inzwischen vor der Scheune angelangt, wo er absaß, die Türen öffnete und sein schnaufendes Pferd ins Warme führte. Wenige Minuten später kam er wieder heraus, und sein Atem bildete große weiße Wolken in der kalten Luft, als er langsam zur Station herüberkam. Als er den Kopf hob und Evangeline und Abigail am Fenster sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht, das auf seine Weise genauso strahlend wie der frisch gefallene Schnee war, der in der Sonne glitzerte.
Evangeline trat rasch zurück und hob ganz unbewusst die Hand, um über ihr Haar zu streichen, das, ihrer eigenen Einschätzung nach, von einem langweiligen Blondton, aber tadellos frisiert war. Sie hielt sich weder für unscheinbar noch für hübsch mit ihrer hohen, kräftigen Gestalt und ihren starken Händen. Sie hatte braune Augen, gute Zähne, eine gesunde Haut und ein scheues, zurückhaltendes Lächeln. Sie konnte arbeiten, war ehrlich und verstand mit Zahlen und Wörtern umzugehen. Sie wusste, wie man Gemüse zog, Hühner züchtete, Kühe melkte, ein Haus sauber hielt, und sie kochte gut und nähte gern. Alles in allem war sie nahezu die ideale Heiratskandidatin.
Sie strich den Rock ihres blauen Kattunkleids glatt, das zerknittert von so vielen Wochen in der Reisetruhe war, und als sie aufschaute, begegnete ihr Blick June McCaffreys, einer kleinen, grazilen Frau mit mütterlichem Wesen.
Mrs. McCaffrey schaute ihren Mann an, Jacob, der vor dem riesigen Natursteinkamin saß und ein Pferdehalfter flickte. Er war ein gutmütiger Mann von beeindruckender Größe, der meist sehr ernst und still war und dichtes dunkles Haar besaß.
»June«, sagte er jetzt ruhig, »du wirst dich da nicht einmischen.«
Evangeline hatte schon fast genügend Mut gesammelt, um zu fragen, was er meinte – es war nicht die erste Bemerkung dieser Art zwischen den beiden, seit sie eingetroffen war und ihnen gesagt hatte, sie sei gekommen, um John Keating zu heiraten –, als es an der schweren Tür klopfte, Sekunden nur, bevor sie sich öffnete, ein Schwall eiskalter Luft hereindrang und den Mann mitbrachte, den Evangeline zu heiraten erwartete. Hinter ihr war Abigail, die sich ein eigenes Pony wünschte und erst recht natürlich einen Vater, so aufgeregt, dass sie sich kaum noch bezähmen konnte und ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat.
Evangeline hätte sich jetzt vielleicht vorgestellt, und tatsächlich trat sie schon vor, um es zu tun, als der Neuankömmling seinen Hut abnahm und blondes, von der Sonne gebleichtes Haar darunter zum Vorschein kam. Sein fein geschnittenes Gesicht war rot vor Kälte, und der Blick in seinen blaugrünen Augen verriet Neugier und Belustigung zugleich, Bedauern und Interesse.
Evangeline spürte einen Kloß im Hals. »Sie sind nicht Mr. Keating«, gelang es ihr gerade noch zu sagen.
Er betrachtete sie für einen endlosen Moment, wie ihr schien, und sein Gesichtsausdruck verriet nicht die geringste Emotion. Dann, endlich, antwortete er. »Nein, Ma’am«, bestätigte er schlicht, »das bin ich nicht.«
Während Evangeline betroffen schwieg – Abigail, bemerkte sie aus dem Augenwinkel, war endlich still –, hielt der Mann den Hut in beiden Händen und nickte den McCaffreys zu. »Jacob«, sagte er statt eines Grußes. »June.«
»Du wirst heißen Kaffee wollen nach einem solchen Ritt«, erklärte June und ging an den drei großen Tischen, die der Bewirtung ihrer Gäste dienten, vorbei zum Herd. Sie war sehr schlank und hatte braunes, nur leicht angegrautes Haar, gesunde, straffe Haut und Augen von einem auffallenden Blau. »Und Hunger hast du sicher auch. Setz dich doch, Scully.«
Evangeline blieb stocksteif stehen, aus Angst, jetzt irgendetwas falsch zu machen. Der Mann konnte durchaus ein Bote ihres zukünftigen Ehemannes sein, aber ihr Gespür – in Verbindung mit den merkwürdigen Blicken, die die McCaffreys wechselten –, sagte ihr, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmte.
Mr. McCaffrey, stets der perfekte Gentleman, legte seine Pferdegeschirre beiseite, erhob sich und wischte sich die großen, von der Arbeit rauen Hände an den schwarzen Hosen ab. »Mrs. Keating«, sagte er, nachdem er sich kurz geräuspert hatte, »das ist Scully Wainwright. Er ist Big Johns Partner auf der Circle JW. Scully, das ist Mrs. Keating.«
Hölzern reichte Evangeline ihm ihre Hand. Wainwright zögerte zunächst, streifte dann seine dicken Lederhandschuhe ab und erwiderte die Geste. »Mrs. Keating«, sagte er. Er verfügte über eine unerschütterliche Selbstbeherrschung, das spürte sie sofort, denn obwohl es ganz leicht um sein Kinn zuckte, wich er ihrem Blick nicht einmal aus.
»Ich hatte meinen zukünftigen Mann erwartet«, sagte Evangeline. Es ist sinnlos, lange um den heißen Brei herumzureden, dachte sie.
Er seufzte und strich sich mit einer Hand durch sein wirres Haar. Wer immer er auch sein mochte, er brauchte jemanden, der sich um ihn kümmerte: Sein Kinn und seine Wangen waren von einem dunklen Stoppelbart bedeckt, sein Haar war struppig, und sein Hemdkragen war verschlissen. Bestimmt hatte er auch Löcher in den Schuhsohlen und in den Socken.
»Du solltest es ihr jetzt besser sagen«, riet Jacob, als er Wainwrights Jacke nahm und sich dann rasch zum Gehen wandte. Irgendwie erinnerte er Evangeline an einen Mann, der gerade eine Handvoll Schießpulver in ein Feuer geworfen hatte.
»Ich hatte gehofft, das hättet ihr bereits getan«, erwiderte Scully seufzend. Er wandte nicht den Blick von Evangeline ab, als er sprach, aber ihm war anzusehen, dass er es gern getan hätte.
Abigail war nun vorgetreten, stand dicht hinter Evangeline und umklammerte die Röcke ihrer Mutter.
Jacob trat neben June, die am anderen Ende des großen Raums am Herd stand. Sie sprachen leise miteinander, während sie Arbeiten verrichteten und so taten, als bemerkten sie das Drama nicht, das sich ganz in ihrer Nähe abspielte.
Wainwright stieß einen weiteren tiefen Seufzer aus. »Big John ist nicht da. Im Moment gibt es nur mich, die Ranch und ein paar Rinder«, erklärte er.
Evangeline überlegte, was es für sie bedeuten würde, nach Pennsylvania zurückzukehren, den gekränkten Mott zu überreden, sie nun doch zu heiraten, und spürte, wie der Mut sie derart schnell verließ, dass sie sich rasch auf eine der Bänke an den Tischen setzen musste. Abigail, die ihr jetzt nicht mehr von der Seite wich, schaute mit großen, erschrockenen Augen zu Scully auf.
Er musste dem kleinen Mädchen wie ein Gigant vorkommen; selbst für Evangeline war er wie Goliath. Die Tatsache, dass er nur ein unfreiwilliger Bote war, änderte nicht viel daran. Evangeline begann allmählich einzusehen, dass sie und Abigail die lange, beschwerliche Reise für nichts und wieder nichts auf sich genommen hatten.
»Was soll das heißen, Mr. Keating ist nicht hier?«, zwang sie sich zu fragen. »Er schrieb mir und bot mir die Ehe an. Er schickte mir sogar eine Bankanweisung ...«
Wainwright hockte sich rittlings auf das Ende der langen Bank und stützte einen Ellbogen auf die Tischplatte. June kam mit einer dampfend heißen Tasse Kaffee, die sie schweigend vor ihm absetzte, bevor sie rasch wieder ging. »Ja, Ma’am, das weiß ich«, fuhr er fort. »Aber er musste geschäftlich in den Süden, nach Denver, und es wird länger dauern, als wir dachten. Er wird vermutlich bis zum Frühjahr nicht zurückkehren, so unpassierbar, wie die Wege sind.«
Evangeline kannte den Zustand der Verkehrswege. Die Kutsche, die sie nach Springwater gebracht hatte, war kaum durchgekommen, und obwohl der Fahrer darauf bestanden hatte, nach einer warmen Mahlzeit und einem Pferdewechsel unverzüglich zur nächsten Station weiterzufahren, war nicht zu sagen, wann die nächste Kutsche Springwater erreichen würde. Laut Aussage der McCaffreys konnte es Wochen dauern, falls das Wetter sich nicht änderte.
Trotzig schob Evangeline das Kinn vor und weigerte sich, ihre Empfindungen zu zeigen. Bis auf Abigail und ihren Stolz war ihr nichts mehr geblieben. »Und was bitte, wenn ich fragen darf, sollen wir bis dahin tun?«
Seine breiten Schultern zuckten, und jetzt wandte Mr. Wainwright seinen Blick einen Moment lang ab. »Das Beste wäre wohl, wenn Sie mit mir auf die Ranch hinauskommen würden, Ma’am. Sie können sich dort einrichten und heiraten, wenn Big John im Frühjahr wieder heimkehrt.«
Evangeline war erleichtert und entsetzt zugleich, da sie den Eindruck hatte, dass Mr. Wainwright seit der Abreise seines Partners ganz allein auf der Circle JW arbeitete und lebte. Es war eine Sache, eine Unterkunft zu haben, und eine andere, sie mit einem Fremden zu teilen, der zu allem Überfluss auch noch ein Mann war.
Abigail, die bis dahin ganz ungewöhnlich still gewesen war, riskierte einen Blick um Evangeline herum und fragte: »Darf ich ein Pony haben? Ich hätte gern ein geflecktes, aber eine andere Farbe wäre mir natürlich auch recht.«
Da lächelte Wainwright, und als er es tat, berührte das Evangeline tief in ihrem Innern. Die daraus entstandenen Emotionen, die in ihr widerhallten wie perfekt gestimmte Harfensaiten, blieben besser unerforscht. »Der Schnee ist zur Zeit zu tief«, erwiderte er. »Aber es könnte sein, dass wir einen Einjährigen haben, den du reiten kannst.«
»Danke«, sagte Abigail feierlich, trat vor und streckte ihre Hand aus, als wolle sie die Abmachung besiegeln. Sie wirkte ungemein zerbrechlich mit ihrem zarten Knochenbau, den riesigen blauen Augen und der blassen Haut, die einen auffallenden Kontrast zu ihren pechschwarzen Korkenzieherlocken bildete, aber in diesem Fall traf es zu, dass der äußere Anschein täuschen konnte. Abigail war auf dem Land aufgewachsen und trotz ihres adretten Kleidchens und puppenhaften Äußeren zäh und beweglich wie ein Junge und mindestens genauso spitzbübisch. In der kleinen Brust ihrer Tochter, erkannte Evangeline mit einer Mischung aus Stolz und Schrecken, schlug das Herz eines Strolchs und Straßenjungen.
Evangeline ergriff die Hand ihrer Tochter und zog sie sanft zurück, obwohl die Abmachung eindeutig längst besiegelt war. Abigail würde ihr Pony bekommen. Und das war immerhin ein kleiner Trost für ihre Mutter.
»Ich weiß nicht, ob das schicklich wäre«, sagte sie mit einem strengen Blick auf Mr. Wainwright. Sein Gesicht war von der Sonne tief gebräunt, was nur den türkisfarbenen Ton seiner Augen und seine ebenmäßigen weißen Zähne betonte. »Es sei denn, Sie wären verheiratet. Wenn Ihre Frau –«
»Ich habe keine Frau«, unterbrach er sie und trank einen Schluck von dem Kaffee, den June ihm gebracht hatte. Von den McCaffreys war nichts mehr zu sehen, obwohl ihre Stimmen aus dem kleinen Vorratsraum neben der Küche drangen, wo sie eine Art freundschaftliches Streitgespräch zu führen schienen. »Aber ich kann im Geräteraum draußen in der Scheune schlafen, und Jacob und Miss June werden bestätigen, dass ich kein Mann bin, der sich einer Frau aufzwingen ...« Hier brach er ab, warf einen Blick auf Abigail und war anständig genug, um zu erröten. »Ich bin ein Gentleman, Mrs. Keating, in jeder Hinsicht. Sie brauchen meinetwegen nicht beunruhigt zu sein.«
Evangeline glaubte ihm, sogar nach all ihren üblen Erfahrungen mit Mott, die sie gegen Männer misstrauisch gestimmt hatten. In den acht Jahren ihrer Ehe mit Charles hatte sie jedoch eine untrügliche Intuition entwickelt, und die sagte ihr nun, dass Wainwright keine physische Bedrohung für sie oder für Abigail darstellte. Das hieß nicht, dass er zahm war; alles an ihm und seinem Verhalten schien darauf hinzuweisen, dass er wild war wie die Wölfe und die Pumas, die die Berge dieses gefährlichen, unzivilisierten und unfassbar schönen Lands bevölkerten.
Evangeline wusste, dass sie keine andere Wahl hatte. Selbst wenn in nächster Zeit eine Kutsche durchkam, war ihr nicht einmal annähernd genug Geld für die Rückreise nach Pennsylvania geblieben. Mott würde ihr Geld schicken, wenn sie ihm schrieb und reumütig darum bat, aber das würde Monate dauern, und außerdem würde er im Ausgleich dafür nicht nur ihren Körper, sondern sogar ihre Seele fordern. Und die Gastfreundschaft der McCaffreys konnte sie auch nicht länger in Anspruch nehmen. Sie waren nett, sogar sehr großzügig zu ihr gewesen, aber es war nicht ihre Aufgabe, sich um eine aus der Bahn geworfene Frau und ihr Kind zu kümmern.
Es blieb ihr also gar nichts anderes übrig, als sich auf der Circle JW einzurichten und dort auszuharren, bis Mr. Keating von seiner Reise zurückkehrte. Zumindest, dachte sie in einer Art Galgenhumor, brauche ich meinen Namen nicht zu ändern, wenn ich wieder heirate. Abigail würde ein warmes, sicheres Zuhause haben und genug zu essen. Und die Vorstellung, einen ganzen Winter Zeit zu haben, um sich auf die Pflichten einer Ehefrau vorzubereiten, war nicht ohne einen gewissen Reiz für sie.
Falls sie Mr. Wainwright wirklich trauen konnte – ein Eindruck, den sie sich auf jeden Fall von den McCaffreys bestätigen lassen würde, bevor sie die Station verließ –, mochte dieses Arrangement vielleicht sogar ein Segen, ein Geschenk des Himmels sein.
»Wie würden wir zur Ranch gelangen?«, fragte sie. »Mir ist aufgefallen, dass Sie nur ein Pferd mitbrachten.«
Wainwright lächelte, als hätte sie etwas Komisches gesagt. »Jacob hat einen Schlitten. Den könnten wir uns ausleihen, zusammen mit vier Maultieren. Es wird allerdings eine lange, kalte Fahrt sein, sodass Sie sich und die Kleine warm einpacken sollten.«
»Werden wir Wölfe sehen unterwegs?«, wollte Abigail wissen. Ihre Augen wurden rund wie Suppenteller. Evangeline fragte sich, ob ihre Tochter irgendwie ihre eigenen stummen Vergleiche zwischen Wainwright und jenen wilden Bestien, die die Berge und das flache Land bevölkerten, erraten hatte.
»Sie werden uns nichts tun«, erwiderte Mr. Wainwright zuversichtlich und legte eine Hand an den 45er, der in einem Halfter an seinem rechten Schenkel steckte. Evangeline bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass er bewaffnet war, und wusste nicht, ob sie froh oder beunruhigt darüber sein sollte. Sie mochte keine Waffen, aber sie wusste auch, dass sie eine Notwendigkeit hier draußen waren, wo wilde Tiere, Banditen und feindselige Indianer nichts Ungewöhnliches darstellten.
»Sie würden sie erschießen?«, fragte Abigail.
»Ich würde es bestimmt nicht gern tun«, gab Wainwright zu. »Doch falls die Lage es erfordern sollte, wäre es mir lieber, wenn die Tiere sterben und nicht ich.«
Diese Antwort schien Abigail zu befriedigen. Sie setzte sich auf die Bank neben dem Tisch und ließ ihre Füße baumeln, während sie sich die Abenteuer ausmalte, die sie bestimmt erwarteten. Andere Kinder hätten vielleicht Alpträume nach einem derartigen Gespräch, aber Abigail besaß die Seele eines Abenteurers und wäre schwer enttäuscht gewesen, wenn sie im Laufe ihre Kindheit nicht wenigstens eine lebensbedrohende Situation erlebt hätte.
Evangeline unterdrückte ein Erschaudern. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie es vorgezogen, in Pennsylvania zu bleiben, so verwüstet es auch war nach diesem letzten schlimmen Krieg, um in Frieden zu leben, an der Seite eines braven Mannes zu arbeiten, Abigail aufzuziehen und noch mehr Kinder auf die Welt zu bringen. Es verblüffte sie noch immer, dass sie einen Neuanfang gewagt hatte, an diesem weit entfernten und ihr fremden Ort, wo alles so fremd für sie war. Sie vermisste plötzlich die sanft ansteigenden Hügel und unendlich weiten Felder ihres Heimatstaats.
Mr. Wainwright deutete ihren Gesichtsausdruck mit verblüffender Genauigkeit. »Dies ist ein hartes Land, Ma’am«, sagte er, »aber ein schöner Ort zum Leben. Es erfordert nichts weiter als Unternehmungsgeist und harte Arbeit.«
Evangeline dachte, dass sie ebenso viel Unternehmungsgeist wie jeder andere besaß, und Gott wusste, dass harte Arbeit nichts Fremdes für sie war, aber ihr war auch klar, dass der Westen einer Frau nicht die gleichen Chancen bot wie einem Mann. Sie versuchte nur, das Beste aus einer schwierigen Situation zu machen. Als sie Mrs. McCaffrey mit Töpfen und Pfannen klappern hörte, entschuldigte sie sich und ging zu ihr hinüber.
June summte ein Liedchen vor sich hin, als sie Schmalz in eine Pfanne gab, in der sie offenbar ein Hühnchen braten wollte. Ein Topf mit Wasser und geschälten Kartoffeln, der auf dem hinteren Teil des Herds stand, fing gerade an zu köcheln.
Evangeline blickte rasch noch einmal zu Wainwright, sah, dass er sie grinsend beobachtete, und kehrte ihm den Rücken zu.
»Ist es ungefährlich, mit diesem Mann zu reisen?«, fragte sie Mrs. McCaffrey flüsternd.
June lächelte. »Scully? Er ist ein anständiger Mann. Er wird sich gut um Sie und das kleine Mädchen kümmern. Sie haben nichts von ihm zu befürchten.«
Evangeline verschränkte ihre Arme. »Warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass Mr. Keating nach Denver gefahren ist? Das mussten Sie doch wissen.«
Mrs. McCaffrey begann, gut gewürzte und panierte Hühnerteile in die Pfanne zu legen. »Ich und Jacob hatten schon daran gedacht«, gab sie zu. »Aber Sie waren so durchgefroren und erschöpft von Ihrer langen Fahrt, als Sie gestern Abend hier ankamen, dass wir nicht das Herz hatten, etwas davon zu sagen. Außerdem wussten wir ja, dass Scully kommen würde, um Sie abzuholen.«
»Er ist also ein Freund von Ihnen? Scully, meine ich?«
June lächelte warmherzig. »Er ist wie ein Sohn für uns«, bestätigte sie, während sie nach einer Dose mit grünen Bohnen griff, die bereits geöffnet war, und sie in eine etwas kleinere Kasserolle ausleerte. »Wir kennen Scully schon, seit wir herkamen, um die Station zu führen.« Ihr Lächeln verblasste ein wenig, und sie sprach noch leiser. »Unsere eigenen beiden Söhne sind in Chattanooga gefallen.«
Evangeline schwieg, während sie über den schrecklichen Verlust nachdachte, den die McCaffreys erlitten hatten. So viele Söhne, Väter, Brüder und Ehemänner waren in diesem Krieg gefallen, bei der Union wie bei den Konföderierten. Um sich abzulenken von diesem schrecklichen, unfassbaren Leid, schaute sie sich noch einmal unauffällig nach Scully Wainwright um, der mit Jacob plauderte, der jetzt bei ihm am Tisch saß. Abigail hockte auf der Bank neben Scully und lauschte und betrachtete ihn fasziniert.
»Und Mr. Keating? Wie ist er?« Sie hatte bis dahin nicht gewagt zu fragen, weil sie die Antwort zu sehr gefürchtet hatte. Und wenn er nun ein Trinker, ein Wüstling und ein Grobian war? Wenn er sie schlug oder – dafür würde ich ihn umbringen – Abigail?
Mrs. McCaffrey lächelte wieder, obwohl die Trauer um ihre toten Söhne nach wie vor in ihren Augen zu erkennen war. »Er ist ein anständiger Mann. Älter als Scully, zwanzig Jahre oder so. Sie haben ein gutes Stück Land dort draußen und ein solides Blockhaus. Im letzten Herbst haben sie eine große Herde Rinder an die Armee verkauft und einen Haufen Geld damit verdient. Ich glaube, Big John wollte Vieh mitbringen, wenn er aus Denver zurückkommt, um eine neue Herde aufzubauen.«
Da das Hühnchen briet und die Kartoffeln kochten, nahm June die blaue Emaillekanne und trug sie zu dem Tisch, an dem die Männer saßen. Evangeline folgte ihr. Sie würde den Rest ihres Lebens damit zubringen, am Herd zu stehen, und es wäre sinnlos gewesen, ihre Zeit damit zu verschwenden, bevor es nötig war.
»Ihr solltet hier übernachten, Scully«, riet June, während sie ihrem Gast und ihrem Mann Kaffee nachschenkte. »Zehn Meilen sind ein weiter Weg bei diesem Wetter. Außerdem sind Mrs. Keating und die Kleine noch immer sehr erschöpft von ihrer anstrengenden Reise aus Pennsylvania.«
Scully warf einen prüfenden Blick durchs Fenster. »Mit dem Wetter hast du recht«, gab er zu, ohne allerdings auf Evangelines oder Abigails Erschöpfung einzugehen, »aber ich möchte das Vieh nicht so lange allein lassen. Es ist viel gestohlen worden in letzter Zeit.«
Jacob zog eine schwarze Augenbraue hoch. »Indianer?«
Abigail beugte sich noch interessierter vor. »Richtige Indianer?«, wisperte sie begeistert. »Solche, die einen skalpieren?«
»Abigail!«, schalt Evangeline. So jung die Kleine war, kannte sie doch schon eine Menge schrecklicher Geschichten. Wahrscheinlich hatte sie sie von ihrem sehr viel älteren Halbbruder gelernt, von Mott, der wohl gehofft hatte, Mutter und Tochter damit so einzuschüchtern, dass sie bei ihm blieben.
Scully, der natürlich nichts von all dem wusste, nickte. »Das kommt ab und zu mal vor«, bestätigte er. »Aber trotzdem«, fuhr er fort und wandte sich dabei an Jacob, »tun mir die armen Kerle leid. Wild wird schwer zu finden sein, wo der Winter in diesem Jahr so früh gekommen ist, und sie müssen es sich teilen mit den Wölfen und den Berglöwen, die hinter jedem Hasen und Opossum her sind. Das Rotwild bringt auch nicht viel Fleisch, so dünn und knochig, wie es dieses Jahr ist.«
Trotz ihrer geheimen Angst, von Wilden skalpiert oder entführt zu werden, war Evangeline gerührt von dem Mitgefühl, das Mr. Wainwright den Indianern entgegenbrachte; auf der Zugfahrt nach Westen und später in den Postkutschen hatte sie andere Männer sagen hören, man solle die Rothäute ein für alle Mal vernichten und die Wege für anständige Leute wieder sicher machen.
»Wenn ich heimkomme, kann ich mich glücklich schätzen, wenn mir noch ein einziges Huhn geblieben ist«, fügte er hinzu.
Auf das Stichwort »Huhn« hin kehrte June an den Herd zurück, um das Mittagessen im Auge zu behalten. Eine halbe Stunde später hatte sie Brot aufgebacken und eine Sauce zubereitet, die sie zu den anderen Gerichten essen würden, und es duftete so verlockend aus der Küchenecke, dass Evangelines Magen knurrte. Auf der Reise hatte sie oft nichts gegessen, um Geld zu sparen und ihrer Tochter nichts versagen zu müssen, sodass sie Mrs. McCaffreys gute Küche jetzt sehr zu schätzen wusste.
Evangeline deckte den Tisch, der dem Kamin am nächsten stand, während Jacob und Mr. Wainwright in die Scheune gingen, um sich zu vergewissern, dass der Schlitten in Ordnung war für diese Reise. Als sie zurückkehrten und sich auf der kalten Veranda vor dem Haus die Hände wuschen, war es zwei Uhr nachmittags, und das Licht wurde bereits schwächer. Evangeline war dankbar für eine weitere Nacht in der warmen, sicheren Postkutschenstation, weil ihr bewusst war, wie anstrengend und gefährlich die Reise am nächsten Tag sein würde.
Nach dem Essen half Evangeline Mrs. McCaffrey beim Geschirrspülen, während Jacob und Mr. Wainwright wieder hinausgingen, um zu rauchen und die Wetterlage einzuschätzen. Abigail, die nach dem guten Essen und den aufregenden Gesprächen müde war, schlief in einem Sessel am Kamin.
»Fühlen Sie sich nie einsam hier draußen?«, fragte Evangeline, während sie einen Teller trocknete.
Mrs. McCaffrey lächelte und schüttelte den Kopf. »Ich habe meinen Jacob und den Herrgott, wenn ich Gesellschaft brauche, und es ist immer sehr viel los hier, wenn die Kutschen kommen. Ich sehe ständig neue Leute, und sie alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen.«
Evangeline wollte nach Mrs. McCaffreys Söhnen fragen, aber die Frage erschien ihr zu persönlich. Die Leute im Westen waren ziemlich wortkarg, fand sie, und schienen es vorzuziehen, ihre Geheimnisse für sich zu bewahren. »Es jagt mir ein bisschen Angst ein«, gestand sie. »Die Vorstellung, so allein zu sein, meine ich.«
June schenkte ihr ein weiteres Lächeln. »Alleinsein muss nicht schlimm sein, wissen Sie. Ein Mensch kann lernen, sich selbst besser zu verstehen. Manche Leute finden in ihrem gesamten Leben nichts über ihre eigenen Gedanken und Gefühle heraus, aber hier draußen braucht man nichts anderes zu tun, als aufzupassen.«
»Aufzupassen«, wiederholte Evangeline zerstreut. Hinter den dicken Wänden der Station war das erste nächtliche Heulen der Wölfe zu vernehmen. Jacob und Scully, die wieder an einem der drei Tische saßen, waren in eine Partie Schach vertieft und schauten bei dem schaurigen Geräusch nicht einmal auf.
June berührte plötzlich ihren Arm. »Sie brauchen keine Angst zu haben, Mrs. Keating. Sie werden sicher sein bei Scully, Sie und Ihre Kleine. Ich habe noch keinen Bären, keinen Wolf oder Yankee gesehen, mit dem er nicht fertiggeworden wäre.«
Evangeline begann, sich besser zu fühlen – bis ihr langsam dämmerte, was Mrs. McCaffrey ihr da gerade mitgeteilt hatte. »Er hat auf der Seite der Konföderierten gekämpft?«
June strahlte vor Stolz. »Das hat er allerdings«, erklärte sie. »Scully war Kurier für General Robert Lee persönlich.«
Die Schatten innerhalb des Hauses schienen sich in jenem Augenblick noch zu vertiefen, obwohl Evangeline sich ziemlich sicher war, dass es nur eine Sinnestäuschung war. Sie betrachtete Mr. Wainwrights Profil, als er die Hand ausstreckte, um eine Petroleumlampe näher an das Brett heranzuziehen, den gläsernen Schirm entfernte und ein brennendes Streichholz an den Docht hielt. Als er Feuer fing, setzte er den Glasschirm wieder auf, und er und Jacob fuhren fort mit ihrer Schachpartie.
Evangeline räusperte sich. »Da ich aus Pennsylvania komme, bin ich ... politisch gesehen ...«
»Das macht nichts«, fiel June ihr ins Wort und drückte ihre Hand. »Sie können nichts dafür, dass Sie ein Yankee sind. Scully weiß das, und er wird es Ihnen ganz bestimmt nicht vorhalten.« Sie runzelte die Stirn. »Was Big John Keating angeht, so habe ich keine Ahnung, wie er in dieser Frage denkt. Wahrscheinlich hält er es mit keiner Seite.« Sie senkte die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern, als teilte sie Evangeline ein wohlgehütetes Geheimnis mit. »Er ist in Texas aufgewachsen. Seiner Meinung nach macht ihn das weder zu einem Yankee noch zu einem Konföderierten. Er ist Texaner, sagt er.«
Erst später, als sie im Bett lag mit Abigail, die den Schlaf der Unschuldigen schlief, fielen Evangeline Mrs. McCaffreys Bemerkungen wieder ein. Sie hatte den ganzen Abend über Scully Wainwright nachgedacht und sich gefragt, ob er die Nordstaatler hassen mochte für all das, was der Süden während des langen, grimmigen Bruderkriegs erlitten hatte. Sie fragte sich, wo und wie er aufgewachsen sein mochte und ob es in seinem Leben jemals eine Frau gegeben hatte, die ihm wichtig war.
Dass sie eigentlich über Big John Keating hätte nachdenken müssen, der in wenigen Monaten ihr Ehemann sein würde, in guten wie in schlechten Zeiten, in Reichtum und in Armut, bis dass der Tod sie scheide, war selbstverständlich. Und dennoch fand sie Scully Wainwright, den höflichen, stillen, rätselhaften Mann, der hergekommen war, um sie heimzuholen, erheblich interessanter.
2
Das kleine Mädchen, eingehüllt in dicke Bärenfelle und große, weiße Atemwolken, schien wunschlos glücklich zu sein auf seinem sicheren Platz im hinteren Teil von Jacobs selbstgebautem Schlitten. Ihre Mutter hingegen ... Während Scully noch ein allerletztes Mal die vier geborgten Maultiere begutachtete, um sich zu vergewissern, dass sie fit waren für die zehn Meilen über Eis und Schnee, saß Evangeline stocksteif da und suchte mit ihren Blicken die nähere Umgebung nach Wölfen, Banditen und Indianern ab.
Scully lächelte im Stillen, als er das Vorderbein eines Maultiers anhob, um sich den Huf von unten anzusehen. Das Tier war etwas schreckhaft, seit sie es aus dem Stall geholt hatten, und Scully konnte nicht riskieren, dass es zu lahmen begann, wenn sie mitten in der Wildnis waren, wo er und seine beiden Schützlinge vielleicht erfrieren würden.
Der Maulesel stieß ihn hart gegen die Schulter, als ob er protestieren wolle.
»Ruhig, mein Junge«, sagte er, obwohl ihm klar war, dass der Befehl wahrscheinlich nicht viel nützte. Ein Esel blieb ein Esel; es wäre dumm gewesen, von dem Tier ein anderes Verhalten zu erwarten.
»Alles in Ordnung, Mr. Wainwright?«, rief Evangeline von irgendwo unter der Kapuze ihres dicken Wollumhangs.
Er seufzte und ermahnte sich im Stillen, dass die Frau ein Greenhorn war und dazu auch noch ein Yankee. Der Westen war für sie fremd und beängstigend, was eigentlich nur bewies, dass sie Verstand besaß. Er fragte sich, ob sie wohl auf der Stelle zur Station zurückkehren würde, falls er sie bat, ihn mit seinem Vornamen anzusprechen. Wenn die Leute ihn »Mr. Wainwright« nannten, brauchte er immer ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass sie ihn und nicht irgendjemanden in der Nähe meinten.
»Alles bestens, Ma’am«, erwiderte er.
Jacob und June standen frierend in der Eingangstür der Postkutschenstation und winkten. »Passt gut auf euch auf!«, rief June.
Scully hob grüßend eine Hand, bevor er neben Mrs. Keating in den Schlitten stieg und die Zügel nahm. Sie rief den McCaffreys ein unsicheres »Vielen Dank für alles« zu und richtete den Blick auf die Wildnis, die vor ihnen lag. Der Weg, soweit er überhaupt als solcher zu bezeichnen war, war vollkommen zugeschneit, aber der Schnee war über Nacht gefroren, und die Sonne tauchte die Landschaft in ihr helles Licht.
Nachdem Scully sich die Zeit genommen hatte, seinen Hut zurechtzurücken und die unendliche Weite der Landschaft, die sich vor ihnen erstreckte, zu bewundern, setzte er die Maultiere mit einem Zügelklatschen in Bewegung. Sein Hengst würde bei den McCaffreys bleiben, bis Scully in ein paar Tagen den Schlitten und die Maultiere zurückbrachte.
Eine Zeit lang kostete es ihn große Mühe, die sturen Tiere in Bewegung zu halten; die Maulesel wären lieber in ihrem warmen Stall geblieben, wo es Schutz und Futter gab, und Scully konnte es ihnen nicht verübeln. Die Fahrt würde für sie alle mühsam werden, für Mensch und Tier, aber ihnen blieb nichts anderes übrig, als sie hinter sich zu bringen. John Keating würde erwarten, dass seine aus Philadelphia angereiste, zukünftige Frau schon auf der Ranch war, wenn er im Frühling aus Denver zurückkehrte, und als Big Johns Freund und Partner fühlte Scully sich verpflichtet, seine Interessen wahrzunehmen. Was allerdings nicht bedeutete, dass es ihn nicht etwas verstimmt hätte, dass Big John die Frau und das kleine Mädchen hatte herkommen lassen und dann beschlossen hatte, zu verschwinden.
Klar, die Herde musste ergänzt werden, aber es wäre sinnvoller gewesen, Scully zum Einkaufen zu schicken und für den langen Heimweg nach Montana Treiber anzuheuern, damit Big John auf der Circle JW bleiben konnte, um selbst auf seine Braut und Stieftochter zu warten. Scully schätzte Big John Keating wirklich sehr, aber manchmal fragte er sich, ob die Aussicht, nach all den Jahren, in denen er allein gelebt hatte, noch eine Frau zu nehmen, ihn nicht vielleicht dermaßen eingeschüchtert hatte, dass er die Reise nach Denver als Vorwand für eine Flucht genutzt hatte.
Wieder seufzte er. Evangeline war eine hübsche Frau – und klug genug, um mit den unvermeidlichen Härten des Lebens hier zurechtzukommen. An Big Johns Stelle wäre er überglücklich gewesen, eine solche Gesellschaft abends am Kamin zu haben, ganz zu schweigen von den anderen Vorzügen, die eine Ehe mit sich brachte.
»Wie weit sind zehn Meilen?«, fragte das kleine Mädchen aus dem hinteren Teil des Schlittens.
Scully drehte sich zu ihr um und lächelte sie an. »Es ist weit«, antwortete er, »aber wir müssten noch vor Einbruch der Nacht zu Hause sein.«
»Wenn wir nicht von Wölfen aufgefressen werden«, erwiderte Abigail, und es klang beinahe erwartungsvoll.
»Richtig«, stimmte er schmunzelnd zu.
»Oder von Indianern angegriffen werden.«
»Das auch.« Scully nickte ernst.
»Oder von Banditen überfallen werden.«
»Abigail!«, mischte Evangeline sich ein. »Das genügt jetzt. Mr. Wainwright muss sich auf das Lenken der Maultiere konzentrieren.«
»Scully«, berichtigte er sie, ohne es zu wollen. Dann wurde er heiser und räusperte sich umständlich. »Nennen Sie mich Scully.«
Ihre braunen Augen musterten ihn ernst. »Also gut. Aber ich glaube nicht, dass es korrekt wäre, wenn Sie mich mit meinem Vornamen ansprechen.«
Es versetzte ihm einen Stich, aber nicht etwa, weil Evangeline darauf bestand, Distanz zu wahren. Es war die Traurigkeit, die er aus ihren Worten heraushörte. »Was immer Sie für richtig halten, Ma’am.«
»Ich denke, Ma’am wird für den Moment genügen«, erwiderte sie steif. Er fand es interessant, dass sie ihn nicht bat, sie mit »Mrs. Keating« anzusprechen, und wünschte plötzlich, mehr zu wissen über ihren ersten Mann, der Big Johns liebster Cousin gewesen war.
Aber andererseits war es wahrscheinlich besser, sich auf seine eigenen Angelegenheiten zu beschränken. Denn schließlich besaß auch er Geheimnisse, die er nicht gern mit anderen geteilt hätte.
Das Land, das sie durchquerten, war ziemlich flach, aber überall gab es Wäldchen aus Pinien, Cottonwood und Birken, und wenn Evangeline sich umschaute, war die Postkutschenstation nur noch als kleiner dunkler Fleck im Schnee zu sehen, mit zwei Kaminen, aus denen dünner Rauch emporstieg. Einerseits sehnte sie sich danach, in den Schutz dieses kleinen warmen Gebäudes zurückzukehren, wo sie und Abigail in Sicherheit sein würden, aber andererseits wusste sie auch, dass kein Ort wirklich sicher war. Selbst in den Maisfeldern von Pennsylvania hatten Männer einander umgebracht, sich gegenseitig erschossen und erstochen und mit Kanonenfeuer in die Luft gejagt. Die beiden großen Armeen, die in den ersten Julitagen 1863 in Gettysburg aufeinandergestoßen waren, hatten Blut und Kummer, zerstörte Ernten und gebrochene Herzen hinter sich zurückgelassen und Schäden von unvorstellbaren Ausmaßen verursacht. Und die psychologischen Folgen des Massakers waren sogar noch sehr viel unheilvoller.
Evangeline schloss die Augen vor den Bildern, die sie nie vergessen würde. Nach der Schlacht in Gettysburg waren sowohl verwundete Unionssoldaten wie auch Rebellen in die umliegenden Städte gebracht worden, um dort notdürftig versorgt zu werden, da die Feldlazarette die unzähligen Verwundeten schon lange nicht mehr fassen konnten. Sie und andere Frauen aus ihrer kleinen Gemeinde hatten getan, was sie konnten, um zu helfen, hatten Verbände gewechselt und Briefe für Angehörige geschrieben, die meiste Zeit jedoch nur hilflos herumgesessen und irgendeinem Jungen, der im Sterben lag, die Hand gehalten. Dabei hatte sie oft gedacht, wie jetzt wieder, dass es, wenn die Uniform eines Mannes blutdurchtränkt war, unmöglich war, die eine von der anderen zu unterscheiden.
Sie schwieg, bis die Station nicht mehr zu sehen war, und dann, angesichts der vielen kalten Stunden in Scullys Gesellschaft, die vor ihr lagen, ganz zu schweigen von dem langen Winter, entschloss sie sich, eine Unterhaltung zu beginnen. Mit dem Gedanken, dass dieser Moment so gut wie jeder andere war, um etwas klarzustellen, richtete Evangeline sich sehr gerade auf, faltete die Hände auf dem Schoß und begann: »June erzählte mir, Sie hätten in der Armee gedient. Während des Krieges, meine ich.«
Seine blaugrünen Augen, in denen eben noch so etwas wie Mutwillen gefunkelt hatte, wurden schmaler, als er sie betrachtete, und ein harter Zug erschien um seinen Mund. Dann nahm er sich zusammen, lächelte und nickte zustimmend. »Ja, Ma’am«, sagte er.
»Unter General Lee.«
»Ja, Ma’am. Unter General Lee.«
Es war gar nicht leicht, Scully Wainwright in eine simple Unterhaltung zu verwickeln. Evangeline hätte noch nicht sagen können, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes war. »Ich nehme an, Sie wissen, dass mein Mann ... dass ich...«
»Dass Sie Yankees waren?«, fragte Scully, und jetzt klang wieder eine leise Belustigung in seiner Stimme mit. »Keine Sorge, Ma’am. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Ihnen das zum Vorwurf machen würde. Ein Mensch kann schließlich nichts dafür, wenn er nördlich der Mason-Dixon-Linie geboren ist, nicht wahr?«
Evangeline hatte das Gefühl, als wäre sie gerade höflich, aber entschieden auf ihren Platz verwiesen worden, obwohl kein Groll in Wainwrights Ton oder Verhalten zu erkennen war. Sie straffte ihre Schultern. »Und doch sind Sie hierhergekommen«, gab sie zu bedenken. Selbst ihr Atem schien in dieser klaren, kalten Luft zu Wölkchen zu gefrieren.
Eins der Maultiere im Geschirr begann zu bocken, und er beruhigte es mit einem scharfen Pfiff. »Es war nicht mehr viel übrig von meinem Zuhause, als die Yankees mit uns fertig waren«, erwiderte er ruhig. »Mein Vater starb während des Krieges, als ich nicht zu Hause war, und so weit ich weiß, ist keiner meiner Brüder je zurückgekommen. Ich habe eine Zeit lang auf sie gewartet, dann alles bis auf meinen Sattel und meine Waffe gegen diesen Hengst getauscht und mich auf den Weg gemacht nach Westen. Eine Weile zog ich ziellos durch die Gegend, bis ich schließlich Big John in Colorado traf und beschloss, eine Partnerschaft mit ihm einzugehen und die erste Herde nach Norden zu treiben.«
»Haben Sie Indianer unterwegs gesehen?«, warf Abigail neugierig ein.
Scully lachte. »Eine Menge«, sagte er.
Evangeline verdrehte die Augen.
»Haben sie jemanden skalpiert?«
»Abigail«, warnte Evangeline.
Scully zwinkerte ihr zu, und erstaunlicherweise wärmte sie das mehr als alle Bärenfelle oder Decken es gekonnt hätten. »Nein«, antwortete er. »Sie wollten nur ein bisschen Rindfleisch. Wir gaben ihnen ein paar Stiere, und sie zogen glücklich und zufrieden weiter.«
Die Antwort schien Abigail zufriedenzustellen, zumindest für den Augenblick. Sie kuschelte sich wieder in ihre Felle, aber Evangeline wusste, dass ihr Köpfchen schneller dramatische Situationen fabrizierte, als die nördlichen Munitionsfabriken Kugeln während des Konflikts gegossen hatten. Abigail war zu altklug für ein Kind in ihrem Alter, aber sie war nun einmal, was sie war. Sie las und rechnete seit ihrem vierten Lebensjahr und hatte ihren Namen sogar vorher schon geschrieben, und sie konnte mehr als zwanzig Gedichte und Bibelstellen rezitieren, die ihr Vater sie auf eigenen Wunsch gelehrt hatte.
Zum ersten Mal seit vielen Wochen gestattete sich Evangeline, an Charles zu denken. Sie hatten nie eine Bilderbuchehe geführt; Charles hatte Clara, seine erste Frau, vergöttert, und obwohl er immer gut zu Evangeline gewesen war, war sie mehr eine Kameradin als eine Ehefrau für ihn gewesen. Er neigte dazu, zum fernen Horizont hinüberzustarren, vor allem, wenn die Sonne unterging, als erwartete er, Clara dort zu sehen, und er hatte Evangeline so oft mit ihrem Namen angesprochen, dass sie begonnen hatte, darauf zu hören.
Aber trotz allem war Charles ein guter, braver Mann gewesen, der keine großen Ansprüche stellte und nicht kleinlich war, und sie vermisste ihn jetzt sehr. Wenn sie die Uhr hätte zurückstellen können zu der Zeit vor seinem Tod, hätte sie es trotz des schrecklichen Krieges, der dazwischenlag, getan. Doch da diese Möglichkeit ihr versagt war, wie allen anderen Menschen, blieb ihr gar keine andere Wahl, als sich kühn in eine unsichere Zukunft zu begeben. Ohne Versprechungen und ohne Garantien.