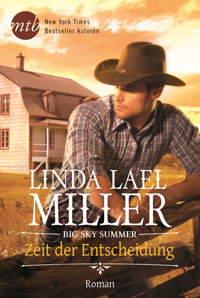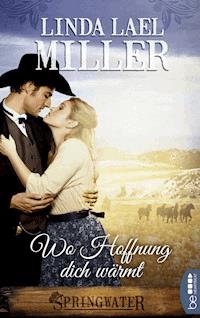
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unvergesslicher Winter in den Bergen Montanas
Montana, Herbst 1882. Olivia Darling hat sich von der Eröffnung einer kleinen Pension in Springwater einen Neuanfang versprochen. Doch in dem fremden Ort bleibt sie eine Außenseiterin - bis ein Neuankömmling ihr Gast wird: Jack McLaughlin. Olivia spürt, dass den Mann ein Geheimnis umgibt. Dennoch fühlt sie sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Schnee und Kälte machen ihr nichts aus - bis kurz vor Heiligabend ein Unglück geschieht ...
"Linda Lael Miller macht uns einmal mehr ein Geschenk der Liebe." Romantic Times
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Sieg der Herzen" erschienen.
Weitere historische Liebesroman-Reihen von Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT:
Die McKettrick-Saga. Die McKenna-Brüder. Die Corbin-Saga. Die Orphan-Train-Trilogie um die Chalmers-Schwestern.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:
Springwater – Im Westen wartet die Liebe
Band 1: Wo das Glück dich erwählt
Band 2: Wo Träume dich verführen
Band 3: Wo Küsse dich bedecken
Die McKettrick-Saga
Band 1: Frei wie der Wind
Band 2: Weit wie der Himmel
Band 3: Wild wie ein Mustang
Die Corbin-Saga
Band 1: Paradies der Liebe
Band 2: Zauber der Herzen
Band 3: Lächeln des Glücks
Über dieses Buch
Ein unvergesslicher Winter in den Bergen Montanas
Montana, Herbst 1882. Olivia Darling hat sich von der Eröffnung einer kleinen Pension in Springwater einen Neuanfang versprochen. Doch in dem fremden Ort bleibt sie eine Außenseiterin – bis ein Neuankömmling ihr Gast wird: Jack McLaughlin. Olivia spürt, dass den Mann ein Geheimnis umgibt. Dennoch fühlt sie sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Schnee und Kälte machen ihr nichts aus – bis kurz vor Heiligabend ein Unglück geschieht …
Über die Autorin
Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.
Linda Lael Miller
Springwater – Wo Hoffnung dich wärmt
Aus dem amerikanischen Englisch von Joachim Honnef
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Linda Lael Miller
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „A Springwater Christmas“
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2001/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Sieg der Herzen“
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © gettyimages: konstantin32; © Period Images; © iStock: LifeJourneys; © shutterstock: Lotus_studio
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6880-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für John und June,mit Liebe,Dankbarkeitund der größten Bewunderung
Und er sprach: Was hast du getan?Horch! Das Blut deines Bruders schreitzu mir vom Erdboden her.Und nun, verfluchet seiest du von der Erde,die sich aufgetan hat,um das Blut deines Bruders von deiner Handzu empfangen!Wenn du den Erdboden bebaust,soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben;unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde ...
Das erste Buch Mose 4:10 – 12
Prolog
Tennessee,Frühjahr 1863
Es war kurz nach der Morgendämmerung, doch Wes McCaffrey schritt bereits die Straße hinunter, zusammengerollte Decken auf den Rücken geschnallt und sein Jagdgewehr in einer Hand. Als Will ihn einholte – er hatte darauf verzichtet, nach ihm zu rufen, weil er die Leute nicht wecken wollte –, packte er seinen Zwillingsbruder an den Jackenaufschlägen, zerrte ihn herum und stieß ihn mit dem Rücken gegen den Stamm einer Eiche.
Wes stöhnte auf, starrte Will wütend an und bückte sich, um seine Mütze aufzuheben, die ihm vom Kopf gerutscht war. »Du kannst mich nicht aufhalten«, sagte er, und Will wusste, dass es stimmte, so sehr ihn seine eigene Ohnmacht auch krank machte. »Wenn du auf der Veranda stehen und den Yankees zuwinken willst, wenn sie kommen, um uns auszuräuchern, ist das deine Wahl. Ich hingegen werde kämpfen.«
Will presste die Lippen aufeinander und unterdrückte seinen aufwallenden Zorn. Am liebsten wäre er explodiert, doch wenn man es mit Wes zu tun hatte, musste man einen kühlen Kopf bewahren. Wenn man ihn zur Vernunft prügeln wollte, wie Will es in diesem Moment am liebsten getan hätte, wurde er nur noch sturer. Dann war er ungefähr so gefügig wie ein von Bienen gestochenes Maultier, das man aus einem Schlammloch ziehen wollte.
»Du kannst sie nicht aufhalten, Wes«, sagte er schließlich mit ruhiger Stimme. »Niemand kann das. Sie sind in der Überzahl, und sie haben alles reichlich – Pferde, Waffen, Proviant, einfach alles. Es ist vergebliche Mühe, sie aufhalten zu wollen.«
Wes’ blaue Augen blitzten, und sein Gesicht wurde rot wie der Unterrock eines Freudenmädchens. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund, als könne er dadurch den Impuls unterdrücken, Will ins Gesicht zu spucken. »Ich hätte nie gedacht, dass sich mein eigener Bruder einmal als Feigling entpuppen würde«, stieß er wütend hervor. Er trat auf Will zu und drückte ihm einen Zeigefinger gegen die Brust. »Wenn General Lee dich so reden hört, würde er dich noch vor Sonnenuntergang aufhängen lassen.«
Will verschränkte die Arme und zeigte sich unbeeindruckt. Wes war nicht die einzige halsstarrige Person der Familie McCaffrey. Er war nur einer von vieren. »Nun, General Lee ist nicht hier, oder?«, höhnte er. »Verdammt, Wes, wenn du nicht den Kopf voller Flausen und Ruhmes-Träumereien hättest, wäre dir klar, dass meine Ansichten vernünftig sind. Was, zum Teufel, willst du so eifrig verteidigen? Vielleicht das Sklaventum? Die Interessen eines Haufens fetter Plantagenbesitzer und Aristokraten, die dich eher mit der Peitsche bearbeiten würden, als dich mit ihren Töchtern tanzen zu lassen? Du weißt, wie sie unsereinen nennen, nicht wahr? Weißes Gesindel, das sind wir für sie.«
»Halt die Schnauze!«, schrie Wes. Wenn es überhaupt eine Hoffnung gegeben hatte, dass die Leute ihren Streit nicht mitbekamen, dann war sie jetzt hinüber. »Es ist nicht so, und du weißt das! Gesindel sind diejenigen, die hier herunter kommen – die Blaubäuche, die brandschatzen und plündern und morden. Für die würde ich nicht eintreten.«
»Du redest, als könntest du sie ganz allein stoppen. Du bist gerade mal siebzehn Jahre alt, Wes! Du bist ein Junge, der Soldat spielen will, und du wirst in den Tod gehen, wenn du nicht vernünftig bist.«
Wes wollte ihm an den Kragen gehen, besann sich jedoch anders und blieb widerwillig stehen. »Ich gehe«, sagte er ernst. »Damit hat sich’s. Und wenn du auch nur ein bisschen Mumm hast, Will McCaffrey, gehst du mit mir.«
Will fuhr sich mit den gespreizten Fingern durchs Haar und legte dann die Hände auf die Hüften, um nicht seinen eigenen Bruder zu erwürgen. »Du willst abhauen, ohne dich von Mama und Daddy zu verabschieden?«, fragte er verwundert, und seine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Flüstern. »Wes, das wird sie umbringen.«
Schließlich gab Wes klein bei, aber nur ein bisschen. »Ich werde ihnen schreiben, sobald ich bei einer richtigen Einheit bin«, sagte er.
In Wills Augen flammte ohnmächtiger Zorn auf.
»Sag ihnen auf Wiedersehen von mir«, fuhr Wes fort, als Will nichts sagte – nichts sagen konnte.
Schließlich atmete Will tief durch. »Ich gehe mit dir«, erwiderte er langsam. »Aber ich gehe nicht von hier fort, ohne erst mit Mama und Daddy zu sprechen. Sie verdienen Besseres von dir, Wes, und das weißt du verdammt genau.« Insgeheim bezweifelte er, dass sie überrascht sein würden, jedenfalls was Wes betraf.
Überall ringsum marschierten Männer und Jungen gleichermaßen in den Krieg davon, und kaum jemand sprach in diesen Tagen über etwas anderes.
Wes schaute fort. Er konnte Wills Blick nicht standhalten. »Ich werde auf dich warten«, sagte er, jetzt wieder völlig stur. »Eine halbe Meile von hier.«
»Nein, verdammt!«, grollte Will. »Wenn du das tust, versohle ich dich hier auf der Straße. Wes, ich schwöre bei Gott, dass ich es tun werde, bevor ich zulasse, dass du ihnen dies antust.«
Es folgte ein Moment des Schweigens, in dem alles in der Schwebe hing. Dann ließ sich Wes erweichen. Er grinste sogar ein wenig. Mit der freien Hand klopfte er Will auf die Schulter.
»Also gut«, sagte er. »Also gut.«
Sie gingen zurück über die vertraute Straße, und beide schwiegen. Will nahm den Anblick der Hügel und Ebenen der Umgebung in sich auf, prägte sich die Laute und Gerüche ein, sodass sie für immer in ihm gespeichert waren und er sich daran erinnern konnte, wenn ihm danach zumute sein würde. Wes pfiff leise ein Liedchen durch die Zähne; er war ungeduldig und wollte so schnell wie möglich weg.
Als sie ihr Elternhaus betraten, stand ihre Mutter am Herd, und ihr Vater saß an seinem üblichen Platz beim Kamin. June briet gerade Spiegeleier. Sie wusste, dass nun schließlich doch der Tag gekommen war, vor dem sie sich gefürchtet hatte, seit der erste Schuss in Fort Sumter gefallen war. Jacob verschränkte mit ernster Miene die Arme und wartete.
»Wir werden heute Morgen gehen«, sagte Wes, als Will sich weigerte, es ihm leichter zu machen und als Erster zu sprechen. »An die Front.«
June tastete nach einem Stuhl und ließ sich aufseufzend darauf niedersinken. Jacob stand auf, durchquerte den Raum und trat vor seine Söhne. Will war fast so groß wie er, Wes hingegen war etwas gedrungener.
»Willst du das wirklich, Will?«, fragte Jacob mit leiser und doch volltönender Stimme.
Will schluckte. »Nein, Sir«, sagte er.
Jacob heftete den Blick seiner dunkelbraunen Augen auf Wesleys Gesicht. »Dann ist alles deine Idee?«
Wesleys Hals und Gesicht röteten sich. »Es ist das Richtige«, antwortete er.
Jacob schüttelte nur den Kopf. Dann bohrte sich sein Blick in Wills Augen. »Dein ganzes Leben lang hast du auf deinen Bruder hier aufgepasst. Ich nehme an, du hältst das für deine Pflicht.«
»Ja, Sir«, sagte Will. Er war den Tränen nahe, und er glaubte, vor Scham zu sterben, wenn er ihnen freien Lauf lassen würde.
Jacob legte ihm eine Hand auf die Schulter. Er sah Wes mit einer Mischung aus Ärger und Kummer an, wandte sich ab und verließ das Haus. Will nahm an, dass sein Vater ein paar Minuten allein sein wollte; das konnte er verstehen.
Unterdessen hatte June ihre Fassung wiedererlangt, doch sie blickte Will an wie jemand, der sich an die Stücke eines unwiederbringlich zerbrochenen Schatzes klammert. Sie legte einen Arm um Wes, drückte ihn lange an sich und ließ schweren Herzens geschehen, dass sich ihr zweitgeborener Zwillingssohn aus ihrer Umarmung löste und flüchtete, überwältigt von seinen Gefühlen.
Will trat zu ihr, und sie legte die Hände auf seine Oberarme, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn leicht auf die Wange. »Dein Daddy hat Recht; du hast immer auf Wes aufgepasst«, sagte sie. Tränen glänzten in ihren Augen, und sie schniefte und versuchte zu lächeln. »Ich mag gar nicht daran denken, wie viel du bis zum Erwachsenwerden wegen deines Bruders durchgemacht hast.«
»Ich werde auf ihn aufpassen, Mama«, versprach er mit belegter, wie erstickt klingender Stimme.
Sie nickte und streichelte leicht mit den Fingerspitzen über seine Wange. »Vergiss nicht, auf dich selbst aufzupassen.«
Er küsste sie auf die Stirn, wollte gehen, doch sie hielt ihn fest und zog ihn wieder zu sich heran.
»Lass nicht zu, dass ihm etwas passiert«, sagte sie.
Will konnte kein Wort herausbringen; er nickt nur. Dann löste er sich von ihr, ein für alle Mal, und ging zur Tür. Er sah seinen Vater, der zu den Baumwollfeldern schritt – kerzengerade, den Kopf hoch erhoben, die langen, kräftigen Arme an den Seiten schwingend. Wes war bereits auf dem Weg zur Straße; seine wütende Miene und seine ungestümen Schritte ließen darauf schließen, dass er und Jacob unter vier Augen gesprochen hatten, während er, Will, sich von ihrer Mutter verabschiedet hatte.
Will beeilte sich, seinen Bruder einzuholen.
1
Springwater, Territorium Montana, Herbst 1882
Die fernen Hügel hoben sich schemenhaft von dem herbstlich satten Rot, Gelb und Braun der Landschaft ab, das tiefe Blau des Himmels rührte etwas in den Tiefen von Olivia Wilcott Darlings Herz an, und die frische Luft war ein Versprechen auf frühen Frost, vielleicht sogar Schnee.
Olivia, die an diesem Oktobermorgen damit beschäftigt war, trockene Äste zu verbrennen, die vor einem Monat von Bäumen, Büschen und Fliedersträuchern in ihrem Garten weggeschnitten worden waren, hielt inne und legte eine Hand auf ihre Stirn. Der scharfe, herbstliche Geruch von Holzrauch weckte in ihr ein sonderbares, jedoch vertrautes Gefühl von fast betrübter Feierlichkeit. Obwohl sie dem Sommer mit seinen Päonien und Lilien und später den Rosen nachtrauerte, war der Herbst immer noch ihre liebste Jahreszeit. Sie liebte seine leuchtenden Farben und die Aussicht auf Kälte. Und in Augenblicken wie diesen – mit dem wohlriechenden und fröhlich prasselnden Feuer in der Nähe, mit ihrem schönen weißen Haus, das solide und imposant im Hintergrund aufragte – fühlte sie sich erwartungsvoll, als würde bald etwas geschehen. Etwas außerhalb des Normalen, etwas Wundervolles.
Eine freundliche Frauenstimme riss sie aus ihren Träumereien. »Olivia? Kommen Sie mit zum Nähkränzchen bei Rachel?«
Sie zwang sich, Savannah Parrish anzulächeln, die mit ihrem Mann und mehreren Kindern auf der anderen Straßenseite wohnte und an den Gartenzaun herangetreten war. Der Zaun war ordentlich gestrichen; sie hatte den jungen Toby McCaffrey im Frühjahr angeheuert, um die Pfosten weiß anstreichen zu lassen, und er hatte seine Sache gut gemacht.
Savannah, eine hübsche Frau mit kupferfarbenem Haar, deren Augen vor Glück glänzten, war mit dem einzigen Arzt der kleinen Stadt verheiratet. Sie hatte Olivia frei heraus erzählt, dass sie einst eine Saloonbesitzerin und Tänzerin gewesen war, was Olivia damals verwundert hatte, denn so etwas hätten die meisten Frauen nicht einmal einer engen Freundin gegenüber zugegeben, geschweige denn einer Bekannten. Jetzt wartete Savannah in einem grauen Mantel und einem kornblumenblauen Wollkleid, den Korb mit Nähutensilien auf einem Arm, auf eine Antwort.
Olivia schüttelte den Kopf, blickt kurz fort und sah sie wieder an. Man konnte nicht behaupten, dass die Frauen von Springwater sie mieden – sie wurde zu jeder Teegesellschaft, allen Wohltätigkeitsveranstaltungen der Kirche und jedem Nähkränzchen eingeladen. Einige Male hatte sie die Einladungen angenommen, sich jedoch inmitten all des fröhlichen Geplappers so fehl am Platze gefühlt, dass es ihr leichtgefallen war, einfach nicht mehr hinzugehen.
»Wir nähen heute die Steppdecke für Cornucopia fertig«, erklärte Savannah lächelnd. »Wer hätte gedacht, dass dieser Trailboss eines Tages in die Stadt reiten, im General Store einen Beutel Tabak von ihr kaufen und um ihre Hand anhalten würde – einfach so?«
Olivia bemühte sich, das Lächeln zu erwidern, doch sie schaffte es einfach nicht. Mit ihren zweiunddreißig Jahren hatte sie den Gedanken an eine Heirat und eine eigene Familie längst aufgegeben – sie war eine alte Jungfer, wie ihre inzwischen verstorbene Tante allzu oft gesagt hatte –, aber das hieß nicht, dass sie sich nicht manchmal danach sehnte. Sie konnte Cornucopia gut leiden, eigentlich mochte sie alle: Mrs. McCaffrey, Mrs. Wainwright, Mrs. Hargreaves, Mrs. Kildare, Mrs. Calloway und natürlich Savannah und all die anderen, doch insgeheim beneidete sie die Ladenbesitzerin um ihr Glück. Es verstärkte nur das, was Tante Eloise stets gesagt hatte: Sie, Olivia, war zu groß, zu unscheinbar, zu mager, zu klug und viel zu streitsüchtig, um einem attraktiven Mann zu gefallen. Sie sollte diese Tatsachen akzeptieren und weiterleben wie bisher. Das Dumme war, dass dies nicht immer leicht war.
»Ich – ich muss mich um dieses Feuer kümmern«, führte Olivia als Vorwand an. »Ich bin ganz rußig, und meine Kleidung riecht nach Rauch – zweifellos mein Haar ebenfalls. Bis ich mich zurechtgemacht und anständig angezogen habe, seid ihr mit dieser Steppdecke bestimmt längst fertig und habt sie als Geschenk verpackt und mit einer Schleife versehen.«
Savannah schüttelte den Kopf, aber ihre Miene blieb freundlich. »Unsinn. Alle werden enttäuscht sein, wenn Sie nicht dabei sind.«
Olivia blickte wieder zum Feuer, das bereits bis auf die Glut herabgebrannt war, und sah dann wieder Savannah an. »Es tut mir leid. Ich bin einfach – zu beschäftigt.«
Savannah schaute sie lange schweigend an. Dann nickte sie und seufzte leicht. »Vielleicht beim nächsten Mal.«
»Vielleicht«, erwiderte Olivia. Sie würde eine andere Ausrede parat haben, wenn ein weiterer gesellschaftlicher Anlass bevorstand, und Savannah wusste dies genau. Sie zögert kurz, nickte noch einmal und machte sich dann eilig auf den Weg zum Haus von Rachel und Trey Hargreaves.
Olivia schaute ihr nach, bis sie um die Ecke der Postkutschenstation von Springwater verschwunden war, und fühlte sich einsamer denn je.
Springwater.
Er zügelte den Rotschimmel, stützte einen Arm aufs Sattelhorn und ließ den Blick durch das Tal, die Quellen und die Ansammlung der Häuser inmitten der weitläufigen Wiesen schweifen. In der kleinen Stadt herrschte reger Betrieb, obwohl die ersten purpurnen Schatten der Abenddämmerung über die Landschaft krochen.
Er seufzte langgezogen. Er sollte kehrtmachen und in unbekannte Gebiete davonreiten. Die ganze Sache hinter sich lassen, ein für alle Mal.
Andererseits würde er im kommenden Frühjahr 37 Jahre alt sein, und er hatte so lange unter falschem Namen gelebt, dass er schon zweimal überlegen musste, bevor er sich erinnerte, wer er in Wirklichkeit war. Verdammt, aber er war es leid, davonzureiten. Er hatte es satt, Lügen zu erzählen, mitten in der Nacht schweißgebadet und mit rasendem Puls aufzuwachen.
Er würde sich vorläufig weiterhin Jack McLaughlin nennen; es war sinnlos, die Leute gleich zu schockieren. Sie waren jetzt alle älter, und der eine oder andere würde nicht mehr der Gesündeste sein. Es war besser, zunächst Distanz zu halten und alles langsam angehen zu lassen. Wenn er erst herausgefunden hatte, wie die Dinge standen, würde er entweder seine Karten aufdecken oder auf sein Pferd steigen und wieder davonreiten.
Die Aussicht auf Letzteres behagte ihm nicht sehr, denn er sehnte sich nach einem Dach über dem Kopf, regelmäßigen, von einer Frau gekochten Mahlzeiten und richtigen Betten mit sauberen Laken. Aber wenn er eines in seinem Leben gelernt hatte, dann die Erkenntnis, dass nur Narren erwarteten, dies auf leichtem Wege zu erreichen.
Er wartete noch einen Augenblick und beobachtete den Rauch, der blaugrau aus den Kaminen dieser kleinen Stadt aufstieg. Dann drückte er dem Rotschimmel leicht die Hacken in die Flanken und gab ihm die Zügel frei. Als sei er begierig darauf, in freundliche Gesellschaft zu geraten, setzte sich der Rotschimmel sofort in Bewegung.
Es war fast dunkel, als er an ihrer Tür auftauchte, dieser hünenhafte, struppige Fremde. Er hielt den Hut in der Hand, und seine blauen Augen hielten ihrem fragenden Blick offen stand.
»Man erzählte mir drüben im Brimstone Saloon, dass man hier ein Zimmer bekommen kann«, sagte er. »Haben Sie eins frei?«
Olivias Haltung straffte sich leicht. Die meisten Reisenden übernachteten in der Springwater Station, wo sie June McCaffreys berühmte Kochkünste genießen konnten. Deshalb wurde sie von der Frage überrascht.
»Ja«, antwortete sie reserviert. Sie konnte es sich nicht leisten, zu kühl zu sein; schließlich hatte sie Tante Eloises gesamtes Vermächtnis für den Kauf dieses Hauses ausgegeben, besaß nur noch ein paar letzte Dollar und brauchte zahlende Gäste. In Wirklichkeit hatte sie überhaupt keine Gäste, weder zahlende noch andere. Dennoch traf sie keine Anstalten, die Verandatür zwischen sich und dem Fremden zu öffnen.
Sein Mund verzog sich nach einer Seite wie zu einem fragenden Grinsen, und Olivia war wie vom Blitz getroffen von seiner Ähnlichkeit mit – mit jemandem. Sie hätte nicht sagen können, wem er ähnelte, aber durch dieses plötzliche Gefühl des Vertrautseins entspannte sie sich ein wenig.
»Es tut mir leid, dass ich Sie behelligt habe, Ma’am«, sagte er und wandte sich ab. Er war groß und kräftig und hatte auffallend breite Schultern. Seine Kleidung – Jeans, ein farbloses Baumwollhemd, abgenutzte Chaps aus Wildleder und ein langer Mantel, wie ihn Revolverschwinger trugen –, hatte ebenso bessere Tage gesehen wie seine abgetragenen Stiefel.
»Warten Sie«, sagte Olivia und biss sich auf die Unterlippe.
Er verharrte und wandte sich um.
»Ich berechne zwei Dollar pro Woche, ohne Mahlzeiten«, erklärte sie und merkte selbst, dass sie zu hastig sprach, aber sie konnte ihren Wortschwall einfach nicht bremsen. »Vier, wenn Sie Frühstück und Abendessen wollen. Ich wasche auch Wäsche, aber die berechne ich stückweise.« Sie legte eine Pause ein und räusperte sich. »Sie werden im Voraus bezahlen müssen. Die zwei Dollar, meine ich.«
Olivia kam es so vor, als lache er; es klang so tief, dass sie es nicht mit Sicherheit sagen konnte. »Fair genug«, sagte er. Er war im Begriff gewesen, den Hut aufzusetzen, aber jetzt hielt er ihn locker in seiner rechten Hand. »Mein Name ist Jack McLaughlin, wenn das wichtig ist.«
Olivia betete stumm, dass er sie nicht in ihrem Bett ermorden würde – oder Schlimmeres –, entriegelte die Verandatür und öffnete sie. »Natürlich ist Ihr Name wichtig. Kommen Sie herein, Mr. McLaughlin«, sagte sie. »Ich werde Ihnen Ihr Zimmer zeigen und das Abendessen auftragen, wenn Sie hungrig sind.«
»Haben Sie einen?«, fragte er, als er in der Halle stand, größer als die hohe Standuhr an der Wand.
Olivia zögerte und hoffte, dass ihre Stimme nicht zitterte und verriet, wie sie sich fühlte: benommen und schwindelig, als sei sie soeben in der Dunkelheit über einen Abgrund gesprungen im Vertrauen darauf, den Sturz in die Tiefe zu überleben. »Ein Zimmer?«, fragte sie verwirrt.
Er lächelte. »Einen Namen.«
Sie hob das Kinn. »Miss Olivia Wilcott Darling«, sagte sie. »Miss Darling wird reichen, wenn Sie wünschen, mich anzusprechen.«
Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Mann rasiert, und sie hatte auch noch nie an so etwas Intimes gedacht, doch wenn sie Mr. McLaughlin nur ansah, stieg in ihr der wilde Wunsch auf, ihre große Schere zu nehmen und all das hellbraune Haar abzuschneiden, diesen schrecklichen Bart, der so viel von seinem Gesicht verbarg.
»Dann also, Miss Darling«, erwiderte er leichthin, immer noch mit dem Hut in der Hand.
Olivia raffte ihre Röcke, gerade hoch genug, damit sich ihre Füße nicht im Saum verfingen, und begann, die breite Treppe hinaufzusteigen. Sie wagte nicht, zu Mr. McLaughlin zurückzublicken, aus Furcht, ihm könnten Hörner und ein Teufelsschwanz wachsen, während ihr Rücken ihm zugewandt war. Sie fragte sich, welcher Dämon sie geritten hatte, als sie dieses Haus unbesehen nach einer Annonce in der Zeitung gekauft und dabei praktisch all ihr Geld bis auf den letzten Penny ausgegeben hatte. Was in aller Welt hatte sie in diese abgelegene und ländliche Umgebung gezogen, in der sie keine Menschenseele gekannt hatte. Sich im Wilden Westen niederzulassen, war der erste impulsive Entschluss gewesen, den sie jemals in ihrem langweiligen und eintönigen Leben gefasst hatte – kaum eine Woche nach Tante Eloises Beerdigung im Familiengrab in Simonsonburg, Ohio.
Wie war sie nur auf den Gedanken gekommen, sie könnte fähig sein, eine Pension zu führen? Angesichts ihres Rufs, ungesellig zu sein, würde sie lange Zeit tot in diesem Haus liegen, bevor irgendjemand sie vermissen würde ...
»Ich mag nicht so aussehen, Ma’am«, sagte McLaughlin einen Schritt hinter ihr, als sie die Treppe hinaufstiegen, »aber ich bin ein Gentleman. Habe niemals in meinem Leben eine Frau angerührt – jedenfalls nicht entgegen ihren Wünschen.«
Er hatte ihre Gedanken gelesen! Olivia wagte nicht, ihm ihr Gesicht zu zeigen, das sicherlich rot geworden war, weil ihr das Blut in den Kopf gestiegen war. »Ich habe keine Angst vor Ihnen oder irgendeinem anderen Mann«, erwiderte sie und mimte in ihre Verzweiflung wieder die Kratzbürste. »Außerdem habe ich einen Revolver im Schrank neben meinem Bett und weiß damit umzugehen.«
Beredtes und vielleicht etwas amüsiertes Schweigen folgte, und Olivia hatte ausreichend Zeit, um zu bedauern, dass sie ihr Bett erwähnt hatte, ganz zu schweigen von der Waffe, die sie bei ihrer Ankunft gekauft und kein einziges Mal abgefeuert hatte.
Sie erreichte das beste der drei Gästezimmer, öffnete die Tür und trat zur Seite.
Mr. McLaughlin blieb einen Moment vor ihr stehen und trat dann ein. Im Zimmer war es dunkel. Und Olivia war gezwungen, hineinzugehen und die Lampe auf dem Tisch anzuzünden. Ihr Schein fiel auf das schlichte eiserne Bett mit seiner Wolldecke – eine der vielen, die sie in den Jahren der Krankheit ihrer Tante Eloise gehäkelt hatte. Im Zimmer stand auch eine Spiegelkommode und ein kleiner Waschständer, aber sonst nichts.
»Das ist ja prima«, erklärte McLaughlin.
Er zog seinen Mantel aus, und Olivia, peinlich berührt von der simplen, aber irgendwie männlichen Geste, spürte, wie sie schneller atmete und sich ihr Gesicht wieder rötete. Seine Anwesenheit schien den Raum zu füllen, sich zu jeder Wand hin auszubreiten, und sie hätte geschworen, dass er mehr als die normale Menge Luft verbrauchte.
Sie blieb nahe bei der Tür stehen, eine Hand auf dem Türknauf. »Ich werde etwas Wasser heraufbringen, damit Sie sich vor dem Abendessen waschen können.«
Er stand mit den Händen auf den Hüften da, und Olivia bemerkte zum ersten Mal, dass er bewaffnet war. Er trug einen Revolver – einen 44er, nahm sie an – in einem Schulterhalfter unter der linken Achsel, also in Reichweite seiner rechten Hand.
»Es gibt einige Hausregeln«, sagte sie und hob das Kinn etwas an.
Mr. McLaughlin fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Das dachte ich mir«, erwiderte er mit einem leichten Lächeln. Er zog den Revolver aus dem Halfter – ihm war nicht entgangen, dass sie auf die Waffe gestarrt hatte – und legte ihn auf die Spiegelkommode; das Schulterhalfter schnallte er nicht ab. »Und das Rauchen ist verboten, wette ich. Das Trinken von Alkohol ebenfalls. Und keine Besucher außer im Erdgeschoss, besonders keine weiblichen. Sonst noch etwas?«
Obwohl er in höflichem, sogar freundlichem Tonfall gesprochen hatte, gaben Mr. McLaughlins Worte Olivia das Gefühl, eine kleinliche alte Jungfer zu sein. Sie ärgerte sich, wusste jedoch nicht genau, ob über ihn oder sich selbst. »Kein Fluchen«, fügte sie hinzu. »Kein Spucken und keinerlei Tiere auf dem Zimmer.«
Olivia sah ihm an, dass er nur mit Mühe ein Lachen unterdrückte; irritiert wandte sie sich ab und verließ fluchtartig wie ein Feigling das Zimmer, hastete über den hinteren Gang und die schmale Stiege hinab, die zur Küche führte. Dort machte sie sich sofort daran, das versprochene Wasser zu erhitzen und das Abendessen zu planen, aber ihre Geschäftigkeit half ihr nicht wie sonst, sich abzulenken. Ihre Gedanken weilten oben bei Mr. McLaughlin. Sie hörte das Hallen seiner Stiefelabsätze auf dem Holzboden, als er das Zimmer durchquerte und vermutlich zum Fenster ging, und sie staunte, welche Wirkung es auf sie hatte.
Wie die meisten Männer, die im Westen allein reisten, hatte ihr neuer Pensionsgast mit Sicherheit eine bewegte Vergangenheit; er war zweifellos auch gefährlich, doch irgendwie anders als ein Gesetzloser oder Trunkenbold oder Gauner. Er hatte nichts Falsches getan, hatte sie von Anfang an freundlich und mit Respekt behandelt – und dennoch war sie besorgt. Er hatte eine sofortige und starke Wirkung auf sie, eine für sie unerklärliche, und ihre Tugend – stets fest um sie wie ein eng geschnürtes Korsett – schien sich plötzlich ... nun, leicht zu lockern.
»Lächerlich«, murmelte sie und legte den Deckel auf den Warmwasserbehälter.
»Wie bitte, Ma’am?«
Sie erschrak fast zu Tode; hatte der Mann die Stiefel ausgezogen und war auf Socken die Treppe heruntergeschlichen? Sie fuhr zu ihm herum, die blaue Schöpfkelle in einer Hand.
Er grinste auf eine Art, die man nur als jungenhaft bezeichnen konnte, doch es war nicht zu leugnen, dass er ein voll ausgewachsener Mann war. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe«, sagte er. »Ich dachte mir, ich erspare Ihnen den Weg mit dem heißen Wasser die Treppe hinauf, das ist alles.«
Sie starrte ihn einen Augenblick stumm an und fragte sich, weshalb sich nur bei seinem Anblick und dem Klang seiner Stimme ihr Puls beschleunigte und ihr das Atmen schwerfiel. »Sie möchten – Sie möchten Abendessen?«
Er nickte. »Bitte.« Dann griff er in die Tasche seiner Arbeitshose – er hatte die Wildleder-Chaps abgelegt –, zog ein glänzendes 20-Dollar-Goldstück hervor und legte es auf den Tisch. »Ich werde einen Monat oder zwei hier sein, nehme ich an.«
Es fehlte nicht viel, und Olivia wäre zum Tisch gestürzt und hätte sich die Münze geschnappt, bevor er sich anders besann und sich entschloss, doch noch in der Springwater Station abzusteigen und die Zimmermiete zurückzuverlangen. Sie wies auf einen Eimer, der an einem Haken hing, und sofort begann er, mit der Schöpfkelle das dampfende Wasser aus dem Behälter zu holen.
Er roch nach Pferd und Mann und frischer Oktoberluft und noch etwas anderem, das nicht ganz zu definieren war, und Olivia war sich der Hitze und Kraft seines Körpers bewusst, obwohl sie gar keinen unmittelbaren Kontakt miteinander hatten.
»Haben Sie einen Beruf, Mr. McLaughlin?«, fragte sie, weil sie einfach etwas sagen musste, um nicht wie eine scheue Braut vor einem nackten Ehemann davonzulaufen.
Er sah sie mit vergnügt funkelnden Augen an, während seine großen, schwieligen Hände noch mit dem Eimer und der Schöpfkelle beschäftigt waren. »Nun, Ma’am, ich hab in meinem Leben viele verschiedene Arbeiten gemacht. Habe beim Eisenbahnbau geholfen. Ein paar Mal als Schmied gearbeitet – ich kann auch ziemlich gut mit Hammer und Säge umgehen. Und wie fast jedermann westlich des Mississippi hab ich schon oft Rinder getrieben.« Er legte eine Pause ein. »Und Sie?«
Olivia wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie wusste nicht einmal, wie sie atmen sollte. Nicht zum ersten Mal wünschte sie sich, ein engeres Verhältnis zu Savannah Parrish und Rachel Hargreaves und den anderen Frauen zu haben. Es wäre tröstlich gewesen, jemanden zu haben – eine verheiratete Frau mit Erfahrung –, die sie wegen der sonderbaren Wirkung hätte befragen können, die dieser Mann auf ihre Nerven und Sinne hatte.
»Ob ich Rinder getrieben habe?«, fragte Olivia.
Er lachte und klappte den Deckel auf den Wasserbehälter, während heißer Wasserdampf aus dem Eimer wie Nebel zwischen ihnen wallte. »Ich meinte: Wie hat es Sie hier nach Springwater verschlagen, ganz allein, als Pensionswirtin?«
»Woher wissen Sie, dass ich allein bin?«, fragte Olivia.
»Das ist ziemlich offensichtlich angesichts der Tatsache, dass Sie eine höllische Angst vor mir hatten, jedoch trotzdem bereit waren, mich unter Ihrem Dach und an Ihrem Tisch zu dulden. Außerdem haben Sie sich als ›Miss‹ Darling vorgestellt, erinnern Sie sich?«
Es war sonderbar und unerklärlich für sie, aber sie wünschte sich, ihm alles über sich zu erzählen. Sie wünschte sich, ihm zu sagen, dass sie einst süße Träume und Hoffnungen gehabt hatte wie jede andere Frau, wollte erklären, wie sie mit 15 zur Waise geworden war und anschließend ihre besten Jahre damit verbracht hatte, sich um eine schrullige Tante zu kümmern. Aber sie konnte ihm doch nicht solche persönlichen Einzelheiten preisgeben.
»Ihre Frage ist ein wenig zu vertraulich, Mr. McLaughlin«, sagte sie.
Er grinste, zuckte mit den breiten Schultern, nahm den Eimer mit warmem Wasser und wandte sich ab, um die Treppe hinaufzusteigen. Warum wirkte er so sehr vertraut auf sie, wenn er zweifellos ein Fremder war?
»Das Abendessen wird in einer Stunde serviert«, rief sie ihm nach.
»Ich werde pünktlich sein«, erwiderte er.
Jack stand vor dem Spiegel der Kommode in Olivia Wilcott Darlings Pensionszimmer und betrachtete sich abschätzend. Er wirkte wie ein alter Kauz, wie ein Tramp, der überall und nirgends lebte. Plötzlich juckte sein Bart, sodass er das Gefühl hatte, sich kratzen zu müssen wie ein Hund. Eine Rasur war sicherlich angebracht.
Nein, dachte er mit einem langgezogenen Seufzen. Es war unvernünftig, jetzt leichtsinnig zu werden. Er durfte nicht erkannt werden, jedenfalls im Augenblick noch nicht.
So wusch er sich am Waschständer mit dem Wasser, das Miss Olivia für ihn erhitzt hatte, und zog sein Ersatzhemd an. Nach dem Abendessen würde er einen Unterstand für seinen Rotschimmel suchen müssen, denn er hatte den armen Gaul vor dem Brimstone Saloon angebunden zurückgelassen; doch zuerst wollte er das seltene und einmalige Vergnügen genießen, mit dieser schönen Frau zu speisen.
Miss Olivia war groß und schlank wie die Weiden, die einst entlang des Baches in seiner Heimat gewachsen waren. Ihr Haar war rötlichbraun wie feines Rosenholz, das mit Bienenwachs poliert war, und beim Anblick ihrer Augen musste er an die Farbe von Sherry denken, den feine Leute tranken, wenn sie Anlass zum Feiern hatten.
Er neigte sich vor, stemmte die Hände auf die Kanten der Kommode und musterte sich im Spiegel.
»Du warst zu lange auf dem Trail«, murmelte er. »Miss Olivia ist eine Lady, und eine Yankee-Lady obendrein. Nicht interessiert an Typen wie dir, Jack McLaughlin.«
Er runzelte die Stirn. Der Name kam ihm plötzlich befremdend vor, verblichen mit der Zeit und abgenutzt; und er hätte ihn am liebsten abgestreift wie eine alte Unterhose, die Schultern gestrafft, den Kopf gehoben und der Wahrheit ins Auge gesehen.
Doch das wagte er nicht, er wusste es. Sein Rückgrat krümmte sich, und seine Schultern sackten herab. Er war ein Feigling, schlicht und einfach ein jämmerlicher Feigling. Sein halbes Leben lang hatte er versucht, vor diesem einen, schrecklichen, nicht wiedergutzumachenden, in Stein gemeißelten Tag zu flüchten; und wahrscheinlich würde er die Flucht fortsetzen, so sinnlos sie auch war.
Er hätte nicht nach Springwater reiten sollen.
Das Beste war, mit Miss Olivia zu Abend zu essen, ihr das Goldstück für ihre Mühen zu überlassen und zu verschwinden, die ganze Nacht über und den nächsten Tag hindurch zu reiten und nie an eine Rückkehr zu denken.
Er hob den Kopf, und diesmal sah er Verachtung in seinen Augen. Verachtung vor sich selbst. »Du reitest nirgendwohin«, sagte er wütend und wandte seinem Spiegelbild den Rücken zu.
Olivia ging mit einer Laterne in der Hand nach draußen, fing eines der Hühner im Stall, drehte ihm den Hals herum und bereitete es für den Suppentopf vor, ein Talent, das sie erst nach ihrer Ankunft in Springwater entwickelt hatte. Bei den ersten paar Malen hatte sie sich fast übergeben müssen, doch jetzt konnte sie ein Beil schwingen, um das tote Huhn zu säubern und danach zu rupfen, wie es jede Farmerin in dieser Gegend tat.
Als Mr. McLaughlin auftauchte, gekämmt, gewaschen und mit einem ziemlich frischen Hemd, kochte der Vogel schon auf dem Herd, das Fenster über der Spüle war mit Dampf beschlagen, und das Haus wurde von köstlichem Duft erfüllt.
»Ich habe Klöße gemacht«, sagte sie und fühlte sich nur etwas weniger nervös als zuvor, »und ich könnte Kaffee kochen. Das heißt, wenn er Sie nicht zu lange wachhält.«
»Ich würde mich freuen, mal anderen Kaffee als meinen eigenen zu trinken«, erwiderte er. Er nahm nicht am Tisch Platz, obwohl dieser gedeckt war. Irgendwann hatte Jack McLaughlin, der Herumtreiber, wenigstens ein bisschen gute Manieren gelernt. Es war ermutigend, das zu wissen. »Vielen Dank.«
Olivia nickte zum Tisch hin. »Nehmen Sie Platz, Mr. McLaughlin. Es macht mir nichts aus, Sie zu bedienen. Dies ist schließlich kein gesellschaftlicher Anlass.«
Er zögerte kurz, zog dann einen der Stühle zurück und setzte sich. »Haben Sie viele Pensionsgäste?«, fragte er, und es klang so zaghaft und verlegen, wie sie sich fühlte.
Sie schüttelte den Kopf. Es war besser, ehrlich zu sein. Sie hatte Mr. McLaughlins 20-Dollar-Goldstück, und sie war nicht bereit, es zurückzugeben, jedenfalls nicht kampflos. »Nicht viele«, sagte sie, hob den Deckel des Kochtopfes und blinzelte gegen einen Schwall Dampf an. »Die meisten Leute übernachten in der Springwater Station.«
Er hob eine Augenbraue und schaute zu, wie sie am Spülbecken Wasser in eine blaue Kaffeekanne aus Emaille pumpte. »So? Wie kommt das?«
Sie stellte die Kanne auf den Herd, nahm ein Glas mit Kaffeebohnen, das sie erst gestern bei Cornucopia im General Store gekauft hatte, und warf Kaffeebohnen in die Kanne. »Mrs. McCaffrey – June – ist eine ausgezeichnete Köchin. Die Leute fühlen sich anscheinend zu ihr hingezogen, und auch zu ihrem Mann.«
Er schwieg so lange, dass es Olivia auffiel, und sie blickte zu ihm. »Mr. McLaughlin?«
Er lächelte, doch es wirkte gezwungen. In Olivia keimte der Verdacht, dass ihr kostbarer Pensionsgast es womöglich bereits bereute, in ihrem Haus ein Zimmer genommen zu haben statt in der Station.
»Muss ziemlich hart sein, sich den Lebensunterhalt auf diese Weise zu verdienen«, sagte er nach langem Schweigen.
Olivia brauchte einen Moment, um zu erkennen, was er meinte: Er bezog sich nicht auf die McCaffreys und ihr blühendes Geschäft, sondern auf ihre eigenen jämmerlichen Bemühungen, sich über Wasser zu halten. Tante Eloise hatte Recht gehabt, dachte sie und seufzte innerlich. Sie hatte nicht die robuste Art, um eine Pension an der Siedlungsgrenze zu betreiben; sie hätte in Ohio bleiben, häkeln und in der Sonntagsschule unterrichten und in würdevoller Armut von ihrer bescheidenen Erbschaft leben sollen.