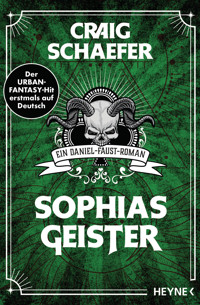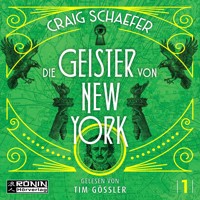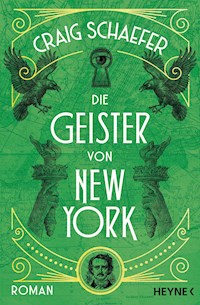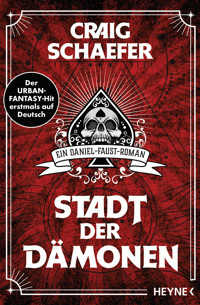
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Daniel-Faust-Reihe
- Sprache: Deutsch
Las Vegas, Stadt der Sünde – und der Dämonen, wie Daniel Faust, Gangster und Magier, nur allzu gut weiß. Als er angeheuert wird, um Rache an den Mördern einer jungen Frau zu nehmen, gerät Daniel ins Netz einer Intrige, in deren Zentrum niemand geringeres als der Prinz der Hölle steht. Jemand, der Faust heißt, sollte eigentlich wissen, was passiert, wenn man sich mit Dämonen einlässt. Doch Caitlin, die rechte Hand des Höllenfürsten, ist klug und verführerisch – und so lässt er sich breitschlagen, einem uralten Artefakt nachzuspüren, für das jeder magisch Begabte in Las Vegas über Leichen gehen würde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Las Vegas, Stadt der Sünde – und Stadt der Dämonen, wie Daniel Faust, Gangster und Magier, nur allzu gut weiß. Als er angeheuert wird, um Rache für den Mord an einer jungen Frau zu nehmen, gerät Daniel ins Netz einer gewaltigen Intrige, in deren Zentrum niemand Geringeres als der Prinz der Hölle steht. Jemand, der Faust heißt, sollte eigentlich wissen, was passiert, wenn man sich mit Dämonen einlässt. Doch Caitlin, die rechte Hand des Höllenfürsten, ist klug und verführerisch – und äußerst überzeugend. Gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach einem uralten Artefakt, das so mächtig ist, dass jeder Zauberer in Las Vegas über Leichen gehen würde …
Die Autorin
Craig Schaefer ist das Pseudonym der Autorin Heather Schaefer. Sie lebt in North Carolina, wo sie sich gerne in Museen, Büchereien, an einsamen Kreuzungen mitten im Nirgendwo und ähnlichen Orten aufhält, wo sich Autor*innen düsterer Fantasy gerne versammeln.
CRAIG SCHAEFER
STADT DER DÄMONEN
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kempen
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:THELONGWAYDOWN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Redaktion: Claudia Fritzsche
Copyright © 2014 by Craig Schaefer
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Prozo, VasiliyArt, lukbar, Chikovnaya, amid999, Paper Wings)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30867-4V001
1
»Ich weiß, was Sie sind«, sagte der alte Mann. Das Zittern in seiner Stimme verriet mir, dass er sich nicht so sicher war. Er hatte sich als Jud vorgestellt, Jud Pankow aus Minnesota. Er war weit weg von zu Hause.
Wir saßen in einer Nische ganz hinten im Tiki Pete’s, einem schäbigen Diner vier Blocks östlich vom Las Vegas Strip. Ich bezweifelte, dass der Laden eine Hygienekontrolle überstehen würde, aber die schmutzigen Fenster und die Nebenstraße hielten die Touristenströme fern. Außerdem war ich nicht wegen des Essens hier.
»Dann wissen Sie, dass ich kein Privatdetektiv bin«, erklärte ich ihm, »zumindest nicht offiziell.«
Er hielt eine kaffeefleckige Aktenmappe in den kräftigen Farmerhänden und kniff die Lippen zusammen. Ich nippte an meinem Mai Tai.
»Er hat mein kleines Mädchen umgebracht, Mr. Faust. Er hat sie ermordet und sie dann wie ein Stück Abfall weggeworfen. Ich brauche keinen Privatschnüffler, um mir das zu sagen.«
»Die Polizei ist anderer Meinung. Möchten Sie, dass ich das Gegenteil beweise?«
»Es ist mir egal, was irgendjemand denkt«, sagte Jud, »und nichts wird mein Baby zurückbringen, ob man etwas beweisen kann oder nicht. Das ist mir klar.«
»Was wollen Sie also von mir?«
Seine wässrigen Augen füllten sich mit einem Schmerz, den ich nicht ermessen konnte. Der Aktenordner knisterte unter seinem Griff, während er flüsterte, gerade laut genug, dass ich ihn verstehen konnte. »Ich will, dass er bestraft wird.«
Ich hätte ihn wegschicken sollen. Ich wusste nicht, warum, aber ich fühlte mich wie in einer Achterbahn, die sich zum ersten Scheitelpunkt hinaufschob, Stück für Stück, nur wenige Herzschläge vom Sturz in den Wahnsinn mit hundert Meilen pro Stunde entfernt. All meine Instinkte schrien mich an, auf diesen Auftrag zu verzichten und zu gehen.
Doch als ich ihn ansah, brachte ich es nicht über mich. Er brauchte irgendeine Hoffnung. Verdammt, er brauchte nur jemanden, dem es nicht scheißegal war.
»Ich werde nichts versprechen«, sagte ich zu ihm und bemerkte, wie sich seine Augen aufhellten.
Er kramte in seiner Hosentasche und drückte mir einen Umschlag in die Hände. Er war vollgestopft mit grünen kleinen Scheinen, zerknittert und verblasst. Dieses Geld kam nicht frisch von der Bank. Es war die Art von Bargeld, das seit Jahren in einer Kaffeedose in einem Küchenschrank steckte und für einen regnerischen Tag aufgespart wurde.
»Damit«, sagte ich und tippte auf den Umschlag, »erkaufen Sie sich ein paar Tage meiner Zeit. Wenn ich glaube, dass ich Ihnen nicht helfen kann, gebe ich es Ihnen zurück, abzüglich meiner Spesen. Also, ist Stacy Ihre …?«
»Enkeltochter. Ihr Vater hat nie eine Rolle gespielt, und ihre Mutter … sie hat ihre eigenen Probleme. Ich glaube, sie hat es nicht einmal gemerkt, als Stacy abgehauen ist. Ich hab so gut wie möglich auf das Mädchen aufgepasst. Hab ihr sogar ein paarmal Geld geschickt, nachdem sie von zu Hause weggegangen war, als ich eine Adresse hatte, an die ich es schicken konnte. Dann hat sie sich mit diesem … diesem Drecksack eingelassen. Sie schrieb mir, dass sie bei ihm eingezogen war, dass er ihr einen Job besorgt hatte, einen gut bezahlten Job …«
Er schob den Aktenordner über den Tisch. Auf dem Stapel darin lag ganz oben ein zerfranster Zeitungsausschnitt, den man aus der Vegas Sun herausgerissen hatte, und die knappe Überschrift erzählte die Geschichte.
»Pornostar in Sturmtunnel ertrunken.«
Ich musste den Artikel nicht lesen. Ich hatte die Story bereits im Fernsehen gesehen. Selbst mitten in der Mojave-Wüste gab es jedes Jahr an ein paar Tagen Regen, und wir hockten hier in einem natürlichen Becken. Unter der Stadt erstreckte sich ein Netzwerk aus Sturmtunneln und Abzugskanälen, die den gelegentlich herabrauschenden Wolkenbruch auffangen und das Wasser von den Straßen fernhalten sollten, was toll für alle war, abgesehen von den Obdachlosen, die sich da unten verkrochen, um der Hitze zu entgehen. Manchmal schafften sie es, rechtzeitig vor dem Regen nach draußen zu stolpern, und manchmal mussten die Wartungsteams ihre Leichen herausfischen.
Als Nächstes folgte ein Autopsiebericht der Gerichtsmedizin von Clark County. Kein Foto, nur ein paar Seiten voll mit medizinischem Jargon, der mir die Tränen in die Augen trieb. Die Todesursache war Ertrinken, also keine Überraschung, aber dann runzelte ich die Stirn, als ich die Bemerkung unmittelbar darunter las.
»Der Todeszeitpunkt ist schwer einzuschätzen, doch angesichts der geringen Anzeichen von Totenstarre sowie der Hautbeschaffenheit der Leiche geht die Gerichtsmedizin von einer Todeszeit irgendwann am 15.3. aus.«
»Das Gewitter war am Siebzehnten«, sagte ich und blätterte zurück, um mich anhand des Datums auf dem Zeitungsausschnitt noch einmal zu vergewissern.
»Richtig«, sagte Jud.
Ich blickte zu ihm auf. »Sie ertrank zwei Tage vor dem Sturm.«
Er nickte.
»Entweder liegt der Mediziner völlig falsch, oder wir haben es hier mit einem Verbrechen zu tun. Warum gehen die Bullen der Sache nicht nach?«
»Ich sollte das eigentlich gar nicht erfahren.« Jud starrte auf seine Hände. »Sie sagten mir, sie können diesen Bericht nur an direkte Verwandte weitergeben. Ein Opa zählt nicht. Auf meinem Weg nach draußen zog ein junger Kerl mich beiseite und drückte mir diese Kopie in die Hand. Sagte, ich soll alles sehr genau lesen. Genau das hab ich gemacht und ein paar Sachen überprüft. Hab herausgefunden, dass dieser Fall Detective Holt zugeteilt worden war, also hab ich ihn angerufen.«
»Was hat er Ihnen gesagt?«
»So ziemlich gar nichts. Nur dass sie dran arbeiten würden, aber er hätte achtzig Fälle auf dem Schreibtisch und bla, bla. Er stellte klar, dass mein kleines Mädchen für ihn weniger wichtig ist als sein Abwasch.«
Unter dem Autopsiebericht lagen ihre Briefe nach Hause. Handschrift auf losen Blättern, die vom Leben in der großen Stadt erzählten. Sie hatte jeden mit »Liebe, Stacy« unterschrieben und den i-Punkt als winziges Herz gezeichnet. Ich schaute mir die Datumsangaben an. Die Briefe waren in immer größeren Abständen gekommen.
»Sie hat nie irgendwelche Probleme erwähnt?«
»Ich wäre sofort losgezogen, um sie zu holen«, sagte er und ballte die verwitterten Hände zu Fäusten, »hätte ich gewusst, was sie wirklich gemacht hat, wozu er sie gezwungen hat.«
»Erzählen Sie mir mehr über diesen Kerl.«
Jud schnaufte. »Artie Kaufman. Nennt sich ›Daddy Warbucks‹, wenn er diesen Dreck filmt. Er hat Stacy zu seinem großen Star gemacht.«
Ich trank von meinem Mai Tai und schüttelte den Kopf.
»Das Problem ist, Mr. Pankow, dass Sie ihm gerade sein Motiv weggenommen haben. Wenn dieser Kerl mit Stacy viel Geld verdient hat, warum sollte er sie dann umbringen?«
»Haben Sie die Filme gesehen, die er macht?«
»Nein«, sagte ich, »vermutlich nicht.«
»Wenn ja, würden Sie sich daran erinnern. Sie sind nicht richtig, Mr. Faust. Die Sachen, die er macht … er selbst ist nicht richtig.«
Ich tippte noch einmal auf den Umschlag und dachte an meine überfällige Miete. Ob Artie Kaufman nun ein Mörder war oder nicht, Jud schien jedenfalls nur einen Herzschlag davon entfernt zu sein, ihn mit einer Waffe in der Hand aufzusuchen. In so etwas wollte ich nicht hineingezogen werden. Aber ich wollte auch nicht, dass dieser alte Mann den Rest seines Lebens im Gefängnis verbrachte, weil er eine Dummheit begangen hatte.
»Ich habe ein paar Grundregeln«, sagte ich und nahm den Umschlag auf. »Bleiben Sie in der Stadt?«
»Hab ein Zimmer in der Value Lodge an der East Tropicana. Zumindest bis Freitag. Kann es mir nicht leisten, länger zu bleiben.«
»Es wäre mir lieber, wenn Sie noch heute Abend nach Hause führen, aber wenn Sie hierbleiben, möchte ich, dass sie sich dann in Ihr Hotelzimmer zurückziehen und absolut gar nichts tun. Sie halten mindestens eine Meile Abstand zu Kaufman. Und wenn ich mir die Sache genauer ansehe und herausfinde, dass seine Hände sauber sind, dann war es das. Geben Sie mir Ihr Wort.«
Jud nickte langsam, und ich fragte mich, wie weit ich darauf vertrauen konnte, dass er sich daran hielt.
»Nächster Punkt.« Ich beugte mich vor und bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Ich werde Stacys Tod untersuchen, aber das ist alles, was ich Ihnen anbiete. Wenn es Mord war und wenn ich die Person finde, die dafür verantwortlich ist, liegt alles, was danach passiert oder nicht passiert, allein in meinem Ermessen. Sie werden sich nicht einmischen. Das geschieht zu Ihrem und zu meinem Schutz. Verstanden?«
Darüber grübelte er einen Moment lang nach. Jud gehörte zu den Leuten, die sich ihre Sätze zurechtlegten, bevor sie sie aussprachen.
»Ich habe von Ihnen gehört. Am Computer. Ich hatte einen Mailwechsel mit einer Dame namens Jenna Rearden. Sie hat mir erzählt, was mit ihrem Ex-Mann passiert ist.«
Jenna. Das erklärte alles. Ich musste ihr sagen, dass sie aufhören sollte, überall meinen Namen fallen zu lassen. Ich hatte einen Auftrag für sie erledigt und damit gut. Normalerweise machte ich mir die Hände nicht so schmutzig, aber der betreffende Ex war nachts immer wieder im Schlafzimmer ihrer sechs Jahre alten Tochter erschienen. Daran hatte ich Anstoß genommen.
»Sie sagte, er sei im Irrenhaus eingesperrt«, sagte Jud und beäugte mich abwartend. »Sie müssen ihm ständig Glückspillen geben, weil er sich sonst die Kehle aus dem Hals schreit. Die Ärzte wissen auch nicht, warum.«
»Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mich mit dem Tod Ihrer Enkelin befassen werde. Darüber hinaus verspreche ich Ihnen nichts.«
Jud musterte mich. »Jenna Rearden denkt, Sie könnten der Teufel sein.«
»Na klar!« Ich trank aus. »Aber Sie dürfen sich glücklich schätzen, dass ich mich nur mit Bargeld bezahlen lasse.« Ich faltete den Umschlag zusammen, steckte ihn ein, stand auf und schüttelte ihm die Hand. Sein Griff war fest, und er hatte Schwielen wie Mondgestein. »Ich werde Sie anrufen«, sagte ich und ging hinaus in die Nachmittagssonne.
Es war nicht schwer zu erkennen, dass Jud Pankow langsam starb. Er hatte den einzigen Menschen verloren, an dem ihm etwas lag, und ich wusste, dass er seine Stunden damit ausfüllte, alles aufzulisten, was er bereute, alles, was er hätte sagen sollen, aber nicht gesagt hatte, und umgekehrt. Das war ein vertrautes Lied, von dem ich jede einzelne Note kannte. Allerdings besaß ich einen Vorteil, den Jud nicht hatte: einen klaren Kopf.
Ich überlegte mir, dass der Ort von Stacys Ende die beste Stelle für einen Anfang war. Ich würde dorthin gehen, wohin die Bullen ganz sicher nicht gingen. In den Untergrund.
2
Mein Zuhause war eine Etagenwohnung im ersten Stock eines Gebäudes ohne Fahrstuhl nicht weit von der Bermuda Road. Es war ein Motel und eine Touristenfalle gewesen, bevor die Zimmer irgendwann in den Sechzigern zu Apartments umgebaut wurden. Ein bemalter Betonkaktus und ein staubiger Parkplatz hießen mich unter dem Schatten einer absterbenden Palme willkommen. Eine blasse Eidechse auf dem Geländer schaute mit trägen Augen zu, wie ich die Treppe hinaufjoggte und den Schlüssel ins Schloss der Tür zu Zimmer 208 fummelte.
Meine Möbel waren überwiegend antiquiert und stammten noch aus den alten Tagen des Motels, aufgehübscht durch Schätze aus sporadischen Haushaltsauflösungen. Doch das Kombinationsschloss in der Tür des Wandschranks war neu. Ich schaltete die Schreibtischlampe ein, ließ die Vorhänge geschlossen und stellte den Zahlencode nach Gefühl ein. Eine Hälfte des Schranks war für Hemden, Krawatten und meinen einzigen anständigen Anzug reserviert. Die andere Hälfte diente geschäftlichen Zwecken.
Bücher mit ausgeblichenen Einbänden drängten sich auf zwei eingebauten Regalen, von Eichmanns Abhandlung über die Alchemie der Renaissance bis zu einer Erstausgabe von Balfous LeCulte des Goules. Die nächsten drei Regalbretter beherbergten ein Durcheinander aus Beuteln, Fläschchen und Kreidestiften – alles, was ein Magier für seine Arbeit brauchte. Ganz oben lag mein Werkzeug, ordentlich in zwei Schuhkartons verstaut.
Ich deckte mich mit ein paar Kleinigkeiten ein und suchte in meiner Kramschublade nach einer funktionierenden Taschenlampe. Ich war gerade dabei, mich in eine alte schwarze Jeans zu zwängen, die ruhig schmutzig werden durfte, als mein Handy klingelte. Ich hielt es mir mit einer Hand ans Ohr, während ich mit der anderen an meinem Hosengürtel zerrte.
»Danny-Boy!«, dröhnte die Stimme am anderen Ende der Leitung, die einer Frau, deren Kreolakzent so dick war, dass man ihn mit einem Messer schneiden konnte. »Wo hast du dich nur versteckt? Alle fragen schon nach dir.«
»Mama Margaux, hey! Mir geht’s gut, hatte nur eine lange Woche. Hab mit einigen Sachen zu tun.«
»Das waren wohl eher zwei Wochen.«
Ich blickte hinüber zu meinem zerwühlten Bett und den drei leeren Flaschen Jack Daniels, die im Mülleimer Staub ansetzten.
»Hm, könnte sein. Hör mal, ich werde bald rausgehen und alle treffen. Mir war in letzter Zeit nur nicht so nach Geselligkeit.«
»Heute Abend«, sagte sie. »Du kommst heute Abend runter in den Garden. Wage es nicht, mir Nein zu sagen, Junge. Ich werde kommen und dich am Ohr rüberzerren. Glaub nicht, ich würde es nicht tun!«
Ich musste lachen. »Also gut, also gut, ich glaube dir. Ich komme später rüber. Jetzt gleich muss ich einen Auftrag erledigen.«
»Hm-hm?« Ich konnte hören, wie ihre Zweifel aus dem Handy tropften. »Ein Auftrag? So nennst du es, wenn du Touristen beim Kartenspielen abzockst?«
»Ein richtiger Auftrag, aber ich glaube, es wird nicht viel dabei rumkommen. Hauptsächlich werde ich versuchen, meinen Klienten davon abzuhalten, einen Kerl zu massakrieren, der vielleicht unschuldig ist. Weißt du irgendwas über die Regenablauftunnel?«
»Ich weiß, dass ich niemals da runtersteigen werde. Voller verrückter Junkies und Schlimmerem.«
»Von den Junkies weiß ich«, sagte ich. »Es ist der ›schlimmere‹ Teil, weswegen ich mir Sorgen mache.«
Plötzlich klang sie zurückhaltend. »Nichts allzu Besonderes, aber ich habe gestern Nacht die Kauri-Muscheln geworfen, nur um zu sehen, woher der Wind weht. Die Loa sagen, dass ein Sturm kommt. Ein schwerer.«
»Meinst du, deine Geister könnten sich vielleicht etwas präziser äußern?«
»Pass du gut auf dich auf«, sagte sie. »Jemand wird eine ganze Menge Ärger bekommen.«
Wenn Mamas Geister sagten, dass Ärger im Anmarsch war, würde ich auf gar keinen Fall daran zweifeln. Wie auch immer, ein Auftrag war ein Auftrag, also konnte ich nur hoffen, dass irgendwelche dunklen Wolken, die am Horizont aufzogen, nicht in meine Richtung unterwegs waren. Ich rief auf meinem Laptop eine Übersichtskarte der Eingänge zu den Sturmtunneln auf und glich sie mit dem Artikel über Stacys Tod ab, um die Stelle zu ermitteln, wo sie am wahrscheinlichsten abgetaucht war. Oder wo ihre Leiche entsorgt wurde.
Ich setzte meine Hoffnung auf einen Wassergraben ein paar Blocks nördlich der Freemont Street. Es war vier Uhr nachmittags, als ich meinen ramponierten alten Ford am Straßenrand parkte und zu einem Stacheldrahtzaun ging. Ich wollte bis zum Einbruch der Dunkelheit wieder von hier weg sein, auch wenn das keine Rolle mehr spielen würde, sobald ich unter der Erde war. Mit dem Zaun hatte ich nicht gerechnet, aber das war kein Problem, weil irgendein abenteuerlustiger Zeitgenosse bereits einen Drahtschneider angesetzt und ein Loch aufgehebelt hatte, das groß genug war, um hindurchzuschlüpfen, genau unter einem eindeutigen »Zutritt verboten«-Schild.
Der Graben verlief etwa fünf Meter tief und hatte recht steile Wände. Der Beton ganz unten war mit Wasserflecken und Müll übersät, eine Brache aus zerdrückten Bierdosen, Plastikfetzen und glitzernden Glasscherben. Ich stieg eine Leiter hinunter und überprüfte zum zwanzigsten Mal meine Taschenlampe. Es war ein altes Modell zum Anstecken. Sie hatte mir noch nie zuvor den Dienst versagt, aber dies wäre ein denkbar ungünstiger Ort, um damit anzufangen.
Hier öffnete sich einer der Sturmtunnel, gute drei Meter breit und genauso hoch. Graffiti in allen möglichen verblassten Farben zierten die Wände des Tunneleingangs. Mehrere Schichten aus Tags, Krakeleien und Symbolen, als wäre es eine Ausgrabungsstätte, die darauf wartete, dass irgendein Archäologe die Farbe millimeterweise abtragen und auf uralte Weisheiten stoßen würde. Die frischesten Tags waren grob, kantig und knallrot. Sie sahen nicht wie moderne Kunst aus, sondern wie Stammeszeichen.
Das Sonnenlicht erlosch nach ein paar Schritten in den Tunnel. Schotter und Glas knirschten unter meinen Füßen. Ich schaltete die Lampe ein und befestigte sie an meiner Hosentasche. Ich verfluchte den schwachen Lichtstrahl, während ich immer tiefer vordrang. Der Tunnel wurde vom Geruch nach Schimmel und abgestandenem Wasser durchflutet. Ich blickte immer wieder zum Eingang zurück, zu dem beruhigenden Fleck von Tageslicht, der sich weiter und weiter zurückzog. Nach ein paar Minuten machte der Tunnel eine scharfe Biegung, und auch dieser letzte Trost entschwand.
Es fühlte sich an, als wäre ich in einer versiegelten Gruft gelandet. Die Betonwände verstärkten meine Schritte, machten daraus Pistolenschüsse. Die Echos tropfenden Wassers umgaben mich. Etwas huschte, ließ einen Stein klackern, und ich drehte den Strahl der Taschenlampe herum. Doch ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf die daumengroßen Kakerlaken, die sich vor dem Licht in Sicherheit brachten.
Es war dunkel. Keine Mitternachtsdunkelheit, nicht einmal zur Mitternacht bei Neumond. Es war stockfinster. Die Art, auf die sich die Augen nicht einstellen können, egal, wie sehr man sich anstrengt. Vielleicht dreißig Meter nach der Biegung teilte sich der Tunnel an einer Kreuzung. Ein schwacher, ferner Schein lockte mich, nach links zu gehen.
Der Schein erwies sich als Lampe hinter einer zusammengeflickten Wand. Winzige Finger aus Licht drangen hindurch und griffen nach mir. Der Strahl meiner Taschenlampe strich über morsche Bretter und einen umgekippten Einkaufswagen. Ich erstickte fast am Gestank nach Schimmel und verfaultem Abfall. Die Lampe stand in einer primitiven Hütte, die aus zusammengeklaubtem Müll erbaut worden war. Als ich mich näherte, glaubte ich, Geflüster und das Klirren von Glas auf Metall zu hören.
Ich blieb wie angewurzelt stehen. Schwer zu sagen, wem ich hier über den Weg laufen würde, aber niemand wohnte in einem Sturmtunnel, weil er ein offenes Wesen hatte und gern neue Leute kennenlernte.
»Ist da jemand?«, rief ich und zuckte zusammen, weil der Tunnel meine Stimme hallend zu mir zurückwarf. »Ich bin gleich wieder weg, ich will keinen Ärger machen.«
Zwei blutunterlaufene Augen lugten durch einen Spalt in der Bretterwand. »Sind Sie von der Polizei?«
»Nein. Ich will nur einem Freund einen Gefallen tun. Kann ich näher kommen? Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen.«
Die Augenlider zogen sich zusammen, und ich hob meine leeren Hände.
»Ja, meinetwegen«, brummte die Stimme. Ich näherte mich langsam, ließ mir Zeit, keine plötzlichen Bewegungen, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, einen möglicherweise geistesgestörten Vagabunden in einer Hütte mehrere Meter unter den Straßen der Stadt zu besuchen. Andererseits war ich schon an unheimlicheren Orten gewesen.
Die Hütte besaß nur zwei Wände, wie ich erkannte, als ich seitlich herumging. Die Rückseite war zwischen einer Wand und dem Beton des Tunnels offen, und der Bewohner hatte drinnen ein kleines Zuhause für sich eingerichtet. Es gab eine Pritsche aus Armeebeständen, einen Tisch mit einer Kochplatte und ein paar durchsichtige Müllsäcke, die mit Kleidung vollgestopft waren. Hier schien es seltsam hell zu sein, mehr Licht, als die winzige Lampe hätte abgeben können, bis ich bemerkte, dass er die Innenwände und die Tunneldecke mit einem Anstrich in der Farbe einer staubigen Eierschale versehen hatte.
»Das ist wegen der Witwen, damit ich sie sehen kann, wenn sie sich an mich anschleichen«, knurrte der Mann. Er war vielleicht Ende dreißig, ein wenig älter als ich, aber seine Augen waren eingefallen, und seine blasse Haut war mit Aknenarben und Runzeln übersät, die ein Jahrzehnt zu früh gekommen waren.
»Wie bitte?«
»Weil Sie so geguckt haben«, sagte er und deutete auf seine Behausung. Mir wurde klar, dass er die Farbe meinte. »Schwarze Witwen. Die Tunnel sind voll von diesen Viechern. Ich habe Netze mit vierzig, fünfzig gesehen, die es sich dort gemütlich gemacht haben und warten. Ein Biss, und man schwillt an wie ein Wasserballon. Die Kakerlaken sind schlimm, aber diese Witwen, Mann, die sind fies.«
Ich widerstand dem Drang, meine Arme und Beine abzuklopfen, da ich mir bereits vorstellte, wie glänzende Spinnen darauf herumkrochen. Stattdessen trat ich einen Schritt vor und streckte ihm meine Hand hin.
»Ich bin Daniel. Leben Sie schon lange hier unten?«
Er ergriff sie mit fester Hand und einem Nicken. »Eric. Bin hier seit … Mann, sechs Jahren? Sieben? Besser als auf den Straßen, sobald man sich dran gewöhnt hat. Niemand schikaniert mich hier unten.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Eric. Ich suche nach jemandem, der vielleicht auch hier unten gelandet ist. Haben Sie dieses Mädchen schon mal gesehen?«
Ich zog den eingerissenen Zeitungsartikel aus der Tasche und zeigte ihn Eric. Man hatte ein Foto vom Abschlussball der Highschool genommen, auf dem Stacy wie ein Mädchen mit einer Zukunft voller Diamanten lächelte.
Eric runzelte die Stirn. »Scheiße, Mann, das waren die Bullen, die das getan haben.« Er schüttelte den Kopf.
»Die was getan haben? Die gekommen sind und ihre Leiche rausgefischt haben?«
»Nein«, sagte er. »Die Bullen haben sie nach hier unten gebracht.«
Plötzlich erinnerte ich mich an das ungute Gefühl, das ich hatte, als ich Jud am Tisch gegenübergesessen hatte. Die Achterbahn bewegte sich ein weiteres Stück auf den unvermeidlichen Absturz zu.
»Das war ein paar Tage vor dem letzten Regen«, sagte er. »Sie kamen mit dem armen Mädchen in einem Leichensack herunter. Haben sie etwa hundert Meter weit in Tunnel C abgeladen, neben dem Wasserzulauf.«
»Woher wissen Sie, dass es Bullen waren?«, fragte ich.
»Ich und ein paar der anderen Jungs hier unten haben sie bedrängt. Wir wollten wissen, was zum Teufel sie hier machten. Einer der Bullen hat mir seine Dienstmarke unter die Nase gehalten. Der Kerl war ein Detective, kein Scherz. Sagte, dass wir uns verpissen sollten, und zeigte uns die Waffe an seinem Gürtel. Also sind wir abgezogen.«
»War sie wirklich echt?« Ich wünschte mir verzweifelt, dass er sich irrte. »Dienstmarken kann man kaufen …«
Eric schüttelte den Kopf und sah mich mit einem traurigen Lächeln an. »Das war mein Job, bevor ich mir eine schlechte Gewohnheit zulegte und hier unten landete. Ich kenne Dienstmarken. Es waren echte Bullen. Magerer Kerl mit einem Gesicht wie eine Axt und ein Bodybuilder mit blonder Dauerwelle. Es war Axtgesicht, dem es Spaß machte, mit seiner Waffe herumzufuchteln.«
»Haben Sie irgendwem davon erzählt?«
»Mann, wem soll ich was erzählen?« Er scharrte mit einem Turnschuh über den feuchten Beton. »Glauben Sie, irgendwer will hören, was wir zu sagen haben? Sie würden einfach sagen, dass ich sie getötet habe, oder vielleicht bringen diese Bullen mich für immer zum Schweigen. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich fühle mich lieber schlecht als tot.«
Ich nickte. »Sie haben nichts zurückgelassen, oder? Ich meine, abgesehen von dem Mädchen.«
»Nein, und wenn, dann wäre es fünf Sekunden nachdem sie gegangen waren, eingesammelt worden. Verdammt, ich und mein Kumpel Amos haben uns abgewechselt und an der Leiche der Kleinen Wache gehalten, bis der Regen kam, um sicherzugehen, dass niemand an ihr rummacht. Das wäre nicht richtig, wissen Sie? Es wäre einfach nicht richtig. Sie können sich im Tunnel C umsehen, wenn Ihnen danach ist, aber ich würde es nicht tun, wenn ich Sie wäre.«
»Warum? Wegen der Schwarzen Witwen?«
Erics Gesicht nahm einen nervösen Ausdruck an, sein Blick huschte in die Dunkelheit hinter meinem Rücken. Er schüttelte den Kopf und senkte die Stimme.
»Nein, Mann. Dieses Mädchen? Sie ist immer noch hier unten. Und sie ist darüber gar nicht glücklich.«
3
Ich hatte keine Ahnung, durch welche Gewohnheit Eric so tief abgestürzt war. In Vegas kann sich jeder sein Gift aussuchen: Schnaps, Glücksspiel, Sex, Meth. Alles ist vorhanden und wartet auf einen, vierundzwanzig Stunden am Tag. Allerdings wirkte er nicht wie ein Junkie, und das ungute Gefühl in meiner Magengrube verriet mir, dass er mir auch keinen von Alkohol erzeugten Fiebertraum anvertraute.
»So etwas wie Geister gibt es nicht«, sagte ich in unbeschwertem Tonfall.
Er verzog die spröden Lippen zu einem Grinsen. »Sie kennen so was. Sie wissen Bescheid. Spielen Sie mir nichts vor. Sie haben diesen Blick.«
»Könnte sein. Hat sonst noch jemand diesen Vielleicht-Geist gesehen?«
»Mein Kumpel Amos«, sagte er. »Aber er lebt nicht mehr hier unten. Er ging nach oben, meinte, auf der Straße verprügelt zu werden, sei besser als eine weitere Nacht in Tunnel C. Auch einige andere Leute sind ein paar Tage später abgezogen. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen.«
»Aber Sie nicht? Haben Sie keine Angst?«
Eric wedelte mit der Hand. »Sie bleibt da drüben, ich bleibe hier. Wir kommen uns nicht in die Quere. Und wenn sie näher kommt, weiß man es. Da ist dieser Geruch. Gibt einem genug Zeit zum Wegrennen.«
»Was für ein Geruch?«
»Sie werden es wissen, wenn Sie darauf stoßen. Im Ernst, Mann, Sie wollen da nicht runtergehen.«
Ich steckte eine Hand in die Tasche und schloss die Finger um eine Fünf-Dollar-Note, während ich so tat, als würde ich mit der anderen meine Lampe zurechtrücken. Ich faltete den Geldschein in der Hand auf und bot ihn ihm an.
»Schon gut«, sagte ich zu ihm. »Ich bin Magier.«
Eric kicherte und nahm den Schein mit einem Nicken an. »Sie könnten einen Kartentrick für sie machen, aber ich glaube nicht, dass das helfen würde.«
»Sie wären überrascht. Ich habe ein paar richtig gute Kartentricks drauf.«
Eric schaute mir nach, als ich ging. Auf dem Weg durch den Tunnel verblasste der Schein seiner Lampe hinter mir, und ein Gefühl des entspannten Selbstvertrauens überkam mich. Schwarze Witwen waren eine Sache, aber Geister? Mit Geistern kam ich klar.
Der typische Geist ist nur eine psychische Prägung. Er ist die Nachwirkung eines Traumas, einer Verzweiflung, einer so starken Emotion, dass sie nicht mit der Person stirbt, die sie erlebt hat. Unheimlich, aber etwa so gefährlich wie ein Filmstreifen. Falls der Mord an Stacy einen bleibenden Eindruck hervorrief, könnte ich vielleicht etwas daraus lernen. Und wenn nicht, konnte ich ihn zumindest bannen und Eric und seinen Kumpels einen Gefallen tun. Sie hatten schon genügend eigene Geister, mit denen sie herumkämpften.
Müllfetzen übersäten den Tunnelboden. Der Strahl meiner Lampe zuckte über einen zerbrochenen Hockeyschläger, ein paar Plastiktüten, einen Einkaufswagen, der auf der Seite lag und an dem sich ein Rad langsam in einem kaum spürbaren Luftzug drehte. Ich blickte wieder zur Mitte des Tunnels und erstarrte.
Auf dem Boden lag eine schwarze Plastikkugel, die nicht wie weggeworfen wirkte, sondern eher so, als wäre sie bewusst dort deponiert worden, wie eine Requisite in einem abgebrochenen Spiel. Ich hockte mich hin, um sie aufzuheben, und erkannte schließlich, dass es eine dieser Spielzeugkugeln war, ein Magic 8 Ball. Aus einer Laune heraus schüttelte ich sie.
»Ist hier unten jemand?«, fragte ich und drehte sie dann herum. Durch ein zerkratztes Plastikfenster begrüßten mich die Worte »Antwort unklar, frag später noch einmal«. Ich lachte leise und wollte das Ding wieder hinlegen.
Dann ruckte die Kugel in meiner Hand, und die Antwort wechselte zu »Ja«.
Sie fiel mir aus den Fingern, knallte auf den Beton und sprang in die Dunkelheit davon. Ich zog ein Kartendeck aus der Tasche und mischte es langsam überhändig, während ich tiefer in den Tunnel hineinging. Die geschmeidig durch meine Finger gleitenden Karten halfen mir, mich zu konzentrieren.
»Also gut«, sagte ich zu den Schatten, »wir können es auf diese Weise machen.«
Die unterirdische Luft hatte sich feucht und kühl angefühlt, wie ein Tag im Spätherbst. Nun wehte der Winter herein. Eine kalte Brise strich über mein Rückgrat und verwandelte meinen Atem in Raureif, kurz bevor mich der Geruch erreichte. Der heftige Gestank nach Abwasser quoll empor, als hätte jemand eine Kloake unter meinen Füßen geöffnet. Mein Magen drehte sich um, und ich konnte kaum noch atmen, während ich die oberste Karte meines Decks umdrehte. Die Pik-Dame. Ich mischte sie wieder hinein.
Der Lichtstrahl huschte über eine Nische in der Tunnelwand. Strähniges blondes Haar, eine nackte Schulter, blutleere Lippen. Mit einem geflüsterten Krächzen trat Stacy heraus, um mich zu begrüßen.
Aber nicht alles von ihr.
Jud Pankows ermordete Enkelin schwebte im Strahl meiner Taschenlampe, in ihrem Gang war ein ruckhaftes Humpeln, und sie starrte mich mit irren Augen in der Farbe von Silberdollars an. Ein Arm fehlte ihr. Und ein halbes Bein. Und ein ovales Stück ihres Bauches. Es sah aus, als wäre es mit einer Präzisionssäge entfernt worden. Kein Blut war zu sehen, nicht einmal die Andeutung einer Wunde. Ihr Körper hörte einfach an diesen Stellen auf, als wären Teile von ihr wegretuschiert worden.
Ich wusste, dass sie mich nicht wirklich verletzen konnte, dass dies nichts anderes als die Erinnerung an Stacys Schmerz war, der Gestalt und Leben angenommen hatte, aber dennoch fühlte sich mein Mund wie ausgetrocknet an. Ich versuchte, mich an die Worte eines alten Volkszaubers aus Louisiana zu erinnern, den ich schon einmal benutzt hatte, um ein Gespenst zur Ruhe zu bringen.
Stacy riss den Mund auf, ihr Unterkiefer erzitterte, und Wasser lief ihr in Rinnsalen über das Kinn, bis es auf den Betonboden klatschte. Dann schrie sie und machte mir klar, wie wenig ich wirklich über Geister wusste.
Ihr Kreischen fühlte sich an wie Rasierklingen, die meine Trommelfelle aufschlitzten, getragen von einem Wind aus purer Qual. Ich taumelte zurück, wankte unter einem Schwall aus Grauen, das in scharfe Form gepresst wurde. Finger der Verzweiflung und bitteren Enttäuschung krallten sich in meinen Geist, versuchten, mich mit ihrem Schmerz zu infizieren, mich damit zu verschlingen.
Ich reagierte instinktiv. Ich strich mit meiner freien Hand über das Deck, der Karo-Bube sprang an meine Fingerspitzen, und ich warf ihn zu ihr. Die Karte traf das Stacy-Wesen an der Schulter und flog durch sie hindurch, wobei er in einem Blitz aus grellem violettem Licht pulsierte. Die Erscheinung schlug um sich, ihr Schreien brach ab, und ich fing den Buben auf, als er zu meinen Händen zurückwirbelte.
Wie ich zu Eric gesagt hatte, kannte ich ein paar gute Kartentricks. Aber nicht gut genug für das hier. Ich kam mir vor wie ein Boxer, der einige Runden mit einem Weltergewicht erwartete und auf einmal vor Mike Tyson stand. Ich musste herausfinden, was zum Teufel das für ein Wesen war, und mir etwas einfallen lassen, wie ich es unschädlich machen konnte, bevor es jemanden verletzte, doch das alles konnte ich nicht tun, solange es versuchte, mich zu töten.
Ich zog eine weitere Karte, zeichnete mit dem Daumen das Siegel des Saturn über das Gesicht des Wesens und warf sie in die Luft. Sie hing da wie an einem unsichtbaren Faden, eine winzige Pappbarriere zwischen mir und dem Stacy-Wesen. Das Gespenst bäumte sich auf und ließ einen weiteren Schrei los, aber er berührte mich nicht. Ich sah nur, wie die Karte in der Luft vibrierte und den tödlichen Strom absorbierte.
Dann entzündete sich die Karte.
Ich rannte und hatte es fast bis zum Tunneleingang geschafft, als ein dritter Schrei mich von hinten traf. Meine Hände erschlafften und ließen die Karten fallen, sie lagen nutzlos und inaktiv um meine Füße verstreut. Mein Magen verkrampfte sich. Ich fiel auf ein Knie und erbrach einen Schwall aus brackigem Wasser, während verschwommene schwarze Punkte mein Sichtfeld überschwemmten. Ich ertrank in umgekehrter Abfolge, die Flut raubte mir die Luft, meine Hände tasteten verzweifelt über den Tunnelboden. Halb blind und mit dem Rauschen meines Blutes in den Ohren schloss ich die Finger um eine Karte, erfüllte sie mit dem letzten Funken meiner Macht und warf sie in die Luft.
Der Strom wurde gestoppt. Ich hustete Wasser aus und zwang mich wieder auf die Beine. Die neue Schildkarte vibrierte bereits, ihre Macht löste sich Sekunde um Sekunde auf. Ich taumelte zur Tunnelwand, zog einen Lederbeutel aus meiner Hüfttasche und riss ihn auf, wobei er mir fast aus den zitternden Fingern gefallen wäre. Ich schüttete das Pulver in einer schmalen Spur auf den Boden, unregelmäßig, aber ununterbrochen, von einer Seite des Tunnels zur anderen. Ich war gerade damit fertig, als die Karte in Flammen aufging.
Das Gespenst tauchte aus der Dunkelheit auf und erstarrte. Es schwankte in der Luft, strahlte Verwirrtheit aus, dann zog es sich in die Schatten zurück.
Ich beugte mich vornüber und stützte die Hände auf den Knien ab, bis ich wieder atmen konnte. Der Strahl meiner Taschenlampe folgte der Pulverlinie, sodass ich sie mit dem restlichen Inhalt des Beutels ausbessern konnte, nur um ganz sicherzugehen. Das Pulver war Mama Margaux’ persönliches Rezept. Ich wusste, dass es hauptsächlich aus rotem Ziegelsteinstaub und gereinigtem Salz bestand, aber sie hütete das Geheimnis der restlichen Inhaltsstoffe der Mixtur, als wäre es das streng geheime Coca-Cola-Rezept. Ich wusste nur, dass alles, was nicht aus Fleisch und Knochen bestand, instinktiv von diesem Zeug zurückgestoßen wurde. Solange die Linie nicht unterbrochen war, würde sich das Stacy-Wesen vom Tunneleingang fernhalten.
Ich taumelte durch den Tunnel zurück, klatschnass und voller Schmerzen, und mein Magen war ein einziger Knoten. Erics Gelächter begrüßte mich, als ich seine Hütte erreichte.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie da nicht reingehen wollen.«
»Dieser Tunnel«, keuchte ich. »Was ist auf der anderen Seite? Wohin führt er?«
»Nicht weit. Etwa zwei Blocks östlich gibt es einen Abzugskanal, aber er ist mit einem Gitter mit Vorhängeschloss versperrt. Da kommt niemand rein oder raus.«
Ich nickte. »Gut. Ich werde bald zurück sein. Bis dahin halten Sie sich von dort fern. Lassen Sie auch nicht zu, dass irgendwer sich hineinwagt.«
»Das müssen Sie mir nicht zweimal erklären. Wie gesagt, ich bin jetzt schon seit sieben Jahren hier unten. Hab gelernt, dass es immer am besten ist, sich weit zu entfernen, wenn man gruselige Scheiße sieht.«
Ich konnte ihn noch eine Weile kichern hören, als ich fortging. Touristen!
Ich trat aus dem Tunnel in eine warme Vegas-Nacht. Der sternenlose schwarze Himmel schimmerte im elektrischen Widerschein. Ein gleißender Lichtstrahl vom Strip feuerte senkrecht in die Ferne, zerschnitt die Luft wie ein Stilett aus Neon. Ich fuhr nach Hause, zog mir die nasse Kleidung aus und sprang unter die Dusche, wo ich das Wasser knapp unter brühheiß aufdrehte, während ich mir die Haut wund schrubbte.
Stacy war ermordet worden, daran gab es für mich keinen Zweifel, und ihre Leiche wurde kurz vor einem Gewitter entsorgt, das vor einer Woche von der Wettervorhersage angekündigt worden war. Es wäre die perfekte Vertuschung gewesen, wäre der Sturm nicht ein wenig zu spät gekommen oder hätte die Gerichtsmedizin weniger gründlich gearbeitet. Wer hätte etwas davon, einen Pornostar zu ermorden, und warum waren ein paar Polizisten daran beteiligt? Korruption war eine Sache, vielleicht eine kleine Bestechung oder ein Wegschauen bei einem geringfügigen Verstoß, aber die Entsorgung von Leichen stand auf einem ganz anderen Level von schlechten Neuigkeiten.
Mein viel dringlicheres Problem war die Frage, was zum Teufel aus Stacy geworden war. Das Wesen in der Kanalisation war kein harmloser Spuk, und ich hatte noch nie etwas in dieser Art erlebt. Ich brauchte ein wenig Hilfe, um das Rätsel zu lösen. Zum Glück wusste ich genau, wohin ich dazu gehen musste.
4
Jede größere Stadt hat ihr eigenes Refugium für den okkulten Untergrund, einen Ort, wo sich unseresgleichen trifft und fern von neugierigen Augen über die jeweiligen Laster austauscht. Es gibt die Dashwood Abbey in New York, den Salon Rouge in New Orleans und den Bast Club in Chicago. In Las Vegas haben wir den Tiger’s Garden. Hier gibt es weder Gebühren noch einen geheimen Händedruck, und die Mitgliedschaft basiert auf einem ganz einfachen Test: Der Garden muss einen hereinlassen wollen.
Geschrubbt und umgekleidet und mit einem frischen Kartendeck in der Tasche, machte ich mich auf den Weg zur Fremont Street. Die Fußgängerzone erstrahlte unter einem Baldachin aus grellen Lichtern. Kameras blitzten, und betrunkene Touristen tummelten sich zwischen Open-Air-Bars, die mit Margaritas für einen Dollar warben, während sich Straßenmusiker und plärrende Lautsprecher in einer rasenden Kakofonie überlagerten. Liedfetzen gingen ineinander über und wurden vom Gesprächslärm und fernen Motorengeräuschen übertönt. Ein Straßenkünstler mit silbern bemaltem Gesicht erregte meine Aufmerksamkeit, weil er mit Keulen jonglierte, an denen LED-Streifen befestigt waren, sodass er wirbelnde Farben in die Luft zeichnete. Neben mir kam eine Straßenratte mit dem Kopfwackeln eines Meth-Junkies näher und hatte die Augen fest auf meine Hüfttasche gerichtet. Ich bedachte ihn mit einem Blick, der Glas hätte schneiden können, worauf er sich jemand anderen suchte, dem er sich zuwenden konnte.
Die Luft roch nach billigen Zigarren und verschüttetem Bier. Ich nahm einen tiefen Atemzug, ließ mich von der Musik und der Unruhe treiben, bewegte mich im Tempo der aufgewühlten Menge. Ich wurde eins mit dem Verkehr, mit der Straße selbst, gab mich dem Chaos hin.
Einen Herzschlag später stand ich in dem schmalen Vorraum auf einer abgewetzten Gummifußmatte, die Leute und die blinkenden Lichter hinter mir zurücklassend wie ein Pflaster, das man von einer Wunde reißt. Türglocken bimmelten leise hinter mir. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich hier hereingekommen war.
So ist es mit dem Tiger’s Garden. Wenn man danach sucht, wird man ihn nie finden. Man könnte jeden Zentimeter der Straße nachmessen, sämtliche Ecken und Winkel, und er wäre einfach nicht da. Doch wenn man seinen Geist leert und mit dem Strom schwimmt und wenn man hierhergehört – und wenn der Garden einen haben will –, wird man den Weg nach drinnen finden.
Ich lief über den fadenscheinigen, mit Zigarettenbrandlöchern übersäten orangefarbenen Teppich an der Garderobe und der Einrichtung vorbei, die schon in den Siebzigern aus der Mode gekommen war. Ein paar Fenster in den gischtgrünen Wänden waren mit schweren Holzgittern verschlossen. Niemand hatte diese Fenster jemals offen gesehen, und niemand wollte das Schicksal herausfordern und hindurchlugen. Ich atmete ein, genoss den Duft frischer indischer Gerichte. In der Luft wimmelte es von Gewürzen und Geheimnissen.
»Also«, erklärte eine raue Stimme hinter der nächsten Ecke, »ich sage ja nicht, dass die Loa objektiv nicht real wären …«
»Aber genau das hast du gesagt«, gab eine verdrossene Mama Margaux zurück. »Mit deinen eigenen Worten, Junge.«
Ich wusste genau, was ich zu sehen bekommen würde, wenn ich um die Ecke bog. Margaux, die an ihrem gewohnten Tisch in einem geblümten Zeltkleid Hof hielt und sich an einem Rumpunsch festklammerte, während sie sich mit Corman zankte. Corman war Ende sechzig und hatte den Körperbau eines Preisboxers im Ruhestand. Er trug einen zerknitterten Smoking mit offener Fliege, die er sich um den Hals drapiert hatte. Bentley saß neben ihm, silberhaarig und in einen Beerdigungsanzug gekleidet, spindeldürr im Vergleich zu Cormans Stämmigkeit. Auf dem Tisch zwischen den dreien standen leere Gläser, die für mehrere Abende mit schwerem Besäufnis gereicht hätten.
Corman schnaubte und gestikulierte mit seinem Whiskyglas zu Margaux. »›Junge?‹ Mein Haar wurde schon weiß, als dein Vater noch eine Machete für Papa Doc geschwungen hat.«
»Das nimmst du zurück! Das nimmst du sofort zurück!«
Bentley warf mir einen hilflosen Blick zu, da er unklugerweise beschlossen hatte, sich zwischen die beiden zu setzen. Ich räusperte mich und ging hinüber, zog mir einen Stuhl von einem anderen Tisch herüber. Im Moment hatten wir vier den Garden für uns allein, auch wenn es hier eigentlich nie eine Warteschlange gab.
»Mama Margaux.« Ich ließ mich auf den Stuhl fallen. »Du weißt, dass Corman ein Zeremonialist ist, also musst du ihm die Verwendung von Fachbegriffen zugestehen. Corman, du weißt, dass wir an diesem Tisch nicht über apa-Pe ock-De sprechen. Bentley, wie ich sehe, warst du beim Friseur. Sieht richtig schick aus.«
Mein Ablenkungsmanöver bewirkte, dass ihr Gezänk aufhörte, aber leider auch, dass sich nun alle Waffen auf mich richteten. Drei Stimmen im Ton unterschiedlich starker Verärgerung wollten gleichzeitig wissen, wo ich gewesen war und warum ich keine Anrufe beantwortete. Ich hob die offenen Hände und versuchte, ebenfalls zu Wort zu kommen.
»Dieses Flittchen hat ihn sitzen lassen«, erklärte Mama Margaux an meiner Stelle, obwohl ich nicht ganz dieselben Worte benutzt hätte.
»Ach du meine Güte! Roxy? Sie war ein süßes Mädchen«, sagte Bentley und schüttelte den Kopf.
»Ja, das war sie.« Ich blickte über die Schulter und starrte genau auf die Knöpfe einer weißen Kochjacke. Amar, der einzige Angestellte des Garden, hatte sich völlig lautlos von hinten an mich herangeschlichen. Er balancierte ein Tablett mit Messingrand auf einer Hand und servierte geschickt eine weitere Getränkerunde, einschließlich der Cola mit Rum, um die ich gerade hatte bitten wollen.
»Danke, Amar.« Ich betrachtete blinzelnd das Glas. »Könnten wir dazu vielleicht …«
»Etwas Naan bekommen«, antwortete er und neigte seinen Kopf mit dem Turban. »Selbstverständlich.« Er huschte zurück in die Küche.
Wir waren uns nicht sicher, ob Amar nur für den Garden arbeitete oder ob er der Eigentümer war, und er war berüchtigt für seine Zugeknöpftheit bei allen Themen, die nicht die Speisekarte betrafen. Dennoch war der Service unübertrefflich.
»Süß wird überbewertet«, sagte Corman, und Bentley warf ihm einen Seitenblick zu. Abgesehen von seiner Schroffheit, musste er irgendwas richtig gemacht haben. Bentley und Corman waren schon seit vierzig Jahren zusammen und verhielten sich trotzdem wie Frischvermählte, wenn sie glaubten, dass niemand zuschaute.
Ich kippte einen großen Schluck aus meinem Glas hinunter und genoss es, wie sich die Wärme in meiner Brust ausbreitete. Die perfekte Mischung, wie immer. »Ich will nicht über Roxy reden«, sagte ich. Das stimmte zwar nicht, aber zwei Wochen mit Herzschmerz und einem Telefon, das nicht klingelte, hatten mir eine bittere Wahrheit in den Dickschädel gehämmert: dass sie nicht mehr zurückkommen würde. »Ich habe einen Auftrag. Lasst uns stattdessen darüber reden.«
»Daniel?« Bentley zog eine dünne Augenbraue hoch und hielt sein Glas Gin in der Hand. Ich brauchte keinen Dolmetscher, um die Besorgnis in seinem Tonfall zu hören. Bentley und Corman waren für mich fast so etwas wie richtige Väter. Über die Leute, die mich aufgezogen hatten, sprach ich nicht; die Zigarettenbrandmale auf meinem Rücken sagten eigentlich alles.
»Ein anständiger Auftrag. Größtenteils anständig.«
Ich umriss die Geschichte in groben Zügen, dann ging ich tiefer ins Detail, als ich zu meiner Begegnung im Sturmtunnel mit dem Wesen kam, das früher einmal Stacy Pankow gewesen war.
»Die Vorfahren können eine Menge Ärger machen«, sinnierte Mama Margaux, »aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Bist du dir sicher, dass es das Mädchen war und nicht ein anderer Geist, der vorgibt, sie zu sein? Da unten im Dunkeln könnte alles Mögliche schwären.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Daran habe ich auch schon gedacht, aber welchen Sinn hätte das? Warum sollte etwas, das imstande ist, einen solchen Schaden anzurichten, beschließen, als beliebiger Geist zu posieren und in einem stillgelegten Tunnel auf der Lauer zu liegen?«
»Die fehlenden Körperteile.« Bentley beugte sich vor. »Dieses Detail verlangt Aufmerksamkeit. Gespenster spiegeln ihre Erschaffer zum Zeitpunkt des Todes, aber in den Zeitungen stand nichts davon, dass ihr Körper tatsächlich verstümmelt wurde.«
»Nein, auch der Kerl, der dort unten lebt, der gesehen hat, wie die Leiche entsorgt wurde, hat nichts davon gesagt. Ich glaube, sonst hätte er es erwähnt.«
»Ich habe mal eine Geschichte gehört«, sagte Corman mit ernster Miene. »Damals, als ich professioneller Wahrsager war, in den Sechzigern. Ist angeblich dem Freund eines Freundes passiert.« Corman wirkte verängstigt, und das war etwas, das ich nicht oft zu sehen bekam. Bentley nickte und berührte leicht sein Handgelenk, damit er weitersprach.
»Wie es heißt, hatte dieser Kerl die falschen Leute verärgert, weshalb sie eine kleine Überraschung für ihn vorbereiteten. Astralreisen waren seine Spezialität, so wie auch meine. Sich in Trance versetzen und die Seele zum Herumspionieren losschicken. Nun, eines Nachts warteten ein paar entkörperlichte Zauberer und belegten ihn mit irgendeinem tibetischen Fluch. Das riss seine Seele in Stücke. Der Kerl starb auf der Stelle, Herzstillstand.
Das war’s dann – einen Monat lang. Seine Frau fand den Geist seines Arms in ihrem Bett. Nur seinen Arm, und er hätte fast das Leben aus ihr herausgewürgt. Sein Kopf tauchte im Schrank meines Kumpels auf. Er beobachtete ihn des Nachts durch einen winzigen Spalt mit diesem wahnsinnigen Hass in den Augen. Dann löste er sich einfach in Luft auf. Am nächsten Morgen fand er den Familienhund ausgeweidet auf dem Boden liegen, und alle Lebensmittel im Haus waren über Nacht vergammelt.«
Amar kehrte gerade lange genug aus der Küche zurück, um uns zwei Körbe mit frisch gebackenem Fladenbrot, einen Teller mit cremigem Hühnchencurry und eine weitere Getränkerunde zu bringen. Wir alle rissen Stücke von dem fluffigen Brot ab und tunkten es in die Soße.
»Sie kamen darauf«, sagte Corman, »dass er gar nicht wirklich gestorben war. Seine Seele war zerbrochen, aber etwas hielt ihn davon ab, weiterzuziehen. Sein Geist war disloziert. In Raum und Zeit fragmentiert. Der Schmerz muss … unvorstellbar gewesen sein.«
»Das erklärt, warum er Menschen angriff, die ihm etwas bedeuteten«, sagte ich und dachte an Stacys rasenden Zorn. »Wie ein Fuchs, dessen Bein in einer Bärenfalle gefangen ist. Er versteht nicht, dass man ihn befreien will, er wird trotzdem in jede Hand beißen, die sich ihm nähert. Wie haben sie ihn also in Ordnung gebracht?«
»Gar nicht.« Corman kippte einen Schluck Whiskey hinunter. »Eines Tages tauchte er einfach nicht mehr auf, und das ist das Ende der Geschichte. Entweder haben sich die verhedderten Fetzen seines Geistes so weit entwirrt, dass er weiterziehen konnte, oder die arme Sau ist immer noch irgendwo da draußen. Um endlos durch die Astralwelt zu driften. Als schreiende Fetzen.«
Am Tisch wurde es still. Wir alle waren uns der Risiken unseres Gewerbes bewusst. Bentley und Corman hatten mich gelehrt, dass Prometheus der erste Magier gewesen war, als er für die Menschen das Geheimnis des Feuers stahl. Zur Strafe wurde er an einem Berg festgeschmiedet und seine Leber über lange Zeit immer wieder von einem Adler angefressen. Das ist ein warnendes Beispiel, das jeder moderne Zauberer kennt. Trotzdem ist es ernüchternd, konkret vor Augen geführt zu bekommen, was geschehen kann, wenn man an der Maschinerie des Universums herumpfuscht.
»Das werde ich nicht zulassen«, sagte ich und riss mir ein weiteres Stück von dem Brot ab. »Was auch immer Stacy durchgemacht hat, sie hat genug gelitten. Ich werde das in Ordnung bringen.«
»Wir sind dabei«, sagte Bentley mit einem entschiedenen Nicken. »Wo wollen wir anfangen?«
»Ob es nun die Bullen waren oder ihr Freund oder jemand anders, Stacys Tod durch Ertrinken war kein Unfall, und das Ganze stinkt von vorn bis hinten nach Magie. Ich werde mich zuerst mit ihrem Freund beschäftigen. Selbst wenn er unschuldig ist, dürfte er besser als jeder andere wissen, was mit ihr los war, bevor sie starb. Tut mir einen Gefallen. Streckt eure Fühler aus, um zu sehen, ob irgendwer neu in der Stadt ist und seine Kreise zieht. Mama Margaux, bist du immer noch mit diesem Kerl aus der Gerichtsmedizin zusammen?«
»Antoine?«, fragte sie und hob eine Augenbraue. »Antoine muss erst einmal erwachsen und sich darüber klar werden, was er eigentlich will. Wenn er das geschafft hat, werden wir reden.«
»Nun, wenn es dir nichts ausmacht, ihn zu fragen, würde ich gern wissen, ob im Besucherverzeichnis außer ihrem Großvater noch andere Leute genannt sind, die sich Stacys Leiche angesehen haben.«
»Wird erledigt«, sagte Margaux.
Wir tranken noch ein paar Runden. Die Stunden verschwammen, im Brotkorb lagen nur noch ein paar einzelne Krümel, und schließlich stockten die Gespräche. Ich schob meinen Stuhl zurück und streckte mich.
»Das war es für mich«, sagte ich. »Morgen will ich wegen dieser Sache früh aus dem Bett springen. Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten.«
Bentley folgte mir in den Vorraum, wo er mir seine runzlige Hand auf die Schulter legte. »Alles in Ordnung mit dir?« Er blickte mir in die Augen. »Ist wirklich alles in Ordnung?«
Ich dachte an Roxy und brauchte einen Moment, um die Worte herauszubringen. »Ich dachte, sie wäre diejenige, welche. Ich meine, das glaubt man immer, aber … ich habe wirklich daran geglaubt. Hochzeitsglocken, ein Märchen in Weiß, die wahre Liebe. Dann ging der Traum eines Nachts einfach zu Ende.« Ich hielt inne und schüttelte den Kopf. »Jetzt bin ich traurig, und das ist okay. Wäre ich nicht traurig, würde ich wütend werden, und ich will nicht wütend auf sie sein. Ich will es nicht im Kopf herumwälzen und das, was wir hatten, in etwas Hässliches verwandeln, verstehst du? So viel bin ich ihr schuldig.«
Er starrte mich eine Weile an, dann schloss er mich wortlos in seine Arme.
Plötzlich stand ich wieder mitten auf der Fremont Street und hatte nur noch eine schemenhafte Erinnerung daran, dass ich mich verabschiedet hatte und zur Tür hinausgegangen war. Man verließ den Tiger’s Garden genauso, wie man hereinkam: vage, als reiste man durch einen seltsamen und flüssigen Raum.
Es war vier Uhr morgens. Die meisten Steuerzahler und anständigen Bürger waren in ihre Hotels zurückgekehrt, um die Nachwirkungen des billigen Biers auszuschlafen, und die Neonlichtshow des Baldachins war tot und kalt. Fremont war in seinen natürlichen Zustand zurückgekehrt, ein vermülltes Ödland, das nur von jenen bewohnt wurde, die nirgendwo anders hingehen konnten. Ein frischer Wind zerzauste mein Haar. Die Finger der kalten Wüstennacht.
Ich war gerade einen halben Block weit gegangen, als ich bemerkte, dass ich verfolgt wurde. Jemand trappelte hinter mir her, vielleicht in drei Meter Abstand, und bemühte sich unbeholfen, im Echo meiner Schritte unterzutauchen. Ich blickte wie beiläufig in das verdunkelte Fenster einer Touristenbar, aber in dem Glas spiegelte sich nur ein verschwommener rundlicher Klumpen, der mich belauerte. Zeit für eine Entscheidung.
Ein Schnorrer wäre einfach gekommen und hätte mich angesprochen. Das hier konnte nur eine unangenehmere Art von Straßenratte sein, jemand, der dumm oder zugedröhnt genug war, um sich jemanden wie mich auszusuchen. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich ihn zu meinem Auto führen würde, damit er mir gleichzeitig die Brieftasche und den fahrbaren Untersatz klauen konnte. Ich enttäuschte seine Hoffnungen, indem ich stehen blieb und zu ihm herumfuhr.
Mit langem strähnigem Haar und irgendwo aufgelesener Touristenkleidung, die mit Schmutz und Essensflecken verkrustet war, sah mein Stalker aus, als wäre er aus einem Grab hervorgekrochen. Seine blutunterlaufenen Augen weiteten sich, während er mit einem gelben abgebrochenen Fingernagel auf mich zeigte.
»Ich habe dich gesehen«, sagte er und klang wie jemand, der Schwierigkeiten hatte, die richtigen Worte zu finden. »Du warst nicht da, dann warst du da. Bist durch eine Tür gekommen, aber das bist du nicht. Simsalabim. Magie.«
Ich seufzte. Wie in jeder großen Stadt haben wir auch hier ein paar Leute, die auf der Straße enden, weil sie keine ärztliche Hilfe oder die Drogen bekommen, die sie brauchen, um zu funktionieren. Gelegentlich haben Schizophrene das Talent, Knitterfalten im Gewebe der Realität zu bemerken – zum Beispiel mich, der ein indisches Restaurant durch eine Tür verlässt, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Natürlich hört niemand auf sie. Ich suchte nach etwas, das ich zur Beschwichtigung sagen konnte. Vielleicht könnte ich ihm ein paar Dollar zustecken und ihn verscheuchen.
Dann sah er mich mit einem zahnlückigen Lächeln an. »Hab gehört, dass Magier zuckersüß schmecken«, sagte er mit einer Stimme, die sich zu einem Knurren senkte.
Er schlurfte näher heran, und nun konnte ich erkennen, dass seine Zähne nicht einfach nur verfault waren. Er hatte mehr Zähne im Mund, als irgendein Mensch haben sollte, sie drängten sich gegenseitig hinaus und bogen sich schief aus kranken Wurzeln hervor. Ungefähr während der Dauer eines Herzschlags zerliefen seine Augen in der Farbe flüssiger Eidotter.
Heute war einfach nicht meine Nacht.
5
Als der Obdachlose auf mich zuwankte, nahm ich einen Hauch von Schwefel im Wind wahr. Er kicherte, als amüsierte er sich über einen Witz, den er nicht erklären konnte.
»Keine Regeln«, brummte er. »Ohne Wachhund keine Regeln.«
Ich steckte die Finger in die Tasche, zog mein Kartendeck hervor.
Er hielt inne, dann ließ er mit Singsangstimme ertönen: »Ist der Wachhund aus dem Haus, kommen die Katzen heraus.«
Auf der Fremont Street wollte ich keine Magie einsetzen. Auch wenn es mitten in der Nacht war, müsste nur irgendein Arschloch mit Handy und YouTube-Account vorbeikommen, und ich bekäme mächtigen Ärger. Wir hatten keinen strengen obersten Rat, der die Zauberer der Welt regulierte und die Geheimnisse der Magie unter seine weise Schutzherrschaft stellte. Wir hatten lediglich die Gerechtigkeit der Straße und ein kollektives brennendes Verlangen, andere daran zu hindern, uns unsere Arbeit zu vermasseln.
Lektion eins für jeden gut ausgebildeten Magier ist die Geschichte von Prometheus. Lektion zwei besagt, wenn du herumläufst und der Welt zeigst, dass Magie real ist, dann erwartet dich – wenn du echt Glück hast – im schlimmsten Fall ein Bordsteinkick.
Ich sah nur zwei realistische Optionen, da ich, was auch immer das für ein Wesen war, diese Zähne auf keinen Fall in meiner Nähe haben wollte. Ich konnte weglaufen und hoffen, dass er nicht schneller war, als es den Eindruck machte, oder mich aus der Situation herausbluffen und hoffen, dass er nicht wusste, wie dringend ich eine magische Abwehrmaßnahme vermeiden wollte. Ich hatte heute bereits eine probiert, was immer noch an meinem Stolz kratzte, also lag die Entscheidung auf der Hand.
Ich seufzte mit echter Genervtheit und sagte: »Im Ernst, Arschloch?«
Er blinzelte. Das war offensichtlich nicht die Reaktion, die er erwartet hatte.
»Die Tür«, sagte er und wedelte mit der Hand. »Wir alle wissen von der Tür, aber man erlaubt uns nicht zu essen. Nie dürfen wir essen. Das ist nicht fair. Aber jetzt …«
»Ja, ja, der Wachhund ist aus dem Haus, das sagtest du schon. Wolltest du also die ganze Nacht hier draußen herumlungern und dich auf den ersten Magier stürzen, der aus der Tür tritt? Die Tür bewegt sich, du Blödmann.«
Ich bemühte mich, locker zu bleiben, aber mein Herz klopfte. Das waren schlechte Neuigkeiten. Der Tiger’s Garden war sozusagen die Schweiz für den okkulten Untergrund. Egal, welchen Stress man mit irgendwem in der Gemeinschaft hatte, und wir waren gar keine große Gemeinschaft, man ließ ihn an der Tür zurück und war nett zueinander. Die unausgesprochene Regel lautete, dass auf der ganzen Länge der Fremont Frieden gewahrt wurde. Wir kämen niemals auf die Idee, draußen vor dem Garden zu warten und einen heraustretenden Gast zu überfallen.
Ich musste herausfinden, womit wir es zu tun hatten und ob dieses Wesen ein einzelner Irrer war, oder ob wir uns auf einen realen Kampf gefasst machen mussten. Ich tastete mit meinen parapsychischen Sinnen nach ihm, sondierte ihn mit einer federleichten Berührung, versuchte, in Erfahrung zu bringen, was immer ich konnte.
»Niemand kann uns aufhalten.« Seine rissigen Lippen verzogen sich zu einem grotesken übermäßigen Grinsen. »Keine Regeln, wir können uns nehmen, was wir wollen. Essen, was wir wollen. Deine Zehen essen. Zehen schmecken am besten.«
»Wer ist ›wir‹?«
»Die unehelichen Kinder der Hölle.« Sein Kinn zuckte, und die Nase runzelte sich. »Die Erben der Lilith. Die Nachkommen von Unrat und Reue.«
Seine kleine Tirade passte zu meinem Bauchgefühl. Ich spürte Echos von psychischer Qual und einen Wind des Wahnsinns, die Hälften zweier unterschiedlicher Seelen, die mit Stacheldraht aneinandergefesselt und in einen missgebildeten menschlichen Körper gestopft worden waren.
»Du bist ein Cambion«, sagte ich.