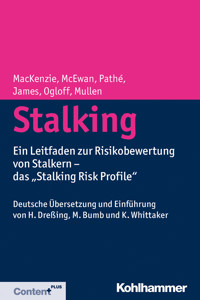
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit einer Lebenszeitprävalenz von etwa 11 % ist Stalking ein weit verbreitetes Phänomen. Fachleute unterschiedlicher Disziplinen müssen sich zunehmend mit der Risikoeinschätzung und Therapie von Stalkern beschäftigen. Wie wichtig es ist, dieser Aufgabe sorgfältig und mit der nötigen Kompetenz nachzugehen, wird durch tragische Tötungsdelikte verdeutlicht, denen Stalking vorausging. Die deutsche Übersetzung des Stalking Risk Profile bietet eine praxisnahe, wissenschaftlich fundierte dynamische Risikoeinschätzung und vermittelt praxisorientierte Vorschläge für Therapie- und Managementstrategien. In einem umfassenden Einleitungskapitel werden die für die Interventionsstrategien relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Rachel MacKenzie ist als klinische Psychologin und als forensische Gutachterin in Melbourne tätig.
Dr. Troy McEwan ist als klinische und forensische Psychologin am Centre for Forensic Behavioural Science, Swinburne University of Technology tätig.
Dr. Michele Pathé ist Forensische Psychiaterin im Forensic Mental Health Service in Brisbane.
Dr. David James ist als Forensischer Psychiater in London tätig und Dozent für Forensische Psychiatrie am University College in London.
Professor James Ogloff ist Rechtsanwalt und Psychologe und Direktor des Centre for Forensic Behavioural Science an der Swinburne University of Technology.
Professor Paul Mullen ist emeritierter Professor der Monash Universität in Melbourne an der er zuletzt als Professor für Forensische Psychiatrie tätig war.
Rachel D. MacKenzie, Troy E. McEwan,Michele T. Pathé, David V. James,James R. P. Ogloff, Paul E. Mullen
Stalking
Ein Leitfaden zur Risikobewertung von Stalkern – das »Stalking Risk Profile«
Deutsche Übersetzung und Einführung in die für Deutschland spezifischen Aspekte von Harald Dreßing, J. Malte Bumb, Konrad Whittaker
Verlag W. Kohlhammer
Danksagung: Die Übersetzer danken Herrn Professor Dr. Peter Gass (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim) für die kritische Durchsicht des Manuskripts und die wertvollen Anregungen.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Australische Originalausgabe:
Stalking Risk Profile. Guidelines for the Assessment and Management of Stalkers
Alle Rechte vorbehalten
© 2009 R. MacKenzie, T. McEwan, M. Pathé, D. James, J. Ogloff, P. Mullen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
1. Auflage 2015
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-023063-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-028822-5
epub: ISBN 978-3-17-028823-2
mobi: ISBN 978-3-17-028824-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Einleitung: Stalking – Forschungsstand und rechtliche Möglichkeiten in Deutschland
Harald Dreßing, Konrad Whittaker und Malte Bumb
Einleitung
1
Risikobewertung bei Stalking
1.1 Theoretischer Hintergrund
1.2 Wie passt das Stalking Risk Profile ins allgemeine Feld der Risikoforschung?
1.3 Warum ist es notwendig, ein auf Stalking zugeschnittenes Risikobewertungsinstrument zu entwickeln?
1.4 Verschiedene Domänen der Risikobewertung von Stalking
2
Synopsis der Stalkertypologien
Teil 1: Hinweise für den Anwender
3
Hinweise zur Anwendung des Stalking Risk Profile
3.1 Zielsetzungen des SRP
3.2 Limitationen des SRP
3.3 Voraussetzungen für die korrekte Verwendung des SRP
3.4 Informationsquellen
3.5 Aufbau des SRP
3.6 Ratingregeln
3.6.1 Erstmalige Anwendung des SRP
3.6.2 Wiederholte Anwendungen des SRP
3.6.3 Risikobewertung
3.7 Risikomanagement, Interventionen und Re-Evaluierung
Teil 2: Anwendung des Stalking Risk Profile
4
Stalkertypologien
4.1 Zuordnung zu einem bestimmten Stalkertypus
4.2 Beim Opfer handelt es sich um eine berühmte Person des öffentlichen Lebens
5
Motivationsebenen für das Stalking
Der »Zurückgewiesene Stalker«
Der »Rache suchende Stalker«
Der »Liebe suchende Stalker«
Der »Inkompetente Stalker«
Der »Beutelüsterne Stalker«
6
Risiko für stalkingassoziierte Gewalt
6.1 »Red Flag«-Risikofaktoren
V1: Suizidgedanken
V2: Tötungsgedanken
V3: »Alles-oder-Nichts-Denken«
V4: Psychotische Symptome mit hohem Risiko
V5: Psychopathie
6.2 Allgemeine Risikofaktoren
V1: Vorherige Gewalthandlungen
V2: Eigentumsbeschädigung
V3: Zugang oder Affinität zu Waffen
V4: Annäherungsverhalten
V5: Impulsivität
V6: Geringe Emotionsregulation
V7: Substanzmissbrauch
6.3 Risikofaktoren der spezifischen Stalkingkonstellationen
6.3.1 Zurückgewiesener Stalker
V-Zurück1: Drohungen
V-Zurück2: Missachten einer einstweiligen Verfügung
V-Zurück3: Kenntnis vom Wohnort des Opfers, Absicht des Aufsuchens
V-Zurück4: Konflikte um gemeinsame/s Kinder/Eigentum
V-Zurück5: Starke Wut, Rachegedanken
6.3.2 Rache suchender Stalker
V-Rache1: Missachten einer einstweiligen Verfügung
V-Rache2: Fehlgeschlagene Versuche, Wiedergutmachung zu erlangen
V-Rache3: Starke Wut
V-Rache4: Paranoide Gedanken
6.3.3 Liebe suchender Stalker
V-Liebe1: Einsicht des Misserfolgs
V-Liebe2: Starke Wut
V-Liebe3: Paranoide Gedanken
6.3.4 Inkompetenter Stalker
V-Inkomp1: Alter unter 30 Lebensjahren
V-Inkomp2: Anspruchshaltung
V-Inkomp3: Starke Wut
6.3.5 Beutelüsterner Stalker
V-Beute1: Vorherige sexuelle Gewalthandlungen
V-Beute2: Fantasien über sexuelle Gewalt
7
Risikofaktoren für persistierendes Stalking
7.1 Allgemeine Risikofaktoren
P1: Unerwünschtes Versenden von Gegenständen und/oder Briefen an das Opfer
P2: Persönlichkeitsstörung
P3: Psychose
P4: Kognitive Verzerrung
P5: Widersetzung gegen gesetzliche Bestimmungen
P6: Ablehnung der Therapie
P7: Aktuelle soziale Isolation
P8: Fehlende Empathie für das Opfer
P9: Aktueller Substanzmissbrauch
P10: Anspruchshaltung
P11: Anhaltender Kontakt zwischen Opfer und Stalker
P12: Kenntnis vom Wohnort des Opfers, Absicht des Aufsuchens
8
Risikofaktoren für Rückfälle
8.1 Allgemeine Risikofaktoren
R1: Stalking in der Vergangenheit
R2: Fehlen praktikabler Pläne
R3: Non-Compliance hinsichtlich indizierter Therapie
R4: Substanzmissbrauch
8.2 Risikofaktoren der spezifischen Stalkingkonstellationen
8.2.1 Zurückgewiesener Stalker
R-Zurück1: Persönlichkeitsstörung
R-Zurück2: Anspruchshaltung
R-Zurück3: Auslaufen gesetzlicher Bestimmungen
R-Zurück4: Veränderungen im Beziehungsstatus
R-Zurück5: Wiederannäherung an das Opfer
R-Zurück6: Einschränkung oder Verbot des Zugangs zu Kindern
8.2.2 Rache suchender Stalker
R-Rache1: Wahnhafte Störungen im Zusammenhang mit Stalking
R-Rache2: Verschlechterung des seelischen Zustandes
R-Rache3: Persönlichkeitsstörung
R-Rache4: Auslaufen gesetzlicher Bestimmungen
R-Rache5: Scheitern förmlicher Beschwerdeverfahren
8.2.3 Liebe suchender Stalker
R-Liebe1: Wahnhafte Störungen im Zusammenhang mit Stalking
R-Liebe2: Verschlechterung des seelischen Zustandes
R-Liebe3: Aktuelle soziale Isolation
R-Liebe4: Persönlichkeitsstörung
R-Liebe5: Primärer Liebeswahn
R-Liebe6: Kontakt zum Opfer
8.2.4 Inkompetenter Stalker
R-Inkomp1: Kognitive Einschränkungen
R-Inkomp2: Aktuelle soziale Isolation
R-Inkomp3: Geringe soziale Kompetenz
R-Inkomp4: Egozentrik
8.2.5 Beutelüsterner Stalker
R-Beute1: Stalking von Fremden
R-Beute2: Non-Compliance hinsichtlich externer Überwachungsmaßnahmen
R-Beute3: Sexuelle Deviation
R-Beute4: Persönlichkeitsstörung
9
Risiko für einen psychosozialen Schaden des Stalkers
9.1 Allgemeine Risikofaktoren
PDS1: Vorherige Gewalttaten
PDS2: Beendigung der Erwerbstätigkeit
PDS3: Wahnhafte Störungen im Zusammenhang mit Stalking
PDS4: Aktuelle soziale Isolation
PDS5: Geringe Resilienz gegenüber Stress
PDS6: Schwierigkeiten im Umgang mit Wut
PDS7: Fehlinterpretation der Reaktionen des Opfers
PDS8: Ausschließliche Beschäftigung mit dem Opfer
PDS9: Depressive Symptome
PDS10: Substanzmissbrauch
PDS11: Eingeschränkter Zugang zu Kindern
Teil 3: Therapeutische Praxis und Umgang mit Stalkern
10
Vorbemerkungen zur Therapie von Stalkern
11
Grundlagen und Bestandteile der Therapie von Stalkern
11.1 Psychische Störung
11.2 Responsivitätsfaktoren
11.3 Stufen des Veränderungsprozesses
Teil 4: Ergänzungen zum Stalking von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
12
Überblick
12.1 Modifizierte Definition von Stalking
12.2 Beziehung zwischen Stalker und Opfer
12.3 Motivationsebene für das Stalking
12.4 Psychische Erkrankungen beim Stalker
12.5 Risikodomänen
12.6 Das Konzept der »Fixierung«
12.7 Stalkingkonzepte in Australien und den USA – Eine vergleichende Darstellung
13
Typologie zum Stalking von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
13.1 Stalkertypologien im Hinblick auf prominente Opfer
Der »Rache suchende Stalker«
Der »Liebe suchende Stalker«
Der »Inkompetente Stalker«
Der »Beutelüsterne Stalker«
Der »Hilfe suchende Stalker«
Der »Aufmerksamkeit suchende Stalker«
Der »Chaotische Stalker«
13.2 Vergleich mit anderen Typologien
14
Risikodomänen bei prominenten Opfern
14.1 Überblick
14.1.1 Gewalt
14.1.2 Persistierendes Stalking
14.1.3 Erneut auftretendes Stalking
14.1.4 Psychosozialer Schaden des Stalkers
14.1.5 Eskalation
14.1.6 Belästigung
14.2 Risikobewertung von Stalking im Hinblick auf prominente Opfer
15
Risiko der Eskalation
15.1 Einführung
15.2 Allgemeine Risikofaktoren
E1: Mehrfache Kontaktaufnahmen
E2: Mehrere Kommunikationsmittel
E3: Mehrere Opfer
E4: Psychose
E5: Größenideen/Größenwahn
E6: Fixierung auf eine Person
16
Risiko der Belästigung
16.1 Einführung
16.2 Allgemeine Risikofaktoren
D1: Belästigung per Post
D2: Ankündigung der Absicht zur Belästigung
D3: Störendes Verhalten an prekären Orten
D4: Versuche, Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden
D5: Größenideen/Größenwahn
D6: Liebeswahn
D7: Persönlichkeitsstörung
D8: Suizidgedanken
Glossar
Literatur
Anhang Arbeitsmaterialien: Beurteilungsbögen
Einleitung: Stalking – Forschungsstand und rechtliche Möglichkeiten in Deutschland
Harald Dreßing, Konrad Whittaker und Malte Bumb
Vorbemerkungen
Während die wissenschaftliche und rechtliche Auseinandersetzung mit Stalking in den angelsächsischen und nordeuropäischen Ländern bereits Anfang der 1990er Jahre erfolgte, wurde die Brisanz dieser Problematik in Deutschland erst wesentlich später erkannt. Mittlerweile ist die Thematik aber sowohl in der Forschung, als auch in der Praxis der psychosozialen Beratung und der Gerichte angekommen. Es gibt hierzu inzwischen eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen (Übersicht bei Dreßing 2004, 2013) aber auch zusammenfassende Darstellungen in Form von Monografien (z. B. Dreßing & Gass 2005; Gallas et al. 2010).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























