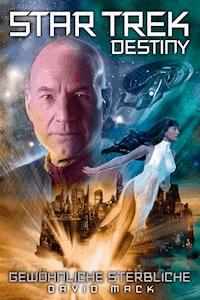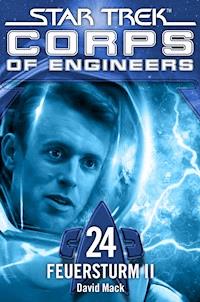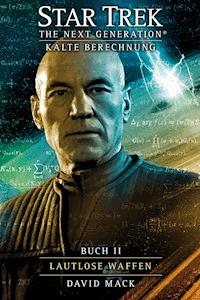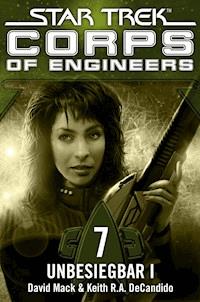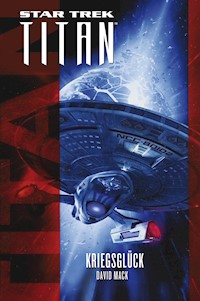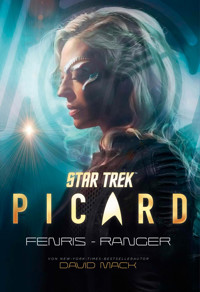
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spannendes Prequel-Abenteuer, das auf der von Fans gefeierten TV-Serie "Star Trek: Picard" basiert! Zwei Jahre nach der Rückkehr der U.S.S. Voyager aus dem Delta-Quadranten wird Seven of Nine für einen Posten in der Sternenflotte abgelehnt … und findet stattdessen eine neue Heimat bei der interstellaren, abtrünnigen Strafverfolgungseinheit, den Fenris-Rangern. Die Ranger scheinen ideal für Seven zu sein – aber um sich dieser neuen Bestimmung zu stellen, muss sie alles zurücklassen, was sie bisher kannte, und riskiert, das Wichtigste in ihrem Leben zu verlieren: ihre Freundschaft mit Admiral Kathryn Janeway.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle, die sich jemals wie Ausgestoßene vorkamen, dadurch aber nur besser und stärker wurden.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
DANKSAGUNGEN
HISTORISCHE ANMERKUNG
Die Hauptereignisse dieser Geschichte spielen 2381, ungefähr zweieinhalb Jahre nach der Rückkehr des Raumschiffs Voyager aus dem Delta-Quadranten (STAR TREK: VOYAGER – »Endspiel«). Die Rahmenhandlung spielt im Jahr 2386, ein knappes Jahr nachdem die Föderation ihre Bemühungen aufgegeben hat, Romulus vor der Supernova seines Sterns zu evakuieren (STAR TREK: PICARD – »Keine Gnade«).
Das Hindernis des Handelns treibt das Handeln voran.Was im Weg steht, wird zum Weg.
– Mark Aurel, Selbstbetrachtungen
1
2386
FENRIS
Die romulanische Sonne starb, und was eine Milliarde Seelen eine Tragödie nannte, sah ein Heer von Parasiten lediglich als günstige Gelegenheit.
Große Katastrophen neigten dazu, ihr eigenes Ökosystem hervorzubringen, einschließlich der sprichwörtlichen Wasserlöcher, an denen sich Jäger und Beute bereitwillig mischten und ihre Kämpfe und Nicklichkeiten vorübergehend ruhen ließen, um ihren Durst zu stillen. Das Kettle war ein solches Wasserloch und eins der beliebtesten in der Hauptstadt von Fenris. Es war voller dunkler Ecken mit hohen gepolsterten Sitzbänken und die dort stattfindenden Transaktionen und Treffen waren in einen permanenten Rauchschleier gehüllt. Verstohlenes Geflüster verbarg sich hinter synthetischer Musik wie Fremde hinter falschen Namen. Seine Betreiber behaupteten, das Etablissement würde Mahlzeiten servieren, aber niemand konnte sich daran erinnern, wann er innerhalb seiner Wände das letzte Mal jemanden hatte essen sehen. Das Kettle war nicht gerade für seine Speisekarte bekannt. Seine mehr als reichlich ausgestattete Bar hingegen war praktisch legendär.
Genau dort, umgeben von Katastrophengewinnlern und plötzlich bekehrten Pilgern, saß Seven allein und sehnte sich nach einem flüchtigen Moment der Ruhe von den Erinnerungen, die sie heimsuchten. Eine Ruhe, die allein durch eine hinreichende Menge Alkohol erreicht werden konnte. Sie war der Gesellschaft anderer, der Sinnlosigkeit von Small Talk und der unablässigen Frage, welches Lächeln echt war, schon lange überdrüssig.
Einst war das Kettle ein friedlicher Ort gewesen, um sich nach einer langen Patrouille zu entspannen – bis vor weniger als einem Jahr das fragile Kartenhaus der Föderation eingestürzt war. Zuerst war da der Androidenanschlag auf die Utopia-Planitia-Flottenwerften auf dem Mars im Sol-System gewesen. Tausende Tote. Zahllose Schiffe, die für die Evakuierung der Romulaner bestimmt waren, verloren. Kurz darauf war Admiral Jean-Luc Picards groß angelegte Rettungsmission dem wachsenden Isolationismus der Föderation zum Opfer gefallen und in einem Anflug von Angst und Misstrauen abgeblasen worden. Diese moralisch fragwürdige Entscheidung hatte hundert Millionen Seelen auf Romulus oder in einem seiner benachbarten Systeme gestrandet zurückgelassen, die alle bald durch die bevorstehende Supernova des romulanischen Sterns ausgelöscht werden würden.
Innerhalb weniger Tage nach dem Rückzug der Sternenflotte und der Föderation sowie der Einstellung materieller Hilfslieferungen war die erste Welle guter Samariter auf Fenris gelandet. Seitdem waren mehr von ihnen eingetroffen, als Seven zählen konnte. Eine Handvoll jeder Welle wollte sich den berüchtigten Fenris-Rangern anschließen. Die meisten anderen waren hier, um sich irgendwie nützlich zu machen, aber es gab immer auch ein paar, die auf der Flucht vor ihrer schmutzigen Vergangenheit in den Qiris-Sektor kamen. Und ebenjene schienen Seven stets hier in dieser Bar zu finden.
Seven vermied grundsätzlich Augenkontakt mit anderen Gästen und meistens war die sture Konzentration auf ihr Getränk genug, um diejenigen abzuschrecken, die auf eine Unterhaltung mit ihr hofften. Dennoch behielt sie alle um sie herum im Auge. Jeden zwielichtigen Taschendieb, der am anderen Ende der Bar sein Unwesen trieb, jeden Säufer, der für einen kostenlosen Drink flirtete, ohne jemals vorzuhaben, sein unausgesprochenes Versprechen einzulösen, jeden bezahlten Schläger, der so tat, als würde er nicht mindestens vier Waffen am Körper versteckt tragen. Gang, Mimik und Körperhaltung – all das waren untrügliche Zeichen, wenn man nur wusste, wonach man Ausschau halten musste, und Seven hatte fünf lange Jahre gelernt, die Hinweise direkt vor ihren Augen richtig zu deuten.
Was das Enigma, das neben ihr saß, doppelt faszinierend machte.
Auf dem Barhocker neben ihr hatte eine dunkelhaarige, gertenschlanke Frau Platz genommen. Sie hatte große, dunkle und ausdrucksvolle Augen, die von kunstvollen Linien und viel Make-up noch betont wurden. Ihr Teint war blass und makellos und als sie Sevens Blick bemerkte, ließ sie blendend weiße Zähne in einem Lächeln aufblitzen. Ihre Kleidung war sauber, aber nicht auf eine spießige Art und Weise. Ihre Stiefel zeigten Spuren natürlicher Abnutzung. Sie sah gepflegt aus, ohne penibel zu wirken.
Die Frau war nicht zu deuten. Ein Rätsel.
Sie deutete auf Sevens leeres Glas. »Darf ich Ihnen die nächste Runde spendieren?«
»Nein.« Seven gab vor, die Fremde zu ignorieren, während sie sie gleichzeitig im Spiegel hinter der Bar beobachtete. »Ich bezahle meine Drinks selbst.«
»Bitte?« Wie ein Zauberer, der eine Karte aus dem Ärmel zieht, legte die Frau einen Creditchip auf die Theke. »Sie sind doch Fenris-Ranger Seven, oder?«
Ihren eigenen Namen zu hören ließ Seven innehalten. Ihr wurde klar, dass die Frau ihre Taktik übernommen hatte und sie nun durch den Spiegel ansah. »Bin ich.« Ihre rechte Hand wanderte langsam zu dem Phaser in ihrem Oberschenkelholster. »Woher kennen Sie meinen Namen?«
Ihre Frage ließ die andere nervös auflachen. »Meinen Sie das ernst? Wer kennt denn Ranger Seven nicht? Ich habe tellaritische Händlermarines in Kneipen von Pollux bis Qo’nos Geschichten über Sie erzählen hören. Und ich wusste, wenn auch nur ein Zehntel von denen wahr ist, muss ich Sie einfach kennenlernen.«
Der Enthusiasmus der Fremden war schmeichelhaft, doch Seven war nicht in der Stimmung. »Ich gebe keine Autogramme.«
»Ich will auch keins.«
Das Selbstbewusstsein der Frau hatte etwas Mysteriöses an sich, auch wenn es von ihrer ehrfürchtigen Bewunderung etwas getrübt wurde. Doch es reichte, um in Seven Neugier bezüglich ihrer eigentlichen Motive zu wecken. Dennoch gab sie sich gleichgültig. »Und was wollen Sie dann?«
»Reden.«
»Worüber?«
»Wie man ein Fenris-Ranger wird.«
Seven unterdrückte ein zynisches Lachen. »Warum sollten Sie das wollen?«
»Weil ich helfen will. Jeden Abend sehe ich es in den Nachrichten: das Leid. Die Obdachlosigkeit. Den Hunger. Kein Wasser, keine Medizin. Anständige Leute, die im Stich gelassen wurden, als die Föderation die Nerven verlor. Gesetzestreue Siedler, die nun der Gnade einer wachsenden Kaste von Warlords ausgeliefert sind. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf … das macht mich krank. Krank vor Wut. Ich habe mir gesagt, dass eine Einzelperson wie ich nichts tun kann. Aber es wurde einfach zu viel. Jeden Abend diese Nachrichten – ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ich weiß, dass ich die Galaxis nicht retten kann. Aber als Fenris-Ranger kann ich vielleicht wenigstens ein paar der Seelen retten, die es sonst nicht schaffen würden.«
Es platzte nur so aus der Frau heraus, ein Geständnis wie ein reißender Strom bei Hochwasser, und es überwältigte Seven. Sie erinnerte sich, wie sie selbst vor ein paar Jahren Ähnliches gesagt hatte, und als sie eine solche Erklärung nun von einer anderen hörte, stellte sie erstaunt fest, wie überzeugend eine solche Mischung aus Leidenschaft und Naivität sein konnte.
Dennoch … sie konnte nicht zulassen, dass jemand blind in ein solch prekäres Leben hineinstolperte. Sie sah der Frau fest in die Augen. »Ich verstehe Sie ja, wirklich. Aber Fenris-Ranger zu sein ist kein Spiel. Es kann gefährlich, aber auch sehr langweilig sein. Wir schützen die Unschuldigen so gut wir können, aber manchmal müssen wir uns mit dem Teufel einlassen, um den Frieden zu wahren. Um einen guten Ranger zu zitieren, den ich einst kannte: Es ist nicht einfach nur ein Abenteuer – es ist ein Job.«
Keins ihrer Worte schien den Eifer der anderen Frau dämpfen zu können. »Ich bin bereit. Für schwere Entscheidungen, schlechtes Essen, die lange Stille der Tiefraumpatrouillen, für alles. Irgendwo da draußen ist jemand, der einen Ranger braucht, der für ihn einsteht. Ich will dieser Ranger sein. Können Sie mir helfen?«
Seven schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Sie scheinen es ernst zu meinen. Aber ein Teil von mir ist besorgt, dass Sie keine Ahnung haben, worauf Sie sich da einlassen. Oder dass Sie es aus den falschen Gründen wollen.«
»Was waren denn Ihre Gründe, sich den Rangern anzuschließen?«
»Lange Geschichte.«
»Schon gut. Ich habe heute Abend nichts mehr vor.« Die dunkelhaarige Frau winkte dem tiburonischen Barkeeper zu und deutete auf Sevens leeres Glas. »Noch einen für den Ranger und einen Belgarian Sunset für mich.« Sie schob ihren Creditchip über die Theke. »Und machen Sie bitte einen Deckel auf.«
Der Barkeeper mit den großen Ohren nahm den Creditchip entgegen, nickte der Fremden zu und machte sich an die Arbeit, ihren und Sevens Drink zuzubereiten.
Die Beharrlichkeit der Frau amüsierte Seven, auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen wollte. Sie bedachte sie mit einem ironischen Seitenblick. »Sie akzeptieren einfach kein Nein, oder?«
Die Fremde erwiderte Sevens Blick schelmisch. »Nie.«
Das brachte Seven zum Schmunzeln. »Da sind wir schon zwei.« Sie hielt inne, als der Barkeeper den bunten Belgarian Sunset und einen Bourbon pur für Seven brachte. Die sprudelnde Fruchtigkeit des Ersteren wirkte neben den rauchigen Vanillenoten des Letzteren fehl am Platz. Seven schmunzelte nur und gab vor, nichts zu bemerken. »Meinetwegen. Solange Sie die Drinks bezahlen, kann es wohl nicht schaden, Ihnen zu erzählen, wie ich hier gelandet bin.«
Die andere Frau lehnte sich näher heran, mit großen Augen und noch breiterem Lächeln. »Ich bin ganz Ohr.«
2
2380
ERDE, KAPSTADT, SÜDAFRIKA
Seven packte ihre restliche Kleidung in einen Seesack aus Synthetik und stellte ihn auf einem Stuhl ab. Die kühle Morgenluft, die durch das offene Fenster ihres Schlafzimmers hereinwehte, war vermischt mit dem Schwefelgestank von verrottendem Seetang. Sie hörte, wie sich vor dem Strandhaus die Wellen am Macassar Beach brachen, gefolgt von leisem Donnergrollen irgendwo draußen in der False Bay, wo ein bleigrauer Himmel voller schwarzer Wolken mit Regen drohte. Mit ein bisschen Glück würde sie weg sein, bevor das Unwetter losging.
Sie wollte gerade ihre Sachen aus dem Wohnzimmer einsammeln, als sie vor ihrer Haustür den melodischen Klang eines Transporterstrahls hörte. Einen Moment später erklang das Klopfen, vor dem ihr seit Wochen graute, dem sie sich aber niemals hätte entziehen können. »Es ist offen.«
Kathryn Janeway öffnete die Tür und machte zwei Schritte ins Haus. Sie trug die Uniform eines Vice Admirals der Sternenflotte. »Seven? Störe ich?«
Seven bemühte sich, unbeschwert zu klingen. »Überhaupt nicht, Admiral.« Sie bedeutete Janeway, sich auf das Schlafsofa zu setzen. »Machen Sie es sich bitte bequem.«
Janeway musterte das minimalistische Möbelstück misstrauisch. »Ich bleibe lieber stehen, wenn das in Ordnung ist.«
»Wie Sie wollen.«
Plötzlich überkamen Seven Zweifel. Sie ist von meinem Zuhause entsetzt. Von seinem mangelnden Komfort. Von meiner Unfähigkeit, wie andere Menschen zu leben.
Mit aller Kraft versuchte Seven, sich ihre Unsicherheit nicht anmerken zu lassen. Wie so oft setzte sie ein falsches Lächeln auf. »Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oder einen Raktajino?«
Janeway winkte ab. »Vielleicht später.«
Der Vice Admiral drehte sich langsam um sich selbst und sah sich im Wohnzimmer um. Sie nickte, als sie die diversen Holorahmen mit Schnappschüssen ihrer ehemaligen Schiffskameraden von der Voyager sah. Auf einem lachte Tom Paris, während ihm B’Elanna Torres einen bösen Blick zuwarf. Auf einem weiteren war Commander Chakotay tief in Gedanken versunken zu sehen, offenbar aus einer diskreten Entfernung aufgenommen. Ein Rahmen wechselte zwischen Bildern von Harry Kim vor einem Wasserfall während einer Außenmission, dem Doktor, der einen Kratzer auf dem Knie einer jungen Naomi Wildman verarztete, und Neelix in seiner Küche. Der letzte der Holorahmen war wieder einem einzigen Bild gewidmet: einem Porträt von Janeway.
Der Admiral sah mit einem verschmitzten Funkeln in den Augen zu Seven. »Mir gefällt, was Sie aus dem Haus gemacht haben.«
»Sarkasmus, nehme ich an?«
»Keineswegs. Ich meine es ernst. Ihr Zuhause reflektiert, wer Sie sind – oder zumindest die Art, wie Sie sich sehen. Ich sehe mich um und erkenne Effizienz, eine aus Disziplin geborene Reinlichkeit – und einen Hauch von Sentimentalität abwesenden Freunden gegenüber.« Nach einem Moment fragte sie: »Apropos, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Chakotay?«
»Nicht seit er sein neues Kommando erhalten hat.«
»Warum nicht?«
Die Frage war Seven unangenehm. »Wir haben uns auseinandergelebt. Was gibt es da sonst noch zu sagen?«
»Ich nehme an, das ist nicht die ganze Wahrheit.«
In einem Anfall von Nostalgie nahm Seven den Holorahmen von Chakotay in die Hand. Sie war immer noch dabei, ihre Schuldgefühle über das Ende ihrer Beziehung zum ehemaligen Ersten Offizier der Voyager zu verarbeiten. Sie hatte sich wirklich zu ihm hingezogen gefühlt und die Aufrichtigkeit seiner Gefühle für sie nie angezweifelt, doch in den letzten Jahren hatten gewisse Umstände Seven so wütend und neidisch gemacht, dass es ihn vergrault hatte. Sie nahm an, dass es die gleichen Umstände waren, die Janeway an diesem Morgen zu ihr geführt hatten.
Sie stellte den Holorahmen wieder ab. »Ich nehme nicht an, dass Sie nach Südafrika gekommen sind, um mein Liebesleben zu kritisieren.«
Janeways Lächeln verblasste nicht, wirkte aber plötzlich ein bisschen gezwungen. »Sie haben sich die Haare wachsen lassen. Sieht gut aus.«
Wie aus Reflex berührte Seven ihre blonden Haare, die inzwischen bis zu ihren Schultern reichten. »Vielen Dank.«
»Und es ist offensichtlich, dass Sie sich in Form halten.«
»Es hilft, einen Privatstrand zum Joggen und Schwimmen zu haben. Aber wir wissen beide, dass Sie Zeit schinden, Admiral. Warum sind Sie wirklich hier?«
Widerwillig ließ Janeway ihre fröhliche Fassade fallen. »Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mit guten Neuigkeiten komme.«
Seven nickte. Dies war eine Fortsetzung einer Reihe enttäuschender Gespräche, die die beiden in den letzten Monaten geführt hatten. »Unser Antrag an den Föderationsrat bezüglich meiner Bürgerschaft?«
»Abgewiesen. Erneut. Und es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber die Sternenflotte weigert sich darüber hinaus, Sie zur Akademie zuzulassen.«
»Wie wir erwartet haben.«
»Wie Sie erwartet haben. Ich dachte, der Stabschef würde zur Vernunft kommen, als ich damit gedroht habe, den Dienst zu quittieren, bis man Sie in den nächsten Kurs aufnimmt. Wie sich herausstellt … lag ich falsch.«
Seven bewegte sich durch den Raum und sammelte langsam die Holorahmen ein. »Haben sie gesagt, warum man meinen Antrag ablehnt?«
»Sie haben alles versucht, um nicht mit der Sprache rauszurücken, aber letztendlich haben sich Ihre Befürchtungen als korrekt erwiesen.«
»Weil ich immer noch halb Borg bin.«
Janeway seufzte frustriert. »Das ist so verdammt kurzsichtig! Ich habe ihnen zu erklären versucht, dass Sie vom Kollektiv befreit sind, dass Sie es verdienen, wie jeder andere behandelt zu werden, aber die sehen nur Ihre Implantate und Nanosonden und reden sich ein, dass Sie eine Spionin sind, die vorhat, die Sternenflotte von innen heraus zu assimilieren.«
Janeway zuliebe bewahrte Seven ihre stoische Fassade, trotz des Aufwallens von Scham und Wut in ihrem Inneren. »Ihre Entscheidung ist enttäuschend, aber nicht überraschend.«
»Nennen wir das Kind beim Namen, Seven: Es ist eine rassistische, reaktionäre Entscheidung, die aus Angst getroffen wurde.« Janeway schüttelte ihren Kopf. »Ich kann das nicht so stehen lassen. Wenn es sein muss, bringe ich es vor Gericht, aber …«
»Nein, bitte. Nicht meinetwegen.«
Janeway wirkte verblüfft. »Warum nicht?«
»Sie haben getan, was Sie konnten, mehr als ich jemals hätte erbitten oder erwarten können. Aber diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Je länger Sie darauf beharren, desto mehr Feinde werden Sie sich machen, in der Regierung wie in der Sternenflotte.«
»Na und?«
»Sie sind jetzt Admiral. Und haben damit automatisch mehr zu verlieren. Bitte setzen Sie nicht Ihre Karriere aufs Spiel, nur um einen verlorenen Kampf für mich auszufechten.«
»Seven, Sie wissen so gut wie ich, dass mir Ränge und Macht egal sind. Wichtig ist mir nur meine Familie, meine Freunde, meine Mannschaft – und für das Richtige einzustehen. Ich kann nicht einfach zusehen, wie Ihnen Sternenflotte und Föderation aus Furcht und Vorurteilen verwehren, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich weiß, dass sie es besser wissen – und ich habe vor, sie daran zu erinnern.«
»Wissen sie es denn besser? Sind Sie sich da vollkommen sicher?«
Janeway runzelte die Stirn. »Warum fragen Sie das?«
Seven steckte die deaktivierten Holorahmen in eine zweite Reisetasche und bedeutete Janeway, ihr zu folgen. »Ich will Ihnen etwas zeigen.«
Sie führte den Admiral durch die Küche und zur Hintertür hinaus. Die zwei gingen über ein Stück Strand, das mit Dünengras bewachsen war, bis sie die Seite von Sevens Häuschen erreicht hatten. Dort prangte ein Graffiti: Stirb, Borg-Schlampe. Janeway zuckte entsetzt zusammen. »Wer war das?«
Seven zuckte mit den Schultern. »Die örtliche Polizei sagt, dass es wahrscheinlich Jugendliche waren, aber bisher wirken sie nicht sonderlich darauf erpicht, die Täter zu finden.«
Janeway verschränkte die Arme, als wollte sie sich vor der Niederträchtigkeit der auf die Wand gesprühten Worte schützen. »Was werden Sie deswegen unternehmen?«
»Nichts.« Seven kehrte zur Hintertür zurück.
Während Janeway ihr folgte, stieg Zorn in ihr auf. »Was meinen Sie mit ›nichts‹? Jemand muss dafür geradestehen.«
»Es spielt keine Rolle mehr, weil ich von hier weggehe.«
»Sie verlassen die Stadt?«
»Ich verlasse die Erde.«
Diese Aussage ließ Janeway überrascht zurück. Seven holte ihren Seesack aus dem Schlafzimmer und kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo Janeway unruhig auf und ab ging. Der Admiral hatte inzwischen jedoch die Stimme wiedergefunden. »Sie wollen die Erde verlassen? Denken Sie nicht, dass Sie etwas überreagieren?«
Seven stellte ihr Gepäck vor der Haustür ab. »Nein.« Sie hielt inne und überlegte, wie viel von ihren momentanen Zweifeln sie erwähnen sollte. Doch dann entschied sie, dass Janeway die Wahrheit verdiente – und zwar nicht nur einen Teil davon, sondern die ganze Wahrheit. »Um ehrlich zu sein, fühle ich mich seit dem Tag unserer Ankunft fremd auf der Erde. Wo ich auch hingehe, sehen die Leute meine Implantate und nehmen das Schlechteste von mir an. Sie denken, dass ich nicht mitbekomme, wie sie die Köpfe zusammenstecken und mich ansehen, doch das tue ich.«
»So schlimm kann es doch nicht sein«, sagte Janeway beschwichtigend. »Es behandelt Sie doch bestimmt nicht jeder so.«
»Erinnern Sie sich an meine Tante Irene?«
»Natürlich.«
»Selbst nach einem Dutzend Besuchen zuckt sie immer noch zusammen, wenn sie mich umarmt, und sie weigert sich, mich Seven zu nennen. Sie besteht darauf, mich als ›Annika‹ anzusprechen, egal wie oft ich ihr sage, dass dieser Name keine Bedeutung mehr für mich hat. Wenn ich protestiere, sagt sie nur, dass das der Name ist, den die Föderation in meine Identifikationspapiere eingetragen hat. Mein echter Name erschreckt andere – selbst meine eigene Familie.«
»Und Sie denken, die Erde zu verlassen wird das ändern?«
»Vielleicht, wenn ich weit genug fortgehe.«
»Und was gedenken Sie da draußen zu finden, Seven?«
»Ich weiß es nicht. Einen Neuanfang vielleicht.« Ihr verbessertes Gehör nahm das Summen eines nahenden zivilen Transportshuttles wahr. »Ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen Raum zum Durchatmen, während ich versuche, all diese Gefühle zu verarbeiten, die in mir hochkommen, seit ich auf der Erde bin. Jeden Tag werden meine Gedanken verwirrender und alles, wonach ich mich sehne, ist eine Gelegenheit, mal nur für mich zu sein. Um herauszufinden, wer ich bin. Wer ich sein sollte.«
Janeway sah auf, als auch sie das Shuttle hörte, das über das Haus flog, um auf dem Strand zu landen. »Ich kann das Bedürfnis verstehen, Zeit für sich haben zu wollen. Das verspüren wir alle gelegentlich. Aber Sie brauchen nicht gleich die Erde zu verlassen, um Einsamkeit zu finden. Es gibt Orte in der Mongolei, in Norwegen oder …«
»Mein Shuttle ist hier.«
Verzweiflung schlich sich in Janeways Tonfall. »Bitte, Seven, geben Sie mir nur noch ein bisschen mehr Zeit, um das hinzubekommen. Ich könnte es auf andere Weise versuchen, Beziehungen spielen lassen, ein paar Gefallen einfordern …«
»Ich habe mich entschieden, Admiral. Danke für alles, was Sie getan haben, aber bitte hören Sie jetzt auf. Werden Sie nicht um meinetwillen zur Geächteten. Wie mir Tuvok immer zu sagen pflegte, die Bedürfnisse der Vielen …«
»Überwiegen die Bedürfnisse der Wenigen«, beendete Janeway den Satz.
»Oder der Einen.« Seven drückte Janeways Hand. »Es ist Zeit für mich zu gehen.«
Tränen schimmerten in Janeways Augen, als sie Seven umarmte. »Passen Sie auf sich auf da draußen.«
»Das werde ich.«
Sie lösten sich voneinander. Seven öffnete die Tür. Das Shuttle wartete auf dem staubigen Boden vor dem Strandhaus. Sie nahm ihr Gepäck.
Janeway betrachtete das Shuttle. »Wohin wollen Sie?«
Seven blieb in der offenen Tür stehen und schenkte Janeway ein Lächeln. »Das werde ich wissen, wenn da bin.«
3
2381
SKÅNEVIK PRIME
Das Rauschen eines beständigen Tropenregens dämpfte die Schritte des Fenris-Rangers. Keon Harper ging voraus und verfluchte innerlich sein Schicksal. Er und Leniker Zehga, sein Deputy in Ausbildung, waren umgeben von einem riesigen Dschungel, der nach Sonnenuntergang in absolute Dunkelheit getaucht war. Ohne die ultraviolettverstärkenden Filter in den Holobrillen wären die beiden Ranger so gut wie blind.
Es half auch nicht, dass das Lager der Schmuggler, das sie suchten, ebenfalls völlig im Dunkeln lag. Harper hätte gedacht, dass sie sie inzwischen längst gefunden haben sollten. Er hasste es, vor einem Neuling dumm dazustehen, selbst wenn Zehga sehr zurückhaltend und respektvoll war. Der junge Zakdorn, der sich stets ein paar Schritte hinter Harper hielt, blieb stehen, als der Ranger seine Hand hob und sie zur Faust ballte. Dann bedeutete er seinem Deputy, wie er auf die Knie zu gehen.
Harper scannte den Dschungel vor ihnen, während Zehga mit hörbarer Abscheu sagte: »Es gibt Dutzende von Planeten im Qiris-Sektor, aber wir werden zu dem geschickt, der nur aus Matsch besteht.«
»Könnte schlimmer sein, Junge. Zumindest sind wir nicht auf TaQ’hor gelandet.«
»Warum ist es da schlimmer?«
»Auf TaQ’hor richteten die Klingonen Targs zur Jagd ab.«
»Durch dich bekomme ich immer die schönsten Orte zu sehen, Harper.«
»Ist nichts Persönliches, Len. Wir gehen dorthin, wo die bösen Jungs sind.«
»Warum sind die bösen Jungs nie auf Risa?«
»Sind sie, nur nicht geschäftlich. Die stehen genauso aufs Jamaharon wie jeder andere Kerl.« Harper sah über seine Schulter zu Zehga und deutete auf ihre rechte Flanke. »Sag mir, ob du da drüben was siehst.«
Zehga runzelte die Stirn. »Nichts als Schatten.«
Harper hatte zwar keinen Grund, davon auszugehen, dass die Sinne eines Zakdorn besser waren als die der Menschen, dennoch hatte er gehofft, dass der Deputy in der Dunkelheit mehr erkennen würde. »Diese Nausikaaner gehen mir auf die Nerven, Len. Wo haben sie so gute Lichtdisziplin gelernt?«
»So gute was?«
»Lichtdisziplin.« Es dauerte einen Moment, bis Harper begriff, dass Zehga den Begriff nicht kannte. »Nach Anbruch der Dunkelheit jede Lichtquelle zu verstecken, um seine Position nicht zu verraten. Auf der Erde wurde diese Methode in der Vergangenheit angewendet, um nicht ins Visier von Bombern oder Scharfschützen zu geraten.«
Zehga antwortete in diesem speziellen Tonfall, der verblüfft klang, von dem Harper aber inzwischen wusste, dass er sarkastisch gemeint war. »Es gilt auf der Erde also als fortgeschrittene taktische Fähigkeit, leise im Dunkeln zu sitzen?«
»Bring mich nicht dazu, dir die Hautfalten aus dem Gesicht zu prügeln.«
Zehga lachte heiser auf, doch dann wich seine Heiterkeit einer konzentrierten Miene. »Kontakt, Peilung zwei sieben Komma fünf. Entfernung neunundfünfzig Komma zwei Meter. Beständiges künstliches Licht.«
Beide Ranger duckten sich tiefer. Harper änderte die Einstellung seiner Holobrille und blinzelte in die Richtung, in die Zehga deutete. »Ich sehe es. Könnte ein Statuslicht an einem Energiepack sein.«
»So viel zu ›Lichtdisziplin‹.«
»Vielleicht auch nicht. Es könnte abgedeckt gewesen sein, bis eine Brise etwas weggeweht hat.« Harper löste die Schnalle, die seinen Impulsphaser im Oberschenkelholster hielt. »Sehen wir uns das mal näher an.«
Mit langsamen, vorsichtigen Schritten bewegten sich Harper und Zehga durch das Unterholz des Dschungels, großblättrige Pflanzen, die sich den vom Blätterdach herabhängenden Lianen entgegenreckten.
Während sie sich dem Schmugglerlager näherten, entdeckte Harper lange Tarnnetze, die sich zwischen der einheimischen Flora erstreckten wie gigantische Spinnennetze. Hinter den Netzen versteckte sich ein Lager aus wackligen Hütten und schlecht gewarteten Oberflächenfahrzeugen. Wachen waren keine zu entdecken. Er nahm an, dass sie das dem Regen zu verdanken hatten.
Harper signalisierte Zehga anzuhalten, als sie nur noch zwanzig Meter vom Lager entfernt waren. »Ich wette, in einem dieser größeren Gebäude bewahren sie die Handfeuerwaffen auf, die sie von den Klingonen gekauft haben. Und in einem anderen lagern sie wahrscheinlich die schwereren Geschütze.«
Dem Zakdorn war deutlich anzusehen, wie sich die Rädchen in seinem Kopf drehten. »Wenn du recht hast, könnten wir das ganze Lager auf einmal vernichten, wenn wir eine Granate mit Zeitverzögerung reinwerfen.«
Harper fragte sich, ob Zehga während der Missionsvorbesprechung überhaupt zugehört hatte. »Wir sind Ranger, kein Einsatzkommando, Kleiner. Denk nicht wie ein Soldat, sondern wie ein Ermittler. Denk daran, was ich gesagt habe: schnell und leise. Rein, die Schmuggelware als Beweis dokumentieren – und dann was?«
Zehga runzelte die Stirn. Ihm gefiel Harpers Kritik nicht. »Dann ziehen wir uns zurück und rufen einen Korsar. Wenn die Verstärkung eingetroffen ist, umzingeln wir das Lager.«
»Und …?«
»Wir verhaften die Schmuggler und bringen sie nach Fenris, wo sie verurteilt werden.«
»Richtig. Das war doch gar nicht so schwer, oder?«
»Sie in die Luft zu jagen würde schneller gehen.«
»Aber es wäre auch Mord und man würde dich verhaften.« Harper zog seinen Impulsphaser aus dem Holster. Zehga tat es ihm mit seiner Betäubungspistole nach – es war die einzige Waffe, die Deputy-Ranger während ihrer Ausbildung tragen durften. Harper deutete auf beide Seiten des Lagers. »Ich gehe nach links, du nach rechts. Schneide dir ein Loch durch das Tarnnetz und sobald du drin bist, finde etwas, für das wir einen Durchsuchungsbefehl bekommen.« Der Neuling nickte und wollte gerade losgehen, als Harper ihn zurückhielt. »Und noch was, Kleiner. Pass auf dich auf, ja?«
»Verstanden, Boss.«
»Ich bin nicht dein Boss. Ich bin dein Partner.«
»Verstanden, Partner.«
»Jetzt nimmst du mich auf den Arm. Also los. Wir sehen uns drinnen.«
Sie teilten sich auf und liefen geduckt das Tarnnetz des Lagers ab, um eine gute Stelle für ein Loch zu finden.
Keine Minute später hatte Harper ein Messer gezückt und wollte gerade das Netz zerschneiden. Doch da erschien ein greller Blitz aus weiß-orangem Licht, ein dröhnender Knall und eine Schockwelle, die ihn auf den Hintern schleuderte. Betäubt und desorientiert versuchte Harper, sich zurechtzufinden, dann sah er, dass die Mission nach hinten losgegangen war. Eine Feuersäule und Rauch stiegen vom anderen Bereich des Lagers auf.
Überall im Lager ging grelles weißes Licht an und eine Alarmsirene heulte aus den an hohen Holzpfählen befestigten Lautsprechern. Das Lager füllte sich mit den Geräuschen nausikaanischer Söldner, die herumeilten.
Mühsam kam Harper wieder auf die Beine. In seinem Kopf drehte sich alles und er sah weiße Punkte. Er stolperte und stieß wiederholt gegen Baumstämme. Aus dem Lager drangen wütende Rufe. Die Stimmen wurden lauter, weil sie in seine Richtung kamen. Torkelnd wie ein Betrunkener nach einer Sauftour lief er durch das dichte Unterholz und näherte sich unbeholfen dem Feuer und Rauch, bis er Zehga gefunden hatte.
Der junge Zakdorn war von der Explosion voll erwischt worden. Sein bartloses Gesicht war auf einer Seite völlig schwarz und seine zurückgekämmten Haare weggebrannt. Seine Kleidung schwelte, was dem süßlichen Gestank seines verbrannten Fleischs eine chemische Note hinzufügte. Die Explosion hatte seinen Torso aufgerissen, Mehrere seiner inneren Organe waren zu sehen und ebenfalls verbrannt. Sein ganzer Körper zitterte, als Harper seine Hand ergriff.
»Großer Gott, was ist passiert, Kleiner?«
Durch einen Mundvoll Blut stieß Zehga eine Antwort hervor. »Stolper…draht.«
Panik, Wut und Trauer ließen Harper innerlich erstarren. Mit Tränen in den Augen kniete er sich neben den Zakdorn. »Es tut mir so leid, Len, das ist alles meine Schuld. Wir hätten zusammenbleiben müssen. Ich hätte …«
»Nicht … deine Schuld.«
Direkt hinter Harpers Kopf kreischte ein Disruptorstrahl auf. Instinktiv wirbelte er herum und gab einen Phaserimpuls direkt in das Gesicht eines Nausikaaners ab. Der hässliche Mistkerl fiel wie ein Sack Schrauben zu Boden.
Er steckte seine Waffe wieder ein und versuchte, Zehgas entstellten, blutigen Körper aus dem Schlamm zu ziehen. »Halt durch, Kleiner. Es sind nur ein paar Klicks zum Prowler, wir …«
»Geh.«
»Wir lassen keinen Ranger zurück.«
»Mit mir … schaffst du’s … nicht. Geh.«
Harper wollte widersprechen, doch ihm lief die Zeit davon. Hinter einer der Hütten kamen ein Dutzend Nausikaaner hervor und entdeckten ihn neben Zehga. Disruptorfeuer erfüllte die Luft mit grellem Licht und einer schrillen Kakofonie, während Zehga seinen letzten Atemzug tat und erschlaffte.
Harper erwiderte das Feuer, während er sich in den Dschungel zurückzog. Wäre er dreißig Jahre jünger gewesen, hätte er vielleicht versucht, Zehgas Leiche zu tragen, nur um den Nausikaanern das perverse Vergnügen zu nehmen, sie zu schänden. Harper war Mitte sechzig, aber es war nicht nur sein Alter, das dies unmöglich machte, sondern all die großen und kleinen Verletzungen, die er sich über die Jahre zugezogen hatte. Er gehörte, wie man früher so schön gesagt hatte, einfach zum alten Eisen. Er konnte Zehga nicht zurück zum Prowler schleppen und gleichzeitig die wütenden Nausikaaner abschütteln, die ihm den ganzen Weg über auf den Fersen blieben.
Die Disruptorimpulse der Nausikaaner prallten von der Hülle seines Starfire-500-Prowlers ab – ein schnelles, wendiges Zweisitzer-Patrouillenschiff mit exzellenten Bordwaffen –, während er ihn nahezu senkrecht in den Orbit steuerte. Der Aufstieg war so heftig, dass er trotz der Trägheitsdämpfer von fünfzehn g in den Sitz gepresst wurde. Er konnte kaum noch atmen und seine Schläfen begannen zu pochen.
Er schaltete die Schubdüsen erst zurück, als sich der Dunst der Atmosphäre auflöste und den sternübersäten Kosmos freigab.
Während Harper Skånevik Prime hinter sich ließ, stellte er die Komm-Konsole aus, damit niemand hörte, wie er brüllte, fluchte und um die gute, tapfere Seele trauerte, die er verloren hatte. Zehga war nur deshalb ein Fenris-Ranger geworden, weil er anderen hatte helfen wollen. Nun war er gestorben, weil Harper zu schnell zu viel von ihm verlangt und ihn viel zu früh allein gelassen hatte.
Nie wieder, schwor sich Harper und starrte voller Wut und Trauer auf sein Spiegelbild im Dachfenster des Prowlers. Nie wieder.
STARHEIM, UTSIRA III
Die Fabrik war eine Kathedrale der Automatisierung. Die riesigen Maschinen und sich endlos drehenden Fließbänder summten und pulsierten vor Hitze. Die Fabrik lief rund um die Uhr, jeden einzelnen Tag, während sich Millionen Rädchen in konstanter Harmonie bewegten, ein unermüdlicher Tanz der Schöpfung. Seven fühlte sich sicher und anonym, während sie allein in dieser Sinfonie des Synthetischen arbeitete.
Sie war sich der Ironie ihrer Umstände durchaus bewusst. Von allen Welten, in die sie innerhalb des Föderationsraums hätte fliehen können, von all den Jobs, die sie hätte annehmen können, um sich wie ein nützliches Mitglied der Gesellschaft vorzukommen, hatte sie sich eine niedere Tätigkeit in einer Industrieumgebung gesucht, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Inneren eines Borg-Kubus hatte. Nur dass es nicht so feucht war.
Ihre Aufgabe bestand darin, am Ende eines Fließbands zu warten, bis etwas ankam, und es in Kisten zu packen. Wenn eine Kiste voll war, benutzte sie einen Antigrav-Heber, um sie auf eine Palette zu wuchten. Wenn eine Palette voll war, musste Seven sie zum Beamen markieren und sah zu, wie sie sich dematerialisierte.
Sie hatte keine Ahnung, wohin die Paletten verschwanden. Keinen blassen Schimmer, wer sie gekauft hatte oder wie viel dafür bezahlt worden war. Und sie hatte auf zwei Welten zuvor auf die harte Tour lernen müssen, keine Fragen zu stellen, schon gar nicht Leuten, die bereit waren, ihre Arbeit mit anonymisierten Creditchips zu vergelten.
Ihre Arbeit war langweilig. Sie erforderte weder Urteilsvermögen noch Kreativität. Es war ein Job, den der Fabrikleiter als »Verschwendung eines Androiden« bezeichnet hatte, und bei Sevens Einstellung hatte er fast entschuldigend gewirkt, als würde er sie zu irgendeiner entsetzlichen Folter verurteilen. Sie behielt die Tatsache für sich, dass sie es seltsam beruhigend fand, von Maschinen umgeben zu sein.
Ein langes, tiefes Surren ließ die ganze Fabrik erzittern.
Es war das Signal für die morgendliche Pause, zu der sich die Handvoll organischer Arbeiter meist auf der an der Ostseite gelegenen Frachtrampe versammelte. Dort landete Maxx, ein stämmiger Bolianer, sein Imbissschiff, ein Kurzstreckenshuttle, das er in ein mobiles Restaurant umgebaut hatte. Sobald Maxx das Shuttle sicher auf der Frachtrampe gelandet hatte, öffnete er steuerbord und achtern gelegene Luken, um warme Sandwiches, süße oder herzhafte Snacks, Stimulanzien zum Rauchen oder Kauen und eine Auswahl warmer und kalter Getränke anzubieten.
Die anderen Arbeiter nutzten diese kurze Pause an der frischen Luft, um zu plaudern, fettige Mahlzeiten hinunterzuschlingen und zu rauchen. Sevens morgendliche Routine bestand hingegen aus einem extrastarken Raktajino, an dem sie nippte, während sie in die trostlose Umgebung starrte.
Utsira III war eine abgelegene, kaum bevölkerte Welt am äußersten Rand des Föderationsraums. Genau genommen war sie ein Föderationsprotektorat, aber kein Mitglied des Föderationsrats – unterlag somit jedoch auch keinen steuerlichen Verpflichtungen. Dieses Detail machte Utsira III für Seven als Ort interessant, an dem sie inkognito leben konnte – auch wenn sie bei der Ankunft hatte feststellen müssen, dass das wirklich der einzige Vorzug war.
Ein Großteil des Planeten kannte nur ein einziges Klima, dessen Hauptmerkmale Kälte, Feuchtigkeit und trostloses Grau waren. Eine bleischwere Wolkendecke hüllte fast die gesamte Welt ein, gab aber nur gelegentlich Regen ab. Auch wenn das Wetter mindestens teilweise dafür verantwortlich war, dass Utsira III größeren Siedlungsplänen widerstand, war der Hauptschuldige doch mit Sicherheit die Hauptindustrie des Planeten: Ressourcenextraktion, was, wie Seven gelernt hatte, ein Euphemismus für Bergbau war.
Die kleine Stadt Starheim, die etwa dreißig Jahre lang nur eine Bevölkerungsexplosion davon entfernt gewesen war, zu einer Großstadt zu werden, entsprach etwa dem Durchschnitt der Siedlungen auf Utsira III. Die meisten Jobs hier gab es im Bergbau, Abriss, Bau und der Sortierung von Metallabfall für die Materierückgewinnung. Schwere, gefährliche Arbeit wie der Tiefbau wurde von Robotermaschinen durchgeführt, die wiederum von Teams von Androiden überwacht wurden. Ein Bruchteil der einheimischen Bevölkerung war im Servicesektor angestellt. Und für die restlichen Erwachsenen, die sich auf diesem schmutzigen Felsen wiederfanden, gab es Bars.
Jede Menge Bars.
Seven hatte ihren Raktajino halb ausgetrunken, als sie bemerkte, wie sich ihre Kollegen um den Holovidprojektor scharrten, den Maxx auf FNN eingestellt hatte. Furcht und Pragmatismus rieten ihr, auf Abstand zu bleiben. Bisher war es ihr einigermaßen gelungen, ihre Borg-Implantate zu verbergen, indem sie bei der Arbeit immer Handschuhe trug und ihr Haar so lang hatte wachsen lassen, dass es das Implantat um ihr linkes Auge verbarg. Aber was auch immer gerade vor sich ging, ließ die anderen regelrecht den Atem anhalten, und so trieb ihre Neugier Seven zu den anderen.
Neben dem Hologramm einer gut frisierten, ernst klingenden bajoranischen Nachrichtensprecherin befand sich eine Sternkarte, auf der ein Schwert und ein Blitz prangten. Darunter standen die Worte CHAOS IN QIRIS. »Im Qiris-Sektor herrschen weiterhin Unruhen«, sagte die Sprecherin. »Mehrere Welten, die auf Föderationsunterstützung durch neutrale, nichtstaatliche Einrichtungen angewiesen sind, stehen nun allein da, nachdem die Sternenflotte und die Föderation ihre Aufmerksamkeit auf die sich rapide verschlechternde Krise auf Romulus richten. Zahlreiche skrupellose Parteien beginnen damit, den plötzlichen Abzug der Sternenflotte und Föderation aus dem Sektor zu nutzen, was zu einer Angst vor einem Bürgerkrieg führt.«
Die Sprecherin fuhr fort, doch Seven konnte das Holovideo nicht länger hören, da ihre Kollegen aufgeregt die Nachricht kommentierten.
»Angst vor einem Bürgerkrieg? Dafür ist es wohl ein bisschen zu spät.«
»Ich habe gehört, dass ein Warlord vorhat, dort alles an sich zu reißen.«
»Was geht es mich an, wenn sich ein Haufen Niemande gegenseitig in die Luft jagen will?«
»Das wahre Problem ist die Schmuggelei. Und die Verschleppung von Leuten.«
»Die Fenris-Ranger werden dem schon schnell ein Ende bereiten.«
»Die Fenris-Ranger? Das ist doch nur ein Haufen verdammter Vigilanten.«
»Sagt wer? Die Föderationsregierung? Was sollen sie denn sonst sagen?«
»Wenn mich die Ranger beeindrucken wollen, müssen sie einen Weg finden, die Preistreiberei unter Kontrolle zu bekommen. Wisst ihr, wie viel man inzwischen für raffiniertes Deuterium bekommt? Mit einem Tankerschiff könnten wir ein Vermögen machen.«
»Und an wen sollten wir es verkaufen? Da draußen hat doch niemand mehr Geld.«
»Weil alle arbeitslos sind. Alles, was sie tun, ist protestieren. Schimpfen und sich beschweren. Heult doch. Ich schufte mir auf diesem Scheißplaneten den Arsch ab und ich protestiere nicht.«
»Du weißt doch nicht mal, wie man protestieren schreibt.«
Da es so aussah, als würden als Nächstes die Fäuste sprechen, nahm Seven das als Zeichen, sich zurückzuziehen. Sie wollte nicht ihren Job riskieren, weil sie auf einer Laderampe in eine Schlägerei verwickelt worden war. Genauso wenig wie sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, indem sie über interstellare Politik, die romulanische Krise, die Fenris-Ranger oder sonst etwas Kontroverses sprach.
Sie hatte sich abgewöhnt, sich um solche Dinge zu kümmern.
Seven wollte einfach nur ihren Job machen.
Und in Ruhe gelassen werden.
Eiskaltes Wasser strömte aus dem Hahn in Sevens hohle Hände. Früher hatte sie Kälte nichts abgewinnen können, aber das war vor ihrer Arbeit als Mensch in einer völlig überhitzten Fabrik gewesen. Nach zehn Stunden am Fließband mit nur wenigen kurzen Pausen kam sie völlig verschwitzt und dreckig nach Hause. Das Einzige, was half, um sie aus dieser Erstarrung zu holen, war eiskaltes Wasser, das sie sich ins Gesicht spritzte.
Seven füllte ihre Hände erneut. Jedes Mal fühlte sich so gut an wie das davor. Es war unglaublich erfrischend.
Über die lauwarme Dusche in ihrer Wohnung konnte sie das dagegen nicht sagen. Der Wasserdruck war schwach und die Kabine war schlecht beleuchtet und roch nach Schimmel. Und sobald das Wasser lief, drang ein noch schlimmerer Gestank aus dem Abfluss. Die Stadt hatte keine nennenswerte Verwaltung, also hatte Seven selbst nach monatelangen Nachfragen keine Erklärung für den Geruch bekommen. Die naheliegendste Erklärung war, dass etwas im Abwasserkanal gestorben sein musste. Nicht dass es irgendjemanden zu interessieren schien.
Der Rest ihrer Wohnung bestand aus ein paar kleinen Räumen mit Blick auf eine schmale Gasse und einem Wasserfleck an der Decke, weil das Dach undicht war. Ihre Videoeinheit konnte dank des planetaren Satellitennetzwerks mit Tausenden von Kanälen voller Ablenkung aufwarten und die ersten paar Monate im Exil hatte Seven damit verbracht, alle möglichen populären Medien zu verschlingen, von bunt gemischten Musikgenres bis hin zu Dramen, Komödien, Thrillern und allem möglichen anderen – darunter auch ein paar, die sie lieber vergessen würde. Die Unterhaltungsmöglichkeiten hier waren deutlich vielfältiger als zu ihrer Zeit auf der Voyager, doch ohne den Vorteil der kulturellen Erkenntnisse ihrer Freunde kam es ihr vor, als würde sie nur die Hälfte verstehen.
Sie bürstete ihre langen blonden Haare, während sie in den gesprungenen Wandspiegel ihres Schlafzimmers blickte. Werde ich mich jemals irgendwo zu Hause fühlen? Ich komme mir immer vor, als wüsste ich nicht, was los ist.
Einsamkeit und Frust folgten ihr überallhin. Prägten jedes ihrer Worte, jede ihrer Taten. Je länger sie auf ihr lasteten, desto mehr näherte sie sich noch dunkleren Emotionen. Neid. Wut. Verbitterung.
Sie schloss die Augen und schob diese Gefühle weit von sich. Hör auf, dich hineinzusteigern. Sei hier. Atme einfach.
Es war der Beginn eines Wochenendes und Seven hatte vor, sich unters Volk zu mischen. Weil das oft mit übertriebenen Mengen alkoholischer Getränke einherging, hatte sie gelernt, wie wichtig es war, etwas zu essen, bevor man ausging. Leider hatte der launische alte Replikator ihrer Wohnung ausgerechnet heute entschieden, Zicken zu machen.
»Computer: Gemüselasagne, Rezept Seven-Alpha, einhundertfünfzig Gramm, Serviertemperatur warm.«
Mit einem Wirbel aus schimmernden Partikeln und einem angenehm melodischen Geräusch lieferte der Replikator eine kochend heiße Schale mit scharf riechendem Kimchi, in dem genug rote Chilischoten waren, um Seven das restliche Wochenende kotzen zu lassen.
»Computer: Eine Portion Maissuppe, ohne Milchprodukte, fünfundfünfzig Grad, mit einer Scheibe warmem Maisbrot, hundert Gramm.«
Ein weiterer Partikelwirbel produzierte lediglich eine zweite Schüssel Todeskimchi.
»Computer: Produziere irgendein anderes vegetarisches Hauptgericht außer Kimchi.«
Die Einheit zirpte, summte und brummte ein paar Sekunden. Dann erschien eine weitere Wolke aus energetisierter Materie …
Und wurde erneut zu Kimchi.
Seven nahm alle drei Schüsseln mit nach draußen, als sie ihre Wohnung verließ. Vor der Tür entsorgte sie das Kimchi in einem Gestrüpp. Sie war fest davon überzeugt, dass es morgen abgestorben sein würde.
Nachts allein auf den Straßen fühlte sie sich verletzlich. Es spielte keine Rolle, dass sie stärker, schneller und belastbarer war als die meisten Humanoiden, die ihr begegneten. Sie fürchtete sich vor einer Begegnung mit mehreren von ihnen auf einmal. In der Unterzahl und umzingelt wäre sie ebenso wehrlos wie jeder andere. Und sie hatte durch bittere Erfahrungen gelernt, dass viele Leute in der Föderation und den angrenzenden galaktischen Mächten es als gerechtfertigt ansahen, sie anzugreifen.
Wegen dieser verdammten Implantate.
Es war das Verlangen, ihre Modifizierungen so gut wie möglich zu verstecken, das sie dazu gebracht hatte, sich die Haare wachsen zu lassen. Doch das war nicht genug, nicht wenn ihr eine steife Brise in einer regnerischen Nacht die Haare aus dem Gesicht wehen und ihr Okularimplantat enthüllen könnte. Seven war dazu übergegangen, Jacken mit großen Kapuzen zu tragen, am liebsten aus schwerem Stoff oder Kunstleder, und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, während sie sich ihren Weg durch die schmutzigen Straßen von Starheim bahnte.
Seven hasste es, sich wegen ihrer Implantate so unsicher zu fühlen. Sie waren der Grund, warum sie sich in so vielen Umgebungen wie eine Ausgestoßene oder eine Kriminelle vorkam. Etwas, das sie vor ihrer Ankunft in der Föderation niemals empfunden hatte. Ihre Kollegen an Bord der Voyager hatten sich stets so verhalten, dass sie sich nicht dafür hatte schämen müssen, wer sie war. Auch ihre verbliebenen Körpermodifikationen und Nanosonden hatten nie ein Problem dargestellt. Sie wusste, dass sie das Captain Janeway zu verdanken hatte, die Seven mit unerwarteter Offenheit und Vertrauen willkommen geheißen hatte. Auch wenn Janeways Vertrauen zu Seven durch ein paar Krisen während ihrer frühen Jahre zusammen durchaus auf die Probe gestellt worden war, hatte ihre unerschütterliche Unterstützung den Ton für die Mannschaft der Voyager vorgegeben – und damit auch für Sevens neues Leben.
Ich wünschte, ich könnte jetzt bei ihnen sein. Ich hätte nie gedacht, wie sehr ich sie vermissen würde, bevor wir alle getrennte Wege gegangen sind. Ich habe nicht erkannt, wie sehr ich sie als selbstverständlich angesehen habe, wie sehr sie mich unterstützt haben, einfach nur, indem sie für mich da waren.
Ein »emotionales Sicherheitsnetz« – so hatte der Doktor, das Medizinisch-Holografische Notfallprogramm der Voyager, die Unterstützung der Mannschaft für Seven während der frühen Jahre ihres Wandels von einer verlassenen Borg-Drohne zurück zu einem Menschen genannt. Es war eine Metamorphose, die sie nach wie vor nicht für abgeschlossen hielt. Es war eine grausame Ironie, dass sie dieses Sicherheitsnetz weggeworfen hatte, bevor sie es am meisten gebraucht hätte. Allein zu leben hatte neue, unbekannte Gefühle in Seven heraufbeschworen und nun kämpfte sie damit, ihre vielen widersprüchlichen Wünsche zu verstehen.
Glück und Vorsicht brachten Seven sicher zum Eingang eines schäbigen Nachtclubs namens Monsoon. Sie hatte bereits viele andere Etablissements in Starheim ausprobiert, das etwas für jeden Geschmack und jedes Klientel zu bieten hatte. Das Monsoon war eine Eckkneipe, die bei den queeren und trans Einwohnern der Stadt beliebt war, nicht zuletzt wegen der schnellen, lauten und wütenden Musik. Von allen Bars, die Seven bisher ausprobiert hatte, war dies diejenige, in der sie sich am meisten wie sie selbst fühlte.
Sie bezahlte den Eintritt und die Türsteherin, eine riesige Balduk namens Gurkha, begrüßte Seven mit einem Nicken, während sie ihr die Tür öffnete.
Sobald sie drinnen war, riss die Musik Seven mit wie eine Welle. Sie bahnte sich ihren Weg zur Theke. Mittels Handzeichen, die sie sich durch systematisches Ausprobieren erarbeitet hatte, bestellte sie einen Whisky pur, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die Band auf der Bühne. Es war ein Neopunk-Quartett namens Amyl’s Night Rate: ein riesiger zotteliger Drummer einer unbekannten Spezies, ein Mensch mit Bart und jeder Menge Tätowierungen, der eine gewaltige E-Gitarre spielte, eine junge Tiburonierin, die ihren Bass so heftig und laut bearbeitete, dass man ihn im Brustkorb spürte, und eine kleine wilde Orionierin mit raspelkurzen platinblonden Haaren, deren Banshee-Geschrei in den Ohren wehtat.
Der Barkeeper servierte Seven ihren Drink. Sie bezahlte mit einem Creditchip, leerte die süße Wärme des Bourbon auf ex und begab sich dann in den Moshpit vor der Bühne.
Das war es, wofür sie lebte und worauf sie sich die ganze Woche lang freute: Dampf abzulassen, ihre Wut und Einsamkeit durch wildes Pogen loszuwerden. Körper stießen gegeneinander, getrieben von der Musik, und verloren sich in einem Strudel aus Fleisch und Knochen.
Seven hatte es beim ersten Mal ziemlich einschüchternd gefunden, doch schließlich hatte sie die Wahrheit erkannt, die sich hinter der vermeintlichen Gewalt verbarg. Niemand war im Moshpit, um andere zu verletzen. Sie alle waren hungrig nach Kontakt, nach einer Verbindung, nach dem Gefühl, zu etwas Größerem zu gehören. Und die Mosher schützten einander auf eine Weise, die Außenstehende normalerweise nicht sehen konnten. Wenn jemand fiel, zogen ihn die anderen wieder auf die Beine. Paare oder Gruppen hielten sich oft aneinander fest und drehten sich im Kreis. Es ging nicht um Konkurrenz. Nicht um Besitzansprüche. Es war gemeinschaftlich. Auf Uneingeweihte wirkte es chaotisch und gefährlich, aber die Mosher fühlten sich in der Gemeinschaft sicher. Es war wie eine große Umarmung gleichgesinnter Seelen.
Während Seven losließ, mit anderen zusammenstieß und herumwirbelte, fühlte sie sich so sicher … wie sie es einst im Kollektiv getan hatte. Vielleicht würde ihr ehemaliger Therapeut auf der Erde dieses Verhalten einen Rückfall oder Selbstverletzung nennen. Doch für Seven war es das Einzige, wodurch sie sich noch einigermaßen glücklich fühlte.
Aber selbst im wilden Durcheinander des Moshpits fühlte sich Seven allein. Abgeschnitten. Einsam. Sie sah im Monsoon so viele andere Partner finden – an der Theke, auf der Tanzfläche oder in einer der Sitzecken –, aber die Kunst des Flirtens entzog sich ihr. Es war, als beherrschten alle um sie herum eine Sprache, die ihr nie beigebracht worden war.
Sie war selten nah genug dran, um zu hören, was andere sagten, um das Gespräch in eine romantische Richtung zu lenken, und sie hatte keine Ahnung, wie sie sich in dieser Umgebung oder irgendeiner anderen vorstellen sollte. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie gemeint hatte, dass jemand mit ihr flirtete, war sie sofort nervös oder misstrauisch geworden. Und weder ihre kurze Romanze mit dem teilweise befreiten Borg Axum im künstlichen Reich der Unimatrix Zero noch ihre kurzlebige und letztendlich von ihr selbst sabotierte Beziehung mit Chakotay hatte sie in irgendeiner Form darauf vorbereitet, als queere Erwachsene zu daten.
Sie wollte sich gerade aus dem Moshpit zurückziehen, als sie die zaghafte Berührung einer weichen Hand im Nacken spürte. Sie landete wie eine Feder auf Schnee, sanft genug, um sie nicht zu beunruhigen.
Seven bewegte sich mit der Musik, achtete aber darauf, den unerwarteten Kontakt aufrechtzuerhalten. Sie drehte sich um und sah eine große junge Andorianerin. Sie trug ihre weißen Haare auf der rechten Seite kurz rasiert, was die blaue Haut durchscheinen ließ, und die andere Seite war zu einer wilden Welle aus Petrolblau, Weiß, Smaragdgrün und Orange frisiert. Sie war spärlich bekleidet, mit stylischen Rissen an den richtigen Stellen, und wie Seven trug auch sie kniehohe Stiefel, die sowohl praktisch als auch schmeichelhaft waren.
Seven kopierte die Geste der Fremden und legte ihre rechte Hand in den Nacken der Andorianerin. Dann drehten sie sich in immer engeren Kreisen, während sich ihre Anziehung fast magisch anfühlte. Seven begann, auf die Unausweichlichkeit einer Verschmelzung zu hoffen. Einer Vereinigung.
Der Song endete, als sie schwitzend und außer Atem zu einer intimen Umarmung zusammenkamen. Die zarten Fühler der Andorianerin zuckten, während sie Seven ein Lächeln schenkte.
Ohne groß darüber nachzudenken, gab ihr Seven einen Kuss. Sie wusste nicht, was sie zu erwarten hatte. Würde die andere Frau sie wegstoßen? Hatte sie den Moment falsch gedeutet?
Die Andorianerin öffnete ihren Mund und ihre Zungen begannen einander zu umspielen.
Das nächste Lied begann und der Moshpit setzte sich wieder in Bewegung. Seven und die hübsche junge Andorianerin blieben stehen, sahen sich tief in die Augen und ließen den Sturm um sich herum toben.
Dann nahm die Fremde Sevens Hand und führte sie von der Tanzfläche. Aus der Bar.
Sie betraten die Straße, die im Gegensatz zum Club unheimlich still war.
Die Andorianerin drückte ihr Gesicht an Sevens Hals. »Ich wohne in der Nähe des Jofur Parks. Und du?«
Als Seven klar wurde, dass die Frau sie danach fragte, in welchem Viertel von Starheim sie lebte, antwortete sie schnell: »Fafnir Heights.«
»Du wohnst näher.« Ein weiteres blendend weißes Lächeln. »Gehen wir zu dir.«
Seven erwachte aus einem unruhigen, immer wieder unterbrochenen Schlaf. Licht drang durch die verbogenen und fehlenden Lamellen ihrer Jalousien. Obwohl es wie üblich ein trüber und grauer Tag zu werden versprach, tat Seven das Licht in den müden Augen weh und verstärkte das Dröhnen in ihrem verkaterten Schädel.
Sie lauschte nach dem Atmen der Andorianerin, hörte aber nur Stille. Langsam drehte sich Seven um, bis sie genug von ihrer Wohnung sah, um zu wissen, dass sie allein war. Die Kleidung der Frau war weg. Abgesehen von ein paar blauen Haaren auf den Kissen war kein Hinweis mehr zu entdecken, dass die Andorianerin jemals hier gewesen war.
Vielleicht war es besser so. Wie so oft im vergangenen Jahr überwältigten ihre Emotionen sie mit widersprüchlichen Reaktionen. Sie fühlte sich durch den klammheimlichen Abgang der Frau betrogen, war aber auch erleichtert, nun keine gezwungenen Gespräche mit einer Fremden führen zu müssen. Es war angenehm, in ihrer vertrauten Umgebung aufzuwachen, aber auch ein Fluch, es erneut allein zu tun.
Die peinlichen Details ihrer intimen Begegnung verfolgten sie. Ihr unbeholfenes Grapschen, ihre Körper in der Dunkelheit, die Versuche der Andorianerin, Seven verbal durch die grundlegenden Elemente des erotischen Vorspiels zu lotsen. So oft hatte sich Seven ausgemalt, wie elegant eine solche Liaison sein würde, wie erhaben sie sich anfühlen musste. Stattdessen konnte sie nun lediglich daran denken, wie ungeschickt sie sich angestellt hatte. Nackt in den Armen einer anderen Frau, hatte sich Seven unbeholfen und gehemmt gefühlt. Sie hatte sich viel zu sehr darauf konzentriert, was sie sagen und tun sollte, um sich gehen zu lassen und einfach den Moment zu genießen. Selbst mehrere Runden alkoholischer Drinks hatten die fehlende Chemie der beiden nicht ausgleichen können.
Seven verzog peinlich berührt und voller Selbsthass das Gesicht.
Ich bezweifle, dass eine von uns letzte Nacht wirklich genossen hat. Sie war so schön. Ich konnte einfach nicht fassen, dass sie mich wollte. Und dann habe ich es völlig verdorben. Selbst nachdem sie mir gesagt hat, ich solle einfach nur daliegen und es genießen, konnte ich einfach nicht stillhalten. Was ist nur los mit mir?
Sie versuchte, sich vorzustellen, wie ihr Abend aus der Perspektive der anderen Frau ausgesehen hatte. Es hieß, einige Andorianer verfügten über telepathische, vielleicht sogar empathische Fähigkeiten.
Nicht dass sie die gebraucht hätte, um meine Angst vor Intimität zu erkennen. Ich habe nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Oder versucht, ihr meinen zu sagen. Ich mag mir die Standpauke nicht mal ausmalen, die ich vom Doktor oder Janeway bekommen würde, wenn sie mich jetzt sehen könnten.
Es war über sieben Jahre her, dass Seven gewaltsam vom Borg-Kollektiv getrennt worden war, während sie sich als seine Repräsentantin an Bord des Raumschiffs Voyager im Delta-Quadranten befunden hatte. Seit jenem schicksalhaften Tag sehnte sie sich mehr als alles andere nach einem Gefühl der Zugehörigkeit, das sich mit dem messen konnte, das sie als Drohne im Kollektiv erfahren hatte. Trotz ihres Verlangens nach einer echten Verbindung mit jemandem oder etwas blieben ihr viele der Subtilitäten und Widersprüche intimer Beziehungen von Individuen fremd. Wo sie nach Intimität suchte, fand sie nichts als Isolation. Und diese neueste Erfahrung sorgte dafür, dass sie sich isolierter als je zuvor fühlte, allein gelassen mit einer schmerzenden Leere, die sie nicht zu füllen vermochte.
Ich dachte, es würde sich regelrecht spirituell anfühlen. Stattdessen kommt es mir nur … billig vor.
Mühsam stand Seven auf. Ihre Kopfschmerzen protestierten, aber sie zwang sich, trotz der Qualen unter die Dusche zu torkeln. Meistens waren die verbliebenen Borg-Nanosonden in der Lage, die schlimmsten Symptome eines Katers zu verhindern.
Doch diesmal hatte sie nicht so viel Glück. Was auch immer die Andorianerin und sie getrunken hatten, um ihre Nervosität zu überwinden, hatte sich als stärker – um nicht zu sagen, toxischer – erwiesen als die üblichen Drinks. Ihr Hirn dröhnte nicht nur, sondern fühlte sich auch heiß an, als würde es langsam von einem Plasmabohrer gekocht werden.
Sie steckte den Kopf in die Duschkabine und stellte das Wasser an. Ein eiskalter Strahl landete auf ihrem Kopf und Nacken. Sich vorzustellen, wie das kalte Wasser die überschüssige Hitze aus ihrem Schädel zog, sorgte sofort dafür, dass das Hämmern nachließ. Es war nicht das ultimative Katermittel, aber es war ein Anfang.
Ohne sich abzutrocknen, sammelte Seven ihre Kleidung vom Vorabend zusammen, da sie vorhatte, sie erneut zu tragen. Eine kurze Durchsuchung des Zimmers förderte alle Bestandteile ihres hastig ausgezogenen Outfits zu Tage, bis auf ein kleines Teil. Alles andere war auf dem Boden oder den Möbeln gelandet, nur ihr Slip war nirgendwo zu entdecken.
Nach einem Moment kam Seven zur einzig richtigen Schlussfolgerung: Die Andorianerin musste ihn mitgenommen haben. Da die Fremde ihre eigene Unterwäsche nicht zurückgelassen hatte, handelte es sich eindeutig nicht um eine Verwechslung. Die Frau hatte Sevens Slip absichtlich mitgenommen. Als Trophäe ihrer Eroberung. Die Vorstellung ließ Seven lächeln.
Vielleicht war ich doch nicht so schlecht, wie ich dachte.
Sie holte sich ein frisches Exemplar aus ihrer Kommode und zog sich schnell an, um der nächsten Phase ihres Katers zuvorzukommen. Denn diese baute sich langsam auf, wie eine Welle, die an Wucht zunahm, während sie sich dem Strand näherte.
Vor ihrem Replikator holte Seven Tabletten gegen Kopfschmerzen sowie Sodbrennen aus einem Küchenschrank und stellte alles auf die Arbeitsfläche. Dann zerstieß sie die erforderlichen Mengen Tabletten mit dem Griff eines Messers zu einem Pulver, das sie in einen Becher Raktajino vom Vortag gab. Sie rührte um, bis sich das Pulver restlos aufgelöst hatte, und kippte die bittere Mischung hinunter.
Dann wischte sie sich koffeinierten Schaum vom Mund. Wie hat Tom Paris dieses Getränk noch gleich immer genannt? Ach ja … »Frühstück für Champions«.
Der Trick bestand darin, so hatte ihr Tom versichert, nach dem Trinken viele Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, »damit der Magen etwas hat, an dem er sich festhalten kann«.
Sie schaltete ihren Replikator ein. »Pancakes, drei Stück, heiß, mit Butter und Sirup.«
Im Ausgabefach des Replikators erwachten mit einem atonalen elektronischen Wimmern schimmernde Partikel zum Leben. Innerhalb von Sekunden verfestigte sich der Miniatursturm … zu einer Schüssel mit Kimchi, das so beißend roch, dass es Seven die Tränen in die Augen trieb.
Plötzlich entstand eine Stichflamme und die vordere Klappe des Replikators begann zu schmelzen. Rauch drang aus dem Gerät, zusammen mit dem Gestank verbrannter isolinearer Chips. Und dennoch roch es immer noch besser als die Portion Kimchi.
Seven seufzte resigniert, schnappte sich ihren Ausweis und verließ die Wohnung auf der Suche nach Frühstück. Und einem neuen Replikator.
Es hatte damals wie eine Lüge geklungen, und Seven war immer noch nicht sicher, ob sie es glauben sollte, aber vor vielen Jahren hatte ihr ein Talaxianer namens Neelix an Bord der Voyager erzählt, dass die besten Mahlzeiten immer in den heruntergekommensten Läden zu finden seien.
Bislang hatten die meisten schäbigen Imbisse dieses Versprechen nicht einlösen können, doch nachdem sie sich vom Art-Deco-Stil des Starheim Diners angesprochen gefühlt hatte, war sie von der schlichten Perfektion der kurzen Speisekarte angenehm überrascht worden, auf der unter anderem ein ganztägiges Frühstück angepriesen wurde. Viele Details ihrer Kindheit als Annika Hansen waren verschwunden, doch sie erinnerte sich dunkel daran, dass sie Frühstücksgerichte zum Abendessen geliebt hatte.
Wie seltsam, welche Dinge uns glücklich machen. Selbst wenn wir gar nicht wissen, warum.
Sie saß allein am Tresen und genoss den Rest ihres French Toasts. Es war eine spontane Wahl gewesen, nachdem sie das Gericht auf dem Teller eines anderen Gasts gesehen hatte. Sie nutzte das letzte Stück, um den Ahornsirup von ihrem ovalen blauen Teller aufzusaugen. Die süße Mischung von Aromen entzückte sie: Vanille, Zimt und Muskat waren subtil, wurden aber nicht vom Sirup überlagert. Es schmeckte so gut, dass es ihr fast nichts ausmachte, an ihrem freien Tag so früh wach zu sein.
Die Bedienung, ein grauhaariger Tellarit mit runder Brille, blieb auf dem Weg zur Küche stehen. »Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen, Miss?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, danke.«
Er lächelte, nickte und ging weiter.
Seven suchte in ihrer Tasche nach einem Creditchip, um das Essen zu bezahlen. Und sie suchte immer noch, als ein attraktiver Mensch in dunklem Anzug das Diner betrat. Er war um die vierzig, hatte schwarze Haare und war frisch rasiert. Zu ihrer Überraschung setzte sich der Neuankömmling, ungeachtet sozialer Normen, auf den freien Platz direkt neben ihr. Er begrüßte Seven, als würde er sie kennen. »Guten Morgen.«
Sie lehnte sich ein wenig zurück und starrte ihn misstrauisch an. »Wenn Sie das sagen.« Endlich fand sie einen Creditchip, um die Rechnung zu begleichen, legte ihn auf den Tresen und wollte gerade aufstehen, als der Fremde erneut sprach.
»Mein Name ist Arastoo Mardani.«
»Ich habe weder gefragt noch interessiert es mich.«
»Das sollte es aber, Miss Hansen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, alles zu bekommen, was Sie jemals wollten.«
Ihre Augen verengten sich. Woher kannte er ihren alten Namen?
Mardani schien ihre Reaktion erwartet zu haben, denn er fuhr fort: »Ihre Sternenflottenakte ist faszinierend. Selbst die zensierte Version, die man uns beim FSD lesen lässt.«
Seven war immer noch vorsichtig, aber auch neugierig. »FSD? Föderationssicherheitsdienst?«
Mardani griff in seine Jacketttasche und zog seine Dienstmarke heraus, die in einer Kunstlederhülle zum Aufklappen steckte. »Korrekt.« Er steckte den Ausweis wieder ein und musterte die Speisekarte an der Wand hinter dem Tresen. »Was ist denn gut hier?«
»Sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.«
Sie wusste, dass es ein Risiko war, Mardani vor den Kopf zu stoßen. Der Föderationssicherheitsdienst war die zivile Spionageabwehr und das Exekutivorgan für interstellare Gerichtsbarkeit. Sein Arm war lang und seine Agenten hatten den Ruf, sehr ausdauernd und gründlich zu sein. Dennoch war Seven nicht in der Stimmung, sich herumschubsen oder einschüchtern zu lassen, weder von Mardani noch von sonst jemandem.
Er setzte ein wohlwollendes Lächeln auf. »Fangen wir noch mal von vorn an. Entschuldigen Sie, Miss? Es tut mir leid, Sie beim Frühstück zu stören, aber ich bin hier, um Ihnen ein großzügiges Angebot zu machen. Eins, das Sie sich garantiert anhören wollen.«
Sie drehte ihren Barhocker herum, sodass sie ihn direkt ansah. »Ich höre.«
»Es war ein Fehler von der Sternenflotte, Sie abzuweisen. Man konnte nicht über ein paar restliche Borg-Implantate hinwegsehen, um zu erkennen, was für ein erstaunlicher Mensch Sie sind.«
»Ich werde mich nicht dem FSD anschließen.«
»Das will auch keiner.« Sein Tonfall wurde geschäftlich. »Ich bin nicht auf der Suche nach einem neuen Agenten. Was ich brauche, ist ein neuer inoffizieller Mitarbeiter.«
»Ein Spion.«
»Ein heimlicher Helfer.«
»Nein, danke.« Seven machte Anstalten aufzustehen.
Mardani bedeutete ihr zu bleiben. »Bitte. Hören Sie mich an. Niemand will, dass Sie etwas Illegales tun. Sie sollen lediglich beobachten und berichten. Informationen sammeln und sie an mich weitergeben. Und auch nicht lange. Vielleicht ein paar Wochen. Höchstens ein, zwei Monate.«
»Was ist für mich dabei drin?«
»Wenn Sie uns helfen, die Informationen zu bekommen, die wir brauchen, werden wir Ihre Föderationszugehörigkeit erneuern und ein paar Strippen ziehen, um Sie wieder an Bord eines Raumschiffs zu bekommen. Mit ein wenig Glück sollten Sie Ende des Jahres bereits als Offizierin eines großen Schiffs dienen.«
Das Angebot war verlockender, als Seven erwartet hatte. Mardani und seine Vorgesetzten hatten offensichtlich ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wussten, wo ihre emotionalen Schwachstellen lagen und wie man sie in Versuchung führte. Dennoch kam Seven irgendetwas an Mardanis Angebot seltsam vor. Und sie würde jetzt gleich erfahren, was genau das war. »Was für Informationen?«
Mardani atmete tief ein, als müsste er seinen Mut zusammennehmen. Er klang ein wenig zögerlich, als er schließlich sprach. »Sie sollen für uns die Fenris-Ranger infiltrieren und uns detaillierte Informationen zu ihrer Einsatzstärke und taktischen Fähigkeiten beschaffen.«
Seven stand auf und schüttete den Rest ihres Raktajinos in Mardanis Schoss. Dann stellte sie den Becher wieder auf den Tresen und starrte ihn unverwandt an. »Nein.«
Anschließend verließ sie das Diner, ohne sich auch nur noch einmal umzudrehen, denn er und sein Angebot waren ihr vollkommen egal.