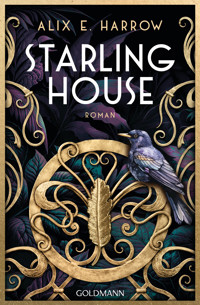
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Auf die junge Opal übt Starling House eine seltsame Faszination aus. Das verwunschene Anwesen am Rande der Kleinstadt Eden, Kentucky, gehörte im 19. Jahrhundert der Autorin des Romans »The Underland«. Als Kind hatte sich Opal in die Geschichte dieses Buchs geflüchtet, nun ist es das verfallende Gebäude selbst, das ihr wie eine Zuflucht erscheint. In Wahrheit lebt sie mit ihrem Bruder Jasper in einem Motel und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Bis ihr Arthur Starling, der unnahbare Erbe von Starling House, eine Stelle anbietet. Opal nimmt das Angebot an, obwohl alle anderen Einwohner von Eden das Herrenhaus meiden. Albträume und Ungeheuer sollen das Gelände heimsuchen und ihren Ursprung in einer Vergangenheit haben, die wie ein Fluch auf der Stadt liegt ...
»Alix E. Harrow ist ein ganz außergewöhnliches Erzähltalent, und ›Starling House‹ ist die pure Lesefreude.« Olivie Blake
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Ähnliche
Buch
Am Ortsrand von Eden, Kentucky, steht ein einsames Haus. Die Einwohner meiden es, da es sie an die unrühmliche Vergangenheit ihrer Kleinstadt erinnert, und am liebsten würden sie Starling House und seinen letzten lebenden Erben, Arthur Starling, vergessen. Nur Opal, die mit ihrem Bruder in einem Motel am anderen Ende der Stadt lebt, zieht es immer wieder zu den schmiedeeisernen Toren des Anwesens. Dort trifft sie eines Abends auf Arthur, der ihr zu seiner eigenen Überraschung eine Stelle als Putzhilfe anbietet. Für Opal ist es eine Chance, ihrem Bruder ein Studium außerhalb ihres trostlosen Heimatortes zu finanzieren. Vor allem aber kann sie nun das Labyrinth des Herrenhauses erkunden, das sie so fasziniert. Bald fühlt sie sich in den verstaubten Räumen – und bei Arthur – seltsam zu Hause. Aber sie entdeckt auch, dass etwas Wahres an den Geschichten ist, die sich um das Grundstück ranken: Geschichten über seltsame Bestien, dunkle Kräfte und Realität gewordene Albträume. Zusammen mit Arthur muss sie tief in die Geschichte von Eden eintauchen, um herauszufinden, welche Geheimnisse unter Starling House begraben liegen …
Autorin
Alix E. Harrow, geboren in Kentucky, ist die New York Times-Bestsellerautorin von Romanen wie »Die zehntausend Türen« und zahlreichen Kurzgeschichten. Sie wurde mit dem Hugo Award und dem British Fantasy Award ausgezeichnet und für zahlreiche weitere Preise nominiert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Charlottesville, Virginia.
ALIX E. HARROW
Starling HOuse
ROman
Aus dem Englischen von Peter Beyer
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Starling House« bei Tom Doherty Associates / Tor Publishing Group.
Tor® is a registered trademark of Macmillan Publishing Group, LLC.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2024
Copyright © der Originalausgabe
2024 by Alix E. Harrow
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München,
published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Eva Wagner
AB · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32073-7V002
www.goldmann-verlag.de
Für meine Brüder
EINS
Ich träume manchmal von einem Haus, das ich noch nie gesehen habe.
Genauer gesagt: Kaum eine Menschenseele hat es je gesehen. Logan Caldwell behauptet zwar, er habe dort in den vergangenen Sommerferien einen Klingelstreich gemacht, aber er ist ein noch größeres Lügenmaul als ich. Es ist nämlich so, dass man das Haus von der Straße aus überhaupt nicht richtig sehen kann. Man erhascht nur einen Blick auf die Zähne des schmiedeeisernen Tors und die rote Auffahrt, die sich zum Haus hinaufzüngelt, und höchstens noch auf die von Geißblatt und Stechwinden fast vollständig überwucherten Kalksteinmauern. Selbst die historische Gedenktafel vor dem Haus ist halb verdeckt von Efeu und nicht gepflegt. Die Buchstaben sind mit Moos bewachsen und im Laufe der Jahre so unleserlich geworden, dass man nur noch die Überschrift entziffern kann:
STARLINGHOUSE
Doch im Winter, wenn es früher dunkel wird, kann man manchmal ein einzelnes beleuchtetes Fenster durch die Äste der Platanen schimmern sehen. Es ist ein seltsames, satt bernsteinfarbenes Licht, das im Wind zittert, ganz anders als das klare Licht einer Straßenlaterne oder das kränkliche Blau einer Leuchtstoffröhre.1 Ich schätze, aus diesem Fenster dringt das einzige Licht, das ich je gesehen habe, das nicht vom Kohlekraftwerk am Flussufer gespeist wird.
In meinem Traum leuchtet das Licht für mich.
Ich gehe durch das Tor die Auffahrt hinauf auf das Licht zu und schreite über die Türschwelle. Eigentlich sollte ich jetzt Angst haben – es gibt Geschichten über Starling House, die man sich spätabends raunend erzählt, begleitet vom Brummen der Verandalampe –, aber in dem Traum zögere ich nicht.
In dem Traum fühle ich mich zu Hause.
Offenbar ist das selbst für mein Unterbewusstsein zu sehr an den Haaren herbeigezogen, denn an diesem Punkt wache ich normalerweise immer auf und finde mich im Halbdunkel des Motelzimmers mit einem beißenden, hohlen Schmerz im Bauch wieder, von dem ich glaube, dass es Heimweh sein muss, obwohl ich es nicht wirklich wissen kann.
Dann starre ich an die Decke, bis die Parkplatzbeleuchtung im Morgengrauen erlischt.
Ich dachte immer, diese Träume hätten etwas zu bedeuten. Sie begannen unvermittelt, als ich zwölf oder dreizehn war und gerade alle Figuren aus den Büchern, die ich las, anfingen, magische Kräfte zu entwickeln oder verschlüsselte Botschaften zu empfangen oder so was Ähnliches. Natürlich war ich total fasziniert von ihnen.
Ich stellte jedem in der Stadt Fragen über Starling House, erntete jedoch nur kurze, schräge Blicke und missbilligende Äußerungen. Die Bewohner dieser Stadt haben mich nie besonders gemocht – ihre Blicke gleiten über mich hinweg, als wäre ich eine Bettlerin an der Straßenecke oder ein überfahrenes Tier, ein Problem, das sie angehen müssten, wenn sie sich genauer damit befassen würden –, aber die Starlings mochten sie noch weniger.
Sie sind als Exzentriker und Misanthropen verschrien, als Familie zweifelhafter Herkunft, die sich seit Generationen weigert, an den traditionellen Veranstaltungen der bürgerlichen Gesellschaft von Eden teilzunehmen (Kirche, Schule, Kuchenverkauf für die Freiwillige Feuerwehr). Stattdessen verkriechen sie sich lieber in diesem imposanten Haus, das außer dem Coroner noch nie jemand mit eigenen Augen von innen gesehen hat. Sie haben Geld – was in der Regel alles entschuldigt, mit Ausnahme von Mord –, aber ihr Geld geht weder auf Kohle noch auf Tabak zurück, und niemandem scheint es je zu gelingen, in das Vermögen einzuheiraten. Der Stammbaum der Starlings besteht aus einem wahnwitzigen Gewucher aus aufgepfropften Ästen und neuen Trieben, voller Auswärtiger und Fremder, die am Eingangstor auftauchten und den Namen Starling für sich beanspruchten, ohne auch nur einen Fuß in den Ort Eden selbst gesetzt zu haben.
Die meisten hier hätten es am liebsten, dass die ganze Sippe samt ihrem Haus in ein Senkloch stürzt und auf dessen Grund verrottet, ohne dass man sich jemals wieder an sie erinnert oder sie gar betrauert, und dass die Stadt damit – vielleicht – von ihrem jahrhundertelangen Fluch erlöst wird.
(Ich glaube zwar nicht an Flüche, aber wenn es so etwas wie eine verfluchte Stadt gäbe, würde sie Eden, Kentucky, sehr ähneln. Früher war die Stadt landesweit Nummer eins der Kohlereviere, heute jedoch ist hier nur noch ein im Tagebau ausgebeuteter Abschnitt des Flussufers mit einem Kraftwerk, einem Flugaschebecken und zwei Filialen von Dollar General. Eden ist einer dieser Orte, an dem nur die bleiben, die es sich nicht leisten können wegzuziehen – Orte, in denen das Wasser nach Rost schmeckt und der Nebel selbst im Sommer kalt vom Fluss aufsteigt und bis weit nach Mittag in den Niederungen herumwabert.)
Da mir niemand die Geschichte von Starling House erzählen wollte, habe ich meine eigene erfunden. In einer Stadt wie Eden hat man nicht viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, und ich hatte nicht viele Freunde in meinem Alter. Wenn du Klamotten aus der Kleiderkammer der First Christian Church trägst und deinen Schulbedarf im Laden klaust, wirst du nie eine große Fangemeinde haben, egal, wie aalglatt du lächelst. Die anderen Kinder spürten den Hunger hinter meinem Lächeln und mieden mich instinktiv, aus Furcht, dass man mich, falls wir alle zusammen Schiffbruch erleiden würden, sechs Wochen später retten würde, während ich gerade ihre Knochen abnage.
Daher verbrachte ich viele Wochenenden mit meinem kleinen Bruder im Schneidersitz auf der Matratze des Bettes im Motel und erfand Spukgeschichten, bis wir beide dermaßen verängstigt waren, dass wir schon losschrien, wenn drei Zimmer weiter auch nur ein Türknauf gedreht wurde. Die besten Geschichten schrieb ich in den stillen Stunden nach Mitternacht komplett auf, wenn Jasper schlief und Mom nicht da war, aber ich reichte sie nie irgendwo ein.2 Mit dem Schreiben habe ich sowieso schon vor Jahren aufgehört.
Mom habe ich mal von den Träumen erzählt. Sie lachte. »Wenn ich dieses verdammte Buch so oft gelesen hätte wie du, hätte ich auch Albträume.«
Zu meinem vierten oder fünften Geburtstag hatte mir Mom ein Exemplar von The Underland geschenkt – eine der alten Ausgaben aus dem neunzehnten Jahrhundert, mit einem Einband aus Leinen in der Farbe von Spinnweben und einem silbern bestickten Buchrücken. Es war gebraucht, wahrscheinlich gestohlen, und auf der Innenseite des Buchdeckels standen die Initialen seines früheren Besitzers. Ich habe es so oft gelesen, dass es irgendwann auseinanderfiel.
Die Geschichte ist ziemlich klischeehaft: Ein kleines Mädchen (Nora Lee) entdeckt eine andere Welt (Underland) und erlebt dort traumartige Abenteuer. Die Illustrationen sind auch nicht gerade umwerfend – eine Abfolge schlichter Lithografien, irgendwo zwischen unheimlich und albtraumhaft. Aber ich weiß noch, wie ich sie so lange angestarrt habe, dass ich noch lange ihre Nachbilder sah, wenn ich die Augen schloss – dunkle, von gespenstischen Kreaturen heimgesuchte Landschaften; blasse Gestalten, verirrt zwischen den knorrigen Bäumen; kleine Mädchen, die in geheime, unterirdische Kammern stürzen. Sie anzuschauen fühlte sich so an, als würde man in die Fantasiewelt eines anderen eintauchen – eines Menschen, der wie ich wusste, dass hinter jedem Lächeln scharfe Zähne lauern und dass unter dem schönen Schein der Welt blanke Knochen liegen.
Ich zeichnete gern mit der Fingerspitze den Namen der Autorin nach, malte ihn versonnen an die Ränder meiner mit C+ bewerteten Schulaufgaben: E. Starling.
Sie hat keine weiteren Bücher veröffentlicht, nie auch nur ein einziges Interview gegeben. Das Einzige, was sie außer The Underland hinterlassen hat, war eben dieses zwischen den Bäumen verborgene Haus. Vielleicht ist dies der eigentliche Grund, warum ich so besessen davon war. Ich wollte sehen, woher sie kam, mir beweisen, dass sie real war. Ich wollte durch das geheimnisvolle Gebäude wandeln, in dem sie gelebt hatte, mit den Fingern über ihre Tapeten streichen, ihre Vorhänge im Wind flattern sehen und einen Moment lang glauben, dass es ihr Geist war.
Es ist jetzt elf Jahre und vierundvierzig Tage her, seit ich dieses Buch zum letzten Mal aufgeschlagen habe. Ich war gerade von Moms Beerdigung nach Hause gekommen, warf es zusammen mit einer halben Packung Newports, einem vergammelten Traumfänger und einem Lippenstift in eine doppelwandige Einkaufstüte und schob alles tief unter mein Bett.
Ich wette, die Seiten sind mittlerweile aufgequollen und haben Stockflecken. In Eden verrottet mit der Zeit alles.
Manchmal träume ich immer noch von Starling House. Ich glaube aber nicht mehr, dass es etwas zu bedeuten hat. Und selbst wenn – ich bin eine Highschool-Abbrecherin mit einem Teilzeitjob bei Tractor Supply, schlechten Zähnen und einem Bruder, der etwas Besseres verdient hat als diese ausweglose, schicksalsgebeutelte Scheißstadt. Träume sind nichts für Leute wie mich.
Leute wie ich müssen zwei Listen erstellen: eine mit dem, was sie brauchen, und eine mit dem, was sie wollen. Wenn man clever ist, hält man die erste Liste kurz und verbrennt die zweite. Meine Mutter hat den Dreh nie rausgekriegt – bei ihr ging es immer um Wollen und Streben, Sehnen, Begehren und Verlangen, bis zu ihrem letzten Atemzug –, ich hingegen lernte schnell. Ich habe genau eine Liste, auf der genau eine Sache steht, und die hält mich genug auf Trab.
Es bedeutet, Doppelschichten zu schieben und Leute zu beklauen, Sozialarbeiterinnen in die Irre zu führen und Tiefkühlpizzas in der Mitte durchzuschneiden, damit sie in die Mikrowelle passen. Es bedeutet, billige Inhalatoren von dubiosen Websites zu besorgen und in langen Nächten dem Rasseln und Zischen von Jaspers Atemzügen zu lauschen.
Und dann gibt es da noch den cremefarbenen Briefumschlag, der von einer schicken Schule im Norden kam, nachdem Jasper seine PSAT-Prüfung für Stipendien gemacht hatte, und das Sparkonto, das ich einen Tag später eröffnete und das ich danach dank der zahlreichen Fähigkeiten, die ich meiner Mutter verdanke – Tricksereien, Diebstahl, Betrug, Charme, einen ebenso hartnäckigen wie völlig unangebrachten Optimismus – anwachsen lassen konnte. Was aber immer noch nicht reicht, um Jasper aus diesem Kaff zu befreien.
Ich denke, Träume sind wie streunende Katzen: Sie werden verschwinden, wenn ich ihnen keine Nahrung mehr gebe.
Also erfinde ich keine Geschichten mehr über Starling House und frage auch niemanden nach den seinen oder ihren. Ich bleibe nicht stehen, wenn ich an dem schmiedeeisernen Eingangstor vorbeikomme, und schaue auch nicht mit klopfendem Herzen hoch in der Hoffnung, einen Blick auf dieses einsame bernsteinfarbene Licht zu erhaschen, das aus einer größeren, merkwürdigeren Welt zu leuchten scheint, nur für mich. Ich ziehe die Einkaufstüte nie unter dem Bett hervor.
Aber manchmal, kurz vor dem Einschlafen, sehe ich die schwarzen Schatten von Bäumen an den Wänden des Motels emporkriechen, obwohl es vor dem Fenster nur Asphalt und Unkraut gibt. Ich spüre den heißen Atem von Bestien um mich herum, und ich folge ihnen hinunter, immer weiter hinunter, nach Underland.
1 Lyle Reynolds zufolge, dem Gasmann von Gravely Power von 1987 bis 2017, wurde Starling House nie an das Stromnetz oder die städtische Wasserversorgung angeschlossen. Die Telefongesellschaft klagte 1947 auf ihr Recht, Masten auf dem Starling-Grundstück aufzustellen, doch dieses Vorhaben wurde nach einer Reihe übler Unfälle, die drei Mitarbeiter ins Krankenhaus brachte, aufgegeben.
2 Dies entspricht nicht den Tatsachen. Zwischen 2006 und 2009 benutzte Opal den Drucker des Personals in der Stadtbücherei, um eine Reihe von Kurzgeschichten auszudrucken. 2008 erhielt sie eine persönliche Absage von einer Literaturzeitschrift, in der stand, dass sie, bedauerlicherweise, weder Fantasy noch Horror oder »was auch immer das sein soll« veröffentlichen würden.
ZWEI
Es ist ein Dienstagabend im Februar, der Himmel ist grau verhangen, und ich bin nach einem ziemlich beschissenen Tag auf dem Rückweg zum Motel.
Warum er so beschissen war, weiß ich gar nicht. Er war mehr oder weniger genau so wie die Tage davor und wie wahrscheinlich auch die folgenden sein würden – eine eigenschaftslose Ausdehnung von Stunden, unterbrochen von zwei langen Fußmärschen durch die Kälte vom Motel zur Arbeit und zurück. Es ist bloß so, dass ich acht volle Stunden lang mit Lacey Matthews Schicht schieben musste, einer totalen Langweilerin, und als die Kasse am Ende unserer Schicht nicht stimmte, bedachte mich der Filialleiter mit einem durchdringenden Ich-behalte-dich-im-Auge-Blick, als ob er glaubte, der Fehlbetrag ginge auf mich zurück. Was auch der Fall war. Es ist bloß so, dass es gestern geschneit hat und die kläglichen Reste sich als Schneematsch in den Rinnsteinen sammeln und durch die Löcher in den Sohlen meiner Turnschuhe dringen, und dass ich Jasper heute Morgen dazu gedrängt habe, den guten Mantel anzuziehen. Es ist bloß so, dass ich sechsundzwanzig Jahre alt bin und mir verdammt noch mal kein Auto leisten kann.
Ich hätte bei Lacey oder ihrem Cousin Lance, der nachts im Callcenter arbeitet, eine Mitfahrgelegenheit haben können. Aber Lacey hätte versucht mich zu bekehren, und Lance wäre auf der Cemetery Road rechts rangefahren, um nach dem obersten Knopf meiner Jeans zu langen. Wahrscheinlich hätte ich ihn gewähren lassen, weil es sich ziemlich gut angefühlt hätte und weil es zum Motel ja auch ein großer Umweg für ihn gewesen wäre. Aber später hätte ich dann seinen Geruch an meinem Hoodie wahrgenommen – einen unspezifischen, säuerlichen Geruch, wie ihn die gelben Seifenstücke in Tankstellentoiletten verströmen – und eine so tiefe, so vollkommen leere Apathie verspürt, dass ich versucht gewesen wäre, diese Einkaufstüte unter dem Bett hervorziehen, nur um mich zu vergewissern, dass ich überhaupt noch etwas empfinden kann.
Also gehe ich zu Fuß.
Es sind vier Meilen vom Tractor Supply bis zum Motel – dreieinhalb, wenn ich die Abkürzung hinter der Stadtbücherei entlang nehme und den Fluss auf der alten Eisenbahnbrücke überquere, was mich immer in eine seltsame, miese Stimmung versetzt.
Ich komme am Gelände des Trödelmarkts und am Wohnwagenpark vorbei, am zweiten Dollar General und an dem Mexikaner, der das alte Hardee’s-Gebäude übernommen hat, bevor ich dann von der Straße abbiege und den Bahngleisen auf das Gravely-Gelände folge. Nachts sieht das Kraftwerk beinah schön aus: eine große, golden schimmernde Stadt, so hell erleuchtet, dass sie den Himmel gelb färbt und lange Schatten wirft.
Die Straßenlaternen summen. Die Stare spotten. Der Fluss murmelt vor sich hin.
Die alte Eisenbahnbrücke wurde zwar schon vor Jahren gepflastert, aber ich balanciere gerne ganz am Rand entlang, dort, wo die Schwellen herausragen. Wenn man zwischen den Lücken hinabschaut, sieht man, wie der Mud River unten dahinrauscht, ein schwarzes Nichts. Also schaue ich lieber nach oben. Im Sommer sind die Uferböschungen so überwuchert mit Geißblatt und Kudzu, dass man nichts als Grün sieht, aber jetzt kann man die Geländekonturen ausmachen und den Aushub eines alten Minenschachts.
Ich habe ihn als ein weit geöffnetes, schwarzes, klaffendes Maul in Erinnerung. Doch die Stadt hat ihn mit Brettern vernageln lassen, nachdem sich ein paar Halbwüchsige bei einer Mutprobe an den Warnschildern vorbeigewagt hatten. Das war zwar vorher auch schon häufig passiert, aber an diesem Abend stieg der Nebel hoch – der Nebel in Eden kommt dicht und schnell und so schwer, dass man fast hören kann, wie er neben einem herwabert –, und einer von ihnen muss sich verirrt haben. Seine Leiche hat man nie gefunden.3
Der Fluss murmelt jetzt laut, es klingt sirenenartig lockend, und ich summe unwillkürlich mit. Die kalte Schwärze des Wassers unter mir verlockt mich nicht wirklich – Suizid ist wie die Hände in den Schoß zu legen, und so schnell gebe ich nicht auf. Aber ich weiß noch, wie es sich dort unten anfühlte zwischen den Knochen und den Fischen: so ruhig, so weit jenseits der zermürbenden Plackerei im täglichen Überlebenskampf.
Es ist bloß so, dass ich müde bin.
Bestimmt würde Mr Cole, der Highschool-Berufsberater, dies als »Krisensituation« bezeichnen, in der ich mich an mein »Unterstützernetzwerk« wenden sollte. Aber ich habe gar kein Unterstützernetzwerk. Ich habe Bev, Besitzerin und Managerin des Motels Garden of Eden, die sich dazu verpflichtet hat, uns mietfrei in Zimmer 12 wohnen zu lassen, weil sie einen dubiosen Deal mit Mom eingegangen ist, aber nicht auch noch dazu verpflichtet werden kann, damit glücklich zu sein. Und ich habe Charlotte, örtliche Bibliothekarin und Gründerin der Muhlenberg County Historical Society, die so nett war, mir kein Hausverbot zu erteilen, nachdem ich eine Adresse gefälscht hatte, um unrechtmäßig in den Besitz eines Bibliotheksausweises zu kommen, und einen Stapel ausgeliehener DVDs online verhökert habe. Stattdessen bat sie mich lediglich, es doch bitte nicht wieder zu tun, und reichte mir eine Tasse Kaffee, der so süß war, dass meine Zahnlöcher wehtaten. Ansonsten gibt es da nur noch die Teufelskatze – ein bösartiges dreifarbiges Tier, das unter dem Müllcontainer des Motels haust – und meinen Bruder.
Ich wünschte, ich könnte mit Mom reden. Ihre Ratschläge waren zwar Mist, aber ich bin jetzt längst erwachsen, und ich glaube, heute wäre es wie ein Gespräch unter Freundinnen.
Ich könnte ihr von der Stonewood Academy erzählen. Dass ich Jaspers Zeugnisse weitergeleitet und sämtliche Formulare ausgefüllt habe, und wie ich sie dann beschwatzt habe, ihm im nächsten Schuljahr einen Platz freizuhalten, wenn ich die Studiengebühren bis Ende Mai bezahle. Dass ich ihnen versicherte, dass dies kein Problem sein würde, und dabei ganz locker und lässig daherkam, so wie Mom es mir beigebracht hatte. Dass ich meine Ersparnisse in den nächsten drei Monaten vervierfachen muss, und zwar mit der Art von Mindestlohnjob, bei dem peinlich genau darauf geachtet wird, dass man unter dreißig Stunden pro Woche bleibt, damit sie einen nicht krankenversichern müssen.
Aber ich werde einen Weg finden, weil ich muss, und für das, was ich brauche, würde ich barfuß durch die Hölle gehen.
Meine kalten Hände sehen im Lichtschein des Handydisplays blau aus. Na du Penner, wie läuft’s mit der Textanalyse
super, schreibt Jasper zurück, gefolgt von einer offen gesagt verdächtig hohen Anzahl von Ausrufezeichen.
Ach ja? Und wie lautet deine These?
Ich bin nicht wirklich besorgt, denn mein kleiner Bruder verfügt über einen messerscharfen, glasklaren Verstand, mit dem er noch jeden Lehrer im öffentlichen Schulsystem um den kleinen Finger wickeln konnte, trotz dem, was sie von Jungen mit brauner Haut und Locken erwarten. Aber wenn ich ihn unter Druck setze, fühle ich mich besser. Schon murmelt der Fluss leiser in meinem Schädel.
Meine These ist dass ich mir vierzehn Marshmallows auf einmal in den Mund stecken kann und dass jeder in diesem Buch eine lange Sitzung mit Mr Cole nötig hat
Ich stelle mir Heathcliff vor, wie er auf einem der zu klein geratenen Plastikstühle des Beraters kauert, mit einer zerknitterten Broschüre über Aggressionsbewältigung in den Händen, und verspüre einen seltsamen Anflug von Mitleid. Mr Cole ist ein netter Mensch, aber er weiß nicht, was er mit Menschen anstellen soll, die auf der Schattenseite des Lebens ohne Regeln aufgewachsen sind, wo die Welt dunkel und gesetzlos ist und nur die Gerissenen und Brutalen überleben.
Jasper ist weder gerissen noch brutal, und das ist nur einer von ein paar hundert Gründen, warum ich ihn hier rausschaffen muss. Das rangiert gleich hinter der Luftqualität und den Konföderierten-Flaggen und dem Pech, das uns wie ein böser Hund dicht auf den Fersen ist. (Ich glaube nicht an Flüche, aber wenn es so etwas gibt wie eine verfluchte Familie, wäre sie der unseren sehr ähnlich.)
Das ist keine These. Meine Fingernägel bleiben an den Haarrissen hängen, die wie Spinnweben mein Display überziehen.
Tut mir leid, was hast du nochmal in der 10. Klasse in Englisch bekommen??
Mein Lachen hängt gespenstisch in der Luft. Ich habe die Fuck-You-Schule mit 4.0 abgeschlossen
Kleine Pause. Entspann dich. Morgen ist Jobmesse, niemand sammelt Aufsätze ein
Als ich noch in die Schule ging, verachtete ich die Jobmesse. Es gibt hier im Grunde gar keine Jobs, außer dem, im Kraftwerk Feinstaub einzuatmen, also gibt es auf dieser Jobbörse bloß einen AmeriCorps-Stand und jemanden von der Baptist Mission, der Flyer verteilt. Der Höhepunkt kommt am Ende, wenn Don Gravely, CEO von Gravely Power, die Bühne betritt und eine nervtötende Rede über harte Arbeit und den amerikanischen Geist hält, und dabei hat er jeden Cent von seinem großen Bruder geerbt. Wir mussten ihm alle die Hand schütteln, als wir der Reihe nach die Turnhalle verließen, und als er zu mir kam, zuckte er zusammen, als ob er fürchtete, Armut könnte ansteckend sein. Seine Hand fühlte sich an wie ein frisch gepelltes gekochtes Ei.
Wenn ich mir vorstelle, dass Jasper die feuchtkalte Hand von diesem Arschloch schüttelt, wird meine Haut heiß und fängt an zu jucken. Jasper muss sich weder irgendwelche schwachsinnigen Reden anhören noch irgendwelche Bewerbungsformulare mit nach Hause nehmen, denn Jasper wird nicht in Eden hängen bleiben.
Ich werde Miss Hudson anrufen und sagen, du hättest Fieber, scheiß auf die Jobmesse
Aber er antwortet: nee, passt schon
Es entsteht eine Pause, während der ich den Fluss hinter mir lasse und den kurvigen Weg bergauf gehe. Über mir hängen die Stromleitungen durch, und die Bäume drängen sich dicht an dicht, sodass sie den Blick auf die Sterne verdecken. In diesem Teil der Stadt leuchten keine Straßenlaternen.
wo bist du gerade? habe hunger
Jetzt laufe ich an einer Mauer entlang, die parallel zur Straße verläuft. Ihre Backsteine sind pockennarbig und porös, der Mörtel zerbröselt zwischen festgekrallten Trieben von Jungfernrebe und Giftsumach. komme gerade an Starling Haus vorbei
Jasper antwortet mit einem Smileygesicht, das eine einzelne Träne vergießt, und den Buchstaben RIP.
Ich sende ihm das Mittelfinger-Emoji und stecke das Handy wieder in die Tasche meines Hoodies.
Ich sollte schnell bei ihm sein. Ich sollte meinen Blick auf den aufgemalten weißen Mittelstreifen der Landstraße richten und meine Gedanken auf das Sparkonto für Jasper.
Aber ich bin müde, durchgefroren und auf eine Art und Weise erschöpft, die mir bis ins Mark dringt. Meine Füße erlahmen. Meine Augen schweifen nach oben und suchen zwischen den dunklen Bäumen nach einem bernsteinfarbenen Schimmer.
Und da ist er: ein einzelnes hohes Fenster, das golden in der Dämmerung leuchtet, wie ein Leuchtturm, der zu weit von der Küste entfernt steht.
Nur dass Leuchttürme einen eher warnen als dazu verlocken sollten, ihnen näher zu kommen. Ich hüpfe über den Gully am Straßenrand und fahre mit der Hand an der Mauer entlang, bis der Backstein kaltem Eisen weicht.
Das Tor von Starling House sieht von Weitem nach nichts Besonderem aus – nur ein dichtes Gewirr aus Metall, halb zerfressen von Rost und überwuchert mit Efeu, verschlossen mit einem so großen Vorhängeschloss, dass es geradezu unhöflich wirkt. Aus der Nähe hingegen kann man einzelne Formen erkennen: Krallenfüße und Beine mit zu vielen Gelenken, geschuppte Rücken und Mäuler voller Zähne, Köpfe mit leeren Augenhöhlen. Ich habe gehört, dass die Leute diese Figuren als Teufel bezeichnen oder, noch vernichtender, als moderne Kunst, aber mich erinnern sie an die Bestien in The Underland, was eine nette Umschreibung dafür ist, dass sie höchst beunruhigend wirken.
Durch das Torgitter kann ich den Lichtschein des Fensters ausmachen. Ich trete näher, fahre mit den Fingern zwischen den aufgerissenen Mäulern und den schlängelnden Schwänzen hindurch, starre hinauf zu diesem Licht und wünsche mir wie ein Kind, es würde für mich leuchten. Wie das Licht auf einer Veranda, das ich angelassen habe, damit es mich nach einem langen Tag zu Hause willkommen heißt.
Ich habe weder ein Zuhause noch eine Verandabeleuchtung. Aber ich habe, was ich brauche, und das ist genug.
Es ist bloß so, dass ich manchmal, Gott steh mir bei, mehr will.
Ich stehe jetzt so dicht vor dem Tor, dass meine Atemzüge auf dem kalten Metall kondensieren. Ich weiß, ich sollte es gut sein lassen – es wird immer finsterer, Jasper braucht Abendessen, und meine Füße sind schon taub vor Kälte –, aber ich bleibe stehen und starre weiter, gequält von einem Hunger, den ich nicht einmal richtig benennen kann.
Ich muss mich wohl korrigieren: Träume sind wie streunende Katzen. Wenn man ihnen keine Nahrung gibt, werden sie mager und gerissen, bekommen scharfe Krallen und gehen dir an die Gurgel, wenn du am wenigsten damit rechnest.
Wie fest ich das Tor umklammere, wird mir erst bewusst, als ich spüre, wie sich das Eisen in meine Hand bohrt und ich die feuchte Wärme von Blut wahrnehme. Fluchend drücke ich mir den Ärmel meines Hoodies auf die Wunde und frage mich, wie viel wohl eine Tetanusimpfung in der Klinik kostet und warum die Luft plötzlich schwer und süßlich riecht – als ich zwei Dinge gleichzeitig wahrnehme.
Erstens, dass das Licht hinter dem Fenster erloschen ist.
Und zweitens, dass mir gegenüber jemand auf der anderen Seite des Tores von Starling House steht.
In Starling House gibt es nie Gäste. Es gibt weder private Gesellschaften noch Verwandtenbesuche, man sieht keine Servicewagen von Heizungs-, Lüftungs- oder Gasfirmen, keine Lieferwagen, die hinein- oder hinausfahren. Manchmal verabreden sich ein paar Highschoolschüler mit unausgeglichenem Hormonhaushalt, über die Mauer zu klettern und sich bis zum Haus zu schleichen. Aber dann steigt der Nebel auf, oder der Wind weht zu heftig, und die Mutprobe wird nie wirklich durchgeführt. Einmal in der Woche stapeln sich Lebensmittellieferungen vor dem Tor oder braune Papiertüten, durchweicht vom Kondenswasser der Milchflaschen, und ab und zu parkt ein schnittiges schwarzes Auto auf der anderen Straßenseite und bleibt dort ein oder zwei Stunden stehen, ohne dass jemand ein- oder aussteigt. Ich bezweifle, dass in den letzten zehn Jahren ein Außenstehender einen Fuß auf das Starling-Grundstück gesetzt hat.
Was bedeutet, es gibt genau eine Person, die auf der anderen Seite des Tors stehen kann.
Der letzte Starling lebt mutterseelenallein. Sein Aussehen erinnert an Boo Radley, und er ist dreifach gestraft: erstens durch seinen hochtrabenden Namen (Alistair oder Alfred, darauf können sich die Leute nie einigen), zweitens durch seinen Haarschnitt (so ungepflegt, als er zuletzt gesehen wurde, dass man daraus nur auf eine beklagenswerte Haltung schließen kann) und schließlich durch das düstere Gerücht, seine Eltern seien auf seltsame Weise und auffällig jung umgekommen.4
Aber der Erbe von Starling House sieht weder aus wie ein reicher Einsiedler noch wie ein Mörder. Er kommt daher wie eine unterernährte Krähe, trägt ein Button-up-Hemd, das ihm nicht recht passt – an den Schultern sitzt es zu stramm. Eine Hakennase dominiert sein kantiges, mürrisches Gesicht, und seine Haare, kurz vor dem Vokuhila-Stadium, sehen aus wie ein zerfledderter Flügel.
Er durchbohrt mich mit seinem Blick.
Mir wird bewusst, dass ich ihn meinerseits aus einer wilden, kauernden Haltung heraus anstarre, wie ein Opossum, das auf frischer Tat beim Plündern der Motel-Müllcontainer erwischt wurde. Ich habe zwar nichts Verbotenes getan, aber ich habe auch keine großartige Erklärung dafür, warum ich kurz nach Einbruch der Dunkelheit vor seiner Einfahrt stehe, und die Wahrscheinlichkeit, dass er eben doch ein Mörder ist, steht fünfzig zu fünfzig. Also tue ich, was Mom immer tat, wenn sie in der Klemme steckte (was jeden Tag der Fall war): Ich lächle.
»Oh, ich habe Sie gar nicht gesehen!« Ich verschränke die Arme vor der Brust und gebe ein kleines, mädchenhaftes Lachen von mir. »Ich kam bloß gerade vorbei und dachte, ich schaue mir mal diese Torflügel näher an. Sie sind so außergewöhnlich. Aber ich wollte Sie nicht stören, also mache ich mich mal wieder auf den Weg.«
Der Erbe von Starling House erwidert mein Lächeln nicht. Er sieht auch nicht so aus, als hätte er jemals gelächelt oder würde es jemals in der Zukunft tun, ganz so, als wäre er aus eiskaltem Stein gemeißelt und nicht auf die übliche Art und Weise auf die Welt gekommen. Sein Blick wandert zu meiner linken Hand, wo das Blut durch den Ärmel gesickert ist und mir dramatisch von den Fingerspitzen tropft.
»Oh, Scheiße.« Ich versuche vergeblich, die Hand in meine Tasche zu schieben, was wehtut. »Ich meine, das ist nichts. Ich bin vorhin bloß gestolpert, und …«
Er greift so schnell zu, dass mir kaum Zeit bleibt, nach Luft zu schnappen. Seine Hand schnellt durch das Gitter und packt die meine. Ich weiß natürlich, dass ich sie ihm wieder entreißen sollte – wenn du ab deinem sechzehnten Lebensjahr alleine aufwächst, lernst du, dich nie und nirgends von fremden Männern anfassen zu lassen –, aber uns trennt ein Tor mit einem riesigen Vorhängeschloss, und seine Haut ist so warm und meine so verdammt kalt. Er dreht meine Handfläche nach oben, und ich vernehme das leise Zischen seines Atems.
Ich hebe eine Schulter. »Ist schon in Ordnung.«
Nichts ist in Ordnung: Meine Hand sieht aus wie ein matschiger roter Klumpen, die Fleischwunde klafft so weit auf, dass ich fürchte, Sekundenkleber und Wasserstoffperoxid werden womöglich nicht ausreichen. »Mein Bruder wird mich schon wieder zusammenflicken. Er wartet übrigens schon auf mich, also sollte ich jetzt wirklich gehen.«
Er lässt mich nicht los, und ich ziehe die Hand nicht zurück. Mit dem Daumen fährt er den gezackten Rand der Wunde entlang, ohne sie zu berühren, und plötzlich merke ich, dass seine Finger, die dicht über meinen schweben, zittern. Vielleicht gehört er zu den Menschen, die beim Anblick von Blut in Ohnmacht fallen, oder vielleicht sind es exzentrische Einsiedler nicht gewohnt, dass junge Frauen ihr Eingangstor vollbluten.
»Ist keine große Sache.« Normalerweise ist Aufrichtigkeit nicht so mein Ding – außer bei Jasper –, aber ich empfinde eine gewisse Sympathie für ihn. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns in gewisser Hinsicht ähnlich sind: Er ist ungefähr so alt wie ich, zu einfach gekleidet, fröstelt und wird von der halben Stadt gehasst. »Mir geht es wirklich gut.«
Er hebt den Blick, und als ich ihm in die Augen schaue, erkenne ich plötzlich mit schrecklicher Gewissheit, dass ich mich geirrt habe. Er zittert gar nicht vor Nervosität oder wegen der Kälte. Er zittert vor Wut.
Seine blutleere Haut spannt sich straff über seinen hohlen Wangen, sodass seine Zähne entblößt werden. Er stößt ein animalisches Knurren aus. Seine Augen sehen aus wie pechschwarze Höhlen.
Ich taumle zurück, als ob mich jemand gestoßen hätte. Mein Lächeln ist wie weggewischt, und auf der Suche nach dem Motelschlüssel taste ich mit der unverletzten Hand in meiner Tasche herum. Er mag größer sein als ich, aber ich würde Gift drauf nehmen, dass ich gnadenloser kämpfen würde.
Aber er öffnet das Tor nicht, sondern beugt sich nur näher zu mir vor, presst die Stirn fest gegen das Eisengitter und umklammert die Stäbe so fest, dass sich seine Fingerknöchel weiß färben. Mein Blut klebt ihm glänzend an den Händen.
»Laufen Sie weg!«, krächzt er.
Und ich laufe weg.
Schnell und mit stampfenden Schritten, die linke Hand fest an die Brust gepresst. Sie pocht immer noch, aber ist nicht mehr ganz so kalt wie vorher.
Der Erbe von Starling House sieht, wie sie vor ihm wegläuft, und bedauert es nicht.
Er bedauert nicht, dass sie ihm ihre Hand entrissen hat oder dass sie ihn anfunkelte, bevor sie weglief, mit stampfenden Schritten und flink wie ein Wiesel. Schon gar nicht bedauert er, dass dieses strahlende, kecke Lächeln, das von Anfang an nicht echt war, plötzlich wie weggewischt war.
Er ringt mit dem kurzen, absurden Drang, ihr hinterherzuschreien – Warten Sie mal!, könnte er rufen, vielleicht sogar Kommen Sie zurück! –, bevor ihm klar wird, dass er gar nicht will, dass sie zurückkommt. Er will, dass sie läuft, immer weiterläuft, so schnell und so weit sie nur kann. Er will, dass sie ihre Sachen packt, im Waffle House ein Greyhound-Ticket kauft und aus Eden verschwindet, ohne sich noch einmal umzuschauen.
Das wird sie natürlich nicht tun. Das Haus will sie, und das Haus ist stur. Schon jetzt ist ihr Blut vom Tor verschwunden, als hätte eine unsichtbare Zunge es abgeleckt.
Er weiß nicht, warum es ausgerechnet sie will, diese sommersprossige Vogelscheuche von junger Frau mit schiefen Zähnen und Löchern in der Jeans. Sie ist völlig unscheinbar, abgesehen von ihrem stahlharten Blick und vielleicht von der Art und Weise, wie sie sich gegen ihn behauptet hat. Er ist ein Geist, ein Gerücht, eine Geschichte, die man sich flüsternd erzählt, nachdem die Kinder zu Bett gegangen sind, und sie hat gefroren und war verletzt, war ganz allein in der Dunkelheit – und doch ist sie erst vor ihm geflohen, als er es ihr befohlen hat. Das Haus hat schon immer eine Vorliebe für die Mutigen gehabt.
Aber Arthur Starling hat am Grab seiner Eltern geschworen, dass er der letzte Wächter von Starling House sein würde. Er ist alles Mögliche – ein Feigling, ein Narr, ein schrecklicher Versager –, aber er ist niemand, der sein Wort bricht. Nach ihm wird keiner mehr jede Nacht wach liegen und auf das Scharren und Kratzen von Krallen und auf keuchenden Atem lauschen. Keiner mehr wird sein Leben damit verbringen, einen unsichtbaren Krieg zu führen, belohnt entweder mit einem stillen Sieg oder einer teuer erkauften Niederlage. Nach ihm wird keiner mehr das Starling-Schwert tragen.
Schon gar nicht so ein dürres Ding mit hartem Blick und dem Lächeln einer Lügnerin.
Arthur löst die Stirn vom Tor und wendet sich ab. Er hat die Schultern so weit hochgezogen, dass seine Mutter missbilligend die Augen zusammenkneifen würde, wenn sie noch Augen zum Zusammenkneifen hätte.
Der Weg zurück zum Haus dauert länger als üblich, denn die Auffahrt windet und schlängelt sich mehr als üblich, der Boden ist rauer, die Nacht dunkler. Seine Beine schmerzen, als er über die Schwelle tritt.
Er hält inne und stützt sich mit einer Hand am Türrahmen ab. Ihr Blut auf seiner Haut ist getrocknet und bröckelt ab. »Lass sie in Ruhe«, flüstert er leise. Sie haben seit Jahren nicht mehr höflich miteinander gesprochen, aber aus irgendeinem Grund fühlt er sich genötigt, ein förmliches »Bitte« hinzuzufügen.
Die Bodendielen knarren und ächzen. In einem entfernten Flur knallt eine bockige Tür zu.
Arthur schlurft die Treppe hinauf und lässt sich aufs Bett fallen, voll bekleidet, aber immer noch fröstelnd. Halb rechnet er damit, dass ein Leitungsrohr über seinem Kopfkissen ein tückisches Leck bekommt oder ein loser Fensterladen unregelmäßig gegen den Fenstersims schlägt.
Stattdessen suchen ihn nur die Träume heim. Immer diese verdammten Träume.
Er ist fünf, und das Haus ist gesund und munter. Es gibt keine Risse im Putz, keine durchgerosteten Geländerstäbe oder tropfenden Wasserhähne. Für Arthur ist es weniger ein Haus als vielmehr ein Land – ein schier endloses Terrain aus geheimen Räumen und knarrenden Treppen, baumbeschatteten Dielenböden und sonnenverblichenen Sesseln. Tag für Tag geht er auf Entdeckungsreise, gestärkt durch die Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade, die sein Vater ihm einpackt, und jede Nacht singen ihn die Stare in den Schlaf. Er weiß nicht einmal, wie einsam er ist.
Er ist acht, und seine Mutter drückt seine Finger um den Schwertgriff und strafft sein dünnes Handgelenk, wenn es sich krümmen will. Du liebst unser Zuhause doch, nicht wahr? Ihre Miene ist ernst und müde. Sie war schon immer müde. Man muss für das kämpfen, was man liebt.
In diesem Moment wacht Arthur schweißgebadet auf und kann nicht wieder einschlafen. Er starrt aus dem runden Fenster seines Mansardenzimmers, beobachtet das Schwanken der Bäume im Wind und denkt an seine Mutter, an all die Wächter vor ihr – und an die junge Frau.
Sein letzter, hoffnungsvoller Gedanke vor dem Morgengrauen ist, dass ihr eine gewisse Schlauheit zu eigen war, eine Gerissenheit. Und dass doch sicher nur die allerdümmsten Narren jemals nach Starling House zurückkehren würden.
3 Willy Floyd, 13, wird seit dem 13. April 1989 vermisst. Der alte Minenschacht wurde vier Jahre vor Opals Geburt mit Brettern vernagelt. Womöglich hat sie nur davon geträumt und den Traum mit einer Erinnerung verwechselt.
4 Lynn und Oscar Starling starben irgendwann im Oktober 2007. Ein genaueres Todesdatum zu bestimmen, war dem Coroner nicht möglich. In seinem Autopsiebericht verweist er auf die unglückselige Verzögerung und den »gottverdammten Zustand der beiden«.
DREI
Nie, nie, nie werde ich noch einmal nach Starling House gehen, egal, wie einsam oder müde ich bin, egal, wie schön das Licht durch die Bäume schimmern mag. Seine Stimme treibt mich den ganzen Weg zurück zum Motel, hallt in meinen Ohren wider: Laufen Sie weg! Laufen Sie weg! Laufen Sie weg!
Sie verklingt erst, als ich keuchend und zitternd in das matte Lampenlicht von Zimmer 12 trete und der Matsch von meinen Schuhen auf den Teppich spritzt.
Jasper begrüßt mich, ohne seine Kopfhörer abzunehmen. Seine Aufmerksamkeit gilt den Graustufen der Bilder des Videos, das er gerade bearbeitet. »Du hast ewig gebraucht, da habe ich mir schon mal den Rest von den Picante-Hühnchen-Ramen reingezogen. Wer zu spät kommt, den bestra…« Er blickt auf, legt sich die Kopfhörer um den Hals, und der selbstgefällige Ausdruck auf seinem Gesicht verschwindet. »Was ist denn mit dir passiert?«
Ich lehne mich gegen die Tür und hoffe darauf, dass ich lässig wirke und nicht so, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. »Hast du wirklich geglaubt, ich würde die letzte Portion Picante-Hühnchen offen herumliegen lassen? Ich habe meinen eigenen Vorrat.«
»Opal …«
»Ich werde dir niemals verraten, wo. Nur über meine Leiche.«
»Was ist passiert?«
»Nichts! Ich bin bloß nach Hause gejoggt.«
»Nach … Hause … gejoggt.« Das Wort gejoggt dehnt er skeptisch in die Länge. Ich zucke mit den Schultern. Er starrt mich mit geschürzten Lippen an, um dann demonstrativ auf den Boden neben mir zu schauen. »Und das ist dann wohl Ketchup, was da auf den Teppich tropft?«
»Nee.« Ich schiebe meine verräterische linke Hand in die Tasche meines Hoodies und stürze ins Badezimmer. »Sriracha-Sauce.«
Jasper stampft mit den Füßen auf, brüllt und stößt wüste Drohungen gegen mich aus, aber ich schalte bloß den Deckenventilator ein und stelle die Dusche an, bis er kapituliert. Dann lasse ich mich auf den Toilettensitz sinken. Das Zittern erfasst erst meine Beine, dann meine Schultern und geht schließlich bis in die Fingerspitzen. Ich sollte jetzt wohl in Panik geraten, angefressen sein oder zumindest verwirrt – aber alles, was ich empfinden kann, ist das dumpfe, gekränkte Gefühl, verarscht worden zu sein, was mir nicht gerade gefällt.
Mich auszuziehen und mich unter die Dusche zu stellen, überanstrengt mich, sodass ich mich nur aus meinem Hoodie winde und die Hand so lange unter fließendes Wasser halte, bis es mehr oder weniger klar in den Abfluss läuft. Die Wunde ist gar nicht so tief, wie ich dachte. Es ist nur eine ausgefranste Linie, die bedrohlich meine Lebens- und Liebeslinien durchschneidet. (Ich habe es nicht so mit Handlesekunst, aber Mom hatte diesen ganzen Mist mit Löffeln gefressen. Gerichtstermine oder Elternabende konnte sie sich nie merken, kannte aber dafür unsere Horoskope in- und auswendig.)
Ich kippe eine halbe Flasche Wasserstoffperoxid auf die Wunde und suche nach einem Pflaster. Am Ende reiße ich Streifen von einem alten Bettlaken ab und wickle sie um meine Hand, so wie ich es in dem Jahr tat, als Jasper zu Halloween als Mumie ging.
Als ich die Tür öffne, ist der Raum dunkel. Das durch die Jalousien einfallende Licht der Parkplatzbeleuchtung malt Tigerstreifen auf die Wände. Jasper liegt im Bett, schläft aber nicht – wegen seines Asthmas schnarcht er –, ich tue aber so, als würde ich es nicht merken, und krieche in mein Bett.
Dort liege ich nun und lausche, so wie er mir lauscht. Ich versuche, das Pochen des Pulses in meiner Hand zu ignorieren und diese schwarzen Augen, die sich regelrecht in meine gebohrt haben, aus dem Gedächtnis zu verbannen.
»Geht es dir gut?«
Jaspers Stimme klingt dermaßen zittrig, dass ich am liebsten zu ihm ins Bett kriechen und Rücken an Rücken mit ihm schlafen würde, so wie früher, als wir noch zu dritt waren und nur zwei Betten hatten. Und später wieder, als die Träume anfingen.
Stattdessen zucke ich nur mit den Schultern und starre an die Decke. »Mir geht es immer gut.«
Die Polyestermatratze gibt ein seufzendes Geräusch von sich, als Jasper sich mit dem Gesicht zur Wand dreht. »Du bist eine ziemlich gute Lügnerin« – Ich bin eine fantastische Lügnerin –, »aber das ist nur gegenüber allen anderen okay so. Nicht bei Familienmitgliedern.«
Die Treuherzigkeit dieser Aussage bewirkt, dass ich am liebsten lachen würde, vielleicht auch weinen. Die größten Lügen tischt man immer denen auf, die man am meisten liebt. Ich werde mich um dich kümmern.Alles wird gut. Es ist alles in Ordnung.
Ich schlucke heftig. »Es ist alles in Ordnung.« Seine Skepsis ist mit Händen zu greifen, dringt wie ein kalter Schauer von der anderen Seite des Raumes zu mir. »Wie auch immer, es ist erledigt.« Ich weiß nicht, ob er es glaubt, aber ich glaube es.
Bis der Traum beginnt.
Er ist nicht wie die anderen. Die anderen waren in ein weiches, sepiafarbenes Licht getaucht, wie früher beim Heimkino oder bei schönen Erinnerungen, die man schon halb vergessen hat. Dieser Traum ist wie ein Sprung ins kalte Wasser an einem heißen Tag, wie der Übergang von einer Welt in eine andere.
Ich stehe wieder vor dem Tor von Starling House, aber dieses Mal fällt das Vorhängeschloss ab, und die Torflügel schwingen vor mir weit auf. Ich gehe den dunklen Schlund der Einfahrt entlang, Dornenzweige zerren an meinen Ärmeln, kleine Äste verheddern sich in meinem Haar. Starling House taucht aus der Dunkelheit vor mir auf wie ein riesiges Tier aus seiner Höhle: ein giebelartiger Rücken, Flügel aus hellem Stein, ein Turm mit einem einzigen, bernsteinfarbenen Auge. Steile Stufen winden sich wie ein Schwanz um seine Füße.
Die Haustür ist ebenfalls unverschlossen. Ich husche über die Schwelle in ein Labyrinth aus Spiegeln und Fenstern, Fluren, die sich verzweigen und teilen und Kehren bilden, und Treppen, die an blanken Wänden oder verschlossenen Türen enden. Ich laufe schneller, immer schneller, schiebe mich durch eine Tür nach der anderen und eile zur nächsten, als gäbe es dort etwas, das ich unbedingt finden muss.
Die Luft wird kälter und feuchter, je weiter ich mich hineinwage. Feiner Nebel quillt aus den Bodendielen empor und schlängelt sich um meine Knöchel. Irgendwann wird mir bewusst, dass ich renne.
Ich stolpere durch eine Falltür und Steinstufen hinab, immer weiter hinunter. Wurzeln winden sich adernförmig über den Boden, und mir kommt der verwirrende Gedanke, dass sie zum Haus selbst gehören müssen, so als könnten Bauholz und Nägel mit der Zeit wieder zum Leben erweckt werden.
Eigentlich dürfte ich in der Dunkelheit gar nichts sehen, erkenne jedoch, dass die Treppe abrupt an einer Tür endet. Es ist eine grobe Steintür, gekreuzt von silbernen Ketten. Daran baumelt wieder ein Vorhängeschloss. Das Schloss ist offen, die Tür ist geborsten.
Eisige Nebelschwaden strömen durch die Öffnung, und ich weiß mit dem seltsamen Fatalismus, der Träumen zu eigen ist, dass ich zu spät komme, dass etwas Schreckliches bereits geschehen ist.
Ich greife nach der Tür, erstickt von einem Kummer, den ich nicht begreife, rufe einen Namen, den ich nicht kenne …
Dann bin ich wach, und ich schmecke salzige Tränen. Ich muss im Schlaf die Fäuste geballt haben, denn der Verband an der linken Hand ist blutgetränkt.
Es ist noch dunkel, aber ich ziehe meine Jeans von gestern wieder an – die Stulpen sind noch nass vom Schneematsch, die Taschen voll mit gestohlenen Geldscheinen – und schlüpfe mit einem Schlafsack über den Schultern nach draußen. Ich lehne mich mit dem Rücken gegen die Betonwand und lasse die Teufelskatze auf meinen Schoß klettern, wo sie abwechselnd schnurrt und knurrt, während ich darauf warte, dass die Sonne aufgeht und der Traum verblasst, so wie die vorherigen.
Aber das tut er nicht. Er hält sich hartnäckig wie eine schwere Erkältung, setzt sich tief in meiner Brust fest. Den ganzen Tag über spüre ich den Druck unsichtbarer Mauern auf den Schultern, das Gewicht von Dachsparren auf mir. Das Herbstlaub am Boden bildet Tapetenmuster auf dem Straßenpflaster, und das verschrammte Linoleum bei Tractor Supply scheint unter meinen Füßen zu knarren wie altes Holz.
An diesem Abend bleibe ich zu lange auf, lese im Lichtschein der Parkplatzbeleuchtung einen Regency-Roman im Versuch, das Haus aus meinem Kopf zu vertreiben oder zumindest diesen schmerzenden, sinnlosen Kummer loszuwerden. Aber jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, holt mich der Traum wieder ein und hetzt mich durch dieselben verwinkelten Flure und gewundenen Treppen, die vor derselben unverschlossenen Tür enden.
Sechseinhalb Tage, nachdem ich vor Starling House weggelaufen bin, kehre ich dorthin zurück.
Um es klarzustellen: Geplant hatte ich das nicht. Ich wollte die zusätzliche halbe Meile Arbeitsweg explizit für den Rest meines Erdendaseins in Kauf nehmen, damit ich mich dem Starling-Grundstück nie wieder weniger als hundert Meter nähern muss. Ich hatte vor, Lacey um Mitfahrgelegenheiten anzubetteln oder vielleicht ein Fahrrad zu klauen. Ich bin kein Feigling, aber durch Jasper habe ich so viele Horrorfilme angeschaut, dass ich in der Lage bin, Warnsignale zu erkennen, wenn sie wie Zaunpfähle vor meinen Augen herumgewedelt werden.
Aber nach sechs Nächten, in denen ich grauenhaft geschlafen habe, und sechseinhalb Tagen, in denen ich Jaspers besorgten Blicken auswich und den langen Weg zur Arbeit nahm, und in denen ich dachte, die Badezimmerspiegel wären Fenster, und nach Türen suchte, die es gar nicht gibt – werfe ich das Handtuch. Ich bin zermürbt und ziemlich durch den Wind, und mir gehen die alten Laken aus, die ich zu Verbänden zerreißen kann, weil sich die Wunde an meiner Hand offenbar nicht schließen will.
Und da bin ich nun und nutze meine Mittagspause am Montag, um das Tor von Starling House anzustarren.
Die Monster auf dem Tor starren mich ihrerseits an, doch im kalten Licht des Tages entpuppen sich ihre Gestalten bloß als Eisenfiguren. Ich lecke mir über die Lippen, bin halb erschrocken und halb irgendetwas anderes.
»Sesam, öffne dich. Oder was auch immer.«
Nichts passiert. Natürlich passiert nichts, weil ich nicht in einer meiner albernen Kindheitsgeschichten stecke und es weder Zauberformeln noch Spukhäuser gibt, und selbst wenn, hätten sie nichts mit jemandem wie mir zu tun.
Ich schaue erst auf meine linke Hand, die ich heute Morgen frisch verbunden habe, dann nach rechts und links die Straße entlang, so wie man es tut, wenn man etwas Lächerliches vorhat und nicht dabei beobachtet werden will.
Ein Pick-up tuckert an mir vorbei. Ich winke munter und beiläufig in seine Richtung und erblicke ein Augenpaar im Rückspiegel, das woanders hinsieht. Diese Stadt ist gut im Wegschauen.
Der Kleintransporter verschwindet um die Kurve, worauf ich den weißen Baumwollstoff abwickele – die Wunde ist immer noch haargenau so breit und ausgefranst wie vor sechs Tagen und sondert immer noch wässriges Blut ab – und meine Handfläche auf das Eingangstor presse. Ich spüre einen Schauer des Wiedererkennens, so wie wenn man in einem überfüllten Raum ein bekanntes Gesicht entdeckt, und das Tor schwingt auf.
Mein Herzschlag stolpert. »Okay.« Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit mir selbst rede oder mit dem Tor. »Okay. Klar.«
Wahrscheinlich sind hier Bewegungssensoren installiert, Kameras oder selbst gebastelte Umlenkrollen, oder es gibt eine andere total rationale Erklärung. Aber es fühlt sich nicht total rational an. Es fühlt sich an wie der Anfang eines Krimis, wenn du die tapfere Protagonistin anschreist, sie solle das Weite suchen, aber irgendwie darauf hoffst, dass sie es nicht tut, weil du willst, dass die Geschichte beginnt.
Ich atme kurz durch und schreite durch das Tor auf das Starling-Grundstück.
Der Zufahrtsweg sieht nicht so aus, als wäre er jemals gepflastert oder wenigstens gekiest worden. Er besteht lediglich aus einem Paar in den roten Lehmboden gefahrenen Spurrillen, getrennt durch eine schmale Linie verdorrtes Gras. In den Rillen hat sich Regenwasser gesammelt, und die Pfützen reflektieren den winterweißen Himmel wie die verstreut herumliegenden Scherben eines zerbrochenen Spiegels. Die Bäume beugen sich dicht über mir zusammen, als versuchten sie, einen Blick auf sich selbst zu erhaschen. Vogelaugen, schwarz und glänzend, funkeln mich aus dem Wald heraus an.
In meinen Träumen war die Auffahrt immer dunkel und kurvenreich, in der Realität hingegen biege ich um eine einzige Kurve. Und da ist es.5
Starling House.
Die Fenster sehen aus wie trübe Augen über morschen Fensterbänken. Leere Schwalbennester hängen unter den Dachtraufen. Das Fundament hat Risse und ist schief, als sei das ganze Haus dabei, in den offenen Schlund der Erde zu gleiten. Die Mauern sind mit den blattlosen, verschlungenen Trieben einer Kletterpflanze überzogen – Geißblatt, nehme ich an. Das Haus wirkt, als sei es kurz davor, ein Bewusstsein zu entwickeln und nach Nahrung zu verlangen. Das einzige Anzeichen dafür, dass hier jemand wohnt, ist eine träge aufsteigende Rauchfahne aus einem windschiefen Schornstein.
Der rationale Teil meines Gehirns signalisiert mir, dass dieses Haus eine Ruine ist, ein Schandfleck, der vom Bauamt für einsturzgefährdet erklärt und in das nächste Senkloch gestoßen werden sollte. Der weniger rationale Teil in mir erinnert sich an jeden Spukhaus-Film, den ich je gesehen habe, an jedes billige Buchcover, auf dem eine attraktive Weiße vor dem Hintergrund der Silhouette eines Herrenhauses Reißaus nimmt.
Ein noch weniger rationaler Teil von mir ist neugierig.
Warum, weiß ich nicht. Vielleicht erinnert mich die Form des Hauses, mit all seinen seltsamen Winkeln und tiefen Schatten wie ein schlecht gehütetes Geheimnis, an eine Illustration von E. Starling. Vielleicht habe ich aber auch nur eine Schwäche für das Vernachlässigte und Verlassene.
Die Eingangsstufen sind glitschig von einer dicken Schicht verrottetem Laub. Die Tür ist eingerahmt von einem imposanten Bogen, der einst rot oder braun gewesen sein mag, jetzt jedoch so farblos ist wie Regenwasser. Die Oberfläche der Tür ist zerkratzt und fleckig. Erst aus der Nähe erkenne ich, dass winzige Formen grob in das Holz geschnitzt sind. Es sind hunderte – Hufeisen, schiefe Kreuze und Augen, Spiralen, Kreise und missgebildete Hände, die sich wie Hieroglyphen oder Codezeilen in langen Reihen dahinziehen. Einige von ihnen sehen fast so aus wie die auf Moms Tarotdecks und Astrologietabellen, aber die meisten sind mir unbekannt, wie Buchstaben eines Alphabets, das ich nicht beherrsche. Ihnen wohnt eine Unordnung inne, eine Verzweiflung, die mir zu verstehen gibt, dass ich lieber gehen sollte, bevor ich rituell enthauptet oder auf einem Steinaltar im Keller geopfert werde.
Stattdessen trete ich näher heran.
Ich hebe eine Hand und klopfe dreimal an die Tür von Starling House. Ich gebe ihm ein paar Minuten – ich schätze, er wird ein Momentchen brauchen, um mit dem Grübeln aufzuhören oder mit dem Lauern oder was immer er dort drinnen macht –, bevor ich erneut klopfe. Ich scharre mit den Füßen im toten Laub herum und frage mich, ob er wohl gerade mit dem Auto unterwegs ist, und dann, ob er überhaupt einen Führerschein hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er mit Mr Cole auf dem Beifahrersitz Einparken übt.
Gerade will ich ein drittes Mal klopfen, als die Tür aufschlägt, ein Schwall Hitze aus dem Haus wabert – und er vor mir steht.
Bei Tageslicht ist der Erbe von Starling House sogar noch hässlicher. Seine Brauen über der schiefen Nase sind flach und breit, und seine Augen, die aussehen wie zwei in einen Kreidefelsen gegrabene Minenschächte, weiten sich.
Ich warte darauf, dass er etwas Normales sagt, etwa Hallo? oder Kann ich Ihnen helfen?, aber er starrt nur mit stummem Entsetzen auf mich herab wie ein menschlicher Wasserspeier.
Ich versuche es mit einem fröhlichen Lächeln. »Guten Morgen! Oder eher guten Nachmittag. Wir haben uns neulich abends getroffen, und ich dachte, ich komme einfach mal vorbei und stelle mich richtig vor. Ich bin Opal.«
Er blickt mit halb zugekniffenen Augen auf meine ausgestreckte Hand herab. Dann verschränkt er die Arme ineinander, ohne mir die Hand zu schütteln. »Ich dachte, ich hätte Ihnen geraten wegzulaufen«, stößt er krächzend hervor.
Ich lächle noch ein bisschen breiter. »Das bin ich ja auch.«
»Ich dachte, dies bedeutet auch, dass Sie nie wiederkommen.«
Seine Stimme klingt so trocken, so abgrundtief verärgert, dass mein Lächeln vorübergehend in Schieflage gerät. Ich bügle es wieder gerade. »Tja, tut mir leid, wenn ich Sie störe, aber ich bin hier, weil« – mir dein gottverdammtes Haus nicht mehr aus dem Kopf geht –, »weil ich einen Online-Architekturkurs mache und gehofft hatte, hier ein paar Fotos für mein Projekt machen zu können.«
Ich weiß nicht einmal, ob die Gemeinde Online-Architekturkurse anbietet, aber ich finde, es ist ein guter Vorwand, mich mal umzuschauen und das Haus aus meinen Träumen und aus meinem Kopf zu vertreiben und es durch die triste Realität schmutziger Tapeten und knarrender Stufen zu ersetzen.
»Sie wollen … Fotos machen. Für Ihren …« – seine ohnehin schon finstere Miene verdunkelt sich weiter – »… Architekturkurs.«
»Yep. Können wir drinnen reden?«
»Nein.«
Ich mime das leicht theatralische Frösteln, das Männer im Allgemeinen dazu bewegt, mir ihren Pullover um die Schultern zu legen. »Es ist ziemlich kühl hier draußen.«
Genau genommen ist es eiskalt. Es ist einer dieser fiesen Februartage, an denen die Sonne nie richtig aufgeht und der Wind Zähne zeigt.
»Dann hätten Sie einen Mantel anziehen sollen«, konstatiert er und beißt sich dabei an jedem einzelnen Wort fest.
Ich muss mich anstrengen, um meine Stimme süß und dümmlich klingen zu lassen. »Hören Sie, ich brauche bloß ein paar Bilder. Bitte?« Ich deute auf das Hausinnere, dessen von Spinnweben übersäter Flur hinter seinen Schultern im Schatten verschwindet.
Sein Blick folgt dem Bogen, den ich mit der Hand beschreibe, und verweilt auf dem frischen Schimmer meines Blutes. Ich lasse die Hand unter meinen Arbeitskittel gleiten.
Sein Blick wandert zurück zu meinem Gesicht. »Nein«, wiederholt er, aber diesmal klingt sein Ton beinah entschuldigend.
»Ich werde morgen wiederkommen«, drohe ich. »Und übermorgen, und am Tag danach. So lange, bis Sie mich reinlassen.«
Der Erbe von Starling House bedenkt mich erneut mit einem anhaltenden garstigen Blick, als ob er denkt, ich würde schleunigst die Einfahrt zurücklaufen, wenn er mich nur unfreundlich genug behandelt. Als hätten mir nicht acht Jahre im Ladenverkauf ein Rückgrat aus Stahl beschert.
Ich zähle langsam bis zehn. Über uns kracht ein loser Fensterladen zu.
Er scheint mit sich zu ringen, seine Lippen verziehen sich, bis er schließlich zögerlich sagt: »Es würde nicht … helfen.«
Ich frage mich, ob er irgendwie von meinen Träumen weiß. Dass ich nachts aufwache und mir die Tränen über die Wangen laufen und ich den Namen einer fremden Person auf den Lippen habe. Ob das hier schon mal passiert ist, anderen?
Die feinen Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Ich bleibe bei einem ganz vernünftigen Tonfall. »Was würde denn helfen?«
»Ich weiß es nicht.« Nach seiner säuerlichen Miene zu schließen, mag er es wohl nicht, wenn er etwas nicht weiß. »Vielleicht, wenn Sie ihm Zeit lassen …«
Ich schaue auf mein Handy hinunter, worauf eine Haarsträhne unter meiner Kapuze hervorspringt. »Tja, ich muss in zwanzig Minuten zurück sein, und morgen arbeite ich eine Doppelschicht.«
Er blinzelt mich an, als wüsste er nicht recht, was eine Schicht ist oder warum man sie verdoppelt. Dann richtet sich sein Blick auf eine Stelle links an meinem Kopf und heftet sich auf diese launische Haarlocke.
Er wird weiß um die Nase. Plötzlich scheint seine steinerne Miene weich zu werden, und ich kann sehen, wie eine Welle von Emotionen seine Gesichtszüge verändert: schrecklicher Verdacht, Schock, Trauer, abgrundtiefe Schuldgefühle.
Ich habe das Gefühl, dass er gleich schreien oder fauchen oder sich in einem Anfall von Wahnsinn die Haare raufen wird, und ich weiß nicht, ob ich auf ihn zu oder vor ihm weglaufen soll. Doch er schluckt nur heftig und schließt die Augen.
Als er sie wieder öffnet, ist seine Miene wieder vollkommen undurchschaubar. »Oder vielleicht, Miss …?«
Mom wählte ihren Nachnamen je nach Stimmung (Jewell Star, Jewell Calamity, Jewell Lucky). Ich halte mich normalerweise an unauffällige schottische oder irische Namen (McCoy, Boyd, Campbell), die zu meinen Haaren passen. Aber aus irgendeinem Grund antworte ich: »Einfach Opal.«
Das scheint ihm nicht recht zu gefallen. Seine Lippen kräuseln sich, bevor er einen Kompromiss eingeht. »Miss Opal.« Er legt eine Pause ein und stößt einen lang anhaltenden Seufzer aus, als wäre ich in meinem Arbeitskittel von Tractor Supply eine Bürde unermesslichen Ausmaßes. »Vielleicht könnte ich Ihnen einen Job anbieten.«
5 Satellitenaufnahmen vom Grundstück sind wenig aussagekräftig. Wenn man die Adresse im Smartphone eingibt, sieht man lediglich schiefergedeckte Dächer und verschwommenes Grün, das nie ganz scharf zu erkennen ist.
VIER
Arthur bereut die Worte, kaum dass sie ihm über die Lippen gedrungen sind. Er beißt sich heftig auf die Zunge, um zu verhindern, dass er noch etwas Schlimmeres von sich gibt.
»Einen Job?« Die Stimme der jungen Frau – Opal – klingt hell, aber ihr Blick ist stahlhart. Sie fixiert ihn. »Was für einen Job?«
»Ah.« Arthur überlegt und verwirft mehrere schreckliche Ideen, bevor er kühl erwidert: »Haushaltsführung.« Er denkt kurz über die Etymologie des Wortes nach – hat es jemals ein Haus gegeben, das eine so strenge Führung benötigt wie dieses? – und schaudert. »Putzen, meine ich.« Er macht eine verächtliche Geste in Richtung Bodendielen, die unter Generationen von Sand- und Staubschichten fast nicht mehr zu erkennen sind.
Der Schmutz stört ihn gar nicht sonderlich, ist er doch eine seiner vielen Waffen in dem langwierigen Kleinkrieg zwischen ihm und dem Haus. Aber ihn zu entfernen könnte mehreren Zwecken dienen: Das Haus könnte durch die Aufmerksamkeit, die es damit erfährt, besänftigt werden, eingelullt durch das falsche Versprechen, es käme ein besserer Wächter. Die junge Frau könnte durch die Schufterei vertrieben werden. Und er könnte einen kleinen Teil der furchtbaren Schuld bezahlen, die er bei ihr auf sich geladen hat.
An diesem Abend neulich hatte Arthur sie nicht erkannt, weil sie sich die Haare unter die Kapuze gesteckt hatte, doch jetzt erinnert er sich daran, wie ihr diese Haare in den Nacken gefallen waren, ihr an den blassen Wangen geklebt und seine Hemdbrust durchnässt hatten. Ihre Haarfarbe konnte er erst erkennen, als der erste Krankenwagen um die Ecke bog. Im plötzlichen Licht der Scheinwerfer wurde ihr Haar in seinen Armen zu einem glühenden Kohleflöz oder einem Feld voller Mohnblumen, die zur falschen Jahreszeit blühten.
Ihm kommt der Gedanke, dass ihr Auftauchen vor seiner Haustür an diesem Mittag Teil eines langwierigen und komplexen Racheplans gewesen sein könnte. Dass es ein schwerer Fehler gewesen sein könnte, sie in sein Haus zu lassen. Aber ihre Miene ist immer noch kühl und misstrauisch.
»Das ist nett«, sagt sie vorsichtig, »aber ich habe doch schon einen Job.«
Arthur schnippt mit den Fingern nach ihr. »Ich bezahle Sie natürlich angemessen.«
In ihren Augen blitzt es berechnend auf, wie Reflexionen auf einer frisch geprägten Münze. »Wie viel?«
»So viel Sie wollen.«
Das Vermögen der Starlings ist im Laufe der Jahre zwar erheblich geschrumpft, aber Arthur wird es nicht mehr lange in Anspruch nehmen, und das, was er ihr schuldet, lässt sich nicht in Dollar bemessen. Ob sie es nun weiß oder nicht, sie hätte jedes Recht, ihn dazu aufzufordern, mit Steinen in der Tasche in den Mud River zu springen.
Opal nennt eine Zahl und reckt in einer ominösen Geste der Herausforderung das Kinn in die Höhe. »Pro Woche, meine ich.«
»Gut.«
Er erwartet erneut ein Lächeln, vielleicht sogar ein echtes, denn nach dem Zustand ihrer Schuhe und den spitzen Knochen an ihren Handgelenken zu urteilen, könnte sie das Geld wohl gut gebrauchen. Stattdessen weicht sie fast unmerklich einen Schritt zurück. Ihre Stimme klingt jetzt leise und bricht fast, sodass er sich wünscht, sie wäre noch ein paar Schritte mehr zurückgewichen.
»Soll das ein Scherz sein?«
»Nein.«





























