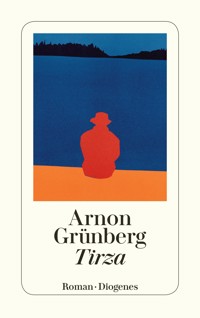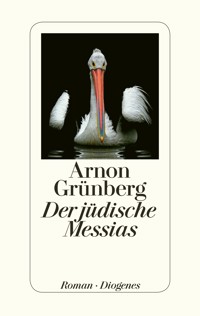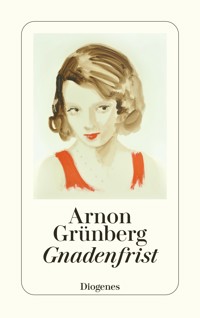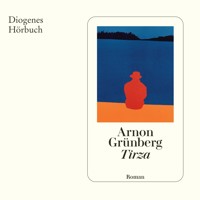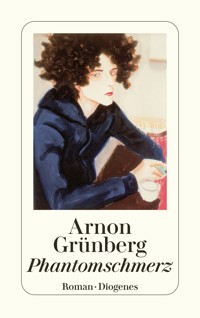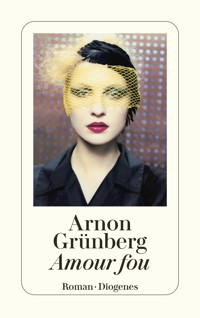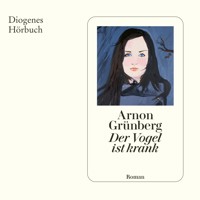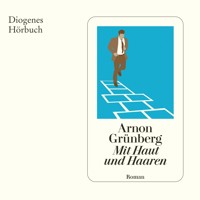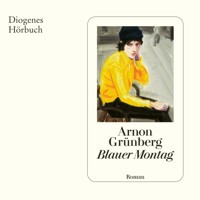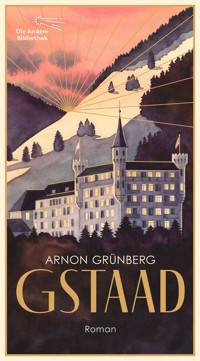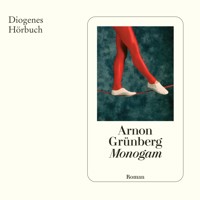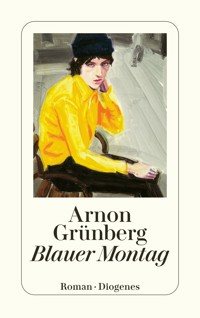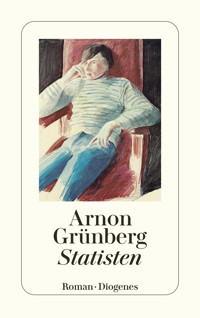
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ewald und Broccoli wollen das Glück nicht wie durch eine Sanduhr hindurchrieseln lassen, sondern hängen einer Reihe großer Träume nach: anders zu sein, Schauspieler zu werden und mit Elvira zu schlafen, die nichts lieber tut als tanzen und schlafen – alleine – und die das Talent hat, alles, was sie tut, so aussehen zu lassen, als sei es die normalste Sache der Welt… Ein sehr gefährliches Talent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Arnon Grünberg
Statisten
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Diogenes
Geldhai
Ich bin der Geldhai, Makler für Bruchbuden.
Im Winter 1995 kam mir zum ersten Mal der Gedanke, Geldhai zu werden. Vorher hatte ich mir auch schon mal vorgenommen, Latin Lover zu werden oder Tangotänzer. Zwei Monate lang habe ich sogar noch einen Tangokurs besucht. Bis sie mir anboten, mir meine Kursgebühr zurückzugeben, wenn ich nur versprechen wollte, nie mehr wiederzukommen. Auf das Angebot bin ich eingegangen.
Eine Karriere als Büroangestellter hatte ich mir auch schon vorgenommen, oder als Filmstar oder Verleger, als Weinhändler, der seinen eigenen Wein austrinkt, als Börsenhändler, als Hure, als Komiker, als Filmregisseur und Mann einer zwanzig Jahre jüngeren Schauspielerin, als Hochstapler, als Schriftsteller, als Don Juan, als Selbstmordkandidat, als Brillenschlange, als Liebhaber von Frederika Steinman, als Weltmeister im Tischfußball, als Freund von Broccoli, als Schriftführer des Vereins der Genialen, als geheimer Mitarbeiter der Operation Brando, als Liebhaber von Elvira Lopez, als Frühlingsbrise von Elvira Lopez, als wandelnde, sprechende und singende Kreditkarte von Elvira Lopez, als ihr Masseur mit zwei linken Händen, als Vater ihrer Kinder – und dann, im Winter 1995, zum ersten Mal als Geldhai. Alles mögliche hatte ich mir schon vorgenommen, echt die verrücktesten Sachen. Am Ende des Lebens will man wahrscheinlich nur noch wandelnde Leiche werden, doch so weit bin ich noch nicht. Obwohl ich vermute, daß es kein angenehmer Anblick sein wird.
Jemand rief mich mal an und sagte: »Du bist ein richtiger Geldhai.« Es war ein Filmproduzent. Ich dachte: Ja, das ist es, ich bin ein Geldhai. »Sie haben recht«, sagte ich, »Sie haben vollkommen recht.« Später schrieb ich ihm noch: »Nichts inspiriert mich so sehr wie Geld. Mein Thema ist die Nummer meines Bankkontos, mein Lied ist das Hohelied auf das Geld, und wenn ich mich in den Schlaf singen lasse, höre ich mir die Wechselkurse im Radio an. Wenn Ihr an mich denkt, denkt dann auch immer ein wenig an Geld, denn wenn ich an Euch denke, tue ich das gleiche.« Als ich mit dem Brief fertig war, öffnete ich das Fenster und schrie über die Straße: »Ich bin der Geldhai, der Geldhai is back in town!« Nicht daß mich jemand gehört hätte, denn von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends donnern ununterbrochen Lastwagen durch meine Straße, und die übertönen jedes Geräusch. Selbst wenn man sich mit dem Megaphon aus dem Fenster hängen würde, käme man nicht dagegen an.
Von den Lastwagen habe ich überall in der Wohnung einen schwarzen Belag, auch wenn ich die Fenster fest geschlossen halte. Eine Weile habe ich noch versucht, den Belag mit einem Schwamm von den Wänden zu kriegen, doch irgendwann habe ich das aufgegeben. Ab und zu rede ich noch mit dem Mann vom Kakerlakendienst darüber; jeden Mittwochmorgen um elf steht er vor meiner Tür. Er ist immer sehr pünktlich. Ein netter Mann. Wir plaudern jedesmal ein wenig zusammen. Er sagt: »Du bist der einzige Normale im ganzen Haus.« Er muß es wissen, er kommt in alle Wohnungen. Im Mietvertrag steht: »Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Beamten des Kakerlakendienstes in Ihre Wohnung zu lassen.«
Auf Anraten eines Freundes bin ich in eine Gruppentherapie gegangen, obwohl ich mich überhaupt nicht krank fühlte. Im Gegenteil. Doch mein Freund sagte: »In Amerika ist das ganz normal, so was ist echt nicht nur für Kranke. Alle machen das, Manager, Professoren, Künstler, die erfolgreichsten Leute, man braucht sich wirklich nicht dafür zu schämen.«
»Außerdem«, fuhr er fort, »halten die Leute dich sonst noch für verrückt, wenn du weiter behauptest, du seist der Geldhai und die Nummer deines Bankkontos sei dein großes Thema. So was mögen sie nicht. Damit endest du in der Gosse oder im Irrenhaus. Da kannst du stundenlang aus dem Fenster schreien, daß du der Geldhai bist, und die amerikanischen Irrenhäuser sind echt brutal, das kannst du mir glauben.«
»Das ist ein überzeugendes Argument«, sagte ich. Natürlich überzeugte es mich nicht wirklich. Schließlich war ich die ersten fünfundzwanzig Jahre meines Lebens auch nicht im Irrenhaus gelandet. Es müßte schon sehr irre kommen, wenn ich in den nächsten fünfundzwanzig Jahren dort landen sollte.
Vier Mittwochnachmittage habe ich an der Gruppentherapie teilgenommen: in einem wunderschönen alten Gebäude in einer Straße, durch die nicht vierzehn Stunden am Tag Lastwagen hindurchdonnern. Dort lernte ich das kollektive Unterbewußte kennen – in der Gruppentherapie, meine ich. Die Frau, die die Gruppe leitete, erklärte, daß wir uns das kollektive Unterbewußte wie einen riesigen Apfelkuchen vorstellen müßten und daß jeder Mensch im Kopf ein kleines Stück von diesem Apfelkuchen mit sich herumtrage.
In der Woche darauf mußten wir einen Traum schildern. Ich erzählte – obwohl ich das überhaupt nicht geträumt hatte, ich kann mich nicht daran erinnern, überhaupt je geträumt zu haben –, ich sei im Traum General einer Armee gewesen. Einer Armee, die ich selbst gegründet hatte. Die Armee der Lächerlichen Menschen. Jeden Werktag von sechs bis acht paradierten sie mit mir vorneweg über die Fifth Avenue. Ich schrie durch ein Megaphon: »Dies ist die Armee der Lächerlichen Menschen. Wir rufen alle lächerlichen Menschen dazu auf, sich uns anzuschließen. Mann oder Frau, jung oder alt, schön oder häßlich, welcher Glaubensrichtung auch immer Sie angehören, jeder kann sich der Armee der Lächerlichen Menschen anschließen. Jeden Werktag von sechs bis acht paradieren wir über die Fifth Avenue und winken mit unseren Regenschirmen den anderen lächerlichen Menschen zu. Das ist alles, was wir wollen: mit unseren Regenschirmen den anderen lächerlichen Menschen zuwinken. Jeden Werktag von sechs bis acht auf der Fifth Avenue.«
Eine geschlagene Stunde lang hat die Gruppe meinen Traum analysiert. Wie ein Rudel ausgehungerter Hunde, das sich auf einen Knochen stürzt. Das kollektive Unterbewußte in Form eines Apfelkuchens kam natürlich auch wieder zur Sprache, und ich mußte an Broccoli denken.
Wenn es jemanden gab, der kurzen Prozeß mit dem kollektiven Unterbewußten gemacht hätte, dann war er das. Trotzdem ist es seltsam, daß ich plötzlich an ihn denken mußte. An alles mögliche hatte ich nämlich denken wollen, nur nicht an ihn und Elvira.
Elvira hat jetzt bestimmt einen Mann mit Motorrad. Sie wollte immer einen Motorradfahrer, bei dem sie hintendrauf sitzen konnte. Sie war total verrückt auf Motorräder, vor allem auf solche mit Seitenwagen. Sie sagte: »Es ist natürlich keine Bedingung, aber es würde alles viel einfacher machen.«
»Was?« fragte ich.
»Na«, sagte sie, »wenn mein Mann ein Motorrad mit Seitenwagen hätte.«
Geldhai kann man bis zum Ende seines Lebens bleiben – ich meine, als Liebhaber von Elvira Lopez, Weltmeister im Tischfußball oder Sexfanatiker geht das nicht, das versteht jeder.
Drei Tage, nachdem der Filmproduzent mich einen Geldhai genannt hatte, ließ ich mir Visitenkarten mit folgendem Text drucken: »Ich bin der Geldhai. Innen vollkommen leer.« Die verteilte ich, vor allem in Bars. Das hatte ich von Broccoli gelernt. Und wenn Leute mich fragten: »Was meinst du damit?«, dann antwortete ich: »Weißt du, was ein Sparschwein ist? Genau das bin ich: das leere Sparschwein.« Und dann begann ich zu grunzen. Das sind so meine kleinen Späße. In letzter Zeit grunze ich kaum noch. Damals mit Broccoli und Elvira grunzte ich ständig – wir alle drei übrigens. Wir lachten uns darüber kaputt.
Vor einer Weile habe ich mit einer Sache gut vierhundert Mille verdient. Runden wir’s ruhig auf eine halbe Million. Die Leute dachten, ich hätte einen reichen Vater oder sei Drogenhändler oder ein kleines Computergenie. Von der halben Million ist nichts mehr übrig. Obwohl ich nichts Besonderes damit gemacht habe. Ich meine, weder Häuser gekauft noch Jachten, nicht mal eine Stereoanlage. Ich habe oft in Restaurants gegessen und in Hotels geschlafen, immer in der Hochzeitssuite, selbst wenn ich allein war, ich habe mir ein paar seidene Unterhosen gekauft und Leute zu Flaschen Wein, Tiramisu, flambierten Pfannkuchen und solchen Sachen eingeladen. Auch habe ich eine Zeitlang viel Champagner getrunken, vor allem in Hotelbars, da kommt ordentlich was zusammen. Wenn ich heute einen Sohn hätte, würde ich ihm sagen: »Nimm den Champagner und trink ihn im Park oder von mir aus in der U-Bahn, aber laß dich ja nicht mit Champagner in einer Hotelbar erwischen.«
In der Gruppentherapie mußte ich erzählen, warum ich manchmal das Fenster aufriß und nach draußen schrie: »Ich bin der Geldhai, der Geldhai is back in town«, obwohl ich wußte, daß niemand mich hören konnte.
»Manchmal halte ich es nicht mehr aus«, flüsterte ich.
»Was denn?« fragte die Therapeutin.
Mir fiel nichts ein.
»Hast du das Gefühl, daß du geizig bist?« fragte ein Junge aus der Schweiz. Er war immer sehr nett zu mir. Er wollte mich ständig kraulen. »Ich bin doch kein Hund«, zischte ich dann. Aber es nutzte nichts. »Ganz ruhig«, sagte der Junge dann immer und kraulte mich einfach weiter.
»Nein«, sagte ich, »ich habe nicht das Gefühl, daß ich geizig bin, ich denke nur, daß Geld das Wichtigste in meinem Leben ist. Alles, was ich zu sagen habe, kann man in Geld ausdrücken, mein ganzes Leben: die neun Stellen meines Bankkontos fassen alles zusammen, was ich je getan und gedacht habe, alles, wofür ich gebetet und wonach ich mich gesehnt, worüber ich mich gesorgt und worüber ich geschrieben habe. Mallarmé hat geglaubt, daß sich zuletzt alles in ein Buch verwandeln würde; früher glaubte ich das auch. Jetzt glaube ich, daß alles sich schließlich in eine Kontonummer verwandelt. Und wer ein bißchen Verstand hat, sieht zu, daß es eine geheime Kontonummer ist.«
Der junge Schweizer begann mich wieder zu kraulen.
»Günther«, sagte ich, »jetzt hör aber auf.«
»Ich versteh dich«, flüsterte er, »ich versteh dein Volk ja so gut.«
In der folgenden Woche mußte ich alle Dinge auf einen Zettel schreiben, die ich nicht mehr aushielt. Wenn es gerade mal nicht um das kollektive Unterbewußte in Form eines Apfelkuchens ging, mußten wir Sachen auf einen Zettel schreiben. Ich weiß noch, was auf meinem stand: Lastwagen. Leute, die Fragen stellen, auf die es keine vernünftige Antwort gibt, zum Beispiel, ob man Liebe kaufen kann, solche Fragen. Leute, die mich kraulen wie einen Hund oder eine Katze. Die Musik meines Nachbarn. Die Stiefel meines Nachbarn. Die machen immer so: tok, tok, tok – den ganzen Tag. Mein Nachbar übt jeden Tag den Holzschuhtanz: tok, tok, tok, bis er ins Bett geht. So jemanden sollte man in Sicherheitsverwahrung nehmen. Der Mann vom Kakerlakendienst findet das auch. (»Sehr gut«, flüsterte die Therapeutin, »laß deine Aggressionen fließen.«) Männer, die Frauen auf Küchentischen nehmen wollen. Was laufen davon aber auch viele herum auf der Welt. Millionen, aus allen Schichten der Bevölkerung.
Die Therapeutin reagierte auf meinen Zettel, indem sie wieder das kollektive Unterbewußte zur Sprache brachte. Vielleicht gibt es so was wie das kollektive Unterbewußte ja wirklich, nur hat es mich offensichtlich vergessen. Das hat Broccoli auch mal gesagt: »Das kollektive Unterbewußte hat mich vergessen.« Und dann schüttelte er drohend die Faust gegen Passanten. Elvira lachte dazu und sagte: »Ich versteh die Männer nicht, und die verheirateten schon gar nicht.« Um dann hinzuzufügen: »Frauen verstehe ich auch nicht.«
Seit März bin ich Makler. Mein Leben muß sich ändern, dachte ich. Ich muß vertrauensvoll in die Zukunft sehen, statt dauernd zu denken, die Zukunft sei ein Krokodil, das mich fressen will. Ich habe die Prüfung gerade noch geschafft. Mit Ach und Krach, meinte der Lehrgangsleiter, selbst Makler von Beruf. Er hatte graues Haar und eine Brille und trug Tennisschuhe. Er erklärte, er sei einer der erfolgreichsten Makler von New York, doch ich dachte: Wenn du wirklich so ein erfolgreicher Makler bist, warum stehst du dann am hellichten Sonntagmorgen hier und gibst Unterricht? Ich lachte nie über seine Witze. Vielleicht hat er mir darum ein »C« gegeben, und das ist nicht gerade eine Note, auf die man stolz sein kann.
In unserem Maklerlehrgang war ein junger Kerl aus Boston, ein schüchterner Junge mit schwarzem Haar. Er stank ein bißchen, weil er keine Wohnung hatte, wo er sich waschen konnte. Das ist natürlich schon komisch, so ein Immobilienmakler ohne Wohnung. Ich glaube, daß darum niemand mit ihm reden wollte. Mit mir wollten sie auch nie reden. In der ersten Stunde mußten wir sagen, warum wir in den Lehrgang gekommen waren, und ich hatte geantwortet: »Weil ich Leute kennenlernen will.«
»Verstehen«, hatte ich noch hinzugefügt. Natürlich sagt man so was nicht, es war mir einfach herausgerutscht. Ich sagte irgendwas. Schließlich habe ich noch nie in meinem Leben etwas länger als drei Jahre getan.
Der Junge, der ein bißchen stank, setzte sich immer neben mich. Als wir eines Tages zum Lunch bei einem Chinesen waren, verlor er seine Zahnfüllung. Zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde – wir sollten Hypotheken behandeln – meldete er sich und fragte: »Darf ich heute früher weg? Ich muß zum Zahnarzt, ich hab beim Chinesen meine Füllung verloren.« Seitdem haben wir ihn nie wiedergesehen.
Nach meiner Theorie ist die Gefahr, Alkoholiker zu werden, um so größer, je mehr Leute man kennt. Mit Leuten reden geht natürlich, aber wenn man sie mit nach Hause nimmt, wird’s schon gefährlich. Aus mehreren Gründen. Ich hatte mal ein Mädchen bei mir, das nicht mehr gehen wollte. Kurz bevor mir kotzübel wurde, sagte ich zu ihr: »Ich glaube, du solltest jetzt lieber gehen.« Ich schlief auf dem Sofa ein, doch als ich wieder wach wurde, saß sie immer noch da. Und ich sagte ihr noch einmal: »Ich glaube, du solltest jetzt wirklich nach Hause gehen, ich kann nicht mehr.« An manchen Leuten scheint so was glatt abzuprallen. Man kann ihnen sagen, was man will, sie bleiben einfach sitzen. Wahrscheinlich denken sie: Drin ist drin.
Jetzt habe ich drei Zeugnisse: ein Schwimmzeugnis, ein Fahrradzeugnis und ein Maklerzeugnis. Mehr Zeugnisse braucht man nicht, finde ich. Mein Schwimm- und mein Fahrradzeugnis habe ich übrigens verloren, aber ich habe auch weder das eine noch das andere im Leben je wieder vor.
In ein paar Jahren will ich mein eigenes Maklerbüro eröffnen, und zwar unter dem Namen: »Geldhai Ltd.« Den zugrunde liegenden Gedanken möchte ich kurz erläutern. Meiner Meinung nach werden die Leute denken: Ha, ein Makler, der sich »Geldhai« nennt – das muß ein ehrlicher Makler sein, und darum zu mir kommen. Zur Eröffnung werde ich folgende Annonce in die Zeitung setzen: »Neu eröffnet: Geldhai, Immobilienmakler.« Mehr nicht. Broccoli und Elvira hätten das bestimmt eine gute Idee gefunden: »Geldhai Ltd.« Vielleicht sind sie ja jetzt auch Makler.
Elvira habe ich über Broccoli kennengelernt, und als ich mit den beiden zusammen war, war ich noch kein Geldhai. Im Gegenteil: Operation Brando lief auf Hochtouren. Ich hatte Broccoli versprochen, ein Drehbuch für Elvira zu schreiben, denn er wollte sie groß herausbringen. Wir beide wollten sie groß herausbringen, sollte ich besser sagen. Marilyn Monroe, Marlene Dietrich. Diese Größenordnung. Darum sind sie auch nach New York gegangen: um Elvira groß herauszubringen.
Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich hätte Aids – oder womöglich was noch Schlimmeres. Ich hatte Wunden am Pimmel, die einfach nicht weggingen. Drei insgesamt. Keine besonderen Wunden, einfach, als hätte eine Katze mich gekratzt – oder genauer: als hätte ein Insekt mich gebissen. Aber sie gingen nicht mehr weg. Ich war bei mindestens zwanzig Ärzten. Sie fummelten auch alle dran herum, und einige, ohne sich die Hände zu waschen. Beim Pinkeln meinte ich auch immer ein Brennen zu spüren. Vor allem an Tagen nach dem Vögeln. Ich ging zum Arzt, doch der sagte: »Nein, Sie spüren kein Brennen beim Pinkeln.« Natürlich hätte ich ihn eigentlich fragen müssen: »Woher wollen Sie das wissen?«, doch das traute ich mich nicht. Irgendwann dachte ich, ich könnte überhaupt nicht mehr pinkeln. Das war am schlimmsten. Zwei Tage kam gar nichts. Und dann die reinste Fontäne.
Diesmal ging ich nicht zum Arzt, sondern in eine Klinik – eine von denen, wo man anonym liegen kann. Aber wenn man jede Woche hingeht, bleibt man natürlich nicht lange anonym. Ich sagte immer: »Nennt mich einfach David, den Namen brauch ich wenigstens nicht zu buchstabieren.« Ab und zu fragen Leute mich: »Wenn du jetzt alles noch einmal tun könntest, was würdest du dann anders machen?« Dann sage ich immer: »Ich würde mir einen Namen aussuchen, den man nicht zu buchstabieren braucht.« Einen Künstlernamen. Auch wenn man kein Künstler ist, so ein Künstlername kann nie schaden.
Ich bin schon mit vielen unappetitlichen Leuten ins Bett gegangen. Ich selbst bin übrigens auch ein unappetitlicher Typ. Obwohl ich jedesmal saubere Socken anziehe, wenn der Mann vom Kakerlakendienst kommt. Wenn ich mich bei einem Eignungstest oder beim Psychologen charakterisieren sollte, würde ich immer nur schreiben: »unappetitlicher Typ«, und unter »besondere Kennzeichen« vielleicht noch: »Geldhai«. Doch nicht, daß ich je noch mal vorhätte, zu einem Eignungstest oder zum Psychologen zu gehen.
Ich habe in meinem Leben schon vielen Menschen folgen wollen. Unzähligen. Ich habe die Menschen studiert, um sie zu kopieren. Manchmal nannten mich die Leute Broccolis und Elviras Schatten. Elvira brauchte man mit Gott und Religion nicht zu kommen. Jedenfalls sprach sie nie darüber. Nach Elvira habe ich eine Frau angebetet, die reformiert war und oft von Gott und anderen alttestamentarischen Figuren redete. Ihr Name ist Frederika Steinman. Ich habe nach ihr auch Frauen begehrt, die mir nichts über sich erzählt haben, und es kann sehr gut sein, daß auch unter ihnen noch ein paar Reformierte waren, doch Frederika Steinman war so reformiert, daß jeder ihrer Anbeter in ihr zwangsläufig auch immer den reformierten Glauben anbetete.
Menschen mit gutem Geschmack reden nicht über Geld oder Sex. Eine Weile habe ich mich unter Menschen mit gutem Geschmack aufgehalten. Ich fühlte mich bei ihnen wie an der Front, doch das geht mir unter Menschen eigentlich öfter so. Um hier eins klarzustellen: Ich bin nie wirklich an der Front gewesen. Wenn man ganz allein ist, gibt es keine Front. Und wenn man bis zu den Zähnen bewaffnet ist: Für eine Front sind mindestens zwei Menschen nötig. Für Sex hat man an sich selbst genug. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Sex und Front.
Ich habe eine Hitliste der drei Phantasien aufgestellt, die nie Wirklichkeit werden dürfen. Meiner Meinung nach muß man alles dafür tun, um die Verwirklichung dieser Phantasien zu verhindern. Ungefähr einmal pro Tag rufe ich sie mir in Erinnerung und trommle dabei auf einem englisch-niederländischen Wörterbuch, denn darauf trommelt es sich so schön. Auf Platz drei: Sex mit Tieren und Pflanzen. Auf Platz zwei: Fallschirmspringen. Und auf Platz Nummer eins: Selbstmord in all seinen Varianten, inklusive Würgesex und Sich-selbst-in-den-Müll-Werfen.
»Entspann dich«, sagen die Leute oft zu mir. Aber ich entspanne mich nicht. Entspannen kann ich mich im Grab. Solange man lebt, muß man auf der Hut bleiben, denn ehe man sich’s versieht, ist wieder eine Phantasie Wirklichkeit geworden, und das kann dann gerade die eine fatale sein.
I
Broccoli
Den ganzen Tag waren wir durch die Stadt gelaufen, auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um uns gegenseitig zu fotografieren. Jedesmal stimmte etwas anderes nicht. Mal war es das Licht oder der Hintergrund, mal war es meine glänzende Nase.
»Mit einer glänzenden Nase wird es nichts«, sagte Broccoli, »die Welt wartet nicht auf Leute mit glänzenden Nasen.«
Das hatte ich inzwischen auch gemerkt. Schon seit sechs Stunden liefen wir durch die Stadt. Es war heiß. Unsere Leben hingen von diesen Fotos ab. Leben hängen von den verrücktesten Dingen ab, von Fotos, von Geld, von einem Stau, von einer nachgehenden Uhr.
»Wir müssen eine Drogerie finden«, sagte Broccoli, »wir müssen dir die Nase pudern.«
Ich trottete hinter ihm her. Er machte große Schritte. Sein Fotoapparat hing ihm lose um den Hals. Ich war achtzehn und wollte jemand anders werden, am liebsten vor hundert oder lieber noch vor tausend Zuschauern. Am liebsten eigentlich vor laufender Kamera. Auch Broccoli wollte sich vor laufender Kamera in jemand anders verwandeln. Wenn niemand sehen konnte, daß man jemand anders geworden war, hatte man ja nichts davon. Ab und zu legte Broccoli seinen Arm um meine Schultern und sagte: »Wir werden Stars der Leinwand, da läßt sich nichts dran ändern.«
Plötzlich blieb Broccoli stehen und sagte: »Du hast ein komisches Gesicht, weißt du das?«
»Das weiß ich«, antwortete ich.
Er sah mich lange an und sagte: »Du hast das komischste Gesicht, das ich je gesehen habe.« Und gleich darauf: »Man muß sich seiner eigenen Schwächen immer bewußt bleiben.«
Er war genial. Ich bin nicht vielen genialen Menschen im Leben begegnet, es ist also nicht bloß dahergesagt, wenn ich ihn genial nenne.
Broccoli fuhr fort: »Du mußt dir so ein Schneidermaßband kaufen und dir damit den Kopf messen. Es kann nie schaden, die Maße des eigenen Kopfes zu kennen. Ich trage meine Kopfmaße immer bei mir.« Und tatsächlich holte er ein kleines Notizbuch aus seiner Hosentasche. Es war leer bis auf die erste Seite: Dort hatte er die Maße seines Kopfes eingetragen.
»Broccoli«, sagte ich, »deine Nase glänzt auch.«
Er blieb stehen.
»Wirklich?« fragte er.
»Wirklich«, antwortete ich. Ich kniff die Augen zusammen, um seine Nase besser betrachten zu können. Eigentlich brauchte ich eine stärkere Brille. »Du hast auch schwarze Punkte drauf.«
Er fluchte. »Dann müssen wir meine Nase auch pudern. Sonst ist alles für die Katz. Dann legen sie uns in irgendeine Schublade zu den anderen glänzenden Nasen.«
Broccoli glaubte, daß die Agenten der Filmgesellschaften in ihren Schreibtischen lauter Schubladen hatten, in denen sie die Leute nach körperlichen Gebrechen einordneten.
Er lief wieder vor mir her. Ich hatte ihn noch nie so viel laufen sehen wie heute. Normalerweise bewegte er sich nur in Taxis. Schließlich fanden wir eine Drogerie. Broccoli blieb vor dem Eingang stehen. »Du darfst nicht vergessen«, sagte er, »daß jeder Mensch schwarze Punkte auf der Nase hat. Sonst kann die Nase nicht atmen, sonst stirbt sie ab.«
Hinter der Ladentheke stand eine Verkäuferin. Sie hatte blondes Haar und rote Wangen. Sie hatte sehr viel roten Puder aufgetragen. Die reinste Kriegsbemalung.
Ich war damals sehr leicht entflammbar. Wie Benzin. Ich kämpfte mit allen möglichen Mitteln dagegen. Das hatte Broccoli mir geraten. Ihm zufolge mußte man sich immer erst einen runterholen, bevor man eine Frau anmachte. Sonst war man zu nervös, und die Welt wartete nicht auf nervöse kleine Würstchen, wie Broccoli sagte. Die Leute hatten mit ihrer eigenen Nervosität schon genug zu tun. Er wollte sogar ein Buch darüber schreiben. Und es mir widmen.
»Wir brauchen Puder«, sagte Broccoli.
»Wofür?« fragte die Verkäuferin.
»Für unsere Nasen«, sagte Broccoli. »Das kann man sehen, nehme ich an.« Er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Broccoli schien sich nie für irgend etwas zu schämen.
»Es ist für eine Fotosession«, hörte ich ihn sagen.
»Ach so«, sagte die Verkäuferin.
Ich betrachtete angestrengt den Fußboden und dann das Angebot an Rheumapflastern – diese Sorte, die man sich auf den Rücken kleben muß, und dann geht das Rheuma weg. Ich sah, wie die Verkäuferin ihr Gesicht dicht vor Broccolis Nase hielt. Ich merkte, daß ich wieder entflammte; darum konzentrierte ich mich auf die Rheumapflaster. Ich hatte damals oft unwillkürliche Erektionen, vor allem in Kneipen. Dann wagte ich nicht mehr aufzustehen, aus Angst, daß alle es sehen könnten, und blieb so lange sitzen, bis es vorüber war. Ich begann sogar, weite Bundfaltenhosen zu tragen. Ich dachte ständig, die Leute würden mir zwischen die Beine sehen. Wir hatten damals einen Rabbiner, der sagte, Gott sähe alles, auch zwischen unseren Beinen, und daß wir uns darum immer gut waschen müßten. Und für eine Beschneidung sorgen, wenn wir noch nicht beschnitten wären. Mir war es immer noch lieber, Gott sah mir zwischen die Beine als die Leute auf der Straße. Broccoli fand, ich sähe in den Bundfalten aus wie ein Bauer aus Volendam. Darum zog ich schließlich wieder normale Hosen an.
»Komm her«, rief Broccoli, »sie will sich deine Nase auch ansehen.«
Ich stand noch nicht richtig an der Theke, da hielt sie ihr Gesicht schon so dicht vor meins, daß ich die Fältchen um ihren Mund sehen konnte. Vorsichtshalber hörte ich auf zu atmen.
»Ihr beide habt nicht die gleiche Hautfarbe«, sagte sie. »Ihr braucht zwei verschiedene Sorten Puder.«
»In Ordnung«, sagte Broccoli.
Sie sagte noch, daß sie uns bestimmt nicht so schnell vergessen würde, und Broccoli antwortete: »Ich Sie auch nicht.«
Vor dem Laden wollte Broccoli meine Nase pudern.
»Muß das unbedingt hier sein?« fragte ich. »Alle starren uns an. So kann ich mich nicht konzentrieren.«
»Jetzt oder nie«, sagte er. Er packte mein Gesicht und rubbelte mit der Quaste rauh über meine Nase. Ich kniff die Augen zusammen, um nicht sehen zu müssen, wie die Leute uns anstarrten.
»Jetzt du.« Er gab mir die Quaste und öffnete die andere Puderdose. Eine plötzliche Windbö blies mir die Hälfte des Puders in den Mund und auf die Brillengläser, doch das war Broccoli schnuppe. Er war wie besessen. Ich sah, wie immer mehr Leute stehenblieben und auf uns zeigten. Auch die Verkäuferin stand jetzt mit einem Kunden vor der Drogerie und sah uns zu.
»Es gibt einen Menschenauflauf«, flüsterte ich. »Laß uns in den Park gehen.« Broccoli hatte seine Brille nicht auf, darum konnte er wenig sehen. Ohne Brille war er praktisch blind.
»Wenn du in Hollywood bist«, rief er, »gibt es auf der Straße dauernd Menschenaufläufe um dich herum. Alles Leute, die ein Autogramm wollen. Wenn du so einen kleinen Menschenauflauf nicht aushältst, schaffst du’s nie in Hollywood.«
»Ich bin doch kein Maskenbildner«, jammerte ich.
»Jetzt puder mir die Nase«, rief Broccoli, »oder ich schlag dir die Brille vom Kopf, du pickliger Pudel.«
Broccoli meinte es gut. Darum nahm ich es ihm nicht übel. Eigentlich war es sehr lustig, wenn er das sagte. Er wollte den Menschen ihre Schwächen zu Bewußtsein bringen. Nicht allen natürlich, aber mir, weil ich sein Freund war. Ich puderte ihm die Nase, wie er es auch bei mir getan hatte.
Wir hatten gelernt, daß sich in dieser Welt das Innere vor allem im Äußeren widerspiegelt, und waren bereit, uns den Regeln dieser Welt zu beugen. Denn Hollywood rief uns. Broccoli vielleicht etwas lauter als mich, doch mich wiederum rief Broccoli, und so lief alles aufs gleiche hinaus.
Als ich fertig war, sagte Broccoli: »Jetzt landen wir wenigstens nicht in der Schublade bei den glänzenden Nasen.«
An einem Kiosk kaufte er sich eine Dose Bier. Ich hatte das Gefühl, daß der Schweiß auf meiner Nase hängenblieb und zusammen mit dem Puder verkrustete, doch das wagte ich nicht zu sagen.
Broccoli trank, wie andere rauchen. Mehr aus Nervosität, als weil er Durst hatte oder betrunken werden wollte. Er wurde auch niemals betrunken. Er schlief einfach ein.
»Nicht so schnell, Broccoli!« rief ich. An einer Ampel blieb er stehen. An seinen Lippen klebte Bierschaum, und seine Brillengläser waren voller Puder.
Wir hatten den Lockruf Hollywoods gehört, so wie andere den des Klosters oder ihrer ehebrecherischen Nachbarin, den des großen Geldes oder den Lockruf Gottes. Vor allem abends, wenn alles ruhig war, hörten wir den Lockruf, der uns gelten mußte. Dann wurden wir ganz kribbelig.
Manchmal wählte Broccoli mitten in der Nacht eine Telefonnummer in Hollywood. Oft legte er sich danach aufs Bett und betrachtete seinen Bauch. Dann sagte er: »Wenn ich je einen Bierbauch bekommen sollte, wird es der schönste Bierbauch der ganzen Welt.«
Wie Broccoli es fertigbrachte, jeden Tag um acht Uhr aufzustehen und schon gleich Lust auf Bier zu haben, ist eine seiner Eigenarten, die ich nie verstanden habe und wohl auch nie verstehen werde.
»Hier«, sagte Broccoli, »hier ist das Licht gut.« Wir waren vor einem Haus an der Realengracht stehengeblieben. Ich konnte an dem Licht nichts Besonderes entdecken. Vielleicht fand er das Haus einfach nur schön oder hatte mit den Bewohnern später noch etwas Geschäftliches zu regeln.
»Für jeden von uns stehen zwölf vor der Tür«, sagte er, »hundert, vielleicht sogar tausend.« Dann zog er mich am Ohr zu sich heran und flüsterte: »Sie gehen nur nach den Fotos, also gib dir Mühe.«
Trotz der Hitze trug Broccoli einen Regenmantel. Er war vier Jahre älter als ich. Das hatte er mir jedenfalls gesagt. Er hatte mir auch gesagt, daß er mit sechs Jahren von seiner Familie zum Wunderkind ausgerufen worden war. Es geschah im Wohnzimmer, erzählte er, er spielte auf seiner Geige, und plötzlich rief die ganze Familie: »Er ist ein Wunderkind, er ist ein Wunderkind.« Es fiel sogar jemand in Ohnmacht dabei. Eine angeheiratete Tante rief: »O Gott, schon wieder ein Wunderkind in der Familie!«
Seitdem ließen seine Eltern ihn nur noch auf der Dachterrasse Geige spielen. Die Nachbarskinder befeuerten ihn mit Tennisbällen und faulen Äpfeln aus ihrem Garten. Doch seine Mutter rief ständig weiter aus dem Fenster: »Er ist ein Wunderkind, er ist ein Wunderkind.«
Nachdem er mir das alles erzählt hatte, hatte er sich ein paar Schritte von mir entfernt hingestellt und gesagt: »Ein Wunderkind kommt durchschnittlich nur alle hundert Jahre vor. Du hast ein sehr seltenes Exemplar vor dir. Vergiß das nicht.«
Broccoli nahm eines der Taschentücher, die er sich aus einem alten Geschirrtuch zurechtgeschnitten hatte, und wischte sich damit den Schweiß aus dem Gesicht. Er hatte mich überreden wollen, mir meine Taschentücher auch aus alten Geschirrtüchern zurechtzuschneiden. Er sagte, das sei, um Geld zu sparen, doch dazu war Broccoli nicht der Typ. Meiner Meinung nach schnitt er sich die Taschentücher nur darum aus alten Geschirrtüchern zurecht, weil er zu faul war, sich seine Taschentücher zu kaufen. Meine Eltern hatten genug Taschentücher, genug für ein ganzes Waisenhaus, um genau zu sein. Das sagte ich Broccoli auch. Außerdem hätte meine Mutter mich massakriert, wenn ich ihre Geschirrtücher zu Taschentüchern verarbeitet hätte.
»Sehe ich ein bißchen geeignet aus für einen Western?« fragte Broccoli. Auf das Genre wollte er sich nämlich spezialisieren. Sein Lieblingssatz war: »I kill for money. But because you are my friend, I’ll kill you for nothing.«
Ich fand nicht, daß ihm eine Westernkarriere ins Gesicht geschrieben stand, eher schon eine Rolle in Tod eines Handlungsreisenden. Aber das sagte ich ihm natürlich nicht.
Ich schoß zwölf Fotos hintereinander, ohne auf das Licht zu achten.
Als er dran war, sagte er: »Schieb deine Haare zur Seite, sonst sieht niemand was von deinem Gesicht.« Er tanzte mit dem Fotoapparat vor mir auf und ab. Ich hatte das Gefühl, daß auf meiner Nase eine ganze Schlammgrube Puder klebte. Doch Broccoli sagte mir, ich sähe aus wie eine kleine Ratte, die gleich jemandem die Eier abbeißen will.
Kurz darauf legte er seinen Arm um mich und sagte: »Aber vielleicht suchen sie ja gerade eine kleine Ratte. Bestimmt sogar, kleine Ratten haben sie immer nötig.«
Er kannte ein Fotogeschäft auf dem Muntplein, wo sie ihm einen Sonderpreis berechneten.
Technisch ungeeignet
Mit siebzehn fuhr ich nach Maastricht, um mich bei der dortigen Schauspielschule zu bewerben. Ich hatte gehört, daß die Schauspielschule Maastricht die beste sei.
Ich wohnte im Hotel de la Bourse. Das Hotel wurde vor allem von Handelsreisenden bevölkert. Jeden Morgen um acht klopfte die Putzfrau an meine Tür und rief in drei Sprachen, daß sie jetzt reinkomme, um zu wischen. Man konnte hundertmal rufen: »Nein, ich bin noch nackt!« – sie kam einfach ins Zimmer.
Es war Juni und sehr heiß. Ich trug eine kurze Hose, die ich kurz vor meiner Abreise aus Amsterdam bei Sissy-Boy gekauft hatte. Mir war eingefallen, daß die modebewußten Mädchen in der Schule dort auch immer ihre Kleidung kauften. Die Hose war mir drei Nummern zu groß, doch nach Meinung der Verkäuferin war es in jenem Jahr Mode, in zu großen Hosen herumzulaufen.
»So, mein Junge, trägst du auch so eine ›Ach-Mama-es-ist-so-heiß-Hose‹«, war das erste, was die Theaterdozentin in Maastricht zu mir sagte. Der Begriff »Ach-Mama-es-ist-so-heiß« sagte mir überhaupt nichts, darum lächelte ich nur freundlich zurück.
Am zweiten Tag wurden alle Jungen in einem kleinen Raum eingeschlossen, wo wir uns ausziehen mußten. Nur die Unterhosen durften wir anbehalten. Die Mädchen warteten in einem anderen Zimmer. Einer nach dem anderen wurden wir aus dem Raum herausgeholt.
Als ich an der Reihe war, brachte ein Mann mich in einen Turnsaal. In meiner Unterhose lief ich neben ihm durch die Gänge der Schauspielschule Maastricht. Angezogene Menschen haben nackten oder halbnackten eine Menge voraus, wurde mir plötzlich bewußt.
Im Turnsaal saßen zwei Frauen und ein Mann an einem Tisch. Der Mann saß in der Mitte. Er trug eine Brille und hatte kurzes, weißes Haar. Zuerst starrte er mich eine Minute lang an. Ohne ein Wort zu sagen. Ich dachte schon, ich hätte etwas Komisches an mir, und untersuchte so unauffällig wie möglich meinen Körper, doch ich konnte nichts entdecken. Zum Glück starrten die beiden Frauen nicht in meine Richtung. Sie sahen aus dem Fenster und gähnten. Schließlich mußte ich mich vor den Tisch stellen und laut und deutlich meinen Namen sagen.
»Ewald Stanislas Krieg«, sagte ich.
»Stanislas Krieg, ist das ein doppelter Familienname?« fragte der Mann.
»Nein«, sagte ich, »Ewald Stanislas ist ein doppelter Vorname.«
Der Mann machte sich eine Notiz. Danach kam er hinter dem Tisch hervor und begann, mich in die Achillessehne zu kneifen. Ich sagte, daß das kitzelte. Er machte ungerührt weiter. Nach zwei Minuten fand er, daß er lange genug an meinen Beinen herumgefummelt hatte.
Er sagte: »Und jetzt, Ewald Stanislas, spring.«
»Ewald, einfach Ewald, das langt schon.«
»Spring«, sagte er.
Ich sprang.
»Höher«, sagte der Mann.
Ich sprang höher.
»Noch höher«, sagte der Mann.
Ich sprang noch höher. Ich kam mir vor wie ein Laubfrosch. Doch der Mann rief immer wieder: »Höher, höher.« Ich fragte mich, warum man unbedingt einen Rekord im Hochsprung aufstellen mußte, um Schauspieler zu werden.
Als der Mann fand, daß ich genug gesprungen war, sagte er: »Und jetzt lauf eine Gerade.«
Ich lief eine Gerade.
Dreimal mußte ich die Gerade wiederholen.
Schließlich sagte die Frau hinter dem Tisch: »T.U.«
Ich fragte, was das bedeutete, und sie sagte: »Technisch ungeeignet.«
»Na, vielen Dank jedenfalls für Ihre Mühe«, sagte ich.
»Vielen Dank für deine Mühe«, sagte der Mann, der mich in die Achillessehne gekniffen hatte. Danach verließ ich den Raum. Ich sah, daß der nächste schon in Unterhose bereitstand.
Am folgenden Tag mußte ich einen Gesangstest ablegen. Ich mußte tête-à-tête mit einer Dame ein Stück aus einer Oper singen. Die Dame war Ende Achtzig und hatte rotes, gelocktes Haar.
»Stanislas«, sagte die Dame, »das ist ein seltsamer Name! Das klingt wie Stanislawski – du weißt doch, wer Stanislawski war?«
»Ungefähr«, sagte ich, »wir haben einander nie kennengelernt.«
»Stanislawski, der große Theaterreformer«, sagte die Dame.
Ich kannte keine Opernarie. Darum sang sie mir etwas vor, und das durfte ich dann nachsingen, was gar nicht so einfach war. Ich mußte die ganze Zeit an schlechten Atem denken.
»Nein«, sagte sie, »du mußt schon den Mund aufmachen, wenn du singen willst. Mach den Mund auf, aufmachen, sag ich! Draußen warten noch zweihundert andere.«
Die Frau hielt ihr Ohr vor meinen Mund, und ich mußte allerlei Geräusche produzieren. Ein »U« und ein »E« und ein »langes U« und »noch eins aus dem Bauch« und ein »U«, das im Hals steckenblieb.
Schließlich wollte sie mir in den Hals sehen.
Ein paar Minuten später sagte auch sie: »T.U.«
Den Rest der Woche besuchte ich noch einige Kurse, obwohl mir inzwischen klar war, daß meine Chance, angenommen zu werden, minimal war. Die Schulleitung hatte uns ans Herz gelegt, vor allem die anderen Aspiranten und Aspirantinnen kennenzulernen, doch es gelang mir nicht, auch nur ein Gespräch mit ihnen anzuknüpfen.
Vor den Leuten an der Schauspielschule Maastricht hatte ich riesige Angst. Eine Angst, die so groß war, daß ich mich jeden Morgen mit wahrer Todesverachtung durch die Eingangstür der Schauspielschule hindurchkämpfen mußte. Ich mußte mich mächtig bezwingen, um nicht einfach im Dunkel des Hotel de la Bourse liegen zu bleiben, wo ich wenigstens nicht wie ein Frosch in Unterhosen auf- und abzuspringen brauchte. Wahrscheinlich hielt ich einfach nur darum an der Schauspielschule fest, weil mein Vater mir gesagt hatte: »Sich Mühe geben ist nicht genug. Auf dem Totenbett mußt du dir sagen können: ›Es hat nicht geklappt, aber Gott weiß, daß ich alles versucht habe. An mir hat es nicht gelegen.‹«
Abends irrte ich durch Maastricht und aß auf Kosten meines Vaters in teuren Restaurants, wo ich mich notfalls für verarmten Adel ausgab. Meine Mitaspiranten aßen in der Kantine der Schauspielschule und hingen in Kneipen herum, in die ich mich nicht hineintraute. Nach dem Essen schloß ich mich in mein Hotelzimmer ein und erlebte ausgesprochen wilde Nächte mit mir selbst. Auch das Bad wurde Schauplatz meiner solistischen Liebesspiele. Als Experiment nahm ich mir vor, meine Abgänge für eine Weile jeden Abend unter Wasser zu produzieren. Manchmal rochen meine Finger schon frühmorgens nach Samen, aber weil ich ja der einzige war, der an ihnen roch, schien mir das eigentlich kein Problem.
Einmal sagte ich in der Kantine zu einem Mitaspiranten: »Seit ein paar Wochen hab ich ganz schwarzes Sperma. Alles, was kommt, ist kohlrabenschwarz – denkst du, ich sollte mal zu ’nem Arzt gehen?«
Ich gebe zu, das war vielleicht kein sehr guter Witz, aber doch immerhin ein Versuch. Doch seit dem Tag machten der Mitaspirant und seine Freunde einen großen Bogen um mich. Seitdem habe ich niemandem mehr etwas von meinem schwarzen Sperma erzählt.
Je jünger, gesünder und fröhlicher die Menschen, um so größer meine Angst vor ihnen. Auf der Schauspielschule Maastricht wimmelte es von jungen, gesunden und fröhlichen Menschen. Ganz Maastricht wimmelte von jungen, gesunden und fröhlichen Menschen – bis auf die Putzfrau, die jeden Morgen um acht in mein Zimmer eindrang.
Am letzten Tag mußten wir im großen Saal der Schauspielschule einen Monolog und ein Stück Lyrik vortragen. Ich hatte mir ein vollkommen unverständliches Gedicht von Boudewijn Büch ausgesucht. Es hatte in der letzten Literaturbeilage der Avenue gestanden und kam mir ungeheuer tiefsinnig vor. Danach sprach ich einen Monolog aus einer griechischen Tragödie. Mittendrin bekam ich heftige Bauchkrämpfe.
In jener Woche hatte ich mich zum ersten Mal an Garnelen vergriffen – Riesengarnelen, um genau zu sein. Ich war in der Überzeugung groß geworden, nur Fische mit Flossen und Schuppen essen zu dürfen wie Kabeljau, Scholle, Seezunge und Karpfen, um nur einige zu nennen. Tintenfisch, Garnelen, Muscheln und Austern dagegen waren verboten. Zu Hause nahmen wir die Speisevorschriften sehr genau. Nicht, daß bei uns auch nur einer an Gott geglaubt hätte. Wir klammerten uns an die Speisevorschriften, weil auch unsere Vorfahren sich daran geklammert hatten.
Ich war fest davon überzeugt, in meinen Bauchkrämpfen die Hand Gottes zu spüren, der sich damit für die Riesengarnelen rächte, die ich am Vortag gegessen hatte. Während des Monologs waren meine Gedanken hauptsächlich bei Riesengarnelen, doch das fiel niemandem auf.
Noch im selben Sommer setzte ich mich auf eine einwöchige Muschel- und Riesengarnelendiät, bis ich keine Riesengarnele oder Muschel mehr sehen konnte. Es war, als schüttelte ich meine Faust gegen den Allmächtigen und riefe: »Ich spiel nicht mehr mit, Deine Gesetze sind nicht mehr meine, wenn Du was gegen Riesengarnelen hast, okay, aber ohne mich. Ich stürze mich ins mondäne Leben, wo sie ganze Austernbänke verputzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich gehöre nicht mehr zu den früh Gebrochenen, ich lasse den Geruch des freiwilligen Ghettos hinter mir und stürze mich in die Welt der Riesengarnelen. Monte Carlo, Las Vegas, Hollywood, die italienische Riviera! Wenn Du mich suchst – dort kannst Du mich finden.« So oder so ähnlich ging der Monolog, den ich täglich gegen den Allmächtigen losließ.
In der Woche der Riesengarnelendiät rief jemand von der Schauspielschule Maastricht bei uns an und teilte mit, daß ich nicht angenommen worden sei und es in den kommenden Jahren auch nicht noch mal zu probieren bräuchte. Ich war nicht zu Hause, mein Vater nahm das Gespräch an. Das Leben lag vor mir, damit war alles gesagt.
Ich tat nichts. Früh am Morgen schlich ich mich aus dem Haus meiner Eltern in der Prinses Margrietstraat, und erst spätabends, oft mitten in der Nacht, kam ich wieder zurück. Dabei achtete ich darauf, daß die Leute von der Prinses Margrietstraat mich nicht zu sehen bekamen. Meistens klappte das, nur manchmal begegnete ich unserer Nachbarin mit ihrem Hund. Sie führte den Hund zu den unmöglichsten Tageszeiten aus. Wenn ich sie sah, ging ich auf die andere Straßenseite und blickte starr auf den Boden.
Niemand zieht freiwillig in ein Ghetto, doch in der Prinses Margrietstraat wohnten alle aus freien Stücken. Sogar mehr als das. Viele hatten jahrelang darauf gespart, dort wohnen zu können. Bei einer Bewerbung sagte mal jemand zu mir: »Oh, Sie wohnen in der Prinses Margrietstraat! Da komm ich höchstens sonntags mal durch. Olala, die Prinses Margrietstraat!«
Gegen Ende des Sommers bekam meine Mutter Besuch von einer fülligen jüdischen Dame mit zwei heiratsfähigen Töchtern. Es war ein schöner Tag, und meine Mutter empfing die Frau und ihre Töchter in unserem Garten.
»Ihr Sohn wird bald achtzehn«, sagte die Frau. »Er hat keinen Schulabschluß, und er geht nicht in die Synagoge, trotzdem habe ich vollstes Vertrauen in ihn. Darf ich Ihnen meine beiden Töchter vorstellen?«
Meine Mutter zog mich aus dem Badezimmer und setzte mir eine Kippa auf. Ich sagte den Töchtern guten Tag. Die eine hatte einen Mund wie ein Briefkasten, die andere sah aus wie nicht von dieser Welt. Sie starrte auf den Boden, und man mußte sie ein paarmal anstoßen, bevor sie mir die Hand gab. Vielleicht war es Einbildung, doch es kam mir vor, als ob kleine Speichelbläschen an ihren Lippen klebten.
Nachdem jeder eine Tasse Kaffee bekommen hatte, sagte die Mutter der beiden Mädchen: »Wir sind nicht reich, aber wir sind eine fruchtbare Familie, und das ist auch eine Art Reichtum.« Ich starrte die Töchter an, doch sie sahen nicht zurück.
»Natürlich«, sagte meine Mutter, »das ist auch eine Art Reichtum.«
»Ich habe volles Vertrauen in deinen Sohn«, sagte die Mutter. Plötzlich sagte sie nicht mehr »Sie.« Das machte mich mißtrauisch. Danach umarmte sie mich und sagte: »Du bist mein Bester, ich lieb dich jetzt schon wie einen Sohn.« Sie drückte mein Gesicht fast platt an ihrem großen Busen.
»Ach, das brauchen Sie nicht«, sagte ich.
»Aber ja doch«, sagte sie, »aber ja!«
Plötzlich bekam ich eine Eingebung, die für eine Weile zu einer gewissen Entfremdung zwischen mir und meinen Eltern führen sollte – auch zwischen meinen Eltern (besonders meiner Mutter) und der jüdischen Gemeinde übrigens. Ich begann, auf und ab zu hüpfen, so wie ich es auf der Schauspielschule Maastricht getan hatte. Während des Hüpfens entledigte ich mich langsam meiner Kleidung. Zuerst lachte die Mutter der Mädchen noch herzlich und sagte: »So ein fröhlicher Junge.« Als ihr klar wurde, daß ich auch noch meine Unterhose ausziehen würde, hielt sie ihren Töchtern die Augen zu. Kurz darauf flüchteten sie vom Grundstück. An der Gartentür drehte sich die Tochter, die mir geistig nicht ganz gesund vorkam, noch einmal um und starrte mich mit großen Glupschaugen an. Meine Mutter rannte ihnen noch hinterher, doch ohne Erfolg. Ich blieb, wie ein Frosch auf und ab hüpfend, nackt im Garten zurück.
Seitdem wurden meiner Mutter keine Heiratskandidatinnen mehr angeboten. So kommt es, daß ich unverheiratet bin.
Im darauffolgenden Frühjahr lernte ich Broccoli kennen. Er war nicht jung, nicht gesund und Gott sei Dank auch nicht fröhlicher als ich. Vor ihm hatte ich dann auch keine Angst.
Mevrouw Meerschwam
Broccoli lernte ich in der Eingangshalle der Schauspielschule Amsterdam kennen. Er stand vor einer Säule und hielt eine Tirade gegen Schauspielschulen im allgemeinen und gegen die Schauspielschule Amsterdam im besonderen. Vorher war er mir nicht aufgefallen.
Plötzlich fragte er mich: »Was stehst du da und gaffst mich an, du Lümmel?«
Das letzte Mal, daß ich das Wort »Lümmel« gehört hatte, war vor Jahren aus dem Mund meiner Mutter gewesen, und selbst bei ihr hatte es leicht lächerlich geklungen. Ich trug meine Bundfaltenhose. Sie rutschte dauernd herunter, und ich mußte sie ständig wieder hochziehen.
»Angenommen oder abgelehnt?« fragte er.
»Abgelehnt«, sagte ich.
»Ich auch«, sagte er, »gehen wir eine Fischsuppe essen.« Er trug eine kurze Hose. Später erklärte er mir, daß seine Beine viel frische Luft bräuchten. Noch später erklärte er mir, daß die Welt nicht auf Leute mit weißen Beinen wartete. Schon gar nicht, wenn sie spindeldürr waren. Es gab viele Sorten Leute, auf die die Welt nicht wartete, und wenn ich Broccoli glauben durfte, kam alles darauf an, nicht auch dazuzugehören.
Und ich glaubte Broccoli. Wenn jemand damals zu mir gesagt hätte: »Broccoli ist Gottes Sohn«, dann hätte ich ihn mir noch einmal genau angesehen und gedacht: Ja, da ist was dran.
Wir gingen ins ›Walem‹. Als wir die Fischsuppe aufgegessen hatten, erzählte er, daß seine Freunde ihn Broccoli nannten.
»Und die anderen?« fragte ich.
»Für die anderen bin ich Mister Broccoli«, sagte er. Danach holte er eine Kreditkarte aus seiner Hosentasche und schwenkte sie über dem Kopf. »In dieser Art von Lokalen erzwingt sich nur die Unhöflichkeit Respekt«, erklärte er mir. Kurz darauf flüsterte er mir ins Ohr: »Was für diese Art von Lokalen gilt, gilt leider auch für den größten Teil der restlichen Welt. Es ist traurig, aber wahr.«
Dann küßte er mich aufs Ohrläppchen. Ich war noch nie aufs Ohrläppchen geküßt worden, weder von einem Mann noch von einer Frau. Ich wußte nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Darum fragte ich schließlich: »Und wie kriegt man so eine Kreditkarte?« Doch er antwortete nicht.
Später, als wir durch die Leidsestraat liefen, sagte er: »Du mußt mal zu mir nach Hause kommen. Ich würde gern mal deinen Kopf messen.«
»Pardon?« fragte ich.
»Alles muß gemessen werden«, antwortete Broccoli, »glaub mir das. Vor allem Köpfe. Meinen eigenen Kopf hab ich auch schon ein paarmal gemessen. Dadurch erfährt man sehr interessante Dinge.«
Manchmal sprach er so leise, daß man ihn kaum verstehen konnte, und dann wieder schrie er mitten auf der Straße: »Ich bin so empfindsam, ich bin so schrecklich empfindsam.« Am Anfang schämte ich mich natürlich dafür, doch das konnte er nicht leiden: Leute, die sich für ihn schämten. Nein, das konnte er auf den Tod nicht ausstehen.
Er wohnte an der Bernard Zweerskade im Haus seiner Eltern, doch sie waren nicht da. Sie waren nie da, wie ich bald herausfand. Sie hatten sich in die Schweizer Berge zurückgezogen, weil sie Ruhe und Erholung brauchten.
Das erste, was mir in seinem Haus auffiel, war der Geruch. Eine Mischung aus Mottenkugeln und süßem Parfüm, wie alte Frauen es benutzen. Im Wohnzimmer waren die Sofas mit Plastikschonern abgedeckt. Vor dem Kamin lag Holz zum Trocknen. Es kam mir so vor, als sei das das einzige, wozu dieses Zimmer noch benutzt wurde.
In der Küche saß eine Frau mit dickem, grauem Haarschopf und trank Tee. Als sie Broccoli sah, stand sie auf und schimpfte: »Auf dem Herd steht eine Pfanne mit Würstchen, die haben bestimmt schon drei Wochen da gestanden, sie waren schon ganz weiß vor Schimmel.«
Broccoli gab ihr einen Handkuß.
»Pfui«, rief die Frau mit den grauen Haaren, »du elender Schmutzfink.«
»Das ist Mevrouw Meerschwam«, sagte Broccoli zu mir. »Sie kommt einmal im Monat zum Saubermachen.«
»Ich komm aber nicht, um deine verschimmelten Würstchen wegzuräumen«, rief sie. »Es ist nicht meine Schuld, daß du nicht für dich selber sorgen kannst.«
Broccoli flüsterte: »Sie ist pralinensüchtig.«
»Werd ich nicht mal vorgestellt?« fragte Mevrouw Meerschwam und zeigte auf mich.
»Das ist Ewald«, sagte Broccoli und öffnete den Kühlschrank, doch der war leer.
Mevrouw Meerschwam sah mich prüfend an. Dann sagte sie leise: »Früher brachte er alles mögliche mit nach Hause.«
»Ah ja?« sagte ich.
»Tiere, Leute, Gerümpel. Doch dem haben wir einen Riegel vorgeschoben.«
Offenbar wartete sie auf eine Reaktion. Ich trat einen Schritt zurück, denn ich befürchtete, Mevrouw Meerschwam könnte glauben, ich stinke. Sie selbst roch durchdringend nach einem Süßwarenladen.
»Ich komm schon seit dreißig Jahren her und hab hier so manches erlebt«, sagte sie, während sie mich weiter anstarrte. Sie schüttelte den Kopf. Mir wurde klar, daß sie in den dreißig Jahren ihre Grenzen öfter notgedrungen hatte revidieren müssen.
Plötzlich zischte sie: »Wie ist dein Familienname?«
»Krieg«, sagte ich, »Krieg, man schreibt es, wie man es spricht.«
Broccoli selbst wohnte auf dem Dachboden. Sein Zimmer hatte Aussicht auf den Kanal und den Beatrixpark. Überall lagen Kleidung und Schuhe herum, an der Wand lehnten drei Angeln. Auf die Tür war ein Poster geklebt, ein Plakat für Once Upon a Time in the West.
Wir setzten uns auf sein Bett. Mevrouw Meerschwam kam herein und begann mit viel Spektakel den Boden zu wischen. Zu allem, was ihr vor die Finger kam, gab sie einen Kommentar ab, bevor sie es in den Teil des Zimmers warf, den sie schon gewischt hatte.
»Sie verfolgt mich«, flüsterte mir Broccoli ins Ohr. Ich nickte.
»Das Angeln reizt mich nicht mehr«, rief Broccoli plötzlich ganz laut. »Außerdem erinnert es mich an meinen Vater.«
»Kannst du dir vorstellen, daß ich noch die Vorhänge für seine Wiege genäht habe?« sagte Mevrouw Meerschwam zu mir. »So lange arbeite ich schon hier.« Sie kniete auf dem Boden. Sie trug Knieschützer.
Broccoli zog mich weg. Als ich die Tür hinter mir zumachte, sah ich, wie Mevrouw Meerschwam uns nachstarrte.
Wir gingen in den Garten. Der war sehr groß, mit einem Teich in der Mitte und blühenden Rhododendronsträuchern in einer Ecke dahinter. Broccoli sagte, daß viele Leute blühende Rhododendrons romantisch fänden. Er sagte: »Wenn du je eine Frau küssen solltest, tu es unter einem blühenden Rhododendron.«
Ich versprach, es mir zu merken.
»Sich merken ist nicht genug.« Dann fügte er hinzu: »Du mußt wissen, ich bin ein Genie.« Er schaute mich ernst an. Ich wußte nicht, was ich sagen sollte.
»Ja«, sagte er nochmals, »ich bin ein Genie.« Er begann zu lachen. Er lachte so lange, bis ich mitlachen mußte. Dabei flog ihm alles mögliche aus dem Mund – auch in mein Gesicht –, und er sagte: »Höflichkeit ist noch nie meine starke Seite gewesen.«
Trotzdem fühlte ich intuitiv, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Broccoli hatte einen Verein gegründet, den Verein der Genialen. Auch ich sollte Mitglied werden. Broccoli sagte: »Der Verein ist für Leute, die auf so einsamer Höhe stehen, daß sie manchmal selbst Zähneklappern davon bekommen.« Dann kniff er mich tief in die Wange und fragte: »Hast du auch manchmal Zähneklappern?«
»Selten«, sagte ich. Ich klapperte fast nie mit den Zähnen. Früher, ja, beim Schwimmen, aber das tat ich schon lange nicht mehr.
Broccoli faßte mich am Arm und flüsterte: »Wenn du lange genug mit mir umgehst, wirst du von selbst ein Genie.«
Wir gingen ans andere Ende des Gartens.
»Nach jedem Gartenfest hat mein Vater hier neuen Rasen legen lassen. Er haßte zertretenen Rasen.«
Im ersten Stock auf dem Balkon erschien Mevrouw Meerschwam. Sie begann, Teppiche auszuklopfen, und rief: »Lange mach ich das nicht mehr mit, ich schwör’s dir, lange mach ich das nicht mehr mit. Sieh dir das an, so ein Dreck!«
Broccoli kümmerte sich nicht um Mevrouw Meerschwams Gezeter.
»Ich war mit zwölf schon ein ausgelernter Klempner«, sagte er feierlich, während er pausenlos auf und ab ging.
»Aha«, sagte ich. Er blieb stehen.
»Bist du nicht neugierig, wie jemand mit zwölf schon ein ausgelernter Klempner wird?« An seinen Blicken konnte ich sehen, daß er wenig Respekt vor Leuten hatte, die darauf nicht neugierig waren.
»Doch«, sagte ich, »ich bin sehr neugierig.«
»Hör mal«, sagte Broccoli, »wenn du nach Hause willst, brauchst du’s nur zu sagen. Ich hab noch mehr zu tun.
Gleich kommt Mooie Bo, das ist ein Freund und Geschäftspartner von mir. Du siehst, ich hab noch mehr zu tun.«
»Ja«, sagte ich, »aber ich will nicht nach Hause.«
»Unsere Toilette war dauernd verstopft«, erklärte Broccoli, »denn mein Vater fabrizierte die längsten Würste, die je ein Mensch auf der Welt fabriziert hat. Manche waren gut fünfundzwanzig Zentimeter lang. Ich wette, dein Vater hat noch nie eine Wurst von fünfundzwanzig Zentimetern fabriziert, und du selbst natürlich auch nicht.«
Das konnte ich bestätigen. Ich sagte, daß mein Rekord bei zwanzig Zentimetern liege, aber daß die meisten gerade mal auf vier, fünf Zentimeter kämen.
»Genau«, rief Broccoli begeistert, »du bist ein kleines Würstchen, da kannst du bei einem Durchschnitt von acht Zentimetern schon ›Hurra‹ schreien. Aber die Würste von meinem Vater waren so groß, daß die Toilette sie gar nicht schaffen konnte. Obwohl wir die beste Toilette hatten, die zu kriegen war. Sie gingen einfach nicht durch. Wenn mein Vater auf dem Klo gesessen hatte, rief meine Mutter: ›Schnell, mach das Rohr frei, bevor es zu spät ist.‹
Wir hatten eine große Motorspirale, die man an die Steckdose anschließen mußte, und die bohrte sich durch alles. Ich war der einzige im Haus, der mit der Spirale umgehen konnte. Wenn wir Besuch hatten, mußte ich es heimlich machen, denn mein Vater wollte nicht, daß die anderen Leute mitbekamen, daß er die längsten Würste der Welt fabrizierte. So kommt es, daß ich mit zwölf schon ausgelernter Klempner war.«
»Du bist wirklich ein Wunderkind«, sagte ich und dachte, daß ich den Mann gern einmal kennenlernen würde, der die längsten Würste der Welt fabrizierte.
Broccoli begann zu strahlen.
»Genau«, sagte er, »darum hab ich auch den Verein der Genialen gegründet – ich bin nicht so einer, der sich zu gut ist, sein Wissen mit weniger intelligenten Leuten zu teilen.« Er sah mich durchdringend an. »Und jetzt spendieren wir Mevrouw Meerschwam ein paar Pralinen.«
Er nahm mich mit in den Vorratskeller. Es war ein riesiger Keller mit mindestens zehntausend Konservendosen. Ich hatte noch nie so viele Konservendosen auf einem Haufen gesehen. Nicht mal im Supermarkt. Dosen mit Rindfleischsuppe, Dosen mit Hühnersuppe, Dosen mit Knackwürsten, Dosen mit Ananas, Dosen mit Fischbouillon, Dosen mit jungen Erbsen, Dosen mit Möhren, genug für ein ganzes Waisenhaus. Irgendwo unter einer alten Zeitung fand Broccoli eine Schachtel Pralinen. Er nahm zwei heraus und brachte sie Mevrouw Meerschwam, die inzwischen in der Küche wieder Tee trank.
»Schau, was ich meinem kleinen Mädchen mitgebracht habe«, sagte Broccoli, während er Mevrouw Meerschwam die Pralinen unter die Nase hielt.
»Ich bin nicht dein kleines Mädchen«, sagte Mevrouw Meerschwam. »Das Geld von deinem Vater ausgeben, das ist das einzige, was du kannst.«
Broccoli zog mich wieder fort.
»Er hat noch nie was getaugt!« rief Mevrouw Meerschwam uns hinterher. »Ich kenn ihn seit seiner Geburt.«
»Wenn sie die Pralinen erst mal im Magen hat«, sagte Broccoli, »wird sie ein ganzes Stück angenehmer.« Dann sah er mich ernst an und sagte: »Die wahre Verführung beginnt mit Pralinen.«
Er bestand darauf, daß ich den Satz wiederholte.
»Bier, Pralinen und schlechte Witze sind die wichtigsten Zutaten einer jeden Verführung, glaub mir«, sagte er. »Und wenn du was von verstopften Toiletten verstehst, mußt du den Trumpf natürlich auch ausspielen.«
Danach fragte Broccoli mich, ob ich eine Partie Badminton mit ihm spielen wollte, doch ich lehnte ab. Die Nachbarin meiner Eltern wollte auch schon immer Badminton mit mir spielen. Badminton war ihr Leben, doch sie hatte keine Partner mehr. All ihre Badmintonfreunde waren gestorben oder saßen im Rollstuhl. Darum rief sie alle zwei Tage bei uns zu Hause an. »Hallo, Ewald«, sagte sie dann, »wollen wir nicht wieder mal ’ne schöne Partie Badminton bei mir im Garten spielen?«
Broccoli holte einen Zahnstocher aus seiner Brusttasche.
»Ich brauch einen Pieper«, sagte er plötzlich. »Ich brauch unbedingt einen Pieper.«
Ich folgte ihm. Wohin er auch ging, er lief immer wie jemand, der gerade noch eine Straßenbahn zu erwischen versuchte. In einem Telefonladen kaufte er sich einen Pieper.
Eine neue Sorte Chips
Wir trafen uns im ›Oranjerie‹, um uns die Fotos anzusehen. Broccoli trug einen Regenmantel und eine Sonnenbrille. Er trug fast immer eine Sonnenbrille. Manchmal vergingen Tage, ohne daß er sie absetzte. Nicht in meiner Anwesenheit jedenfalls. »Sie dürfen mich nicht erkennen«, flüsterte er.
Er saß in einer Ecke. Als er mich sah, gab er mir einen braunen Umschlag und sagte: »Wenn du irgendwann mal viel Geld hast, kannst du mir’s ja bezahlen.«
Für jemanden, der professioneller Fotograf gewesen sein wollte, waren die Fotos einfach schrecklich. Broccoli hatte mir erzählt, er habe mit sechzehn ein Jahr lang als Modefotograf gearbeitet.
Die meisten Bilder waren überbelichtet oder unscharf. Auf dem einzigen, das irgendwie in Ordnung war, fehlte die obere Hälfte meines Gesichts.
»Ich dachte an dieses«, sagte Broccoli. Er holte ein Notizbuch aus seiner Jackentasche, in dem Adressen von Filmgesellschaften und Castingbüros standen.
In einem Spirituosenladen in der Harlemmerstraat kaufte er eine Flasche Champagner, die wir in der Straßenbahn austranken.
»Wir haben etwas zu feiern«, sagte er zu dem Spirituosenverkäufer. Ich hatte ihn noch nie so ausgelassen gesehen. Erst später bemerkte ich, daß er seine Hochstimmung vom einen Moment auf den anderen verlieren konnte und dann tagelang nicht mehr aus seinem Zimmer kam. Wenn ich ihn dann besuchte, nahm er meine Hand und sagte: »Mich quält der Ennui, oh, dieser quälende Ennui.« Damals wußte ich überhaupt nicht, was das war, ich dachte an eine Nierenkrankheit.
»Wir müssen einen guten Begleitbrief schreiben«, sagte Broccoli auf der Straße zu mir. »Einen Brief, den sie nicht ignorieren können.« Als die Flasche leer war, fügte er hinzu: »Und wenn wir im Film nur mal kurz irgendwo vorbeilaufen – wenn wir erst mal drin sind, kriegen sie uns nicht wieder raus.«
Broccoli hatte einen Screentest für uns arrangiert. Er wollte nicht sagen, wie er das geschafft hatte. Der Screentest fand in einem umgebauten Schuppen in der Nähe des Knasts Bijlmermeer statt. In einem Vorraum saßen zehn Jungen und lernten leise einen Text auswendig. Es herrschte die gleiche gespannte Stimmung wie manchmal im Wartezimmer beim Zahnarzt. Vor allem, wenn Leute gerade auf ihr neues Gebiß warten.
Broccoli trug einen Schal und eine Sonnenbrille. »Sind hier noch mehr Abgelehnte von der Schauspielschule?« war das erste, was er beim Hereinkommen fragte. Niemand antwortete.
»Ruhe«, rief die Dame von der Organisation.
Der Screentest war für einen Werbespot für eine neue Sorte Chips mit Schinken und Käse, genannt »Shinkies«.
Wir mußten über eine Stunde warten. Die Jungen, die vom Test zurückkamen, sahen niedergeschlagen aus. Sie erzählten, daß sie Shinkies essen mußten und dabei ihren Text sprechen. Darum sollten wir nur ja viel trinken, bevor wir reingingen.
Ich geriet in Panik, denn damals aß ich noch keinen Schinken. Sonst aß ich alles – bis auf Schinken. Ich weiß, daß das altmodisch war. Es waren die letzten Reste Obskurantismus, die mir im Kopf herumspukten. So erklärte ich es zumindest den anderen.
»Wir müssen die Shinkies auch essen«, flüsterte ich Broccoli zu, doch er reagierte nicht. Er starrte auf den Text, den wir auswendig lernen sollten, als sei es ein Traktat von Schopenhauer.