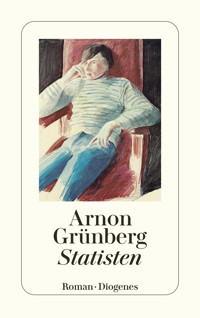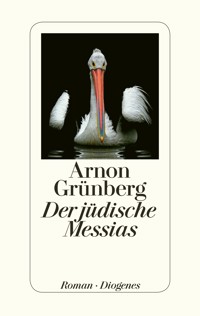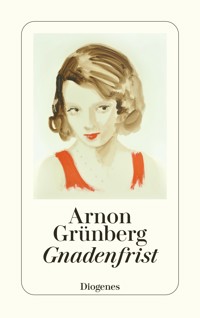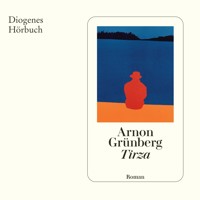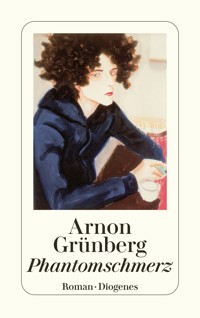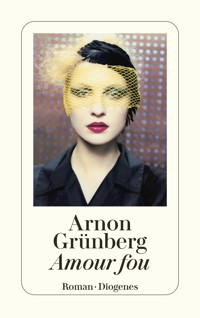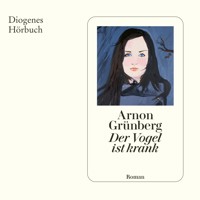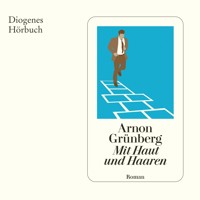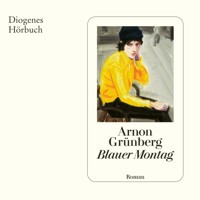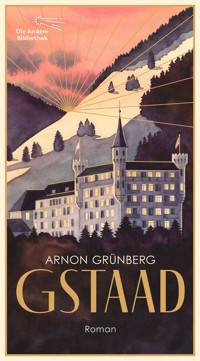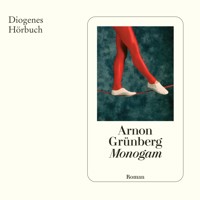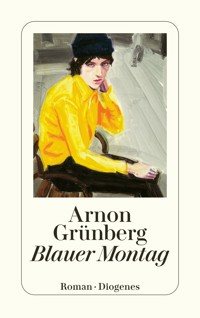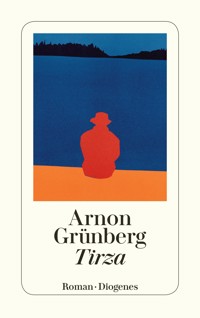
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jörgen Hofmeester, Ende fünfzig, wohlhabend, aber freigestellt, geht ganz auf in seiner Vaterrolle. Vor allem, seit seine Frau ihn verlassen hat. Tirza, so heißt sein Augenstern, die jüngere Tochter. Nach dem Abitur will sie auf Reisen nach Afrika gehen. Dann hat Hofmeester ausgedient, wird keine Rolle mehr spielen – weshalb er aus der seinen fällt und der Leser in den Wahn eines Außenseiters hineingezogen wird, dessen obsessive Vaterliebe in den Abgrund führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Arnon Grünberg
Tirza
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Diogenes
A couple is a conspiracy in search of a crime.
Sex is often the closest they can get.
Adam Philips
I Die Miete
1
Jörgen Hofmeester steht in der Küche und schneidet Thunfisch für das Fest. In der Linken hält er den rohen Fisch. Er schwenkt das Messer, wie er es im Kurs »Sushi und Sashimi selber machen« gelernt hat, den er vor fünf Jahren zusammen mit seiner Frau belegte. Nicht zu viel Druck ausüben, das ist das Geheimnis.
Die Tür in den Garten steht halb offen. Es wird ein warmer Abend, wie Tirza gehofft hat. Seit ein paar Tagen verfolgt sie den Wetterbericht, als hinge der Erfolg ihrer Party ausschließlich vom Wetter ab.
In ein paar Stunden werden die Gäste den Garten in Beschlag nehmen. Pflanzen werden zertreten, junge Leute werden auf der Holztreppe zum Wohnzimmer hocken, andere sich auf den vier Gartenstühlen rekeln, die Hofmeester damals beim Einzug gekauft hat. Wieder andere werden in den kleinen Schuppen vordringen, wo Hofmeester nach Partys schon öfter leere Bierflaschen gefunden hat, halbvolle Weingläser neben dem Rasenmäher, Fläschchen mit exotischen Namen neben der Kettensäge, mit der er im Herbst und Frühling an Sonntagen den Apfelbaum stutzt. Einmal auch eine ungeöffnete Tüte mit Chips, die jemand dort vergessen hatte und die er geistesabwesend aufaß.
Tirza hat schon häufiger Partys gegeben, doch dieser Abend ist etwas Besonderes. Wie Lebensläufe können auch Feste gelingen oder nicht. Obwohl Tirza nichts gesagt hat, spürt Hofmeester, daß viel von diesem Abend abhängt. Tirza, seine Jüngste, die Wohlgeratenste. Ausgezeichnet gelungen, sowohl innerlich als auch äußerlich.
Hofmeester hat die Ärmel hochgekrempelt. Um sein Hemd nicht zu bekleckern, trägt er eine Schürze, die er einmal zum Muttertag gekauft hat. Für seine Verhältnisse wirkt er heute männlich. Seit sechs Tagen hat er sich nicht rasiert. Er kam nicht dazu. Gleich nach dem Aufstehen überfielen ihn Gedanken, die ihm noch nie so gekommen waren: Pläne, Erinnerungen an die Kinder, als sie noch kaum krabbeln konnten, Ideen, die ihm zu dieser Morgenstunde brillant erschienen. Gleich will er sich schnell noch rasieren. Repräsentativ und charmant möchte er aussehen. So will er die Gäste empfangen: ein Mann, der nicht umsonst gelebt hat.
Er wird Sushi und Sashimi herumreichen, stilvoll arrangiert auf einem Tablett, das er speziell zu diesem Anlaß in einem Laden für Japanartikel gekauft hat. Er wird mit den Gästen plaudern, sie nebenbei bitten: »Probiert mal den Sashimi vom Tintenfisch.« Ein Vater, der sich diskret im Hintergrund hält, das wird er sein. Das Geheimnis des Elternberufs: diskrete Selbstverleugnung. Elternliebe ist das Opfer, das schweigend gebracht wird. Alle Liebe ist Opfer. Niemand wird ihm etwas anmerken. Ihm ist auch nichts anzumerken. Manche werden ihm zu Tirzas blendendem Zeugnis gratulieren, der eine oder andere eingeladene Lehrer ihn fragen, was Tirza jetzt vorhat, und er wird antworten, das Sashimi-Tablett in der Hand: »Erst mal will sie ein bißchen verreisen. Namibia, Südafrika. Botswana. Dann kommt sie zurück zum Studieren.« Er wird ein vorbildlicher Gastgeber sein, der seine Augen überall hat. Nicht nur Essen und Getränke wird er den Gästen reichen, auch um die Einsamen und Vernachlässigten wird er sich kümmern. Hofmeester wird die unterhalten, die keinen anderen Gesprächspartner haben als ihr Glas oder ihr Sushi. Verschüchterten Gästen seine Gesellschaft anbieten. Und getanzt werden, getanzt werden soll auch.
Hofmeester greift in eine Schüssel mit lauwarmem Reis, knetet ihn, und während er das tut, wirft er einen Blick auf den Rahmen der Flurtür, als sehe er ihn zum ersten Mal. Er bemerkt die abblätternde Farbe, eine abgeschabte Stelle auf der Tapete daneben, gegen die einmal ein Schuh geflogen ist, den Tirza ihm an den Kopf werfen wollte. Zuvor hatte sie »Arschloch« gerufen. Oder danach, das weiß er nicht mehr so genau. Ein Glück, daß die Scheibe in der Tür heil blieb.
Er betrachtet den Reis in seiner Hand. In Japan geht alles besser. Hofmeesters Sushi sind formlos. Die Hingabe, mit der er knetet, verwundert ihn, wie er sich über Dummheiten aus seiner Vergangenheit wundert. Die Arten Dummheit, die nicht allzuviel Schaden anrichten.
Er wirft noch einen Blick auf die abblätternde Farbe, sie erinnert ihn an seine Haut. Er hat eine Salbe, doch zum Eincremen ist er seit Tagen nicht mehr gekommen. Den Reis in der Hand, schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, dies Haus, sein Haus zu verkaufen. Erst nimmt er ihn nicht ernst, spielt nur damit, wie mit etwas, das doch nie Wirklichkeit wird. Sich nach dem Tod einfrieren und hundert Jahre später wieder auftauen lassen zum Beispiel. Doch der Gedanke überzeugt ihn immer mehr. Die Zeit ist reif. Wie lang soll er noch warten, und worauf?
Früher hätte er solche Ideen sofort verworfen. Sein Haus war sein Stolz. Der Apfelbaum, den er selbst gepflanzt hatte, sein drittes Kind. Sich von Haus und Apfelbaum zu trennen, wenn das Wasser ihm einmal bis zum Hals stände, war ihm zwar früher auch schon durch den Kopf gegangen, doch war es ihm völlig unmöglich vorgekommen. Es war absurd, geradezu widernatürlich. Wo sollte er mit seiner Familie denn hin? Der Apfelbaum ließ sich nicht mehr verpflanzen. Hofmeester war an dieses Haus gekettet, wie an alles andere. Wenn Freunden und Bekannten zu Hofmeester nichts Freundliches einfiel – was hin und wieder durchaus einmal vorkam –, gab es immer einen, der bemerkte: »Dafür wohnt Jörgen aber an erster Adresse.«
An erster Adresse. Für Hofmeester war das lebenswichtig. Irgendworin mußte Erfolg sich ja zeigen. Meist in der Wohnanschrift. Sobald er die Straße nannte, packte ihn eine gewisse Verbissenheit. Als sei seine ganze Identität, alles, was er war und was ihm etwas bedeutete, in diesem einen Straßennamen samt Hausnummer und Postleitzahl enthalten. Mehr als sein Name, sein Beruf oder sein Magistertitel, den Hofmeester manchmal, ohne der Wahrheit damit Gewalt anzutun, vor seine Initialen setzte, erklärte seine Adresse, wer er war und wer er sein wollte.
Jetzt braucht er diese Adresse nicht mehr. Während er ein Stück Thunfisch über den Reis drapiert, kommt ihm der Gedanke plötzlich wie eine Erlösung vor.
Er ist zu alt, um noch entlassen zu werden, hat man zu ihm gesagt. Wer zu alt dafür ist, entlassen zu werden, ist auch zu alt für den Kampf um erste Adressen. Wer nur noch knapp zehn Jahre bis zum Pflegeheim zu leben hat, legt darauf keinen Wert mehr. Er kennt Leute in seinem Alter, die schon an Alzheimer leiden. Sie haben allerdings viel getrunken, das stimmt.
Weg aus diesem Haus, aus dieser Gegend, aus dieser Stadt – ist alles, was er noch denken kann, wenn er versucht, dem Wort »Lösung« einen Sinn zu geben. Es gibt Leute, die morgens mit dem Gedanken erwachen: Ich muß eine Lösung finden, so kann es nicht weitergehen. Hofmeester ist einer von ihnen.
Die Kinder sind aus dem Haus oder dabei, das Haus zu verlassen, seine Arbeit hat sich in eine leere Beschäftigung verwandelt, die nichts Produktives mehr hat, nur noch Warten bedeutet. Er könnte in den Osten gehen. Früher, als er deutsche Literatur studierte und Meinungen über expressionistische Dichter verkündete, als habe er sie persönlich gekannt, hatte er einmal vor, nach Berlin zu ziehen und dort das maßgebende Standardwerk über expressionistische Dichtung zu schreiben. Das könnte er jetzt tun. Für so ein Buch ist es nie zu spät.
Seine Postleitzahl, der Eindruck, den seine Adresse auf die Leute macht, würde ihm allerdings fehlen. Der Anschein, es geschafft zu haben. Der Wahn des Erfolges. Jetzt, da seine Jüngste nach Afrika geht, kann er sich endlich auch von seiner Postanschrift trennen. Er braucht zu keinem Elternabend mehr, keinem Lehrer die Hand zu schütteln. Wem sollte er noch imponieren?
Er muß zugeben, daß nur sentimentale Gründe und Angst vor Veränderung ihn noch hier halten. Da Hofmeester an einem Punkt im Leben angekommen ist, wo er vor allem Bargeld braucht und eine Fluchtroute, einen Ausweg, beschließt er, Sentimentalitäten und Angst zu ignorieren.
Energisch schneidet er den Thunfisch. So macht der Sushimeister das, hack, hack, hack, hack. Der Fisch muß sich nach dem Messer sehnen wie nach einem Freund. Er steckt sich ein Stück Thunfisch in den Mund. Die Krabben liegen auf einem Untersetzer und warten auf ihren Reis.
Am Morgen ist er nach Diemen gefahren, um im Restaurantgroßhandel einzukaufen. Der rohe Thunfisch gibt Hofmeester ein angenehmes Gefühl auf der Zunge. Frisch. Das ist das Geheimnis bei Sashimi.
Seine Frau kommt in die Küche; sie trägt einen Morgenmantel und Flip-Flops. Sie fragt: »Hat Ibi angerufen?«
Hofmeester hat sich noch nicht richtig an ihre erneute Anwesenheit gewöhnt. Sie hatte ihn verlassen, vor drei Jahren. Vor über drei Jahren. Der Kurs »Sushi und Sashimi selber machen« hatte nicht geholfen.
Doch wider Erwarten stand sie plötzlich wieder vor der Tür. Vor sechs Tagen. Gegen sieben Uhr abends.
Hofmeester war in der Küche gewesen. Dort war er oft, seit seine Frau ihn verlassen hatte, doch eigentlich auch schon vorher. Der Herd – sein wahrer Arbeitsplatz. Seine Frau hatte nie die Berufung verspürt, sich in der Küche zu verwirklichen. Ihre Talente lagen jenseits von Lasagne und Erziehung, waren bedeutender. Irgend etwas in ihrem Leben hatte immer mehr gezählt als das Versorgen der Familie.
Es hatte an der Haustür geläutet, vor sechs Tagen, und Hofmeester rief: »Tirza, kannst du mal aufmachen?«
»Ich telefonier grad, Paps«, rief sie zurück.
Tirza telefoniert viel. Das ist normal, hat er von anderen Eltern gehört. Telefonieren kann sich zu einem regelrechten Hobby auswachsen. Er selbst telefoniert selten. Wenn das Telefon klingelt, ist es für Tirza. Als perfekter Hausangestellter und vorbildlicher Papa sagt er dann: »Du kannst sie auf ihrem Handy anrufen. Ich geb dir die Nummer.«
Hofmeester bereitete gerade einen Auflauf zu. Das Rezept stammte aus einem Kochbuch. Seit dem Verschwinden der Ehefrau hatte Hofmeester sich eine beeindruckende Sammlung von Kochbüchern zugelegt. Improvisieren fand er kein Zeichen von Kreativität, sondern von Schlampigkeit. Für ihn war das Rezept heilig. Ein Teelöffel war ein Teelöffel. Er konnte den Herd jetzt nicht allein lassen. Der Backofen lief auf Hochtouren. Er hatte den Auflauf gerade hineingeschoben.
»Tirza, mach du auf«, rief er noch einmal. »Ich kann gerade nicht. Es ist bestimmt der Mann von oben. Sag, ich komm heut abend zu ihm rauf. Geh du an die Tür, Tirza!«
Der Mieter ist ein junger Mann – eigentlich nicht mehr so jung, doch offiziell noch Junggeselle –, der das oberste Stockwerk des Hauses bewohnt, das Hofmeester Ende der siebziger Jahre günstig ergattern konnte. Ständig beklagt sich der junge Mann, ein Jurastudent, bei Hofmeester über alles mögliche, meist über den Gestank im Badezimmer. Mindestens einmal pro Woche steht er mit endlosen Jeremiaden vor der Tür.
Hofmeester verspricht jedesmal Abhilfe, obwohl zwei zuverlässige Klempner ihm erklärt haben, da sei nichts zu machen, außer, er ließe alle Rohre erneuern, was ein Vermögen kosten würde. Und ein Vermögen hat er nicht, und wenn er es hätte, würde er es bestimmt nicht für neue Rohre ausgeben.
Zu allem anderen ist Hofmeester auch noch Vermieter.
Er hörte Tirza fluchen, zur Haustür eilen. Dann wurde es still, und er konzentrierte sich auf den Auflauf, in der Überzeugung, der Mieter stehe wieder mit unerwünschten Belehrungen vor der Tür, neuen, kaum verhohlenen Drohungen.
Das Mietrecht, renommierte Rechtsanwälte, die Bauaufsicht. Womit hat man ihm noch nicht gedroht? Alles hat Hofmeester in seinem Dasein als Hauswirt schon erlebt, aber sie haben ihn nicht untergekriegt. Das Raubtier Hofmeester hat die Zähne gefletscht und sich gewehrt, gegen Behörden, die Mieter – und das Gesetz, das nur darauf aus zu sein schien, ihm alle Rechtsmittel aus der Hand zu schlagen. Das Raubtier Hofmeester ist zäh.
Eine Minute später, mehr kann es nicht gewesen sein, kam Tirza in die Küche gerannt. Er fand, sie sah blaß aus, entsetzt. Doch vermutlich phantasierte er das später dazu und hatte sie immer so ausgesehen. Unmerklich hatte sich Entsetzen in ihrem Gesicht breitgemacht und es nicht mehr verlassen.
»Es ist Mama«, sagte sie.
Instinktiv holte er den Auflauf aus der Röhre und stellte das Gas ab. Er starrte auf die Form. Kabeljau mit Kartoffeln. Ein einfaches und doch leckeres Essen. Er wußte, das würde länger dauern. Kein Mief im Bad des Mieters. Zur Abwechslung einmal kein Abflußproblem, sondern die Mutter seiner Kinder.
Zwar zahlen Ehefrauen keinen Mietzins, doch wie der Mieter, mit dem der Hauswirt per definitionem im Clinch liegt, kommen auch sie, um zu klagen. Die Klage, das hat die Ehefrau mit dem Mieter gemein, den Vorwurf. Die Drohung. Das Auf-die-Nerven-Gehen. Und hinter all dem verborgen: die Abhängigkeit, wie eine Krankheit.
Beamte von der Bauaufsicht, vom Wohnungsamt und Rechtsanwälte: Er war sie alle losgeworden, hatte sie mit Ausflüchten abgespeist, doch die Frau, die sich hinter dem vergessenen Wort »Mama« verbarg, die Mutter seiner Kinder, hatte sich nie abspeisen lassen. Sie war gefährlicher als der Mieterschutz, schlauer als der Inspektor der Bau- und Wohnungsaufsicht.
Das Geschirrtuch, mit dem er den Auflauf aus dem Ofen geholt hatte, über dem Arm, lief er zur Haustür. Ihn überraschte, daß sie ausgerechnet jetzt gekommen war. An diesem Abend, zur Essenszeit.
In den ersten Monaten nach ihrem Verschwinden, das ganze erste Jahr eigentlich, hatte er fast täglich mit ihrer Rückkehr gerechnet. Manchmal hatte er von der Arbeit zu Hause angerufen, um zu hören, ob sie ranging. Sie hatte immer noch die Schlüssel, er hatte die Schlösser nicht auswechseln lassen. Er konnte nicht glauben, daß sie nie mehr zurückkehren würde; sich nicht vorstellen, daß sie bereit war, diese Adresse gegen eine andere einzutauschen, die so viel schlechter, so viel banaler war, so unbedeutend. Ein Wohnboot, hatte man ihm erzählt.
Nach einiger Zeit jedoch mußte er einsehen, daß er sich geirrt hatte: Sie kam nicht wieder. Machte sich nicht mal die Mühe, Kontakt mit ihm aufzunehmen oder ihre restlichen Sachen abzuholen. Sie war weg, und sie blieb weg. Er lernte, mit ihrem Schweigen zu leben, so wie er zuvor mit ihrer Anwesenheit gelebt hatte.
Mit seiner älteren Tochter Ibi hatte die Ehefrau zunächst noch sporadisch Kontakt. Sie trafen sich in der Stadt, in einer anonymen Kneipe. Doch später auch das nicht mehr. Von diesen Treffen erfuhr Hofmeester wenig, und er drang diesbezüglich auch nicht in Ibi, die eigentlich Isabelle hieß, doch seit ihrer Geburt immer nur Ibi genannt wurde. Nein, was Ibi mit ihrer Mutter besprach, blieb ihr Geheimnis.
Tirza wollte nichts mehr mit der Mutter zu tun haben, und mit ihm, dem Vater ihrer Kinder, hatte die Ehefrau seit ihrem Weggehen kein Wort mehr gewechselt. Nicht einmal brieflich oder per E-Mail. Hofmeester wußte, daß sie noch lebte, nach ihrer Zeit auf dem Wohnboot ins Ausland gegangen war, doch weiter reichten seine Erkenntnisse nicht. Mit dem Ausland begann Terra incognita. Und das tat ihm leid.
Je länger das Schweigen dauerte, desto größer wurde der Schmerz. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, entdeckte er, sie reißt neue auf, sorgt für Vergiftungen und Schwären. Der Tod beendet möglicherweise die Schmerzen, die Zeit tut das nicht.
Natürlich hätte Hofmeester sie einfach anrufen oder ihr eine Ansichtskarte schicken können, doch er tat keins von beidem. Er hatte auch seinen Stolz, wartete schweigend, bis sie ihren Irrtum einsehen würde. Mit der Jugendliebe auf dem Wohnboot, das mußte ein Irrtum sein. Kein Zweifel möglich. Schon allein das Wohnboot war ein Irrtum. Ruhig lebte er weiter, da seine Frau irgendwann doch Vernunft annehmen mußte.
Zunächst war es ein Weiterleben mit zwei Kindern. Nach einem halben Jahr jedoch folgte die Ältere dem Beispiel der Mutter: Sie ging aus dem Haus.
Jedesmal wenn es in den ersten Monaten abends an der Tür läutete, ertappte er sich bei dem Gedanken: Das ist sie, meine Frau, sie ist wieder da. Doch nach und nach war die Erwartung zum Ritual verkommen, zur leeren Gewohnheit, und mit der Erwartung schwand auch die Hoffnung. Die Mutter seiner Kinder war fort, auf und davon. Das war ein Fakt, und Fakten werden meist so genannt, weil sie unabänderlich sind.
Doch jetzt stand sie vor ihm, im vollen Ornat, Tatsachen hin oder her. Im Vorraum. Mit demselben Koffer, mit dem sie ihn seinerzeit verlassen hatte. Ein roter Rollkoffer. Ruhig war sie aus dem Haus gegangen, ihr Abgang war kein Drama gewesen, der Abgang nicht.
Der Anblick seiner Frau ging ihm näher, als er erwartet hatte, während er in der Küche den Auflauf aus der Röhre holte. Warum? dachte Hofmeester. Warum heute abend? Was ist geschehen? Ihm war der Besuch ein Rätsel, dabei war er ein Mensch, der die Dinge gern verstehen wollte. Er verabscheute das Irrationale so wie andere Menschen Ungeziefer.
Sein Verlangen nach rationalen Gründen, die zu durchdachtem Verhalten führen, blieb absolut unbefriedigt. Unerwünschte Gedanken überfielen ihn. Er war, wie er zugeben mußte, schon nervös geworden, als seine Tochter das Wort aussprach, das in diesem Haus tabu war: Mama.
Was Gott für Atheisten, war Mama für Familie Hofmeester. Niemand sprach über die Mutter, die davongelaufen war, niemand ließ das berüchtigte Wort fallen. Niemand sagte: »Als Mama noch da war …« Selbst an Elternabenden, die er mit gewissem Fanatismus besuchte, wurde nicht mehr von der Frau gesprochen, die seine Kinder geboren hatte. Man akzeptierte ihn als alleinerziehenden Vater, und zwar so gründlich, als sei er es seit jeher gewesen. Als sei es seine Bestimmung, von Geburt an. Geschaffen als alleinerziehender Vater. Und man mußte es zugeben: Er war mit der Rolle verwachsen.
Es gab keine Mama. Und damit auch kein Wort mehr für sie. Jetzt war er da, Vater und Mutter zugleich. Der einzige und darum der wahre Elternteil, der einzig verbliebene; mit ihm würde sich alles zum Guten wenden.
Während er ihr gegenüberstand, merkte Hofmeester, wie erregt er war. Nicht im sexuellen Sinne des Wortes, sondern erregt wie vor einem Examen, auch wenn man gut vorbereitet ist. Alles mögliche kann schiefgehen. Das war, was sein Adrenalin ihm sagte, die Konzentration, mit der er sie ansah, ihm eingab: Alles mögliche kann schiefgehen.
Er musterte sie, erst ihr Gesicht, dann ihren Koffer. Einen Moment spürte er die ihm unbegreifliche Versuchung, sie an sich zu drücken und minutenlang in den Armen zu halten. Alles, was er tat, war jedoch, sich mit der rechten Hand an der Wand abzustützen, quasi gelassen. Das Geschirrtuch baumelte in seiner Linken. Hofmeester war ein Mann, der ein Leben lang Haltung gesucht, doch bis jetzt, wo sein Leben schon beinah vorbei war, noch keine gefunden hatte. Keine Haltung, bloß ein Geschirrtuch.
Sein einziger Gedanke: Es passiert immer, wenn man’s am wenigsten erwartet. Als passierte es gerade darum, aus keinem anderen Grund.
Wie lange hatte er sich nicht hiernach gesehnt? Daß sie vor der Tür stehen würde. Sie war in der Vergangenheit öfter davongelaufen, aber immer wiedergekommen. Nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, länger als zwei Monate hatten ihre Anwandlungen nie gedauert. Irgendwann kam sie wieder nach Hause. Ohne Zeichen von Scham, ohne ein Wort des Bedauerns; hochmütig, leicht aggressiv – doch sie stand da, vor der Tür. Beim letzten Mal war dem nicht so gewesen, das letzte Mal war anders. Das letzte Mal war definitiv.
Und jetzt, da er es nicht mehr erwartet hatte, es nicht mehr zu erwarten brauchte, weil die Kinder groß waren und er alt genug, als junger Witwer durchzugehen, hatte sie bei ihm geläutet, als sei das die normalste Sache der Welt. Was es vielleicht auch war. Sie blieb die Mutter seiner Kinder. Jahre hatte sie hier gewohnt, zuerst mit ihm allein, dann mit ihm und den Mädchen. Vielleicht wollte sie nur mal nach dem Rechten sehen, ob alles noch gut funktionierte, seinen Apfelbaum bewundern, der in der Tat beachtlich gewachsen war.
Er betrachtete die Frau, die behauptet hatte, er habe ihr Leben kaputtgemacht, ja nicht nur kaputtgemacht, er habe es ihr genommen. Er habe sie nicht leben lassen. Wie ein Taschenspieler ihr Leben davongezaubert, hokuspokus – und weg. Sie wollte es wiederhaben, ihr Leben. Darum war sie gegangen. Wie die Herrschaften vom Wohnungsamt hatte sie das Haus verlassen, ruhig, aber nicht ohne Zorn. Er hatte ihr noch hinterhergerufen: »Soll ich ein Taxi bestellen?« Doch sie hatte geantwortet: »Nicht nötig, ich nehm die Straßenbahn.« Darauf hatte er die Tür geschlossen und sich mit der Abendzeitung ins Wohnzimmer gesetzt.
»Ich dachte: Mal sehen, wie’s ihm geht«, sagte sie und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Ihre Bewegungen, die Art, wie sie da stand, selbstbewußt, vollkommen sicher, daß dies der ideale Moment war, bei ihrer Familie vorbeizuschauen, sie keinen besseren Abend hätte wählen können, ihr leichtes Lächeln, die Sonnenbrille im Haar – alles äußerst lässig, doch ihre Stimme verriet, daß auch sie nervös war. Genauso nervös wie er. Vielleicht war sie dreimal am Haus vorbeigegangen, bevor sie sich den Ruck gegeben hatte zu klingeln. Womöglich schon seit Wochen wieder in Amsterdam, hatte ihn heimlich beobachtet, wenn er zur Arbeit mußte, die Einkäufe nach Hause schleppte oder Tirza zu ihrem Fahrrad begleitete, wenn sie abends noch zu ihrem Freund ging. Wie er dann herumtrödelte und stehenblieb, um erst der davonfahrenden Tirza hinterherzusehen, dann seine Straße und den Park zu betrachten, all das hatte die Ehefrau mitverfolgt.
Ein Mann vor seinem Haus. Das war er in solchen Momenten. Nein, ein alter Mann vor seinem Haus. Im Badezimmer vor dem Spiegel hatte ihn das Gefühl überkommen, etwas Vergangenem gegenüberzustehen. Und das war eine Erleichterung. Was ihn an seinem Leben tröstete, war, daß es vorbei war. Wenn er lang genug suchte, könnte er es in der Vergangenheit wiederfinden.
Auch das hätte die Ehefrau wissen können. Alles hätte sie wissen können, fand Hofmeester. Darum überraschte es ihn, daß sie jetzt plötzlich getan hatte, was sie früher hätte tun sollen – oder für immer lassen: klingeln, mit ihrem roten Rollkoffer vor der Tür stehen.
Er verstand nicht, was sie von ihm wollte. Sex war es wohl kaum. Ein Muttertier war sie auch nie gewesen. Daß er gelernt hatte, so lecker zu kochen, konnte sie nicht wissen. Das war erst nach ihrem Weggang geschehen. Was konnte man an diesem Punkt seines Lebens noch von ihm wollen? Wozu auch immer sie wiedergekommen war, nicht wegen ihm. Nicht zu dem, der er jetzt war. Zu dem, der er gewesen war vielleicht? Doch was er gewesen war, sie beide gemeinsam, ließ sich nicht wiederholen. Wie man es auch drehte und wendete, sie kam zu spät.
Er nahm seine Hand von der Wand. Warf einen kurzen Blick darauf. Die Gartenarbeit hatte Spuren hinterlassen. Immer noch suchte er nach der richtigen Haltung. Er wollte wirken wie bei einem Schwätzchen mit dem Postboten, interessiert, doch auch leicht zerstreut, wie man nun mal ist, wenn man mit dem Postboten redet.
Menschen verlassen einen aus einem bestimmten Grund, soviel ist sicher. Und kommen aus einem bestimmten Grund wieder zurück. Man steht nicht nach drei Jahren einfach so vor der Tür. Wenn das hier bloß eine momentane Eingebung war, was war dann das ganze Leben?
Er mußte sie fragen, was sie von ihm wollte. Einen Moment lag ihm auf der Zunge: »Ist es dringend? Ich hab was im Ofen.«
Sie hatte die Haustür nicht geschlossen. Hofmeester schaute an ihr vorbei auf die Straße.
»Wie bist du hergekommen?« fragte er. Er machte einen Schritt vorwärts, an ihr vorbei, nahm ihren Geruch wahr, noch ein paar Schritte, dann stand er draußen. Er schaute nach links und nach rechts. Niemand zu sehen. Als rechne er mit einem Liebhaber, der brav draußen wartete, während sie das Haus inspizierte. Einen schönen Mann mit blauen Augen. Jugendlich. Der Typ, für den Begierde etwas ist, womit andere ihn täglich belästigen. Er kannte diesen Typ, der ihn in seinen Träumen verfolgte, ihm das Leben versauerte: Der andere Mann, der unsichtbar blieb, jedoch immer da war, jeden Tag, jede Sekunde.
Weiter weg an der Ecke spielte ein Kind mit einem Tennisball. Kein Liebhaber zu sehen. Keine Jugendliebe. Ein Abend im Frühsommer. Wie viele andere. Es versprach warm zu werden, warm, feucht und schwül, gut für Sonnenanbeter. Hofmeester war kein Sonnenanbeter.
»Mit dem Taxi«, sagte sie.
Er ging ins Haus zurück und schloß die Tür. Hob eine Wurfsendung auf. Warum war sie hier? Was konnte sie wollen? Was einfordern? Die Kinder waren groß. Sie waren selbständig, hatten Freunde, über die sie ernsthaft redeten und noch ernsthafter nachdachten. Überlegten, den Rest ihres Lebens mit ihnen zu verbringen. Selbst Gespräche über Verlobungen hatte er schon aufgeschnappt, nicht mal ironisch gemeint. Mit Ringen und allem Tamtam. Die Ehe war wieder im Vormarsch. Eine unverwüstliche Institution. Kein Krieg kam dagegen an. Höchstens die Atombombe.
Die Augen der Ehefrau jedoch straften seine Sorgen Lügen. Sie schaute ihn freundlich an, fast zärtlich. Nicht wütend oder distanziert, vielleicht wollte sie gar nichts fordern. Sie war, es ließ sich nicht leugnen, tatsächlich bewegt.
Sie sieht ihre Vergangenheit, vermutete er. Sie denkt: Herrgott, hab ich hier all die Jahre gelebt? Ist das der Mann, mit dem ich fast zwei Jahrzehnte verbracht habe, mit Unterbrechungen zwar, aber trotzdem? War das hier mein Leben? Sie sah etwas, das eindeutig mit ihr zu tun hatte und das sie doch nicht einordnen konnte.
Angesichts dieser Situation wünschte Hofmeester sich nichts mehr, als laut losprusten zu können. Lang und schallend zu lachen, um sich der Spannung zu entledigen, mit der er nicht zurechtkam. Unsicherheit mündet erst in Gekicher, dann in Schweigen, später in Sex, und dann wieder in Schweigen. Das Lachen, das jeden Bann brechen würde, auch den der Vergangenheit, blieb aus. Nicht mal ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
Jetzt, da die Mutter seiner Töchter nach Jahren wieder vor ihm stand, mußte er plötzlich an Tirzas Geburt denken. Das Warten im Krankenhaus. Es war kein Einzelzimmer frei gewesen. Mindestens zehn Frauen hatten in der Nacht beschlossen, gleichzeitig niederzukommen. Früh am Morgen war er nach Hause gegangen. Er brachte es nicht über sich. Er war vor dem Blut geflüchtet, hatte zu Hause die Wiege vorbereitet und dabei auf den Anruf aus der Klinik gewartet.
»Kommst du von weit her?« fragte er.
»Vom Bahnhof.«
Die Nachbarn hatten sich über ihr Weggehen das Maul zerrissen. Monatelang. Nicht genug konnte man davon bekommen. Man war progressiv, verabscheute den Imperialismus, doch die Möglichkeit, sich über jemanden das Maul zu zerreißen, ließ man sich nicht entgehen. Aus Stolz hatte er sie so weit wie möglich verteidigt, wenn ihm das Getratsche beim Metzger, Gemüsehändler oder auf der Straße zu Ohren kam. »Es ging auch nicht mehr«, pflegte er zu sagen. »Und für die Kinder ist es besser so.« Hofmeester hatte getan, als sei alles einvernehmlich verlaufen. Mit milder Ironie hatte er das Verschwinden seiner Frau kommentiert. Wenn Leute ihn fragten, ob es für die Mädchen nicht schwierig sei, antwortete er lächelnd: »Ein Großteil ihrer Garderobe hängt noch bei uns zu Hause im Schrank, früher oder später wird sie im Leben ihrer Kinder schon wieder auftauchen.«
Doch aus dem Auftauchen war nichts geworden, trotz ihrer Garderobe. Bis zu dem Abend vor sechs Tagen.
Sie sah ziemlich gut aus, fand er. Weniger geschminkt. Brauner, das schon, als liege sie regelmäßig auf der Sonnenbank.
»Komme ich ungelegen?« Sie stellte die Frage ohne merklichen Spott.
Er schaute wieder auf ihren Koffer. Auch der sah ziemlich gut aus. Nach all den Jahren.
»Ich koche gerade, aber echt ungelegen kommst du nicht. Ich meine: Was ist schon ungelegen?«
Sie machte einen Schritt auf ihn zu, als wolle sie ihn umarmen. Es wurde ein Händedruck, ein kräftiger.
»Ich habe mich gefragt, wie’s dir geht«, sagte sie. »Und Tirza.« Bei diesem Namen erschien ein kleines, trauriges Lächeln auf ihrem Gesicht. Als sie den Namen seiner Jüngsten aussprach, zuckte er zusammen wie unter einem Peitschenschlag.
Tirza, wie ging es wohl Tirza?
Das war die Rührung, die er ihr angesehen hatte. Sie hatte ihn verlassen, doch etwas hatte ihr offenbar gefehlt. Ein Stück war aus ihrem Leben gerissen. Von einem Tag auf den anderen hatte sie ihre Töchter nicht mehr aufwachsen sehen. Die Pubertät ihrer Jüngsten kannte sie größtenteils nur vom Hörensagen und vielleicht nicht einmal das.
Und jetzt, da sie dieser Tochter Auge in Auge gegenübergestanden hatte, war ihr die Konsequenz ihres Lebens mit einemmal zu Bewußtsein gekommen.
Sie löste den Händedruck.
So unauffällig wie möglich wischte Hofmeester sich die Hand an der Hose ab. Der Schweiß anderer Menschen war ihm unangenehm. Zu intim. Je unverwundbarer der andere sich gab, desto leichter fiel es ihm, Hofmeester, das Raubtier zu sein. Wenn er etwas in seinem Leben als Hauswirt gelernt hatte, dann daß der Mieter nicht Mensch werden durfte, denn Menschen gegenüber wurde man weich. Man gab nach, sagte: »Ich lass’ das reparieren, ich mach das schon, ein neues Bett, kein Problem. Ein neuer Schrank, warum nicht?« Hofmeester vermietete die Dachetage möbliert. Die Möblierung ermöglichte es ihm, den Mieter notfalls ohne allzuviel juristisches Gezerre wieder loszuwerden. Schon darum durfte der Mieter nicht Mensch werden, denn dann wurde man sentimental, kam die Schwäche in einem hoch wie Schluckauf, und man konnte den Mieter nicht mehr kurzerhand rauswerfen. Schwäche, er verabscheute Schwäche. Er haßte Schwäche.
Der Schweiß der Ehefrau verhieß Wehrlosigkeit. Darum mußte er ihn sich abwischen. Er sah sich um, als erwarte er, Tirza hinter sich stehen zu sehen, doch Tirza war nicht da. Sie telefonierte auf ihrem Zimmer. Oder stand in der Küche, verhielt sich still und belauschte das Gespräch. Wie eine gelernte Spionin. Wieder dachte er an die Tage und Stunden vor ihrer Geburt. Verrückt, daß er sich an diese Geburt soviel besser erinnerte als an die seiner älteren Tochter. Sogar an das Gesicht des Gynäkologen – dem er später eine Flasche Wein vorbeigebracht hatte, eine Flasche für mindestens dreißig Gulden, mit Tirza auf dem Arm. »Das ist sie«, hatte er gesagt. Er zeigte stolz auf ein zerknautschtes Baby mit braunen Haarflusen, wie es so viele gab. Tirza war zerknittert zur Welt gekommen, und es dauerte lange, bis die Knitterfalten verschwanden. Der Gynäkologe hatte den Wein genommen und dem Vater viel Glück gewünscht. Dann hatte er noch gesagt: »Schwere Geburten bringen oft etwas sehr Schönes, etwas ganz Besonderes hervor.« Dabei hatte er getan, als verrate er ein Berufsgeheimnis.
»Alles bestens«, sagte Hofmeester. An seinem Arm baumelte das Geschirrtuch, in der Linken hielt er die Wurfsendung, die er ein paarmal zusammenfaltete und dann zerstreut in die Hosentasche steckte.
»Alles bestens«, wiederholte er. »Tirza hat bestanden. Zweimal neun von zehn. Ein paarmal acht. Ab und zu sieben. Nirgends schlechter als sieben. Nächste Woche gibt sie eine Party.«
Er erzählte es voll Stolz, doch als er zu Ende gesprochen hatte, merkte er, wie absurd es war, das Tirzas Mutter erzählen zu müssen. Das war es also, warum die Nachbarschaft über sie getratscht hatte. Und wahrscheinlich auch über ihn. Man darf kein Fremder für seine Kinder werden. Sie für dich, aber nicht umgekehrt.
Jetzt, da er keine Reklame mehr in der Hand hatte, konnte er nach Herzenslust seine Unterlippe kneten, was er öfter machte, wenn ihn etwas verwirrte, ihn überforderte.
»Schön«, sagte sie. »Die neun Punkte. Ich hatte’s aber auch nicht anders erwartet. Worin?«
»Worin was?«
»Worin hat sie die neun bekommen?«
»In Latein. Und in Geschichte. Hast du das nicht gewußt? Hast du denn gar nichts gehört? Überhaupt nichts?«
Ihre Unwissenheit verblüffte ihn, ärgerte ihn sogar ein wenig. Jemand, der sich zum Zurückkommen entschließt, für wie kurz oder lang auch immer, könnte sich wenigstens diskret über den Stand der Dinge in Sachen Tochter und Mann informieren. Es war sicher nur eine Laune gewesen, diese Rückkehr, wie so vieles in ihrem Leben.
»Vom wem hätte ich es hören sollen? Von Ibi? Ich hab seit Ewigkeiten nicht mit ihr gesprochen. Sie ruft nie an.«
Er bemerkte ihren gereizten Blick auf die Hand, mit der er seine Unterlippe knetete. Er wußte, daß sie diesen alten Tick haßte, und hörte damit auf. Sie ruft nie an. Madame war also der Meinung, daß ihre Kinder sie anrufen sollten. Nicht umgekehrt. Es ging nur um sie.
»Wenn ich nicht störe«, sagte sie, »können wir dann reingehen?«
Sie standen tatsächlich immer unbeholfener da, mitten in der Diele.
»Komm«, sagte er. »Ich hab grad was im Ofen. Ich meine … Es ist nicht mehr drin, ich hab’s rausgeholt.«
Sie schaute ihn an. Sie hatte den Koffer schon gekippt, um ihn ins Wohnzimmer zu rollen, doch ließ ihn wieder los und sagte: »Ich verstehe. Ich weiß genau, was du meinst. Du bist wie – na ja, wie immer. Nicht die Spur verändert.«
Das hatten die Christen und die anderen Religionen nicht bedacht: daß das Wiedersehen im Jenseits auch eine unangenehme Angelegenheit werden könnte. Höflichkeitsgespräche im Himmel. Ein Händedruck, wo man sich hätte umarmen sollen.
Er half ihr schweigend aus dem Mantel, einem hellblauen Regenmantel, den er nicht kannte. Kein Ramsch, das sah er gleich. Sie mochte keine billigen Sachen. Er hängte den Mantel sorgfältig an die Garderobe.
Langsam wurde er ruhiger. Er hatte alles wieder unter Kontrolle. So war nun mal das Leben. Leute verschwanden. Und manchmal tauchten sie wieder auf, einfach so, eines schönen Abends im Frühsommer. Wenn man gerade den Auflauf in den Ofen geschoben hatte, doch das konnten sie natürlich nicht wissen. Wenn man genauer hinschaute, löste sich alle Planung in Luft auf, Eingebungen gewannen Gewicht, Koinzidenzen – wo man auch hinsah, regierte der Zufall.
Gerade jetzt, da er wieder die Ruhe selbst war, schien sie zu zögern.
»Oder ist jemand da?« fragte sie. »Hast du jemanden?«
Hofmeester hörte seine Jüngste aus der Küche stürmen. Wie er vermutet hatte, sie hatte gelauscht. Neugier ist ein Zeichen von Intelligenz, doch ein intelligentes Kind heißt auch, daß die Eltern ständig auf der Hut sein müssen. Bei einem intelligenten Kind weiß man nie, wer wem ein Schnippchen schlägt. Tirza warf ihrem Vater einen vernichtenden Blick zu und rannte die Treppe hoch. An ihrer Mutter vorbei, vorbei an dem blauen Regenmantel, der so auffällig an der Garderobe hing.
»Ob ich jemanden habe?« fragte Hofmeester, als Tirza ihre Zimmertür zugeknallt hatte. Er mußte lachen. »Ob ich jemanden habe? Nicht richtig. Nein. Ich leb hier allein mit Tirza. Natürlich ist sie auch jemand, aber nicht, wie du das meinst.« Hofmeester lachte immer noch. Er konnte sich nicht mehr einkriegen und schämte sich. »Komm«, sagte er, als er sich endlich beruhigt hatte. Er führte sie ins Wohnzimmer. Vor dem Sofa blieb er stehen, doch sie setzte sich nicht. Sie schaute sich um, als wolle sie alles genau überprüfen. Als sei womöglich doch jemand anders, ein Fremder, in diesem Zimmer, wo sie so lange gewohnt, wo sie abendelang gesessen hatte, mit ihm, allein und mit Gästen, wo sie Feste gegeben, Wiegen und Laufställe aufgestellt hatte, wo ihre Töchter über den Boden gekrabbelt waren, wo sie ab und zu Stilleben gemalt hatte.
»Es hat sich nicht viel verändert«, sagte sie. »Du auch nicht. Wie gesagt. Alles unverändert eigentlich. Hast du mal streichen lassen?«
»Das Bücherregal ist neu. Wie du siehst. Der Stuhl da auch. Hat Tirza ausgesucht. Es hat sich schon was verändert.« Die Frage überging er. Wer Fragen ignoriert, kann sich auch nicht verplappern. Als Hauswirt hörte er die meisten Fragen nicht. Gespielte Zerstreutheit ist eine Methode, mit der man jahrelang durchkommt.
Sie betrachtete nicht den Stuhl, den Tirza ausgesucht hatte, auch nicht das Bücherregal. Sie stellte sich direkt vor ihn und musterte ihn. Wie bei einem Gemälde im Museum, das man nur von Ansichtskarten oder aus Katalogen kennt und dem man plötzlich gegenübersteht, bei dem man zu verstehen versucht, warum es auf einmal ein wenig enttäuscht. Nicht sehr, ein kleines bißchen.
»Du hast nicht streichen lassen«, sagte sie nach ein paar Sekunden. »Ich seh’s, alles vergilbt. Du renovierst nicht regelmäßig, man muß ein Haus auch von innen instandhalten. Aber du bist gut in Schuß.«
Sie klang zufrieden. Doch zugleich auch verblüfft. Was hatte sie erwartet? Einen Alkoholiker? Einen Kranken? Zitternde Hände, ein wackliges Gebiß? Ein Wrack mit lichten Momenten? Das nichts Besseres zu tun hatte, als alles malern, das Parkett versiegeln und Abwasserrohre erneuern zu lassen?
Daß er ohne sie zurechtgekommen war, erstaunte sie offenbar, doch enttäuschte sie auch. Genau wie die unrenovierten Wände.
Es gab eine essentielle Gemeinsamkeit zwischen Mieter und Ehefrau. Beide fanden immer irgendeine Zimmerdecke, die es zu streichen galt, immer stießen sie auf etwas im Haus, das erneuert werden mußte. Sie hatten keine Vorstellung von Geld. Keine Ahnung, was Handwerker heutzutage für ein Stündchen Arbeit verlangten. Immer gab es irgend etwas zu klagen, im Falle der Ehefrau eine Klage, die sich auch noch als Liebe tarnte.
Sie trat einen Schritt zurück. »Freust du dich, mich zu sehen?« fragte sie.
Die Frage überrumpelte ihn. Sie machte ihn sprachlos.
»Freuen«, sagte Hofmeester. Er schaute auf die Uhr. »Ja, ich freu mich, aber ich bin auch grade am Kochen. Wenn ich gewußt hätte, daß du kommst, hätte ich mehr gemacht. Du hättest anrufen können. Die Nummer ist immer noch dieselbe. Aber …« Er stockte, nicht vor Rührung, sondern weil ihm nicht einfiel, was er eigentlich sagen wollte. »Es ist schön, dich zu sehen. Man ist ja doch neugierig, ich jedenfalls.«
Es erstaunte Hofmeester, daß die Worte, die er beim Wiedersehen mit dieser Frau von sich erwartet hatte, ihm nicht über die Lippen, ja nicht einmal in den Sinn kamen. Jetzt, da er sie endlich aussprechen konnte, hatte er sie vergessen. Er wollte charmant sein. Stark. Das Schilf war nicht nur ungebrochen, es war auch nicht gebeugt. Nicht einmal angeknackst.
»Neugierig – worauf?«
»Auf dich«, sagte er. »Wie es dir geht. Was du machst. Wie du lebst. Wie’s dir ergangen ist.«
»Wie ich lebe? Warum hast du nie angerufen? In all den Jahren. Ich hätt’s dir schon erzählt. In aller Ausführlichkeit. Ich hätte nichts verheimlicht. Hättest nur einmal anrufen brauchen.«
Typisch. Sie verschwand und erwartete auch noch, daß man ihr hinterherrannte, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen oder zu fragen, ob sie was brauchte.
»Das schien mir keine gute Idee«, sagte Hofmeester. »Dich anzurufen. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Wenn du großen Hunger hast, kann ich noch ein Ei dazu braten. Außerdem hatte ich deine Nummer nicht.«
»Ich bin nicht zum Essen gekommen«, sagte sie und setzte sich aufs Sofa, auf dem sie jahrelang gesessen hatte. Hofmeester hatte es neu beziehen lassen. Das Leder hatte Tirza ausgesucht. Er suchte viel mit ihr zusammen aus.
»Was anderes als ein Ei vielleicht?«
»Jörgen, ich hab keinen Hunger.« Sie sagte es nicht, sie stellte es nachdrücklich fest.
»Man braucht keinen Hunger, um zu essen. Ich mache heut meinen Auflauf. Der ist berühmt. Tirzas Freundinnen sind ganz wild darauf. Wir essen nicht, weil wir Hunger haben, wir essen, weil Essenszeit ist.« Er sagte es wie ein Lehrer, der versucht, den Schülern ein Buch anzupreisen, von dem er weiß, daß sie es hassen werden.
Der Ton mußte ihr vertraut vorkommen, der besserwisserische Ton eines Menschen, der lebt, um anderen ihre Fehler unter die Nase zu reiben. »Ich nicht«, sagte sie. »Ich esse nicht mehr, weil Essenszeit ist. Ich gehorche keinen albernen Regeln mehr. Ich esse, weil ich Lust drauf habe. Ich bin nicht wegen deinem Auflauf gekommen.«
Sie zündete sich eine Zigarette an. Ihre Handtasche war neu. Ein bißchen zu schrill und jugendlich für ihr Alter. Über und über bestickt. Hofmeester dachte an die Handtaschen von Tirzas Freundinnen. Frühmorgens nach Partys standen sie mit ihren Täschchen in der Küche, verziert mit Perlen und spiegelnden Glasstückchen, mit allem möglichen konnte man heutzutage seine Sachen besticken. Hofmeester entschuldigte sich, wenn er im Pyjama in die Küche kam, dort Tirza mit ihren Freundinnen in ausgelassener Stimmung vorfand und es nach Rauch und manchmal auch abgestandenem Essen stank. Schnell schenkte er sich dann ein Glas Milch ein, nahm einen Apfel aus der Obstschale und flüchtete wieder in sein Schlafzimmer – oder im Sommer bei schönem Wetter in den Schuppen, wo er neben Harke und Kettensäge wartete, bis die Mädchen ins Bett oder nach Hause gegangen waren. Tirza war beliebt. Ab und zu hatte er fremde Jungen im Badezimmer getroffen, Jungen, die er nicht kannte und die ihm auch nicht vorgestellt wurden, aber die trotzdem über Nacht blieben. Jungen, die Hofmeester fragen mußte: »Brauchst du ein Handtuch?« Denn Tirza schlief wie ein Stein. Wenn sie einmal schlief, konnte eine Bombe neben ihr einschlagen. Die Jungen wurden immer zuerst wach. Besonders frisch rochen sie nicht, diese Gestalten, die er von Zeit zu Zeit im Badezimmer vorfand. Was Tirzas Jungen gemeinsam hatten, war ihr Gestank. Doch jetzt hatte sie einen festen Freund, und ob der stank, hatte Hofmeester noch nicht feststellen können. Er fürchtete das Schlimmste.
»Du rauchst wieder«, sagte er, den Blick noch auf die Handtasche gerichtet.
Er klang besorgt. Was ihn ärgerte. Was er da sagte, war zu intim. Als ob ihr Rauchen ihn etwas anginge. Ihre Lungen waren ihre Sache. Ihr ganzer Körper. Für ihren Körper war er nicht mehr zuständig.
»Stört es dich?«
»Nicht besonders«, sagte er. »Mich nicht. Ich frag Tirza, ob sie dir einen Aschenbecher bringt. Ich hab sie weggeräumt.«
Er wandte sich zum Flur und rief: »Tirza, kannst du Mama einen Aschenbecher holen?«
Hofmeester horchte auf Antwort, doch Tirza reagierte nicht. Wahrscheinlich saß sie auf ihrem Zimmer und telefonierte. Wahre Passion macht niemals Pause. Sie besprach alles mit ihren Freundinnen, bis ins Detail. Sie hatte es ihm mal beim Essen erzählt. »Auch über mich?« hatte er gefragt. »Redest du auch über mich?« – »Natürlich«, hatte sie geantwortet. »Du bist doch mein Vater. Warum sollte ich nicht über dich reden?«
Die Ehefrau rauchte ungerührt weiter.
»Tirza«, rief Hofmeester, jetzt etwas lauter, »einen Aschenbecher für deine Mutter. Bitte!«
Er starrte auf ihre Zigarettenasche, die immer länger wurde, gleich runterfallen würde, er konnte seinen Blick nicht davon lösen, wie hypnotisiert; er sagte: »Sie ist sehr hilfsbereit. Anders als früher. Selbst als sie fürs Abitur lernen mußte, hat sie darauf bestanden, mir zu helfen.«
Hofmeester redete wie im Traum, er plapperte drauflos, als rede er mehr zu sich als zu ihr, als sei er allein im Zimmer. Als probe er eine Ansprache für sehnsüchtig erwartete Gäste.
Als Tirza sich nicht rührte, ging er selbst in die Küche und suchte einen Aschenbecher. Wo waren sie nur? Niemand rauchte mehr in diesem Haus. Besuch für Hofmeester war selten. Auch die Putzfrau rauchte nicht. Sie trank ab und zu ein Gläschen, aber rauchen, nein. Und wenn Tirzas Freundinnen oder ihre Jungs rauchten – was übrigens selten der Fall war –, dann gingen sie in den Garten. Oder bliesen den Qualm aus dem Fenster. Tirza mochte keinen Rauch, Jungs allerdings schon.
Er fand keinen Aschenbecher. Hofmeester hatte sie zu gut weggeräumt, in der Annahme, sie nicht mehr zu brauchen. Darum nahm er eine Untertasse. Korrekt war das nicht, aber für den Moment ging es. Korrekt, das war für Hofmeester, worum alles sich drehte, auch alle Moral. Wenn er etwas zu seiner Entschuldigung anführen konnte, dann, daß er immer korrekt gewesen war.
Als er ins Zimmer zurückkam, hatte die Ehefrau in die linke Hand geascht. Er reichte ihr die Untertasse und fragte, ob sie ein feuchtes Tuch wolle. »Ich hab feuerfeste Hände«, sagte sie und lachte. Genau wie früher. Menschen ändern sich kaum. Sie finden eine neue Spielwiese für ihre Obsessionen. Falten kommen hinzu, Zähne fallen aus, Knochen brechen, Organe werden durch Apparate ersetzt, doch wirklich ändern tun sie sich nicht.
Als sie zu Ende gelacht hatte, sagte sie: »Wenn ich dir einen Gefallen tu, wenn du’s gern möchtest – und ich weiß, daß du’s gern möchtest –, ess’ ich einen Happen mit, aber mach keine Umstände. Gib mir einfach, was ihr nicht schafft. Nur keinen Streß.«
Hofmeester verschob eine Vase mit Rosen auf dem Eßtisch. Tirza hatte die Blumen vor ein paar Tagen bekommen. So machte er Platz für die überraschend wiederaufgetauchte Ehefrau, die einen Happen mitaß. Er überlegte, ob sie sich in einer nahe gelegenen Kneipe wohl Mut angetrunken hatte, bevor sie hier aufgekreuzt war und plötzlich mit ihrem Koffer vor der Tür stand.
»Kochen ist kein Streß«, sagte er leise. »Es gehört dazu. Ich hab eine Familie. Ich koche. Das ist meine Aufgabe.«
Es war schon für zwei gedeckt. Er deckte den Tisch immer vor dem Kochen. Manchmal gleich, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Weil er es nicht erwarten konnte, mit Tirza am Tisch zu sitzen, weil dieser Moment die Harmonie wiederherstellte, die immer brüchige, prekäre Harmonie. Tirza und er, gemeinsam essend am Tisch. Der Schein einer Familie und mehr als das, ein Bund. Ein heiliger Bund.
Er ging einen dritten Teller holen. Seine heutige Aufgabe fiel ihm wieder ein. Der Auflauf, der Backofen, er mußte kochen. Ratlos stand er da, den Teller in der Hand, unschlüssig, ob er den Besuch allein lassen konnte oder ihn auffordern sollte, in die Küche zu kommen. Um dort über Kleinigkeiten aus grauer Vorzeit zu plaudern. Wie sagt man so was? »Kommst du mit in die Küche?« Er stellte den Teller auf den Tisch. Jetzt war für eine dritte Person gedeckt. Die Ehefrau. Tirzas Mutter.
Mit »einen Happen mitessen« hatte es einmal begonnen. Ein Lammkotelett hatte am Anfang der Familie Hofmeester gestanden. Jörgen hatte für die Frau gekocht, die später die Ehefrau werden sollte. Der Mann hatte ihr mehr zugesagt als das Kotelett. Er dachte an den Koffer, der noch im Flur stand. Bei ihrem ersten Besuch hatte sie eine selbstgemachte Torte dabeigehabt.
»Sie hat sich verändert«, sagte die Ehefrau, den Blick auf ein Gemälde an der Wand gerichtet. Sie hatte es selbst dort aufgehängt, hatte es selbst gemalt und Hofmeester sich nie die Mühe gemacht, es abzuhängen, obwohl Tirza ein paarmal gefragt hatte: »Müssen wir echt den Rest unseres Lebens auf die Obstschale da gucken? Ist das nötig?«
»Wer? Tirza?«
Das Geschirrtuch hing immer noch über seinem Arm.
»Ja, Tirza. Sie ist hübsch geworden.«
»Sie ist eine Frau geworden«, sagte Hofmeester. Doch als er das sagte, bedauerte er es sofort. Eine Frau? Was war eine Frau? Gut, sie hatte Brüste bekommen und ausgeprägtere Hüften. Doch wann war man eine Frau? Was machte ihn zum Mann? Das Geschlechtsteil, das ihm zwischen den Beinen baumelte?
Er wußte nicht, was er über Tirza sagen sollte, über sie sagen wollte. Darum sagte er nur: »Sie war schon immer hübsch. Als Baby war sie zerknittert, wie alle Babys. Ibi nicht so, die hatte wieder andere Probleme. Möchtest du was trinken?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich nehm mir selbst was. Im Moment bin ich echt völlig zufrieden.«
Er starrte sie an, die zufriedene Frau, die das in der Vergangenheit nie gewesen war, trotz all der gepinselten Stilleben. Doch jetzt war sie offenbar zufrieden. Irgendwo hatte ihre Geschichte also ein gutes Ende genommen, Hofmeester war nur nicht dabeigewesen.
Er ging in die Küche, sie würde sich im Wohnzimmer schon alleine beschäftigen. Er schob den Auflauf in den Backofen zurück, machte eine Flasche Weißwein auf und stellte die Eieruhr auf dreißig Minuten. Ohne Eieruhr konnte Hofmeester nicht kochen. Dann legte er das Kochbuch auf den Stapel zurück.
Er blieb vor dem Backofen stehen. Seine Hände strichen über die Anrichte, als könne er nicht sehen und lese Blindenschrift. Wenn das Essen erst einmal auf dem Tisch stand, würde ihm bestimmt etwas einfallen, worüber er sich mit dem Besuch unterhalten konnte. »Warst du lange auf Reisen?« Oder: »Lebt deine Mutter noch?« Als sie ihn verlassen hatte, war ihre Mutter schwer krank gewesen.
Er dachte über seine Arbeit nach, über Tirza und ihre geplante Reise. Botswana war ein Malariagebiet, hatte er gelesen.
Die Eieruhr klingelte, und er brachte den Auflauf umsichtig ins Wohnzimmer. Die Ehefrau hatte sich aufs Sofa gelegt. Sie hatte die Schuhe ausgezogen. Ihre Augen waren geschlossen. Es stank nach Zigarettenqualm.
»Ich werd dir noch Messer und Gabel holen«, sagte er und stellte das Essen auf den Tisch.
Sie rührte sich nicht. Sie lag ausgestreckt und zufrieden da, als sei sie nie weggewesen, hätte nur kurz Brötchen geholt und sei unterwegs aufgehalten worden. Ein Stau, mehr nicht, ihre dreijährige Abwesenheit; ein Stau aus Menschenleibern.
Im Flur rief er: »Tirza, essen!« Er holte das Besteck, ein Glas für den Gast und die Flasche Wein aus der Küche.
»Wo soll ich mich hinsetzen?« fragte die Ehefrau, als er den Wein eingeschenkt hatte. Alle Gläser genau gleich voll. Es geht um jedes Detail. Er ging in seiner Rolle auf. Der Ober, der Hausdiener.
Mühsam stand sie vom Sofa auf. Barfuß ging sie zum Tisch.
»Hier am Kopfende«, sagte Hofmeester. »Da sitzt der Besuch immer. Schöne Schuhe hast du da. Aus Italien?«
»Aus Frankreich.«
Sie nahmen Platz. Hofmeester tat auf. Nochmals rief er, jetzt etwas lauter: »Tirza, essen!«
Die Mahlzeit stand auf dem Tisch, lag auf den Tellern. Doch niemand aß. Man wartete auf das Kind.
»Ein Geschenk«, sagte die Ehefrau, die die Gabel schon in der Hand hielt. Am linken Ringfinger trug sie ein Schmuckstück, das er nicht kannte.
»Was?«
»Die Schuhe. Ein Geschenk.«
»Wie nett. Du hast hier noch mindestens zehn Paar Schuhe stehen. Wußtest du das? Ich wollte sie dir schicken, aber ich wußte nicht, wohin.«
Er nahm ein Stück Brot aus dem Korb, der ebenfalls schon ein paar Stunden auf dem Tisch stand.
»Ich dachte, du hättest sie längst verschenkt.«
Das Brot war trocken.
»Verschenken – wem? Die Schuhe, meinst du?«
»Die Schuhe, ja, ich dachte, du würdest sie weggeben. Und meine Sachen auch. Hatte ich gedacht. Ist doch kein so verrückter Gedanke? Ich hab mir alles neu gekauft.«
»Wer hat schon deine Größe? Ich kenn niemanden. Du hast eine ausgefallene Größe. – Tirza, essen! Alles ist noch genauso, wie du’s im Schrank gelassen hast. Du hättest jederzeit zurückkommen können.«
Sie sah ihn an, forschend, wie um herauszufinden, ob er einen Scherz machte.
»Meine Füße sind ein Juwel, hab ich mir sagen lassen«, meinte die Ehefrau nach einer kurzen Pause. Sie lächelte freundlich. Sie gab sich Mühe, das merkte man. Er aber auch. Das war aus ihnen geworden: zwei Menschen, die sich Mühe geben. Vielleicht waren sie das schon immer gewesen.
»Hast du sie dir mal genau angesehen? Ich habe meine Juwelen gut gepflegt.«
Sie drehte sich ein wenig auf ihrem Stuhl und streckte die Beine neben dem Tisch. Ihre Fußnägel waren rosa lackiert. Die Zehenspitzen berührten Hofmeesters Oberschenkel.
Er erstarrte.
Das Stück trocknes Brot in der Hand, warf er einen Blick auf die nackten Füße und Waden der Ehefrau. Die Zehen, die seine Hose berührten. Er steckte sich das Brot in den Mund und begann zu kauen.
»Hast du mir gar nichts zu sagen, nach all den Jahren?«
»Zu sagen?«
»Was Nettes. Freust du dich, mich wiederzusehen?«
»Über deine Füße, meinst du? Was Nettes?« Das Brot war sehr trocken, doch er hatte keine Lust, aufzustehen und es zu rösten.
»Du weißt doch, wie wichtig bestimmte Dinge für mich sind. Du könntest ein bißchen herzlicher sein, nach so langer Zeit. Du hast doch Gefühl.« Sie wackelte mit den Zehen, und Hofmeester warf noch einen Blick auf ihre Füße.
Herzlichkeit, das wurde also von einem erwartet, wenn die Gattin nach drei Jahren wieder vor der Tür stand.
»Deine Füße sind unverändert«, sagte er.
»Ist das alles?«
»Ich glaub schon.«
»Es sind Juwelen, Jörgen. Meine Füße. Viele haben sie bewundert. Man hat es mir oft gesagt.«
Dann schob sie ihre Beine wieder unter den Tisch.
Hofmeester starrte auf die Rosen. Es war ein teurer Strauß. Mindestens dreißig Euro. Von wem hatte Tirza ihn bekommen? Sie hatte keinen Namen genannt. Sie nannte selten Namen von Jungen. Bei Tisch redeten sie über alltägliche Dinge. Die Nachrichten, das Essen, das Wetter, ihre Freundinnen, die Schulprojekte, nur ab und zu über ihre Weltreise. Politische Gespräche vermieden sie. Zu Afrika gingen ihre Meinungen auseinander.
»Ich finde …«, begann Hofmeester. Weil er eigentlich nicht wußte, was er fand, machte er eine Pause; in dem Moment hörte er Tirza die Treppe hinunterkommen und beschloß, daß er den Satz nicht zu Ende zu sprechen brauchte. Daß es an Tirza war, etwas Nettes und Herzliches zu sagen; wenn schon Bedarf an Herzlichkeit bestand, was man bezweifeln konnte, war es an ihr, dafür zu sorgen.
»Boah, stinkt das hier!« rief Tirza. Sie trug eine weiße Bluse, sie hatte sich zum Essen umgezogen. Das tat sie sonst nie. Außer wenn Besuch da war. Aller Besuch in den vergangenen Jahren war für Tirza gewesen. Nur die Putzfrau aus Ghana kam wegen Hofmeester, doch Besuch konnte man sie im strikten Sinne des Wortes nicht nennen.
Die Tochter setzte sich. Hofmeester hob sein Glas und sagte: »Laß uns trinken, Tirza, auf den überraschenden Besuch deiner Mutter. Trinken wir darauf, daß wir jetzt alle, fast alle, hier wieder als … nun ja, als Familie zusammensitzen. Und daß wir gesund sind.«
Die Tochter hatte ihr Glas schon erhoben, stellte es aber wieder hin und sagte: »Darauf trinke ich nicht. Und es stinkt hier, Papa, riechst du das nicht? Sie hat einfach drauflos gequalmt. Hier darf nicht geraucht werden.« Wenn es drauf ankam, konnte auch Tirza reden wie eine Lehrerin. Ihr Direktor hatte einmal gesagt: »Sie ist die geborene Anführerin, sie ergreift Initiative. Sie geht voraus und zieht alle mit.«
Es entstand eine peinliche Stille. Hofmeester stopfte sich vor Aufregung noch ein Stück Brot in den Mund.
»Wir trinken …«, begann Hofmeester.
»Nein«, sagte Tirza. »Ich mach da nicht mit. Bei diesem Affentheater.«
Auf ihrem Teller stach sie wütend in den Auflauf, den ihr Vater soeben serviert hatte.
»Gut«, sagte Hofmeester, »dann auf das Leben. Auf dein Zeugnis – okay, Tirza? Auf dein Abitur. Auf deine Zukunft. Auf dich.« Ehe jemand weitere Einwände erheben konnte, nahm Hofmeester den ersten Schluck. Der Wein war nicht kalt genug, aber er ging. An einem Abend wie diesem ging vieles.
Hofmeesters Auflauf war auch schon mal besser gelungen, doch solange gegessen wurde, war alles in Ordnung. Die Lage war unter Kontrolle, der Abend, das Beisammensein, die Familie.
Nach ein paar Bissen nahm die Ehefrau die Sonnenbrille aus der Frisur und fragte: »Und, Tirza, wie geht’s? Grad hab ich deinem Vater noch gesagt, daß ich finde, wie hübsch du geworden bist.«
Tirza kratzte einen Käsefaden von ihrem Messer. Ein Auflauf mit Käse, es war ein französisches Rezept. Sie murmelte: »Als würd dich das irgendwie interessieren.«
»Das interessiert mich sehr wohl«, sagte die Ehefrau. »Sogar sehr. Ich hab oft an dich denken müssen. Du bist wirklich hübsch geworden.«
»Geworden?«
»Noch hübscher. Als du schon warst. Du warst schon immer hübsch, aber jetzt bist du, wie soll ich sagen, richtig erblüht.«
Tirza antwortete: »Wie witzig.« Sie kaute mit langen Zähnen. Wie ein Kind. Mit demonstrativem Widerwillen. Sie spielte mit dem Essen.
»Witzig?« fragte die Ehefrau. »Was ist daran witzig?«
»Witzig, daß dir einfällt, daß ich früher auch hübsch war. Witzig, daß dich interessiert, wie’s mir geht. Da hab ich in den letzten Jahren nämlich wenig von gemerkt. Sagen wir ruhig: gar nichts.«
Nach dieser kleinen Animosität aßen sie schweigend weiter. Doch die Aufregung hatte von Hofmeester wieder Besitz ergriffen, noch mehr als zuvor in der Diele beim Anblick des Koffers der Ehefrau. Darum stopfte er sich noch ein paar Stück Brot in den Mund. Er vertilgte den ganzen Brotkorb. Man mußte aufessen. Wegwerfen war Verschwendung, Sünde.
Als ihr Teller so gut wie leer war, fragte die Ehefrau: »Was ist das für Wein?«
»Südafrikanischer«, sagte Hofmeester. »Tirza und ich haben den südafrikanischen Wein entdeckt.«
»Entdeckt?« Sie kicherte. »Wie meinst du das – ›entdeckt‹? Was gibt’s denn da zu entdecken?«
»Jeden Samstagnachmittag veranstaltet der Weinhändler hier um die Ecke Weinproben. Da gehen wir manchmal hin. Nicht wahr, Tirza?«
Tirzas Mutter studierte eingehend das Etikett und sagte: »Die reinsten Turteltauben! Samstag nachmittags zur Weinprobe. Wie romantisch. Wer hätte das gedacht? Daß ihr euch noch mal so gut versteht?«
»Papa!« sagte Tirza.
Doch der Vater tat, als hätte er nichts gehört. Er sagte: »Tirza interessiert sich für Südafrika, für die ganze Region. Ganz Afrika eigentlich. Sag ich das richtig? Ganz Afrika? Am liebsten würde sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Südspitze des Kontinents bis hoch nach Marokko fahren, aber das hab ich verboten. Außerdem gibt’s da kaum öffentlichen Verkehr. Öffentliche Verkehrsmittel in Kamerun, was fällt einem dazu ein? Tote. Ich hab mal gelesen, daß sie in Kamerun keine Leichenwagen haben und die Toten einfach im Bus zum Friedhof bringen. Unterm Arm.«
Er lachte. Die Vorstellung, tote Angehörige unter dem Arm im Bus zum Friedhof zu bringen, machte den Tod ein Stück weniger bedrohlich. Solange man tat, als ob alles im Lot sei, war auch alles im Lot. Er bekam einen Tritt vors Schienbein. Für ihn das Zeichen, die restlichen Krümel aus dem Brotkorb zu klauben und sich in den Mund zu stecken. Essen war Gnade.
»Du willst also mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Afrika reisen?« Tirzas Mutter gab sich Mühe, doch es gelang ihr nicht. Sie hatte die besten Absichten, schon immer gehabt, doch alles, was sie interessierte, war im Grunde sie selbst.
Tirza antwortete nicht. Sie trat ihrem Vater noch einmal vors Schienbein. Vielleicht war das auch eine Antwort.
»Ich hab ihr gesagt«, fügte Hofmeester hinzu, »öffentliche Verkehrsmittel in Afrika …« Wieder ein Tritt.
»Tirza«, sagte Hofmeester, als sein Mund leer war, »ich kann nichts dafür. Hier kann ich zufällig mal wirklich nichts dran ändern. Ausnahmsweise.«
Tirza schüttelte den Kopf. Immer wieder, wie ein kleines Kind, das eigentlich längst schlafen müßte und vor Müdigkeit quengelig geworden ist.
»Es geht nicht darum, wofür du was kannst, Papa«, rief sie, »es geht darum, daß ich das nicht mehr aushalte. Ich ertrag das nicht. Hör bitte auf. Hör damit auf!«
Sie betonte jede Silbe.
Hofmeester sah sie an. Die Hälfte ihres Auflaufs lag unberührt auf dem Teller. Mit der anderen hatte sie nur herumgespielt. Er verstand wenig von Menschen. Manchmal kamen ihm selbst die eigenen Kinder wie Fremde vor. Vertraut, und doch unbegreiflich. Wie die Jungs, die Hofmeester ab und zu morgens im Bad vorfand, auch unbekannt, und dennoch vertraut. Als hätten sie die ganze Nacht im Badezimmer auf ihn gewartet. Auf ihn und ein Handtuch. Die Freunde seiner Tochter, für die er bloß ein besserer Statist war, während er doch eigentlich, er wollte sich jetzt nichts mehr vormachen, etwas ganz anderes hatte sein wollen.
»Womit soll ich aufhören?«
»Mit diesem Getue. Diesem Gespräch. Diesem lächerlichen Gespräch. Hör auf, dich mir gegenüber so aufzuplustern. Hör auf mit diesem Theater. Nur weil diese Trulla hier mit am Tisch sitzt.«
Als sie »diese Trulla« sagte, wurde ihre Stimme lauter, sie schrie beinahe.
»Verhalte ich mich denn anders?« fragte Hofmeester. Er versuchte, sowohl seine Frau als auch seine Tochter nicht aus den Augen zu lassen. Als würden sie sich an die Kehle springen, wenn seine Aufmerksamkeit einen Augenblick erlahmte. »Rede ich anders? Esse ich anders? Oder hab ich auf einmal aufgehört zu schlürfen?« Er lachte über seinen Witz, als einziger.
»Du schlürfst nicht, aber du redest anders als sonst, Papa, ja. Sonst rede vor allem ich, und du nickst, oder du fragst: ›Was macht ihr Vater?‹ Und dann waschen wir ab. Dann sagst du auch fast nichts. Du hörst zu. Und das ist in Ordnung. Manchmal frag ich: ›Und was hast du heute erlebt?‹ Dann sagst du: ›Nichts Besonderes.‹ Ich find das nicht schlimm. So bist du nun mal. Du kannst nicht anders. Und das ist immer noch mehr, als die da kann. Nur dieses Gespräch, dieses vollkommen lächerliche Gespräch, das halt ich nicht aus.«
Hofmeester fühlte an der Auflaufform. Sie war immer noch warm.
»Manchmal rede ich mit dir, Tirza. Das weißt du. Das weißt du sehr gut. Und ich les dir aus der Zeitung vor. Die witzigen Stellen. Das weißt du auch.«
»Es ist in Ordnung, Papa. Auf deine Art bist du lieb. Auf deine Art bist du sehr lieb. Und daß du mir beim Essen die witzigen Stellen aus der Zeitung vorliest, ist auch in Ordnung. Ich find sie nicht immer witzig, aber okay, du findest sie witzig. Und das ist die Hauptsache. Aber darf ich dich was fragen, wo wir jetzt doch miteinander reden und du keine witzigen Stellen aus der Zeitung vorliest, darf ich dich da mal was fragen?«
»Natürlich«, sagte Hofmeester. »Alles, Tirza. Alles, was du willst.«
»Warum hast du die Trulla hier nicht mit ’nem Tritt vor die Tür gesetzt?«
Einen Moment spürte er die Versuchung, sich die Unterlippe zu kneten, doch er unterdrückte den Impuls. Hofmeester schenkte noch einmal nach, erst Tirza, dann der Ehefrau und zuletzt sich selbst. Er versuchte der Ehefrau einen Blick des Einvernehmens zuzuwerfen, doch sie lächelte nur schwach, ohne ihn zu beachten. Dann sagte er: »Man setzt Frauen nicht einfach mit einem Tritt vor die Tür, Tirza, schon gar keine Frauen, mit denen man zwei Kinder gemacht hat. Diese Trulla ist deine Mutter. Darum hab ich sie reingelassen, statt sie vor die Tür zu setzen. Das scheint mir ein sehr guter Grund. Sie ist deine Mutter. Das war sie. Und das wird sie bleiben.«
Tirzas Mutter machte ein Gesicht, als drehte sich das Gespräch um eine Wildfremde. Eine andere Mutter mit einem anderen Kind.