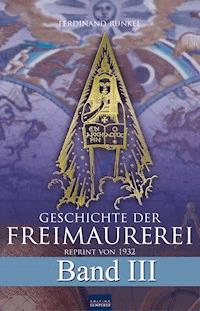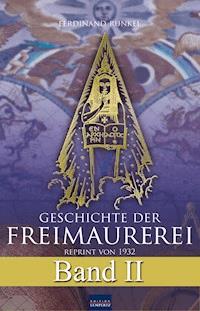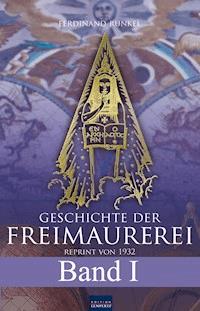Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein" – diese Worte aus der Ode an die Freude von Friedrich von Schiller kennzeichnet das Verhältnis zwischen den beiden Protagonisten dieses hervorragenden Romans – dem Arbeitersohn Doktor Leopold Weltzer, ein genialer Chemiker, und dem Sohn des Geheimrats Schönebeck Dr. Walter Schönebeck, ein hervorragender Jurist –, die zusammen das Rückgrat der Düngemittelfabrik Hartwinkel bilden. Dr. Weltzer ist es gelungen, Stickstoff statt aus dem teuren chilenischen Salpeter aus dem in Brandenburg beheimateten Gips herzustellen und den deutschen Dünger damit konkurrenzlos billig zu produzieren. Doch es gibt Hardliner in dieser Zeit – vor dem französisch deutschen Duo Gustav Stresemann und Aristide Briand –, besonders um den französischen Präsidenten Poincare. Diese missgönnen Deutschland die preisliche Vormachtstellung und es gelingt ihnen durch einen genialen Chemiker, die Gipsgruben so zu manipulieren, dass sie explodieren. Das Werk mit seiner herausragenden sozialen Einstellung droht auseinanderzubrechen, weil nun zudem der juristische Chef entführt wird. Doch der geniale Chemiker kommt auf die Spur der Verbrecher.Ferdinand Runkel (1864–?) war ein deutscher Schriftsteller und Philologe. Runkel wurde in Hanau geboren. Ab etwa 1907 hat er bis um 1940 zahlreiche Erzählungen und Romane, vor allem mystische und Kriminalromane, aber auch philologische und historische Werke publiziert. Besondere Beachtung verdiente er sich mit seiner seine "Geschichte der Freimaurerei". Sein Todesdatum konnte nicht ermittelt werden.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ferdinand Runkel
Stickstoff
Roman
Erstes bis fünftes Tausend
Saga
Stickstoff
© 1924 Ferdinand Runkel
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711593073
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel.
Über den Kalksee bei Rüdersdorf schoss ein schlankes Motorboot; eine Dame lenkte sein Steuer, ein Herr sass ihr gegenüber und blickte unverwandt auf die schönen Mädchenhände, die mit zielbewusster Sicherheit das Rad drehten.
Die beiden Menschen sprachen kaum ein Wort; nur manchmal begegneten sich ihre Augen, und dann glomm eine leuchtende Feuergarbe auf. Sie verstanden sich auch ohne Worte.
Jetzt glitt das Boot aus dem Schatten der hohen Ufer heraus auf die schimmernde Fläche, wo die Wellen blitzten und spielten. Stolz wehte am Hintersteven die schwarzweissrote Flagge.
„Nun ist die schöne Fahrt bald zu Ende, wie danke ich Ihnen für die herrliche Stunde! Es war ein Seelenbad für den armen, müden Kopf, und es schwemmte die Laboratoriumsluft aus jeder Gehirnfalte fort.“ Seine Stimme hatte leise und zutraulich geklungen.
Die junge Dame sah auf und lächelte: „Wenn Sie wieder nach Blossin kommen wollen, rufen Sie vorher an. Dann hole ich Sie ab.“
„Ja, das werde ich gern tun.“
Er hatte dies ganz bescheiden gesagt, aber ein freudiges Glücksgefühl strömte dabei in sein Blut.
Sie konnten nicht weitersprechen; denn das Boot näherte sich dem Landungsplatze, an dem sich eine ganze Anzahl Menschen angesammelt hatte: Arbeiter aus den Nüdersdorfer Kalkwerken und der gewaltigen Stickstoffabrik, die hinter den waldigen Höhen lag.
Der weisse Schwan flog dicht heran, der Motor war abgedrosselt, und im nächsten Augenblick sprang der junge Mann auf die Brücke, um die Kette an einem eisernen Ring festzumachen.
„Wollen Sie nicht einen Augenblick nähertreten?“ fragte er. „Der Herr Kommerzienrat wird wohl noch im Büro sein.“
„Nein, nein. Ich will lieber gleich zurück. Eine Stunde habe ich mindestens noch zu fahren, und die Eltern kämen in Sorge, wenn ich nicht vor Abend zuhause wäre.“
Aus der Menge trat jetzt ein riesiger Arbeiter heraus. Ein höhnisches Lachen verzerrte sein Gesicht.
„Weg mit der Mörderflagge! — Genossen! Wollt ihr euch das gefallen lassen von dem faulen Junkerpack und den Kapitalstrolchen?“
Ein Murren ging durch die Menge, das der Riese zu seinen Gunsten deutete.
„Herunter mit dem Lappen!“
Schwerfällig trat er an das Boot heran und griff mit seiner mächtigen Faust nach der schwarzweissroten Flagge. Da trat ihm der schlanke junge Mann in den Weg. Seine Augen zischten im Feuer. Seine Lippen bebten.
„Hände weg! oder —“
„Was oder?“ grollte der Riese und ballte beide Fäuste.
„Um Gottes willen, Leopold, lassen Sie —“
Die Dame sprang auf und wollte die Kette lösen; aber der Arbeiter griff in den Ring und hielt das Boot fest.
„Herunter mit dem Lappen, oder ich werfe euch ins Wasser!“
Einen Augenblick stand Leopold unentschlossen. Dann strömte eine rote Blutwelle in sein bleiches Gelehrtengesicht. Seine grossen blauen Augen schossen blitzende Pfeile, und ehe der riesige Arbeiter sich’s versah, traf ihn ein Faustschlag gegen den Arm, dass er laut aufheulend die Bootskette fahren liess und sich in schäumender Wut gegen Leopold wandte. Der warf unerschrocken die Kette los, schob das Boot vom Ufer ab und rief dem jungen Mädchen mit zuckendem Munde zu: „Auf Wiedersehn!“
Leicht sprang der Motor an. Und das rassige Fahrzeug kam vom Ufer ab. Aber seine Führerin hielt es in der Nähe, um ängstlich den Fortgang der Ereignisse zu verfolgen.
Der Wutgeselle warf sich jetzt mit seiner ganzen Wucht auf den schlanken Jüngling. Er hob die riesige Faust und wollte sie wie einen Schmiedehammer auf den Kopf seines Gegners niedersausen lassen. Im selben Augenblick wurde er zurückgerissen, und es kam Bewegung in die Menge.
„Was, du willst unsern Herrn Doktor schlagen, du Viechkerl! Warte nur, wir werden dir was!“
„Lasst ihn nur, Freunde,“ rief jetzt der junge Mann. „Ich werde schon allein mit ihm fertig. Wozu hat man denn Boxen gelernt?“
„I wo —“ Ein mächtiger Heizer schob sich zwischen die Kämpfenden. „Herr Doktor dürfen sich an dem Vieh nicht die Hände beschmutzen. Das ist einer von den landfremden Hetzern, die jetzt überall die Leute in den Werken aufputschen. Den überlassen Sie mir!“
Im nächsten Augenblick unterlief er den Mann, hob ihn hoch und trug den schweren Körper wie eine Feder davon.
„Den liefere ich sicher auf der Bahn ab.“
Mit lautem Lachen folgte die Menge, und bald war die Landungsstelle einsam.
Irma lenkte ihr Boot wieder näher heran. Man sah jetzt, dass ihr Gesicht totenblass war. Aber ein glückliches Lächeln spielte um ihren edelgeschnittenen Mund.
„Gott sei Dank, das war eine böse Lage.“
„O nein ... Unsere Leute hätten mich schon herausgehauen, wenn’s nötig gewesen wäre. Aber ich hätte mich ganz allein mit dem Bären auseinandergesetzt. Sie haben wohl Sorge um mich gehabt, Irma?“
Ein warmer Strahl der schönen Augen antwortete ihm.
„Sie wissen, ich bin ein Proletarierkind, und Art hält zu Art. Meine Arbeiter gehen mit mir durch, wohin ich sie führe. Mein Kopf und ihre Fäuste sollen dem kranken Deutschland Genesung bringen.“
„Seien Sie, bitte, recht auf der Hut, der Kerl rächt sich.“
„Lassen Sie ihn, ich bin vorbereitet.“
Langsam wendete das Boot gegen die Mitte des Sees und schoss dann mit Vollgas in die glitzernde Wellenwelt hinaus. Der Jüngling stand lange und schaute dem fliegenden Schwan nach, bis er hinter der vorspringenden Landzunge verschwand. In tiefen Gedanken ging er zum Ufer hinauf. — — —
Der stille Bruder des Tags hatte seine beruhigende Hand auf die gewaltige Fabrik gelegt, die seit dem Krieg hier in den weiten Waldungen der Rüdersdorfer Gemarkung entstanden war. Die Nachtschicht begab sich gerade auf ihre Posten; denn die Arbeit darf nicht ruhen. Freundlich grüssten die Arbeiter den jungen Gelehrten.
Unablässig wird der Stickstoff aus der Luft aufgefangen, in Ammoniakgas verwandelt und in Schwefelsäure eingeleitet, um auf diese Weise das wertvolle Stickstoffdüngesalz, den Ammonsulfat, zu gewinnen. Schon in der Kriegszeit war hier eine Stadt entstanden, die sich vom Kalksee tief in den Forst hineingezogen hatte. Unten am See hat sich fast nichts gegen früher verändert. Nur ein schmuckloser Bahnhof als Endpunkt der Fabrikbahn und ein Ladekai am Ufer. Von den waldigen Höhen grüssen noch immer die hübschen Villen, wo Berliner Grossstadtflüchtlinge ihre Sommertage verleben oder alte Rentner den Abendfrieden zwischen Blumen und Waldesodem geniessen.
Folgt man der Bahn, die sich durch einen Taleinschnitt windet, so gelangt man an ein sauberes Arbeiterdorf. Leopold ist jetzt in die erste Strasse eingetreten, und sein Auge fliegt mit freudigem Stolz weit voraus. Wie aus einer Spielzeugschachtel aufgestellt, reiht sich Häuschen an Häuschen mit Ziergärten davor und Nutzgärten dahinter, angelehnt an die schönen, pinienartigen Kiefern des Rüdersdorfer Forstes. Wieviel Reizvolles haben hier Heimatliebe und Volkskunst geschaffen! Jedes Ästchen der abgeholzten Kiefern ist verwendet worden. Da findet man Gartentore, Blumenbretter, Lauben und Laubenmöbel in geschmackvoller Anlage, zum Teil durch Kerbschnitt, zum Teil durch bunten Anstrich verziert. Klematisgitter und Glyzinienspaliere klettern an den Hausfronten hinauf, Rosen umziehen die Wände. Einige der besonders veranlagten Arbeiterkünstler haben aus dem Abraum der nahen Kalkberge phantastische Bauten in ihren Gärten angelegt: Kleine Geröllhalden, auf denen Edelweiss wächst, Grotten und Brücken, die mit seltenen Pflanzen geschmückt sind, kleine Seen mit Goldfischen, überall die sinnvolle Tätigkeit, der natürliche Geschmack des deutschen Arbeiters. Liebe zur Scholle, Seele des deutschen Volkes in einer Sprache, die zur höchsten Poesie geworden ist, weil sie den Ton der Natur in glückhafter Weise veredelt.
Das Arbeiterdorf.
Hier ist Frieden und Glück, Zufriedenheit und ein sozialer Wohlstand, wie er in der brausenden Grossstadt, im Hetzen nach fernen Arbeitsstellen, im Getöse von Streikversammlungen, politischen Zänkereien und in der Stickluft des Klassenkampfes unmöglich ist.
Auf den Gesichtern der Frauen und Männer liest Leopold mit tiefer Befriedigung Behagen und Freude am schönen Heim. Wie ein Urmotiv steht da über einem besonders liebevoll geschmückten Häuschen: „Klein, aber mein.“
Und erst die Kinder! Alles sauber und nett. Sonne in den deutschen Augen, Sonne in den deutschen Herzen!
Da sitzt eine Gesellschaft mit ihrem jungen Lehrer, dem Kantor Schmölke, unter einer prachtvollen Kieferngruppe, die auf dem sogenannten Marktplatz von dem Erbauer aus dem Forst gerettet wurde, auf Rundbänken aus Naturstämmen. Es sind zwar Ferien; aber der Kantor hat sich seine Kleinen doch zusammengeholt, und mit der Geige unter dem Arm spricht er ihnen einen Text vor, den sie singen wollen. Er hat ihn selbst gedichtet auf eine bekannte Melodie.
Leopold bleibt stehn und lauscht den Worten.
„Das Glück begegnet allen
einmal in dieser Welt,
und goldne Sterne fallen
vom hohen Himmelszelt.
Dann hat uns Gottes Güte
unendlich reich gemacht,
dann geht des Glückes Blüte
uns auf in einer Nacht.“
Jetzt haben sie es begriffen. Es schwingt sich die Melodie auf den Kinderstimmen in die würzige Abendluft des Walddorfes. An den Fenstern der Häuschen erscheinen die Köpfe der Eltern, die Türen öffnen sich, und heraus treten die Männer und Frauen. Sie stellen sich im Kreise um die kleinen Sänger und lauschen mit stillem Glück den einfachen Worten und Tönen des Liedes.
Wenn die Kinder schweigen, ist es, als ob ein Engel durch das Dorf ginge. Nur fernher von jenseits der Hügel klingt dumpf das Geräusch der Maschinen, der schwere Atem der gewaltigen Fabrik, die wie ein mächtiger Riese arbeitet, um allen Heimat und Unterhalt zu schaffen.
Weithin erstrecken sich die Anlagen, hochragende Schornsteine steigen in den dunkeln Abendhimmel. Ausgedehnte Förderanlagen und Rohrbrücken sind Nerven- und Blutbahn des Industriekolosses. Die Bauten für die Verwaltung und für die Laboratorien nehmen eine grosse Fläche ein. Strassenlang Werkstätten, Kesselhäuser und Silobauten gleich ungeheuren Luftschiffhallen. Eine Märchenwelt aus Tausendundeiner Nacht. Die Luft, die wir atmen, wallt und siedet blauflüssig in Eimern. Wunder über Wunder reiht sich an. Die Gasfabrik. Eine Stadt von Gasometern, eine wild leuchtende Hölle. Flammen und Dämpfe in allen Farben des Regenbogens, Russ und Staub und finstere Gestalten, den Kyklopen der alten Sage ähnlich, getreue Wächter, die den Elementen wehren, die hier von dem Riesengeist des Menschen in Fesseln geschlagen und gehorsam sind, die wie kosmische Raubtiere knurren und fauchen, aber nicht schaden können.
Wut und Kraft sind hier zum Segen des Menschengeschlechtes in feste Bahnen gelenkt. Ausbrechen darf keins der Höllentiere, der fahlen, feurigen, bunten Teufelsgespenster. Man glaubt im Innern eines Vulkans zu sein, wo es rast und brodelt und Feuer atmet, während die Menschlein mit ihren kleinen Händen unzerreissbare Ketten schmieden, an denen sie die Weltdämonen wie gut dressierte Pferde leiten.
Welch ein Riese ist der Mensch! Ihm ist gegeben alle Gewalt auf Erden. Welch ein Riese ist das deutsche Volk! Und es sollte ihm nicht gelingen, die furchtbare Tributschuld zu tilgen?
Wenn es einig wäre, einig im Geist, einig in der Arbeit. Wer sich selbst hasst, den hassen auch die andern.
Das waren die Gedanken des jungen Chemikers, Doktor Leopold Weltzer, die ihm durch den ideenreichen Kopf gingen, als er langsam dahinschritt, um sein Geheimlaboratorium zu erreichen, wo er noch eine wichtige Untersuchung abschliessen wollte.
Er war ein Proletarierkind. Sein Vater war Schiessmeister in der Fabrik, die nach dem kleinen Walddörfchen „Stickstoffwerke Hortwinkel“ hiess. Von früh an schon hatte der junge Geist Leopolds aufwärts gestrebt. In der Schule fiel er durch seinen Verstand, seinen Fleiss und seine Willenskraft auf. Nicht wie andere Kinder spielte er mit Soldaten, Murmeln und Tieren, sondern mit der Puppenküche seiner frühverstorbenen Schwester. „Er wird einmal ein Koch werden“, meinte sein Vater, der damals in gutbezahlter Stellung in einer chemischen Fabrik am Nonnendamm wirkte. Der Fabrikdirektor, Kommerzienrat Schönebeck, hielt grosse Stücke auf ihn, weil er gewissermassen das Bindeglied zwischen Leitung und Arbeiterschaft war. Als der Kommerzienrat sich eine Villa draussen in der Nähe der Fabrik baute, um nicht so viel Zeit mit dem Hin- und Herfahren zu verlieren, zog Weltzer als Hausmeister in die Souterrainwohnung, und so kamen die Kinder der beiden Familien mit einander in Berührung.
Walter Schönebeck und Leopold Weltzer wurden Freunde. Aber es war eine merkwürdige Freundschaft. Wenn man die beiden neben einander sah, so hätte man Leopold für den Fabrikantensohn, Walter für das Proletarierkind halten können. Leopold feingliedrig, leicht, mit grossen blauen Sehnsuchtsaugen, Walter hochhäuptig, robust, starkknochig, dazu wild und rauflustig. Er war stets zu dummen Streichen aufgelegt, dabei störrisch wie ein junger Hengst, ein Kreuz für Eltern und Lehrer.
Er gehorchte keinem Menschen, tat immer das Gegenteil von dem, was man von ihm forderte, und machte sich unnütz, wo es nur irgend möglich war. Niemand hatte Einfluss auf ihn, weder Vater noch Mutter, noch die jüngere Schwester, ein zartes Sonnenkind, das in die Welt hineinträumte, Märchen las und auf die Fee wartete, die bestimmt kommen musste, um den Prinzen zu bringen.
Nur Leopold konnte auf Walter wirken. Mit seiner stillen, sachlichen Art machte er Eindruck auf den kraftbewussten, unbändigen Buben. Er brauchte nur zu sagen: „Aber nicht doch, Walter!“, dann sah der grosse Junge seinen Spielgefährten mit seinen dunkeln Augen an und liess von seinen Streichen ab. Eigenartig, wie die beiden zusammenstanden! Sie wussten ihre innersten Gedanken von einander, ohne dass sie ein Wort zu sprechen brauchten, und Walter ordnete sich stets dem überlegenen Verstand Leopolds unter.
Kein Wunder, dass die Eltern sich dieses wohltätigen Einflusses häufig bedienten, und wenn sie bei ihrem Sohne etwas durchsetzen wollten, so steckten sie sich hinter Leopold. Das fing schon damals an, als Walter gewisse Speisen nicht essen mochte, oder ein warmes Kleidungsstück im Winter ablehnte. Dann griff der Proletariersohn ein. Er hatte nur nötig, das Essen gut und das Kleidungsstück notwendig zu finden, sofort war Walter gleicher Meinung. Dasselbe Spiel ging in der Geistesausbildung weiter. Der Kommerzienrat hatte sich Leopolds angenommen und den hochbegabten Jungen mit seinem Sohn gemeinschaftlich unterrichten lassen.
Walter war nicht dumm. Aber er hatte für ganz andere Dinge Interesse als für diejenigen, die ihm der Hauslehrer vortrug. Es schien ihm viel wichtiger, dem bescheidenen Kandidaten einen Papierzopf an den Rock zu stecken, als seine lateinischen Vokabeln zu lernen. Leopold half dann immer beruhigend und fördernd.
Mit den Jahren zeigte es sich, dass die Vorliebe für die Puppenküche seiner Schwester nicht auf den Beruf eines Küchenchefs hindeutete, sondern auf den eines Chemikers, überhaupt auf die Naturforschung, die Zerlegung der Dinge in ihre Bestandteile und die Änderung ihres Charakters durch die Mischung.
Schon im Gymnasium, in das beide Freunde nach gründlicher Vorbereitung eingetreten waren, zeichnete er sich in allen naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern aus, während Walter mehr Neigung für Sprachen, für das Dialektische hatte. Als sie zur Universität gingen, stand es für Leopold fest, dass er Chemie studieren würde. Walter schwankte. Am liebsten hätte er sich den schönen Wissenschaften gewidmet; aber der alte Kommerzienrat drängte zum Rechtsstudium.
Grosse Fusionsgedanken waren in der chemischen Industrie Deutschlands lebendig, und ein tüchtiger Jurist darum viel wert. Walter sollte einmal die Stelle des Vaters einnehmen, und mit dem Freund zur Seite, der ein hervorragender Chemiker zu werden versprach, konnte er das vollenden, was der Vater begonnen: Den gewaltigen Industriekonzern, der den Weltmarkt überragend beherrschte.
Aber Walter wollte nicht recht einschlagen, während Leopold glänzend die Hoffnungen rechtfertigte, die man auf ihn gesetzt hatte.
Da war der Krieg gekommen. Und mit ihm ein völliger Umschwung im Charakter des jugendlichen Referendars. Der vaterländische Impuls hatte ihn machtvoll aufgerüttelt. Das verzweifelte Ringen des deutschen Volkes griff ihm ans Herz. Er sah Deutschland in seiner ganzen heroischen Grösse, und er tat mit, sowohl an der eistreibenden Bzura wie im glühenden pikardischen Staub. Er kämpfte und holte sich Wunden und Auszeichnungen.
Leopold, der seines zarten Körpers wegen nicht Soldat gewesen war, hatte sich im Stundenschlag der Mobilmachung als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Anfänglich holte ihn der Bataillonsarzt zu seiner Unterstützung in der Apotheke heran; aber seiner Neigung entsprach mehr der Geist der Kampffront. Und als die ersten Gasgranaten unter dem Bruch des Völkerrechts vom Feinde angewandt wurden, öffnete sich für Leopold ein weites Feld der Tätigkeit. Er wurde von diesem Zeitpunkt an unentbehrlich, wo die Rohstoffe, vor allem der Salpeter, anfingen zu mangeln.
In jenen Tagen entstand als Kriegsnotwendigkeit die Fabrik Hortwinkel, um den Salpeter aus der Luft zu gewinnen. Und Leopold wurde als leitender Chemiker von der Heimat angefordert.
Dann kam all das Furchtbare: Waffenstillstand, Revolution, Chaos, Versailles. Der deutsche Arbeiter war zum Industriesklaven des Feindes geworden. Wilde Schlangenhäupter erhoben sich im Innern und hetzten deutsches Blut gegen deutsches Blut. Gierig richteten sich die Augen des Entente-Kapitalismus auf Deutschlands grosse Erfindungen. Salpeter aus der Luft, das war Kriegsbetrieb. Kommissionen über Kommissionen schnüffelten den kleinsten Winkel der Fabrik durch. Aber Leopold Weltzer, dem Kommerzienrat Schönebeck die Umstellung auf Friedensbetrieb übertragen hatte, schlug jeden Angriff ab. Mit einem freundlichen Lächeln und tadellosem Französisch führte er die Industriespione auf dem weiten Fabrikgelände herum, zeigte alles, was das Auge erreichen konnte; aber das Wichtigste bekam doch keiner zu sehen. Das ruhte in Retorten und Gläsern, brodelte in Destillierkolben oder schlug sich in Wasserbädern nieder. Es waren die zu Reaktionen oder chemischen Verbindungen gewordenen Ideen des jugendlichen Gelehrten.
Diese weitgreifenden Gedanken waren es, die die Stickstoffwerke Hortwinkel sich tiefer und tiefer in den Forst hineinwühlen liessen. Immer mehr schwoll die Industriestadt an, immer neue Bauten und Anlagen forderte Leopold. Und Walter, der die gesamte geschäftliche Leitung hatte, schaffte eine Million nach der andern herbei, damit der Freund sich ungestört entfalten konnte.
Walter war im Brausen des Weltkrieges weit über seine Jahre kühl und ernst geworden. Ein vollgereifter Mann. Wer die beiden im intimsten Gedankenaustausch belauscht hätte, der hätte seltsame Beobachtungen machen können. Walter war trotz allem ein Ästhet geblieben, selbst dann, wenn er die gewaltigsten Transaktionen durchführte; die Seele seines Wesens war nicht juristisch, wenn ihm auch von dieser Wissenschaft die Klarheit der Sprache und die Nüchternheit des Urteils gekommen waren. Die Seele seines Wesens war der Wirtschaftspatriotismus. Deutschland musste wieder an die erste Stelle in der Weltwirtschaft rücken. Aber zu diesem Zweck war es nötig, dass die politischen Kräfte der deutschen Arbeiterschaft in schöpferische Bahnen geleitet wurden. In dem Valuta-Elend der neuen Zeit war es unmöglich, die einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die wahre Erlösung der Menschen wird nur im Anschluss an die Mutter Erde erlangt. Der Ackerbau gibt alles, was wir brauchen. Wer den Ertrag des Ackers steigert, rettet Deutschland vom Untergang. Und Stickstoff ist die Seele des Ackers.
Oft hatte Walter mit Leopold darüber gesprochen, ob es nicht möglich wäre, die weiten Strecken unfruchtbaren Landes für die Kultur zu gewinnen. Und der junge Chemiker hatte geantwortet, dass darin die Lösung des Wiederaufbau-Problems liege. Wissenschaftlich sei es durchaus denkbar, toten Sand zu tragfähigem Boden umzubilden; aber vorläufig bestehe kein Bedürfnis, wenn wir nur erst so viel hochwertige Düngesalze produzieren könnten, um die ausgehungerten Äcker wieder zu sättigen.
Das war Leopolds Ziel.
Zweites Kapitel.
Kommerzienrat Schönebeck hatte sich auf den malerischen Hügeln von Grünheide ein Landhaus gebaut, das er im Sommer bewohnte, und er empfing dort gern Gäste. Heute war ein besonderes Fest zu Ehren eines spanischen Industriellen, der die Licenzen erwerben wollte, um eine grosse Schwesterfabrik in Spanien anzulegen, und zwar deshalb, weil dort ein wichtiger Rohstoff für die Stickstoffproduktion, der Schwefelkies, in fast unerschöpflichen Mengen vorkommt.
Walter war sehr kritisch diesem Gedanken gegenüber. Man schuf sich eine unnötige und vielleicht gefährliche Konkurrenz.
„Aber mein Junge,“ entgegnete der Kommerzienrat, „es ist die Sache des Juristen, die Verträge derart abzuschliessen, dass wir keinen Schaden nehmen. Wir können uns ja mit einer grossen Summe beteiligen. Jedenfalls haben wir durch diese Verbindung ein festes Kontingent von Rohstoffen zu erwarten. Ich habe alles eingehend mit dem Spanier besprochen. Es handelt sich nur darum, dass er den von dir aufgesetzten Vertrag unterschreibt, das andere ruht im Schosse der Zukunft. Wenn du ein Meister der Verhandlung bist, gewinnen wir bei der Aktion. Auf unsern Leopold kannst du dich jedenfalls verlassen. Gib ihm den festen Stützpunkt, und er hebt dir die Welt aus den Angeln. Er kommt doch heute abend bestimmt?“
„Ich habe ihn noch einmal ausdrücklich daran erinnert, aber du kennst ihn ja, wenn er in seinem Geheimlaboratorium arbeitet, vergisst er die Welt um sich her.“
„Auch Irma?“
„Ich glaube, auch sie.“
„Nun, dann rate ich dir, fahre sofort wieder nach der Fabrik und bringe ihn tot oder lebendig hierher. Wir brauchen ihn nötiger als jemals. Der Spanier ist Chemiker, hat fünf Jahre in Deutschland studiert, und ohne Leopold sind wir ihm nicht recht gewachsen.“
Eben waren die ersten Gäste angekommen, und der Kommerzienrat wurde abgerufen. Es waren zwei Grossgrundbesitzer aus der Mark mit ihren Damen, die ein entscheidendes Wort in der deutschen Landwirtschaft zu sprechen hatten: Herr von Molkwitz sass bei Königswusterhausen, und Herr von Blossin hatte sein prachtvolles Rittergut in der Nähe des Wolziger Sees. Beide waren im Automobil herübergefahren.
„Es freut mich herzlich, dass ihr da seid. Der weite Weg ... Nun lassen wir euch auch so bald nicht fort.“
Der Kommerzienrat küsste den Damen ritterlich die Hand und reichte dann den Herren die Rechte.
„So bald nicht,“ meinte Molkwitz. „Es wird um drei Uhr schummrig, und vorher fahren wir bestimmt nicht nach Hause. Was meinst du, Mutter?“
Er strich seinen prachtvollen, eisengrauen Vollbart und richtete sich zu seiner ganzen Gardehöhe auf.
„Ich deute, es ist nur Geschäftliches zu besprechen. Und die Kommerzienrätin wird sich sehr bedanken, bis zum Morgen aufzubleiben.“
„Aber da kennen Sie mich schlecht,“ liess sich jetzt die liebe Stimme der Dame des Hauses hören, die eben eingetreten war und ihre Gäste begrüsste.
„Frau von Molkwitz, Frau von Blossin, herzlich willkommen! Lassen Sie die Herren nur ihre Geschäfte besprechen und ihre dicken Zigarren qualmen. Wir Damen machen indessen ein kleines Nickerchen und trinken dann unsern Kaffee auf der Veranda. Ich habe schon für alles gesorgt. Aber wo ist denn Irma?“
„Ich wundere mich, dass sie noch nicht da ist, die Wasserratte. Sie wollte mit ihrem Motorboot kommen und fuhr zwei Stunden vor uns ab.“
„Wenn ihr nur nichts passiert ist“, meinte ängstlich Frau von Blossin.
„Hat sie trotz des unangenehmen Zwischenfalls in der vorigen Woche doch noch Mut?“ fragte die Kommerzienrätin.
„Die Irma fürchtet sich vor dem Teufel nicht,“ warf Blossin stolz ein. „Der alte Trotha hat sie gestern zum Kapitänleutnant befördert. Die weiss ihren Kahn zu führen. Sie kommt schon ’ran. Seht ihr, da ist sie schon!“
In diesem Augenblick trat Irma in den Salon.
Und es war, als ob die Kristallkronen mit einem Male heller leuchteten, so ein strahlendes Licht ging von ihren schimmernden Augen aus.
Ein freudiges Begrüssen.
„Wo ist denn die Jugend?“ fragte sie, jedem der alten Herren mit einem kräftigen Seemannsgriff die Hand drückend.
„Hilde ist auf ihrem Zimmer, und Walter ging noch einmal nach der Fabrik. — Kommen Sie, Kind, nehmen Sie mit uns alten Damen vorlieb.“
„Aber gern!“
Und sie setzte sich neben die Kommerzienrätin. Doch sie hatte nicht lange Ruhe, sprang wieder auf, und mit einem kurzen: „Ich werde Hilde aufstöbern!“ verliess sie den Salon.
Draussen fuhr ein Automobil vor, das die Berliner Gäste von der Station Fangschleusse abgeholt hatte. Es war der Spanier Moreto y Gyl und sein Nechtsbeistand, Justizrat Bitter. Auch Irma von Blossin kam Arm in Arm mit der Tochter des Hauses zurück.
„Nun könnten wir zu Tisch gehen, wenn die beiden jungen Herren nicht fehlten.“
„Ich glaube, wir warten nicht auf sie,“ meinte die Kommerzienrätin. „Du weisst, wenn Leopold in seinem Laboratorium steckt, ist kein Verlass auf sein Kommen.“
„Wie du denkst, Liebste ... Dann also zu Tisch.“
Frau Schönebeck hatte mit ihrer Voraussetzung recht; denn als Walter in Leopolds Geheimlaboratorium trat, sass der junge Chemiker vor seinen Retorten und Gebläsen. In weltverlorener Beobachtung der kochenden, zischenden Flüssigkeiten, die in allen Farben leuchteten.
„Aber Leo, du bist ja immer noch nicht fertig! Du weisst doch, dass du heute abend eingeladen bist.“
„Wahrhaftig, das hätte ich beinah vergessen.“
„Beinah ist gut. Nun mach aber schnell!“
„Noch eine Viertelstunde musst du mir schenken. Die Herrschaften gehen ja doch ohne uns zu Tisch und —“
„Irma von Blossin ist da. Ich sah gerade ihr Motorboot am Seepavillon landen.“
Ein leuchtendes Rot ging über das feine, durchgeistigte Gesicht des jungen Gelehrten. Aber seine Augen hafteten auf der grossen Retorte, die über der Gasflamme ruhte.
„Was kochst du denn wieder da, alter Junge? Es muss etwas ganz Bedeutendes sein, da du höflicher und korrekter Mensch die Einladung deines Generaldirektors vergessen hast.“
Leopold Weltzer sah seinem Freunde ernst und gedankenvoll in die Augen.
„Du sollst der erste sein, der die grosse Neuigkeit erfährt. Du kennst unser Verfahren oberflächlich, wie ein Jurist in die Geheimnisse der Natur einblicken kann. Du weisst, dass wir den Stickstoff aus der Luft saugen und in Ammoniakgas verwandeln. Wir vermischen ihn dann — ich spreche populär zu deinem gesunden Menschenverstand — mit Schwefelsäure und erhalten so ein wertvolles Düngesalz, die Seele der Pflanzennahrung. Aber die Sache hat einen Haken. Schwefelsäure gewinnen wir aus Schwefelkiesen auf sehr kostspieligem Wege. Dazu müssen wir den Rohstoff einführen und mit Gold bezahlen. Wenn wir nun dem Spanier, wie dein Vater und der Aufsichtsrat wollen, heute eine Licenz verkaufen, so wird die spanische Fabrik uns sehr bald überflügeln, da sie die Rohstoffe fast umsonst erhält; denn sie liegen nebenan in der Erde.“
„Das macht doch nichts, wenn wir uns gross an dem Geschäft beteiligen.“
„Lass mich mit der Beteiligung in Ruhe. Die Spanier werden ihre Aktien nicht lange behalten. Englisches, vielleicht französisches Kapital drängt sich ein, und wir sitzen draussen.“
„So bist du also gegen diese Transaktion?“
„Seit einer Stunde nicht mehr. Nur lass dir die Millionen in Devisen zahlen und gehe auf keine hohe Beteiligung ein.“
„Aber dann haben wir doch nichts zu sagen.“
„Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen heute nur das Gold des Spaniers.“
„Du sprichst in Rätseln, für mich in Rätseln. Du wirst sie sicher schon gelöst haben.“
„Ich will mich kurz erklären. Es war nötig, uns von dem teuren Rohstoff freizumachen.“
„Mensch! Junge! Freund! Und das ist dir gelungen?“
Der Gelehrte nickte schweigend.
„Ja, dann hast du ja Amerika von neuem entdeckt! Dann bist du der grösste Deutsche unserer Zeit! Dann rettest du unser Vaterland!“
Und stürmisch umarmte Walter den Freund.
„Komm mit, wir wollen es dem Vater mitteilen. Heute ist ein hoher Festtag. Ich habe es ja immer gesagt, Deutschland wird sich selbst und die Welt erlösen durch den hochfliegenden Geist der germanischen Schöpferkraft. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!“
„Höre doch erst, du weisst ja noch garnichts.“
„Wenn du es weisst, genügt es mir. Du bist kein Projektenmacher und Flausenhuber, du bist mein alter Leo! Das sagt für mich alles und genug.“
„Aber so höre doch. Hier auf dem Tisch ruht das ganze Geheimnis.“
„Also sprich, ich verstehe ja doch nichts davon.“
„Das verstehst du: Um von den Schwefelkiesen loszukommen, musste ich nach einer anderen Verbindung suchen, in der die wertvolle Säure enthalten ist, und da verfiel ich auf eine Verbindung mit Kalk, nämlich den Gips, den wir in Deutschland überreichlich besitzen. Ich habe ihn zunächst mit Wasser aufgeschlämmt. Dann habe ich unser Ammoniakgas zugleich mit Kohlensäure hineingeleitet, und es entstand kohlensaurer Kalk mit schwefelsaurem Ammoniak. Und das ist unser Düngesalz. Hier in dieser Retorte siehst du die Verbindung.“
„Aber wie bekommst du unser Salz rein?“
„Ganz einfach. Der kohlensaure Kalk ist unlöslich, ich kann ihn daher durch Filtration aus der Ammoniaksulfatlösung entfernen, dann gewinne ich durch Eindampfen und Abschleudern unser hochwertiges Düngesalz.“
„Im Laboratorium ...?“
„Und im Grossbetrieb ... Nun aber kommt die Hauptsache. Und die ist entscheidend für unser Abkommen mit dem Spanier. Ich habe heimlich die Gegend der Rüdersdorfer Kalkberge untersucht und unerschöpfliche Gipslager festgestellt, die sich bis auf unser Fabrikgelände erstrecken.“
„Mensch, du machst meinen Verstand stillestehn!“
„Nur nicht! Dein Verstand muss arbeiten. Hart und klug arbeiten; denn es gilt den uns noch fehlenden Grund und Boden unauffällig zu erwerben, dann eine Gipsmühle zu bauen und eine Feldbahn anzulegen. Wir müssen unsern ganzen Betrieb umstellen, und dazu brauchen wir die Goldmillionen des Spaniers. Ein Geheimnis, das noch hier in den Retorten liegt, verkaufen wir ihm nicht, weil es vorläufig noch mein geistiges Eigentum ist.“
„Und das ist alles unantastbar sicher?“
„Sicher, weil es einfach ist, so einfach, dass es jeder Student der Chemie im dritten Semester nachmachen kann.“
„Dann wird es auch jeder nachmachen.“
„Wenn ich es ihm erkläre. Es sind einige neue Gedanken in Wirksamkeit getreten, die Geheimnis bleiben, und dann wird uns das fabrikatorische Verfahren geschützt. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu: Ich musste darauf denken, der Landwirtschaft den unschätzbaren und heute unerschwinglich teuren Chilesalpeter zu schaffen.“
„Und das ist dir auch gelungen?“
„Vollkommen.“
„Wie hast du denn das fertiggebracht?“
„Nichts einfacher als das.“
„Ja, deinem Genie.“
„Rede nicht so, das beschämt mich. Es ist wirklich keine Hexerei gewesen. Chilesalpeter ist weiter nichts als unreiner Natronsalpeter. Ich brauchte also nur unsern Ammoniakstickstoff umzuwandeln, das heisst, ich habe ihn einer Art Verbrennung unterzogen. Unser Ammoniakgas mit Sauerstoff zu nitrosen Gasen verbrannt, oder wie wir Chemiker sagen, oxydiert. Durch Verbindung mit Wasser entsteht Salpetersäure. Bringt man diese mit Sodalösung zusammen, so gewinnt man ohne weiteres Natronsalpeter, wie ich schon sagte, das gleiche chemische Produkt wie den Chilesalpeter; nur ist unserer weit reiner, als ihn die Natur liefert. Auf dieser Gedankenleiter kann ich immer weitergehn, um schliesslich den Hunger des Erdbodens nach all seinen Nährmitteln zu befriedigen.“ Und nun wurden seine Augen gross und blickten prophetisch in die Ferne: „In einigen Jahren gibt es in Deutschland kein Ödland mehr. Des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse, die sandbedeckte Brust unserer Mark, wird zur segenspendenden Mutterbrust glücklicher und zufriedener Menschen.