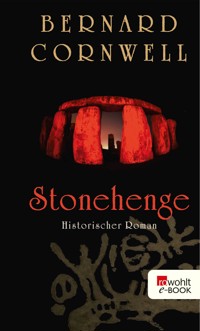
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
«‹Stonehenge› ist ein Meisterwerk.» (The Times) Um die Macht in Ratharryn zu erlangen, wendet sich Lengar, der Krieger, gegen den eigenen Vater und raubt dem Bruder die Frau. Doch Clanführer wird sein jüngster Bruder, Saban der Baumeister, bis Verrat ihn zum Sklaven macht. Blutige, langjährige Kriege überziehen das Volk von Ratharryn. Doch dann hat der Seher Camaban, der mittlere Bruder, eine Vision: Frieden ist nur möglich, wenn ein gewaltiger Steinkreis erbaut wird – eine neue Heimstatt für die Götter: Stonehenge. Eine große Saga um Bruderzwist, Machtgier und Liebe – und die faszinierende Geschichte eines der eindrücklichsten Bauwerke, die jemals von Menschenhand geschaffen wurden. «Bernard Cornwell taucht in die Vorgeschichte ein und versucht sich an einer Antwort auf die Frage, von wem und warum Stonehenge erbaut wurde. Ergebnis ist ein meisterhaft erzähltes Epos, voller starker Figuren, Drama, Farbe, Tempo, Höhepunkte.» (Times Literary Supplement) «Eine reiche Mischung aus blutigem Konflikt, politischen und religiösen Wirren. Was für ein hervorragender Schriftsteller Bernard Cornwell geworden ist.» (The Economist)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 897
Ähnliche
Bernard Cornwell
Stonehenge
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Elke Bartels
Zum Andenken an
BILL MOIR
1943–1998
«Die Druidenhaine gibt’s nicht mehr –
umso besser;
Stonehenge dagegen steht noch –
aber was, zum Teufel, war es?»
Lord Byron, Don Juan
Canto XI, Vers XXV
ERSTER TEIL
Der Himmelstempel
Karte der Siedlung und der Tempel von Ratharryn, ca. 2000v.Chr.
1.KAPITEL
Die Götter sprechen zu den Menschen durch Zeichen. Ein solches Zeichen kann ein Blatt sein, das im Sommer abfällt, der Schrei eines sterbenden Tieres oder die sich plötzlich kräuselnde Oberfläche eines stillen Gewässers. Auch könnte man dicht über den Boden dahinziehenden Rauch entdecken, einen Riss in der Wolkendecke oder die ungewöhnliche Flugbahn eines Vogels.
Aber an jenem Tag schickten die Götter ein Unwetter. Es war ein gewaltiges Unwetter, ein Sturm, an den die Menschen noch lange denken würden, obwohl sie das Jahr nicht nach diesem Naturereignis benannten. Stattdessen nannten sie es «das Jahr, in dem der Fremde kam».
Denn an dem Tag des Unwetters traf ein Fremder in Ratharryn ein. Es war an demselben Sommertag, an dem Saban um ein Haar von seinem Halbbruder ermordet worden wäre.
An diesem Tag sprachen die Götter nicht. Sie schrien.
Wie alle Kinder trug auch Saban im Sommer keine Kleidung. Er war sechs Jahre jünger als sein Halbbruder Lengar, und da er noch nicht die Riten durchlaufen und seine Mannhaftigkeit unter Beweis gestellt hatte, war er nicht von Stammestätowierungen oder Kampfnarben gezeichnet. Aber bis zu seiner Zeit der Prüfung lag nur noch ein Jahr vor ihm, und ihr Vater hatte Lengar angewiesen, Saban in den Wald mitzunehmen und ihm zu zeigen, wo sich die Hirsche aufhielten, wo die wilden Keiler lauerten und wo die Wölfe ihren Bau hatten. Lengar war empört darüber, dass ihm sein Vater diese lästige Aufgabe übertragen hatte; also hatte er seinen Bruder, statt ihn zu unterweisen, durch dorniges Gestrüpp und Dickichte geschleppt, sodass die sonnengebräunte Haut des Jungen aus zahlreichen Kratzwunden blutete. «Du wirst nie ein Mann werden», höhnte Lengar.
Saban war so vernünftig zu schweigen.
Lengar gehörte seit fünf Jahren zu den Männern – er trug die blauen Narben des Stammes auf der Brust und auf den Armen, die Tätowierungen eines Jägers und Kriegers. Seine Waffe bildete ein Eibenholz-Langbogen, der mit Hornspitzen beschlagen, mit Sehnen bespannt und mit Schweinefett eingerieben war. Sein Gewand bestand aus einem Wolfsfell, das lange schwarze Haar baumelte ihm als mit einem Streifen Fuchsfell zusammengebundener Zopf auf dem Rücken. Er war groß, hatte ein schmales Gesicht und galt als einer der tüchtigsten Jäger des Stammes. Sein Name bedeutete «Wolfsauge», denn seine Iris spielte leicht ins Gelbliche. Bei seiner Geburt erhielt er bereits einen Namen; aber wie so viele Stammesmitglieder wollte er ab dem Eintritt in das Mannesalter anders heißen.
Auch Saban war groß und hatte langes schwarzes Haar. Sein Name bedeutete «Der Wohlgestaltete», und viele im Stamm hielten ihn für durchaus passend; denn schon jetzt, mit seinen kindlichen zwölf Sommern, versprach Saban ein gutaussehender Bursche zu werden. Stark und geschmeidig, arbeitete er unermüdlich und lächelte häufig. Was Lengar nur selten tat. «Er hat eine Wolke im Gesicht», sagten die Frauen von ihm, allerdings lediglich hinter vorgehaltener Hand, denn Lengar würde wahrscheinlich der nächste Clanführer des Stammes werden. Lengar und Saban waren die Söhne von Hengall, dem derzeitigen Clanführer des Volkes von Ratharryn.
Den ganzen Tag über führte Lengar Saban durch den Wald. Sie trafen weder auf Damwild noch auf Wildschweine, Wölfe, Auerochsen oder Bären. Ziellos marschierten sie durch das Unterholz; am Nachmittag dann gelangten sie an den Rand des hochgelegenen Geländes und sahen, dass eine Wand dicker schwarzer Wolken das gesamte Land im Westen überschattete. Blitze zuckten durch die Finsternis, schlugen in den fernen Wald ein und tauchten die Umgebung sekundenlang in grelles Licht. Lengar hockte sich auf den Boden, eine Hand an seinem polierten Bogen, und beobachtete das sich nähernde Gewitter. Er hätte sich schleunigst auf den Rückweg machen sollen; aber er wollte, dass Saban es mit der Angst zu tun bekam, und deshalb tat er so, als kümmerte ihn die Drohung des Sturmgottes nicht.
Während dieses heraufziehenden Unwetters nun erschien der Fremde auf der Bildfläche.
Er ritt ein kleines graubraunes Pferd, das über und über mit Schweiß bedeckt war. Sein Sattel bestand aus einer zusammengefalteten wollenen Decke, die Zügel waren aus Nesselfasern geflochten, die er kaum brauchte; denn er war verwundet und wirkte vollkommen erschöpft. Deshalb überließ er es seinem Pony, sich einen Weg den Pfad hinauf zu bahnen, der sich die steile Böschung emporwand. Der Fremde hielt den Kopf gesenkt, und seine Fersen schleiften fast am Boden entlang. Unter einem wollenen, blaugefärbten Umhang trug er in der rechten Hand einen Bogen, während über seiner linken Schulter ein Lederköcher hing, gefüllt mit Pfeilen, an deren Schäften Federn von Seemöwen und Krähen steckten. Seine kurzen Barthaare waren schwarz, die in seine Wangen eintätowierten Stammesabzeichen grau.
Lengar flüsterte Saban zu, sich ganz still zu verhalten, dann verfolgte er den Fremden Richtung Osten. Der große Bruder hatte einen Pfeil in seinen Bogen eingespannt; aber der Fremde drehte sich kein einziges Mal nach etwaigen Verfolgern um – daher war Lengar vorerst bereit, den Pfeil auf seiner Bogensehne ruhen zu lassen. Saban fragte sich, ob der Reiter überhaupt noch lebte, denn er hockte so reglos und in sich zusammengesunken auf dem Rücken seines Pferdes wie ein Toter.
Der Mann musste von jenseits der Grenze sein. Selbst Saban konnte das erkennen, da nur die Fremdländischen solche zotteligen Pferdchen ritten und graue Tätowierungen im Gesicht hatten. Das fremdländische Volk war der Feind, dennoch schoss Lengar immer noch nicht seinen Pfeil ab. Er folgte dem Reiter einfach nur, und Saban folgte Lengar, bis der Unbekannte schließlich an den Waldrand gelangte, wo Adlerfarn wuchs. Dort hielt der Mann sein Pferd an und hob den Kopf, um auf die sanft ansteigende Landschaft hinauszustarren, während Lengar und Saban ungesehen hinter ihm im Unterholz kauerten.
Der Fremde erblickte Farngestrüpp und jenseits davon, wo das Erdreich über der darunterliegenden Kreideschicht dünn war, Grasland. Den flachen Kamm des Graslandes sprenkelten Grabhügel. Schweine wühlten im Laub, während auf den Weiden weiße Rinder grasten. Hier schien noch immer die Sonne. Der Fremde verharrte eine ganze Weile dort und hielt nach Feinden Ausschau, die jedoch ausblieben. Weit in der Ferne dehnten sich mit Dornenhecken umgebene Weizenfelder nordwärts, über die jetzt die ersten finsteren Wolken, Vorreiter des Unwetters, ihre Schatten jagten; aber unmittelbar vor ihm war die Landschaft noch von Sonnenlicht überflutet. Vor ihm befand sich Leben, hinter ihm Dunkelheit, und plötzlich stürmte das kleine Pferd unaufgefordert ins Gestrüpp. Der Reiter ließ sich von ihm tragen.
Das Tier erklomm die sanfte Anhöhe zu den Grabhügeln. Lengar und Saban warteten, bis der Fremde hinter der Horizontlinie verschwunden war, dann schlichen sie ihm nach; und als sie den Kamm des Walls erreichten, kauerten sie sich in die Vertiefung neben einem der Gräber, um festzustellen, dass der Reiter neben dem Alten Tempel angehalten hatte.
Donner grollte in der Ferne, und eine weitere heftige Windbö drückte das Gras nieder, wo das Vieh weidete. Der Fremde glitt zu Boden, durchquerte den mit Unkraut überwucherten Ringgraben des Alten Tempels und verschwand in den Haselnusssträuchern, die dicht innerhalb des geheiligten Kreises wuchsen. Saban nahm an, dass der Mann Zuflucht suchte.
Aber sein Bruder war hinter dem Fremden her, und Lengar neigte nicht dazu, Gnade walten zu lassen.
Das reiterlose Pferd, verängstigt durch den lauten Donner und die großen Rinder, trabte in westlicher Richtung auf den Wald zu. Lengar wartete, bis das Tier zwischen den Bäumen verschwunden war; dann kletterte er aus dem Versteck und rannte zu den Haselnusssträuchern.
Saban folgte ihm, und zwar dorthin, wo er in seinen ganzen zwölf Lebensjahren noch niemals gewesen war.
Zu dem Alten Tempel.
Früher einmal, vor so unendlich vielen Jahren, dass sich kein Lebender mehr an jene Zeiten erinnern konnte, war der Alte Tempel das größte Heiligtum des Herzlandes gewesen. In jenen Tagen, als die Menschen von weit her gekommen waren, um in den Steinkreisen des Tempels zu tanzen, war der hohe Wall aus kreidehaltiger Erde, der das Heiligtum umgab, so weiß gewesen, dass er im Mondschein leuchtete. Der schimmernde Ring maß einen Durchmesser von hundert Schritten; in den alten Zeiten war die geheiligte Fläche in seinem Inneren von den Füßen der Tanzenden platt getrampelt worden, während sie das Totenhaus umkreisten, das aus drei Ringen von behauenen Eichenstämmen bestand. Die nackten, glatten Baumstämme waren mit Tierfett eingeölt sowie mit Efeuranken und Stechpalmenzweigen behängt gewesen.
Jetzt überwucherten den Wall dichtes Gras und Unkraut. Kleine Haselbüsche wuchsen in dem Ringgraben, und weitere Haselnusssträucher hatten sich auf der weiten Fläche im Inneren des Walls angesiedelt; aus der Ferne wirkte der Tempel wie ein Wäldchen von Sträuchern und Büschen. Vögel nisteten jetzt dort, wo einst Menschen getanzt hatten. Ein Eichenpfeiler des Totenhauses ragte noch immer über dem Gestrüpp auf; doch der Pfahl stand mittlerweile schief, sein einst glattes Holz war rissig, schwarz verfärbt und dicht mit allerlei Pilzen überwachsen.
Denn die Menschen hatten den Tempel aufgegeben – dennoch vergessen die Götter ihre Heiligtümer nicht. Manchmal, an stillen Tagen, wenn milchige Nebelschwaden über dem Weidegrund lagen oder der riesige Vollmond reglos über dem Kreidering stand, erzitterten die Haselnussblätter, so, als ob ein Windhauch durch das Laub strich. Die Tanzenden waren verschwunden, aber die göttlichen Kräfte konnte man immer noch spüren.
Und jetzt war ein Fremder in das Heiligtum eingedrungen.
Die Götter schrien vor Zorn.
Wolkenschatten verdunkelten die Weide, als Lengar und Saban auf den Alten Tempel zurannten. Saban fror, und er hatte Angst. Lengar fürchtete sich ebenfalls; aber die Fremdländischen waren berühmt für ihren Reichtum, und seine, Lengars, Gier überwog seine Furcht, den Tempel zu betreten.
Der Fremde war durch den Rundgraben gekrochen und den Wall hinaufgeklettert; deshalb eilte Lengar zu dem alten Eingang an der Südseite, wo ein schmaler, erhöhter Fußweg in das überwachsene Innere führte. Hinter dem Fußweg ließ Lengar sich auf alle viere nieder und kroch durch die Haselnusssträucher. Widerstrebend tat Saban es ihm nach, weil er nicht allein auf der Weide zurückbleiben wollte, wenn sich der Zorn des Sturmgottes entlud.
Zu Lengars Überraschung war der Alte Tempel nicht vollkommen von Gestrüpp überwuchert; denn dort, wo einst das Totenhaus gestanden hatte, erstreckte sich eine gerodete Fläche. Irgendjemand aus dem Stamm musste noch immer den Alten Tempel besuchen, weil das Unkraut gejätet und das Gras mit einem Messer geschnitten worden war und ein einzelner Ochsenschädel in dem verfallenen Totenhaus lag, wo jetzt der Fremde saß, den Rücken gegen den letzten Tempelpfeiler gelehnt. Die Wangen des Mannes waren bleich, seine Augen geschlossen – aber seine Brust hob und senkte sich unter keuchenden, mühsamen Atemzügen. Er trug einen schmalen, langen Keil aus dunklem Stein an der Innenseite seines linken Handgelenks, mit Lederschnüren befestigt. Seine wollenen Beinlinge starrten vor Blut. Der Mann hatte seinen kurzen Bogen und den Köcher mit Pfeilen neben den Ochsenschädel fallen lassen und presste jetzt einen Lederbeutel gegen seinen verletzten Bauch. Drei Tage zuvor war er im Wald aus dem Hinterhalt überfallen worden. Er hatte seine Angreifer nicht gesehen, nur den plötzlichen stechenden Schmerz gespürt, als ein Speer ihn erwischte; dann hatte er seinem Pferd hastig die Fersen in die Flanken gedrückt und sich von ihm aus der Gefahrenzone tragen lassen.
«Ich werde Vater holen», flüsterte Saban.
«Du wirst nichts dergleichen tun!», zischte Lengar. Der Verwundete musste sie gehört haben, denn er riss die Augen auf, und sein Gesicht verzerrte sich zu einer gequälten Grimasse, als er sich vorbeugte, um nach seinem Bogen zu greifen. Aber der Schmerz beeinträchtigte den Fremden in seiner Beweglichkeit, und Lengar war sehr viel schneller als er. Er ließ seinen Langbogen fallen, sprang aus seinem Versteck und rannte hinüber zu dem Totenhaus, um mit einer Hand den Bogen des Fremden an sich zu raffen und mit der anderen dessen Köcher. In seiner Hast kippte er die Pfeile aus, sodass nur noch einer in dem Lederköcher zurückblieb.
Von Westen her ertönte gedämpftes Grollen. Saban erschauerte, voller Angst, dass das Geräusch anschwellen würde, um die Luft mit dem Zorn des Sturmgottes zu erfüllen – aber der Donner verhallte wieder, und danach herrschte tödliche Stille am Himmel.
«Sannas», sagte der Fremde, dann fügte er ein paar Worte in einer Sprache hinzu, die weder Lengar noch Saban sprachen.
«Sannas?», fragte Lengar.
«Sannas», wiederholte der Mann mit Nachdruck. Sannas war die mächtige Zauberin von Cathallo, überall kannte man sie – Saban nahm an, der Fremde wollte von ihr geheilt werden.
Lengar lächelte. «Sannas gehört nicht zu unserem Volk», erklärte er. «Sannas lebt nördlich von hier.»
Der Fremde verstand Lengars Worte nicht. «Erek», sagte er, und Saban, der die Szene noch immer vom Gestrüpp aus beobachtete, fragte sich, ob das der Name des Mannes war oder vielleicht der Name seines Gottes. «Erek», wiederholte der Verwundete matt; doch Lengar, der den einen Pfeil aus dem Köcher des Fremden herausgenommen und in den kurzen Bogen eingespannt hatte, begriff gar nichts. Der Bogen bestand aus schmalen Holzstücken und Geweihsprossen, zusammengeleimt und mit Sehnen bespannt, und Lengars Volk hatte eine solche Waffe nie benutzt. Sie bevorzugten den aus dem Holz der Eibe geschnitzten Langbogen, und der junge Krieger betrachtete die seltsame Waffe voller Neugier. Er zog die Sehne zurück, um ihre Kraft zu prüfen.
«Erek!», schrie der Fremde laut.
«Du bist ein Fremdländischer», sagte Lengar, «und hast hier nichts zu suchen.» Er zog die Sehne abermals zurück, überrascht von der Spannung in der kurzen Waffe.
«Hol eine Heilerin her. Hol mir Sannas», bat der Fremde in seiner eigenen Sprache.
«Wenn Sannas hier wäre», erwiderte Lengar, der nichts außer diesem Namen verstand, «würde ich zuerst sie töten.» Verächtlich spuckte er aus. «Das ist genau das, was ich von Sannas halte. Sie ist eine verschrumpelte alte Hexe, eine Schale böser, giftiger Krötenscheiße, die Menschengestalt angenommen hat!» Er spuckte abermals auf den Boden.
Der Fremde beugte sich vor, hob mühsam die Pfeile auf, die aus seinem Köcher gefallen waren, und fasste sie zu einem Bündel zusammen, das er wie ein Messer in der Hand hielt – als ob er sich damit verteidigen wollte. «Bring mir eine Heilerin», wiederholte er in seiner Sprache. Donner grollte im Westen, und die Haselnussblätter erzitterten, als eine kalte Windbö über die Hügel fegte, ein weiterer Vorbote des heraufziehenden Unwetters. Erneut blickte der Fremde flehend zu Lengar auf und fand doch keinerlei Mitleid in seinen Augen. Er sah dort einzig Mordlust. «Nein», krächzte er rau, «nein, bitte nicht!»
Lengar spannte den Bogen. Er stand nur fünf Schritte von dem Fremden entfernt, und der kleine Pfeil traf sein Ziel mit tödlicher Wucht, ließ den Mann ruckartig auf die Seite fallen. Der Pfeil grub sich so tief in das Fleisch, dass nur noch eine Handbreit des schwarz- und weißbefiederten Schafts aus der linken Brustseite des Getroffenen herausragte. Saban dachte, der Arme müsse tot sein, weil er eine ganze Weile vollkommen reglos dalag; aber dann glitt das Bündel Pfeile aus seiner Hand, als er sich langsam, sehr langsam in eine sitzende Position hochstemmte. «Bitte», röchelte er.
«Lengar!» Hastig kroch Saban aus seinem Versteck und kam herbeigerannt. «Lass mich Vater holen!»
«Sei still!» Lengar hatte einen seiner eigenen, schwarzen Pfeile aus dem Köcher genommen und ihn in den kurzen Bogen eingespannt. Er ging auf Saban zu, zielte und grinste breit über den Ausdruck panischer Angst auf dem Gesicht seines Halbbruders.
Der Fremde richtete ebenfalls den Blick auf Saban und sah einen großen, schönen Jungen mit zerzaustem schwarzen Haar und intelligenten, erschrockenen Augen. «Sannas», flehte er Saban an, «bring mich zu Sannas.»
«Sannas lebt nicht hier», erwiderte Saban, der nur den Namen der Zauberin verstand.
«Wir leben hier», verkündete Lengar und zielte erneut auf den Fremden, «aber du bist ein Fremdländischer, und ihr stehlt unser Vieh, macht unsere Frauen zu Sklavinnen und betrügt unsere Händler.» Damit schoss er den zweiten Pfeil ab, und genau wie der erste bohrte er sich mit voller Wucht in die Brust des Fremden, diesmal jedoch in die Rippen seiner rechten Körperseite. Wieder schlug es den Mann zur Seite, und abermals zwang er sich mit äußerster Kraftanstrengung hoch, als ob sein Geist sich weigerte, seinen gequälten Körper zu verlassen.
«Ich kann dir Macht verschaffen», äußerte er stoßweise, während ein Rinnsal schaumigen hellroten Blutes aus seinem Mund quoll und in seinen kurzen Bart sickerte. «Macht», flüsterte er.
Aber Lengar verstand die Sprache des Mannes nicht. Er hatte zwei Pfeile auf ihn abgeschossen, und noch immer weigerte sich der Fremde zu sterben; deshalb hob Lengar seinen Langbogen vom Boden auf, spannte einen Pfeil ein und wandte sich erneut zu seinem Opfer um. Er zog die straffgespannte Sehne zurück und zielte sorgfältig.
Der Fremde schüttelte den Kopf; doch er kannte jetzt sein Schicksal und starrte Lengar unverwandt in die Augen, um ihm zu zeigen, dass er keine Angst vor dem Ende hatte. Er verfluchte seinen Mörder, obwohl er bezweifelte, dass die Götter ihn erhören würden – denn er war ein Dieb und ein Flüchtiger.
Lengar ließ die Bogensehne zurückschnellen, der schwarzbefiederte Pfeil traf den Fremden mitten ins Herz. Er musste eigentlich tot sein – dennoch bäumte er sich ein letztes Mal auf, als wollte er die Pfeilspitze aus Feuerstein abwehren; dann fiel er hintüber, erzitterte einige Herzschläge lang und blieb zuletzt verkrümmt liegen.
Eilends spuckte Lengar in seine rechte Hand und verrieb die Spucke auf der Innenseite seines linken Handgelenks, wo die Bogensehne des Fremden seine Haut gepeitscht und einen brennenden Schmerz hinterlassen hatte; und Saban, der seinen Halbbruder beobachtete, begriff plötzlich, warum der Fremde den schmalen Steinkeil an der Innenseite seines Unterarms trug. Lengar tanzte ein paar Schritte, um seinen Sieg zu feiern, aber gab das rasch auf. Tatsächlich zweifelte er, ob der Mann wirklich tot war; denn er näherte sich dem reglosen Körper sehr vorsichtig und stieß ihn mit dem mit Horn verstärkten Ende seines Bogens an, bevor er hastig zurücksprang, für den Fall, dass der Leichnam plötzlich wieder zum Leben erwachen und sich auf ihn stürzen würde; doch der Fremde rührte sich nicht mehr.
Wieder bewegte sich Lengar vorsichtig auf den Toten zu, riss den Beutel aus dessen leblosen Händen und wich erneut ein paar Schritte zurück. Einen Moment lang starrte er in das aschfahle Gesicht des Leichnams, dann, endlich überzeugt, dass der Geist des Mannes wirklich aus seinem Körper entflohen war, zerrte er hastig an der Lederschnur, die den Beutel verschloss. Er spähte in das Innere, verharrte einen Augenblick abwartend, dann schrie er laut auf vor Freude. Macht! Er hatte Macht bekommen!
Saban, erschrocken über den Aufschrei seines Bruders, wich zurück, dann kam er neugierig wieder näher, als Lengar den Inhalt des Beutels in das Gras neben dem ausgeblichenen Ochsenschädel schüttete. Für Saban sah es so aus, als ob ein Strahl von Sonnenlicht aus dem Lederbeutel glitt.
Im Gras lagen Dutzende von goldenen Rauten, jede ungefähr so groß wie der Daumennagel eines Mannes, und vier größere rautenförmige Schmuckplatten, so groß wie eine Männerhand. Sowohl die großen als auch die kleinen Gegenstände wiesen winzige Bohrlöcher an den schmaleren Enden auf, sodass sie auf eine Sehne gefädelt oder an ein Kleidungsstück genäht werden konnten; alle bestanden aus dünngewalzten Goldplatten, in die gerade Linien eingeritzt waren; aber Lengar konnte mit dem Muster nichts anfangen. Ärgerlich riss er Saban eine der kleinen Rauten aus der Hand, die dieser aufzuheben gewagt hatte; dann klaubte er alle Stücke, groß und klein, zusammen und schichtete sie auf einen Haufen. «Weißt du, was das hier ist?», fragte er seinen jüngeren Bruder und wies auf den Stapel.
«Gold», riet Saban.
«Macht», erklärte Lengar. Er warf einen Blick auf den Toten. «Weißt du, was man mit Gold machen kann?»
«Es tragen?», schlug Saban vor.
«Dummkopf! Man kauft Männer damit.» Lengar lehnte sich auf die Fersen zurück. Die Wolkenschatten wurden immer dunkler, und der zunehmende Wind zerrte an den Haselnusssträuchern. «Mit Gold kauft man Speerwerfer», triumphierte er. «Man kauft Bogenschützen und Krieger! Man kauft Macht!»
Saban schnappte sich eine der kleinen Rauten, dann wich er rasch zur Seite aus, als Lengar sie ihm wegzunehmen versuchte. Der Junge lief über die gerodete Fläche, und da es schien, als würde Lengar ihn nicht jagen, ging er in die Hocke und betrachtete das Stückchen Gold stirnrunzelnd. Es schien ein merkwürdiges Ding zu sein, um Macht damit zu erkaufen. Saban konnte sich vorstellen, dass Männer bereit waren, für Nahrung oder für Töpfe zu arbeiten, für Feuerstein oder für Sklaven oder auch für Bronze, die man zu Messern, Äxten, Schwertern und Speerspitzen hämmerte – aber für dieses helle Metall? Es war nicht hart genug, um zu schneiden, sondern war einfach nur da – und dennoch erkannte Saban selbst an diesem bewölkten Tag, wie wundervoll das Metall glänzte. Es glänzte so herrlich, als ob ein Stück der Sonne in seinem Inneren eingeschlossen wäre, und plötzlich schauderte es ihn. Nicht weil er nackt war und fror, nicht weil er noch nie zuvor Gold berührt hatte – sondern weil er noch nie ein Stückchen der allmächtigen Sonne in der Hand gehalten hatte. «Wir müssen es zu Vater bringen», sagte er ehrfürchtig.
«Damit der alte Idiot seinen Schatz damit aufstocken kann?», meinte Lengar verächtlich. Er ging zu dem Toten zurück und schlug den Umhang über den Pfeilschäften zurück – um zu entdecken, dass die Beinlinge des Fremden an einem Gürtel befestigt waren, dessen Schnalle aus einem dicken Klumpen schweren Goldes bestand, während er noch mehr von den kleinen Rauten an einer Sehne um den Hals trug.
Lengar warf einen verstohlenen Blick auf seinen jüngeren Bruder, leckte sich über die Lippen; dann hob er einen der Pfeile auf, die dem Fremden aus der Hand geglitten waren. Er hielt immer noch seinen Langbogen griffbereit und spannte jetzt den schwarz- und weißbefiederten Pfeil in die Sehne ein. Einen Moment starrte er in das Dickicht der Haselnusssträucher, wich ganz bewusst dem Blick seines Halbbruders aus… doch Saban begriff jäh, was Lengar im Sinn hatte. Wenn Saban entwischte, um ihrem Vater von diesem Schatz zu erzählen, dann würde Lengar das kostbare Gold verlieren oder würde zumindest erbittert darum kämpfen müssen; aber wenn Saban tot aufgefunden werden würde, mit dem schwarz- und weißbefiederten Pfeil eines fremdländischen Bogenschützen zwischen den Rippen, dann würde niemand argwöhnen, dass Lengar ihn getötet hatte – es würde auch niemand auf die Idee kommen, dass Lengar einen großen Schatz für seine eigenen Zwecke gestohlen hatte. Das Donnergrollen im Westen wurde deutlich lauter, und der kalte Wind drückte die Wipfel der Bäume flach. Lengar zog die Bogensehne zurück, obwohl er noch immer nicht zu Saban hinschaute. «Sieh dir das hier an!», schrie Saban auf einmal und hielt die kleine Raute hoch. «Sieh doch nur!»
Lengar lockerte den Druck der Bogensehne ein wenig, als er auf die Raute starrte, und in dem Moment flitzte der Junge davon wie ein Hase, der plötzlich aus dem Gras schießt. Er stürmte durch die Haselnusssträucher und floh quer über den breiten Weg, der zu dem Sonneneingang des Alten Tempels führte. Dort ragten noch mehr verfaulte Holzpfeiler aus dem Boden, genau wie derjenige beim Totenhaus. Er schlug einen Zickzackkurs ein, um den morschen Stümpfen auszuweichen, und gerade als er sich einen Weg zwischen ihnen hindurchbahnte, sirrte Lengars Pfeil dicht an seinem Ohr vorbei.
Ein ohrenbetäubendes Krachen zerriss den Himmel in Fetzen, als der erste Regen herniedertrommelte. Ein greller Blitzstrahl traf den gegenüberliegenden Hang. Saban hetzte weiter, während er sich zwischen den Pfeilern hindurchwand, und er wagte es nicht, sich umzuschauen, ob Lengar ihn verfolgte. Der Regen prasselte stärker und immer stärker vom Himmel, erfüllte die Luft mit seinem bösartigen Tosen, bildete jedoch eine Art schützenden Schirm um den Jungen, als dieser in nordöstlicher Richtung auf die Siedlung zurannte: Er schrie gellend um Hilfe, in der Hoffnung, dass vielleicht noch einer der Hirten auf dem Weidegrund wäre; aber er entdeckte niemanden, bis er die Grabhügel am Rand des Hügels hinter sich gelassen hatte und den schlammigen Pfad zwischen den kleinen Weizenfeldern entlangstürmte, die von dem peitschenden Regen arg in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Galeth, Sabans Onkel, und fünf andere Männer waren gerade in die Siedlung zurückgekehrt, als sie die Schreie des Jungen vernahmen. Sie marschierten wieder den Hügel hinauf, und da jagte Saban durch den strömenden Regen herbei, um hilfesuchend nach dem Hirschledergewand seines Onkels zu greifen. «Was hast du denn, Junge?», fragte Galeth überrascht.
Saban klammerte sich wie ein Ertrinkender an seinen Onkel. «Er hat versucht, mich zu töten!», keuchte er. «Er hat versucht, mich zu töten!»
«Wer?», drang Galeth in ihn. Er war der jüngste Bruder von Sabans Vater, groß, bärtig und berühmt für seine Kraftakte. Galeth, so hieß es, hatte einst einen ganzen Tempelstützpfeiler hochgestemmt, und nicht etwa einen der kleinen, sondern einen mächtigen Baumstamm, der hoch über den anderen Pfosten aufragte. Wie seine Gefährten, so trug auch Galeth eine Axt mit einer schweren Bronzeklinge, denn sie hatten soeben Bäume gefällt. «Wer hat dich zu töten versucht?», beharrte er.
«Er!», schrie Saban und zeigte den Hügel hinauf, wo Lengar erschienen war, seinen Langbogen hochgereckt, in den er einen neuen Pfeil eingespannt hatte.
Lengar blieb stehen. Er sagte nichts, blickte nur auf die Gruppe von Männern, die jetzt seinen Halbbruder schützten. Schweigend nahm er den Pfeil von der Sehne.
Galeth starrte seinen älteren Neffen finster an. «Du hast versucht, deinen eigenen Bruder zu töten?»
Heiser lachte Lengar auf. «Ich doch nicht! Es war ein Fremdländischer, nicht ich.» Langsam kam er den Hügel herunter. Sein schwarzes Haar war klatschnass vom Regen und klebte glatt an seinem Kopf, was ihm ein furchteinflößendes Aussehen verlieh.
«Ein Fremdländischer?», fragte Galeth und spuckte schnell auf den Boden, um Unheil abzuwehren. Es gab viele in Ratharryn, die anstelle von Lengar lieber Galeth als nächsten Clanführer hätten; aber die Rivalität zwischen Onkel und Neffe verblasste neben der Gefahr eines Überfalls durch das feindliche Volk. «Da oben auf der Weide sind Fremdländische?», fragte Galeth alarmiert.
«Nur der eine», gab Lengar lässig Auskunft. Er schob den Pfeil des Fremden in seinen Köcher. «Nur der eine», wiederholte er, «und der ist jetzt tot.»
«Dann kann dir jetzt ja nichts mehr geschehen, Junge», sagte Galeth zu Saban. «Du bist jetzt sicher.»
«Er hat versucht, mich zu töten», wiederholte Saban beharrlich, «wegen des Goldes!» Er hielt die kleine Raute als Beweis hoch.
«Gold, wie?», fragte Galeth, als er dem Jungen das winzige Stück aus der Hand nahm. «Ist es das, was du da hast? Gold? Wir sollten es besser deinem Vater bringen.»
Lengar warf Saban einen hasserfüllten Blick zu, aber jetzt war es zu spät. Saban hatte den Schatz gesehen sowie den Mordanschlag überlebt, und deshalb würde ihr Vater von dem Gold erfahren. Grimmig spuckte Lengar auf den Boden, dann machte er kehrt und floh wieder den Hügel hinauf. Er verschwand im Regen, riskierte den Zorn des Sturmgottes, um den Rest des Goldes für sich zu retten.
Das war der Tag des Unwetters, an dem der Fremde Zuflucht in dem Alten Tempel suchte, der Tag, an dem Lengar Saban zu töten versuchte, und der Tag, an dem sich die Welt von Ratharryn grundlegend änderte.
In jener Nacht wütete der Sturmgott auf der Erde. Sintflutartige Regenfälle drückten das Getreide platt und verwandelten die Hügelpfade in reißende Bäche. Sie überfluteten die Marschgebiete nördlich von Ratharryn; der Fluss Mai trat über seine Ufer, schwemmte umgestürzte Bäume aus dem steilen Tal, das sich durch das höhergelegene Gelände wand, bis es die große Schleife erreichte, wo Ratharryn erbaut war. Das Wasser in den Gräben von Ratharryn trat über die Ufer, der Sturm rüttelte an den Reetdächern der Hütten und heulte um die Holzpfeiler der Tempelkreise.
Keiner wusste, wann die ersten Menschen in das Gebiet am Fluss gekommen waren oder wie sie entdeckt hatten, dass Arryn der Gott des Tales war. Dennoch musste sich Arryn diesen Menschen offenbart haben, denn sie benannten ihr neues Zuhause nach ihm und bebauten die Hügel um sein Tal herum mit Tempeln. Es waren schlichte Weihestätten, nichts weiter als Lichtungen im Wald, wo man einen Kreis aus Baumstämmen hatte stehen lassen; und jahrelang – niemand wusste, wie viele Jahre lang – pflegten die Stammesmitglieder den Waldpfaden zu jenen Baumkreisen zu folgen, wo sie die Götter um Schutz anflehten. Im Laufe der Zeit rodete Arryns Volk den größten Teil der Wälder, fällte Eichen und Ulmen, Eschen und Haselnussbäume, baute Roggen oder Weizen auf den kleinen Feldern an. Sie fingen Fische in dem Fluss, der Arryns Gemahlin Mai geweiht war; sie hüteten Rinder auf den Weiden und Schweine in den Waldungen; die jungen Männer des Stammes jagten Wildschweine und Damwild, Auerochsen, Bären und Wölfe in den Urwäldern, die jetzt hinter den Tempeln zurückgedrängt lagen.
Die ersten Tempel zerfielen, neue wurden erbaut, und mit der Zeit wurden auch die neuen wieder alt und morsch; dennoch blieben es weiterhin Ringe aus Baumstämmen, obwohl die äußeren Ringe nun aus glatten, behauenen Holzpfählen bestanden, die innerhalb eines Walles und eines Rundgrabens errichtet wurden, welche einen größeren Kreis um den Ring aus Stämmen bildeten. Immer handelte es sich um Kreise, denn das Leben war ein in sich geschlossener Kreis, und der Himmel war ein Kreis, und der Rand der Welt war ein Kreis, und vor allem die Sonne – auch der Mond wuchs zu einem Kreis an, und das war der Grund, warum die Tempel bei Cathallo und Drewenna, bei Maden und Ratharryn, ja sogar in fast allen über das Land verstreuten Siedlungen kreisförmig angelegt wurden.
Cathallo und Ratharryn galten als die Zwillingsstämme des Herzlandes. Sie waren durch Blutsverwandtschaft miteinander verbunden und so eifersüchtig wie zwei Ehefrauen. Ein Vorteil für den einen Stamm stellte einen Affront für den anderen dar, und in jener Nacht brütete Hengall, Clanführer des Volkes in Ratharryn, über dem Gold der Fremdländischen. Er hatte darauf gewartet, dass Lengar ihm den Schatz bringen würde, und obwohl Lengar tatsächlich mit einem Lederbeutel nach Ratharryn zurückkehrte, betrat er nicht die Hütte seines Vaters. Als Hengall einen Sklaven zu seinem Sohn schickte, mit dem Befehl, ihm unverzüglich die Schätze zu übergeben, hatte Lengar ihm erklärt, dass er zu erschöpft sei, um zu gehorchen. Deshalb fragte Hengall jetzt den Hohepriester des Stammes um Rat.
«Er will dich herausfordern», verkündete Hirac.
«Söhne sollen ihre Väter herausfordern», erwiderte Hengall. Der Clanführer war ein großer, stämmiger Mann mit einem narbenbedeckten Gesicht. Seine Haut war wie die der meisten Leute dunkel vor eingedrungenem Ruß und Schmutz, Schweiß und Rauch. Unter der Schmutzschicht wiesen seine Arme zahllose blaue Male auf, die bezeugten, wie viele Feinde er im Kampf getötet hatte. Sein Name bedeutete schlicht «Der Krieger», obwohl Hengall den Frieden weitaus mehr liebte als Krieg.
Der sehr viel ältere Hirac war mager, sein weißer Bart ziemlich schütter, seine Gelenke schmerzten. Hengall mochte zwar der Anführer des Stammes sein, aber Hirac sprach mit den Göttern, und deshalb hörte jeder auf seinen Rat. «Lengar wird dich bekämpfen», warnte Hirac den Clanführer.
«Das wird er nicht.»
«Er könnte es aber tun, er ist jung und stark», erwiderte Hirac. Der Priester war nackt, seine Haut bedeckte eine getrocknete Schicht aus Kreide und Wasser, in die eine seiner Ehefrauen mit den Fingerspitzen spiralförmige Muster eingezeichnet hatte. Um den Hals trug er eine Lederschnur mit einem aufgefädelten Eichhörnchenschädel, während sich um seine Taille ein Gürtel aus Nussschalen und Bärenzähnen schlang. Sein Haar und der Bart waren dick mit rötlichem Schlamm eingeschmiert, der in der starken Hitze von Hengalls Feuer allmählich trocknete und rissig wurde.
«Und ich bin alt und stark», knurrte Hengall, «wenn er mich bekämpft, werde ich ihn töten.»
«Wenn du ihn tötest», zischte Hirac, «dann wirst du nur noch zwei Söhne haben.»
«Nur noch einen», fauchte Hengall, und er sah den Hohepriester finster an, weil er es gar nicht leiden konnte, daran erinnert zu werden, wie wenig Söhne er gezeugt hatte. Kital, Clanführer des Stammes bei Cathallo, besaß acht Söhne; Ossaya, der der Clanführer von Maden gewesen war, bevor Kital den Ort erobert hatte, hatte sechs gezeugt; und Melak, Clanführer der Leute von Drewenna, sogar elf. Deshalb schämte Hengall sich, dass er nur drei Söhne gezeugt hatte, und als noch größere Schande empfand er die Tatsache, dass einer dieser Söhne ein Krüppel war. Natürlich hatte er auch Töchter gezeugt, und einige von ihnen waren am Leben geblieben, aber Töchter konnte man nicht mit Söhnen vergleichen. Und seinen zweiten Sohn, den verkrüppelten Jungen, den stammelnden Schwachsinnigen namens Camaban, wollte er nicht als sein eigen Fleisch und Blut gelten lassen. Lengar erkannte er an und Saban ebenfalls, aber nicht den mittleren.
«Außerdem wird Lengar mich nicht zum Kampf herausfordern», fuhr Hengall fort. «Das wird er nicht wagen.»
«Er ist kein Feigling», warnte der Priester.
Hengall lächelte. «Nein, das ist er nicht; aber er kämpft nur dann, wenn er weiß, dass er siegt. Das ist der Grund, warum er ein guter Clanführer sein wird, wenn er überlebt.»
Der Priester hockte neben dem Mittelpfosten der Hütte. Zwischen seinen Knien lag ein Haufen dünner Knochen: die Rippen eines Kindes, das im vergangenen Winter gestorben war. Er stocherte mit einem langen, kreidebeschmierten Finger in den Knochen herum und schob sie zu willkürlichen Mustern zusammen, die er mit schiefgeneigtem Kopf betrachtete. «Sannas wird das Gold haben wollen», murmelte er nach einer Weile; dann legte er eine Pause ein, um diese Feststellung wirken zu lassen: Genau wie jeder andere Sterbliche, so hatte auch Hengall einen Heidenrespekt vor der Zauberin von Cathallo; aber er schien den Gedanken mit einem Achselzucken abzutun. «Und Kital hat viele Speerwerfer», fügte Hirac als weitere Warnung hinzu.
Hengall stieß den Priester an und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. «Die Speere lass nur meine Sorge sein, Hirac. Sag mir lieber, was das Gold zu bedeuten hat. Warum ist es hierhergekommen? Wer hat es geschickt? Was soll ich damit machen?»
Der Priester sah sich in der großen Hütte um. Auf einer Seite hing ein Ledervorhang, um die Sklavinnen abzuschirmen, die Hengalls neue Ehefrau bedienten. Hirac wusste, dass bereits ein großer Schatz in der Hütte verborgen war, unter dem Fußboden vergraben oder unter einem Stapel von Fellen versteckt. Hengall hatte schon immer gehortet, niemals verschwendet. «Wenn du das Gold behältst», orakelte Hirac, «dann werden andere es dir wegzunehmen trachten. Dies ist kein gewöhnliches Gold.»
«Wir wissen doch gar nicht, ob es das Gold von Sarmennyn ist», wandte Hengall ein, wenn auch ohne große Überzeugung.
«Doch, das ist es», beharrte Hirac und wies auf die eine kleine Raute, die Saban mitgebracht hatte und die jetzt zwischen ihnen auf dem festgestampften Lehmboden schimmerte. Sarmennyn war ein fremdes Land, viele Meilen weiter westlich, und seit den vergangenen beiden Monaten machten zahlreiche Gerüchte die Runde, dass die Bewohner von Sarmennyn einen großen Schatz verloren hätten. «Saban hat den Schatz gesehen», fuhr Hirac fort, «und es ist das fremdländische Gold, und die Fremdländischen beten Slaol an, obwohl sie ihn anders nennen…» Er hielt inne, während er sich an den Namen zu erinnern versuchte, aber er wollte ihm nicht einfallen. Slaol war der Gott der Sonne, ein mächtiger Gott, der jedoch in Lahanna, der Göttin des Mondes, eine ebenbürtige Rivalin hatte; und die beiden, einstmals Liebende, hatten sich inzwischen entfremdet. Das war die Rivalität, die Ratharryn beherrschte und die jede Entscheidung quälend machte; denn eine Geste an den einen Gott verärgerte den anderen, und Hiracs Aufgabe bestand darin, alle rivalisierenden Götter – nicht nur die Sonne und den Mond, sondern auch den Wind und die Erde, den Fluss und die Bäume, die wilden Tiere und das Gras und das Farnkraut und den Regen, alle die unzähligen Götter und Geister und unsichtbaren Mächte – zufriedenzustellen.
Der Priester hob die kleine goldene Raute vom Boden auf. «Slaol hat uns das Gold geschickt», begann er von neuem, «und Gold ist Slaols Metall – aber die Raute ist Lahannas Symbol.»
Hengall zischte: «Willst du damit sagen, dass das Gold Lahanna gehört?»
Hirac blieb eine ganze Weile stumm. Der Clanführer wartete. Es war die Aufgabe des Hohepriesters, die Bedeutung seltsamer Ereignisse zu ermitteln… obwohl Hengall sein Bestes tun würde, um diese Auslegung zum Vorteil des Stammes zu beeinflussen. «Slaol hätte das Gold in Sarmennyn lassen können», sagte Hirac schließlich. «Aber das hat er nicht getan. Also sind es die Leute dort, die den Verlust erleiden. Dass das Gold hierhergekommen ist, ist kein schlechtes Omen.»
«Gut», grunzte Hengall.
«Andererseits», gab Hirac zu bedenken, «sagt uns die Form des Goldes, dass es einst Lahanna gehört hat, und ich glaube, sie wollte es sich zurückholen. Hat Saban nicht gesagt, der Fremde hätte nach Sannas gefragt?»
«Doch, das hat er.»
«Und Sannas verehrt Lahanna mehr als alle anderen Götter», fasste der Priester zusammen, «also muss Slaol uns das Gold geschickt haben, um zu verhindern, dass es in ihre Hände gelangt. Aber Lahanna wird eifersüchtig sein und von uns eine Gegengabe wollen.»
«Ein Opfer?», fragte Hengall argwöhnisch.
Der Priester nickte, und Hengall zog ein finsteres Gesicht, während er bei sich überschlug, wie viele Rinder der Priester in Lahannas Tempel würde schlachten wollen; aber Hirac schwebte keine solche Plünderung des Stammesvermögens vor. Das Gold war wichtig, sein Auftauchen außergewöhnlich, und der Dank dafür musste entsprechend großzügig ausfallen. «Die Göttin wird eine Seele wünschen», teilte der Hohepriester ihm mit.
Hengalls Miene hellte sich wieder auf, als ihm klar wurde, dass sein Vieh sicher war. «Du kannst ja diesen Trottel Camaban nehmen», bot der Clanführer seinen verstoßenen zweiten Sohn an. «Mach ihn nützlich, schlag ihm den Schädel ein!»
Hirac lehnte sich auf die Fersen zurück, die Augen halb geschlossen. «Er ist von Lahanna gezeichnet», erwiderte er ruhig. Camaban kam mit einem halbmondförmigen Muttermal auf dem Bauch zur Welt, und der Halbmond war, genau wie die Raute, eine dem Mond geweihte Form. «Lahanna könnte zornig werden, wenn wir ihn töten.»
«Vielleicht würde sie sich über seine Gesellschaft freuen?», schlug Hengall listig vor. «Vielleicht ist das der Grund, warum sie ihn gezeichnet hat? Damit er zu ihr geschickt wird?»
«Das könnte durchaus zutreffen», räumte Hirac ein, und der Gedanke ermutigte ihn, eine Entscheidung zu treffen. «Wir werden das Gold behalten», erklärte er, «und Lahanna mit der Seele von Camaban versöhnlich stimmen.»
«Gut», willigte Hengall ein. Er wandte sich zu dem Ledervorhang um und rief einen Namen. Ein Sklavenmädchen kam demütig herbeigeschlichen und trat in den Lichtschein des Feuers. «Wenn ich morgen mit Lengar zu kämpfen habe», sagte der Clanführer zu dem Hohepriester, «dann sollte ich jetzt besser einen weiteren Sohn zeugen.» Er winkte das Mädchen zu dem Stapel von Fellen, der ihm als Lagerstatt diente.
Der Hohepriester sammelte die Kinderknochen wieder ein, dann eilte er durch den ständig zunehmenden Regen, der die Kreide von seiner Haut wusch, zu seiner eigenen Hütte zurück.
Der Sturm tobte weiter. Blitze zuckten auf die Erde herab, machten die Welt kohlrabenschwarz und kreideweiß. Die Götter brüllten vor Zorn, und die Menschen konnten sich nur ducken.
2.KAPITEL
Saban fürchtete sich davor, schlafen zu gehen; nicht deshalb, weil der Sturmgott auf die Erde einhämmerte, sondern weil er dachte, Lengar könnte in der Nacht zu ihm kommen, um Rache zu nehmen. Aber sein älterer Bruder ließ ihn in Ruhe, und im Morgengrauen kroch Saban aus der Hütte seiner Mutter in einen kalten und feuchten Wind hinaus. Die letzten Reste des Sturms wirbelten die frühmorgendlichen Nebelschwaden innerhalb des hohen Erdwalls auf, der die Siedlung umgab, während die Sonne ihr Antlitz hinter Wolken verbarg und nur gelegentlich als matte Scheibe in dem dunstigen Grau zu erkennen war. Ein reetgedecktes Dach, durchtränkt von Regen, war in der Nacht zusammengebrochen, und die Stammesmitglieder wunderten sich darüber, dass die Familie nicht von dem einstürzenden Dach erschlagen worden war. Ein Strom von Frauen und Sklavinnen wanderte über den südlichen Uferdamm, um Wasser aus dem angeschwollenen Fluss zu schöpfen, während Kinder die gefüllten Nachttöpfe zu den Sammelgruben der Lohgerber brachten, die ebenfalls überflutet waren; aber alle kehrten in großer Eile wieder zurück, eifrig darauf bedacht, nicht die Konfrontation zwischen Lengar und seinem Vater zu verpassen. Selbst die Leute, die jenseits des großen Schutzwalls in den Hütten auf dem höhergelegenen Gelände lebten, hatten die Neuigkeit gehört und fanden plötzlich einen Grund, um sich an diesem Morgen nach Ratharryn zu begeben. Lengar hatte das fremdländische Gold gefunden, Hengall wollte es haben, und einer der beiden musste die Oberhand gewinnen.
Hengall erschien als Erster. Er kam aus seiner Hütte, in einen langen Umhang aus Bärenfell gehüllt, und schlenderte machtbewusst durch die Siedlung. Er begrüßte Saban, indem er ihm das Haar verwuschelte, dann sprach er mit den Priestern über das Problem, einen der großen Pfeiler des Tempels von Lahanna zu ersetzen, und danach saß er auf einem Hocker vor seiner Hütte und hörte sich die besorgten Schilderungen der Schäden an, die das nächtliche Unwetter auf den Weizenfeldern angerichtet hatte. «Wir können jederzeit Getreide kaufen», verkündete Hengall mit lauter Stimme, sodass ihn möglichst viele Stammesmitglieder hören konnten. «Es gibt zwar diejenigen, die sagen, dass das Vermögen, das in meiner Hütte versteckt ist, für Waffen ausgegeben werden sollte – aber es würde uns besser dienen, wenn wir Getreide dafür kaufen. Und wir haben Schweine zu essen, Regen tötet auch nicht die Fische im Fluss. Wir werden also nicht verhungern.» Er öffnete seinen Umhang, klatschte sich auf seinen dicken nackten Bauch. «Und ich werde dieses Jahr nicht zusammenschrumpfen.» Die Leute lachten.
Gleich darauf traf Galeth mit einem halben Dutzend Männern ein und hockte sich neben die Hütte seines Bruders. Alle waren mit Speeren bewaffnet, und Hengall erkannte, dass sie gekommen waren, ihn zu unterstützen; aber er erwähnte den bevorstehenden Kampf mit keinem Wort. Stattdessen fragte er Galeth, ob er eine genügend große Eiche gefunden habe, um den vermoderten Pfeiler in Lahannas Tempel zu ersetzen.
«Wir haben eine gefunden», bestätigte Galeth, «aber sie nicht gefällt…»
«Ihr habt sie nicht gefällt?»
«Es war schon spät am Tag, und wir hatten unsere Äxte nicht geschliffen.»
Hengall grinste. «Dennoch ist deine Frau schwanger, wie ich hörte?»
Galeth lächelte schüchtern. Seine erste Ehefrau war vor einem Jahr gestorben und hatte ihn mit einem Sohn zurückgelassen, der ein Jahr jünger als Saban war; gerade hatte er sich eine neue Frau genommen. «Richtig, das ist sie», gestand er.
«Dann ist ja wenigstens eine deiner Klingen scharf», bemerkte Hengall und rief damit noch mehr Gelächter hervor.
Das Gelächter erstarb jedoch abrupt, denn Lengar wählte genau diesen Moment, um aus seiner Hütte zu treten, und in dem grauen, wolkenverhangenen Morgen leuchtete er wie die Sonne selbst. Ralla, seine Mutter und Hengalls älteste Ehefrau, musste die ganze sturmgepeitschte Nacht hindurch aufgeblieben sein, um die kleinen Goldrauten auf Sehnen aufzufädeln, sodass ihr Sohn sie als Halsketten tragen konnte; anschließend hatte sie die vier großen goldenen Rauten auf sein Hirschlederhemd genäht, über dem er den Gürtel des Fremden mit der massiven Goldschnalle trug. Ein Dutzend junger Krieger, allesamt Lengars engste Jagdgefährten, folgte ihm, und hinter dieser mit Speeren bewaffneten Truppe hatte sich eine Gruppe schlammbeschmierter Kinder eingefunden, die aufgeregt mit Stöcken herumfuchtelten, in Nachahmung des Jagdspeeres in Lengars Hand.
Zuerst beachtete Lengar seinen Vater überhaupt nicht. Stattdessen marschierte er hocherhobenen Hauptes zwischen den Hütten vorwärts, an den beiden Tempeln vorbei, die innerhalb des Schutzwalls standen, dann hinauf zu den Hütten der Töpfer und den Gerbergruben im Norden der Einfriedung. Seine Gefolgsleute schlugen klirrend ihre Speere aneinander, und hinter ihm sammelten sich mehr und mehr Menschen, sodass er sein Gefolge erregter Anhänger schließlich auf einem verschlungenen Pfad durch die Siedlung führte, der sich zwischen den regendurchweichten Reetdächern der niedrigen Rundhütten dahinwand. Erst nachdem er zweimal durch die Siedlung gezogen war, kehrte er zu der von seinem Vater bestimmten Stelle zurück.
Hengall erhob sich von seinem Hocker, als sein Sohn näher kam. Er hatte Lengar seinen Triumphzug auskosten lassen; jetzt stand er auf und schüttelte den Bärenfellumhang von den Schultern, warf ihn mit der Fellseite nach unten in den Schlamm zu seinen Füßen. Er wischte sich die Feuchtigkeit des Sprühregens mit den Enden seines langen Bartes aus den Augen, dann wartete er barbrüstig, damit alle Bewohner von Ratharryn sehen konnten, wie dicht sich die blauen Symbole getöteter Feinde auf seiner Haut drängten. Schweigend stand er da, während der Wind sein struppiges schwarzes Haar zauste.
Lengar blieb seinem Vater gegenüber stehen. Er war so groß wie Hengall, aber nicht so stämmig und muskulös. In einem Kampf würde er sich wahrscheinlich als der Schnellere und Behändere erweisen, während Hengall der Stärkere sein könnte; dennoch zeigte Hengall keine Furcht vor dieser Begegnung. Stattdessen gähnte er nur, dann nickte er seinem ältesten Sohn zu. «Du hast das Gold des Fremden gebracht», sagte er. «Das ist gut.» Er wies auf den Umhang aus Bärenfell, der zwischen ihnen auf dem Boden lag. «Leg alles dorthin, Sohn!»
Lengar versteifte sich. Die meisten der anwesenden Stammesmitglieder glaubten, er würde kämpfen, denn seine Augen ließen seine ausgeprägte Vorliebe für Gewalttätigkeit erkennen, die an Wahnsinn grenzte; aber der Blick seines Vaters war ruhig und unverwandt, und Lengar zog es vor zu diskutieren, statt mit seinem Speer zuzustoßen. «Wenn ein Mann ein Geweih in den Wäldern findet», verlangte er zu wissen, «muss er es dann seinem Vater übergeben?» Er sprach laut genug, dass die Menschenmenge ihn hören konnte. Die Leute hatten sich zwischen den nahegelegenen Hütten versammelt und Platz für den Kampf frei gelassen – eine ganze Reihe von ihnen bekundete jetzt Zustimmung für Lengars Vergleich durch laute Rufe. «Oder wenn ich den Honig der wilden Bienen finde», fragte Lengar, ermutigt durch ihre Unterstützung, «muss ich die Stiche ertragen und den Honig dann meinem Vater aushändigen?»
«Ja», erwiderte Hengall, dann gähnte er erneut. «In den Umhang damit, Junge!»
«Ein Krieger kommt in unser Land», rief Lengar, «ein feindlicher Fremdländischer, und er hat Gold bei sich. Ich töte den Fremden und nehme sein Gold. Gehört es dann nicht mir?» Ein paar Leute in der Menge riefen, dass das Gold tatsächlich ihm gehöre; aber es waren nicht mehr ganz so viele wie zuvor. Hengalls große, massige Gestalt und seine Miene von unerschütterlicher Gelassenheit schüchterten sie durchaus ein.
Der Clanführer kramte in einem Beutel, der an seinem Gürtel hing, und zog die kleine goldene Raute hervor, die Saban aus dem Alten Tempel mitgebracht hatte. Er ließ das Stückchen Gold auf den Umhang fallen. «Und jetzt leg den Rest dazu», befahl er.
«Das Gold gehört mir!», widersprach Lengar beharrlich, und diesmal traten nur Ralla, seine Mutter, und Jegar, einer seiner engsten Freunde, für ihn ein. Jegar war ein kleiner, drahtiger Mann, genauso alt wie Lengar, aber schon jetzt einer der größten Krieger des Stammes. Im Kampf tötete er mit einer Inbrunst, die Lengars Lust am Töten in nichts nachstand; auch jetzt brannte er auf einen Kampf, aber keiner von Lengars anderen Jagdgefährten hatte sonderliche Lust, sich mit Hengall anzulegen. Trotzdem verließen sie sich darauf, dass Lengar die Auseinandersetzung gewinnen würde, und es schien, als wollte er das mit Gewalt erreichen, denn plötzlich hob er seinen Speer; doch statt mit der Klinge zuzustoßen, hielt er ihn hoch über seinem Kopf, um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen. «Ich habe das Gold gefunden! Ich habe für das Gold getötet! Das Gold ist zu mir gekommen! Und soll es jetzt etwa in der Hütte meines Vaters versteckt werden? Soll es dort Staub ansammeln?» Diese kleine Rede rief verständnisvolles Gemurmel hervor, denn viele in Ratharryn ärgerten sich über die Art, wie Hengall Schätze hortete. In Drewenna oder Cathallo belohnte der Clanführer seine Krieger mit Bronze, er schmückte seine Frauen mit glänzendem Metall, und er baute große Tempel – aber Hengall lagerte die Reichtümer von Ratharryn in seiner Hütte.
«Was würdest du denn mit dem Gold anfangen?», warf Galeth ein. Er stand jetzt aufrecht da und hatte seinen langen Zopf gelöst; sein Haar hing wie eine schwarze, zottelige Mähne um sein Gesicht, was ihm das Aussehen eines Kriegers verlieh, der im Begriff war, sich in die Schlacht zu stürzen. Seine Speerklinge war auf Lengar gerichtet. «Sag uns, Neffe», fragte er mit weithin schallender Stimme, «was wirst du mit dem Gold tun?»
Jegar hob seinen Speer, um Galeths Herausforderung zu begegnen, aber Lengar drückte die Speerspitze seines Freundes auf den Boden. «Mit diesem Gold hier», rief er und klopfte auf die goldenen Rauten auf seiner Brust, «sollten wir Krieger und Speerkämpfer und Bogenschützen anheuern, um Cathallo ein für alle Mal ein Ende zu bereiten!» Jetzt erhoben sich die Stimmen, die ihn schon zuvor unterstützt hatten, erneut beipflichtend, denn es gab viele in Ratharryn, die Cathallos wachsende Macht fürchteten. Erst im vergangenen Sommer hatten die Krieger von Cathallo die Siedlung Maden erobert, die zwischen Ratharryn und Cathallo lag; nun verging kaum eine Woche, ohne dass Cathallos Krieger auch in Hengalls Gebiet einfielen und das Land nach Rindern oder Schweinen abkämmten; viele im Stamm nahmen es Hengall übel, dass er anscheinend nichts plante, um den räuberischen Überfällen einen Riegel vorzuschieben.
«Es gab einmal eine Zeit, als Cathallo uns Tribut zollte!», schrie Lengar jetzt, ermutigt durch die Unterstützung der Menge. «Als ihre Frauen kamen, um vor unseren Tempeln zu tanzen! Jetzt ducken wir uns ängstlich, wann immer sich ein Krieger von Cathallo blicken lässt! Wir kriechen vor diesem widerlichen Miststück Sannas! Und das Gold und die Bronze und der Bernstein, die uns befreien könnten, wo sind die? Und wo wird dieses Gold hier verschwinden, wenn ich es hergebe? Dort!» Mit diesem letzten Wort wandte er sich um und zeigte mit seinem Speer anklagend auf seinen Vater. «Und was wird Hengall mit dem Gold tun?», fragte Lengar. «Er wird es in der Erde vergraben! Gold für die Maulwürfe! Kostbares Metall für die Würmer! Schätze für die Engerlinge! Wir scharren im Boden nach Feuerstein, und dabei haben wir die ganze Zeit über Gold!»
Traurig schüttelte Hengall den Kopf. Die Menge, die Lengars letzte Worte mit lautem Beifall quittiert hatte, verstummte und wartete auf den Kampfbeginn. Lengars Männer mussten geglaubt haben, dass der Augenblick nahe war, denn sie nahmen all ihren Mut zusammen und schlossen mit erhobenen Waffen hinter ihrem Anführer auf. Jegar tanzte erregt hin und her, die Zähne gefletscht, seine Speerspitze auf Hengalls Bauch gerichtet. Galeth trat näher an Hengall heran, bereit, seinen Bruder zu verteidigen, aber Hengall winkte ihn fort; dann wandte er sich um, beugte sich vor und zog seinen Streitkolben aus seinem Versteck unter dem tief herabgezogenen Reetdach seiner Hütte. Der Streitkolben war eine Keule aus Eiche, so dick wie der Unterarm eines Kriegers, und endete in einem unförmigen Klumpen aus grauem Stein, der einem erwachsenen Mann so mühelos den Schädel zertrümmern konnte, als wäre er ein Zaunkönigei. Hengall wog die schwere Keule in der Hand, dann wies er mit einer Kopfbewegung auf den Umhang aus Bärenfell. «Den ganzen Schatz, Junge», wiederholte er, wobei er seinen Sohn absichtlich beleidigte, «sämtliches Gold auf den Umhang!»
Lengar starrte ihn an. Der Speer hatte eine größere Reichweite als die Keule; aber wenn er mit seinem ersten Stoß sein Ziel verfehlte, dann würde ihn die Keule des Vaters vernichten. Deshalb zögerte Lengar, aber Jegar drängte an ihm vorbei, bereit, den Clanführer anzugreifen. Hengall zeigte mit seinem Streitkolben auf Jegar. «Ich habe deinen Vater getötet, Junge», schnauzte er, «als er mich zum Kampf um die Clanführerswürde herausforderte – ich habe ihm die Knochen zerschmettert und sein Fleisch an die Schweine verfüttert. Aber ich habe seinen Kieferknochen aufbewahrt. Hirac!»
Der Hohepriester, dessen Haut von Schmutz und Kreide gesprenkelt war, tauchte am Rand der Menge auf.
«Du weißt, wo der Kieferknochen versteckt ist?», verlangte Hengall zu wissen.
«Ja», erwiderte Hirac.
«Dann beleg sein Blut mit einem Fluch», ordnete Hengall an, während er Jegar finster anstarrte, «wenn dieser Wurm hier nicht zurückweicht. Lass seine Lenden zu Stein erstarren. Füll seinen Bauch mit schwarzen Würmern!»
Den Bruchteil einer Sekunde zögerte Jegar. Er fürchtete zwar nicht Hengalls Streitkolben, aber er fürchtete sich vor Hiracs Fluch, deshalb wich er jetzt einen Schritt zurück. Hengall fixierte erneut seinen Sohn. «In den Umhang damit, Sohn», wiederholte er energisch, «und beeil dich gefälligst! Ich will endlich mein Frühstück haben!»
Lengars Widerstand brach in sich zusammen. Einen Moment lang schien es so, als wollte er sich mit einem Satz auf seinen Vater stürzen, als zöge er den Tod der Schande vor; doch dann sanken seine Schultern mutlos herab, und er ließ mit einer verzweifelten Geste den Speer fallen, löste die goldenen Ketten um seinen Hals und schnitt die Fäden durch, die die großen Goldrauten an seinem Hemd festhielten. Er legte sämtliche Schätze auf den Umhang aus Bärenfell, dann hakte er den Gürtel mit der massiven Goldschnalle auf und warf ihn von sich. «Ich habe das Gold gefunden», protestierte er lahm, als er fertig war.
«Du und Saban habt es gefunden», erklärte Hengall, «aber ihr habt es in dem Alten Tempel gefunden, nicht in den Wäldern, und das bedeutet, dass die Götter das Gold uns allen gesandt haben! Und warum?» Der Clanführer erhob die Stimme, sodass sämtliche Anwesenden ihn hören konnten. «Die Götter haben ihre Absicht nicht enthüllt… deshalb müssen wir warten, um die Antwort zu erfahren. Aber es ist Slaols Gold, und er hat es uns gesandt, wofür er einen Grund gehabt haben muss.»
Er hob den Bärenfellumhang mit der Fußspitze an und schleifte ihn mitsamt Inhalt zum Eingang seiner Hütte, wo prompt zwei Frauenhände herauslangten, um den glitzernden Haufen ins Innere der Hütte zu befördern. Durch die Menge ging ein gedämpftes Murren, denn sie wussten, dass es lange Zeit dauern würde, bis sie dieses Gold jemals wieder sehen würden. Hengall ignorierte die Proteste. «Es gibt hier einige», rief er, «die verlangen, dass ich unsere Krieger in eine Schlacht gegen die Leute von Cathallo führe, und es gibt Leute in Cathallo, die wollen, dass ihre jungen Männer uns angreifen! Dennoch wollen nicht alle Bewohner von Cathallo einen Krieg mit uns. Sie wissen, dass viele ihrer Söhne dabei umkommen würden und dass sie, selbst wenn sie den Krieg gewännen, durch den Kampf geschwächt würden. Genau deshalb wird es keinen Krieg geben», schloss er abrupt. Das war eine erstaunlich lange Rede für Hengall gewesen, und eine seltene außerdem, denn er hatte seine Gedankengänge enthüllt. Verrate jemandem, was du denkst, hatte er einmal gesagt, und du gibst deine Seele preis; aber er verriet wohl kaum ein Geheimnis, wenn er seinen Abscheu vor Krieg kundtat. Hengall, der Krieger, hasste Krieg. Der Sinn des Lebens, pflegte er gerne zu sagen, besteht darin, Samenkörner zu pflanzen, nicht Speerspitzen. Es machte ihm nichts aus, Kriegerverbände gegen die Fremdländischen anzuführen, denn sie waren Fremde und Diebe; aber er verabscheute es, gegen benachbarte Stämme zu kämpfen, weil sie Verwandte waren und weil sie die Sprache von Ratharryn sprachen und die Götter von Ratharryn anbeteten. Er blickte Lengar an. «Wo ist der tote Fremdländische?», fragte er.
«Im Alten Tempel», murmelte Lengar widerstrebend.
«Nimm einen Priester mit», wies Hengall Galeth an, «und seht zu, dass ihr die Leiche loswerdet.» Damit verschwand er in seiner Hütte und ließ Lengar besiegt und gedemütigt stehen.
Die letzten Nebelschwaden lösten sich auf, als die Sonne durch die dünne Wolkenschicht brach. Die moosüberwachsenen Reetdächer dampften leicht. Fürs Erste hatte sich die Aufregung in Ratharryn gelegt, obwohl es noch immer die Folgen des Unwetters gab, die den Leuten zu schaffen machten. Der Fluss strömte oberhalb seiner Ufer dahin, der große Graben, der innerhalb des kreisförmigen Schutzwalls lag, war überflutet, und die Weizen- und Roggenfelder hatte der Schlamm zugedeckt. Aber Hengall war immer noch der Clanführer.
Der gewaltige Erdwall galt als das besondere Kennzeichen von Ratharryn. Die Leute staunten noch immer darüber, dass ihre Vorfahren einen solchen Schutzwall errichtet hatten; denn er war fünfmal so hoch wie ein Mann und bildete einen Ring um die Hütten, in denen annähernd hundert Familien lebten. Den Wall hatten sie mit Hilfe von Geweihsprossen und Knochenschaufeln aus Erdreich und Kreide aufgehäuft; der obere Rand war mit den Schädeln von Ochsen, Wölfen und feindlichen Speerkämpfern besetzt, um die bösen Geister des dunklen Waldes fernzuhalten. Jede Siedlung, selbst die schäbigen Hütten auf dem höhergelegenen Land, umgab sich mit Schädeln, um die Geister abzuwehren; aber Ratharryn pflanzte seine Schädel auf den großen Erdwall, der auch dazu diente, die Feinde des Stammes abzuhalten und ihnen Furcht einzuflößen.
Die Familien lebten alle im südlichen Bereich der Einfriedung, während sich im Norden die Hütten der Töpfer und Zimmerleute befanden, die Werkstatt des einzigen Schmieds des Stammes und die Gruben der Lohgerber. Im Inneren des Schutzwalls war noch genügend Platz, um die Viehherden und Schweine unterzubringen, falls ein feindlicher Angriff drohte. Zu diesen Zeiten pflegten die Stammesmitglieder zu den beiden Tempeln zu strömen, die im Inneren des Erdwalls aufragten. Beide Heiligtümer bestanden aus ringförmig angeordneten Holzpfählen. Der größere Tempel hatte fünf Ringe und war Lahanna geweiht, der Göttin des Mondes, während in dem kleineren mit nur drei Ringen Arryn, der Gott des Tals, angebetet wurde und Mai, seine Ehefrau, die Göttin des Flusses. Die höchsten Pfähle jener Tempel waren dreimal so hoch wie Galeth, der größte Mann des Stammes; aber sie wirkten unscheinbar im Vergleich zu dem dritten Tempel, der südlich des kreisförmigen Schutzwalls lag. Dieser dritte Tempel hatte sechs Ringe aus Holzpfählen, und bei zweien der Ringe überspannten die Pfeiler hölzerne Oberschwellen – dieser Tempel war Slaol, dem Sonnengott, geweiht. Der Sonnentempel befand sich außerhalb der Siedlung; denn Slaol und Lahanna waren Rivalen, und ihre Tempel mussten ein Stück voneinander entfernt stehen, damit der eine Gott nicht sehen konnte, wenn dem anderen ein Opfer dargebracht wurde.
Slaol, Lahanna, Arryn und Mai stellten die Hauptgötter von Ratharryn dar; aber die Leute wussten, dass es noch tausend andere Götter im Tal gab und ebenso viele in den Hügeln und noch zahllose weitere jenseits der Hügel und Myriaden von Göttern in den Winden. Kein Stamm konnte für jeden dieser Götter einen Tempel erbauen oder auch nur wissen, wer sie alle waren; und neben dieser Vielzahl von Göttern trieben außerdem noch die Geister der Toten ihr Wesen, die Geister von Tieren und Bächen und Bäumen, Geister des Feuers, Geister der Luft und die Geister von allem, was da kreuchte und fleuchte, atmete und tötete oder wuchs. Wenn man in der Abendstille auf einem Hügel stand und aufmerksam horchte, konnte man manchmal das Gemurmel der Geister hören; das vermochte einen in den Wahnsinn zu treiben, wenn man nicht ständig in den Tempeln betete.
Dann gab es noch ein viertes Heiligtum, den Alten Tempel, der auf dem südlichen Hügel stand und dessen Überreste jetzt mit Haselnusssträuchern überwachsen und fast unter Unkraut erstickt waren. Dieser Tempel gehörte Slaol; aber vor vielen Jahren – niemand konnte sich mehr daran erinnern, wann – hatte der Stamm für Slaol den neuen Tempel in unmittelbarer Nähe der Siedlung gebaut, und das alte Heiligtum lag verlassen da. Es war im Laufe der Zeit einfach vermodert; dennoch mussten dort noch immer göttliche Kräfte am Werk sein, weil es dieser Ort war, wo das Gold der Fremdländischen auftauchte. Jetzt, an dem Morgen nach dem heftigen Unwetter, nahm Galeth drei Männer zu dem Alten Tempel mit, um den Leichnam des Fremden zu suchen und zu begraben. Die vier Männer wurden von Neel begleitet, dem jüngsten Priester von Ratharryn, der dabei war, um sie vor dem Geist des toten Fremden zu beschützen.
Die Gruppe hielt auf der Kuppe des Hügels an und schlug dann einen Bogen zu den Grabhügeln, die zwischen dem Alten Tempel und der Siedlung lagen. Neel heulte wie ein Hund, um die Geister der Ahnen auf sich aufmerksam zu machen; dann erklärte er diesen Geistern, welcher Auftrag die Männer auf das höhergelegene Gelände führte. Während Neel den Toten in monotonem Sprechgesang seine Botschaft mitteilte, starrte Galeth auf den geheiligten Pfad, der so schnurgerade wie die Flugbahn eines Pfeils nach Westen verlief. Die Vorfahren hatten diesen Fußweg erhöht angelegt; aber genau wie der Alte Tempel war auch dieser Pfad jetzt mit Unkraut überwuchert. Nicht einmal die Priester konnten sagen, warum die langen, geraden Gräben und Wälle zu beiden Seiten des Weges aus dem Erdreich aufgeschüttet worden waren. Hirac nahm an, die Anlage sollte einst Rannos, den Gott des Donners, besänftigen; aber er wusste es nicht wirklich, und es kümmerte ihn auch nicht. Als Galeth sich jetzt auf seinen Speer stützte und darauf wartete, dass Neel ein Omen entdeckte, wollte ihm seine Welt auf einmal unsicher erscheinen. Sie war im Zerfall begriffen, genauso wie der uralte geheiligte Pfad und der Alte Tempel zerfielen. So wie auch Ratharryn unter dem zersetzenden Einfluss von schlechten Ernten und hartnäckigen Krankheiten dahinsiechte. Die Luft war von einem Überdruss erfüllt, als ob die Götter es leid geworden wären, endlos um die grüne Welt zu kreisen; und dieser spürbare Überdruss ängstigte Galeth zutiefst.





























