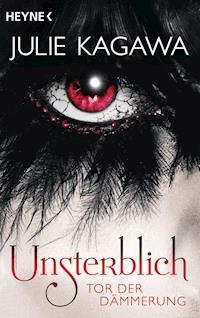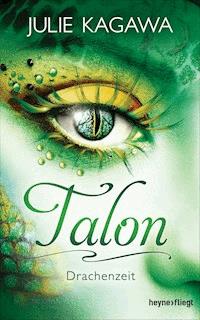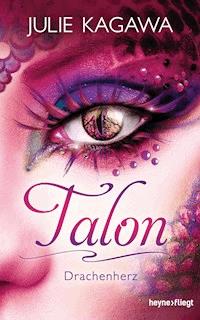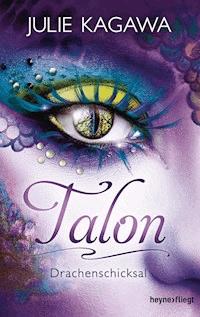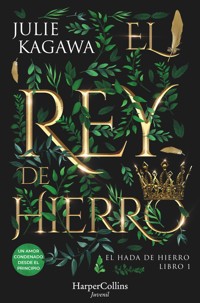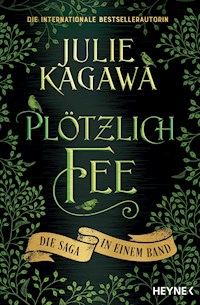11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Storm-Dragons-Reihe
- Sprache: Deutsch
Magisch. Episch. Drachenstark.
Einst beherrschten sagenumwobene Drachen die Magie, nach der auch die Menschen von Galecia strebten. Als das Königreich ins Wanken gerät, beginnt die Suche nach den fantastischen Wesen. Doch die gefährliche Reise bringt Düsteres ans Licht.
Als Remy ein Drachenbaby zufliegt, verändert sich sein Leben von Grund auf. Er spürt eine besondere Verbindung zu dem Tier und schwört, es zu beschützen.
Währenddessen erfährt Prinzessin Gem, dass ihr schwebendes Reich dem Untergang geweiht ist. Sie bricht auf, um die Wahren Drachen zu finden. Nur sie können ihre Heimat noch retten.
Als Remy und Gem am Ende der Welt aufeinandertreffen, müssen sie sich verbünden. Denn ein Magier am Ende der Welt droht, alles zu zerstören, was ihnen wichtig ist ...
Der erste Band des epischen Drachenabenteuers für alle Fantasyfans ab 10 Jahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Julie Kagawa
Storm Dragons
Gewitter am Ende der Welt
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Koob-Pawis
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 der deutschsprachigen Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Storm Dragons – Lightningborn« bei Disney Hyperion, einem Imprint von Buena Vista Books, Inc.
published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Text: Copyright © 2024 by Julie Kagawa
Übersetzung: Petra Koob-Pawis
Redaktion: Silvia Schröer
Umschlagillustration und -gestaltung: Melanie Korte
Innenillustrationen: YaiPa TaKlong, jan stopka, studio uguisu / stock.adobe.com
ah · Herstellung: AJ
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31615-0V002
www.cbj-verlag.de
Für Kieran, Nick und alle Drachenfreunde
Teil I
Kapitel 1
Es war ein riskanter Sprung.
Keiner, bei dem du dir das Knie aufschürfst oder einen Zahn ausschlägst, wenn du dich verschätzt. Keiner, der mit gebrochenen Knochen, einer blutigen Nase oder sogar einer leichten Gehirnerschütterung endet, weil du – wie blöd kann man eigentlich sein? – kopfüber eine Bruchlandung hinlegst. Nein, dies war ein Sprung der Kategorie »Endloser-Sturz-ins-Leere-mitten-durch-ein-Blitzgewitter-hindurch-in-dem-du-wie-ein-Hähnchen-gegrillt-wirst«. Ein Sturz direkt in den Mahlstrom. Kein Boden, der deinen Fall, deinen Stolz oder deine Knochen abbremst, wenn du die Landung nicht schaffst. Da unten gibt es nichts, was dich retten könnte. Wenn du von der Inselkante abrutschst, wirst du für alle Zeiten in einem zornig tosenden Sturm gefangen sein. Oder zumindest so lange, bis dich einer der violetten Blitze zerfetzt. Natürlich halten sich die meisten vernünftigen Menschen so weit wie möglich von der Kante fern.
Aber die meisten vernünftigen Menschen kommen auch nicht auf die Idee, Himmelspiraten zu bestehlen.
»Da ist er!«
Remy warf erschrocken einen Blick über die Schulter. Drei Piraten staksten den schlammigen, mit Planken ausgelegten Weg zwischen den Hütten entlang, ihre gezückten Schwerter blitzten im matten Licht. Einer von ihnen entdeckte Remy und deutete mit seiner krummen, rostigen Klinge auf ihn.
»Du kleine diebische Ratte!«, brüllte er. »Du denkst wohl, du kannst mich einfach beklauen? Ich hänge dich an den Zehen auf und lasse dich als Futter für die Sturmmöwen von der Kante baumeln!«
»Äh, nein danke, das klingt ziemlich ungemütlich!« Verzweifelt sah Remy sich nach einem Fluchtweg um. Auf beiden Seiten der schlammigen Straße standen wackelige Häuser aus Holz und rostigem Blech dicht an dicht. Die windschiefen Gebäude stützten sich gegenseitig, damit sie nicht umfielen, und manche waren sogar übereinandergebaut worden. Direkt hinter Remy hörte der Pfad abrupt auf. Früher, noch vor Remys Geburt, hatte es am Ende des Wegs einen Zaun gegeben, der die Übermütigen, Betrunkenen oder einfach nur Dummen davon abhalten sollte, über die Kante ins Leere zu stolpern. Aber mit der Zeit und weil niemand sich darum gekümmert hatte, waren von dem einstigen Schutzzaun nur noch ein paar verrottende Pfosten im Gestrüpp übriggeblieben. Es gab also keine Barriere zwischen Remy, dem weiten Himmel und dem Mahlstrom unter ihm.
Wie um Remy zu verspotten, driftete ausgerechnet in diesem Moment ein Felsbrocken vorbei. Es war einer von vielen tausend kleinen Abbruchstücken, die die Insel umkreisten wie Planeten die Sonne. Einst feste Bestandteile der Insel, hatten sie sich im Laufe der Zeit und durch den Einfluss der Naturgewalten von ihr gelöst. Ihre Magie hatten sie jedoch nicht verloren, weshalb sie auch weiterhin frei in der Luft schwebten und nicht in den Mahlstrom hinabstürzten. Die meisten von ihnen waren winzig, etwa so groß wie ein Kopf oder sogar noch kleiner. Ein paar waren allerdings so groß, dass man sie mit schweren Ketten an der Insel verankert und sogar Häuser oder Geschäfte darauf errichtet hatte, damit jede verfügbare Fläche genutzt werden konnte. Und dann gab es noch Gesteinsbrocken wie den, der gerade an Remy vorbeiglitt und auf dem sich nichts weiter als ein absterbender Baum befand. Ein Inselbruchstück, gerade groß genug, dass eine einzelne Person darauf Platz hatte. Zumal wenn es sich dabei um einen mageren, zerzausten Straßenjungen handelte.
Und vorausgesetzt, dieser Junge schaffte den Sprung.
»Jetzt sitzt du in der Falle, kleine Ratte!« Die Piraten stapften durch den Schlamm auf ihn zu und ihre gezückten Klingen blitzten im Licht der Laternen und Fackeln. Der Pirat, der zuerst gesprochen hatte, ein schlaksiger Mann mit strähnigen strohgelben Haaren und drei funkelnden Goldzähnen, grinste Remy höhnisch an. »Hör zu, ich mache es dir leicht. Wirf mir den Beutel rüber, dann werde ich dich nur erstechen! Es wird schnell vorbei sein. Ich kann dich natürlich auch an den Füßen über dem Mahlstrom baumeln lassen, damit dir die Sturmmöwen die Augen auspicken!«
»Meinst du etwa den hier?« Remy hielt einen kleinen Lederbeutel hoch. In das Leder war mit Tinte ein kleines Kaninchen tätowiert – viel zu niedlich für einen ruppigen Piraten. »Der gehört dir?«
Die Augen des Piraten wurden groß und seine Miene verfinsterte sich. »Ja, er gehört mir! Gib ihn her, dann bin ich gnädig und schlitze dich mit einem einzigen Hieb auf!« Er hob sein Entermesser und lächelte boshaft. »Es wird ganz schnell gehen, Ehrenwort.«
Remy warf den Beutel in die Luft, fing ihn wieder auf und grinste den Piraten frech an.
»Danke, aber ich entscheide mich für Möglichkeit Nummer drei. Du willst den hier haben?« Er hob die Hand und ließ den Beutel hin und her baumeln, wie um den Piraten anzustacheln. »Dann komm und hol ihn dir!«
Nach diesen Worten drehte er sich blitzschnell um, sprang durch das Gestrüpp und rannte auf den Abgrund zu.
Die Inselkante war direkt vor ihm, und dahinter, verlockend nah, schwebte träge der Felsbrocken. Von unten kam eine Windböe gebraust, zerzauste seine Haare und zerrte an seiner Kleidung. Remy erreichte die Abbruchkante genau in dem Moment, als der Felsbrocken an ihm vorbeitrieb. Ohne zu zögern, sprang er ins Leere.
Nicht nach unten schauen, nicht nach unten schauen, nicht nach unten schauen.
Er hörte ein ohrenbetäubendes Krachen, lauter als jeder Donner, und plötzlich brach ein violetter Blitz durch die Wolken hindurch. Remy hatte das Gefühl, als wollte er nach ihm greifen und ihn in die Tiefe zerren. Er spürte, wie die Härchen auf seiner Haut sich aufstellten. Einen Moment lang schwebte er schwerelos im freien Himmel.
Dann schlug er auf dem Felsbrocken auf und warf sich instinktiv nach vorn, um sich am Baumstamm festzuklammern. Seine Arme schlossen sich wie von selbst um die raue Rinde. Ihm blieb fast die Luft weg, als er gegen den Stamm prallte und sich dabei Wange und Arme aufschürfte. Der Boden unter ihm schwankte, und die kleine Insel drehte sich um sich selbst, versank jedoch trotz des zusätzlichen Gewichts nicht im Mahlstrom, sondern schwebte weiter träge in der Luft.
Nach Atem ringend, hob Remy den Kopf und sah das Piratentrio an der Felskante stehen, von der er abgesprungen war. Keiner von ihnen wagte es, seinen waghalsigen Sprung nachzumachen. Einer war sogar in ziemlicher Entfernung vom Abgrund stehen geblieben und weigerte sich, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Der Pirat mit den Goldzähnen sah Remy zornig an und schüttelte in hilfloser Wut sein Entermesser.
»Das werde ich mir merken, du Ratte! Wart’s nur ab! Wenn ich dich erwische, wirst du dir wünschen, ich hätte dich kurz und schmerzlos erstochen!«
Seine Stimme wurde immer leiser und seine Drohungen und Flüche verklangen in der Ferne. Remy winkte den Piraten ein letztes Mal zu, während er davonschwebte. Die drei Männer wurden immer kleiner, bis sie schließlich gar nicht mehr zu sehen waren.
Glaubte man Brummbart – dem weißhaarigen, runzligen alten Mann, der Stammgast im Salzfass war, einer berüchtigten Piratenspelunke –, dann war die Welt vor zweitausend Jahren noch ganz gewesen. Es hatte weder schwebende Inseln gegeben noch Himmelsschiffe, die durch die Wolken segelten, und erst recht keinen Mahlstrom, der in der Tiefe brodelte. Stattdessen hatte es Dörfer und Städte, große Ortschaften und kleine Siedlungen gegeben, und die Menschen waren auf befestigten Straßen durchs Land gereist, von einem Königreich zum nächsten.
Dann kam das Große Beben und die Welt fiel auseinander. Niemand wusste, wie oder warum es geschehen war; manche sagten, es sei ein Naturereignis gewesen, andere vermuteten, dass allzu ehrgeizige Magier tief unter der Erde etwas entdeckt hatten, von dem sie besser die Finger gelassen hätten. Was auch immer der Grund gewesen war, die Folgen waren verheerend. Die ganze Welt war explodiert, in Stücke gerissen von einer Sturmflut magischer Energie. Königreiche waren zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ganze Städte waren innerhalb von Sekunden eingestürzt. Alle hatten gedacht, das Ende der Welt sei gekommen.
»Aber wie ihr alle seht, die Welt ist noch da«, beendete Brummbart seine Geschichte stets mit einem verschmitzten Zwinkern. »Sie hat überlebt, weil wir Menschen zu dickköpfig sind, um einfach so zu sterben, selbst wenn alles um uns herum in die Luft fliegt. Wir haben Wege gefunden, zu überleben. Wir haben neue Städte auf den Überresten der alten Welt gebaut, auf den Inseln, die jetzt über dem Mahlstrom schweben. Die großen Sturmkristalle im Kern jeder Insel halten uns in der Luft. Aber fragt mich nicht, wie sie dorthin gekommen sind, denn dieses Geheimnis ist nach dem Großen Beben in Vergessenheit geraten. Seit dem Bau der Himmelsschiffe können wir von Insel zu Insel reisen und leben nicht mehr so abgeschieden. Und natürlich …« An dieser Stelle senkte Bart immer seine Stimme, sodass man sich zu ihm beugen musste, um die nachfolgenden Worte zu verstehen. »Und natürlich gibt es da noch … die Drachen. Die mächtigen geflügelten Echsen, die durch die Lüfte segeln und Feuer spucken. Feuer, so heiß, dass die Flammen sogar Stahl zum Schmelzen bringen. Wenn ihr mehr über diese Kreaturen hören wollt – nun ja, dann weise ich euch auf meinen leeren Becher hin, der darauf wartet, mit ein paar Kupfermünzen gefüllt zu werden.«
Drachen. Remy verdrehte die Augen. Er lehnte an dem Baum und betrachtete den Abendhimmel durch die dürren, knorrigen Äste. Weit über ihm ließen die letzten Sonnenstrahlen die Segel eines Himmelsschiffs aufleuchten, das sich immer weiter von der Halsabschneider-Insel entfernte, jenem schwebenden Stück Land, das er sein Zuhause nannte. Alle wollten etwas über Drachen hören. Remy hatte in seinem Leben schon viele Himmelsschiffe gesehen, aber noch nie einen Drachen. Und doch zweifelte er nicht daran, dass es sie gab. Die Himmelsritter der königlichen Leibgarde ritten auf mächtigen Drachen. Und manchmal lauschte er den Geschichten, die man sich in den Tavernen erzählte, von kühnen Luftmatrosen, die auf ihren Reisen durch das Königreich auf Drachen gestoßen waren.
Aber hier im Randbezirk, jenem Ring von Inseln, der am weitesten von der Hauptstadt entfernt war, gab es keine Drachen. Und auch keine Möglichkeit, jemals einen zu Gesicht zu bekommen. Drachen waren selten und extrem teuer; nur die reichsten und wichtigsten Leute des Königreichs konnten sich einen leisten. Wenn man dem alten Bart eine Runde spendierte, erzählte er wundersame Geschichten von wilden Drachen aus der Zeit vor dem Großen Beben. Heutzutage erhielt jeder Drache gleich nach dem Schlüpfen eine ganz spezielle magische Tätowierung. Sie gab Auskunft über den Besitzer, die Blutlinie und das Datum des Schlüpfens, sodass kein Drache verloren gehen konnte.
Remy betrachtete einen Moment lang den Beutel, bevor er die Kordel aufzog und hineinsah. Darin befanden sich eine Handvoll Kupfermünzen und sogar ein paar glänzende Silberstücke. Der Anblick entlockte Remy nur ein trauriges Lächeln. Er könnte tausend solcher Beutel stehlen, sogar eine Million, und hätte immer noch nicht genug beisammen, um einen Drachen zu kaufen. Und selbst wenn er genug Geld auftreiben könnte, wurden Drachen nur an die reichsten und angesehensten Leute verkauft. Leute, die in der Nähe der Hauptstadt lebten und Ställe besaßen, größer als das ganze Viertel, in dem er wohnte. Eine arme Straßenratte mit matschbraunen Haaren, matschbraunen Augen und ohne Zukunft konnte nicht einmal davon träumen, jemals einen Drachen zu Gesicht zu bekommen.
Der schwebende Felsbrocken trieb wieder näher an die Inselkante heran und Remy sprang mit einem großen Satz zurück auf festen Boden. Sicherheitshalber machte er ein paar große Schritte von der Klippe weg, um genügend Abstand zwischen sich und den Mahlstrom zu bringen. Dann atmete er tief durch und sah sich um. Die karge und schlammbedeckte Halsabschneider-Insel war nicht besonders groß. Eigentlich war das Stück Land nur eine Ansammlung von Hütten, die man eher als Himmelsdorf denn als Himmelsstadt bezeichnen konnte. Nicht wie die Hauptstadt, wo man von manchen Stellen aus die Inselkante angeblich nicht einmal sehen konnte. Hier auf der Halsabschneider-Insel gab es eine einzige Anhöhe, an der die Luftschiffe andockten und auf der sich die Taverne, die Lagerhäuser, die Spielhölle und all die anderen Orte befanden, die jenes Publikum anzogen, das der Insel ihren Namen gegeben hatte. Ansonsten gab es nur Stelzenhäuser und dicht aneinandergebaute Hütten, manchmal drei oder vier Stockwerke hoch, sodass ein Labyrinth aus engen Gassen, schmalen Durchgängen, mit Planken ausgelegten Pfaden und klapprigen Brücken entstanden war. Die perfekte Umgebung für eine Schlammratte wie ihn.
Remy wiegte die Börse in seinen Händen und spürte durch das Leder hindurch das Gewicht der Münzen. Eigentlich war es gar nicht so viel Geld, aber für jemanden mit leeren Hosentaschen, der praktisch nichts besaß, war es ein Vermögen. Einen Moment lang stand er da und kämpfte mit sich, bevor er die Schultern sinken ließ und einen Stoßseufzer ausstieß.
Dann steckte er den Beutel in seine Tasche und machte sich auf den Weg durch das Straßenlabyrinth.
Das Salzfass, ein zwielichtiges Wirtshaus, befand sich auf einem großen, weit in den Himmel hinausragenden Felsvorsprung, der von allen nur Nase genannt wurde. Außer den Lagerhäusern, in denen so manche verbotene Ware aufbewahrt wurde, befand sich kein anderes Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Docks. Daher war das Wirtshaus auch das Erste, was die Himmelsmatrosen sahen, wenn sie ihre Luftschiffe verließen. Kein Wunder, dass die Taverne eine beliebte Anlaufstelle war, ein Zufluchtsort für Schmuggler, Glücksritter, Luftpiraten und alle anderen, die das Gesetz mieden.
»Was suchst du hier, Schlammratte?«, fragte Ferus schlechtgelaunt, als Remy durch die windschiefe Tür schlüpfte und sich in der heruntergekommenen Spelunke umsah. Der Wirt war ein dünner, zappeliger kleiner Mann mit fettigen schwarzen Haaren und dunklen, wachsamen Augen. Er mochte Remy nicht, weil der Junge kein Geld hatte, um etwas bei ihm zu bestellen. Außerdem verschwanden zurückgelassene Dinge oder Essensreste manchmal wie durch Zauberhand, wenn er da war. Ferus war es eigentlich egal, ob Remy seine Gäste bestahl, aber er konnte es nicht leiden, wenn der gewitzte Junge ihm die liegen gelassenen Münzen direkt vor der Nase wegschnappte.
»Behalte deine klebrigen kleinen Finger bei dir, Kleiner«, warnte Ferus Remy und deutete mit seinem knochigen Zeigefinger auf ihn. »Ich schwöre dir, wenn du auch nur eine Brotkruste stibitzt, sorge ich dafür, dass Lod dir deine Finger bricht, und zwar einen nach dem anderen. Mal sehen, wie flink deine Hände dann noch sind.«
»Dazu müsste er mich erst einmal erwischen.« Remy grinste. Lod war der Koch der Taverne, aber wegen seiner immensen Körpergröße kam er auch als Rausschmeißer zum Einsatz, wenn aufmüpfige Gäste Ärger machten. Allerdings war er – höflich ausgedrückt – ungefähr so flink wie die Kartoffeln in seinem dickflüssigen Eintopf. Überhaupt stieß Ferus diese Drohung mindestens einmal im Monat aus. Sollte der Wirt ihm einmal keine Gewalt androhen, würde Remy sich viel mehr Sorgen machen. Wenn Ferus schwieg, schmiedete er Pläne.
»Ich will nur kurz zu Bart«, sagte Remy. »Danach hau ich sofort wieder ab.«
Ferus verdrehte die Augen und machte sich daran, den Tresen mit einem nassen Lappen abzuwischen. »Er ist an seinem Stammplatz«, sagte er und deutete ans andere Ende der Taverne. »Der alte Schwätzer grummelt mal wieder vor sich hin. Er sagt, ihm sei heute Abend nicht nach Geschichtenerzählen zumute. Pah! Wozu ist er sonst gut?«
Remy warf einen Blick zum Kamin. Ein weißhaariger alter Mann in einem zerschlissenen Kapitänsmantel saß missmutig am Feuer, die Schultern hoch- und die Mundwinkel nach unten gezogen.
»Muntere ihn ein bisschen auf«, drängte Ferus Remy. »Aus irgendeinem seltsamen Grund kann er dich gut leiden. Bring ihn zum Reden. Sieh zu, dass er in Erzähllaune ist, bevor die Abendgäste eintreffen. Es kommt nicht infrage, dass er nutzlos herumsitzt und auf meine Kosten trinkt.«
Remy ging zum Kamin hinüber, wo Brummbart in einem abgewetzten Ledersessel saß. Auf einem Beistelltisch stand ein leerer Becher, der als Trinkgeldkasse diente. Verdrossen starrte der Alte in die Glut und blickte selbst dann nicht auf, als Remy auf ihn zukam.
»Keine Geschichten heute«, brummte Brummbart, als Remy neben seinem Sessel stehen blieb. »Hab keine Lust.« Mit einem Seufzer ließ er sich tiefer in die Kissen sinken und sah Remy immer noch nicht an. »Werde bloß nicht alt, Junge«, sagte er mit seiner krächzenden Stimme. »Niemand hat mehr Respekt vor den Älteren. Man sollte meinen, die Leute wären anständig genug, einen alten Mann nicht zu bestehlen, der nichts mehr hat im Leben außer seinen Geschichten. Aber es gibt keine anständigen Menschen mehr. Zumindest nicht hier auf diesem verfluchten, trostlosen Geröllhaufen von einer Insel. Da möchte ich das Geschichtenerzählen am liebsten ganz aufgeben.«
Seufzend kramte Remy die Börse aus seiner Hosentasche und hielt sie dem alten Mann hin. »Ich glaube, du hast etwas verloren«, sagte er und sah, wie Barts Augen sich weiteten.
»Mein Glückskaninchen!«, rief der Alte und riss Remy den Lederbeutel aus der Hand. »Du hast es gefunden!«
»Ja.« Remy nickte. »Ich habe die Börse auf einem Tisch in der Spielhalle liegen sehen und sie ist mir gleich bekannt vorgekommen. Leider war der Pirat, dem ich den Beutel abgenommen habe, nicht ganz so betrunken, wie ich dachte.«
Bart schüttelte den Kopf. »Dummer Junge«, schimpfte er. »Was sage ich dir immer? Piraten sind Diebe und Halsabschneider, aber sie vergessen niemals, wer sie bestohlen hat. Wenn du weiterhin Piraten beklaust, wirst du dich eines Tages auf einer Planke über dem Mahlstrom wiederfinden.«
Remy zuckte mit den Schultern. »Noch haben sie mich nicht gekriegt«, sagte er ungerührt. »Übrigens, gern geschehen. Falls du dich erkenntlich zeigen willst, könntest du ein oder zwei Münzen rausrücken. Du weißt schon, weil ich deine Börse zurückgebracht habe und dafür quer über die ganze Halsabschneider-Insel gejagt wurde. Verstecken kann man sich hier ja nicht wirklich.«
Bart reckte das Kinn vor, öffnete den Lederbeutel und schob mit seinem dünnen, schmutzigen Finger die Geldstücke hin und her. »Da fehlen ein paar Kupfermünzen«, murmelte er.
»Sieh mich nicht so an«, protestierte Remy entrüstet. »Ich hab nichts rausgenommen. Ich bin zwar ein Dieb, aber ich beklaue niemanden, den ich kenne.«
»Hmpf«, brummte Bart und zog den Beutel wieder zu. »Tja … Du gehörst doch hoffentlich nicht zu denen, die einem alten Mann das bisschen Geld nicht gönnen?«, fragte er mit plötzlich ungewohnt schwacher Stimme. »Ich mach dir einen Vorschlag: Komm morgen Abend wieder, dann erzähle ich dir eine Drachengeschichte. Vielleicht sogar meine schönste über die Drachen und die Welt, wie sie vorher war.«
»Die kann ich dir alle auswendig aufsagen.« Remy seufzte, war jedoch nicht wirklich wütend. Er kannte Bart schon sein ganzes Leben lang und konnte ziemlich genau einschätzen, wie der alte Mann in den meisten Situationen reagierte. »Ich höre dir zu, seit ich fünf bin. Es gibt keine Geschichte, die ich nicht kenne.«
»Ach, wirklich?« Bart zog die Augenbrauen zusammen und richtete sich in seinem Sessel auf. »Dann weißt du sicher auch, was passiert ist, als der jüngste Sohn des Herzogs von Wolkenheim einen verletzten Drachen in einer Höhle unterhalb des Familienanwesens fand?«
»Er freundete sich mit dem Drachen an, rettete den König vor einem Piratenangriff und wurde zum allerersten Himmelsritter geschlagen«, leierte Remy herunter.
»Hmpf.« Bart rümpfte die Nase und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Na schön, du Schlaumeier. Wenn du angeblich alle meine Geschichten kennst, dann beantworte mir folgende Frage: Was ist aus den Wahren Drachen geworden und wo sind sie jetzt?«
»Sie sind längst ausgestorben«, antwortete Remy. »Es gibt sie in Märchenbüchern und Legenden, aber sonst nirgends.«
»Ah, da irrst du dich.« Bart grinste triumphierend. »Siehst du, Junge, du weißt doch nicht so viel, wie du glaubst. Dieser alte Mann hier hat noch ein paar Geheimnisse in petto.«
Remy zuckte mit den Schultern. Die Geschichte der Wahren Drachen war ein Mythos, über den die Meinungen auseinandergingen. Angeblich waren sie die Vorfahren der gewöhnlichen Drachen, so wie die Wölfe die Vorfahren der Haushunde waren. Aber während die normalen Drachen großen Pferden mit Schuppen ähnelten, schienen die Wahren Drachen empfindsame, kluge Wesen zu sein, die sogar sprechen konnten. In manchen Geschichten verfügten sie über Magie und setzten sie gezielt ein. In einigen sehr düsteren Erzählungen waren es die Wahren Drachen, die das Große Beben verursacht und damit die Zerstörung der Welt in Gang gesetzt hatten. In einem Punkt waren sich jedoch alle einig: Es gab keine Wahren Drachen mehr. Und Remy hatte keine Lust, Brummbart zuzuhören, wie er eine Geschichte zum Besten gab, die er schon ein Dutzend Mal gehört hatte.
Die Tür der Taverne schwang auf, und laute Stimmen füllten den Raum, als eine Horde Piraten hereingestürmt kam. Sie johlten und schubsten sich gegenseitig. Remy erschrak und wollte schon hinter einem Stuhl in Deckung gehen, doch dann sah er, dass es nicht das Trio war, das ihn am Nachmittag verfolgt hatte. Trotzdem nahm er es als ein Zeichen, dass es höchste Zeit war, sich aus dem Staub zu machen.
»Ich muss los«, sagte er zu Bart und wandte sich zum Gehen. »Bis später. Pass auf dein Glückskaninchen auf. Ich habe keine Lust, es ein zweites Mal für dich zurückzuklauen.«
»Remy«, rief Brummbart, und der Junge drehte sich noch einmal um. Der alte Mann sah ihn seufzend an und schnippte ihm etwas zu, das im Licht glitzerte. Grinsend fing Remy es auf: eine einzelne Kupfermünze. Nicht viel, aber genug, um etwas zum Abendessen zu kaufen. Das war es fast wert, sich von Piraten über die ganze Insel hetzen zu lassen.
»Die Wahren Drachen existieren noch«, raunte Bart ihm zu und steckte seinen Beutel in die Manteltasche. »Niemand glaubt daran, aber sie sind noch da. Wenn du schlau bist, kommst du morgen wieder und hörst dir auch den Rest der Geschichte an.«
»Damit ich Münzen, die ich gar nicht habe, in deinen Becher werfe? Nein, danke.« Remy schüttelte den Kopf und wandte sich ab. Drachengeschichten würden ihn nicht vor dem Verhungern bewahren. »Selbst wenn ich glauben würde, dass es irgendwo da draußen noch Wahre Drachen gibt, was soll’s?«, fragte er herausfordernd. »Hierher wird es sie garantiert nicht verschlagen. Warum sollte ich mir also unnötig den Kopf über sie zerbrechen?«
Bart grummelte etwas Unverständliches, aber Remy huschte bereits zur Tür hinaus. Die Sonne war hinter dem Horizont untergegangen und die Luft war kühl und roch nach Schlamm und Frost. Remy vergrub die Hände in den Taschen seiner zerschlissenen Hose und machte sich auf den Heimweg.
Das Bettlerviertel war ein Bezirk der Halsabschneider-Insel, der so berüchtigt war, wie sein Name es vermuten ließ: Hier lebten die Ärmsten der Armen, in notdürftig zurechtgezimmerten Baracken und Hütten, die zum Schutz vor der Nässe auf Pfählen errichtet worden waren. Wackelige Holzbrücken, Treppen und Stege durchzogen die engen Straßen, und obwohl man die modrigen Planken mehrere Fußbreit über dem Boden angebracht hatte, waren sie stets mit Schlamm bedeckt. Wie auch alle Bewohner, die hier lebten.
Remys »Haus« befand sich am Ende der Gasse, bedenklich windschief stand es über einem Regenwasserkanal, der an dieser Stelle in einen Tümpel mündete. Remy war hier aufgewachsen. Nach dem Tod seiner Mutter vor drei Jahren hatte er damit gerechnet, dass man ihm die Hütte wegnehmen und ihn davonjagen würde. Aber die Monate verstrichen und wurden zu Jahren, ohne dass etwas passierte. Vielleicht wollte niemand die alte Hütte. Vielleicht kümmerte es auch einfach niemanden. Remy stellte keine Fragen. Die Hütte war klein, wackelig und drohte jeden Augenblick einzustürzen und in den Tümpel zu fallen. Aber für eine mittellose Schlammratte wie ihn bot sie ein Zuhause.
Als Remy jetzt darauf zuging, hörte er das laute Knarren der Bretter und Dielen, die im Wind ächzten. Ein zerfleddertes graues Tuch verdeckte den Eingang, denn eine richtige Tür gab es nicht, und die Fenster waren mit Brettern vernagelt, um die Kälte abzuhalten. Remy schob das Tuch beiseite und betrat den kleinen Raum dahinter. Neben einem Tisch, der nur noch drei Beine hatte, gab es einen einzigen Stuhl, und in der Ecke war eine Hängematte aufgespannt, auf der eine mottenzerfressene Decke lag. Remy musste erhöht schlafen, weil bei Regen Wasser ins Haus drang. Brutus, die große braune Ratte, die sich bei ihm eingenistet hatte und die gerade an einem Stuhlbein nagte, blickte kurz auf, zuckte mit einem Ohr und kaute dann weiter am Holz. Remy seufzte.
Trautes Heim, Glück allein.
Remy ging zu dem Tisch und brachte den Stuhl vor Brutus’ scharfen Schneidezähnen in Sicherheit. Dann setzte er sich und holte ein Bündel hervor, das er auf dem Heimweg bei Silas, dem Lebensmittelhändler, gekauft hatte. Als er es öffnete, kamen ein harter Kanten Brot und zwei Tauben am Spieß zum Vorschein – eben das, was er sich mit einer einzigen Münze hatte leisten können. Die beiden gebratenen Vögel hatte er für eine Kupfermünze bekommen, aber Silas hatte ihm auch noch den Kanten Brot dazugegeben, weil er den Jungen mochte. Im Gegensatz zu einigen anderen hungrigen Bewohnern des Bettlerviertels bestahl Remy ihn wenigstens nicht.
Brutus umkreiste den Tisch und setzte sich auf die Hinterbeine. Seine Schnurrhaare bebten, als er in der Luft schnupperte. Remy schnitt eine Grimasse.
»Nein, das ist nicht für dich«, sagte er zu dem Nagetier. »Du bist nicht derjenige, der heute von Piraten quer über die Halsabschneider-Insel gejagt wurde. Such dir dein eigenes Abendessen.«
Die Ratte starrte ihn mit großen schwarzen Augen an. Remy seufzte. »Also gut. Aber nur damit du nicht wieder die Seile von meiner Hängematte anknabberst.« Er warf Brutus eine Kruste zu, die dieser sich sofort schnappte, um damit in einem der vielen Löcher in der Wand zu verschwinden. »Gern geschehen«, rief ihm Remy hinterher. »Und hör auf, meine Stühle anzufressen.«
Das Brot war hart wie Stein, und die gebratenen Tauben waren so mager, dass sie fast nur aus Knochen bestanden, aber es war etwas Essbares. Remy hatte sich schon mit viel Schlimmerem begnügen müssen. Nachdem er das Brot weichgekaut und das Fleisch vom ersten Taubenspieß bis auf die Knochen abgenagt hatte, wickelte er den zweiten wieder in das fettige Tuch und steckte das Bündel für später in die Tasche. Denn er wusste ja nie, wann er die nächste Mahlzeit bekommen würde. An manchen Tagen konnte er Piraten bestehlen und ungeschoren davonkommen, an anderen war das Glück einfach nicht auf seiner Seite. Bart gefiel es gar nicht, wenn Remy Dinge stahl, aber der Alte kapierte es einfach nicht. Niemand kümmerte sich um Remy; er musste selbst für sich sorgen.
Seufzend dachte Remy an das, was Bart heute Abend gesagt hatte. Es hatte eine Zeit gegeben, vor ein paar Jahren, da hatten Drachen ihn fasziniert. Damals hatte er mit großen Augen auf dem harten Fußboden der Taverne gesessen und wie gebannt Barts Drachengeschichten gelauscht. Er hatte davon geträumt, einmal als blinder Passagier auf einem Piratenschiff mitzufahren oder vielleicht als Kajütenjunge anzuheuern. Er wollte in die Hauptstadt fliegen, wo Himmelsritter auf Drachen durch die Lüfte sausten und reiche Leute atemberaubende Rennen veranstalteten, um zu sehen, welcher Drache der schnellste war. Und vielleicht, nur vielleicht, würde er eines Tages vor dem König eine Heldentat vollbringen, genau wie der Herzog von Wolkenheim, und selbst ein Himmelsritter werden.
Aber das war gewesen, bevor er zum Waisenkind wurde. Bevor sein Vater auf einem Schiff abgereist und nie zurückgekehrt war und bevor eine tödliche Krankheit ihm seine Mutter genommen hatte. Seine Mutter hatte Remys Leidenschaft für Drachen immer unterstützt. Wenn er ihr von seinem Traum erzählte, ein Himmelsritter zu werden, hatte sie das nie für unmöglich gehalten. Wenn er ihr von den Geschichten erzählte, die er in der Taverne gehört hatte, lächelte sie und sagte ihm, dass er eines Tages ein wunderbarer Himmelsritter werden würde. Aber nach ihrem Tod hatte Remy sich der harten Realität stellen müssen: Schlammratten wie er wurden keine Himmelsritter. Sie besaßen keine Drachen und erlebten keine Abenteuer. Er hatte seiner Mutter nie die Schuld dafür gegeben, ihn in seinen Träumen bestärkt zu haben, nur damit diese von der Wirklichkeit zerquetscht werden konnten. Aber an dem Tag, als sie starb, hörte er auf, Barts Drachengeschichten zu lauschen.
Anfangs hatte er sogar versucht, die Halsabschneider-Insel zu verlassen. Doch er hatte bald gemerkt, dass selbst dieser Traum nie in Erfüllung gehen würde. Das Leben war schon vorher hart gewesen, aber für eine Schlammratte ohne Familie und ohne Geld war es noch härter. Keine Schiffsbesatzung wollte ihn haben; er war zu schwach, zu klein, zu mickrig. Er wäre den Strapazen des Schiffslebens nicht gewachsen, behaupteten sie und entschieden sich stets für die stärkeren und widerstandsfähigeren Jungen. Denn Remy war nicht der Einzige, der die Hauptstadt mit eigenen Augen sehen wollte. Alle versuchten, von der Halsabschneider-Insel wegzukommen, und die Himmelsschiffe waren die einzige Möglichkeit dazu. Leider zog so ein Piratenhafen nur Himmelsräuber und andere Halsabschneider an – Leute, die Remy bestenfalls verhöhnten und ihn schlimmstenfalls ihre Faust oder gar ihre Klinge spüren ließen. Bis er schließlich den Plan aufgab, ein Pirat werden zu wollen, und sie stattdessen lieber bestahl.
Remy schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu vertreiben, und stand auf. Seine nackten Füße landeten mit einem lauten Platschen auf den Holzdielen, als wollten sie ihm auf diese Weise die trostlose Realität vor Augen führen. Die Fantasien eines kleinen Jungen waren genau das: Fantasien. Seine Welt bestand aus Dreck, Kälte, Hunger sowie, wenn er Glück hatte, geschnorrten Essensresten und der ein oder anderen ergatterten Münze. Diebe und Schlammratten wurden keine Himmelsritter. Außer in den Geschichten, die Brummbart erzählte, würde Remy mit der Welt der Drachen nie in Berührung kommen.
Draußen erhellte ein Blitz den Himmel, und Remy zuckte zusammen, als ein Windstoß an den Brettern vor seinen Fenstern rüttelte. Brutus steckte den Kopf aus einer Nische hervor, und seine Barthaare zuckten, als er in der Luft schnupperte.
»Ein Sturm zieht auf«, sagte Remy zu ihm. »Ich hoffe, die Bretter halten, sonst wird es eine ziemlich nasse Nacht.«
Brutus wackelte mit einem Ohr und verschwand wieder in seinem Loch. Remy bückte sich, hob seine einzige Laterne auf und hängte sie an einen Nagel, dann kletterte er in seine Hängematte.
Er zog sich die löchrige Decke über den Kopf, schloss die Augen und lauschte dem aufkommenden Wind draußen, bis dieser ihn in einen unruhigen Schlaf lullte.
In seinen Träumen glaubte er, ein leises Weinen zu hören.
Kapitel 2
Gemillia Sonnenwind Gallecia, weißt du, warum ich dich schon wieder zu mir gerufen habe?«
Gem kaute auf ihrer Lippe. Sie wollte auf ihre Stiefel schauen, auf den Boden, aus dem Fenster, irgendwohin, um dem verärgerten Blick der Schulleiterin Idella auf der anderen Seite des Schreibtisches zu entgehen. Aber ein solches Verhalten gehörte sich nicht für jemanden ihres Standes. »Halte den Kopf hoch«, hatte ihr Vater ihr immer wieder eingeschärft. »Sieh deinem Gegenüber in die Augen. Damit zeigst du, dass du nichts zu verbergen hast, und du erkennst, ob dich jemand anlügt.«
Schulleiterin Idella zog eine dünne Silberbraue hoch und ihre halbmondförmige Brille blitzte im matten Licht des Arbeitszimmers auf. Die Rektorin war nicht alt, aber wie bei allen Sturmmagiern war ihr krauses und zerzaustes Haar durch die jahrzehntelange Ausübung von Magie schneeweiß geworden. Gems glatte schwarze Haare hatten noch ihre ursprüngliche Farbe, bis auf eine einzelne silberne Strähne, die ihr in die Stirn fiel. Gem trug sie mit Stolz, denn die Strähne wies sie unübersehbar als jemanden aus, der die Sturmmagie beherrschte.
Leider war das auch der Grund, warum sie nun hier war. Schulleiterin Idella musterte sie über den Schreibtisch hinweg und wartete auf eine Antwort. Mehrere Ausreden schossen Gem durch den Kopf, aber die Erinnerung an die Stimme ihres Vaters verdrängte alles andere. »Sag immer die Wahrheit«, hörte sie seine Ermahnung. »Auch wenn es wehtut. Ehrlichkeit ist wichtig, wenn du willst, dass man dir vertraut.«
Sie seufzte. »Ich habe heimlich Magie geübt. Außerhalb des Unterrichts.«
»Gemillia.« Die blau lackierten Fingernägel der Schulleiterin trommelten auf die Schreibtischplatte. »Darüber haben wir doch bereits gesprochen.«
»Ja, Ma’am. Ich weiß.«
»Du bist Schülerin im ersten Jahr«, fuhr die Rektorin fort, als hätte sie Gem nicht gehört. »Innerhalb dieser Mauern haben dein Stand und deine Privilegien keine Bedeutung. Dein Vater hat mir gleich zu Anfang mitgeteilt, dass du unterrichtet und behandelt werden sollst wie alle anderen auch. Das bedeutet, dass du dich an dieselben Regeln halten musst und dir dieselben Strafen drohen wie allen Schülern und Schülerinnen. Ich weiß, dass du Privatlehrer hattest, bevor du hierhergekommen bist, und dass du die Magie wahrscheinlich besser beherrschst als die meisten in deinem Jahrgang. Aber die Regeln gibt es aus gutem Grund, Gemillia.« Die Schulleiterin redete sich immer weiter in Rage, bis sogar die kleinen Kristalle auf ihrem Schreibtisch zu vibrieren begannen. »Sturmmagie ist unberechenbar und gefährlich«, fuhr sie fort und deutete mit ihrem blau lackierten Fingernagel auf Gem. »Und wenn Schülerinnen im ersten Jahr ihre Magie ohne Aufsicht ausüben, kann das leicht in einer Katastrophe enden. Ich bin nicht erpicht darauf, deinem Vater in einem Brief erklären zu müssen, dass es zu einem schrecklichen Unglück gekommen ist, nur weil du dachtest, für dich würden die Regeln nicht gelten!«
Die Kristallsplitter erhoben sich zitternd von ihrem Schreibtisch und verharrten eine Handbreit über der Oberfläche. Gem konnte die Energie im Raum spüren: wie die Luft vor einem Sturm, schwer und statisch aufgeladen. Schulleiterin Idella stieß einen Seufzer aus und schnippte mit den Fingern, um die magische Energie zu zerstreuen, die ihr Gefühlsausbruch hervorgerufen hatte. Die Kristalle drehten sich noch einen Moment lang träge in der Luft, dann sanken sie langsam und mit leisem Klimpern zurück auf den Schreibtisch.
Gem schluckte. Ein Junge aus dem zweiten Jahr hatte sich heute Morgen über sie lustig gemacht und behauptet, sie sei nur wegen ihres Vaters an der Schule und habe in Wahrheit gar kein Talent für Magie. Natürlich hatte sie ihm da das Gegenteil beweisen müssen, auch wenn ihr klar gewesen war, dass sie damit gegen die Regeln verstieß. Wie ihr Vater immer sagte: »Die Gesetze gibt es nicht ohne Grund. Nicht einmal wir dürfen sie missachten. Wenn wir die Regeln brechen, müssen wir die Konsequenzen tragen wie alle anderen auch.«
»Ich bin bereit, die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen, Schulleiterin Idella«, sagte Gem und hob ihr Kinn. »Aber es gibt keine eindeutig festgelegte Strafe für den Gebrauch von Magie außerhalb des Unterrichts. In den Regeln steht nur, dass es ›bis hin zum dauerhaften Ausschluss von der Schule‹ führen kann. Wenn ich genauer wüsste, welche Folgen ein Verstoß gegen die genannten Regeln hat, könnte ich überlegtere Entscheidungen treffen.«
Die Rektorin schürzte die Lippen. »Du bist die Tochter deines Vaters, durch und durch«, murmelte sie. »Nun gut. Hier ist deine Strafe, und wenn du weiter gegen die Regeln verstößt, bekommst du noch mehr davon aufgebrummt: Ich erwarte von dir einen fünfzehnseitigen Aufsatz über die Geschichte und die Gefahren unkontrollierter Magie, vom Zeitalter des Chaos bis heute. Und ich will ihn bis Anfang nächster Woche auf meinem Schreibtisch haben.«
»Fünfzehn Seiten?« Gem verschluckte sich fast.
Schulleiterin Idella lächelte. »Oh, keine Sorge, zu diesem Thema gibt es ausreichend Stoff, um eine ganze Bibliothek damit zu füllen. Und jedes Mal, wenn du eine Regel brichst, erhöht sich die Anzahl der Seiten um weitere fünf. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt, Miss Gallecia?«
»Ja, Ma’am«, sagte Gem matt.
»Ausgezeichnet.« Die Schulleiterin lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und sah zufrieden aus. »Du kannst nun in deinen Schlafsaal zurückkehren. Der Unterricht ist für heute beendet, aber ich schlage vor, du fängst gleich mit deinem Aufsatz an. Du hast eine Menge zu tun.«
Etwas bedröppelt schlich Gem nach draußen in den Korridor mit seinen eleganten blau-goldenen Teppichen, den holzvertäfelten Wänden und den großen Ölgemälden, von denen ihr berühmte Magier entgegenblickten. Erst allmählich dämmerte ihr, wie viel Arbeit ihr bevorstand.
Am Ende des Gangs spähte jemand um die Ecke – ein großer, schlaksiger Junge in Gems Alter, mit kurzen braunen Haaren und einer langen weißen Strähne, die ihm leider wie ein Leuchtfeuer mittig in die Stirn hing. Sein Name war Lutos, aber einige der älteren Schüler hatten irgendwann angefangen, ihn Leuchtturm zu nennen, und der Spitzname war ihm geblieben.
»Gem.« Leuchtturm winkte ihr zu, verharrte jedoch an der Ecke.
Gem verdrehte die Augen. »Du kannst ruhig herkommen. Keine Angst, die Rektorin wird dich schon nicht gleich auffressen.«
»Sag das nicht zu laut.« Leuchtturm huschte über den Flur auf sie zu, behielt jedoch die Tür im Auge, durch die sie gerade gekommen war. Er hatte verständlicherweise Angst vor der Schulleiterin, genau wie die meisten Schüler im ersten Jahr.
Nur Gem fürchtete sich nicht vor ihr.
»Bist du von der Schule geflogen?«, fragte er und sah sie mit großen Augen an. »Ich habe dir gesagt, du sollst Petor einfach nicht beachten. Er ist zu allen fies.«
»Nein, ich bin nicht rausgeflogen.« Gem schnaubte. »Ich muss nur einen Aufsatz über die Gefahren unkontrollierter Magie schreiben. Es hätte schlimmer kommen können. Und Petor ist ein Idiot. Ich würde es jederzeit wieder tun.«
»Wow.« Leuchtturm klang ehrfürchtig und auch ein klein wenig neidisch. »Du Glückspilz. Ich schätze, sogar die Schulleiterin hat Angst vor deinem Vater.«
Gem verspürte Ärger in sich aufsteigen. Egal, wo sie hinging, schienen alle nur die Tochter ihres Vaters in ihr zu sehen. Nie sie selbst. Nie einfach nur Gem.
»Egal«, sagte sie seufzend und bog in einen Gang. »Ich muss zur Bibliothek und Bücher für meinen Aufsatz ausleihen. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht magst.«
Leuchtturm zuckte mit den Schultern und holte sie mit wenigen Schritten ein. »Ich habe sowieso nichts anderes zu tun.«
Sie gingen die langen Korridore der Akademie für Magie entlang, vorbei an anderen Schülern, Lehrern und sonstigem Personal. Die meisten Schüler und Schülerinnen waren wie Gem und Leuchtturm gekleidet: schwarze Hosen, Lederstiefel und dunkelblaue Tuniken mit weiten Ärmeln. Allerdings konnte man an den silbernen Stickereien auf den Tuniken leicht erkennen, welchem Jahr die Schüler angehörten. Im ersten Jahr waren die Uniformen schlicht und unauffällig, im vierten Jahr prangten feine Stickereien auf Schultern und Ärmeln. Je älter man war, desto kunstvoller war die Uniform. Gem mochte ihre schlichte blaue Tunika. Von den Lehrern war niemand aufwendig gekleidet – abgesehen von Magier Opus, aber der neigte grundsätzlich zur Übertreibung.
In diesem Flügel des Internats gab es nur sehr wenige ältere Schüler; die Zimmer des dritten und des vierten Jahres lagen auf der anderen Seite des Innenhofs, während das erste und zweite Jahr in Schlafsälen außerhalb des Hauptgebäudes untergebracht waren. Im Vorbeigehen sah Gem manchmal Blitze oder plötzliche Energieexplosionen in den Sälen der höheren Klassen, und sie fragte sich, ob die Regel »keine Magie außerhalb des Unterrichts« auch für die älteren Schüler galt.
»Hey, hast du schon gehört?« Leuchtturm stieß die Tür des Gebäudes auf und zuckte zusammen, als ihn das helle Sonnenlicht blendete. »Obermagier Alaric verlässt die Schule.«
Gem runzelte die Stirn. Obermagier Alaric – ein großgewachsener Magier mit einer krummen Nase und weißen Haaren, die wirr in alle Richtungen abstanden – war einer der wichtigsten Lehrer an der Schule. Weil er die Sturmenergie beherrschte wie kaum ein anderer, galt er als eines der mächtigsten Mitglieder der Akademie. Wenn Schüler es schafften, blaue Blitze aus ihren Fingern sprühen zu lassen, konnte man sicher sein, dass sie von Alaric unterrichtet worden waren.
»Warum?«, fragte sie.
Leuchtturm zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht. Keiner will mit der Sprache herausrücken, aber das dritte und das vierte Jahr scheinen nicht gerade glücklich darüber zu sein.«
Interessant. Das war jetzt schon der zweite Magier, der innerhalb einer Woche die Akademie verließ. Als Erste war Obermagierin Elina gegangen, die Freies Schweben unterrichtet hatte. Gem dachte an jenen Abend zurück. Alle hatten sich für das Abendessen im Speisesaal versammelt. Die Lehrkräfte und sonstiges Personal saßen natürlich an ihrem eigenen Tisch im hinteren Teil des Raumes. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass an diesem Abend irgendetwas anders war als sonst.
Gem erinnerte sich daran, wie die Tür aufgegangen war und ein Bote den Saal betreten hatte. Er war ihr sofort aufgefallen, weil er die Uniform der königlichen Kuriere trug, und einen Moment lang hatte sie befürchtet, er sei ihretwegen gekommen. Vielleicht hatte ihr Vater ihn geschickt? Vielleicht hatte er es sich anders überlegt und wollte doch nicht mehr, dass seine Tochter die Schule für Magier besuchte, weshalb er sie nun in den Palast zurückbeorderte? Aber zu Gems Erleichterung hatte der Bote auf direktem Weg den Lehrertisch angesteuert. Obermagierin Elina saß an einem Ende des Tisches, ihr silbernes Haar hatte sie an diesem Abend wie immer zu einem Dutt hochgesteckt. Sie hatte verwundert aufgeblickt, als der Bote vor sie getreten war, sich verbeugt und ihr mit beiden Händen einen versiegelten Umschlag überreicht hatte. Gem hatte sie genau beobachtet, während sie den Brief öffnete. Deshalb war ihr nicht entgangen, wie sich die Augen der Lehrerin hinter der Brille geweitet hatten und sie ganz blass geworden war. Alle Lehrerinnen und Lehrer hatten die Köpfe gehoben, als sie abrupt aufgestanden und zum Kopfende des Tisches gegangen war. Dort hatte sie Schulleiterin Idella etwas ins Ohr geflüstert, sodass diese sich in ihrem Stuhl aufgerichtet und sie beunruhigt angesehen hatte.
Dann hatte sich die Rektorin erhoben und beide Frauen hatten unter dem Getuschel und den neugierigen Blicken der Schüler und Lehrer den Speisesaal verlassen. Seitdem hatte Gem Obermagierin Elina nicht mehr gesehen. Es gab eine offizielle Mitteilung der Schulleitung, wonach sie aus familiären Gründen auf ihre Insel zurückgekehrt war. Aber wenn das stimmte, warum hatte dann ein königlicher Bote die Nachricht überbracht? Diese Kuriere wurden nur vom König und dem Kronrat eingesetzt, um Nachrichten von höchster Wichtigkeit weiterzuleiten. Irgendetwas war faul an der Sache, aber Gem hatte nicht weiter nachgefragt.
Und jetzt hatte auch Obermagier Alaric die Akademie für Magie verlassen. Seltsam. Aber auch daran konnte Gem im Moment nichts ändern.
Sie mussten den Haupttrakt verlassen, um zur Bibliothek zu gelangen, die sich auf der anderen Seite des Hofs befand. Die Bibliothek war das größte Gebäude der ganzen Schule und beherbergte die umfassendste Sammlung von Büchern, Schriftrollen, Texten und Folianten im ganzen Königreich. Die Magier waren äußerst stolz auf diesen Wissensschatz und hüteten ihn sorgsam. Die drei Stockwerke der Bibliothek, die aus uralten Steinen, Ziegeln und Mörtel errichtet war, überragten das gesamte Gelände. Zwei imposante steinerne Drachen bewachten den Eingang und ihre breiten Schwingen spannten sich bogenförmig über die Treppe. Angeblich stellten die Statuen zwei der Wahren Drachen dar, die nicht nur größer und stärker, sondern auch viel klüger waren als die Drachen, die Gem kannte. Auch wenn diese Geschöpfe schon lange ausgestorben waren, erzählte man sich immer noch davon, wie sie den Menschen Magie beigebracht hatten, in den alten Zeiten vor dem Großen Beben.
Gem liebte Drachen. Zu Hause ritt sie am liebsten auf Schneewolke, ihrem süßen weißen Drachen mit den wunderschönen blauen Augen. Ihr Vater besaß ein beeindruckendes Drachengestüt. In seinen Ställen befanden sich nicht nur friedliche Reitdrachen wie Schneewolke, sondern auch schlanke, pfeilschnelle Renndrachen und sogar gepanzerte Kampfdrachen, die ungestüm und schwer zu lenken waren. Jeder Drache war anders und einzigartig, und Gem liebte es, ihre jeweiligen Eigenheiten und Temperamente kennenzulernen. Doch beim Anblick der gigantischen Statuen, die die Treppe zur Bibliothek bewachten, lief ihr unwillkürlich ein Schauder über den Rücken. Vielleicht lag es an ihrer Größe; sie waren mindestens dreimal so groß wie der imposanteste Kampfdrache, den sie je gesehen hatte. Auf der Tafel am Sockel war zu lesen, dass es sich dabei um Lebensgröße handelte. Vielleicht lag es aber auch an ihren strengen Reptiliengesichtern, mit denen sie auf die mickrigen Sterblichen hinabblickten. Gem ahnte, dass die beiden, wären sie lebendig, von den Menschen heutzutage nicht sonderlich beeindruckt wären.
»Wie lautet das Thema deines Aufsatzes noch mal?«, fragte Leuchtturm, als sie die Stufen hinaufstiegen und in die kühle, schummrige Stille der Bibliothek eintauchten. Er hatte geflüstert, denn die Bibliothekare, die sich in den Gängen tummelten, hatten nicht nur ein Gehör wie Fledermäuse, sondern auch die Angewohnheit, wie heraufbeschworene Dämonen aus dem Nichts aufzutauchen, sobald irgendein Unfug in ihrer Bibliothek passierte. Ihre Sinne waren geradezu übernatürlich scharf. Gem hatte einmal aus Versehen ein schweres Bündel Papier auf den Fliesenboden fallen lassen, und noch ehe sie es aufheben konnte, hatten sie bereits drei Bibliothekarinnen umringt, die sie mit zusammengekniffenen Lippen missbilligend anstarrten.
Gem seufzte. »Die Gefahren unkontrollierter Magie«, sagte sie zu Leuchtturm und verdrehte entnervt die Augen. »Ich glaube, die Schulleiterin will mir damit eine Lektion erteilen.«
Leuchtturm nickte mitleidig. »Miss Hagda könnte dir Bücher zu diesem Thema raussuchen, wenn du sie fragst«, schlug er vor und nickte zu der alten Oberbibliothekarin, die hinter dem Mahagonischreibtisch in der Ecke saß.
Gem zuckte bei der Erwähnung ihres Namens zusammen und schüttelte den Kopf. Hagda Habichtauge hatte ihre Nase stets in einem dicken Wälzer vergraben und ignorierte normalerweise alles und jeden um sie herum. Aber immer, wenn Gem an ihr vorbeiging, blickte sie von ihrem Buch auf und folgte ihr mit ihrem sprichwörtlich scharfen Blick aus ihren schwarzen Augen, bis Gem außer Sichtweite war. »Nein, ich suche sie mir lieber selbst heraus. Ich weiß ungefähr, wo ich nachschauen muss.« Gem ließ ihren Blick durch den scheinbar endlosen Raum voller Regale und Gänge schweifen und seufzte. Wie es aussah, würde sie die nächsten Tage hier verbringen. »Und was hast du vor?«, wandte sie sich an ihren Begleiter.
Leuchtturm zuckte mit seinen mageren Schultern. »Ich muss für einen Test in antiker Zwergengeschichte lernen«, antwortete er ausweichend.
Gem schmunzelte. »Du meinst, du willst in der Abteilung für Abenteuerromane abtauchen, bis die Bibliothek schließt, und hoffen, dass die Bibliothekare dich nicht rauswerfen.«
»Pst! Sag das nicht so laut, sonst hören sie dich.« Leuchtturm blickte sich vorsichtig um, trat dann einen Schritt zurück und räusperte sich. »Ich muss lernen«, sagte er, etwas lauter als nötig. »Ähm, du brauchst doch keine Hilfe, oder, Gem?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf und winkte ab. »Geh schon. Viel Spaß beim Lernen mit Captain Madhammer und den Piraten der Zukunft.«
»Den Freibeutern der Zukunft«, korrigierte er sie. »Du solltest die Reihe wirklich mal lesen. Captain Madhammer kämpft nicht nur ständig gegen Monster, er löst auch Rätsel.«
»Eine Geschichte über einen Piratenhelden, der gegen böse Magier und Ungeheuer aus magischen Stürmen kämpft, um das Königreich zu retten?« Gem verdrehte die Augen. »Das sind doch nur Hirngespinste.« Natürlich gab es Himmelspiraten. Sie hatte unzählige Warnungen gehört, sich nicht zu weit von der Hauptstadt und dem sie umgebenden Ring von Inseln zu entfernen. Je weiter man das Zentrum des Königreichs mit seinen Gesetzen und dem Schutz der Himmelsritter hinter sich ließ, desto gefährlicher wurde die Reise. Der gesetzlose Randbezirk, jener Inselring ganz weit draußen, gehörte Dieben, Schmugglern und anderen Halsabschneidern. Und keiner von denen kämpfte gegen das Böse und für das Wohl des Königreichs. »Piraten sind Verbrecher«, schloss Gem. »Es gibt keinen echten Captain Madhammer.«
Leuchtturm schniefte. »Na ja, ich mag ihn trotzdem«, sagte er stur und wandte sich ab. »Besser als verstaubte alte Lehrbücher ist die Reihe allemal. Viel Spaß mit deinem fünfzehnseitigen Aufsatz«, rief er über die Schulter. »Ich lese lieber etwas Spannendes.«
Sie beobachtete, wie er am Gang mit den Geschichtsbüchern vorbeihastete, scharf links in Richtung Romane und Abenteuergeschichten abbog und aus ihrem Blickfeld verschwand. Seufzend drehte Gem sich um und ging zur Treppe. Die Magie-Abteilung der Bibliothek nahm den gesamten ersten Stock ein. Hier würde sie die benötigten Informationen finden.