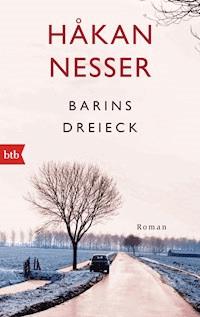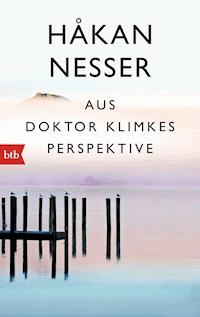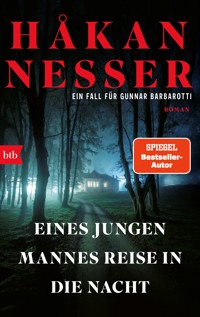5,99 €
Mehr erfahren.
Wenn wir unser Leben Revue passieren lassen, sind wir dann frei von Schuld?
Der Brief kommt überraschend, und er holt den Schriftsteller Max Schmeling aus seiner Komfortzone: einen Gefallen soll er ihm tun, seinem ehemaligen Schulkameraden Tibor Schittkowski, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat und den er aus vielen Gründen auch nicht sonderlich gut leiden konnte. Dass er sich auf ein Spiel mit gefährlichem Einsatz einlässt, ist ihm da noch nicht klar...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Der Brief kommt überraschend, und er holt den Schriftsteller Max Schmeling – der seinen Namen einer romantischen Anwandlung seines boxversessenen Vaters verdankt – aus seiner Komfortzone: einen Gefallen soll er ihm tun, seinem ehemaligen Schulkameraden Tibor Schittkowski, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat und den er aus vielen Gründen auch nicht sonderlich gut leiden konnte.
Tibor erinnert Schmeling daran, dass er ihm in jungen Jahren zwei Mal das Leben gerettet hat. Nun bittet er um eine letzte Begegnung (denn er ist sterbenskrank) – und um Hilfe in einer dringlichen Angelegenheit. Wider besseres Wissen begibt sich Schmeling auf die Reise nach Gimsen, in die Vergangenheit. Dass er sich auf ein Spiel mit gefährlichem Einsatz einlässt, ist ihm da noch nicht klar …
PAULA POLANSKI ist das Pseudonym einer deutschen Publizistin, die dieses Buch gemeinsam mit Håkan Nesser verfasst hat. Warum sie lieber anonym bleiben möchte, erschließt sich aus der Lektüre des Romans.
HÅKAN NESSER ist einer der beliebtesten Autoren Schwedens. Er gilt als der »Philosoph unter den Krimiautoren Skandinaviens« (Hannes Hintermeier, FAZ). Nesser begegnete Paula Polanski während einer seiner Lesereisen in Deutschland, wo sie ihm ihre Geschichte erzählte.
PAULA POLANSKI HÅKAN NESSER
STRAFE
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die schwedische Ausgabe erschien 2014 unter dem Titel »STRAFF« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm
Copyright © 2014 by Paula Polanski
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotive: © Margie Hurwich/Arcangel Images; Anthony Hatley /Arcangel Imagres
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15400-4 V003 www.btb-verlag.de
»I like to believe I am based on a true story.«
Archie Moore
I.
1
Am fünften September erhält der Schriftsteller Max Schmeling einen Brief in einem Brief seines Verlags.
Das kommt gelegentlich vor. Meistens handelt es sich um irgendwen aus Österreich oder Spanien, der ihn um ein Autogramm bitten möchte, oder um jemanden, der sein letztes Buch gelesen und auf Seite 255 eine Ungenauigkeit entdeckt haben will.
Handgeschrieben. Auch das ist nicht weiter ungewöhnlich, Menschen, die in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts geboren wurden, sind es aus ihrer Schulzeit häufig noch so gewöhnt.
Sein Name in großen Druckbuchstaben auf der Vorderseite des Umschlags, unterstrichen. Mit blauer Tinte. Er schlitzt ihn auf und zieht ein zusammengefaltetes DIN-A4-Blatt einfachster Art heraus.
Es ist Viertel vor elf am Vormittag. Er hat im Café Mephisto sein übliches Frühstück zu sich genommen, einen Spaziergang durch das Deijkstraa-Viertel gemacht und sich gerade hingesetzt, um mit dem Schreiben zu beginnen. Vielleicht an einem weiteren Kapitel des Romans, der seinem untrüglichen Gespür nach kurz vor einer Havarie steht. Auch das kommt bisweilen vor, aber irgendetwas muss man ja tun, während man auf den Tod wartet.
Der Brief besteht aus wenigen Zeilen. Die Handschrift ist nicht ganz leicht zu entziffern, aber Max Schmeling hat viele Jahre als Lehrer gearbeitet, er ist daran gewöhnt, alles aufs Trefflichste zu deuten.
Gimsen, den 21. August 2013
Lieber Max,
ich bin’s, Tibor, der dir diese Zeilen schreibt. Du erinnerst dich doch sicher? Immerhin habe ich dir zwei Mal das Leben gerettet, und deshalb denke ich, dass du mir einen Gefallen schuldest. Die Sache ist die, dass es mir ziemlich schlecht geht, ich habe nicht mehr lange zu leben, aber es gibt da etwas, was ich noch in Angriff nehmen muss. Und dabei brauche ich deine Hilfe.
Das Leben hat sich nicht so entwickelt, wie wir es uns einst vorgestellt haben.
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich so schnell wie möglich bei mir meldest.
Freundliche Grüße,
Tibor Schittkowski
Ganz unten eine Adresse in Gimsen und eine Telefonnummer. Das ist alles.
Er legt seinen Kopf in die Hand und liest noch einmal. Bereut, dass er das Kuvert überhaupt geöffnet hat, und versucht gleichzeitig zu entscheiden, wie es nun weitergehen soll. Ob er den Brief einfach auf den Stapel zukünftiger Verpflichtungen legen oder sich auf der Stelle mit ihm beschäftigen soll.
Oder ob er ihn einfach ignorieren kann. Wenn man die Grüße unbekannter Menschen beantwortet, besteht das Problem nämlich darin, dass man in neun von zehn Fällen einen neuen Gruß erhält. Eine Antwort auf die eigene Antwort, die häufig etwas ausführlicher ausfällt und immer eine oder mehrere explizite Fragen enthält.
Beantwortet man daraufhin diese eine oder alle – normalerweise ist so etwas ja schnell erledigt, wenn es sich um eine Korrespondenz per Mail handelt –, kommt recht bald ein weiterer Kommentar. Und damit hängt man am Fliegenfänger. Die Konversation ist etabliert, und es erscheint nahezu unmöglich, sie zu beenden, ohne ein klein wenig unhöflich zu werden.
Max widerstrebt es, unhöflich zu sein. Und wenn er es ohnehin sein muss, kann er es genauso gut von Anfang an sein und es unterlassen, das erste Anschreiben zu beantworten, und sollte die betreffende Person dann ein halbes Jahr später bei einer Signierstunde in einer Buchhandlung auftauchen, ist es für ihn ein Leichtes, einfach so zu tun, als wüsste er gar nicht, worum es geht. Er hat nie einen Brief bekommen. Auf die Post ist heutzutage wirklich kein Verlass mehr, weder auf die normale noch auf die elektronische.
Doch Tibor Schittkowski ist kein Unbekannter. Max wechselt vom Schreibtisch zur Couch und versucht, sich an ihn zu erinnern. Überlegt, ob er als Erwachsener jemals wieder auf ihn gestoßen ist.
Wenn er sich recht erinnert, ist das nie passiert. Also müssen sie sich das letzte Mal als Jugendliche gesehen haben; seither sind vierzig, fünfundvierzig Jahre vergangen, und nun behauptet Tibor, er brauche Hilfe.
Weil er im Sterben liegt und noch etwas zu erledigen hat?
Was könnte das sein?
Warum ausgerechnet Max Schmeling?
Weil er ihm das schuldig ist?
Abwegig. Das ist das Wort, das am deutlichsten in Max’ Kopf ertönt. Abwegig. Er erinnert sich, dass Tibor Schittkowski damals ein ziemlich schräger Vogel war, und möglicherweise ist sein Leben in diese Richtung weiterverlaufen. So ergeht es den meisten, alles geht einfach immer so weiter, ob man will oder nicht. Aber was weiß man schon? Fünfundvierzig Jahre sind trotz allem eine beträchtliche Zeitspanne, und ob in Max selbst noch sonderlich viel von jenem Fünfzehn- oder Achtzehnjährigen steckt, der er früher einmal war, tja, das ist mit Sicherheit eine Frage, die sich nicht auf die Schnelle beantworten lässt.
Eine Zeile im Schreiben irritiert ihn mehr als die anderen. Das Leben hat sich nicht so entwickelt, wie wir es uns einst vorgestellt haben. Was will Tibor damit sagen? Soll das eine Art Weisheit sein, die er verkünden möchte? Oder meint er damit nur sein eigenes Leben? Aber warum heißt es dann Wir? In Verbindung mit einst wirkt es gelinde gesagt merkwürdig. Als ginge es insbesondere um ihn und Max. Als hätten sie damals einen gemeinsamen Plan gehabt, woran er sich beim besten Willen nicht erinnern kann.
Oder will er lediglich sein eigenes erbärmliches Leben zu etwas Allgemeingültigerem erheben? Ein Wir ist schließlich immer ein bisschen größer als ein Ich?
Max hat keine Ahnung, ob diese Fragen in irgendeiner Form relevant sind, bleibt aber trotzdem in seiner Couchecke liegen und grübelt. Er versucht zurückzudenken und sich an das eine oder andere zu erinnern. Möglicherweise schläft er auch ein, ja, genau das tut er natürlich, denn eine halbe Stunde später wacht er wieder auf und hat die Frage in gewisser Weise beantwortet.
Wie er mit diesem Brief umgehen soll. Vielleicht durch irgendetwas, was in seinem Traum aufgetaucht ist, undenkbar ist das nicht. Je älter man wird, desto schwieriger scheint es zu werden, die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Schwieriger, aber auch weniger notwendig, als man es sich als jüngerer Mensch gerne eingebildet hat.
Es klingelt ziemlich lange, ehe sich jemand meldet.
»Ja?«
Eine müde Stimme. Es ist natürlich nur ein Wort, aber er hat dennoch das Gefühl, eine gewisse Resignation heraushören zu können. Aber wenn er wirklich im Sterben liegt, denkt Max, hat er natürlich das Recht, müde zu sein.
Gleichzeitig ist da jedoch auch der Anflug eines vorwurfsvollen Tons, als sei er bei etwas Wichtigem gestört worden, als dränge dieser Anruf in privates und verbotenes Territorium ein. Max’ erster Impuls besteht darin, aufzulegen, aber irgendetwas in der nachfolgenden Stille lässt ihn weitermachen. In dieser einen Sekunde oder worum es sich handeln mag.
»Tibor Schittkowski?«
»Ja.«
Diesmal ohne Fragezeichen. Aber genauso müde. Max erklärt, wer er ist und dass er über den Umweg seines Verlags den Brief erhalten hat.
Das verändert den Ton merklich.
»Storchi? Du bist es wirklich? Das ist ja ein Ding.«
Max fragt sich, wie lange es her ist, dass er diesen Spitznamen von sich gehört hat. Selbst damals, vor vierzig oder fünfzig Jahren, waren es nicht viele, die ihn benutzt haben; zwar hatte er in den ersten Teenagerjahren eine storchenähnliche Physiognomie, aber keiner seiner richtigen Freunde hat ihn jemals so genannt. Nun ja, richtige Freunde? Was meint man damit eigentlich?
Plötzlich fällt ihm ein, dass es Leute gab, die Tibor Scheißhaufen nannten, was auf seinen ungewöhnlichen Nachnamen anspielen sollte, aber er beschließt, dieses Detail unter den Teppich zu kehren und lieber nicht daran zu erinnern.
»Ja, genau«, antwortet er stattdessen. »Ich habe deinen Brief bekommen und dachte, dass ich dich zumindest einmal anrufen und mich erkundigen sollte, wie es dir geht …«
»Schlecht«, erklärt Tibor augenblicklich. »Richtig schlecht. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich leide an ALS, wenn dir das etwas sagt … ich bin mehr oder weniger gelähmt, die Krankheit breitet sich irgendwie im ganzen Körper aus, und ich sitze den ganzen Tag im Rollstuhl. Das heißt, wenn ich nicht liege.«
»Es tut mir leid, das zu hören«, sagt Max Schmeling.
Er ist noch nie besonders gut darin gewesen, jemandem zu kondolieren oder Mitleid zu zeigen. Es fällt ihm schwer, die richtigen Worte zu finden, und weil es hier um einen Mitmenschen geht, den er seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen hat, ist er sich nicht sicher, ob die richtigen Worte überhaupt existieren. Beispielsweise zu behaupten, er nähme »aufrichtig Anteil an deinem Schicksal«, würde in jedermanns Ohren verlogen klingen.
»Aber man möchte sein irdisches Dasein ja trotzdem auf die richtige Art verlassen«, stellt Tibor nach der Pause fest, die eingetreten ist.
»Das deckt sich mit meiner Erfahrung«, erwidert Max, ohne die geringste Ahnung zu haben, was er damit eigentlich sagen will. Oder worauf dieses Gespräch hinauslaufen wird.
»Und deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du bei mir vorbeischauen könntest.«
»Vorbeischauen?«
»Ja.«
»Wo wohnst du? Oder liegst du im Krankenhaus?«
»Eine Pflegerin kümmert sich zwölf Stunden am Tag um mich, aber ich werde, so lange es irgendwie geht, zu Hause bleiben. Ich wohne in der Eggerstraat 14, aber ich gehe mal davon aus, dass du in den letzten Jahren nicht in Gimsen gewesen bist?«
»Das ist richtig«, bestätigt Max.
»Es ist ein Neubaugebiet. Ich bin eingezogen, als es vor drei Jahren fertiggestellt wurde. Damals war ich noch ziemlich gut in Schuss … hinter dem Knast, wenn du dich erinnerst?«
»Im Pokerwald?«
Tibor Schittkowski lacht auf, aber sein Lachen klingt ein wenig gequält, und Max schätzt, dass ihn die Krankheit behindert.
»Stimmt genau, ich fürchte allerdings, dass von dem nicht mehr viel übrig ist. Wann warst du das letzte Mal hier?«
Max denkt nach. »Vor sieben oder acht Jahren, glaube ich.«
»Eine Lesung in der Buchhandlung?«
Er bestätigt auch das.
»Damals habe ich noch nicht hier gewohnt. Aber ich lese ziemlich viel. Ich habe bestimmt zwei oder drei von deinen Büchern … nun ja, genau deshalb brauche ich ja deine Hilfe. Aber du bist wahrscheinlich ziemlich beschäftigt, was?«
»Allerdings«, antwortet Max. »Es gibt eine Menge zu erledigen. Und ich weiß nicht recht …«
»Du wohnst in Maardam, habe ich gelesen.«
Max wartet.
»Mit dem Zug bist du in gerade einmal drei Stunden in Gimsen. Ich bilde mir wie gesagt ein, dass du mir das schuldig bist. Man bekommt …«
Er verstummt und beginnt zu husten.
»Ja?«
»Wenn es einem so geht wie mir grade, bekommt man irgendwie eine gute Auffassung von der Infrastruktur des Lebens.«
»Der Infrastruktur des Lebens?«
»Nenn es, wie du willst. Ich bin mir sicher, dass du verstehst, was ich meine. Du beschäftigst dich doch mit Worten und Gedanken. So hast du dich durchs Leben geschlagen, nicht?«
»Ja, schon …«
»Solange ich nicht den Löffel abgebe, habe ich alle Zeit der Welt. Es könnte allerdings durchaus sein, dass ich aufgrund der Lähmungen bald nicht mehr sprechen kann, und deshalb wäre es das Beste, wenn du in einer Woche kommen könntest … oder allerhöchstens in zwei. Die Prognose ist ein bisschen unsicher, aber mein Arzt gibt mir noch zwei Monate, im Höchstfall ein halbes Jahr. Es kriecht sozusagen von unten immer höher, so dass es in der letzten Zeit wohl darauf hinauslaufen wird, wie ein vergessenes Steak herumzuliegen, und darauf zu warten, dass man verfault.«
»Ich verstehe«, sagt Max.
Was nur bedingt der Wahrheit entspricht. Trotz des düsteren Themas klingt Tibor beinahe aufgeräumt. Ein vergessenes Steak? Immerhin scheint er sich mit seiner Situation abgefunden zu haben, und Max spürt eine widerwillige Neugier in sich erwachen. Ganz gleich, wie es um den Rest des Scheißhaufens bestellt sein mag, sein Kopf scheint jedenfalls noch zu funktionieren. Als hätte er Max’ Gedanken gelesen und als wollte er sie bestätigen, unterstreicht er dies auch.
»Meiner Birne fehlt nichts, es ist mir wichtig, dass du das weißt. Jedenfalls nicht mehr als sonst. Ich löse Sudokus und erinnere mich immer noch an alle Leichtathletik-Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rom.«
»Silber über fünfzehnhundert Meter?«, fragt Max.
»Jazy«, antwortet Schittkowski. »Ein Franzose.«
»Okay«, sagt Max. »Das stimmt. Aber was willst du eigentlich von mir. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, wobei und wie ich dir behilflich sein kann.«
»Schon klar«, erwidert Tibor. »Ich bin ja noch gar nicht zur Sache gekommen. Aber das lässt sich auch nicht am Telefon besprechen. Du wirst dich schon zu mir bemühen müssen. Wie gesagt, drei Stunden mit dem Zug. Einmal umsteigen in Aarlach natürlich. Wenn du das Auto nimmst, dauert es in etwa genauso lange, ich weiß nicht, was dir lieber ist.«
Nach einem viel zu kurzen Zögern – so kurz dass es sich in Wahrheit um etwas anderes handeln muss als ein Zögern, vielleicht sogar um dessen Gegenteil – erklärt Max, dass er die Einladung annimmt, und bittet nur um etwas Bedenkzeit, um ein passendes Datum zu finden.
»Warte nicht zu lange«, erinnert ihn Tibor. »Nächste Woche würde es mir passen.«
Max verspricht, seinen Terminkalender durchzusehen und ein paar Stunden später erneut anzurufen.
Er verlässt die Couch. Setzt sich an den Schreibtisch und starrt eine Weile aus dem Fenster. Zwei kleine Vögel wirbeln draußen durch die Büsche, obwohl es schon Anfang September ist. Seine Gedanken wirbeln in ähnlicher Weise. Er hat nun wirklich keine Lust, sich nach Gimsen zu begeben, weder mit dem Zug noch mit dem Auto. Nicht, um Tibor Schittkowski zu treffen, und auch aus keinem anderen Grund. Der Sommer ist vorbei, er hat mindestens einen Monat ungestörter Arbeitszeit vor sich, und selbst wenn der Text, an dem er momentan schreibt, die Absicht hat zu havarieren oder zu implodieren (oder was sich sonst abspielen mag, wenn Romane sich das Leben nehmen), hält er dennoch daran fest, dem Ganzen eine ehrliche Chance zu geben. Man muss sich hinsetzen und ins Zeug legen, die Worte stellen sich nicht von alleine ein, erst recht nicht, wenn man über sechzig ist, eine halbe Ewigkeit lang ein Buch pro Jahr veröffentlicht hat und sich ungern wiederholt.
Verdammt. Denkt der Schriftsteller Max Schmeling und geht seinen Kalender durch. Es ist genau so, wie er geahnt, ja, im Grunde schon gewusst hat: Die kommende Woche ist so inhaltsleer wie ein Karfreitag in den fünfziger Jahren.
Und so kommt es, dass er eine gute Stunde später mit dem sterbenden Scheißhaufen Tibor Schittkowski vereinbart, sich mit diesem in dessen Zuhause im früheren Pokerwald in Gimsen zu treffen.
Nächste Woche, Dienstagnachmittag. Am liebsten irgendwann kurz nach zwei, da die Krankenschwester ihren Patienten zwischen zwei und fünf in Frieden lässt, und der Patient am liebsten alles, was auf der Tagesordnung steht, unter vier Augen besprechen möchte.
So fängt es an. Vielleicht fängt es aber auch an einem Sommertag Mitte der sechziger Jahre an. Oder noch früher; aber selbst mit zwanzig Romanen im Rücken ist es nicht ganz leicht, den Moment zu bestimmen, in dem etwas ins Rollen kommt.
2
Ein paar Worte über Max, es geht nicht anders. Damit er nicht mit einem anderen verwechselt wird.
Sein vollständiger Name lautet Max Herrgott Schmeling. Sein Vater hieß Alois Kopper und war von Kriegsende bis Anfang der siebziger Jahre Besitzer eines Schuhgeschäfts am Marktplatz von Gimsen. Nachdem Max’ Mutter gestorben war – an Tuberkulose, der Junge war knapp dreizehn und das einzige Kind –, nahmen Vater und Sohn den Namen Schmeling an. Max hatte dem berühmten Boxer, der den legendären Joe Louis auf die Bretter geschickt hatte und für kürzere Zeit Boxweltmeister im Schwergewicht gewesen war, bereits seinen Vornamen zu verdanken. Alois Kopper hatte in seiner Jugend zwei seiner Kämpfe in Europa gesehen, und als sein einziges Kind zur Welt kam und ein Junge war, stand der Vorname augenblicklich fest. Herrgott wurde er nach Max’ Großvater mütterlicherseits getauft.
Wie man es später schaffte, sich Schmeling unter den Nagel zu reißen, ist ausgesprochen unklar, aber es ging offensichtlich. Alois Schmeling betonte seinem Sohn gegenüber zudem immer wieder, dass ihr Namensgeber im Zweiten Weltkrieg zwar für Deutschland gekämpft habe – als Pilot bei der Luftwaffe, nicht? –, insgeheim jedoch ein Widerstandskämpfer gewesen sei und sich beispielsweise persönlich in Lebensgefahr begeben habe, indem er zwei jüdische Kinder vor dem Holocaust rettete.
Vier Monate nach dem Tod seiner Mutter wurde Max unter seinem neuen Namen in die städtische Realschule aufgenommen. Anfangs wurde er in den Pausen des Öfteren verprügelt, von Idioten, die behaupteten, sie hießen Rocky Marciano oder Sonny Liston, aber mit der Zeit entwickelte er eine gute linke Gerade sowie eine Rechte, die auch nicht zu verachten war, und verschaffte sich auf diese Weise Respekt und gewann neue Freunde.
Dann wuchs er auf, wurde erst Lokomotivführer, danach Aushilfslehrer, später schließlich Schriftsteller, und in den letzten Jahrzehnten hat er sich als solch freischaffender Künstler durchs Leben geschlagen. Er verfasste einen Roman, der zu Hause und international zu einem großen Erfolg wurde, erweiterte ihn auf Anraten seines Verlags zu einer Art Tetralogie, und dank dieses Rats und dieser Bücher hat er seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr in einer Lokomotive oder hinter einem Lehrerpult gesessen. Er hat die sechzig überschritten, und das Risiko, dass er es jemals wieder tun muss, tendiert gen null.
Derzeit ist er alleinstehend. Seine dritte Frau hat ihn vor einem halben Jahr verlassen; das löste eine leichte Depression aus, aber seine Therapeutin behauptet, dass er sie überwunden habe. Er hat zwei Kinder, einen Sohn aus erster Ehe, eine Tochter aus zweiter. Sie sehen ihren Vater nicht sonderlich oft, haben aber auch keine ungelösten Konflikte mit ihm, jedenfalls nicht, soweit er wüsste. Sie wohnen in London beziehungsweise Kopenhagen, in letztgenannter Stadt hat er inzwischen zwei Enkelkinder.
Hier soll es jedoch nicht in erster Linie um Max Schmeling gehen, zumindest ist das nicht beabsichtigt. Was genau beabsichtigt ist, davon hat er einstweilen keine Ahnung, aber er kennt Schriftstellerkollegen, die behaupten, so und nicht anders zu arbeiten: Sie setzen sich mit Stift und Block an den Schreibtisch oder an ihren Computer, ohne einen einzigen Gedanken im Kopf zu haben. Und warten anschließend darauf, dass etwas passiert. Was auch geschieht. Und daraufhin schreiben sie es auf. Max hat diese Methode nie erprobt und behauptet regelmäßig, dass seine Kollegen lügen, aber diesmal gibt er nach. Er hat eine endlose Reihe sorgsam geplanter Romane geschrieben, vielleicht ist die Zeit reif, etwas Neues zu versuchen.
Will sagen, falls er wirklich auf dem Weg in eine Geschichte sein sollte, und es scheint einiges dafür zu sprechen, dass es so ist.
Er beschließt, das Auto zu nehmen. In Gimsen festzusitzen, weil am Abend kein Zug mehr fährt, möchte er nicht riskieren, und so hat er um kurz nach elf am Dienstagvormittag Maardam hinter sich gelassen, ist auf die A 35 gefahren und kann darüber spekulieren, was vor ihm liegt. Seit dem Telefonat in der vergangenen Woche hat er keinen Kontakt mehr zu Schittkowski gehabt. Bei ihrem zweiten Gespräch, als sie den Zeitpunkt für seinen Besuch festlegten, ist dieser keinen Deut mitteilsamer gewesen als bei ihrer ersten Unterhaltung.
Er möchte Max treffen, weil er seine Hilfe benötigt. Er findet, dass Max ihm dies schuldig ist. Er liegt im Sterben.
Das ist alles.
Irgendwo zwischen Aarlach und Oostwerdingen beginnt es zu regnen. Es ist kein gewöhnlicher Landregen, sondern ein Wolkenbruch, der es fast unmöglich macht, auf der Fahrbahn voranzukommen. Max hat das Gefühl, in einem Fluss gegen die Strömung zu fahren, und da er ohnehin tanken muss, biegt er auf eine wie gerufen auftauchende Tankstelle ab. Als er getankt hat, ist nach wie vor keine Wetterbesserung in Sicht; er betritt ein angeschlossenes Café und lässt sich mit einer Tasse Kaffee und einer Boulevardzeitung in einer Sitznische nieder.
Für die Zeitung braucht er fünf Minuten, danach faltet er sie zusammen und denkt über die Krankheit nach, an der Tibor Schittkowski offenbar leidet. ALS. Max hat sich im Internet schlaugemacht, unmittelbar nach ihrem ersten Telefonat.
Amyotrophe Lateralsklerose. Was er gelesen hat, klingt wenig erfreulich. Eine Art Muskelschwäche, die unerbittlich zum Tode führt. Keine bekannten Heilmittel, nur Medikamente, die den Krankheitsverlauf verlangsamen. Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Diagnose und Tod beträgt etwa drei Jahre. Es endet in der Regel damit, dass man nicht mehr atmen kann.
Schittkowski hat nicht erzählt, wie lange er schon betroffen ist, aber Max nimmt an, dass er schon mehr als zwei Jahre krank sein muss, wenn er inzwischen nur noch ein paar Monate zu leben hat. Er versucht, ihn sich vorzustellen, wie er aussieht und wohnt, was natürlich eine unmögliche Aufgabe ist. Als Jugendlicher ähnelte Tibor ziemlich stark Ringo Starr, daran erinnert Max sich noch. Allerdings hatte er wesentlich stärker abstehende Ohren; ganz gleich, wie er seine langen Haare kämmte, es gelang ihm nie, sie zu verbergen, und dies und die Tatsache, dass er in allen möglichen Situationen schnell rot wurde, führte dazu, dass er in manchen Kreisen unter der Bezeichnung Zwei blutrote Segel bekannt war. Obwohl Max das mit dem Erröten eigentlich nur vom Hörensagen weiß, und wenn ihm sein Gedächtnis keinen Streich spielt, hat Tibor seine ärgerlichen Hörorgane operieren lassen, damit sie flacher am Schädel anliegen. Er kann sich allerdings nicht erinnern, das Ergebnis jemals mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Der Scheißhaufen und Zwei blutrote Segel. Es lohnt sich natürlich nicht, über diese alten Spitznamen nachzugrübeln, vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass ihr Träger bald sterben wird, und Max merkt, dass ihn eine Art Trauer übermannt. Eine Trauer über die Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit des Lebens wahrscheinlich. Über die Unbestechlichkeit des Todes. Da hat er nun Tausende Seiten über diese Dinge geschrieben oder zumindest versucht, einiges zu diesem Thema zu Papier zu bringen, aber wenn die Wirklichkeit dann unter dem Make-up der Worte zum Vorschein kommt, erscheint einem das anders. Ja, völlig anders, überlegt Max Schmeling. Er denkt ein, zwei Momente darüber nach, seine Therapeutin anzurufen, aber da sie kaum etwas anderes beizusteuern haben wird als eine weitere Reihe neunmalkluger und unzuverlässiger Wortpflaster, lässt er es bleiben.
Stattdessen leert er seine Kaffeetasse und rennt durch den Regen zu seinem Auto. Obwohl es nicht mehr als zwanzig, dreißig Meter sind, wird er dabei klatschnass und denkt, dass es eine Übersprunghandlung gewesen sein muss, auf Schittkowskis Wunsch einzugehen. Unabhängig davon, worum es eigentlich gehen wird. Als er wieder auf der Straße ist, stellt er außerdem fest – wenig überraschend und ganz folgerichtig –, dass über dieser Landschaft eine gewisse Trostlosigkeit hängt. Vielleicht auch eine bleich schimmernde Melancholie, ja, wie vielleicht über allen Landschaften und Ländern und über dem menschlichen Dasein als solchem?
Ein bleiches Schimmern, können wir im Grunde mehr erwarten als das?
Ab und zu, wenn der Regen für kurze Zeit schwächer wird.
Trotzdem hat seine Fahrt ja ein Ziel und eine Richtung, ist es nicht so? Sind Trostlosigkeit und Melancholie dasselbe? Er begreift nicht wirklich, woher diese Gedanken kommen, und ebenso wenig, ob sie hilfreich sind oder ihn behindern, aber vielleicht braucht man ja trotz allem etwas Pompöses, an das man sich klammern kann, wenn man spürt, dass man nur noch hinter einem Lenkrad sitzt und verkümmert und unterwegs zu einem Tod ist, der zwar nicht der eigene ist, diesen aber immerhin ankündigt.
Oder etwas in der Art.
Obwohl er sich an der Raststätte Zeit gelassen hat, erreicht er Gimsen eine halbe Stunde zu früh. Schittkowski hat ihm gesagt, dass er erst kommen darf, sobald seine Pflegerin ihn in Frieden gelassen hat – also um zwei Uhr –, und so nutzt Max die Gelegenheit, um vorher noch eine Runde durch die Stadt zu fahren.
Als Erwachsener in die Stadt seiner Kindheit zurückzukehren, ist so, als würde man abends frühstücken. Es irritiert, und nichts stimmt. Die alten Baudenkmäler sind verfallen oder abgerissen worden, an ihre Stelle ist Neumodisches getreten. Die Verheißungen sind erloschen, die Visionen geschrumpft, und es fällt einem leicht, sich einzubilden, dass die gesamte Kindheit und Jugend nur eine Schimäre oder ein Bluff waren. An der Straßenecke hinter dem Sportplatz, wo Max zum ersten und einzigen Mal Regina Bauer geküsst hat, steht ein Dackel und hebt sein Bein an einem Müllkorb.
Er stellt fest, dass Rathaus und Kirche immerhin einigermaßen intakt aussehen, und steuert schließlich den Pokerwald an.
Dort liegt inzwischen wie erwartet ein Wohnviertel. Etwa zwanzig dreistöckige Häuser, die fünf oder zehn Jahre auf dem Buckel zu haben scheinen. Der Pokerwald ist zu einer traurigen Reihe von Kiefern geschrumpft, die in drei Himmelsrichtungen die Wohnhäuser umrahmen. Er findet ohne größere Schwierigkeiten den richtigen Hauseingang in der Eggerstraat, parkt den Wagen auf einem der Stellplätze für Besucher und steht exakt fünf Minuten nach zwei vor einer braun furnierten Tür in der obersten Etage mit einem handgeschriebenen Namensschild über dem Briefeinwurf: PIRMASEN/RANDERS. Max hat keine Ahnung, was das bedeutet, es lässt einen eher an den Namen einer Firma als an einen Menschen denken, aber Tibor Schittkowski hat ihm erklärt, dies und nichts anderes stehe auf seiner Tür. Warum auch immer.
Er zögert einige Sekunden, noch ist es nicht zu spät umzukehren, dann legt er den Zeigefinger auf den Klingelknopf.
Schittkowski muss auf ihn gewartet haben, vielleicht hat er ihn auch schon durchs Fenster gesehen, denn die Tür wird praktisch sofort geöffnet. Max weiß nicht, was er eigentlich erwartet hat, weder was die Wohnung noch was ihren Besitzer betrifft; eine triste, traditionelle Dreizimmerwohnung und einen vom Tode gezeichneten Vierundsechzigjährigen, der wahrscheinlich älter aussieht, aber ehrlich gesagt hat er sich wohl gar kein mentales Bild dieser Art gemacht.
Es trifft so oder so auch nicht zu. Tibor Schittkowski sitzt zwar in einem Rollstuhl und sieht auch nicht unbedingt gesund aus, strahlt aber etwas aus, was auf Eigenschaften schließen lässt, die Max so nicht erwartet hat. Haltung möglicherweise? Integrität? Intelligenz? Warum er vorausgesetzt hat, dass es seinem alten Bekannten an solchen Qualitäten mangelt, ist eine Frage, zu der er ungern Stellung beziehen möchte, und schlagartig wallt in ihm ein Gefühl von Scham auf.
Schittkowski lässt ihm im Übrigen ausreichend Zeit für diese Reflexionen, da er in den ersten drei oder vier Sekunden nichts sagt. Stattdessen betrachten sie einander lediglich, Max im Türrahmen, Tibor im Rollstuhl. Eins hat die Krankheit ihm jedenfalls nicht genommen: seinen Haarwuchs. Er besitzt eine üppige, graumelierte Mähne und einen Bart wie ein alttestamentarischer Prophet oder zumindest wie ein Russe. Sein Gesicht ist hager, bemerkt Max, geradezu ausgehöhlt, und langgezogen wie das eines Pferds. Die Ohren, das wenige, was man von ihnen erkennen kann, sehen ausgesprochen normal aus, die Operation ist damals also allem Anschein nach erfolgreich verlaufen. Die Brille mit ihren dünnen Metallbügeln hängt weit unten auf einer kräftigen Nase; sie ist leicht, ein wenig braun getönt, und er begegnet Max’ Blick über ihren Rand hinweg. Max denkt, wenn es ein einziges kleines Detail gibt, das an den Tibor vor vierzig, fünfzig Jahren erinnert, dann sind es diese Augen.
Er hatte damals einen durchdringenden Blick, war es nicht so? Ein bisschen irre.
Aber Ringo Starr? Eher nicht.
Und hager, heute so gut wie damals. Eine dicke, grüne Strickjacke hängt lose auf Schultern und Körper; von den Beinen ist nichts zu sehen, da er eine Decke um sie geschlungen hat, die bis über die Füße hinabreicht. Die Hände, die reglos auf den Armlehnen ruhen, sehen benutzbar, wenngleich ein wenig geschwächt aus.
»Tibor Schittkowski?«
»Max Schmeling. Lange nicht gesehen.«
Ein schiefes Lächeln aus dem Inneren des Barts.
»Herzlich willkommen, mein Freund. Erstaunlich, dass alles, jede Sache und Unternehmung, mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir uns vorstellen. Außer dem Leben selbst, bei dem ist es umgekehrt.«
Seine Stimme ist ein wenig röchelnd, ein wenig zischelnd. Er setzt mit dem Rollstuhl zurück und lässt seinen Gast herein. Max überlegt, ob dies eine einleitende Bemerkung ist, die er sich vorher zurechtgelegt hat, es hat ganz den Anschein, und wenn dem so ist, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, was vorbereitet ist. Aber ist ihm das nicht schon vorher klar gewesen? Er bereut erneut, dass er gekommen ist, aber so, wie die Dinge jetzt liegen, hat er natürlich keine Chance mehr, eine Kehrtwende zu machen.
»Tritt ein. Ich habe mir gedacht, dass wir uns als Erstes einen Schluck Whisky gönnen, um uns ein wenig zu stärken.«
Das kommt überraschend, aber Max erkennt, dass es in der Tat genau das ist, was er fürs Erste braucht.
3
Lebensrettung 1
Schon vor dem Bau des Gefängnisses lauerten in einer Stadt wie Gimsen Gefahren.
Die Bedrohung, die von der Justizvollzugsanstalt ausging, wurde ansonsten mit Sicherheit übertrieben; hinter den Mauern des Großen Graus saßen unbestritten die schlimmsten Schwerverbrecher des Landes, aber in den seltenen Fällen, in denen einem von ihnen die Flucht gelang, blieb der Betreffende nicht sonderlich lange in der Stadt. Keine Minute länger als nötig, dachte Max immer. Warum sollte er auch bleiben? Das Fluchtauto fuhr mit Sicherheit in südliche oder westliche Richtung; außer Landes, nach Hamburg oder weiter den Kontinent hinunter.
Die Polizeiwache in Gimsen wurde etwa zu der Zeit geschlossen, als das Gefängnis fertiggestellt war; er erinnert sich, dass sein Vater Alois des Öfteren eine ironische Bemerkung über diesen Schachzug fallen ließ, aber vielleicht verfolgte man damit ja tatsächlich einen Plan. Und in das Schuhgeschäft am Marktplatz wurde niemals eingebrochen, in fast dreißig Jahren kein einziges Mal.
Die Gefahren, die in den fünfziger und Anfang der sechziger Jahre lauerten, waren jedenfalls, wie sie waren. Eine der übelsten hörte auf den Namen Guy van der Punck. Schwer zu sagen, welche Bedeutung man der Tatsache zumessen sollte, dass er vierzig Jahre später Bürgermeister in Raatlingen wurde, und Max ist in seinen literarischen Werken stets bemüht gewesen, sich politischer Spekulationen zu enthalten. Als er aufwuchs, war Guy van der Punck jedoch ein übler Schläger, das ist vielfach belegt. Wenn er einem entgegenkam, wechselte man die Straßenseite, und ging man an seinem Haus vorbei, beschleunigte man seine Schritte oder machte lieber gleich einen Umweg um den Block. Guy fuhr Motorrad, seit er zwölf war, und ein unbestätigtes Gerücht besagte, er habe seinen Vater ermordet.
Letzteres hat Max nie geglaubt und vermutlich auch nicht viele andere. Arnold van der Punck war mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit bei einer feuchtfröhlichen Angeltour auf dem Meer ertrunken; die Familie besaß ein Sommerhaus an der Landzunge Wimmers, aber Guy war niemand, der ein nützliches Gerücht dementiert hätte.
Er ging in die siebte Klasse, als Max und seine Kameraden in die vierte gingen, er benutzte Pomade und rauchte knittrige Zigaretten. West oder North State ohne Filter – im Notfall auch Zimmelmanns –, und zwang regelmäßig kleinere Kinder, sie für ihn einzeln bei Weckers Tobacco in der Kernstraat zu kaufen.
Man erzählte sich des Weiteren, dass er vögele, und zwar mit Elfriede Maas und Brigitte Buijgen. Auch diese jungen Damen gingen in die siebte Klasse, alle drei hatten dunkle, fast schwarze Augenbrauen, was als sicheres Zeichen dafür galt, dass man sich dieser speziellen Betätigung widmete.
Es war natürlich unglaublich idiotisch, fast schon schwachsinnig, Guy van der Puncks Fahrrad zu klauen. Aber weder Max noch Bernie wussten, dass es sich um seinen Drahtesel handelte; wahrscheinlich glaubten sie in ihrer Einfalt, jemand wie Guy führe ausschließlich Motorrad. Sie hatten es eilig gehabt, vom Sportplatz heimzukommen, wo sie viel zu lange herumgestanden und das Training der ersten Mannschaft beglotzt hatten, eine Beschäftigung, der sie in jenen Jahren gerne nachgingen, und als dann direkt vor dem Eingang ein brauchbares und nicht abgeschlossenes Fahrrad ein bisschen schlampig an den Zaun gelehnt stand, nahmen sie es sich einfach. Bernie trat in die Pedale, Max saß auf dem Gepäckträger. Wenn seine Erinnerung ihn nicht trügt, hatte er sich die Füße wundgelaufen und konnte deshalb nicht an den Pedalen behilflich sein.
Als es passierte, waren sie gerade in den Adlers steeg eingebogen. Er tauchte auf wie Flint, der Rächer, in »Die Kompanie des Schwarzen Todes«, ein Film, der ein oder zwei Wochen zuvor im Onyx-Kino gelaufen war – allerdings ohne Pferd, also Guy –, und Bernie entschloss sich, schnurstracks in die Fichtenhecke vor Limmermanns Gärtnerei zu fahren. Vielleicht wollte er auch versuchen, durch sie hindurchzufahren, um zu entkommen, aber das bleibt unklar. Max sprang im letzten Moment ab, schlug sich ein Knie blutig und schürfte sich die Handflächen im Schotter auf.
»Verdammte Scheiße, ich bringe euch um!«, erklärte Guy van der Punck aus dem Mundwinkel heraus – im anderen hing eine West oder eventuell auch eine North State, aber keine Zimmelmanns, denn die sahen anders aus – und wedelte mit einem groben Seil, das er aus irgendeinem Grund in den Händen hielt. »Wer meinen Drahtesel klaut, hat seine letzte Kartoffel gesetzt.«
»Wir … wir …«, stammelte Bernie und rappelte sich auf.
»Ja?«, entgegnete Guy, nahm die Fluppe heraus und spuckte in die Fichtenhecke.
»Wir wollten es nur für dich nach Hause fahren«, sagte Bernie. »Wir haben übrigens gar nicht gewusst, dass es dir gehört.«
Das war beim besten Willen nicht sonderlich durchdacht, was selbst Max begriff, als er mit zitternder Unterlippe danebenstand und kein Wort herausbekam. Guy erkannte das auch und zeigte mit einem gelben Grinsen seine Zähne.
»Ihr zwei kommt jetzt mit, dann werdet ihr schon sehen, was mit Bengeln passiert, die Drahtesel klauen, bevor sie richtig trocken hinter den Ohren sind.«
»Drahtesel haben keine Ohren«, bemerkte Bernie. Max hat nie begriffen, warum er ausgerechnet das sagte, aber wahrscheinlich war er so außer sich vor Angst, dass er keine Kontrolle mehr darüber hatte, welche Worte ihm aus dem Mund rutschten.
»Gehört deinem Alten nicht die Starkonditorei?«, fragte Guy und zog an seiner West oder North State.
»Äh … ja«, antwortete Bernie.
»Der Mann kann einem wirklich leidtun«, meinte Guy.
Und damit stiefelten sie los. Das Fahrrad ließen sie in der Fichtenhecke zurück. Sie nahmen den Adlers steeg und anschließend die Adlerallee bis zum Wald, und als sie diesen erreicht hatten, gingen sie in ihn hinein. Bernie und Max als Erste, gefolgt von Guy. Keiner sagte etwas. Es war früher Abend, es muss im Juni oder August gewesen sein, entweder kurz vor oder kurz nach den Sommerferien, Max ist es später nie gelungen, sich zu erinnern. In diesem Moment spielte das jedoch keine Rolle, es sei denn, man stirbt lieber nach den großen Ferien als vor ihnen. Jedenfalls war kein Mensch im Wald. Nur Bäume, dieselben guten alten Kiefern, die dort seit ewigen Zeiten standen, und Max dachte, dass nun ihr letztes Stündlein geschlagen habe. Außerdem musste er auf einmal ganz dringend pinkeln, traute sich aber nicht, um Erlaubnis zu bitten, stehen bleiben und sich erleichtern zu dürfen.
»Stopp«, befahl Guy, als sie etwa hundert Meter in den Wald hineingekommen waren. »Die Stelle hier ist gut. Lehnt euch an Bäume … du an den und du an den.«
Er zeigte. Max und Bernie gehorchten.
Daraufhin stellte sich heraus, dass Guy van der Punck in Wahrheit zwei Seile dabeihatte, nicht bloß eins, was Max im Nachhinein oft einigermaßen seltsam vorgekommen ist. Als habe er gewusst, dass er Verwendung für sie haben würde. Als habe er das Ganze geplant. Dass sein Fahrrad gestohlen und er die Täter auf diese Weise ertappen werde. War das nicht wirklich eigenartig?
Erst schnürte er Benny sorgsam an einem Kiefernstamm fest, danach Max an einem anderen. Ungefähr fünf Meter lagen zwischen ihnen, sie standen einander zugewandt, und Max sah, dass Bernie leichenblass war und jeden Moment losheulen würde. Guy zog und zerrte ein paarmal an den Seilen, um sicherzugehen, dass sich seine Gefangenen nicht würden befreien können, woraufhin er sich eine neue West oder North State anzündete – folglich jedoch keine Zimmelmanns. Er stellte sich breitbeinig vor sie und glotzte sie an. Lächelte höhnisch, leckte sich die Lippen, rauchte und genoss es.
»Also schön«, sagte er. »Ich gehe jetzt nur kurz nach Hause und hole eine Axt. In einer Viertelstunde bin ich zurück und hacke euch den Kopf ab. Der Teufel soll euch holen, wenn ihr versucht, euch zu befreien.«
Anschließend ging er. Max und Bernie standen, wo sie standen, in diesem friedlich rauschenden Wald, und weil es jetzt auch keine Rolle mehr spielte, pinkelte Max in die Hose. Bernie sah es, verzichtete jedoch darauf, es zu kommentieren.
»Wer hätte gedacht, dass man nur zehn Jahre alt werden würde«, sagte er stattdessen. »Das ist doch nun wirklich traurig.«
»Stimmt«, sagte Max. »Meine Mutter wird nicht erfreut sein. Für meine Eltern ist es schlimmer als für deine, du hast wenigstens noch Geschwister.«
»Da hast du recht«, erwiderte Bernie und schluchzte auf, vielleicht flennte er jetzt auch los. »Aber wir sollten lieber nicht versuchen, uns zu befreien, sonst wird er nur noch wütender.«