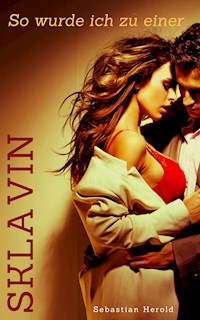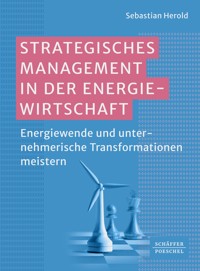
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Herausforderungen für Energieunternehmen sind so hoch wie nie zuvor. Nationale und europäische Energiewenden verlangen eine ambitionierte Dekarbonisierung. Geopolitische Verwerfungen rücken das Thema Versorgungssicherheit verstärkt ins Blickfeld. Industrieunternehmen wie Verbraucher reagieren teils sensibel auf Preise. Und die immer umfassendere Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, birgt aber auch Gefahren für angestammte Geschäftsfelder. Anhaltender unternehmerischer Erfolg ist in solchen Konstellationen keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert vorausschauende strategische Entscheidungen. Dieses Buch analysiert unter den besonderen Bedingungen der Energiewirtschaft, wie strategische Entscheidungen in dynamischen Zeiten erfolgreich getroffen werden und welche Instrumente dafür genutzt werden können. Entwicklungen im Umfeld der Energiewirtschaft spielen dabei eine ebenso zentrale Rolle wie die Berücksichtigung von Ressourcen und Fähigkeiten innerhalb der einzelnen Unternehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumHinweise zum Buch1 Strategische Befreiung und neue Erschütterungen1.1 Paukenschlag am Wochenende1.2 Abkehr von früherer Branchenlogik1.3 Kanonendonner und Energiekrise1.4 Die Grundfrage1.5 Strategie und strategisches Management1.6 Besonderheiten und Pfadabhängigkeiten1.7 Vorgehen2 Branche mit Besonderheiten2.1 Der Wert von Energie 2.1.1 Erst kommt die Energie, dann kommt die Moral2.1.2 Strom als Luxusgut2.2 Zwischen Kosten und Zahlungsbereitschaft2.2.1 Preisspielräume2.2.2 Fremdbestimmte Gaspreise2.2.3 Mit hohen Investitionen zu günstigen Kostenstrukturen2.3 Die Macht der Kommunen2.4 Grenzen der Kundennachfrage2.5 Zwischen Kampf und Kooperation2.6 Absicherungen gegen Wettbewerb2.7 Ruhe – Wohlstand – Erholung3 Wandlungen der modernen Energiewirtschaft3.1 Erzwungener Wettbewerb3.1.1 Im Stromkrieg3.1.2 Chaos in den Vorstandsetagen3.1.3 Rückbesinnung auf alte Strukturen3.1.4 Die großen Vier3.1.5 Nach der Regulierung ist vor der Regulierung3.2 Die Angebotsseite im Fokus3.2.1 Profite in der Produktion3.2.2 Strom geht an die Börse3.2.3 Parallelmarkt Systemstabilität3.3 Im Zeichen des Klimawandels3.3.1 Das größte Marktversagen aller Zeiten3.3.2 Den Staat zahlen lassen3.3.3 Ideologie monetarisieren3.3.4 Umbrüche und Trägheiten im Klimaschutz3.3.5 Erneuerbare starten gerade erst3.3.6 Enteilte politische Ziele3.3.7 Zwischen »Klimazerstörung« und »grüner Diktatur«3.3.8 Polarisierung rechts wie links4 Ziele, Konflikte und Performance4.1 Hoheit über Unternehmensziele4.1.1 Shareholder versus Stakeholder4.1.2 Roter Marx – grüner Marx4.1.3 License to operate4.1.4 Energiewirtschaft auf der Anklagebank4.1.5 Der Code des Kapitalismus4.2 David gegen Goliath4.3 Deep Purpose4.4 Kommunale Unternehmen prägen Energieversorgung4.4.1 Zielpluralismus der Stadtwerke4.4.2 Vorbehalte gegen öffentliche Unternehmen4.5 Gewinn als Zielfunktion – nicht als Zweck4.6 Ausgangspunkt des strategischen Managements4.7 Performance4.8 Kennzahlen4.9 Die Umwelt im strategischen Management5 Wendezeiten5.1 Tektonische Verschiebungen5.2 Die Ohnmacht des Energiemanagers5.3 Tiefe Einschnitte5.4 Der lange Schatten der Vergangenheit5.5 Akzeptanz von Risiken5.6 Sonnenland Deutschland5.7 Aufstieg des Sonnenkönigs5.8 Geplatzte Träume 6 Das Umfeld als prägender Faktor6.1 Umwelt im strategischen Management – PESTEL6.1.1 Political: Politisierte Energiewirtschaft6.1.2 Political: Monstertrassen6.1.3 Political: Stagnation und neue Ideen6.1.4 Political: Die Macht der Bilder6.1.5 Political: Nord Stream 2 statt Fracking6.1.6 Political: Neubewertung von CCS6.1.7 Political: Regulierung fördert Lobbyismus 6.1.8 Economic: Dynamiken von Angebot und Nachfrage6.1.9 Social: Paradigmenwechsel und Polarisierungen6.1.10 Technological: Smarte Netze und Riesenwindräder6.1.11 Ecological: Klimaziele und Kühlbedarf6.1.12 Legal: Flut an Normen6.2 Prognosen6.3 Szenarioanalysen6.3.1 Welche Perspektiven für fossile Energien?6.3.2 Ölwetten6.4 Von der weiten zur nahen Analyse7 Direkte Konkurrenz7.1 Im Zentrum der deutschen Gaswirtschaft7.2 Porters Five Forces7.2.1 Die Gefahr von Markteintritten: Festung Gasmarkt7.2.2 Die Macht der Zulieferer und Käufer: Hochspezifische Pipeline-Investitionen7.2.3 Die Gefahr von Substituten: Gas und Öl als Konkurrenten und Partner7.2.4 Die Rivalität zwischen Wettbewerbern: Familienangelegenheiten7.3 Ein neuer Player formiert sich7.3.1 Angriff von zwei Seiten7.3.2 Kampf um Marktanteile7.3.3 Vom Outlaw zum Familienmitglied7.4 Dynamik der Branchenkonstellation7.5 Boomender Markt für Wärmepumpen7.6 Ressourcen und Fähigkeiten als strategische Faktoren8 Realer Stresstest Energiekrise8.1 Die Macht der Ressourcen8.1.1 Fußgänger auf Autobahnen8.1.2 Gewagte Energiepartnerschaft8.1.3 Putins Staat, Putins Gazprom8.1.4 Gas schweißt zusammen8.2 Deutschland im Energiekrieg8.2.1 Zugeständnisse an den Angreifer8.2.2 Angst vor der Ebbe8.2.3 Gas stoppt, Pipelines explodieren8.2.4 … und es strömt weiter8.2.5 Putinologie8.3 Existenzielle Marktverwerfungen8.3.1 Unternehmen im Krisenmodus8.3.2 Tägliche Verluste in Düsseldorf8.3.3 Liquidität am Limit8.3.4 Zwei Milliarden Euro in zwei Stunden8.3.5 Stadtwerke nur bedingt handlungsfähig8.3.6 Wetten kommt vor dem Fall8.3.7 Auf Kosten der Kunden8.4 Strategische Relevanz von Ressourcen und Fähigkeiten9 Ressourcen und Fähigkeiten im Fokus9.1 Stadtwerke-Sterben?9.2 Individuelle Ressourcen und Kompetenzen9.3 Wettbewerbsvorteil – VRIO9.3.1 Value9.3.2 Rareness9.3.3 Inimitability9.3.4 Organisational support9.4 Digitale Transformation9.4.1 Digitalize or Die9.4.2 Utilities 4.09.5 Wertketten im Energieunternehmen9.6 Reifegradmodell9.7 Geschäftsmodelle9.7.1 Create Value, Capture Value9.7.2 Innovationen von Produkten und Geschäftsmodellen9.7.3 Grüner Wasserstoff9.7.4 CO2 einlagern9.8 Generische Strategien10 Erfolgsmuster und individuelle Wege10.1 Anders oder besser als die anderen10.1.1 Ein Ölkonzern auf neuen Wegen10.1.2 Ein Ölkonzern bleibt sich treu10.1.3 Flüchtiger Erfolg10.2 Generische Strategien 10.2.1 Kostenführerschaft10.2.2 Differenzierung10.2.3 Fokus10.3 Alles gleich?10.4 Stuck in the Middle10.5 Marktkontrolle und Wertangebot10.5.1 Red Ocean – Blue Ocean10.5.2 Branchenlogik durchbrechen10.6 Breite der eigenen Aktivität10.6.1 Verabschiedung vom Mischkonzern10.6.2 Zunehmende Fokussierung10.6.3 Better-off?10.7 Umsetzung von Strategie10.7.1 Anpassungen nach dem Praxiskontakt10.7.2 Das 7-S-Modell10.8 Paradox des Erfolgs11 Praxistauglichkeit als Maßstab11.1 Fit – Focus – Flexibility – Fun11.2 Wichtig ist …LiteraturverzeichnisDer AutorStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6081-1
Bestell-Nr. 10987-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6082-8
Bestell-Nr. 10987-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6083-5
Bestell-Nr. 10987-0150
Sebastian Herold
Strategisches Management in der Energiewirtschaft
1. Auflage, Dezember 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): Stoffers Grafik-Design, Leipzig, KI-generiert mit Midjourney
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Barbara Buchter, extratour, Freiburg
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Für Klaudia
Hinweise zum Buch
Der Text adressiert Unternehmen mit Blick auf ihre Rechtsform (AG, GmbH etc.) als weiblich, auch wenn er die Rechtsform nicht explizit nennt. Für Personenbezeichnungen verwendet er das generische Maskulinum, um alle Geschlechter zu inkludieren. Einzelne Durchbrechungen, in denen die männliche und weibliche Form genannt werden, sind bewusst gewählt, sollen dann aber weitere Geschlechter nicht ausschließen.
Nicht gesondert markiert sind einige wenige Eigenzitate.
Meinen Master-Studierenden danke ich für anregende Diskussionen und wertvolle Hinweise.
Darmstadt, im Juni 2024
Sebastian Herold
1 Strategische Befreiung und neue Erschütterungen
1.1 Paukenschlag am Wochenende
Wenn die zwei bedeutendsten Akteure der deutschen Energiewirtschaft in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine gemeinsame Mitteilung veröffentlichen, kündigt sich Größeres an. Es war ein März-Abend, an dem Fußballdeutschland darüber diskutierte, ob das letzte niemals abgestiegene Gründungsmitglied der Bundesliga, der Hamburger Sport-VereinHamburger Sport-Verein, nach einer fatalen 6:0-Niederlange bei den BayernBayern München in München noch eine Chance hätte, der drohenden Zweitklassigkeit zu entgehen. Die zwei Unternehmen, die um 01:15 Uhr ihre Ad-hoc-Mitteilung versendeten, waren zwar immer noch die unbestrittenen Platzhirsche unter den deutschen Energieversorgern, standen nach Jahren der Krise aber wie die Hamburger mit dem Rücken zur Wand. Nun setzten sie zum Befreiungsschlag an, für den sie auch ihre tief verwurzelte Rivalität zurückstellten:1 E.ONE.ON und RWERWE teilten ihre Konzerne untereinander neu auf und fokussierten sich fortan auf unterschiedliche Geschäftsbereiche. In diesem Zuge übernahm RWE Anteile an E.ON und stieg zu deren größter Aktionärin auf.
Als Deutschland am Sonntagmorgen aufwachte, waren aus Erzkontrahenten Verbündete geworden. E.ON-Chef Johannes TeyssenTeyssen, Johannes und sein RWE-Pendant Rolf Martin SchmitzSchmitz, Rolf Martin hatten seit Jahresbeginn in geheimen Verhandlungen die bisherigen Strukturen der beiden Unternehmen grundlegend hinterfragt und sich darauf verständigt, ihre Assets komplett neu zuzuordnen. Mit einem »Paukenschlag« (Handelsblatt) bekam die Bundesrepublik 2018 einen »Herrn der Netze« und einen »obersten Kraftwerksdirektor« (FAZ):2 E.ON erhielt neben den eigenen Netzen auch sämtliche Netze der RWE-Tochter Innogy, zudem auch deren Vertriebsaktivitäten. RWE sicherte sich zusätzlich zu den erneuerbaren Energien, die sie von Innogy zurück zur Konzernmutter holte, auch die von E.ON und schuf sich damit neben ihrem konventionellen Kraftwerkspark ein zweites Standbein in der Stromerzeugung. Die filetierte Innogy gehörte anschließend zu E.ON, an der RWE in Gegenzug einen Anteil erhielt.
Einzelne Stimmen sahen den Deal zwar skeptisch. Der Spiegel sprach von einem »Rückschritt in Zeiten des Monopols«.3 Die FAZ mahnte: »Wenn sich Konkurrenten sonntags den Markt aufteilen, ist das in einer Marktwirtschaft kein Grund zur Freude.«4 Verschiedene kommunale Energieversorger kündigten Klagen an.5 Insgesamt aber überwog die Zustimmung: Die Börsenkurse stiegen, Gewerkschaften und Politik lobten die innerdeutsche Lösung trotz eines angekündigten Jobabbaus von 5.000 Stellen und selbst der Vorsitzende der Monopolkommission hielt die Verschiebungen aus Wettbewerbssicht für eher unproblematisch.6 Das internationale Wirtschaftsmagazin Economist sah »a deal that looks good for everyone involved«.7
1 Vgl. E.ON SE 2018. Für die Anbahnung des Deals vgl. Kirchfeld und Nair 2018. Die Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung erfolgte am 11.03.2018.
2 Vgl. Flauger 2018 und Koch 2018.
3 Vgl. Dohmen 2018.
4 Vgl. Göbel 2018.
5 Vgl. VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V. 2023a, Beck-aktuell 2023 und Bundeskartellamt 2019.
6 Vgl. Flauger et al. 2018.
7 Vgl. The Economist 2018.
1.2 Abkehr von früherer Branchenlogik
Die Energiewirtschaft hatte sich in den vorausgegangenen zwei Jahrzehnten dramatisch gewandelt. Nur so waren die geringen Proteste zu erklären, welche die Ankündigung der zwei mit Abstand größten Unternehmen im deutschen Energiemarkt entfaltete, sich zukünftig aus dem Weg zu gehen und den Wettbewerb untereinander faktisch einzustellen. Während der Hamburger Sport-Verein am Ende der Saison tatsächlich in die Zweitklassigkeit abstieg und seine legendäre Stadionuhr abmontierte, die die ununterbrochene Zugehörigkeit zum Oberhaus des deutschen Fußballs anzeigte, gewannen E.ON und RWE mit ihrer strategischen Neuordnung das Vertrauen der Anleger zurück und konnten die Krisenzeiten vorerst hinter sich lassen, in denen sie als Übernahmekandidaten gehandelt wurden und RWE-Chef Schmitz sogar eine bevorstehende Pleite dementieren musste.8 EU-Kommission und das Bundeskartellamt stimmten unter geringen Auflagen zu, die Klagen anderer Energieversorger blieben erfolglos.
Mit dem Deal verabschiedeten sich E.ON und RWE endgültig von der früheren Branchenlogik, nach der Energieversorgungsunternehmen die gesamte WertschöpfungsketteWertschöpfungskette von der Erzeugung bis zum Verkauf an die Endkunden bedienten. Eine Fokussierung auf jeweils nur Teile davon passte zu den rasanten TransformationenTransformation des Energiesystems in Richtung DezentralisierungDezentralisierung, DekarbonisierungDekarbonisierung und DigitalisierungDigitalisierung, die sich wechselseitig bedingten und verstärkten. Aus einem System, in dem zentrale Großkraftwerke den schwankenden Bedarf der Stromverbraucher nachfuhren, entwickelte sich ein System, in dem Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit aufeinander reagierten. Dabei erfolgte die Erzeugung durch immer mehr Wind- und Solarstrom zunehmend volatiler und dezentraler. Viel mehr Marktteilnehmer mit viel kleinteiligeren Anlagen interagierten und konkurrierten miteinander. Gleichzeitig änderten sich die Kosten- und Preisstrukturen, da die variablen Brennstoffkosten der klassischen Kraftwerke bei Solar- und Windenergie nicht länger anfielen, ihr Kapazitätsaufbau aber hohe fixe Kosten in den Anlagen mit sich brachte. Die Netzbetreiber investierten parallel in den Ausbau der Netzinfrastruktur, um Strom aus dem windreichen Norden in den verbrauchsstarken Süden zu transportieren und in den Verteilnetzen zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Digitalisierung ermöglichte neue datenbasierte Services für Kunden, die teilweise als »ProsumerProsumer« Strom bezogen und ihn auch selbst mit heimischen Solaranlagen erzeugten oder in Elektroautos netzdienlich zwischenspeicherten.
Eine Konzentration von E.ON und RWE auf je eine Hälfte dieser Wertschöpfungskette und die damit verbundenen GeschäftsmodelleGeschäftsmodell9 versprach die Reduktion von Komplexität und eine bessere Abstimmung der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten auf die dortigen Herausforderungen. Zudem steigerte sie das eigene Gewicht im reduzierten Tätigkeitsfeld durch die wechselseitig übernommenen Assets und den Rückzug des jeweils anderen.
8 Vgl. Balzter und Meck 2016.
9 Ein Geschäftsmodell erzeugt Wert für Kunden durch den profitablen Einsatz unternehmerischer Ressourcen und Fähigkeiten und beantwortet damit die Frage, wie ein Unternehmen Geschäfte macht oder funktioniert. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt in Kapitel 9.
1.3 Kanonendonner und Energiekrise
Dem innovativen Paukenschlag von E.ON und RWE folgte vier Jahre später dumpfer Kanonendonner, der ins Bewusstsein rief, wie relevant die klassischen Themen der »alten« Energiewirtschaft bei allen Weichenstellungen auf neue Ziele weiterhin blieben. Am 24. Februar 2022 überfielRussisch-Ukrainischer KriegEnergiekrise Russland die Ukraine.10 Daraus resultierte die größte Zäsur für die Energiewirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Laufe der nächsten Monate nahm Russland auch Deutschland und Europa als ukrainische Unterstützer ins Visier. Ein Vorstoß erfolgte über die Energieversorgung. Erst drohte Russland, dann drehte es am Gashahn. In der Folge schossen die Preise von Gas in nicht für möglich gehaltene Höhen und zogen die Preise von Strom mit, dessen Produktion anteilig mit Gas erfolgte. Fragezeichen erschienen hinter der ausreichenden Verfügbarkeit von Erdgas und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Die Sicherstellung der VersorgungssicherheitVersorgungssicherheit und die Vermeidung von sozialen und industriellen Verwerfungen rückten in den Vordergrund und dominierten den energiepolitischen Diskurs auch gegenüber Nachhaltigkeitsthemen. Am Ende übernahm der deutsche Staat die wichtigsten Gasimportgesellschaften, deren finanzielle Ressourcen nicht ausreichten, um fehlendes Gas an anderer Stelle in den neuen Preisdimensionen zu beschaffen, nachdem die russische Seite die Belieferung vertragswidrig eingestellt hatte. Die Politik ebnete auch den Weg, um in Rekordtempo Anlandeterminals für Erdgas per Schiff zu errichten (LNGLNG).
Die Zeit, die Mitarbeiter von Energieunternehmen in Krisenstäben und Task-Forces verbrachten, dürfte 2022 einen einsamen Rekord erreicht haben: Die Unternehmen mussten ausbleibende russische Gaslieferungen ersetzen, sich auf eine mögliche Rationierung der Gasversorgung vorbereiten und zusätzliche Liquidität für die steigenden Gas- und Strompreise organisieren. Gleichzeitig war die Frage allgegenwärtig, was die Entwicklungen für aktuelle Geschäftsmodelle bedeutete und wie sich Unternehmen für die Zukunft positionieren sollten, um weiterhin erfolgreich zu sein – oder es wieder zu werden.
10 Eine ausführliche Darstellung der Energiekrise inklusive Quellenangaben erfolgt in Kapitel 8.
1.4 Die Grundfrage
Das ist die Grundfrage des strategischen ManagementsStrategisches Management: Warum sind einige Unternehmen erfolgreich und andere nicht? Und wie lässt sich das eigene Unternehmen aufstellen, um erfolgreich zu sein?
Endgültige Lösungen gibt es dafür nicht. Das Umfeld, in dem sich Unternehmen bewegen, wandelt sich ständig, sei es aus der Branche heraus, wie durch den EON-RWE-Deal, sei es aus weltgeschichtlichen Entwicklungen heraus, wie beim russischen Angriff, oder sei es aus politischen Vorgaben heraus, wie bei der Etablierung von LNG-Terminals und der Energiewende. Mit der Veränderung des Umfelds wandelt sich häufig auch die Strategie, die für ein Unternehmen Erfolg verspricht. Damit wandeln sich ebenfalls die dafür erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen, die das Unternehmen für die eigene Strategie benötigt. Häufig kündigen sich Veränderungen im Umfeld nicht durch Paukenschläge oder Kanonendonner an, sondern nehmen eine schleichende Entwicklung. Solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, dabei die relevanten von den weniger relevanten zu unterscheiden, die eigene Strategie rechtzeitig zu adjustieren und die dafür erforderlichen Maßnahmen im Unternehmen auch tatsächlich umzusetzen, ist eine gewaltige Aufgabe, die zu meistern selbst für erfahrene Managerinnen und Manager nicht selbstverständlich ist. Von den 30 Unternehmen, mit denen der DAX als Leitindex der Deutschen Börse 1988 startete, waren zum 35-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 nicht einmal mehr die Hälfte weiterhin dort vertreten.11
Die Aufgabe von Managern, das eigene Unternehmen erfolgreich durch unsichere Zeiten zu steuern, ist herausfordernd, die Wahrscheinlichkeit nicht (besonders) erfolgreich zu sein, ist beträchtlich. Alles dafür zu geben, es doch zu schaffen, macht Management so spannend. Bewusste oder unbewusste strategische Entscheidungen stehen dabei im Zentrum von Erfolg und Misserfolg von Unternehmen.
11 Vgl. Cünnen 2023.
1.5 Strategie und strategisches Management
StrategieStrategie ist ein vielschichtiger Begriff.12 Strategie
meint das Planen von Handlungen im Voraus unter Berücksichtigung von Zielen und eigenen Kapazitäten;
definiert Ziele und sucht nach Ressourcen und Methoden, diese Ziele zu erreichen, und passt gleichzeitig die Ziele in Abhängigkeit vom tatsächlich Realisierbaren an die verfügbaren Mittel an;
ist relevant in allen Lebensbereichen, wenn gegensätzliche Interessen im Spiel sind, wenn die eigenen Ziele mit den Zielen anderer kollidieren und wenn es darum geht, die eigenen Ziele durchzusetzen beziehungsweise die eigenen Ressourcen bestmöglich einzusetzen.
Charakteristisch ist dies insbesondere auch für den politischen und militärischen Bereich: Strategie »is about getting more out of a situation than the starting balance of power would suggest. It is the art of creating power.«13 Der preußische Generalmajor und Militärwissenschaftler Carl von ClausewitzClausewitz, Carl von beschrieb die Nähe von Politik und militärischer Auseinandersetzung sehr eingängig: »Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln«.14 Welche Akteure bei der Verfolgung ihrer Ziele auf welche Mittel zurückzugreifen, ist erst einmal offen, eine Garantie für die Einhaltung von Regeln gibt es weder im Krieg noch an anderer Stelle.15 SunziSunzi, der chinesische Meister der Strategie, formulierte bereits um das Jahr 500 vor unserer Zeitrechnung: »Die Kriegsführung gehorcht dem Prinzip der Täuschung. Der Fähige gibt sich daher den Anschein der Unfähigkeit, Einsatzbereitschaft gibt sich den Anschein von Zurückhaltung, Nähe gibt sich den Anschein von Ferne, und Ferne gibt sich den Anschein von Nähe.«16
Strategie dreht sich um Entscheidungen, die getroffen werden. Eine gute Analyse der Ausgangslage und der relevanten internen Faktoren führt dabei zu besseren Ergebnissen. Aber egal wie gut die Analyse ausfällt, sie wird nie ein vollständiges Bild zeichnen. Die Verantwortlichen treffen die Entscheidungen stets unter Unsicherheit. Von Clausewitz betonte: »Der Krieg ist das Gebiet der Ungewißheit; drei Vierteile derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit. Hier ist es also zuerst, wo ein feiner, durchdringender Verstand in Anspruch genommen wird, um mit dem Takte seines Urteils die Wahrheit herauszufühlen.«17 Der theoretische Teil der Strategie bleibt dabei Diener der praktischen Umsetzung. Winston ChurchillChurchill, Winston wird die Aussage zugeschrieben: »However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.«18
Strategie in der Sphäre der Wirtschaft ist Gegenstand des strategischen ManagementsStrategisches Management. Strategisches Management dreht sich um die Frage einer überlegenen unternehmerischen Performance: »Strategic Management is, in its essence, a company’s manifest plan of action for the ongoing creation and appropriation of value.«19
Eine überlegene Performance ist dabei ebenso abhängig von den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten wie vom Umfeld, in dem sich ein Unternehmen bewegt. Eine überzeugende Strategie stimmt beides aufeinander ab, wobei die eigene Strategie und die eigenen Ressourcen zu einem größeren Grad gestaltbar sind, das Umfeld nur begrenzt. Die in jedem BWL-Studium gelehrte SWOT-MatrixSWOT-Matrix ist eine anschauliche Darstellung der Verbindungen, die sich aus den Chancen und Risiken des Umfelds und den Stärken und Schwächen der eigenen Organisation ergeben (Abb. 1). Basis hierfür ist eine substanziierte Analyse von Umfeld und eigenen Ressourcen.
Abb. 1:
SWOT-Matrix (Eigene Darstellung)
12 Vgl. Freedman 2013, S. ix-xvi.
13 Vgl. Freedman 2013, S. xii.
14 Vgl. Clausewitz 1999, S. 44.
15 Sanktionierte Regeln inner- oder zwischenstaatlicher Ordnungen erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit für regelkonformes Verhalten.
16 Vgl. Sunzi 2013, S. 12.
17 Vgl. Clausewitz 1999.
18 Vgl. International Churchill Society 2023. Das Zitat wird, wie viele andere, Churchill fälschlicherweise zugeordnet.
19 Vgl. Amason und Ward 2021, S. 6 f. Die Frage, wie Performance zu definieren ist, diskutiert Kapitel 4.
1.6 Besonderheiten und Pfadabhängigkeiten
Die Energiewirtschaft weist einige Besonderheiten gegenüber anderen Branchen auf, denen dabei eine grundlegende Bedeutung zukommt. Beispielsweise sind Strom und Erdgas auf Netze angewiesen. Hat ein Unternehmen keinen Zugang zu den Netzen, hat es keinen Zugang zu den Kunden und bleibt vom Markt abgeschnitten, da eine parallele zweite oder dritte Netzinfrastruktur nicht wirtschaftlich wäre. Die Liberalisierung öffnete die Netze für alle Marktteilnehmer, womit sie für ihre Besitzer die strategische Eigenschaft als Machtfaktor verloren. Gleichzeitig gewann die Ausgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen an Bedeutung, die nun den Zugang zu den Netzen festlegten und die Erlöse bestimmten, welche die Netzbetreiber erzielten.
Eine andere Besonderheit ist die enge Verknüpfung zwischen Energiewirtschaft und Klimawandel. Die Energiewirtschaft als Hauptemittentin von Treibhausgasen steht unweigerlich im Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Kontroversen, wie viel Klimaschutz zu welchem Zeitpunkt mit welchen Mitteln angemessen ist. Energiewende und Wärmewende bieten große Chancen für Energieunternehmen, gehen aber auch mit gravierenden Risiken einher für bestehende und neue Geschäftsmodelle, deren Erfolg teils abhängig bleibt von der Ausgestaltung staatlicher Förderungen oder regulatorischer Rahmenbedingungen.
Energieinfrastruktur ist langlebig und durch Pfadabhängigkeiten gekennzeichnet: Neue Weichenstellungen etwa für mehr LNG oder weniger grünen Wasserstoff wirken über Jahrzehnte weiter. Genauso prägen viele Jahre zurückliegende Entscheidungen die Strukturen der Gegenwart. Ein Blick in geschichtliche Entwicklungen bietet häufig wertvolle Erkenntnisse für aktuelle Zusammenhänge. Strategische Grundkonstellationen sind zudem zu einem gewissen Grad zeitlos und lassen sich, in allen Feldern, mit etwas mehr Abstand häufig besonders klar betrachten.
Nachdem die USA den Vietnamkrieg verloren hatten, versandte das US Naval War College eine Pflichtlektüre an den neuen Jahrgang der Offiziersausbildung, auf der die Diskussion strategischer Themen in den kommenden Monaten basierte.20 Um die Niederlage zu reflektieren und Lehren daraus zu ziehen, sollten die angehenden Offiziere eintauchen in einen anderen Krieg, den nahezu zweieinhalb Jahrtausende zuvor im antiken Griechenland die damalige Vormacht Athen und das aufstrebende Sparta führten. Die Seemacht Athen unterlag nach fast drei Jahrzehnten der Landmacht Sparta und büßte ihre Hegemonie ein. Die ausführliche Schilderung dieses Peloponnesischen Krieges durch Thukydides behielt trotz aller technologischer Weiterentwicklung ihre strategische Aktualität.
Für energiewirtschaftliche Zusammenhänge reichen relevante historische Bezüge nicht bis ins antike Griechenland zurück. Für das strategische Management in der Energiewirtschaft ist aber weiter erhellend, wie Hugo StinnesStinnes, Hugo aus einem kleinen Essener Stromversorger den RWERWE-Konzern schuf, RuhrgasRuhrgas jahrzehntelang die deutsche Gaswirtschaft dominierte, BASFBASF und GazpromGazprom diese Position untergruben und wie zuerst die Liberalisierung von Strom und Gas und später die Energie- und Wärmewende etablierte Strukturen infrage stellten und neue Chancen eröffneten. Die Branche erlebte bereits mehrere Wenden mit strategischen Implikationen. Nicht nur die Dekarbonisierung stellte eine »EnergiewendeEnergiewende« dar, sondern ebenso die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes oder die Energiekrise nach dem russischen ÜberfallRussisch-Ukrainischer Krieg auf die Ukraine. Beim Segeln bezeichnet Wende ein Manöver, das einen Kurswechsel vollzieht. In ähnlicher Weise reagieren Unternehmen strategisch auf Veränderungen.
Viele energiewirtschaftliche Zusammenhänge sind global. Eine prominente Rolle nehmen dabei die internationalen ÖlunternehmenÖl ein, die ihre Geschäftsmodelle über Jahrzehnte immer wieder an veränderte Rahmenbedingungen anpassten. Gelegentlich beschritten sie dabei neue Wege, etwa als Standard OilStandard Oil, die Mutter aller modernen Öl-Majors, im 19. Jahrhundert in einigen Ländern Petroleumlampen verschenkte, um anschließend das dafür notwendige Petroleum verkaufen zu können.21
20 Vgl. Gaddis 2018, S. 60 ff. Die deutsche Reclam-Ausgabe der klassischen Schilderung des Peloponnesischen Kriegs hat 850 Seiten. Vgl. Thukydides 2000.
21 Vgl. Chernow 1998, S. 244.
1.7 Vorgehen
Die nachfolgenden Kapitel greifen aktuelle und historische Konstellationen der Energiewirtschaft auf, um strategisches Management und unternehmerischen Erfolg und Misserfolg speziell unter den Bedingungen der Energiewirtschaft zu betrachten. Die dabei angeführten Beispiele sind nicht chronologisch gegliedert, behandeln gleichzeitig aber die prägenden Ereignisse in der Entwicklung der deutschen Strom- und Gaswirtschaft und ausgewählte Aspekte internationaler Energiemärkte. Die Anordnung der Kapitel orientiert sich am Grundmuster des strategischen Managements: Die Ziele und deren Messung stehen am Beginn. Ohne klares Ziel wäre ein Kurs so gut wie jeder andere. Es folgt die Analyse erst des weiteren Umfelds und dann der näheren Branche. Die dramatischen Ereignisse nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verbinden Umfeld und unternehmerische Ressourcen und leiten über zu den unternehmensinternen Aspekten strategischen Managements. Erfolgversprechende generische Strategien und Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen in einzelnen Geschäftsfeldern und auf Konzernebene führen Umfeld und Ressourcen anschließend systematisch zusammen und bilden mit der Implementierung von Strategie und einem kurzen Fazit den Abschluss. Vorgeschaltet werfen das nächste und übernächste Kapitel einen Blick erst auf die Besonderheiten der Energiewirtschaft und dann auf die Rahmenbedingungen der modernen liberalisierten Energiemärkte. Eingebettet in das nächste Kapitel sind erste grundlegende Zusammenhänge des strategischen Managements.
2 Branche mit Besonderheiten
2.1 Der Wert von Energie
»Wie teuer müsste Strom sein, damit Sie bereit wären, auf Ihr Smartphone zu verzichten? Oder konkret: Wären Sie bereit, einen Euro für das Aufladen Ihres Smartphones zu bezahlen, wenn es Strom nicht günstiger gäbe?«
Meine Studenten nicken meist einhellig auf letztere Frage. Und ich nicke mit. Die Vorstellung eines Lebens ohne Smartphone erscheint uns mittlerweile wie aus einer grauen Vorzeit. Und eine Welt ohne Lichtschalter, Fernseher, Kühlschrank oder Computer katapultierte uns hinaus aus der bekannten Zivilisation, in der mittlerweile selbst Fahrräder motorisiert sind.
Ein Euro für eine Smartphone-Ladung entspräche einem Preis von 80 Euro (oder 8.000 Cent) je Kilowattstunde (bezogen auf die Batteriekapazität eines Smartphones, die nur einen Bruchteil einer Kilowattstunde beträgt).22 Das ist das Zweihundertfache des auf 40 Cent je Kilowattstunde gedeckelten Strompreises, den die Bundesregierung nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine als eine Art politisch zumutbaren Höchstpreis eingeführt hat. Der Nutzen, den Haushalte aus Elektrizität ziehen, liegt in vielen Anwendungen also deutlich über dem Preis, den sie tatsächlich dafür zahlen. Die Differenz zwischen ihrer maximalen ZahlungsbereitschaftZahlungsbereitschaft und dem tatsächlich realisierten Preis ist die KonsumentenrenteKonsumentenrente, die für Energie insgesamt und für Strom im Besonderen außergewöhnlich hoch ausfällt.23 Dies ist eine von verschiedenen Besonderheiten der Energiewirtschaft, mit denen sich dieses Kapitel beschäftigt.
Erst die Bereitstellungen von Energiedienstleistungen in Form von Wärme, Beleuchtung, Mobilität, technischen Haushaltshilfen oder Kommunikation ermöglichen unseren modernen Lebensstil. Analoges gilt für Produktionsprozesse in Industrie und Gewerbe und für die Staatstätigkeit. Energie stellt in diesem Sinne ein essenzielles GutEssenzielles Gut dar, dessen Nichtverfügbarkeit zu gravierenden gesellschaftlichen Folgen führt und dessen Bereitstellung deshalb immer auch staatliche Interessen berührt.24 Die Reaktion der Nachfrage auf Preisveränderungen fällt bei Energie anders aus, als es bei den meisten anderen Produkten üblich ist. Auch bei steigenden Preisen bleibt die Nachfrage nach Energie häufig (weitgehend) konstant. Normale Produkte weisen in ökonomischer Umschreibung hingegen eine preiselastische Nachfrage auf, bei ihnen reduzieren die Konsumenten ihre Einkaufsmengen mit steigenden Preisen. Passiert dies nicht, liegt eine preisunelastische Nachfrage vor.25
Russlands ÜberfallRussisch-Ukrainischer KriegEnergiekrise auf die Ukraine verknappte in Folge von Liefereinstellungen und Sanktionen das globale Angebot an Gas und Öl und verunsicherte die Energiemärkte hinsichtlich der weiteren Entwicklungen. Daraus resultierten Rekordpreise auf den europäischen Gasmärkten, die aufgrund des Einsatzes von Erdgas zur Stromerzeugung auch auf die Strommärkte abstrahlten. Die deutschen Verbraucherpreise folgen den internationalen Märkten zwar etwas abgeschwächt, da Netzentgelte und staatliche Preisbestandteile einen merklichen Anteil an ihnen ausmachen, gleichwohl kletterten sie 2022 auf bislang nicht gekannte Höhen. Um rund 300 Prozent stiegen die Gaspreise für Haushaltskunden im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr.26 Der Verbrauch der Haushalte reduzierte sich in diesem Zeitraum, unter Berücksichtigung der Witterung, aber lediglich um sechs Prozent. Eine Verdreifachung des Preises ging (kurzfristig) nur mit einer marginalen Reduzierung des Gasverbrauchs einher.
2.1.1 Erst kommt die Energie, dann kommt die Moral
Viele Menschen waren bereit, für eine behagliche Wohntemperatur deutlich mehr zu bezahlen, als sie dies bislang mussten. Sie ließen sich auch nicht nennenswert durch politische oder moralische Argumente davon überzeugen, Energie einzusparen, was unter anderem durch die Absenkung der Heiztemperatur möglich gewesen wäre. Europa rang um die Unterstützung der Ukraine und um Sanktionen gegenüber Russland und Russland setzte dieses Europa mit reduzierten Energielieferungen erheblich unter Druck. Niemand wusste im Vorfeld, ob der Winter mild oder streng und das Gas am Ende knapp werden würde. Ende September traten die Spitzen der Regierungskoalition gemeinsam vor die Presse und schilderten eine schwerwiegende Konfrontation Russlands mit Deutschland und Europa: Bundeskanzler Olaf ScholzScholz, Olaf erklärte, Russland setze »Energielieferungen als Waffe« ein, Finanzminister Christian LindnerLindner, Christian sah Deutschland »in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit« und Wirtschaftsminister Robert HabeckHabeck, Robert unterstrich »die Notwendigkeit, Energie einzusparen«.27 Eine entschlossene Antwort der Bevölkerung blieb jedoch aus, wenn die tatsächlichen Einsparungen als Maßstab gelten und die ohnehin überschaubaren sechs Prozent Einsparungen in weiten Teilen aus Preissteigerungen resultierten. Frei nach Brecht ließe sich fragen: Denn wovon lebt der moderne Mensch? Erst kommt die Energie, dann kommt die Moral.28
Noch deutlicher akzentuierten die Besitzer von ÖlheizungenHeizung ihre Prioritäten. Sie bezogen neun Prozent mehr leichtes Heizöl als im vorangegangenen Jahr – trotz Preissteigerungen von 40 Prozent, eines milden Winters und einer insgesamt rückläufigen Verbreitung von Ölheizungen zugunsten von Erdgas-Brennwertgeräten und Wärmepumpen.29 Ölheizungen verfügen über einen eigenen Ölspeicher, der das per Tanklastwagen angelieferte Öl einlagert und der nun zur Krisenvorsorge genutzt wurde.
Die europäischen Regierungen priorisierten ebenfalls die VersorgungssicherheitVersorgungssicherheit, etwa bei der Beschaffung von neuen Flüssigerdgas-Kapazitäten (LNG) im Zuge der Russlandkrise. Überwogen zuvor noch politische Vorbehalte gegen die Umweltauswirkungen amerikanischen Fracking-Erdgases, spielten diese plötzlich keine Rolle mehr.30 Mit politischer Unterstützung zeichneten die europäischen Importgesellschaften hierfür nun gerne langlaufende Lieferverträge.
Hierin zeigt sich der essenzielle Charakter von Energie: Wenn es hart auf hart kommt und Zielkonflikte bestehen, hat die Versorgungssicherheit für Kunden wie für Regierungen Vorrang. 88 Prozent der Bevölkerung gaben an, ihnen sei entweder Versorgungssicherheit am wichtigsten beim Thema Energie (48 Prozent) oder niedrige Preise (40 Prozent), die letztlich wiederum Versorgungssicherheit voraussetzen.31 Umwelt- und Klimaschutz führten zwölf Prozent als wichtigsten Aspekt an. Andersherum betrachtet: Das energiepolitische Ziel Umwelt- beziehungsweise Klimaverträglichkeit wird nur erfolgreich sein, solange Versorgungssicherheit und hinreichende Preisgünstigkeit als Nebenbedingungen gewährleistet bleiben.
Günstige Strompreise sind für die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der energieintensiven Industrie hochgradig relevant. Anders als Haushalte und Gewerbe agieren stromintensive Industriebetriebe üblicherweise im internationalen Wettbewerb, weshalb sie elastischer auf steigende Preise reagieren und ihre Produktion bei fehlender Konkurrenzfähigkeit herunterfahren oder dauerhaft verlagern. Während die Gewerbe- und Haushaltskunden ihren Stromverbrauch 2022 trotz neuer Rekordpreise leicht erhöhten, sank der Verbrauch der Industrie deutlich.32 Die Reduktionen differierten je nach Branche, am größten waren sie bei der Grundstoffchemie mit 25 Prozent.
2.1.2 Strom als Luxusgut
Eine Zahlungsbereitschaft von 8.000 Cent je Kilowattstunde aus dem Smartphone-Beispiel mag gleichwohl konstruiert wirken. Schließlich hätte ich auch 20 oder 50 Cent statt einem Euro aufrufen können. Zu Beginn der ElektrifizierungElektrifizierung lagen die Preise aber tatsächlich nicht weit davon entfernt. Die Pariser Weltausstellung von 1881 präsentierte die zwei Jahre zuvor von Thomas EdisonEdison, Thomas entwickelte Glühlampe erstmalig der staunenden europäischen Öffentlichkeit. Das elektrische Licht und seine Vermarktungsperspektiven begeisterten auch Emil RathenauRathenau, Emil, der im Nachgang die Nutzungsrechte von Edisons Patenten für Deutschland erwarb und die »Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität« gründete, die spätere AEGAEG. Auf Basis eines Vertrags mit der Stadt Berlin errichtete die Deutsche Edison 1884 die erste öffentliche Elektrizitätsversorgung im Lande, die sich als »Actiengesellschaft Städtische Electricitäts-Werke« in der Anfangszeit ganz auf Strom zu Beleuchtungszwecken fokussierte. Für das begehrte neue Licht berechneten die Elektrizitätswerke den Berlinern einen Strompreis, bei dem ihre eigenen Arbeiter für neun Lampen, die täglich drei Stunden leuchteten, 1.400 Stunden im Jahr hätten arbeiten müssen, um sich das eigene Produkt leisten zu können.33 Umgerechnet auf heutige Stundensätze entspricht dies 7.700 Cent je Kilowattstunde. Strom war in der Anfangszeit ein Luxusgut für vornehme Cafés, repräsentative Bankgebäude oder wohlhabende Privatleute.
Auch der heutige eine Euro für das Laden eines Smartphones überstiege schnell das verfügbare Einkommen von Normalverdienern, wenn der gleiche Elektrizitätspreis für Kühlschrank, Licht und Herd aufzuwenden wäre. Aber davon ist der Strompreis sehr weit entfernt. Der durchschnittliche Haushaltspreis lag vor dem russischen Überfall bei 32 Cent je Kilowattstunde und stieg im Laufe des Jahres 2022 auf 40 Cent je Kilowattstunde, ohne dass dies zu Nachfragerückgängen geführt hätte.34 Warum aber profitieren Energieversorgungsunternehmen nicht stärker von dieser Zahlungsbereitschaft der Kunden und warum haben sie die Preise nicht schon viel früher angehoben? Die offensichtliche Antwort ist, dass dies im Wettbewerb mit anderen Anbietern nicht durchsetzbar gewesen wäre. Und das führt zu grundlegenden Zusammenhängen des strategischen Managements.35
2.2 Zwischen Kosten und Zahlungsbereitschaft
Ein Unternehmen ist mit seinen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich, wenn Kunden diese höher wertschätzen als die verfügbaren Alternativen und die Kosten des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt dann einen WettbewerbsvorteilWettbewerbsvorteil, der in dem Grund liegt, aus dem Kunden dem Unternehmen einen profitablen PreisPreis zahlen. Eine Grenze für den Preis ist die maximale ZahlungsbereitschaftZahlungsbereitschaft der Kunden, ab dem die Kunden lieber auf das Produkt verzichten, anstatt den Preis zu bezahlen. Diese Grenze liegt für jeden einzelnen Kunden unterschiedlich hoch. Eine zweite Grenze ergibt sich aus den verfügbaren Alternativen von Wettbewerbern, die als gleichwertige, höherwertige oder gerade noch akzeptable Option in Betracht kommen, um den jeweiligen Kundenbedarf zu befriedigen. Deren wahrgenommenes Preis-Leistungs-Verhältnis begrenzt den akzeptierten Preis ebenfalls. Die schärfere dieser beiden Grenzen gibt den Ausschlag und lässt nur dann Raum für ein profitables Angebot, wenn die KostenKosten des Unternehmens niedriger liegen. Kurzfristig relevant sind die variablen Kosten, längerfristig die Gesamtkosten. Abb. 2 verdeutlicht die Zusammenhänge grafisch. Es ist Teil der täglichen Herausforderungen von Managerinnen und Managern, sich »zwischen Umsatz und Kosten zu stellen und diese beiden Variablen, die offenbar eine natürliche Tendenz zur Annäherung besitzen, auseinanderzuhalten«, um das Überleben des Unternehmens zu sichern.36
Abb. 2:
Preisspielraum des Unternehmens (Eigene Darstellung in Anlehnung an Simon und Fassnacht 2016, S. 99)
Ein Unternehmen ist umso profitabler, je weiter es den Abstand zwischen den Kosten seines Produkts und der Zahlungsbereitschaft seiner Kunden für das Produkt vergrößern beziehungsweise halten kann. Letzteres hängt maßgeblich von Konkurrenzprodukten ab, die sich dynamisch weiterentwickeln. Der sicherste und bequemste Wettbewerbsvorteil ist daher einer, der den Wettbewerb dauerhaft unterbindet und damit die Konkurrenzprodukte aus der Gleichung herausnimmt. Selbst wenn es tatsächlich keinen direkten Wettbewerb gibt, weil Wettbewerber keinen Zugang zu dem entsprechenden Markt haben, bleibt aber die maximale Zahlungsbereitschaft als Grenze. Im abgeschirmten Gelände des Fußballstadions, in dem nur ein Getränkeanbieter ausschenkt, zahlen die Zuschauer höhere Preise für ein Bier als im Supermarkt, aber auch hier gibt es eine Schmerzgrenze. Die ist individuell unterschiedlich hoch und sicher auch davon abhängig, wie warm das Wetter ist und ob gerade Abstiegsrettung oder Meisterschaft in greifbare Nähe rücken. Aber es gibt sie. In aggregierter Form resultiert daraus die typische fallende Nachfragekurve, bei der ein hoher Preis mit niedrigerer Menge und ein niedriger Preis mit höherer Menge einhergeht.
2.2.1 Preisspielräume
Die maximale ZahlungsbereitschaftZahlungsbereitschaft für Energie ist sehr hoch, aber nicht unbegrenzt, wie die Verbrauchsrückgänge von Industriekunden im internationalen Wettbewerb im Zuge der Russlandkrise demonstrierten und die endlichen Einkommen von Haushalten anzeigen, aus denen diese auch noch weitere (essenzielle) Produkte erwerben müssen. Selbst ein Energieversorger als theoretisch uneingeschränkter MonopolistMonopol mit GewinnmaximierungGewinnmaximierung als Ziel müsste also berücksichtigen, dass höhere Preise zu Mengenrückgängen führen und ein noch höherer Preis deshalb nicht immer ein lukrativerer Preis ist. Vielmehr gibt es für den Monopolisten einen gewinnmaximalen Preis, bei dem Preis- und Mengeneffekte auf der Erlösseite ideal untereinander und mit der Kostenseite ausbalanciert sind.37
Das Kalkül fällt noch einmal anders aus, wenn der Monopolist nicht einen einheitlichen Preis für alle Kunden erhebt, sondern verschiedene Preise setzen kann. StromStrom und ErdgasErdgas benötigen besondere Leitungen für ihren Weg zum Endkunden und können mit vertretbarem Aufwand auch nicht anderweitig transportiert werden (Netz als Essential FacilityEssential Facility). Als eine Folge davon wird es für die Kunden faktisch unmöglich, Strom und Erdgas ohne Unterstützung ihrer Lieferanten weiterzuverkaufen. Energieversorgungsunternehmen können ihren Kunden somit nicht nur vertraglich untersagen, ihre Produkte zu handeln, solange eine solche Untersagung rechtlich zulässig ist, sondern dies auch ohne nennenswerten Aufwand durchsetzen. Das folgt unmittelbar aus der leitungsgebundenen Struktur der Industrien und wird für die Stromwirtschaft noch dadurch verstärkt, dass Elektrizität selbst mit fortschrittlicher Batterietechnik in größerem Umfang nur sehr aufwendig zu speichern ist und es früher faktisch gar nicht war. Wenn Kunden Strom untereinander nicht weiterverkaufen und damit unterschiedliche Bezugspreise nicht angleichen können, eröffnet sich für Energielieferanten im Monopol die Möglichkeit, Preise zu differenzieren.
Aus der Option zur PreisdifferenzierungPreisdifferenzierung resultiert ein zusätzliches Gewinnpotenzial. Bei Preisdifferenzierung wird es möglich, die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften umfassender auszuschöpfen, die Gruppen oder einzelne Kunden für das Produkt besitzen. Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft zahlen hohe Preise, Kunden mit geringerer Zahlungsbereitschaft niedrigere Preise, solange diese für den Anbieter noch lukrativ sind. Die Ausdehnung der Menge durch Absenken des Preises für einen Kunden oder eine Gruppe von Kunden reduziert nun nicht mehr den Preis für alle Abnehmer, was das Kalkül für die gewinnmaximal anzubietende Menge ändert. Diese wird gegenüber der Monopollösung mit einheitlichem Preis ausgedehnt und erreicht im Falle einer individuellen Preisdifferenzierung ihr Maximum, bei dem alle Kunden Angebote mit individuellen Preisen unterbreitet werden, solange ihre Zahlungsbereitschaften oberhalb der Kosten für die Angebotsausdehnung liegen.38
Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen vor der Liberalisierung nutzten die Möglichkeit zur Differenzierung bei ihrer Preissetzung, auch wenn sie von einer individuellen Ausgestaltung weit entfernt blieben. Mit Blick auf unterschiedliche Tarife für Sonderabnehmer, Haushaltsabnehmer, gewerbliche Lichtabnehmer, gewerbliche Kraftabnehmer und landwirtschaftliche Abnehmer monierte die Monopolkommission in den 1970iger-Jahren »eine Politik der Gewinnmaximierung durch Preisdifferenzierung entsprechend den unterschiedlichen Elastizitäten der Nachfrage«.39
2.2.2 Fremdbestimmte Gaspreise
Auch die PreiseGaspreis von Erdgas variierten lange Zeit von Kundengruppe zu Kundengruppe. Die Lieferanten spiegelten damit die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften der Segmente, welche durch die jeweils einsetzbaren Substitute bestimmt wurden:40 für Haushalte leichtes Heizöl, für die Industrie je nach produktionstechnischen Gegebenheiten leichtes Heizöl oder günstigeres schweres Heizöl oder – in besonderen Fällen – noch günstigere Kohle. Die Idee des anlegbaren GaspreisesGaspreis, anlegbarer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es, für alle Kundengruppen – und im Falle größerer Industriekunden auch individuell – einen Preis einzustellen, der dem jeweiligen Substitut entsprach. Liberalisierung und diskriminierungsfreier Netzzugang für Dritte lagen damals noch in weiter Ferne. Eine formeltechnische Indexierung des Gaspreises an den jeweiligen Preis für leichtes oder schweres Heizöl beziehungsweise an Kohle gewährleistete den Gleichlauf mit der jeweiligen Substitutionsenergie.
Die Ölpreisbindung entwickelte sich zur klassischen Form der kontinentaleuropäischen GaspreisbildungGaspreis. Mit ihr ist auch die Erfolgsgeschichte der deutschen GaswirtschaftGaswirtschaft verknüpft, die sich binnen weniger Jahrzehnte zu einem Pfeiler der deutschen Energieversorgung entwickelte. Der Anteil des Erdgases am Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik betrug im Jahr 1960 0,4 Prozent und stieg bis 1994 (letzter Wert für die »alten« Bundesländer) auf 18,5 Prozent an. Als Newcomer galt es für Erdgas, Öl und zum Teil auch Kohle als etablierte Platzhirsche zu verdrängen. Dies geschah mithilfe des anlegbaren GaspreisesGaspreis, anlegbarer, nach dem die Gasverbraucher einen Preis zahlten, der Erdgas gegenüber der jeweiligen Konkurrenzenergie wettbewerbsfähig hielt.
Kundengruppen mit günstigen Substitutionsoptionen in Form von schwerem Heizöl oder Kohle, die bei einem einheitlichen Gaspreis nicht mehr bedient worden wären, profitierten von dem Preismodell. Umgekehrt zahlten Kunden mit teuren Substitutionsmöglichkeiten vergleichsweise hohe Preise. Sichere Absatzgebiete und komfortable Gewinnmargen erleichterten es der Gasindustrie, die Infrastruktur weiter auszubauen und jahrzehntewährende Verträge mit Produzenten in weit entfernt liegenden Regionen in der norwegischen Nordsee und in Sibirien einzugehen.41 Die langfristig angelegten Partnerschaften mit preislicher Indexierung an die globale Commodity Öl, in die jeweils die eine Seite exklusiv die Gasquellen und die andere Seite den Gasabsatz einbrachte, entschärften durch eine wechselseitige Abhängigkeit die sogenannte Hold-upHold-up-Problematik. Diese entsteht aufgrund der Möglichkeit eines Partners, geschlossene Verträge infrage zu stellen (opportunistisches Verhalten), nachdem die andere Seite in die neue Infrastruktur zur physischen Realisierung der neuen Lieferwege investiert hat und damit an den neuen Partner gebunden ist (Lock-in).42
2.2.3 Mit hohen Investitionen zu günstigen Kostenstrukturen
Die Leitungsgebundenheit von Strom und Gas erforderte in den Anfangszeiten der Industrien den Aufbau einer komplett neuen und sehr kapitalintensiven Infrastruktur, die für nichts anderes als für den Transport von Gas bzw. Strom zu verwenden war (hohe Faktorspezifität). Nicht mehr genutzte Leitungen wären, genauso wie nicht mehr genutzte Kraftwerke, weitgehend wertlos und damit Stranded AssetsStranded Assets. Die Monopolkommission verweist in ihrem ersten Hauptgutachten für die Jahre 1973/1975, in dem sie sich skeptisch zeigt, ob es denkbar wäre, die Stromwirtschaft in einen Wettbewerbsmarkt zu überführen, auf diese »außerordentliche Kapitalintensität« und die langen Amortisationszeiten der Elektrizitätswirtschaft, die dreimal so hoch ausfielen wie im verarbeitenden Gewerbe.43
Hugo StinnesStinnes, Hugo rang wiederholt mit dem hohen Kapitalbedarf und der Notwendigkeit, immer neue Mittel zu mobilisieren, als er Anfang des 20. Jahrhunderts die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft (RWERWE) vom kleinen Essener Stadtwerk zum größten Stromversorger Deutschlands ausbaute.44 Seine Vision lag nicht nur darin, immer mehr Gebiete mit Leitungen zu durchziehen und sie damit für das Produkt StromElektrifizierung zu erschließen. Er sah auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, die Stromversorgung als größeres System zu denken. Soweit es vor Ort überhaupt schon Strom gab, konzentrierten sich die Stadtwerke bis dahin auf ihr jeweiliges Gebiet und den damit verbundenen Absatz, der vornehmlich durch Strom für Beleuchtung bestimmt war, die sich aber nur ein Teil der Menschen leisten konnte. Die 1898 zur Stromversorgung der Stadt Essen gegründete RWE bildete anfangs keine Ausnahme. In einem Schuppen produzierte sie Strom mit dem Generator einer Dampflokomotive, der es auf 0,15 Megawatt brachte. Der Zechenbesitzer und Kohlenhändler Hugo Stinnes gehörte als Nichtaktionär dem ersten Aufsichtsrat der RWE an, weil er Eigentümer des Grundstücks war, auf dem das Elektrizitätswerk errichtet wurde. Die Lage unmittelbar auf dem Zechengelände versprach eine besonders preisgünstige Versorgung mit Kohle.
Als die bisherigen Hauptaktionäre in der Wirtschaftskrise 1901/02 ihre Anteile verkaufen mussten, erwarb Stinnes in einem Konsortium zusammen mit dem Industriellen August ThyssenThyssen, August die Mehrheit an RWE. Sie tauschten den Aufsichtsrat fast komplett aus. Stinnes übernahmen dessen Vorsitz und bestimmte die weitere Entwicklung der RWE, die fortan neue Absatzgebiete im Ruhrgebiet und Rheinland erschloss und ihre Erzeugungskapazitäten massiv ausbaute. Das Essener Werk erhielt erst mehrere 0,5-Megawatt-Anlagen, dann eine 5-Megawatt-Turbine. Seine aggregierte Leistung steigerte es bis 1908 auf 22 Megawatt. Die Produktion einer Kilowattstunde Strom in immer größeren Kraftwerken versprach immer günstiger zu werden (Größenvorteile). Mit Hütten und Zechen, die eigene Elektrizität erzeugten, schloss RWE zusätzlich Gegenseitigkeitsverträge, über die RWE tagsüber Strom lieferte und am späten Nachmittag, zu Zeiten ihres Licht-Spitzenbedarfs, Strom bezog. Auf diese Weise steigerte RWE ihre Stromlieferungen kurzfristig weiter und hielt gleichzeitig die teuren Kapazitäten für die Deckung des Spitzenbedarfs gering.
Eine weitere Kostenreduktion versprach der Einsatz von BraunkohleKohle zur Kraftwerksbefeuerung, die im Gegensatz zur Steinkohle im preiswerteren Tagebau gewonnen wurde. Ein Transport der Braunkohle aus den abseits gelegenen Regionen, in denen sie vorkam, war aufgrund ihres hohen Wassergehalts aber zu teuer. RWE löste das Problem, indem sie Kraftwerke direkt in den Förderrevieren errichtete und über damals innovative Hochspannungsleitungen Strom statt Kohle zu den Abnahmezentren transportierte. Das neue Braunkohlewerk in Knappsack dimensionierte RWE auf aggregiert 240 Megawatt.
Die Realisierung von GrößenvorteilenGrößenvorteile machte sich für RWE bezahlt und verschaffte ihr Flexibilität.45 RWE war in der Lage, Preise zu senken, wenn ihr dies zur Ausweitung ihres Absatzes unternehmerisch sinnvoll erschien. Kurz nachdem Stinnes den Kurs bestimmte, reduzierte das Unternehmen den Lichtstromtarif von 60 auf 40 Pfennig je Kilowattstunde und konnte so neue gewerbliche Großabnehmer gewinnen und mit weiteren Kommunen Stromlieferungsverträge schließen. Ebenso nutzte RWE einige Jahre später die günstige Produktion von Braunkohlenstrom, um damit die chemische Industrie und andere Großabnehmer als Kunden zu akquirieren. Zur gleichen Zeit hielt sie hingegen ihre Verbrauchertarife für Lichtstrom und für Kraftstrom weitgehend konstant.46 Es ging nicht darum, ohne Kalkül Geschenke zu verteilen.
RWE hatte sich einen Kostenvorteil erarbeitet, der sie in eine andere Liga als selbst größere Stadtwerke hob. Im Jahre 1913 produzierte RWE eine Kilowattstunde für 5,8 Pfennig Selbstkosten, während die Stadtwerke HannoverStadtwerke Hannover und NürnbergStadtwerke Nürnberg 22 und die Stadtwerke StettinStadtwerke Stettin 38 Pfennig aufwendeten.
36 Vgl. Simon 2020, S. 104.
37 In modelltheoretischer Betrachtung entspricht im Gewinnmaximum der Grenzerlös den Grenzkosten (»Cournot-Punkt« im mikroökonomischen Standardmodell zur Monopolpreisbildung). Ein höherer Preis führt von diesem Punkt aus ebenso wie ein niedrigerer Preis zu geringeren Gewinnen.
38 Mengenseitig entspricht dies der ökonomischen Gleichgewichtslösung im vollkommenen Wettbewerb. Der Unterschied auf der Preisseite führt dazu, dass in diesem theoretischen Extremfall die gesamte vorherige Konsumentenrente nun dem Anbieter zufließt und Teil der Produzentenrente wird.
39 Monopolkommission 1976, S. 410.
40 Vgl. Herold 2012, S. 68–79.
41 Die Öl- und Gasproduzenten profitierten zudem davon, dass sie endliche natürliche Ressourcen vermarkteten, deren Begrenztheit nach dem Hotelling-Modell selbst in einem Wettbewerbsmarkt eine Knappheitsprämie oberhalb der Kosten erwarten ließ. Vgl. Hotelling 1931.
42 Ausführlicher dazu Kapitel 7. Zur Hold-up-Problematik vgl. Erlei et al. 2016, S. 178–182.
43 Vgl. Monopolkommission 1976, S. 382 und 417 ff.
44 Vgl. Pohl 1992, S. 10–20 und 37–42, und Feldman 1998, S. 249 ff.
45 Vgl. Pohl 1992, S. 16 und 40, und Becker 2021, S. 27.
46 Unterschiedliche Preise für Licht- und Kraftstrom sind ebenfalls eine Form der Preisdifferenzierung, die eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft desselben Kunden für verschiedene Einsatzgebiete abschöpft.
2.3 Die Macht der Kommunen
In einem normalen Markt hätte RWERWE bei diesem Kostenvorteil lokale StadtwerkeStadtwerke als Stromerzeuger verdrängen können. Die Leitungsgebundenheit von Strom verhinderte dies in zweifacher Weise. Einmal wirkten hier ökonomische Kräfte, die zu einem natürlichen MonopolMonopol, natürliches führten.47 Es ist teuer und kapitalintensiv, ein StromStromnetz- oder GasnetzGasnetz zu errichten. Diese hohen Fixkosten gehen mit vergleichsweise geringen variablen Kosten einher. Bis zur Kapazitätsgrenze ist es sehr günstig, die Belieferung auf weitere Abnehmer auszudehnen. Selbst wenn neue Leitungen gebaut werden müssen, können diese in einem bestehenden Netz von vorhandenen Leitungen abzweigen. Außerdem ist ein Netz mit größerer Kapazität von vornherein günstiger als zwei mit geringerer, da unter anderem die Materialkosten bei Leitungen unterproportional zu den Kapazitäten steigen und Verbrauchsschwankungen sich innerhalb eines Netzes besser ausgleichen. Längerfristig behauptet sich deshalb nur ein Anbieter je Netz.
Das allein hätte noch nicht ausgeschlossen, dass RWE Stadtwerken die Stellung als natürlicher Monopolist streitig macht. Mit ihrem überragenden Kostenvorteil hätte sie drohen können, eine parallele Infrastruktur aufzubauen, wenn die Stadtwerke nicht ihre verkaufen. Es war aber noch ein anderer, stärkerer Player involviert. Die KommunenKommunen als staatliche Instanz verhinderten, dass eine Verdrängung ungesteuert stattfinden konnte. Um Leitungen in oder über den Straßen verlegen zu dürfen, benötigten Energieversorger damals wie heute die Zustimmung der jeweiligen Kommune, die in KonzessionsverträgenKonzession gewährt wird, wie sie in Deutschland erstmalig in Berlin die »Actiengesellschaft Städtische Electricitäts-Werke« abschloss, und die üblicherweise mehrere Jahrzehnte laufen, bevor sie neu vergeben werden. Die Kommunen waren in der Regel bereits als Wasserversorger tätig. Es lag aus ihrer Sicht nahe, auch die Gas- und die Stromversorgung selbst zu übernehmen, was zu der heutigen Struktur des deutschen Energiemarktes mit Hunderten kommunalen Stadtwerken führte. Bei einem so wichtigen Gut wie Strom war es schwer vorstellbar, dass der Staat einem privaten Unternehmen das Monopol frei überließe. Die Frage war weniger, ob es einen staatlichen Einfluss gäbe, sondern wie und in welchem Umfang dieser realisiert werden würde.
Für die Ausweitung ihres Marktes musste RWE also nicht die Letztverbraucher als Kunden überzeugen, sondern sich in oft langwierigen Verhandlungen mit den Kommunen verständigen. Im Erfolgsfall erhielt RWE in noch unerschlossenen Gebieten die Konzession oder belieferte bestehende kommunale Stadtwerke mit Strom, an denen sie möglichst auch Anteile übernahm.48 Eine weitere Möglichkeit bestand darin, Unternehmen mit ihren Konzessionen zu erwerben. In der Folge etablierten sich bei RWE zwei verschiedene Lieferstrukturen: Teils belieferte RWE Stadtwerke, die ein eigenes Verteilnetz betrieben, teils investierte sie selbst in die Verteilnetze und belieferte dann die Letztverbraucher direkt. Im Gegenzug öffnete sich RWE für eine Beteiligung der Kommunen am eigenen Unternehmen, die damit die Finanzierung des weiteren Ausbaus stützten. 1911 befand sich etwas mehr als ein Drittel der Aktien in den Händen von Gemeinden und Landkreisen, die auch 14 der 25 Aufsichtsratsmitglieder stellten. RWE pflegte die Beziehung zu ihren Kommunen und Gremienmitgliedern und zahlte den Bürgermeistern und Landräten im Aufsichtsrat hohe Tantiemen, die ihren regulären Beamtengehältern entsprechen konnten.
Hjalmar SchachtSchacht, Hjalmar, der spätere zweimalige Reichsbankpräsident, beschrieb die Situation auf dem deutschen Strommarkt als zeitgenössischer Beobachter wie folgt: »Erwarb man bestehende Elektrizitätswerke, so erwarb man damit auch deren Wegerechte. Es ist bezeichnend, daß es sich für ein wirtschaftlich arbeitendes, großes Werk rentierte, kleine Werke, die es bei freier Wegenutzung [...] mit Leichtigkeit niederkonkurrenziert hätte, lediglich wegen ihrer Wegerechte zu erwerben. Nicht die Produktionsanlagen werden bezahlt, sondern das Monopol, welches unsere Rechtsverfassung diesen garantiert.«49
Im Jahr 1907 gab es in Deutschland 1.530 ElektrizitätswerkeElektrizitätswerke der öffentlichen Versorgung, die im Durchschnitt über eine Anschlussleistung von 0,7 Megawatt verfügten. Ihre Wirtschaftlichkeit stellten die kleineren Werke, soweit sie nicht auf günstige WasserkraftWasserkraft zurückgreifen konnten, durch hohe StrompreiseStrompreis sicher. Die Strompreise in Deutschland streuten zwischen 7 und 60 Pfennig je Kilowattstunde.
47 Für einen Überblick über die Ökonomie des natürlichen Monopols vgl. Fritsch 2018.
48 Vgl. Pohl 1992, S. 21–36, und Becker 2021., S. 27.
49 Vgl. Schacht 1908, Zitat auf S. 98. Schacht war erst in der Weimarer Republik und dann noch einmal unter den Nationalsozialisten Reichsbankpräsident und zwischenzeitlich auch Reichswirtschaftsminister. Im Nürnberger Prozess wurde er als Führungsperson des Dritten Reichs angeklagt, aber freigesprochen. Zur Zeit des Zitats arbeitete Schacht für die Dresdner Bank und hatte beruflich mit der RWE zu tun.
2.4 Grenzen der Kundennachfrage
Die Haushalts- und kleinen Gewerbekunden waren für die Energieversorgungsunternehmen sichere Abnahmegruppen, da sie keine Alternative zu dem einen Stromanbieter hatten, der vor Ort über die Konzession verfügte. Mit zunehmender Elektrifizierung der Haushalte wuchs deren Strombezug, was geschicktes Marketing noch unterstützte. Die Elektrizitätswerke MünchenStadtwerke München boten in den 1930er-Jahren Vorträge über elektrisches Kochen und umfangreiche Koch- und Backkurse an, die sich großer Beliebtheit erfreuten.50 Allein 1938 zählten sie 3.000 »Hausfrauen« in ihren Vorträgen und berieten 350 in Hausbesuchen (die zeitgenössischen Rollenbilder waren eindeutig).
Größere Industriebetriebe hingegen hatten eine Alternative – den Strom selbst zu produzieren.51 Eine eigene Stromproduktion war für sie häufig die Ausgangslage, wenn die Frage Make-or-BuyMake-or-Buy relevant wurde. Erste Schritte in das elektrische Zeitalter gingen viele Unternehmen über Einzelanlagen, die vor Ort den Strom für ihre Beleuchtung und andere Anwendungen erzeugten. Diese etablierten sich bereits einige Jahre vor Beginn der ersten öffentlichen Stromversorgung, deren Ausbau sich zudem über Jahrzehnte erstreckte. BASFBASF illuminierte ab 1887 ihren Eingangsbereich mit Bogenlampen. Den Strom erzeugte vor Ort eine kleine Dynamomaschine von 0,01 Megawatt, der später immer größere Anlagen folgten. Innerhalb von zehn Jahren überschritt die Leistung die Ein-Megawatt-Grenze, als zur wachsenden Zahl von Lampen auch Elektromotoren und erste Elektrolyse-Anwendungen hinzukamen. Die EigenproduktionEigenproduktion blieb auch nach dem Anschluss an das öffentliche Netz für viele Industrieunternehmen weiterhin eine Option, die sie auch praktizierten. Bei BASF in Ludwigshafen stieg die elektrische Erzeugungskapazität im Zeitablauf auf 1.100 Megawatt an, die sich auf drei Kraftwerke verteilten.
Andere Unternehmen nahmen die Unsicherheit, die sie während der EnergiekriseEnergiekrise 2022 bei Versorgungssicherheit wie bei Preisen erfuhren, zum Anlass, die Eigenerzeugung zu forcieren. VeltinsVeltins-Generalbevollmächtigter Michael HuberHuber, Michael erklärte: »In spätestens acht bis zehn Jahren bezieht Veltins zu 100 Prozent erneuerbare Energien. Wir wollen bis zu sechs Windräder auf unserem Gelände aufstellen, drei sind schon genehmigt. Allein in Windkraft investieren wir 65 Millionen Euro. Parallel haben wir Photovoltaik installiert. Auch über Biogas denken wir nach, um autark zu werden. Vor zwei Jahren mussten wir bangen, dass uns das Gas abgedreht wird. So etwas wollen wir nicht noch einmal erleben.«52
Lange Zeit war die eigene Stromproduktion größeren Industrieunternehmen vorbehalten, die mit hohem technischem Aufwand Generatoren installierten. Heute kann jeder Hauseigentümer eine Solaranlage auf seinem Dach montieren und jeder Balkonbesitzer Solarplatten vor die Brüstung hängen. Aus Konsumenten werden so ProsumerProsumer, die weiter am Netz angeschlossen sind, je nach Sonnenschein aber mal dort einspeisen und mal von dort Strom beziehen. Die Wirtschaftlichkeit solcher privaten Lösungen setzte Fortschritte in der Technik voraus, die die Bedeutung von GrößenvorteilenGrößenvorteile reduzierte. Zudem profitierte die Eigenerzeugung davon, dass ihr Strom keine Netzkosten trug.
50 Vgl. Bähr und Erker 2017, S. 133.
51 Vgl. Fischer 1992, S. 39–45, Abelshauser 2002, S. 81, und UBA Umweltbundesamt 2023a.
52 Vgl. Terpitz 2024.
2.5 Zwischen Kampf und Kooperation
RWERWE blieb in der Anfangszeit der Elektrifizierung nicht das einzige Unternehmen, das die offensichtlichen Größenvorteile in der Stromwirtschaft nutzen wollte.53 Und die KommunenKommunen blieben nicht die einzigen staatliche Akteure, die sich unternehmerisch in der Elektrizitätswirtschaft betätigen wollten. Im föderalen deutschen System zeigten das Reich wie auch die Länder Ambitionen, die weit über das Setzen von rechtlichen Rahmenbedingungen hinausgingen und motiviert waren von einer Mischung aus wirtschaftlicher Entwicklungsförderung, Postulat einer grundsätzlichen Zuständigkeit des Staates für die Elektrizitätswirtschaft (als natürliches MonopolMonopol, natürliches