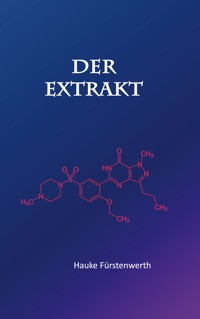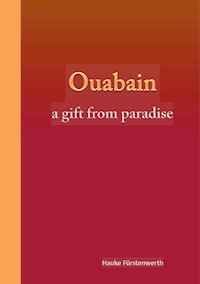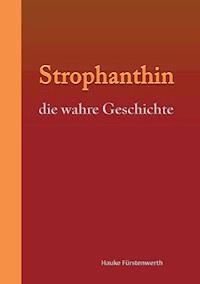
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Strophanthin ist ein Herzmedikament. Es gehört zur Klasse der herzaktiven Steroidglykoside und wird wie diese aus Pflanzen gewonnen. Bis in die 1980er Jahre hinein ist es in Deutschland zur Behandlung von Herzinsuffizienz eingesetzt worden. Wie kaum ein anderes Medikament hat Strophanthin die Zunft der Ärzte in Deutschland polarisiert. Von Befürwortern wurde es als Insulin des Herzens gefeiert, von Gegnern als Placebo verunglimpft. Euphorisches Lob und vernichtende Kritik prägten einen überaus polemischen und emotional geführten Streit zwischen praktischen Ärzten und Hochschulklinikern. Auch heute noch wird Strophanthin heftig und kontrovers diskutiert. Das Buch schildert Aufstieg und Fall des Strophanthins. Hauke Fürstenwerth präsentiert eine objektive, an belegbaren Fakten orientierte Aufarbeitung der wahren Geschichte des Strophanthins. Mit bisher nicht bekannten Tatsachen schildert er die wechselvolle Geschichte dieses Arzneimittels. Die Geschichte des Strophanthins ist nicht abgeschlossen. Aktuelle Forschungsergebnisse ermöglichen eine neue Interpretation der langjährigen therapeutischen Erfahrungen. Strophanthin verfügt über ein nicht ausgeschöpftes therapeutisches Potenzial. Das Buch zeigt auf, wie Strophanthin zum Nutzen von Herzpatienten wieder zugelassen werden kann. Die Geschichte des Strophanthins ist eingebunden in die Entwicklung von Pharmazie und Medizin. Patienten werden heute auch ohne Krankheitssymptome medikamentös behandelt. Das statistische Risiko für eine zukünftige Krankheit ist als eigenständiges Krankheitsbild etabliert worden. Richtwerte für Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker definieren eine Krankheit. Auch dieser Wandel ist Teil der Strophanthin Historie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Ich danke Frau Dr. Kern-Benz, Stuttgart, für die Überlassung von umfangreichen Unterlagen zum Wirken von Dr. Berthold Kern
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
William Withering und der Rote Fingerhut
Vom Pfeilgift zum Medikament
Info Box: Herzglykoside
Schmiedeberg und das Digitalin
Die Qualität von Digitalispräparaten
Die intravenöse Strophanthintherapie
Das Kombetin
Ernst Edens - die Behandlung der Angina pectoris
Info-Box: Das Herz und seine Funktion
Berthold Kern und die Linksinsuffizienz
Info Box: Herzinsuffizienz
Die orale Strophanthin-Behandlung
Strophoral
Der Strophoralstreit
Bioverfügbarkeit
Herzinfarkt
Berthold Kern und die Linksmyokardiologie
Das Heidelberger Tribunal
Das Arzneimittelgesetz
Endogenes Ouabain
Ouabain und seine Wirkungen
Ouabain und die Koronarinsuffizienz
Ouabain und der Energiehaushalt des Herzens
Ouabain und Digitalis
Ouabain schützt die Niere
Paradigmenwechsel in der Pharmaforschung
Medizin und Wissenschaft
Venture Capital
Cornavita
Literaturverzeichnis
Vorwort
„Es wird einmal die Zeit kommen, in der man die Unterlassung der rechtzeitigen Strophanthinbehandlung von Angina pectoris als Kunstfehler verurteilen wird.“ Mit dieser Prophezeiung fasste der an der Universität Düsseldorf lehrende Internist Ernst Edens (1876 – 1944) 1943 seine Erfahrungen mit dem Herzglykosid Strophanthin zusammen. 1985 konstatierte der Münchener Kardiologe Erland Erdmann: „es besteht keine gesicherte Indikation mehr für Strophanthin, sei es oral, perlingual oder intravenös.“ Worin lag dieser Sineswandel begründet? Aus welchen neuen Erkenntnissen konnte Erdmann seine Einschätzung ableiten? Es gab keine Studien in denen Strophanthin mit neuen Medikamenten verglichen worden war und sich als unterlegen erwiesen hatte. Erdmanns Darstellung markierte den Schlusspunkt einer über Jahrzehnte hinweg verbissen ausgetragenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung in der Medizin.
Wie kaum ein anderes Medikament hat Strophanthin die Zunft der Ärzte polarisiert. Euphorisches Lob und vernichtende Kritik prägten einen überaus polemisch und emotional geführten Streit. Aufstieg und Fall des Strophanthins sind bereits mehrfach beschrieben worden. Nahezu alle bisherigen Darstellungen konzentrieren sich auf eine in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhundert öffentlich in Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehbeiträgen ausgetragenen Auseinandersetzung um die Ursachen von Herzinfarkt zwischen dem Stuttgarter Internisten Berthold Kern und dem Heidelberger Pharmakologen Gotthard Schettler. Es fehlt bisher eine objektive, an belegbaren Fakten orientierte Aufarbeitung der Geschichte des Strophanthins. Diese Lücke möchte ich mit dem vorliegenden Buch schließen.
Heute erinnern sich nur noch wenige ältere Mediziner an dieses einst in Deutschland so beliebte Herzmedikament. Jüngere Ärzte kennen Strophanthin nicht mehr. In Lehrbüchern wird es, wenn überhaupt, nur als historische Randnotiz erwähnt. Strophanthin basierte Präparate sind nur noch als frei verkäufliche homöopathische Produkte oder als rezeptpflichtige Defekturarzneimittel verfügbar. Gibt es mehr als nur ein historisches Interesse, um sich mit diesem „alten“ Medikament überhaupt noch zu befassen?
Zwei Befunde deuten darauf hin, dass eine Neubewertung des Strophanthins in der Therapie von Herzinsuffizienz auch aus wissenschaftlichem Interesse angebracht ist. Zum einen besteht ein dringender Bedarf an wirksamen Mitteln in der Behandlung der Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz ist die einzige Krankheit, deren Inzidenz und Prävalenz in vielen entwickelten Ländern stetig zunehmen. Trotz moderner Behandlung mit Beta-Blockade und voller Angiotensin-II-Modulation liegt die Fünf-Jahres-Mortalität von Herzinsuffizienz bei über 50% und entspricht der von Krebserkrankungen. Die Wirksamkeit der heutigen Standard-Medikation zur Behandlung der Herzinsuffizienz ist in absoluten Zahlen ausgedrückt nur um wenige Prozentpunkte besser als Placebo. Zum anderen belegen aktuelle Forschungsergebnisse, dass Strophanthin über bisher nicht bekannte Wirkqualitäten verfügt, welche es rechtfertigen, dieses Medikament einer klinischen Neubewertung zu unterziehen.
Wer Aufstieg und Fall des Strophanthins verstehen will, muss sich mit den in jahrhundertelanger Forschung aufgedeckten wissenschaftlichen Grundlagen dieses Medikaments ebenso wie mit den Erkenntnissen zu Ursachen von Herzerkrankungen auseinandersetzen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine zeitlos unabänderlich gültigen Gesetze. Sie unterliegen vielfältigen Einflüssen und Veränderungen, welche nur im historischen Kontext verstanden werden können.
Generationen von Forschern und Ärzten haben die Geschichte des Strophanthins geprägt. Herausragende Persönlichkeiten haben aufeinander aufbauende grundlegende Erkenntnisse erarbeitet und in die klinische Praxis umgesetzt. Die Geschichte des Strophanthins ist auch eingebunden in die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie und in den Wandel der ihr zu Grunde liegenden Wissenschaftsdisziplinen. An die Stelle von klinischen Beobachtungen am Patienten als Ausgangspunkt der Entwicklung neuer Medikamente sind Pharmakologie, Genetik, Molekularbiologie und weitere Wissenschaftsdisziplinen getreten. Patienten werden heute auch ohne Krankheitssymptome medikamentös behandelt. Das statistische Risiko für eine zukünftige Krankheit ist als eigenständiges Krankheitsbild etabliert worden. Richtwerte für Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker definieren Krankheiten. Auch dieser Wandel ist Teil der Strophanthin Historie. Die Geschichte dieses Herzglykosids ist darüber hinaus geprägt von Fehlschlägen, voreiligen Verallgemeinerungen, genialer Intuition, polemischer Kritik, akademischer Eitelkeit, materiellen Interessen und persönlichem Gewinnstreben.
Die Geschichte des Strophanthins ist nicht abgeschlossen. Strophanthin ist nach wie vor Gegenstand intensiver Grundlagenforschung. Aktuelle Forschungsergebnisse ermöglichen eine neue Interpretation der langjährigen therapeutischen Erfahrungen. Diese neuen Erkenntnisse - auch im Kontext aktueller Befunde zu den Ursachen von Herzerkrankungen - zeigen, dass dieses Herzglykosid über ein nicht ausgeschöpftes therapeutisches Potenzial verfügt. Dieses Potenzial zum Nutzen herzkranker Patienten aufzuzeigen und erschließen zu helfen ist das Hauptanliegen dieses Buches.
Hauke Fürstenwerth
William Withering und der Rote Fingerhut
Pflanzen und Kräuter sind allen Epochen der Menschheitsgeschichte genutzt worden, um daraus Heilmittel zu gewinnen. Therapeutische Erfahrungen mit Pflanzen und Pflanzenextrakten sind zu allen Zeiten gesammelt und beschrieben worden. Die älteste überlieferte Rezeptsammlung für pflanzliche Heilmittel ist mehr als 5000 Jahre alt. Sie stammt aus Mesopotamien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris. Ägyptische Aufzeichnungen zur Verwendung von Arzneipflanzen stammen aus der Zeit um 1.500 v. Chr. Chinesische Aufzeichnungen datieren um 1.100 v. Chr. In Indien sind Beschreibungen zum Gebrauch von Heilpflanzen im Rahmen der Ayurveda-Medizin bereits um 1.000 v. Chr. entstanden. Im Mittelalter waren es vor allem die Klöster, welche das überlieferte Wissen um den Gebrauch von Heilpflanzen bewahrten, dokumentierten und praktizierten. Mit der Erfindung des Buchdrucks im 16. Jahrhundert wurde das Erfahrungswissen um die Heilkraft von Pflanzen dann in Form von Kräuterbüchern niedergelegt und damit allgemein verfügbar. Im 18. Jahrhundert begannen Wissenschaftler die Wirkung von Heilpflanzen gezielt zu erforschen. Zunächst ging es um die Klärung, welche Heilpflanze bei welcher Krankheit am besten wirkt. In späteren Jahrhunderten wurden die Untersuchungen auf die Reindarstellung der in den Heilpflanzen enthaltenen Wirkstoffe, der Aufklärung ihrer chemischen Struktur und auf deren pharmakologische Wirkungen erweitert. Gegen Ende des 19. Jahrhundert kam die chemische Abwandlung der Wirkstoffe hinzu. Viele der heute eingesetzten Arzneimittel sind Abwandlungen von in Pflanzen vorkommenden Naturstoffen.
Eine der ersten systematischen Untersuchungen der Wirkungen einer Heilpflanze, dem Roten Fingerhut (Digitalis purpurea), stammt von dem englischen Arzt William Withering. Die Ergebnisse seiner Studien publizierte er 1785 unter dem Titel „An Account of the Foxglove and some of its Medical Uses: with Practical Remarks on Dropsy and other Diseases“. Bereits ein Jahr später erschienen eine deutsche („Abhandlung vom rotem Fingerhut und dessen Anwendung in der praktischen Heilkunde vorzüglich bei der Wassersucht und einigen anderen Krankheiten“) und eine französische Übersetzung. Auch aus Amerika kamen sehr bald Interessensbekundungen an Witherings Ergebnissen. Da der Rote Fingerhut in Amerika nicht vorkommt, versorgte Withering seinen amerikanischen Kollegen Hall Jackson mit Samen der Pflanze. Jackson kultivierte den Roten Fingerhut und führte die Digitalistherapie der Wassersucht mit Fingerhut in Amerika ein [Skou 1986].
Withering (1741 – 1799) hat an der Universität in Edinburgh Medizin, Botanik und Mineralogie studiert. 1766 begann er seine berufliche Tätigkeit als Arzt in einer Praxis in Stafford, in der Grafschaft Staffordshire. 1775 übernahm Withering zusammen mit seinem Kollegen John Ash eine Praxis in Birmingham. 1779 wurde er in das Ärzteteam des General Hospital in Birmingham berufen, in welchem er bis zu seinem Ruhestand in 1792 tätig war. Daneben betrieb er seine florierende Privatpraxis weiter.
Kurz vor seinem Umzug nach Birmingham erhielt Withering Kenntnis von einer Kräutermischung zur Behandlung von Wassersucht (eine abnorme Ansammlung von Körperflüssigkeiten). Das Rezept für die Mischung stammte von einer alten Frau aus der Grafschaft Shropshire. Sie erzielte damit Heilerfolge auch bei Patienten, bei denen die Behandlung durch Ärzte versagt hatte. Die Kräutermischung der Heilerin enthielt mehr als 20 verschiedene Kräuter. Für den auch als Botaniker ausgebildeten Withering war es, wie er schreibt, „nicht schwierig, zu erkennen, dass die aktiven Kräuter nichts anderes als Fingerhut sein konnten.“ Witherings Entscheidung, die Wirkung von Fingerhut eingehend zu untersuchen wurde bestärkt durch die Erfahrung seines Kollegen Dr. Cawley aus Oxford, der unter einer für seine Ärzte unheilbaren Wassereinlagerung in der Brust (hydrops pectoris) litt und durch die Einnahme von Fingerhut Wurzeln geheilt werden konnte [Skou 1986].
Der Fingerhut gehört zur Pflanzengattung der Wegerichgewächse (Plantaginaceae). Es gibt etwa 25 Arten, welche in Europa, Nordafrika und im westlichen Asien beheimatet sind. Von medizinischer Bedeutung sind der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea) und der Wollige Fingerhut (Digitalis lanata). Die Verwendung von Fingerhut als Heilpflanze ist erstmalig 1250 in einem Wallisischen Kräuterbuch unter der Bezeichnung „foxes glofa“ erwähnt. Der deutsche Botaniker und Arzt Leonhard Fuchs beschreibt in seinem 1542 erschienenen Buch „Historia Stirpium“ detailliert verschiedene Fingerhut Arten und gibt diesen den Namen Digitalis [Greef 1981]:
„Diss gewechss würdt von unsern Teutschen fingerhut geheyssen, darumb das seine blumen einen fingerhut, so man zu dem näen braucht, gantz und gar ähnlich seind. Man mags in mittler zeit, bis man einen bessern namen findt, wie wir in unserem Lateinischen Kreuterbuch gethan haben, Digitalem zu Latein, dem Teutschen namen nach nennen.“
1650 werden eine Digitalis Salbe und Digitalis Tabletten erstmalig in der offiziellen englischen Medikamenten Liste „Pharmacopeia Londoniensis“ erwähnt. 1748 beschreibt der französische Arzt Francois Salerne die extreme Giftigkeit von Digitalispflanzen bei Verfütterung an Truthähne und mahnt zur Vorsicht bei der Anwendung dieser Pflanzen. Als Withering seine Studien mit Fingerhut aufnimmt ist diese Pflanzenart bereits offizieller Bestandteil mehrerer offizieller Medikamenten Listen: 1744 Edinburgh Pharmacopeia, 1748 Paris Pharmacopeia, 1771 Wittenberg Pharmacopeia. Fingerhut wurde zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen empfohlen. Wundheilung, Kopfschmerzen, Asthma, Rheuma, und Schüttelkrampf waren nur einige von vielen Erkrankungen bei denen Fingerhutzubereitungen eingesetzt wurden.
Withering wusste aus den Schilderungen der Heilerin aus der Grafschaft Shropshire, dass der Fingerhut starke diuretische Wirkungen hat, oftmals begleitet von heftigem Erbrechen und Durchfall. Er wusste auch um die extreme Giftigkeit des Fingerhuts. Entsprechend vorsichtig plante er seine Versuche. In der Einleitung seines Buches Account of the Foxglove listet Withering vier Möglichkeiten auf, welche ihm geeignet erschienen, die Wirkungen des Fingerhuts zu untersuchen. Die Untersuchungen könnten erfolgen auf chemischem Wege. Diese Methode beschränkte sich zu Witherings Zeiten aber auf verbrennen der Substanz und hatte sich bis dahin als nutzlos erwiesen. Als zweite Möglichkeit sah er die Beobachtung der Fingerhut Wirkungen an Tieren. Über Wirkungen von Heilkräutern an Tieren und deren Bedeutung für die Wirkung an Menschen gab es nur wenige zuverlässige Beobachtungen. Withering verwarf auch diese Methode. Aus gleichem Grunde verzichtete er auf eine mögliche dritte Alternative, den Vergleich mit Heilpflanzen ähnlicher Wirkungen. Als einzig zuverlässigen Weg, die Wirkungen des Fingerhuts zu studieren, wählte er den empirischen Gebrauch und die Beobachtung der Wirkungen an Patienten. Heute wissen wir, dass Digitalis an gesunden Menschen und Tieren kaum Wirkungen zeigt. Hätte Withering sich also für Untersuchungen an Tieren entschieden, hätte er die Wirkung von Digitalis nicht gefunden. Diese hat er nur an kranken Patienten studieren können.
Derartige Experimente am Menschen sind unter heute gültigen ethischen Maßstäben nicht zu rechtfertigen. Doch ist es nicht angebracht, die Handlungen Witherings mit heutigen Maßstäben auf Basis heutigen Wissens zu beurteilen. Im 18. Jahrhundert war es in vielen Regionen Europas noch gängiger Gebrauch, Frauen wegen nichtiger Anlässe als Hexen auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Witherings Handeln kann nur im kulturgeschichtlichen Kontext seiner Zeit und vor dem Hintergrund des ihm zur Verfügung stehenden Wissens beurteilt werden. Zu Witherings Zeiten gab es weder Kenntnisse über die Ursachen der zu behandelnden Krankheiten, noch war bekannt, wie und warum Heilkräuter und andere Heilmittel ihre Wirkungen entfalten. Die Wissenschaftsdisziplinen Pharmakologie und Toxikologie gab es noch nicht. Es ist das große Verdienst William Witherings, das bis dahin übliche Verfahren des „ausprobieren und verwerfen“ durch systematisches Vorgehen zu ersetzen und damit neue Heilungsmöglichkeiten zu erschließen. Erst 200 Jahre nach Witherings Arbeiten zum Roten Fingerhut sind Arzneimittelgesetze erlassen worden, welche vorschreiben, dass heute umfangreiche präklinische Studien durchgeführt werden müssen, bevor ein neues Medikament an Menschen getestet werden darf.
Dr. Small, einer von Witherings Vorgängern am General Hospital in Birmingham, hatte es eingerichtet, dass pro Tag jeweils eine Stunde sich mittellose Kranke im General Hospital kostenlos behandeln lassen konnten. Diese Tradition setzte Withering fort. Auf diese Weise wurden pro Jahr zwei- bis dreitausend arme Patienten behandelt. Aus diesem Patientenpool wählte Withering die geeigneten Patienten für seine Fingerhut Studien aus. Von 1776 bis 1785 behandelte Withering 163 Patienten mit unterschiedlichen Fingerhutzubereitungen in abgestuften Dosierungen [Skou 1986].
Die erste Aufgabe war es, eine geeignete Darreichungsform für den Fingerhut zu finden. Welche Pflanzenteile sind besonders gut geeignet? Wie müssen sie zubereitet werden? In welcher Dosierung sollten sie verabreicht werden? Als besonders geeignet und wirksam erwiesen sich pulverisierte, getrocknete Blätter, welche während der Blütezeit des Fingerhut gesammelt worden waren. Wässrige Extrakte waren nur schwach wirksam, alkoholische Extrakte verfügten über zu starke Nebenwirkungen. Solche Nebenwirkungen beobachtete Withering auch nach Verabreichung der getrockneten Blätter, versuchte aber, diese durch Verringerung der Dosis weitgehend auszuschließen. Als optimale Dosierung beschreibt Withering solange Digitalis zu verabreichen, bis Nebenwirkungen einsetzen: „2 mal täglich 1 - 3 grain (65 – 200 mg) pulverisierte, getrocknete Fingerhut Blätter so lange bis es entweder auf die Nieren, den Magen, den Puls oder die Eingeweide wirkt; stoppen Sie die Digitalisgabe beim ersten Auftreten einer dieser Nebenwirkungen." Zur Unterdrückung der Nebenwirkungen – insbesondere Übelkeit und Erbrechen – empfahl er die gleichzeitige Gabe von Opium [Somberg 1985].
In seinen Versuchen fand Withering die extreme Giftigkeit des Fingerhut bestätigt. Als toxische Effekte listet er auf: "Krankheit, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Sehstörungen, Objekte erscheinen grün und gelb; erhöhte Sekretion von Urin, langsamer Puls, bis hinunter zu 35 Schlägen in einer Minute, kalter Schweiß, Krämpfe, Ohnmacht, Tod“. Diese Effekte traten vor allem auf bei den hohen Dosierungen mit denen Withering seine Untersuchungen begann. „Ich habe es in sehr viel zu hohen Dosierungen und über einen viel zu langen Zeitraum verabreicht.“ Todesfälle waren die Folge.
Gemäß Witherings Beobachtungen wirkt Digitalis primär als Diuretikum, welches allen anderen bis dahin bekannten harntreibenden Mitteln in der Behandlung von Wassereinlagerungen im Gewebe überlegen war. Withering erwähnt auch die Wirkung der Fingerhutpräparate auf die Herzaktivität: „Digitalis übt auf die Bewegungen des Herzens einen starken Einfluss aus, wie es bisher bei keiner anderen Medizin beobachtet wurde; und dieser Einfluss kann zu Heilzwecken benutzt werden“. Zu Witherings Zeiten waren die Ursachen von Wassersucht noch nicht bekannt. Die Erkenntnis, dass Wassereinlagerungen eine Folge von Herzschwäche sind, setzte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhundert durch. Deshalb maß Withering der Wirkung von Digitalis auf das Herz keine besondere Bedeutung bei. Die Entdeckung, dass Digitalis ein potentes Mittel zur Behandlung von Herzkrankheiten ist blieb späteren Generationen von Ärzten und Wissenschaftlern vorbehalten. Dennoch gilt William Withering heute als Vater der Digitalistherapie. Seine Studien des Roten Fingerhut sind ein Musterbeispiel systematischer Studien, welche eine neue Ära in der medizinischen Forschung eingeleitet haben. Der Mediziner und Digitalis-Experte Albert Fraenkel (1864–1938) formulierte 1936: „Witherings Großtat war die einer intuitiven pharmakologisch-klinischen Konzeption. Nicht die Anwendung der Digitalis ist sein Ruhmestitel. Die Unsterblichkeit verdankt er dem tastenden Suchen und endlichen Finden der auch heute noch richtigen Dosierung und der Erkennung und planmäßigen Benutzung der Pulsfrequenz als Indikator für die Anwendung und für den Erfolg der Therapie.“ [Fraenkel 1936] In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen wurde William Withering 1785 in die Royal Society in London aufgenommen, der Gesellschaft mit dem größten Sozialprestige im England des 18. Jahrhunderts.
Witherings Arbeiten über die Wirkungen des Roten Fingerhut stießen auf großes Interesse bei den Ärzten, nicht nur in England, auch in Frankreich und Deutschland wurde Digitalis nun häufiger eingesetzt. Doch der Erfolg war von begrenzter Dauer. Obwohl Withering im Account of the Foxglove genaue Anweisungen gab zum Sammeln der Fingerhutblätter - Standort der Pflanze, Sammelzeitpunkt, Aufbewahrungsart und anderes mehr - waren viele Digitaliszubereitungen von zweifelhafter und wechselnder Qualität. Digitalis wurde als Allheilmittel gegen viele Krankheiten eingesetzt, bei denen keine Wirkung zu erzielen war. Die angewandten Dosierungen waren zu hoch. Vergiftungen in Folge von Überdosierungen waren die Regel. Digitalis blieb bis ins späte 19. Jahrhundert ein umstrittenes Heilmittel mit nur begrenzter Akzeptanz bei Ärzten. Dieses änderte sich erst als man die Ursachen der Wassersucht erkannte und Fortschritte in Chemie und Pharmakologie es erlaubten, die in Digitalis Pflanzen enthaltenen Wirkstoffe zu isolieren und deren pharmakologische Eigenschaften zu studieren.
Vom Pfeilgift zum Medikament
Die in Afrika und in Teilen Asiens beheimateten Lianen der Strophanthus-Arten und der Acokanthera Sträucher enthalten Herzglykoside, welche denen der Digitalis-Arten strukturell ähnlich sind. Die Glykoside dienen den Pflanzen als Abwehrmittel gegen Fressfeinde. Auch Menschen und Tiere haben sich die Giftigkeit dieser Pflanzen zu Nutze gemacht. Die afrikanische Mähnenratte (Lophiomys imhausi) nutzt sie für eine außergewöhnliche Abwehrstrategie. Sie kaut die Rinde hochgiftiger Acokanthera Sträucher, welche das herzaktive Glykosid g-Strophanthin (Ouabain) enthalten, und trägt den toxischen Speichel dann auf die Haare ihres auffallenden Rückenkamms auf. Die schwammartige Struktur der Haare sichert durch Kapillarkräfte die Sättigung des Fells mit Gift beladenem Speichel. Hunde, welche die Mähnenratte attackieren und in Kontakt mit dem giftigen Fell kommen, zeigen starke Vergiftungserscheinungen, die bis zum Tod führen können [Kingdon 2012]. Ratten selbst sind gegenüber Steroidglykosiden sehr viel weniger empfindlich als andere Tierarten. Deshalb zeigt das Acokanthera Gift bei ihnen keine Wirkung.
Viele Volksstämme in Afrika haben Zubereitungen von Strophanthus und Acokanthera Pflanzen als Pfeilgifte verwendet. Diese wurden sowohl auf der Jagd nach Wildtieren als auch bei Kriegshandlungen eingesetzt. Selbst Großtiere wie Elefanten konnten mit den hochgiftigen Pfeilen erlegt werden. Giftpfeile waren wichtige Waffen im Arsenal der afrikanischen Bevölkerung beim Widerstand gegen Eindringlinge, Sklavenjäger und Kolonialherren. In den Britischen Kolonien wurde es den Eingeborenen bei Androhung drastischer Strafen verboten, Pfeilgifte herzustellen und zu besitzen. Selbst der Anbau von Strophanthus Pflanzen und das Sammeln von Strophanthus Samen stand unter Strafe [Osseo-Asare 2014]. Die Rezepturen für die Zubereitung der Giftmischungen wurden als Geheimrezepte nur innerhalb des eigenen Stammes weitergegeben. Außenstehenden wurde nicht verraten, welche Pflanzenteile zu welcher Zeit geerntet werden mussten und wie diese aufbereitet und vielfach auch mit weiteren Zutaten wie Schlangen- oder Skorpion-Gift anzureichern waren.
Afrikanischen Heilern war der medizinische Wert von Strophanthus Pflanzen bereits sehr früh bekannt. Durch Einweichen der Pflanzenwurzeln mit anschließender Fermentierung wurden alkoholische Extrakte hergestellt. Die bitter schmeckenden Lösungen wurden in kleinen Schlucken über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen verabreicht. Um Vergiftungen zu vermeiden, wurde die verabreichte Menge vom Heiler sorgsam dosiert. Behandelt wurden Muskelschmerzen, offene Wunden, Verstopfung, Lebensmittelvergiftung, Geschlechtserkrankungen und Herzleiden [Osseo-Asare 2014]. Für die Einheimischen war Strophanthus Gift und Heilmittel in einem. In der Mythologie des Stammes der Wilé in Obervolta wurde diese Pflanze aus dem Paradies zur Erde geschickt, damit sie Menschen – je nach ihrem Verdienst – heile oder strafe [Leuenberger 1972].
Im Bericht über seine Expedition nach Mosambik, auf der er von 1857 bis 1863 die Nebenflüsse des Sambesi erkundete, beschreibt der schottische Missionar David Livingstone ein Gift, welches von den einheimischen Kriegern im Hochland des Shire am Najassasee „zum Töten von Menschen“ eingesetzt und als kombé bezeichnet wurde. „Wenn man nur ein winziges Stück von diesem Gift mit der Zunge berührt, so ist diese gelähmt.“ Begleitet wurde Livingstone auf seiner Expedition von dem Botaniker John Kirk. Dessen Aufgabe war es, nach Pflanzen Ausschau zu halten, welche für kommerzielle Produkte geeignet und gewinnbringend erschienen. Kirk berichtet, dass ein einziger vergifteter Pfeil genügt habe, einen Büffel zu töten, allerdings mussten die Jäger dem angeschossenen Tier oft einen halben Tag auf den Fersen bleiben, bis die tödliche Wirkung eintrat. Kirk bewahrte einige Exemplare der kombé Giftpfeile in einer Tasche auf, in der er auch seine Zahnbürste verwahrte. Als er diese eines morgens im März 1859 benutzte bemerkte er einen bitteren Geschmack. Bedingt durch eine fiebrige Erkältung war Kirks Puls erhöht, senkte sich aber nach Benutzung der Zahnbürste deutlich. Diesen schnell eintretenden Effekt führte Kirk auf eine Verunreinigung seiner Zahnbürste mit dem kombé Gift zurück. Kirk sandte Proben des Giftes und Teile der Pflanze, aus welcher das kombé Gift zubereitet wurde, an das Königliche Botanische Institut in London (Kew Gardens). Dort wurde die Pflanze zunächst als Strophanthus hispidus, später dann korrekt als Strophanthus kombé identifiziert.
Mehrere Forscher haben sich um die Aufklärung des in Strophanthus kombé enthaltenen Wirkstoffs und seiner pharmakologischen Eigenschaften verdient gemacht. Am intensivsten befasste sich Thomas Richard Fraser (1841 - 1922) - der in Edinburgh gleichzeitig Pharmakognosie, Pharmazie, Pharmakologie und Therapie lehrte - mit dem kombé Gift. Ihm gelang die Isolierung des reinen Wirkstoffs und dessen Charakterisierung als Glykosid. Weiter konnte er zeigen, dass der Strophanthus-Wirkstoff über eine ausgeprägte Herzwirkung verfügt und für die Therapie am Menschen geeignet ist. 1885 berichtete Fraser über erste Erfahrungen mit einer Strophanthus Tinktur an Patienten und empfahl deren Verwendung bei allen Formen der „Herzermüdung“ und als Diuretikum. Frasers Arbeiten gelten heute als Grundlage für die Anwendung des Strophanthins am Menschen.
Digitalis Präparate waren am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund ihrer unsicheren Wirkungen und ihrer gefürchteten Giftigkeit ein umstrittenes Heilmittel mit nur begrenzter Akzeptanz bei Ärzten. Frasers Arbeiten nährten die Hoffnung, dass Strophanthusglykoside ein geeigneter Ersatz für Digitalis Präparate sein könnten. Entsprechend intensiv war die nach 1885 einsetzende Strophanthus-Forschung. Bereits 1890 summierte sich die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen auf über einhundert. Auch in Frankreich und Deutschland wurde intensiv an Strophanthus Wirkstoffen geforscht.
Insbesondere französische Forscher differenzierten zwischen den Inhaltsstoffen aus unterschiedlichen Strophanthus Arten. Catillon gewann 1888 reine Körper aus den Strophanthus Arten gratus, hispidus, niger und kombé. Kristalline Produkte erhielt er regelmäßig nur aus Strophanthus gratus, während die anderen, insbesondere Strophanthus kombé nur amorphe Produkte lieferten. Arnaud beschäftigte sich zur gleichen Zeit mit einem Pfeilgift, das die Somalis aus dem Holz eines als Acokanthera ouabaio bezeichneten Baumes gewannen. 1888 gelang ihm die Isolierung eines kristallinen Wirkstoffs, den er Ouabain nannte. Nur wenig später wies er einen damit identischen Wirkstoff in einem Pfeilgift nach, welches aus Strophanthus gratus angefertigt worden war. Der Name g-Strophanthin für das Strophanthus gratus Glykosid wurde 1904 von Thoms eingeführt, um es von den Wirkstoffen anderer Strophanthus Arten zu unterscheiden [Gilg 1904]. Das in dem von Fraser untersuchten Strophanthus kombé vorkommende Glykosid wurde fortan als k-Strophanthin bezeichnet. Das mit g-Strophanthin identische Ouabain hat in Frankreich nach dem ersten Weltkrieg als „Ouabain Arnaud“ k-Strophanthin Präparate in der Therapie von Herzpatienten weitgehend verdrängt. In Deutschland setzte die klinische Strophanthus Forschung erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einer Publikation von Schedel ein. Er bezieht sich darin auf Fraser, denn nach dessen Veröffentlichung von 1885 erschien „eine wahre Flut von Veröffentlichungen über dieses neue Herzmittel, ein Zeichen, dass die Verwendung der Digitalis doch nicht allen Anforderungen genüge.“ In seiner 1904 publizierten Arbeit berichtet Schedel über positive Erfahrungen mit einer Strophanthus gratus Tinktur, welche das g-Strophanthin (Ouabain) enthielt. Er betont die auch von anderen Klinikern beobachteten günstigen Wirkungen auf Atemnot (Dyspnoe) und Puls bei Herzkranken [Schedel 1904].
~ ~ ~
Als Fraser 1885 seine bahnbrechende Arbeit zur Wirkung von Strophanthus Wirkstoffen publizierte wurden Medikamente üblicher Weise in Apotheken und Hausapotheken der Ärzte hergestellt. Aber auch Kräutersammler, Hausierer und Quacksalber durften als Heilmittel deklarierte Produkte verkaufen. Regulierung und Kontrolle der Herstellung, der Qualität und der Wirksamkeit von Arzneimitteln waren praktisch nicht vorhanden. Reinheit und Wirkqualität von Medikamenten waren abhängig vom Geschick und der Erfahrung des einzelnen Apothekers. Der Umgang mit einheimischen Heilpflanzen wie den Fingerhut Arten war den meisten Apothekern noch einiger Maßen vertraut. Wobei jedoch jeder Apotheker selbst entwickelte Rezepte zur Herstellung seiner Produkte einsetzte. Um eine Mindestqualität der Arzneimittel zu sichern hatte man bereits im 18. Jahrhundert in vielen Ländern begonnen offizielle Arzneibücher (Pharmakopoe) zu erstellen, in denen als wirksam bekannte Arzneimittel und Methoden ihrer Herstellung und Lagerung aufgelistet waren. Das erste deutsche Arzneibuch (DAB1) entstand 1872. In Österreich war ab 1812 die Pharmacopoea Austriaca gültig. In Amerika gibt es seit 1820 die United States Pharmacopeia.
Der Umgang mit tropischen Pflanzen stellte Apotheker und Ärzte vor neue Herausforderungen. Erfahrungen mit der Identifizierung von Pflanzen und geeigneten Pflanzenteilen (Blätter, Samen) und Methoden der Aufbereitung geeigneter Darreichungsformen lagen nicht vor. Die chemische Analyse war noch nicht auf einem Stand, der eine genaue Bestimmung des Wirkstoffgehalts von Pflanzen und Extrakten ermöglicht hätte. Empirisches Ausprobieren war die Regel, extreme Qualitätsunterschiede vermeintlich identischer Produkte die unvermeidliche Folge.
Die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhundert war eine Zeit des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs. Fortschritte in vielen Wissenschaftsdisziplinen führten in der Medizin zur „Verwissenschaftlichung“ therapeutischer Maßnahmen. Empirie und Überlieferung wurden durch Wissenschaft ersetzt. Auf Forschung basierte Industrieunternehmen wurden gegründet. Unternehmen wie Hoechst, Bayer, BASF, Sandoz, Ciba, E. R. Squibb and Sons (heute Bristol-Myers Squibb) und Boehringer sind alle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Sie alle waren auf der Suche nach attraktiven Produkten. Die Herstellung von Medikamenten war ein vielversprechendes Geschäftsfeld.
1851 gründete Ernst Christian Friedrich Schering (1824-1889) in Berlin eine Apotheke aus der 1864 die „Chemische Fabrik Ernst Schering“ wurde, welche sich rühmte, besonders „reine Präparate“ anzubieten. Daraus ging später die Schering AG hervor, welche heute Teil des Bayer Konzerns ist. Der Apotheker Heinrich Emanuel Merck (1794 - 1855) hatte bereits 1827 begonnen, anderen Apothekern, Chemikern und Ärzten aus Pflanzen isolierte Wirkstoffe wie Koffein, Kokain, Morphin und Nikotin zu verkaufen. Diese Aktivitäten waren der Grundstein für das pharmazeutisch-chemische Unternehmen E. Merck Darmstadt. Der Schwerpunkt der Merckschen Produktpalette lag auf Wirkstoffen, welche aus tropischen Pflanzen gewonnen wurden. Die Hoffnung auf weitere wertvolle Pflanzen war der Grund, warum an Expeditionen wie der von Livingstone nach Mosambik stets auch Botaniker wie John Kirk teilnahmen. Deren Aufgabe war es, gezielt nach solchen Pflanzen Ausschau zu halten.
Der Amerikaner Henry Wellcome (1853–1936) hatte ein großes persönliches Interesse an neuen Entwicklungen in Medizin, Pharmakologie und Botanik. Er war überzeugt von dem großen Potenzial tropischer Pflanzen für neue Medikamente. In den 1870er Jahren war er in Südamerika auf der Suche nach Chinin haltigen Pflanzen unterwegs gewesen. 1880 hat er mit seinem Partner Silas Burroughs in London das Unternehmen Burroughs, Wellcome & Co gegründet. Das junge Unternehmen war bemüht, neue Produkte zu finden. Als Fraser auf der Jahresversammlung der British Medical Association 1885 in Cardiff über seine therapeutischen Erfahrungen mit selbst hergestellten Strophanthus Tinkturen berichtete war auch Henry Wellcome anwesend. Nach einer intensiven Diskussion mit Fraser beschloss Wellcome, das Strophanthus Produkt in das Sortiment seiner jungen Firma aufzunehmen. Fraser unterstützte Burroughs, Wellcome & Co hierbei mit seinem Wissen um Auswahl geeigneter Strophanthus Samen und Herstellung einer für die therapeutische Anwendung geeigneten Tinktur. Bereits 1886 war das neue Produkt „Tincture of Strophanthus“ im Handel, welches zu sieben Schilling pro Unze in England und Amerika verkauft wurde. Ab 1887 wurde die Tinktur auch in Deutschland, Holland und anderen Ländern vermarktet. Die Tinktur wurde bei Erwachsenen zur Behandlung von Herzgeräuschen, „nervösem Asthma“, Typhus und Lungenentzündung empfohlen. Mit süßen Sirup versetzt um den bitteren Geschmack zu maskieren wurde es auch an Kinder verabreicht.
Es erwies sich zunächst als schwierig, ausreichende Mengen geeigneter Strophanthus Samen für die industrielle Produktion von Strophanthus Tinkturen zu beschaffen. Nur die Samen des Strophanthus kombé waren zur Herstellung der von Fraser entwickelten Tinktur geeignet. Geliefert wurden jedoch häufig Samen ungeeigneter Strophanthus Arten. Mit Hilfe von John Buchanan, dem britischen Konsul von Malawi, baute Wellcome eine zuverlässige Lieferkette auf [Hokkanen 2012]. 1906 wurden 16 Tonnen Strophanthus Samen im Wert von 8.000 Britischen Pfund aus dem Britischen Protektorat in Zentralafrika nach England exportiert. Geerntet wurden die Samen von wild wachsenden Pflanzen. Eine Kultivierung der Pflanzen erschien zu wenig attraktiv. Auch andere Unternehmen begannen, Strophanthus Präparate zu vermarkten. Diese waren zum Teil von zweifelhafter Qualität. Um sich hiervon abzusetzen, warb Wellcome damit, dass seine Tinktur dem Original Rezept von Fraser entspräche und von diesem getestet sei. Burroughs Wellcome machte in seiner Werbung umfangreichen Gebrauch von medizinischer und wissenschaftlicher Literatur - vor allem von Frasers Artikeln. Ab Anfang 1886 wurden Sonderdrucke von Frasers Veröffentlichungen in The Lancet und British Medical Journal zur Promotion der „Tincture of Strophanthus“ eingesetzt. Die Autorität der Wissenschaft wird auch heute noch von allen Pharmafirmen als essentieller Teil der Marketingstrategie für Medikamente eingesetzt. Die „Tincture of Strophanthus“ war ein kommerzieller Erfolg und begründete das rasche Wachstum von Burroughs, Wellcome & Co im späten 19. Jahrhundert.
Über geeignete medizinische Indikationen für die Strophanthus Tinktur lagen zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Fraser hatte an wenigen Patienten die diuretische Wirkung, einen schnellen Wirkungseintritt und positive Effekte bei Ödemen und Atemnot beschrieben. Weitere klinische und pharmakologische Untersuchungen waren notwendig. Da Burroughs Wellcome noch nicht über eigene Laboratorien verfügte, stellte es seine Tinktur Ärzten und Krankenhäusern im In- und Ausland kostenlos für Versuchszwecke zur Verfügung. 1894 wurden dann die Wellcome Physiological Research Laboratories gegründet, eine der ersten kommerziellen Forschungslaboratorien ihrer Zeit.
1930 begann Burroughs Wellcome mit dem Vertrieb von Digoxinpräparaten, welche reines, aus Digitalis lanata isoliertes Digoxin enthielten und sehr schnell zu einem großen kommerziellen Erfolg wurden.
In Amerika war E. R. Squibb and Sons einer der ersten Anbieter von Strophanthus Präparaten. Besonders beliebt war eine mit Schokolade überzogene Tablette einer Mischung aus Digitalis und Strophanthus Extrakten, welche zu 16 Cent pro einhundert Stück verkauft wurde. Die empfohlene Dosis für Herzklopfen, Raucher-Herz und als Herzstärkungsmittel war eine Tablette alle drei bis vier Stunden. In Deutschland wurden Strophanthus Präparate von Boehringer Mannheim und E. Merck angeboten. In Ermangelung geeigneter Forschungsabteilungen stellten auch diese Unternehmen interessierten Ärzten und Wissenschaftlern Proben reiner Strophanthus Extrakte für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung.
Info-Box Herzglykoside
Die als herzaktive Glykoside bekannten Wirkstoffe werden auch als Herzglykoside oder Steroidglykoside bezeichnet. Die Vertreter dieser Klasse von chemischen Wirkstoffen kommen in zahlreichen Pflanzenarten vor. Neben den Fingerhut Arten (Digitalis) zählen hierzu unter anderen Adonisröschen (Adonis), Maiglöckchen (Convallaria majalis), Oleander (Nerium oleander) und die in Afrika beheimateten Lianen der Strophanthus-Arten und der afrikanische Baum Acokanthera ouabaio. Es sind etwa 200 Wirkstoffe dieser Klasse bekannt. Von medizinischer Bedeutung sind die Digitalisderivate Digitoxin (aus Digitalis purpurea), Digoxin (aus Digitalis lanata) und die Strophanthusderivate k-Strophanthin (aus Strophanthus kombé) und das g-Strophanthin (aus Strophanthus gratus), welches identisch ist mit dem aus Acokanthera ouabaio isolierten Ouabain. Chemisch sind die Steroidglykoside alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: ein Steroidgerüst, welches dem der Sexualhormone und der Gallensäuren ähnelt ist mit einer Zuckerkette bestehend aus einem oder mehreren Zuckerresten verbunden. Die Steroidglykoside differenzieren sich von einander durch unterschiedliche Zuckerketten und unterschiedliche Substituenten am Steroidgerüst. Das Steroidgerüst wird als Aglykon oder auch als Genin bezeichnet.
Digitoxose – Digitoxose – Digitoxose – Digitoxigenin
Das im Roten Fingerhut enthaltene Digitoxin besteht aus dem Aglykon Digitoxigenin und einer Zuckerkette bestehend aus drei Einheiten Digitoxose. Die Zuckerkette des in Digitalis lanata enthaltenen Digoxin besteht ebenfalls aus drei Digitoxose Einheiten. Vom Digitoxin unterscheidet es sich durch eine Hydroxlygruppe am C-12 des Aglykons.
Digitoxose – Digitoxose – Digitoxose - Digoxigenin
Die strukturell verwandten Steroidglykoside aus den Strophanthus Arten – k-Strophanthin und g-Strophanthin – enthalten im Aglykon mehrere Hydroxgruppen. Diese bedingen eine gegenüber den Digitalis-Derivaten sehr viel höhere Wasserlöslichkeit. Das in Strophanthus gratus und Acokanthera ouabaio vorkommende g-Strophanthin wird auf englisch als Ouabain bezeichnet.
Glukose – Glukose - Cymarose – k-Strophanthidin
Diese Bezeichnung wird heute in der wissenschaftlichen Literatur ausschließlich verwendet. Im Gegensatz zu den Hydrolyse stabilen Digoxin, Digitoxin und Ouabain wird das k-Strophanthin durch Säure und Basen sehr leicht gespalten. Das für therapeutische Zwecke verwendete k-Strophanthin aus Strophanthus kombé (Kombetin) enthält deshalb stets auch geringe Mengen k-Strophanthin-β (entsteht durch Abspaltung einer Glukose) und k-Strophanthin-α (entsteht durch Abspaltung von zwei Einheiten Glukose). k-Strophanthin-α ist identisch mit dem aus dem Adonisröschen gewonnenen Cymarin.
Rhamnose – g-Strophanthidin (Rhamnose –Ouabagenin)
Neben den natürlichen Wirkstoffen sind auch halbsynthetische Digoxinderivate erfolgreich in der Therapie eingesetzt worden, das β-Acetyl-Digoxin (Handelsname Novodigal) und das β-Methyl-Digoxin (Handelsname Lanitop). Diese Derivate haben gegenüber dem Digoxin eine verbesserte Resorption. Sie setzen im Körper Digoxin frei und haben deshalb eine mit diesem identische Wirkung.
Reine chemische Substanzen, die frei sind von Verunreinigungen, neigen dazu, zu kristallisieren. Gelingt es, von einer Substanz Kristalle zu erzeugen, so ist dieses ein starkes Indiz für die Reinheit der Verbindung. Liegen Substanzen in amorpher, nicht kristalliner Form vor, so ist dieses ein Hinweis auf Substanzgemische oder verunreinigter Substanz. Es ist nur in seltenen Fällen gelungen, kristallines k-Strophanthin zu gewinnen. Die hohe Anfälligkeit für Hydrolyse bedingt, dass stets Anteile von k-Strophanthin-β und Cymarin enthalten sind. Deshalb wird k-Strophanthin im Gegensatz zu g-Strophanthin (Ouabain) stets als amorphes Produkt erhalten.
Die Aufklärung der genauen chemischen Struktur der Herzglykoside erfolgte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert. Entscheidende Beiträge lieferten Heinrich Kiliani (1855-1945), der Nobelpreisträger Adolf Windaus (1875-1959), Rudolf Tschesche (1905–1981) und Arthur Stoll (1887–1971).