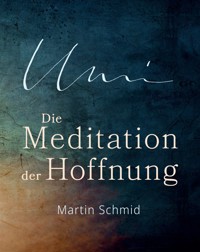Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Besonderheit des Studienbuches ist der lebensweltnahe Zugang zu den Themenfeldern der Angewandten Soziologie. Unter Bezug auf den Lebenslauf (Kindheit, Jugend, Erwerbstätigkeit, Alter) werden Alltagserfahrungen in einer modernen Gesellschaft betrachtet. Dabei greift das Buch Beispiele auf, die aus dem Alltag bekannt sind, aktuelle Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens berühren oder Bezüge zur Praxis in sozialwissenschaftlich geprägten Berufen aufweisen. Die einzelnen Kapitel stellen in sich abgeschlossene Abhandlungen dar und können im Studium als Grundlage für Seminare und Vorlesungen herangezogen werden. Das Buch deckt dabei vielfältige Themen ab: vom Wandel der Sozialstruktur über Körper und Gesundheit, Digitalisierung und Arbeitswelt, Wirtschaft und Migration bis hin zu aktuellen Entwicklungen wie dem Erstarken des Populismus und der Corona-Pandemie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Lebenslauf, Lebenslage und Sozialstruktur
1.1 Lebenslauf, Biographie und Karriere
1.1.1 Lebensläufe, Familien- und Erwerbsbiographie: Laura, ihr Bruder Max und ihre Großeltern
1.1.2 Alter, Kohorte und Generation
1.1.3 Individualisierung und die De-Standardisierung des Lebenslaufs
1.1.4 Bildung, Erwerbsarbeit und Familie im Lebenslauf
1.2 Kindheit, Jugend und Sozialisation
1.2.1 Lebenswelten des Heranwachsens: Amelie Parker und Jonas Kleber
1.2.2 Historische Kindheiten: Vom europäischen Mittelalter bis zur Industrialisierung
1.2.3 Kindheit(en) in der westlichen Welt: Familie, Schule und Wohlfahrtsstaat
1.2.4 Jugend(en) in der europäischen Moderne: (Aus-)Bildung, Peers und Freizeitgestaltung
1.3 Familie, Partnerschaft und Erziehung
1.3.1 Die moderne Kleinfamilie: Eheleute Reiter und Tochter Andrea
1.3.2 Geschichte der Familie: Vom europäischen Mittelalter zur Industriegesellschaft
1.3.3 Familienformen, Rollenmuster und Beziehungsgeflechte
1.3.4 Partnerschaft, Erziehung und Freizeitgestaltung
1.4 Sozialstruktur, soziale Ungleichheit und Diversität
1.4.1 Formen sozialer Ungleichheit: Kathinka Lasar, Tobias Rückert und Mohammed Al Masry
1.4.2 Klasse, Schicht, soziale Milieus und Lebensstile
1.4.3 Armut, Reichtum und die Rückkehr der Klassen
1.4.4 Geschlecht, Ethnizität und andere Achsen der Ungleichheit
2 Körper, soziale Teilhabe und gesundes Altern
2.1 Körperbilder, Inszenierung und Optimierung
2.1.1 Verkörperung des Sozialen: Familie Dahlberg – schön und glamourös
2.1.2 Geschichte des Körpers: Von der Leibfeindlichkeit zur Selbstoptimierung
2.1.3 Inszenierung und Selbstfindung: jugendlich, makellos und entblößt
2.1.4 Optimierung und Selbstsorge: gesund, kontrolliert und vital
2.2 Behinderung, Reformansätze und Lebensbereiche
2.2.1 Vanessa Pickert – »Ich bin nicht behindert, ich werde behindert.«
2.2.2 Geschichte der Behinderung: Vom Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
2.2.3 Prinzipien und Leitbilder: Normalisierung, Empowerment und Inklusion
2.2.4 Lebenskontexte von Menschen mit Behinderung: Schule, Beruf und Alter
2.3 Gesundheit, Krankheit und das Gesundheitssystem
2.3.1 Das Gesundheitssystem im Stresstest der Pandemie
2.3.2 Gesundheit und Krankheit im historischen Überblick
2.3.3 Verhalten, Verhältnisse und Gesundheitsförderung
2.3.4 Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik in vergleichender Perspektive
2.4 Alter, Altern und die alternde Gesellschaft
2.4.1 Manfred Widmann und Paula Drewes: Altersbilder im Vergleich
2.4.2 Die Lebensphase Alter im historischen Wandel
2.4.3 Demographischer Wandel und die alternde Gesellschaft
2.4.4 Junge Alte, Hochbetagte und die Potenziale des Alters
3 Netzwerkgesellschaft, Digitalisierung und neue Arbeitsstrukturen
3.1 Netzwerke, Digital Divide und Cybercrime
3.1.1 Tendenzen digitaler Vernetzung: Technologie, Ökonomie und Kultur
3.1.2 Digital Divide: Digitale Ungleichheit – Initiativen und Befunde
3.1.3 Cybercrime: Erscheinungsformen, Bekämpfung und Prävention
3.1.4 Cyberlife: Jugend online – Trends und Herausforderungen
3.2 Massenmedien, Journalismus und Öffentlichkeit
3.2.1 Realität der Massenmedien: Luca Folkers in der Multimediagesellschaft
3.2.2 Mediengeschichte: Höhlenbilder, Buchdruck und digitale Medien
3.2.3 Traditionelle Medien und Journalismus: Enthüllungen und Verfehlungen
3.2.4 Digitale Medien und (Teil-)Öffentlichkeiten: Rollenwechsel und Nutzung
3.3 Industrie 4.0, Plattform-Economy und Care Work: Arbeit in postindustriellen Gesellschaften
3.3.1 Smart Factory, Fahrradkurier und Intensivpflege: Beispiele aus der modernen Arbeitswelt
3.3.2 Landwirtschaft, Industrialisierung, Dienstleistungen: ein kurzer geschichtlicher Überblick
3.3.3 Arbeiten 4.0: Digitalisierung, Dezentralisierung, Entgrenzung
3.3.4 Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel: Geht der Gesellschaft die Arbeit aus?
3.4 Konsum 4.0, Freizeit und Erlebniswelten
3.4.1 Konsum 4.0, Freizeit und Erlebniswelten
3.4.2 Mittelalter und Frühe Neuzeit: Feiertage, Geselligkeit und höfische Festkultur
3.4.3 Industrialisierung und Moderne: Volksvergnügen, Warenhäuser und Kommerzialisierung
3.4.4 Empirische Trends: Freizeitgestaltung und Konsumgewohnheiten
3.4.5 Erlebniskonsum 4.0: Hybrides Shopping, Prosuming und neue Geschäftsmodelle
4 Weltwirtschaft, Megacities und Migration
4.1 Wachstum, Internationalisierung und Wohlstandsmehrung
4.1.1 Grundlagen des Wirtschaftens: Märkte, Zahlungsmittel und staatliche Regulierung
4.1.2 Europäische Wirtschaftsgeschichte: Handel, Territorialstaaten und Kolonialismus
4.1.3 Globalisierung und Weltwirtschaft: Entgrenzung, Vernetzung und Verdichtung
4.1.4 Ungelöste Probleme: Verteilungsgerechtigkeit und Externalisierung
4.2 Urbanisierung, soziale Ungleichheit und ökologische Nachhaltigkeit
4.2.1 Global Cities und Megastädte: Aktuelle Entwicklungen im Überblick
4.2.2 Geschichte der europäischen Stadt: Vom Mittelalter bis zur modernen Großstadt
4.2.3 Sozialraum und soziale Ungleichheit: Segregation, Gentrifizierung und Exklusion
4.2.4 Nachhaltige Stadtentwicklung: Ökonomie, Ökologie und urbane Sicherheit
4.3 Migration, Integration und Postmigrationsgesellschaften
4.3.1 Von der Migration zum Migrationshintergrund – ein Überblick
4.3.2 Eckpunkte der Migrationsgeschichte in Deutschland seit 1945
4.3.3 Politische Steuerung, Religion und Rassismus
4.3.4 Assimilation, Integration und die Postmigrationsgesellschaft
4.4 Globale Ungleichheiten, Entwicklung und Postkolonialismus
4.4.1 Soziale Lagen, Weltgesellschaft und Nationalstaaten
4.4.2 Ungleichheit zwischen Staaten, innerhalb von Staaten und in der Weltgesellschaft
4.4.3 Von Modernisierungstheorien zum Postkolonialismus
4.4.4 Ungleichheiten und Kontextrelationen
5 Aktuelle Herausforderungen angewandter Soziologie – eine Auswahl
5.1 Soziale Probleme, Sozialpolitik und soziale Dienste
5.1.1 Von der Sozialen Frage zur Soziologie sozialer Probleme
5.1.2 Soziale Probleme, Inklusion und Exklusion
5.1.3 Sozialpolitik, Soziale Arbeit und die Sozialwirtschaft
5.2 Demokratie, Populismus und Autoritarismus
5.2.1 Demokratisierung und Autokratisierung
5.2.2 Funktionale Differenzierung, politisches System und Inklusion
5.2.3 Öffentlichkeit, Diskurs und Digitalisierung
5.2.4 Populismus und Autoritarismus
5.3 Corona-Krise, Risikopolitik und Verschwörungstheorien
5.3.1 Seuchen, Pandemien und ihr gesellschaftlicher Umgang
5.3.2 Corona-Krise, fachliche Expertise und Risikopolitik
5.3.3 Querdenkende, Verschwörungstheorien und Aluhüte
5.4 Anthropozän, Fridays for Future und globale Klimapolitik
5.4.1 Natur, Umwelt und Gesellschaft
5.4.2 Anthropozän, Ökologie und Nachhaltigkeit
5.4.3 Soziale Bewegungen und Fridays for Future
5.4.4 Klimapolitik, Weltklimagipfel und internationale Beziehungen
Stichwortverzeichnis
Literatur
Die Autoren
Dr. Thomas Hermsen ist seit 2000 Professor für Soziologie an der Katholischen Hochschule Mainz und leitet das Institut für Forschung und Internationales. Nach dem Studium zum Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Köln und einer beruflichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst folgten u. a. ein Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Düsseldorf und der Soziologie an der Universität Bielefeld. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre gehören die allgemeine Soziologie, die Organisationssoziologie und die Kinder- und Jugendhilfe.
Dr. Martin Schmid ist seit 2013 Professor für sozialwissenschaftliche Grundlagen sozialer Arbeit an der Hochschule Koblenz. Nach dem Soziologiestudium an der Goethe-Universität Frankfurt arbeitete er u. a. als Drogenberater in Offenbach und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Frankfurt. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre gehören die Soziologie des Lebenslaufs, die Soziologie sozialer Probleme, Drogen- und Suchtforschung sowie Case Management.
Thomas HermsenMartin Schmid
Studienbuch Angewandte Soziologie
Verlag W. Kohlhammer
Für Bettina und Rita
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-039564-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-039565-7epub: ISBN 978-3-17-039566-4
Vorwort
Unter einer angewandten Soziologie wird eine auf Gesellschaft bezogene Wissenschaft verstanden, die theoretisches und empirisches Wissen auf konkrete soziale Zusammenhänge und Alltagserfahrungen ausrichtet. Inhaltlich wird hierbei Bezug genommen auf individuelle Erlebnisse, auf verallgemeinerbare Geschehnisse des Alltags sowie auf gesellschaftliche Ereignisse und steuerungspolitische Herausforderungen. Das Ziel dieser Zugangsweise besteht darin, einen wissensbasierten und zugleich aktuellen Zusammenhang sowohl zur eigenen Lebenswirklichkeit als auch zu allgemeinen Fragestellungen menschlichen Zusammenlebens herzustellen. Im Gegensatz zu traditionellen Einführungen in die Soziologie über ihre Grundbegriffe, Theorien oder Klassiker hat dieser Zugang den Vorteil, dass eine Verknüpfung aus Alltagserfahrungen, lebenspraktischen Bezügen und wissenschaftlichem Erklärungswissen hergestellt wird. Studierende der Soziologie oder vergleichbarer Studiengänge im Haupt- und Nebenfach haben so die Möglichkeit, sich thematisch und zugleich anwendungsbezogen mit ausgewählten relevanten Themen zu beschäftigen. Darüber hinaus können auch Bezüge zur beruflichen Praxis hergestellt werden.
Das Studienbuch fokussiert im ersten Kapitel einen lebenslaufbasierten Zugang (▸ Kap. 1). Unter Bezugnahme auf konkrete Fallkonstellationen in prägenden Lebensphasen wie Kindheit und Jugend, Familie und Erwerbsbiographie werden spezifische Herausforderungen der Persönlichkeitsentwicklung und des gesellschaftlichen Miteinanders in den Blick genommen.
Kapitel 2 konzentriert sich auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und greift Themenbereiche wie Körperlichkeit, Identitätsbildung, Gesunderhaltung und Formen sozialer Ausgrenzung am Beispiel der Behinderung auf (▸ Kap. 2).
Kapitel 3 legt den Schwerpunkt auf Aspekte sozialer Interaktion und Lebensführung, die insbesondere durch den informationstechnologischen Wandel der Moderne grundsätzlich neugestaltet werden bzw. neu zu gestalten sind (▸ Kap. 3). Stichworte sind hier neue Formen der Informations- und Wissensgenerierung, der medialen Vernetzung, aber auch der Erwerbsarbeit und des Konsums.
In Kapitel 4 kommen Herausforderungen in den Blick, die sich auf einen globalen sozialstrukturellen Wandel beziehen (▸ Kap. 4). Themen wie Urbanisierung, Wirtschaft, Migration und globale soziale Ungleichheiten werden überblicksartig behandelt.
Kapitel 5 nimmt Bezug auf aktuelle Herausforderungen und Problemlagen gesellschaftlicher Entwicklung (▸ Kap. 5). Am Beispiel der Gegenstandsbereiche soziale Probleme, Populismus, Pandemien und Klimawandel wird verdeutlicht, welche Bezüge sich aus einer angewandten Soziologie ergeben.
Eine systematische Einführung in zentrale Themen und Grundbegriffe der Soziologie kann und will das Studienbuch nicht bieten. Das Ziel des Studienbuches besteht in einer übersichtlichen und verständlichen Einführung in ausgewählte Themenfelder der Soziologie. Auf der Basis dieses Einstiegs und Überblicks sollen Studierende in die Lage versetzt werden, sich mit bestimmten Fragestellungen, Teilaspekten und empirischen Befunden während ihres Studiums, z. B. im Rahmen von zu erstellenden Referaten oder Hausarbeiten, vertiefend zu beschäftigen. Die Kapitel bauen daher auch nicht aufeinander auf. Je nach Interesse ist ein selektiver Zugang, ohne Lektüre der vorhergehenden Kapitel, möglich.
Für Lehrende kann das Studienbuch eine hilfreiche Unterstützung zur Strukturierung und inhaltlichen Ausgestaltung von Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen sein. Die Texte sind so aufgebaut, dass auf der Grundlage von einleitenden Fallbeispielen und einer historischen Verortung des Gegenstandsbereichs Zugänge zu aktuellen Wissensbeständen und Debatten erschlossen werden. Auf dieser Grundlage können vertiefende Betrachtungen zu einzelnen Teilaspekten einer Thematik erfolgen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Vorschläge für die weitere Beschäftigung mit den jeweiligen Inhalten. Bei den Fallbeispielen in den Kapiteln handelt es sich um fiktive Geschichten und nicht um Berichte über reale Personen.
Die Autoren danken ganz herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kohlhammer Verlags für die äußerst hilfreiche und konstruktive Zusammenarbeit. Zu danken ist auch Justin Geißler, der uns bei der Erstellung der Druckvorlage tatkräftig unterstützt hat.
September 2022Thomas Hermsen & Martin Schmid
1 Lebenslauf, Lebenslage und Sozialstruktur
1.1 Lebenslauf, Biographie und Karriere
1.1.1 Lebensläufe, Familien- und Erwerbsbiographie: Laura, ihr Bruder Max und ihre Großeltern
Laura Schneider studiert im dritten Semester Soziale Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder Max, der gerade ein Medieninformatikstudium begonnen hat, war sie am Wochenende beim 75. Geburtstag ihrer Großmutter Renate. Wie immer bei solchen Anlässen wurde viel von früher erzählt, und Laura und Max haben sich während der Heimfahrt noch lange darüber unterhalten, wie sich ihr Leben vom Leben ihrer Großeltern unterscheidet.
Renate Schneider wurde kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren und 1953 in der katholischen Volksschule eingeschult, von der sie später aufgrund guter Leistungen auf die Mädchenmittelschule wechselte. Nach der Mittleren Reife arbeitete sie als Büroangestellte in der Personalabteilung des neu eröffneten Bochumer Opelwerks. Dort lernte sie auch den Großvater von Laura und Max, Werner Schneider, kennen, der in der Lackiererei arbeitete. Bei der Heirat war sie 20, und als sie zwei Jahre später mit Lauras Vater schwanger war, kündigte sie bei Opel und wurde Hausfrau und Mutter. Bei der Geburtstagsfeier hatte sie erzählt, dass das damals bei allen jungen Paaren so war. In den 1970er Jahren verdiente Werner bei Opel genug, um alleine die Familie zu versorgen und aus der Mietwohnung in ein Reihenhaus umziehen zu können. Als die Kinder mit der Schule fertig waren, wollte Renate wieder arbeiten, aber für einen neuen Bürojob hatte sie zu lange pausiert. Von 1990 bis zur Rente arbeitete sie halbtags an der Kasse im Supermarkt. Werner wurde nach 44 Jahren Betriebszugehörigkeit mit 60 Jahren mit einer Abfindung in den Vorruhestand geschickt. Immerhin: Die Geburtstagsfeier hat bestimmt eine Menge Geld gekostet. Neben den Verwandten waren auch viele ehemalige Kollegen eingeladen, v. a. von der Gewerkschaft, in die Werner Schneider schon als Auszubildender eingetreten war. Und regelmäßige Urlaube leisten sich die Großeltern auch – also scheint die Rente gar nicht so schlecht zu sein.
Laura und Max haben die Erzählungen ihrer Großeltern mit ihrem bisherigen Leben verglichen: In dem Alter, in dem sie zu studieren angefangen haben, hatten die Großeltern bereits geheiratet, und zwei Jahre später war das erste Kind da. Laura plant, nach dem Bachelor noch ein Masterstudium anzuschließen und will auf jeden Fall für ein oder zwei Jahre ins Ausland gehen. Kinder will sie später vielleicht auch haben, aber sie kann sich nicht vorstellen, dafür dauerhaft auf einen Job zu verzichten. Max findet die Vorstellung, über 40 Jahre in der gleichen Firma zu arbeiten, nicht nur extrem langweilig, sondern auch heutzutage völlig unrealistisch! Aus seiner WG kennt er viele Geschichten von wechselnden Praktika und befristeten Verträgen. Dass man mehr als 50 Jahre Beiträge an eine Gewerkschaft zahlt, leuchtet ihm auch nicht ein. Allerdings wissen Max und Laura auch, dass sie auf jeden Fall länger als ihre Großeltern arbeiten müssen – und dass es dann noch eine Rente gibt, von der man leben kann, können sie sich kaum vorstellen. Am Ende hat sich Laura gefragt: Was hat sich eigentlich geändert – sind wir anders als unsere Großeltern oder haben sich die Strukturen geändert, in denen wir leben?
Laura hat recht: Die Lebensläufe haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Blickt man noch länger zurück, so zeigt sich ein noch größerer Wandel.
In vorindustriellen agrarischen Gesellschaften war nicht nur die durchschnittliche Lebenserwartung wesentlich kürzer als heute. Hinzu kam, dass der Tod in jedem Alter drohte. Die Säuglingssterblichkeit war hoch, und auch wer die frühe Kindheit überlebt hatte, war stets der Gefahr von Krankheiten, Missernten und Hungersnöten, Krieg und anderen Katastrophen ausgesetzt. Wie lange das Leben dauerte und wie das Leben verlief, war zu einem großen Anteil von Zufällen und äußeren Ereignissen abhängig. Zu welchem Stand man gehörte, war durch die Geburt festgelegt und kaum durch eigenes Handeln veränderbar. Kinder mussten früh bei der Arbeit auf dem Feld mithelfen, und Wissensvermittlung, Bildung und die Weitergabe beruflicher Kenntnisse erfolgte innerhalb des Familienverbundes. Eheschließung, Familiengründung und der Erwerb von Besitz war für große Teile der Bevölkerung gar nicht möglich. Wer zu alt oder zu krank zum Arbeiten war, war wiederum auf die Unterstützung anderer Familienmitglieder angewiesen. Insgesamt waren Lebensläufe in vorindustriellen Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, »dass das Einzelleben für weite Teile der Gesellschaft eingebettet war in das an die Scholle gebundene Familienschicksal« (Mayer 1998, 448). Zwar gab es auch in vorindustriellen Gesellschaften Darstellungen des Lebenszyklus von der Geburt bis zum Tod, aber Lebensphasen wie Kindheit, Erwachsenenleben und Alter waren weniger klar strukturiert, weniger voneinander abgegrenzt und die Übergänge zwischen den Lebensphasen variierten je nach individuellem Schicksal.
Diese Lebensphasen, in die wir heute wie selbstverständlich Lebensläufe aufteilen, entwickelten sich erst im Übergang zur Industriegesellschaft. Verbesserte hygienische Verhältnisse, Steigerungen der Nahrungsmittelproduktion und Verbesserungen in der medizinischen Versorgung führten zu einem Anstieg der Lebenserwartung und damit auch zu einer größeren Vorhersehbarkeit in Bezug auf den weiteren Lebensverlauf. Die tatsächliche Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht verstärkten die Ausdifferenzierung einer eigenständigen Lebensphase Kindheit auch über das Bürgertum hinaus. Neue industrielle Berufsbilder erforderten verlängerte Schulzeiten und neue Formen der beruflichen Ausbildung, die wesentlich zur Entstehung der Lebensphase Jugend beitrugen.
In der Industriegesellschaft wurde dann für männliche Erwachsene entlohnte Erwerbstätigkeit (inklusive Phasen erzwungener Arbeitslosigkeit) zum dominierenden Strukturelement ihres Lebenslaufs. Frauen waren mindestens bis zur Eheschließung auf dem Arbeitsmarkt aktiv, an die sich rasch die Geburten und eine längere Phase der Versorgung und Betreuung der Kinder anschloss. Parallel dazu entstand der moderne Wohlfahrtsstaat, der mit Krankenversicherung (ab 1883), Unfallversicherung (ab 1884), Invaliditäts- und Altersversicherung (ab 1889), Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (ab 1922), staatlicher öffentlicher Fürsorge (ab 1924) und schließlich der Arbeitslosenversicherung (ab 1927) bei immer mehr Risiken im Lebenslauf finanzielle Unterstützung und staatliche Regulierungen vorsah. Die Altersversicherung wurde anfangs erst ab dem 70. Lebensjahr (das die wenigsten Versicherten damals erlebten) und nur als »Sicherheitszuschuss zum Lebensunterhalt« gezahlt. Doch mit einem immer weitere Bevölkerungsgruppen umfassenden Altersversicherungssystem begann die Ausdifferenzierung der Lebensphase »Ruhestand«, die gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass man nicht mehr erwerbstätig sein musste.
Hinter diesen Umbrüchen wird ein dreigeteilter Lebenslauf (vgl. Kohli 1985) erkennbar, der aus einer Qualifizierungs- und Ausbildungsphase (Kindheit und Jugend), einer Erwerbsphase (Erwachsenenalter) und dem Ruhestand (Alter) besteht. Während die Qualifizierungsphase wesentlich vom Bildungssystem dominiert wird, steht in der mittleren Lebensphase der Arbeitsmarkt mit allen damit verbundenen sozialpolitischen Regulierungen und Organisationen im Mittelpunkt. Im Ruhestand sind die Alterssicherungssysteme der zentrale Referenzpunkt.
Männer und Frauen verknüpfen in der Industriegesellschaft Familiengründung und Kinderbetreuung sehr unterschiedlich mit der Erwerbsphase, wodurch sich geschlechtsspezifische Lebensläufe herausbilden. Während Männern die Rolle des Familienernährers zugewiesen und damit die Bedeutung der Erwerbsarbeit verstärkt wird, wird von Frauen erwartet, für die Familienarbeit wie die Versorgung und Betreuung der Kinder (und später der eigenen Eltern) die Erwerbsbiographie zu unterbrechen und eigene Karriereambitionen zurückzustellen (vgl. Krüger 1995).
Für Kohli (1985; 2003) wird in modernen Gesellschaften der Lebenslauf selbst zur Institution. Einerseits wird der Lebenslauf immer stärker normiert und standardisiert. Andererseits wirkt dieser normierte und standardisierte Lebenslauf immer stärker normierend auf die Individuen ein, sich an dieser vorgegebenen Struktur zu orientieren. In der Industriegesellschaft wird die Regulierung der Abfolge der einzelnen Sequenzen im Lebensverlauf – von der Geburt im Krankenhaus über die Betreuung in der Kindertagesstätte, der Einschulung, dem Übergang in Berufsausbildung oder Studium, dem Eintritt in den Arbeitsmarkt, Phasen der Erwerbslosigkeit, den Austritt aus dem Arbeitsmarkt und den Beginn des Ruhestandes bis hin zu Pflegebedürftigkeit und dem Tod – immer umfassender. Gleichzeitig werden die lebensweltlichen Sinnwelten und Erwartungen, innerhalb derer Individuen handeln, immer stärker von diesem vermuteten Normallebenslauf strukturiert. So enthält der institutionalisierte Lebenslauf etwa allgemein geteilte Erwartungen, in welcher Lebens- oder Altersphase bestimmte Ereignisse wie z. B. der Beginn der Berufstätigkeit oder die Familiengründung zu erfolgen haben. An solchen allgemein geteilten Erwartungen orientieren Menschen dann wiederum ihr Handeln. Der Lebenslauf wird damit für Kohli zu einer eigenständigen gesellschaftlichen Strukturdimension, die die Gestalt eines Lebenslaufregimes annimmt.
Dem widerspricht nicht, dass Menschen ihre biographischen Entscheidungen – welche Schule sie besuchen (oder auch nicht), ob und wie viele Kinder sie haben wollen (oder auch nicht), welchen Job sie annehmen (oder auch nicht), welches Modell zur Koordination von Erwerbsarbeit und Familienarbeit sie für sich wählen – nach ihren individuellen Präferenzen und Erwartungen treffen und damit ihre individuelle Biographie durchaus auch in Abweichung von einer vermuteten Normalbiographie gestalten. Im Lebenslauf verschränken sich gesellschaftliche Strukturen (die Makroebene der Gesellschaft) und individuelle Handlungen (die gesellschaftliche Mikroebene) zu einer »Koproduktion sozialstruktureller Bedingungen und individueller Handlungen im Zeitablauf« (Heinz/Sackmann 2020, 248). Menschen treffen individuelle biographische Entscheidungen innerhalb der Strukturbedingungen, die u. a. von jeweils dominierenden Lebenslaufregimes vorgegeben werden. Ihre Handlungsfähigkeit muss in Relation zu den sie umgebenden Strukturen verstanden werden. Gleichzeitig beeinflussen sie durch ihre Handlungen – welche Berufe sie z. B. ausüben, wie viele Kinder sie zur Welt bringen, wie sie Familien- und Erwerbsleben miteinander kombinieren – die Weiterentwicklung dieser Strukturen. Individuelle Lebensläufe sind dann »das (kontingente) Resultat eines komplexen structure-agency-Zusammenspiels über die Zeit« (Wingens 2020, 122).
Lebenslauf
Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Lebenslauf meist eine strukturierte Darstellung über bisherige Bildungsabschlüsse und Berufstätigkeiten, die im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für eine neue Stelle oder für die Aufnahme in einer bestimmten Organisation verfasst werden muss. Der soziologische Begriff des Lebenslaufs geht darüber hinaus und bezieht sich auf die historisch und kulturell durchaus unterschiedlichen Regelsysteme, die die Abfolge von Ereignissen, Lebensabschnitten und Übergängen in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen wie etwa der Familie, dem Bildungssystem oder der Erwerbsarbeit strukturieren und miteinander verknüpfen. Handlungen, Ereignisse und Episoden (z. B. die Bewerbung auf eine Stelle und die Zu- oder Absage durch den Arbeitgeber oder das Zusammenziehen mit der Partnerin, die Geburt des ersten Kindes und die Elternzeit) verknüpfen sich in der Biographie zu einem subjektiven »Erfahrungs- und Handlungszusammenhang« (Kohli 2018, 261). Da damit auch der Wechsel von Positionen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen verbunden ist (etwa von der studentischen Hilfskraft zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin und Fachreferentin oder vom Ersatzspieler zum Stammspieler im örtlichen Fußballverein) lassen sich Lebensläufe auch als unterschiedliche Karrieren – hier die Berufskarriere, dort die Karriere im Freizeitsport – beschreiben.
In der empirischen Forschung zu Lebensläufen lassen sich zwei Theorie- und Methodenstränge unterscheiden. Die Lebenslaufanalyse untersucht typische Abfolgen von Ereignissen, Übergängen und Positionen über die Zeit bei größeren Gruppen von Individuen und nutzt dafür umfangreiche und komplexe quantitative Methoden. Die Biographieforschung »setzt in ihren Untersuchungen an individuellen Lebensläufen an«, »bemüht sich um die Rekonstruktion der Lebensgeschichte der Befragten« (Kelle/Kluge 2001, 13) und greift dazu auf qualitative Verfahren zurück. In den letzten zwei Jahrzehnten haben Forschungsansätze an Bedeutung gewonnen, die auf eine Kombination und Integration dieser beiden Stränge zielen (Kluge/Kelle 2001). Für Lebenslauf- und Biographieforschung gleichermaßen gilt, dass sie weniger an der Analyse von Zuständen als vielmehr an Verläufen und Entwicklungen über die Zeit interessiert sind.
1.1.2 Alter, Kohorte und Generation
Den drei Begriffen Lebenslauf, Biographie und Karriere gemeinsam ist die Bedeutung der zeitlichen Dimension, wobei sich mehrere Zeitebenen unterscheiden lassen. Es geht zum einen um den biologischen Alternsprozess im Verlauf des Lebens und es geht darüber hinaus um biographische Zeiterfahrungen im Sinne von Erinnerungen an Vergangenes in der Biographie und Erwartungen für die Zukunft. Entscheidungen, Handlungen und Entwicklungen in früheren Lebensphasen beeinflussen die Handlungsmöglichkeiten in späteren Phasen. So können etwa vorhandene oder nicht vorhandene Bildungsabschlüsse spätere Berufskarrieren ermöglichen oder limitieren. Gleichzeitig können Erwartungen an spätere Entwicklungen wie etwa die Familiengründung zeitlich vorgelagerte Entscheidungen z. B. bei der Berufswahl beeinflussen. Hinzu kommen historische Zeitdimensionen (wie im Beispiel von Laura und ihren Großeltern, ▸ Kap. 1.1.1) und institutionelle Zeithorizonte, die z. B. für die Schulpflicht oder den Eintritt in den Ruhestand gelten.
Mit dem chronologischen Alter wird der Alterungsprozess messbar gemacht und in Jahre, Monate, Wochen etc. untergliedert. Dass Menschen exakt wissen, wie alt sie und die Menschen um sie herum sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Dazu sind schriftliche Dokumente wie Geburtsregister und Geburtsurkunden erforderlich. Bedeutsam wird das Wissen um sein chronologisches Alter dann, wenn Altersnormen bestimmte Handlungen und Erwartungen an ein festgelegtes Alter knüpfen, wie das etwa im Konzept der Volljährigkeit geschieht. Manche dieser Altersnormen sind gesetzlich fixierte starre und verbindliche Normen (wie z. B. das Mindestalter für den Erwerb des Führerscheins), andere sind eher flexible und nach unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich ausgeprägte Kann-Erwartungen (wie etwa Vorstellungen darüber, ab welchem Alter ältere Menschen nicht mehr Auto fahren sollten). Sackmann definiert das soziale Alter als »ein durch gesellschaftliche Kategorien und Normen bestimmtes Bündel an Erwartungen von Altersstatus und Altersrollen, die an das Individuum herangetragen werden, von diesem verinnerlicht werden und im Handeln transformiert werden« (Sackmann 2013, 35).
Altersnormen und das soziale Alter haben einen wesentlichen Einfluss auf den Lebenslauf, geben sie doch vor, wann im Lebenslauf welche Handlungen und Übergänge erwartet werden. Wiederum kann zwischen verbindlichen Muss-Erwartungen (wie etwa den U-Untersuchungen in der Kindheit, dem Beginn und Ende der Schulpflicht, den Strafmündigkeitsgrenzen, sozialrechtlichen Altersgrenzen wie z. B. beim BAföG oder – auf der anderen Seite des Lebenslaufs – beim Rentenbeginn) und Soll- oder Kann-Erwartungen wie etwa dem Auszug Jugendlicher aus dem Elternhaus, der ersten Partnerschaft oder der Familiengründung differenziert werden. Besonders dicht ist die Abfolge solcher Altersnormen in der Kindheit und in der Jugend. In Anlehnung an die Entwicklungspsychologie haben Hurrelmann und Quenzel daraus das Konzept sozialer Entwicklungsaufgaben entwickelt.
»Entwicklungsaufgaben beschreiben die für die verschiedenen Altersphasen typischen körperlichen, psychischen und sozialen Anforderungen und Erwartungen, die von der sozialen Umwelt an Individuen der verschiedenen Altersgruppen herangetragen werden und/oder sich aus der körperlichen und psychischen Dynamik der persönlichen Entwicklung ergeben« (Hurrelmann/Quenzel 2016, 24).
Die Übergänge zwischen den Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Alter ergeben sich dann weniger aus verbindlichen Altersnormen als vielmehr aus der Bewältigung der mit der jeweiligen Lebensphase verbundenen Entwicklungsaufgaben. Wie starr und für alle verbindlich oder flexibel und individuell unterschiedlich diese Entwicklungsaufgaben und die Übergänge zwischen den Altersphasen sind, unterscheidet sich zwischen einzelnen Gesellschaften und Zeitepochen. Je nach Gesellschaft und Zeit werden Übergänge zwischen Altersphasen und innerhalb der einzelnen Altersphase mehr oder weniger deutlich durch entsprechende Übergangsrituale markiert und öffentlich gestaltet. So sind z. B. in Deutschland Abschlussfeiern zum Abitur oder zum Bachelor seit vielen Jahren wieder beliebte Rituale, zu deren Durchführung Organisationskommitees gegründet und Budgetpläne erstellt werden.
Wie sehr Altersnormen und alterstypische Ereignisse und Handlungen dem sozialen Wandel unterliegen, lässt sich am Beispiel der Familiengründung zeigen. In den 1960er und 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts waren Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt zwischen 24 und 25 Jahre alt – auch Lauras Großmutter Renate aus dem Beispiel vom Anfang des Kapitels (▸ Kap. 1.1.1). Seither ist das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes kontinuierlich gestiegen und liegt inzwischen bei etwa 30 Jahren. Früher geborene Frauen haben also früher Kinder zur Welt gebracht als später geborene Frauen.
Die Lebenslaufforschung unterscheidet zwischen Alterseffekten und Kohorteneffekten. Mit dem Begriff der Geburtskohorte werden alle bezeichnet, die im gleichen Jahr geboren worden sind. Man kann also formulieren: Die Geburtskohorten der um 1950 geborenen Frauen waren bei der Geburt des ersten Kindes jünger als die Geburtskohorten der um 1990 geborenen Frauen. Daraus lässt sich dann auch ableiten, dass sich am Vergleich verschiedener Alterskohorten der – wodurch auch immer verursachte – soziale Wandel ablesen lässt. Kohorten müssen nicht über Geburtsjahrgänge definiert werden, auch andere Ereignisse wie der schon erwähnte Schulabschluss können Kohorten definieren. Verglichen werden können dann z. B. verschiedene Abiturjahrgänge.
Kohortenanalyse
Die Kohortenanalyse, also der Vergleich verschiedener Kohorten, ist in der Lebenslaufforschung und in der Soziologie ganz allgemein eine klassische Form der Erforschung des sozialen Wandels.
Der Beginn der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 hat nicht nur die Abiturfeiern, sondern auch den Unterricht und die Lehre an Schulen und Hochschulen kurzfristig völlig verändert. Der übliche Präsenzunterricht musste kurzfristig auf Online-Unterricht und später dann auf Wechselunterricht und andere Organisationsformen umgestellt werden. Die COVID-19-Pandemie hat massiv in die Lebensläufe von Menschen aus allen Altersklassen eingegriffen: Kinder konnten nicht mehr wie gewohnt in die Kita und die Grundschule gehen, jugendliche Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mussten ihr Abitur nach Monaten der Distanzlehre schreiben (und auf die Abiturfeier verzichten), erwachsene Berufstätige konnten ihre Berufe etwa in der Gastronomie nicht mehr ausüben und alte Menschen durften im Pflegeheim plötzlich nicht mehr von ihren Angehörigen besucht werden. Der Beginn der Pandemie hat also alle Altersgruppen betroffen und alle Geburtskohorten, aber in unterschiedlichen Phasen ihres Lebenslaufs. »Personal-biographische Veränderungen«, die als Reaktionen auf ein solchermaßen »gravierendes historisches Ereignis« (Wingens 2020, 80) interpretiert werden können, werden Periodeneffekte genannt.
Will man also etwa Bildungserfolge von Schülerinnen und Schülern untersuchen, kann zwischen Alterseffekten (sechsjährige Grundschülerinnen und -schüler lernen anders als 18-jährige Abiturientinnen und Abiturienten), Kohorteneffekten (heutige Grundschülerinnen und -schüler unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von Grundschulklassen 1970) und Periodeneffekten (z. B. Distanzunterricht durch die COVID-19-Pandemie) unterschieden werden.
Diese Unterscheidung zwischen Alters-, Kohorten- und Periodeneffekten ist in der Theorie recht einleuchtend, in der Praxis und in empirischen Studien aber oftmals nicht trennscharf herauszuarbeiten. So ist aus der aktuellen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Drogenkonsum von Jugendlichen bekannt, dass der Anteil der Zigarettenraucherinnen und -raucher von knapp einem Prozent bei den 12- und 13-Jährigen auf knapp 24 Prozent bei den 18- bis 19-Jährigen steigt (vgl. Orth/Merkel 2020, 22). Das ist ein klarer Alterseffekt, der zeigt, dass der Beginn des Rauchens in die Lebensphase Jugend fällt und mit steigendem Alter dann immer mehr Jugendliche mit dem Rauchen anfangen. Da diese Befragungen seit rund 30 Jahren in vergleichbarer Form durchgeführt werden, wissen wir allerdings auch, dass der Anteil der Raucherinnen und Raucher unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit Jahren rückläufig ist. Das sieht nach einem klassischen Kohorteneffekt aus, der darauf zurückzuführen ist, dass später geborene Kohorten weniger häufig rauchen als früher geborene Kohorten. Doch wie stark ist dabei der Periodeneffekt, der mit dem Hochsetzen der Altersgrenze für das Rauchen von 16 auf 18 Jahre im Jugendschutzgesetz und der Einführung mehrerer Nichtraucherschutzgesetze im Jahr 2007 verknüpft ist? Und noch etwas muss berücksichtigt werden: Mit Alters-, Kohorten- und Periodeneffekten alleine lassen sich die Daten zum Rauchen von Jugendlichen keineswegs hinreichend beschreiben. Hinzu kommen z. B. statistische Unterschiede bei der Frage nach dem Rauchen zwischen Mädchen und Jungen (die über die Zeit eher abgenommen haben) und zwischen verschiedenen Schularten. Und die jeweils individuellen Gründe, warum jemand mit dem Rauchen anfängt oder nicht, sind nur über qualitative Verfahren zugänglich.
Der Kohortenbegriff ist klar definiert und in empirischen Studien auch gut operationalisierbar. Deutlich komplizierter verhält es sich mit dem Generationenbegriff. Der klassische Text zum »Problem der Generationen« stammt aus dem Jahr 1928 und wurde von Karl Mannheim (1893 – 1947) verfasst, der damit ein Verständnis von Generationen begründete, das sich bis heute gehalten hat. Mannheim ging davon aus, dass junge Menschen, die in der gleichen historischen Zeit in einer Gesellschaft aufwachsen, ähnliche prägende Erfahrungen machen und sich daraus ein »natürliches« Weltbild entwickelt, das sich vom Weltbild anderer Zeiten unterscheidet. Das reicht aber Mannheim zufolge noch nicht aus, damit sich aus dieser »Generationslagerung« auch ein tatsächlicher »Generationszusammenhang« entwickelt. Dazu kommt für ihn noch eine »Verbundenheit« durch die Partizipation an »gemeinsamen Schicksalen« und Kollektivereignissen hinzu. Generationen sind also – folgt man Mannheim – mehrere nah beieinanderliegende Alterskohorten innerhalb einer räumlich gebundenen Gesellschaft, die in ihrer Jugend ähnlich prägende Erfahrungen gemacht haben und durch schicksalhafte Erlebnisse verbunden sind. Der Wechsel von einer Generation zur nächsten erfolgt in Zeiten beschleunigten sozialen Wandels schneller, wenn die zeitlichen Erfahrungszusammenhänge, die junge Menschen in diesem Sinn prägen, und die schicksalhaften Ereignisse sich schneller ablösen. In Zeiten verlangsamten sozialen Wandels verlangsamt sich auch die Generationenfolge, wodurch mehr Geburtskohorten zur gleichen Generation gehören. Damit löste sich Mannheim von der gängigen Vorstellung, dass eine Generation aus einer festgelegten Zahl von Geburtskohorten bestand. Umgekehrt ergibt sich sozialer Wandel geradezu dadurch, dass gemeinsame Erfahrungen und schicksalhafte Erlebnisse in der Jugend jeweils neue Generationen mit einem eigenen Weltbild hervorbringen können, die dann später die Generation davor als »Kulturträger« ablösen.
So nachvollziehbar dieses sehr einflussreiche und grundlegende Konzept von Mannheim auch klingt, zeigen sich doch etliche Unschärfen in der praktischen Anwendung etwa in der empirischen Sozialforschung. Für junge Männer, die den Ersten Weltkrieg als Soldaten erlebt haben, mag die Vorstellung von verbindenden schicksalhaften Erlebnissen noch zutreffen, wobei es durchaus einen Unterschied machte, in welcher Position man am Krieg teilgenommen hatte. Während des Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg unterschieden sich die Schicksale verschiedener Täter- und Opfergruppen diametral voneinander, so dass daraus kaum ein gemeinsames Generationenverständnis und Weltbild ableitbar wäre. In der Nachkriegszeit machte Schelsky (1957) den Begriff der »skeptischen Generation« für junge Menschen in Westdeutschland zwischen 1945 und 1955 populär, die ihre frühen und in Mannheims Sinn prägenden Jahre während der Zeit des Nationalsozialismus verbracht hatten. Gut zehn Jahre später entstand dann das Label der »68er Generation«, mit dem die protestierenden Studierenden der späten 1960er und frühen 1970er Jahre bezeichnet wurden. Dabei bleibt außen vor, dass der größte Teil der jungen Menschen »1968« gar nicht studierte, und selbst unter den Studierenden waren die in der Studentenbewegung aktiven nur eine Minderheit.
Der nächste Generationenbegriff kam dann aus den USA, wo mit dem Begriff der »Baby Boomer« die geburtenstarken Jahrgänge bezeichnet wurden. In Deutschland waren das die Geburtsjahrgänge von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre, die zumindest die Erfahrung teilten, überall – ob in Schule, Ausbildung, Universität oder bei der Arbeitsplatzsuche – viele gewesen zu sein. Wie sich daraus dann aber ein Generationenzusammenhang oder gar kollektive Lebensläufe ergeben sollen, bleibt unklar. Seither werden insbesondere im Feuilleton immer neue Generationen ausgerufen, bei denen das die jeweilige Generation konstituierende gemeinsame Ereignis oder »Schicksal« eher im Verborgenen bleibt. Das gilt für die Generation X, Y und Z ebenso wie für die Generation der Millennials oder die »Generation Praktika«. Interessant ist, dass die historischen Ereignisse von 1989/90 – der Fall der Mauer, das Ende der DDR und der Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik – bislang nicht zu neuen Generationsetiketten geführt haben, was wohl daran liegen könnte, dass diese kollektiven Erfahrungen die Lebensläufe der Menschen im Osten zwar dramatisch, die der Menschen im Westen hingegen nur bedingt beeinflusst haben. Ob irgendwann die »Generation Corona« ausgerufen wird, bleibt abzuwarten. In der Lebenslaufforschung findet sich jedenfalls weitaus häufiger der nüchterne, allerdings auch eher theorielose Begriff der Geburtskohorte als der vielfach aufgeladene Generationenbegriff.
1.1.3 Individualisierung und die De-Standardisierung des Lebenslaufs
Der dreigeteilte Lebenslauf mit Qualifizierungs- und Ausbildungsphase (Kindheit und Jugend), Erwerbsphase (Erwachsenenalter) und dem Ruhestand (Alter) entwickelt sich mit der Industriegesellschaft, setzt sich in den industrialisierten Nachkriegsgesellschaften immer stärker durch und wird in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem »Regelsystem der zeitlichen Dimension des Lebens« (Wingens 2020, 152), an dem sich sowohl die Individuen als auch die Gesellschaft immer stärker orientieren. Während der Blütezeit dieses Lebenslaufregimes in den 1950er bis 1970er Jahren waren zentrale Phasen und Übergänge für den Einzelnen und die Einzelne erwartbar und wurden in der Folge auch von den Individuen erwartet.
Für die Bundesrepublik Deutschland zeichnete sich dabei folgendes Phasenmodell ab: Die frühe Kindheit wurde überwiegend zu Hause und dort bei den Müttern verbracht. Im sechsten Lebensjahr erfolgte dann die Einschulung, in den 1950er Jahren meist noch in die geschlechts- und konfessionsgetrennte Volksschule, die dann allmählich von der koedukativen staatlichen Grundschule abgelöst wurde. In den 1950er Jahren war die Volksschule die Regelschule und nur wenige Kinder besuchten mittlere oder höhere Schulen. Mit dem Ausbau des Bildungssystems ab den 1960er Jahren wechselten die Kinder dann nach vier Jahren innerhalb des dreigliedrigen Schulsystems auf die Hauptschule, die Realschule oder ins Gymnasium. Mit diesen Entscheidungen waren sich stark unterscheidende weitere Lebensläufe und Karrieren verbunden, zwischen denen nur schwer gewechselt werden konnte. Auf die Schule folgte eine Ausbildung oder ein Studium und danach – bei den Männern unterbrochen durch die von 1956 bis 2010 geltende Wehrpflicht – der schnelle Eintritt ins Berufsleben.
Getragen von einem stetigen Wirtschaftswachstum dieser Jahrzehnte waren sowohl der Erfolg bei der Jobsuche als auch ein beruflicher Aufstieg und Karriere im Erwerbsleben erwartbar und wurden wiederum auch von den Einzelnen erwartet. Bei der privaten Lebensführung dominierten Ehe und Familiengründung Erwartungen und auch Verhalten. Spätestens nach der Geburt des ersten Kindes verließen die Mütter den Arbeitsmarkt oder reduzierten zumindest die Arbeitszeit, während die Väter weiter an ihren Karrieren arbeiteten. Während manche Frauen auch nach dem Auszug der Kinder in der Hausfrauenrolle verblieben, versuchten andere nach der Kinderphase wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wo dann meist die Männer bereits mehrere Karriereschritte absolviert hatten. Die mitgliederstarken Gewerkschaften handelten Jahr für Jahr stabile Lohnzuwächse aus, so dass ein dauerhafter Aufstieg und Wohlstand für alle möglich schien. Zur (männlichen) »Standarderwerbsbiographie« gehörte i. d. R. eine qualifizierte Ausbildung, danach die Übernahme als Facharbeiter, und im Anschluss dann eine mehr als 40 Jahre andauernde Erwerbskarriere, wobei der Arbeitgeber eher selten gewechselt wurde. Der Übergang in die Rente erfolgte regelmäßig bei den Männern mit 65 Jahren und bei den Frauen ein paar Jahre früher. Zur »Standarderwerbsbiographie« passte der »Standardrentner«, der 45 Jahre lang gearbeitet und Beiträge gezahlt hatte. Durch die Rentenreform von 1957 waren die Renten an die Entwicklung der Arbeitseinkommen gekoppelt worden und dadurch deutlich gestiegen, wodurch auch in der Lebensphase Alter ein abgesichertes Leben und Teilhabe an der Wohlstandsentwickung möglich wurde. Die finanzielle Absicherung der Frauen erfolgte meist über den Ehemann und auch nach dessen Tod über die Witwenrente. Die gesetzliche Krankenversicherung deckte die gesundheitlichen Risiken ab, und Pflege- und Betreuungsbedarf wurde meist innerhalb der Familie von der Ehefrau oder von Töchtern oder Schwiegertöchtern übernommen.
Bereits auf dem Höhepunkt der Durchsetzung dieses dreigeteilten Normallebenslaufs in den 1970er Jahren begann indes die Grundlage des Modells zu erodieren. Mit der Ölkrise von 1973 deuteten sich erste Wirtschaftskrisen an, die die Vorstellung eines immerwährenden Wirtschaftswachstums erschütterten. In der Folge der Bildungsexpansion stieg der Anteil der Studierenden und auch der Frauen unter den Studierenden stark an. Die Studentenbewegung und die Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre wirbelten die Vorstellungen von Ehe, Familie und einer festgelegten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, bei der die Männer für das Erwerbsleben und die Frauen für die Familie und die Kindererziehung zuständig waren, durcheinander.
Bereits in seinem für die deutsche Diskussion grundlegenden Artikel zur »Institutionalisierung des Lebenslaufs« von 1985 hatte Kohli vorsichtig auf Anzeichen hingewiesen, dass »der Prozess der Chronologisierung zu einem Stillstand gekommen ist oder sich sogar umgekehrt hat« (Kohli 1985, 22). Solche Anzeichen sah er in Veränderungen des familialen Verhaltens (z. B. im Anstieg des Heiratsalters, in den sinkenden Geburtenzahlen, steigenden Scheidungsraten und insgesamt einer »Destandardisierung des Familienzyklus«), in Veränderungen im Erwerbsleben (in dem die »Standarderwerbsbiographie« durch Arbeitslosigkeit und wechselnde Beschäftigungsverhältnisse immer mehr an Bedeutung verlor) und einen Bedeutungsverlust ehemals strikter Altersnormen für z. B. formale Bildungsprozesse oder auch Sexualität.
Ulrich Beck (1944 – 2015) setzte in seinem zum Klassiker avancierten Buch über die »Risikogesellschaft« den Begriff der Individualisierung gegen das Konzept der Institutionalisierung (Beck 1986) und beschrieb eine Wirklichkeit, die der »Standarderwerbsbiographie« immer weniger entsprach. Die »Standarderwerbsbiographie« verlor an Bedeutung, weil einerseits immer mehr – zunehmend auch noch gut ausgebildete – Frauen erwerbstätig wurden, die versuchten, Job, Familie und Kindererziehung miteinander zu vereinbaren und dafür auf Teilzeitarbeit und Erziehungszeiten zurückgriffen. Andererseits gelang es auch den Männern in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse immer weniger den Vorgaben der dauerhaften Erwerbstätigkeit und Beitragszahlungen an die Rentenkasse zu entsprechen. Aber nicht nur im Erwerbsleben, sondern auch bei privaten Lebensformen und im Verhältnis der Geschlechter zeichneten sich dramatische Veränderungen ab. Scheinbar fest zementierte Männer- und Frauenrollen sowie Mütter- und Väterrollen wurden zunehmend hinterfragt, und an die Stelle einer traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenteilung in der Familie traten komplexe Aushandlungsprozesse in sich ausdifferenzierenden inner- und außerfamiliären Lebensformen. Parallel dazu verloren klassen- und schichtspezifische Lebensstile und Arten der Lebensführung an Bedeutung. Für Beck bedeutet Individualisierung einerseits Befreiung aus überkommenen Zwängen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Damit sind aber auch andererseits Stress und Stabilitätsverlust verbunden: »Die Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Arbeitsplatz, Wohnort, Ehepartner, Kinderzahl, usw. mit all ihren Unterentscheidungen können nicht nur, sondern müssen getroffen werden« (Beck 1986, 216). In der sich individualisierenden Gesellschaft wird das Individuum zum Planungsbüro seiner eigenen Biographie und Karriere in allen Lebensbereichen.
Als dritte Dimension der Individualisierung beschreibt Beck das Entstehen neuer Mechanismen der Re-Integration, die an die Stelle starrer gesellschaftlicher Erwartungshaltungen treten und trotz Stabilitätsverlust und neuer Vielfalt den gesellschaftlichen Zusammenhalt absichern. Wenn z. B. nicht mehr sichergestellt ist, dass Frauen die Care-Arbeit – also etwa die Betreuung und Erziehung der Kinder und die Pflege der Alten – übernehmen, dann führt das zu einem Ausbau der frühkindlichen Betreuungsplätze und der ambulanten Pflegedienste.
Gut 30 Jahre später sind einige dieser Begrifflichkeiten aus der Soziologie in den Alltagssprachgebrauch übergegangen. Von einer Pluralisierung privater Lebensformen, von Patchworkbiographien und von Patchworkfamilien sprechen längst nicht nur Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, und flexible Bildungsverläufe, andauernde Praktika und prekäre Beschäftigungsverhältnisse gehören zu den Alltagserfahrungen vieler Menschen in ihren individuellen Lebensverläufen. Mit der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und der Abkehr von der starren Zweigeschlechtlichkeit auch im Personenstandsrecht und im bürokratischen Formularwesen durch die Einführung einer dritten Kategorie bei der Frage nach dem Geschlecht zeigt sich, wie weit die Individualisierung auch in Fragen der Sexualität und im kodifizierten Recht vorangekommen ist. Und ob Frauen und Männer heiraten, wenn sie eine Familie gründen, ist weitgehend ihnen überlassen und nicht mehr mit gesellschaftlichen Sanktionen belegt.
So unstrittig diese Individualisierungstendenzen und die damit verbundene De-Standardisierung des Lebenslaufs einerseits erscheinen, so uneindeutig und widersprüchlich sind andererseits die bis heute vorliegenden empirischen Befunde und die Schlussfolgerungen daraus.
1.1.4 Bildung, Erwerbsarbeit und Familie im Lebenslauf
Im Bildungssystem kam es in der Bundesrepublik seit den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem massiven Ausbau von Bildungsinstitutionen, der üblicherweise als Bildungsexpansion bezeichnet wird. Auf dem Höhepunkt der Industriegesellschaft verlangte der technologische Fortschritt nach immer besser ausgebildeten Facharbeitern und Ingenieuren, während gleichzeitig der Anstieg des wissensbasierten Dienstleistungsbereichs einen Bedarf nach mittleren und höheren Qualifikationen im administrativen, kaufmännischen und sozialen Bereich offenbarte. Um die bislang nicht genutzten »Bildungsreserven« zu erschließen, wurden Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Universitäten massiv ausgebaut. Ende der 1960er Jahre wurden die Fachhochschulen als neuer Hochschultyp gegründet, die eine praxisnahe Ausbildung auf akademischem Niveau anbieten und damit den gestiegenen Bedarf an akademisch qualifizierten Fachkräften in der Industrie, im Sozialbereich und in der Verwaltung decken sollten. Die Zahl der Studierenden wuchs von rund 250.000 im Wintersemester 1960/61 auf knapp drei Millionen im Wintersemester 2020/21 an (vgl. Statistisches Bundesamt 2020). Mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler beenden ihre Schulzeit inzwischen mit einem zu einem Studium berechtigenden Abschluss. Parallel dazu verlor die Hauptschule an Bedeutung: »Besuchten 1955 noch mehr als 70 Prozent der damals 13-jährigen Schülerinnen und Schüler die Hauptschule (bis 1968 ›Volksschule‹), so reduzierte sich dieser Anteil bis 2015 kontinuierlich auf 12 Prozent« (Erlinghagen/Hank 2018, 142).
Mit der Bildungsexpansion wurden Bildungs- und Berufskarrieren für große Teile der Bevölkerung zugänglich, die früher einer kleinen Gruppe von ohnehin Privilegierten vorbehalten waren. Die einzelnen Bildungsabschlüsse wurden dabei allerdings weniger wertvoll: Wenn immer mehr über Abitur und Hochschulabschluss verfügen, garantieren solche Abschlüsse nicht mehr den Zutritt zu privilegierten Berufspositionen. Dabei wurden auch die Geschlechterverhältnisse durcheinander gemischt: Waren vor der Bildungsexpansion an Gymnasien und Universitäten fast nur Jungen und Männer anzutreffen, so befinden sich heute auf den Gymnasien mehr Mädchen, während auf den Hauptschulen und Förderschulen der Jungenanteil über dem Mädchenanteil liegt. Für immer mehr Ausbildungsberufe im dualen System reicht der Hauptschulabschluss inzwischen aber nicht mehr aus.
Einerseits hat sich die soziale Mobilität durch die Bildungsexpansion erhöht, während andererseits die soziale Ungleichheit durch das Bildungssystem nicht beseitigt wurde. Kinder aus Akademikerfamilien haben noch immer eine deutlich größere Chance, eine weiterführende Schule oder eine Hochschule zu besuchen, als Kinder von Eltern ohne akademische Bildung (vgl. Huinink/Schröder 2019, 216 ff.; Erlinghagen/Hank 2018, 146 ff.). Längst sind auch die Kinder und Enkel diverser Generationen von Arbeitsmigrantinnen und -migranten auf allen Stufen des deutschen Bildungssystems angekommen, woraus sich wiederum andere und vielfältige Bildungs- und Lebensverläufe ergeben. Mit der Veränderung der Hochschulabschlüsse im Rahmen des Bolognaprozesses und der Umstellung vom Diplom auf Bachelor- und Masterabschlüssen wurden eine Vielzahl neuer Studiengänge und Studienabschlüsse eingeführt, die die Unübersichtlichkeit des Bildungssystems noch verstärkt haben.
Das Bildungssystem ist über die letzten 60 Jahre insgesamt nicht nur massiv ausgebaut, sondern auch differenzierter und komplexer geworden. Immer qualifiziertere Bildungsverläufe haben dazu geführt, dass die Zeit, die junge Menschen im Bildungssystem verbringen, deutlich länger geworden ist. Inzwischen schiebt sich für viele junge Männer und Frauen zwischen die Lebensphase Jugend und das – durch Erwerbstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern definierte – Erwachsenenleben eine weitere Lebensphase, die als Postadoleszenz oder »Emerging Adulthood« (Arnett 2000) bezeichnet wird. Wingens zufolge sind die Übergänge vom Bildungssystem ins Erwerbssystem »zeitlich länger und auch gebrochener, komplizierter, flexibler, vielfältiger geworden« (Wingens 2020, 170). Heute »erfolgt nach Ausbildungsabschluss seltener der Eintritt in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis; befristete Arbeitsverträge, Zeitarbeit, Teilzeitarbeit, geringfügige und prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben zugenommen« (Wingens 2020, 170). Hinzu kommt, dass auf die erste Ausbildung oder das erste Studium oft noch weitere Qualifizierungsphasen folgen, wie es z. B. im Bachelor-Master-System vorgesehen ist. Wingens unterscheidet beim Übergang ins Erwerbssystem drei Gruppen: Der ersten und zahlenmäßig größten Gruppe gelingt der Übergang, und an die Ausbildung schließen sich zum Qualifikationsniveau passende Arbeitsverhältnisse an. Je höher der Bildungsabschluss, desto höher sind auch die Chancen für eine zum Abschluss passende Berufskarriere. Eine zweite Gruppe benötigt Umwege und Verzögerungen, schafft dann aber auch den Übergang vom Bildungs- ins Erwerbssystem. Die dritte Gruppe scheitert bereits im Bildungssystem und durchläuft umfangreiche Maßnahmen im sog. »Übergangssystem«, das aus Qualifizierungsangeboten, Ausbildungsprojekten und auf eine Ausbildung vorbereitenden Kursen besteht. Nur einem Teil dieser Gruppe gelingt dann doch noch der Übergang ins Erwerbssystem. Daran ändern offensichtlich auch wirtschaftliche Aufschwungsphasen und ein sich allmählich abzeichnender Fachkräftemangel nichts.
Bereits bei der Betrachtung des Bildungssystems deutet sich an, dass sich Institutionalisierung des Lebenslaufs, De-Standardisierung und Individualisierung nicht unbedingt widersprechen müssen, wenn man zwischen unterschiedlichen soziodemographischen Gruppen differenziert. Für junge Menschen aus der akademischen Mittelschicht sind die Bildungsverläufe länger geworden, bieten mehr individuelle Entscheidungsmöglichkeiten (und -notwendigkeiten) und münden am Ende doch meist in sichere Berufskarrieren. Kinder aus nicht akademisch geprägten Elternhäusern haben größere Chancen auf höhere Bildungs- und Berufskarrieren als ihre Eltern und Großeltern, müssen sich aber im dreigliedrigen Schulsystem erst einmal bewähren und sich dann an den entscheidenden Stellen für Investitionen in noch mehr Bildung entscheiden. Bildungsbiographien, die zur Hochzeit der Industriegesellschaft typisch waren, bei denen auf den Hauptschulabschluss eine Berufsausbildung und eine langjährige Berufskarriere (oft ohne den Arbeitsplatz zu wechseln) folgte und die zu einem Einkommen führten, das Teilhabe am Wohlstand für die ganze Familie versprach, finden sich heute nur noch ausnahmsweise. Wer bereits im Ausbildungssystem scheitert, hat erhebliche Schwierigkeiten beim Übergang in das Erwerbssystem. Mädchen und Frauen haben bei diesen Transformationen im Bildungssystem eher mehr Optionen hinzugewonnen, während v. a. weniger qualifizierte Jungen und Männer eher verloren haben.
Auch in der Erwerbsarbeit hat ein gewaltiger Strukturwandel stattgefunden. Reckwitz beschreibt diesen Strukturwandel als den Übergang von der industriellen zur postindustriellen Ökonomie. Nach dem Höhepunkt der Industriegesellschaft in den 1950er bis 1970er Jahren wurden massiv Arbeitsplätze im industriellen Sektor ab- und im Dienstleistungssektor aufgebaut.
»In einzelnen Regionen ist es zu einer regelrechten Entindustrialisierung gekommen, so im mittleren Westen der USA, in Nordengland, Nordfrankreich oder im Ruhrgebiet. Der westliche Industriearbeiter mit seiner gesellschaftlich geschätzten körperlichen ›harten‹ Arbeit, mit seinem staatlich-gewerkschaftlich gesicherten Mittelklasse-Lebensstandard und verlässlichem Normalarbeitsverhältnis ist im 21. Jahrhundert zu einer nahezu aussterbenden Spezies geworden« (Reckwitz 2019, 78).
Für männliche Industriearbeiter bedeutet das drohender Arbeitsplatzverlust, erneute Qualifizierungsphasen (passend zum Motto des »lebenslangen Lernens«) und diskontinuierliche Berufsbiographien. Männern mit entsprechendem Bildungs- und Ausbildungsniveau verspricht hingegen auch die postindustrielle Ökonomie aufsteigende Berufskarrieren und institutionell strukturierte und abgesicherte Lebensläufe.
Verglichen mit dem institutionalisierten Lebenslauf der 1970er Jahre, der noch weitgehend vom Modell des männlichen Alleinverdieners geprägt war, stehen Frauen heute weitaus mehr Optionen – von der Vollzeiterwerbstätigkeit über unterschiedliche Teilzeitmodelle bis zur ausschließlichen Familienarbeit – zur Verfügung. Da familienbezogene Arbeit weiterhin überwiegend von Frauen übernommen wird, sind es wiederum ganz überwiegend die Frauen, die mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu kämpfen haben. Offen bleibt, ob es sich bei dieser Pluralisierung von Möglichkeiten »wirklich um frei zugängliche Optionen handelt oder eher um fremdbestimmte Muster und erzwungene Reaktionen auf veränderte Opportunitätsstrukturen« (Kohli 2003, 535). Erwerbsbiographien von Frauen sind jedenfalls deutlich häufiger als die von Männern durch Unterbrechungen, Unsicherheiten, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und dadurch De-Standardisierungstendenzen gekennzeichnet.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass unter dem Etikett der Dienstleistungsgesellschaft sehr unterschiedliche Formen von Erwerbstätigkeiten zusammengefasst werden. Zu den Dienstleistungen gehören anspruchsvolle und gute bezahlte Jobs in Bereichen wie Forschung, Medizin, Beratung, Bildung, Medien und Informationstechnologien, aber auch einfache Dienstleistungen, »die eine geringe formale Qualifikation voraussetzen. Zu nennen sind hier etwa die Sicherheits- und die Reinigungsbranche, die Gastronomie, das Transportwesen und die haushaltsnahen Dienstleistungen« (Reckwitz 2019, 80). Gerade hier, bei den einfachen Dienstleistungen, finden sich gehäuft Beschäftigungsformen, die nicht dem Normalarbeitsverhältnis aus dem Modell des institutionalisierten Lebenslaufs entsprechen. Das sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte unbefristete Normalarbeitsverhältnis verschwindet nicht etwa, nur sind die Chancen auf Normalarbeitsverhältnisse oder prekäre Beschäftigungsformen je nach Geschlecht, Bildungsniveau und Migrationsstatus ungleich verteilt.
Auch was den Familienbereich angeht, fallen die empirischen Befunde durchaus unterschiedlich aus. Einerseits haben die Zahlen der nichtehelichen Lebensgemeinschaften, der Alleinerziehenden, der Einpersonenhaushalte und der Paare ohne Kinder zugenommen. Ein Teil dieses Wandels lässt sich allerdings auch über die gestiegene Lebenserwartung erklären, die dazu führt, dass sich bei vielen Paaren an die Familienphase nach dem Auszug der Kinder eine längere nachelterliche Paarphase anschließt. Nach dem Tod eines der beiden Ehepartner taucht der oder die Überlebende dann in der Statistik wiederum als Einpersonenhaushalt auf. Andererseits wachsen auch heute noch die weitaus meisten Kinder in eher traditionell zusammengesetzten Familien auf. Eheschließungen sind etwas seltener und finden oft etwas später im Lebenslauf statt, und auch die Geburt der Kinder hat sich zeitlich nach hinten verschoben. Die durchschnittliche Kinderzahl hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zumindest in den westlichen Bundesländern auch nicht dramatisch verändert. Im Osten Deutschlands waren die Geburtenzahlen im Zusammenhang mit der Vereinigung und dem dadurch bedingten Transformationsprozess zunächst deutlich eingebrochen, hatten sich dann aber wieder den Zahlen im Westen angenähert.
Betrachtet man die sozialpolitischen Maßnahmen, die die Institutionalisierung des Lebenslaufs seit den ersten Sozialversicherungsgesetzen im Kaiserreich unter Bismarck flankieren, so sind auch hier allenfalls mäßige Tendenzen Richtung De-Standardisierung zu entdecken. So wurde das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht und flexibilisiert. Auf der anderen Seite wurden mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 und dem Recht auf einen Betreuungsplatz für zunächst Drei- bis Sechsjährige Kinder und seit 2013 auch für Kinder unter drei Jahren die Versorgung in unterschiedlichen Phasen des Lebenslaufs weiter ausgebaut.
Aus einer empirischen Perspektive lässt sich die Frage, ob die Institutionalisierung des Lebenslaufs durch De-Standardisierungsprozesse in den letzten Jahrzehnten abgelöst oder zumindest abgeschwächt wurde, nicht eindeutig beantworten. Aus der Empirie lassen sich ebenso Beispiele für – mäßige – De-Standardisierungsprozesse heranziehen als auch Belege für eine weiter fortbestehende Standardisierung der Lebensläufe. Das mag auch daran liegen, dass unterschiedliche soziodemographische Gruppen sehr unterschiedlich von De-Standardisierungsprozessen betroffen waren. Bei Frauen waren die durch die deutlich gestiegene Beteiligung am Bildungssystem und an der Erwerbsarbeit hervorgerufenen Veränderungen sicher wesentlich bedeutsamer als bei Männern. Weitere Differenzierungen zeichnen sich zwischen eher höher Qualifizierten und eher weniger Qualifizierten ab (vgl. z. B. Zimmermann/Konietzka, 2020). Während also die Optionen, die sich im Lebenslauf bieten, und die Stabilitäten und Instabilitäten, die damit verbunden sind, je nach Gruppenzugehörigkeit gestiegen oder gesunken sind, spricht wenig für einen generellen Bedeutungsverlust des institutionalisierten Lebenslaufs.
Laura Schneider und ihr Bruder Max aus dem Fallbeispiel vom Anfang dieses Kapitels haben bei der Geburtstagsfeier ihrer Großmutter Renate offensichtlich Unterschiede zwischen ihren Lebensläufen und den Lebensläufen ihrer Großeltern beobachtet, die es nicht nur in ihrer Familie gibt. Dazu gehören sowohl größere individuelle Entscheidungsspielräume als auch veränderte Sicherheiten und Unsicherheiten.
Weiterführende Literatur
Heinz, W. R., Huinink, J. & Weymann, A. (Hrsg.) (2009): The Life Course Reader. Individuals and Societies across Time. Frankfurt a. M.: Campus.
Sackmann, R. (2013): Lebenslaufanalyse und Biografieforschung. Eine Einführung (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
Sackmann, R. & Wingens, M. (2001): Statuspassagen und Lebenslauf. Übergang – Sequenz – Verlauf. Weinheim: Juventa.
Wingens, M. (2020): Soziologische Lebenslaufforschung. Wiesbaden: Springer.
1.2 Kindheit, Jugend und Sozialisation
1.2.1 Lebenswelten des Heranwachsens: Amelie Parker und Jonas Kleber
Amelie Parker ist 11 Jahre alt und die einzige Tochter von Nicole und Oliver Parker (beide 41 Jahre). Frau Parker hat Politikwissenschaften studiert und nach der Promotion drei Jahre am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft in München gearbeitet. Nach der Geburt von Amelie hat sie den Beruf aufgegeben. Herr Parker arbeitet als Controller in leitender Position bei einem internationalen Pharmaunternehmen. Vor zwei Jahren ist die Familie in einen Neubau im Rhein-Main-Gebiet gezogen (180 qm, eigener Garten).
Amelie besucht das Albert-Einstein-Gymnasium. Ihre Schulleistungen sind überwiegend ausreichend. Besondere Schwierigkeiten hat sie mit den Fächern Mathematik, Physik und Chemie. Um die Versetzung nicht zu gefährden, erhält Amelie mehrmals in der Woche Nachhilfeunterricht. Frau Parker ist musisch begabt und daher gibt es auch ein eigenes Klavier im Haus. Einmal in der Woche bekommt Amelie Musikunterricht. Die Lieblingshobbys von Amelie sind das Tanzen und Reiten. Da die Familie über zwei PKWs verfügt, gibt es für Amelie auch noch ausreichend Zeit, beiden Hobbys in der Woche nachzugehen.
Vor einigen Wochen hat Frau Parker eine halbtägige Assistentenstelle im Rektorat der nahegelegenen Grundschule angenommen. Herr Parker ist beruflich viel unterwegs und nur selten zu Hause. Die luxuriösen Urlaube verbringt die Familie in allen Teilen der Welt. Diese Auslandsaufenthalte werden oftmals verknüpft mit einem ausgiebigen Kulturprogramm. Amelie wird von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als aufgeschlossen und modebewusst beschrieben. Für die Schule interessiert sie sich wenig. Sie wird von vielen beneidet.
Jonas ist so alt wie Amelie und war mit ihr auf der Grundschule. Die beiden hatten sich ein wenig angefreundet, da Jonas Amelie immer bei den Hausaufgaben geholfen hat. Nach der vierten Klasse haben sie den Kontakt zueinander verloren. Jonas lebt mit seiner Schwester Lena (9 Jahre) und seiner Mutter Anja Kleber (39 Jahre) in einer Dreizimmerwohnung im Frankfurter Mainfeld in Niederrad. Die Etagenwohnung ist 76 Quadratmeter groß und kostet 1050 Euro Miete. Frau Kleber hat sich vor drei Jahren von ihrem Mann getrennt. Durch den regelmäßigen Alkoholkonsum von Herrn Kleber kam es häufig zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in der Familie. Die Ehe wurde vor zwei Jahren geschieden. Den Beruf als Krankenschwester hatte Frau Kleber mit der Geburt der Kinder aufgegeben. Inzwischen arbeitet sie wieder halbtags in einem Krankenhaus. So oft es geht, passt Jonas auf seine Schwester auf und macht mit ihr die Hausaufgaben. Trotz seiner überdurchschnittlichen Intelligenz besucht Jonas die nahegelegene Realschule. Durch die familiären Belastungen hatten sich seine Schulnoten stark verschlechtert. Sofern Jonas Zeit bleibt, spielt er leidenschaftlich gerne Schach und liest sehr viel. Jonas wird von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern als schüchtern beschrieben. Die gemeinsamen Urlaube verbringt die Familie in Deutschland, meist in einer Ferienwohnung auf einem Bauernhof. Im letzten Jahr waren Lena und Jonas gemeinsam in einem Feriencamp vom Deutschen Jugendherbergswerk.
Amelie, Jonas und Lena haben gemeinsam, dass sie sich in der Lebensphase der Kindheit befinden.
Lebensphasen
»Lebensphasen ordnen Lebensläufe [...] [und] lassen sich als altersstrukturierte und biographische Entwicklungsabschnitte beschreiben, die sowohl sozial und kulturell überformt als auch gesellschaftlich bedingt sind« (Schierbaum/Bossek 2020, 191). Lebensphasen markieren idealtypisch unterschiedliche biographische Abschnitte in der Entwicklung, die durch bestimmte qualitative Merkmale gekennzeichnet sind und sich somit auch voneinander abgrenzen. Zu diesen Abschnitten im Lebenslauf gehören Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter (vgl. Schulz 2018; Abels u. a. 2008).
Jede dieser Phasen wird als eigenständige Entwicklungsstufe betrachtet, die mit bestimmten sozialen, kulturellen, körperlichen, ökonomischen, entwicklungspsychologischen und biographischen Herausforderungen und Anforderungen verbunden sind (vgl. Liebsch 2012). Zugleich handelt es sich allerdings auch um ganz unterschiedliche Kindheiten, Jugenden, Erwachsenheiten und Alter, da diese im praktischen Alltag ganz entscheidend wie bei Amelie und Jonas von den vielfältigen individuellen Lebensbedingungen, sozialen Kontexten, personalen Ressourcen (Interessen, Kompetenzen) und sozialen Kompetenzen geprägt sind (Pluralisierung). Von besonderer Bedeutung sind hierbei Faktoren der Sozialisation (Erziehung, Bildung, kulturspezifisches Wissen), der Lebensführung (Gesundheit, Konsum, Freizeit), der sozioökonomischen Rahmenbedingungen (Einkommen, Vermögen, Wohnen), aber auch der sozialen Kontakte (Freundschaften, Peers, Netzwerke).
Obwohl es sich bei den genannten Lebensphasen in der empirischen Praxis um idealtypische Unterscheidungen handelt, die in den konkreten Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen geprägt sind durch Überlappungen, Entgrenzungen (Bildung im Vorschulbereich) und Entstrukturierungen (lebenslange Qualifizierung, Berufswechsel und Weiterbildung), bleiben altersbezogene Entwicklungsaufgaben im Lebensverlauf weiterhin prägend (Witte/Schmitt/Niekrenz 2021; Olk 1985).
Aus einer historischen Perspektive wird deutlich, dass es sich bei Kindheit und Jugend keineswegs um naturgegebene Konstanten handelt. Je nach historischem, geographischem und kulturellem Kontext werden nicht nur die Lebensphasen selbst immer wieder neu definiert, sondern vielfach auch geschlechtsspezifisch voneinander unterschieden. Hierbei handelt es sich um soziale Konstruktionen, die auf normativen Konventionen und Leitbildern beruhen. Diese Übereinkünfte werden u. a. geprägt von den sozialen Strukturen des jeweiligen Gesellschaftstyps (z. B. demokratisch/autokratisch) sowie den Interessen- und Machtverhältnissen in den Bereichen Erziehung und Bildung, Politik, Religion, Wirtschaft, Recht, Massenmedien und Wissenschaft, aber auch vom jeweiligen technischen, medizinischen und kulturellen Entwicklungsstand.
1.2.2 Historische Kindheiten: Vom europäischen Mittelalter bis zur Industrialisierung
Das Kindsein im europäischen Mittelalter (600 n. Chr.–1500 n. Chr.) lässt sich in drei Phasen einteilen. Während der ersten sechs Jahre (infantia) wuchs das Kind zu Hause auf. Kinder wurden dort erzogen und waren weitestgehend von häuslichen Pflichten befreit. Bei Bauern- und Handwerkerfamilien war es allerdings üblich, dass mit etwa vier Jahren erste häusliche Pflichten übernommen wurden. Ab dem siebten Lebensjahr, der Phase der Pueritia, stand die Ausbildung des Kindes an, die vorrangig vom Vater übernommen wurde. Je nach Standeszugehörigkeit begann nun die Schulausbildung oder handwerkliche Ausbildung, i. d. R. nur für die Jungen. Die Mädchen hatten Hausarbeit und Feldarbeit zu verrichten. Zugleich wurde aber auch die Möglichkeit geboten, den Alltag spielerisch zu gestalten und sich auf diese Weise nicht nur bestimmte Fähigkeiten anzueignen, sondern die Phase des Aufwachsens durchaus auch genießen zu dürfen. Dies ändert allerdings nichts daran, dass Kinder vorrangig als wichtige Arbeitskraft zur materiellen und sozialen Sicherung angesehen wurden.
Durch die hohe Kindersterblichkeit war der elterliche Bezug zum Nachwuchs weniger durch eine besondere Fürsorglichkeit, innere Bindung und Zuwendung geprägt. Das heißt aber nicht, dass es im Mittelalter keine Vorstellung von Kindheit gegeben hätte, die mit einer besonderen Form der Fürsorglichkeit einherging (vgl. Fossier 2011, 72 f.). An Kindheit ausgerichtete Formen der Betreuung, Pflege, Ernährung, Bestrafung und Trauer können in vielfältigen Darstellungen, Briefen und Schriften jener Zeit nachgewiesen werden (vgl. Bühler-Niederberger 2022, 470 ff.; Hoyer 2015, 28 f.).
Generell war das alltägliche Leben im Mittelalter von einer ausgeprägten Frömmigkeit bestimmt mit entsprechenden Auswirkungen auf das erzieherische Selbstverständnis. Der Nachwuchs wurde gottestreu erzogen, um zu einem gottesfürchtigen Menschen zu werden. Als erzieherische Mittel war die aus heutiger Sicht gewaltsame Züchtigung mittels Stock und Rute ein probates Mittel. Nur auf diese Weise, so die damalige Auffassung, konnte die gewünschte sittliche Reife erreicht werden.
Ähnlich wie in der Antike und im Römischen Reich gab es im Mittelalter auch noch keine staatlich geführten Schulen. Schulen waren private Einrichtungen, für die Schulgelder entrichtet wurden. Zu den wichtigsten Lehrern, insbesondere bei den Bauernkindern, gehörten die Dorfpfarrer, die meist unentgeltlich unterrichteten (vgl. Shahar 2003, 275 f.). Als Gegenleistung mussten Ministranten- oder Haushaltsdienste verrichtet werden.
Ab dem 13. Jahrhundert wurde ergänzend zur Unterrichtssprache Latein auch die jeweilige Volkssprache zugelassen. Erleichtert wurde zudem der Zugang zu kirchlichen Schulen sowie die Staffelung des Schulgeldes je nach den finanziellen Möglichkeiten der Familie bzw. deren Standeszugehörigkeit. Zu den Unterrichtsinhalten gehörte das Lesen, Schreiben, Rechnen und die Rhetorik. An die Elementarschule schloss sich für begabte Schüler und Kinder reicher Familien die höhere Lateinschule und mit dem 16. Lebensjahr in besonderen Fällen die Universität an.
Die Altersphase ab dem 14. Lebensjahr wurde als Adolescentia bezeichnet. Bei Mädchen begann diese bereits zwei Jahre früher. Von nun an waren diese heiratsfähig. Mit Beginn der Adolescentia wurden die Jugendlichen strafmündig. Es gab bei den einfachen Schichten der Bauern und Handwerker grundsätzlich keinen Unterschied mehr in Bezug auf die zu bewältigenden Arbeitsanforderungen. Die eigentliche sittliche Reife, d. h. das Recht ein Erbe anzutreten oder Verträge abzuschließen, erwarb man mit etwa 21 Jahren (vgl. Winkler 2017).
Die frühe Neuzeit (16.–18. Jahrhundert) ist geprägt durch eine Veränderung des Weltbildes und der Geisteshaltung. Während das Mittelalter den Fokus auf das Verhältnis von Gott, Jenseits und Lebensführung legte, wendete sich der Mensch nun verstärkt dem Diesseits zu. Die religiöse Fixierung wurde abgelöst durch eine Form der Zuwendung zur Welt, auf die aktiv Einfluss ausgeübt werden konnte. Es war die Aufgabe der weltlichen Ordnung sowie des Menschen selbst, zu seiner ästhetischen, moralischen und geistigen Entwicklung beizutragen.
Die vom humanistischen Gedankengut inspirierte Epoche ging von einem Idealbild menschlicher Gesinnung, Würde, Tugendhaftigkeit und Bildung aus. Der Humanismus stärkte in seiner grundsätzlichen Ausrichtung das Selbstbewusstsein des Menschen und damit auch das Bestreben nach Bildung, Wissenserwerb und die Schaffung von idealen Rahmenbedingungen in der Phase des Aufwachsens junger Menschen. Diese neue geistige Grundhaltung führte zu einer veränderten Einstellung gegenüber den Heranwachsenden. Erziehung diente der Ausbildung eines vernünftig handelnden Menschen, der argumentativ und auf der Grundlage überzeugten Vorlebens zu einem verantwortungsvollen Mitglied der Gesellschaft heranreifen sollte. Den Kindern wurde ein eigener Wesenscharakter zugesprochen, der der Schulung und Formung bedurfte.
Gefördert wurde diese Geisteshaltung u. a. auch durch technologische Entwicklungen, wie z. B. der Erfindung des modernen Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts durch Johannes Gutenberg (1400 – 1468). Von nun an konnte Wissen einer größeren Bevölkerungsgruppe zugänglich gemacht werden. Bücher wurden nicht nur in großer Zahl und kostengünstig produziert, sondern sie förderten auch die Verbreitung, Beschäftigung und Auseinandersetzung mit (neuem) Wissen und trugen zu einer Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten bei. Der moderne Buchdruck lieferte insofern auch die Basis zur Gründung von staatlichen Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen, die ständeübergreifend den Jungen und Mädchen Lesen, Rechnen und Schreiben beibrachten. Gleichwohl blieb die ständische Ordnung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weiterhin prägend, mit entsprechenden Folgen für das Aufwachsen der Kinder. Die Ständezugehörigkeit manifestierte weiterhin die erheblichen sozialen Unterschiede und Entwicklungsmöglichkeiten.
Ähnlich wie schon in der Antike standen der humanistischen Geisteshaltung in ihrer philosophisch-theoretischen Ausgestaltung die realen Lebensbedingungen der Menschen gegenüber. Kinder wuchsen zum überwiegenden Teil in gravierender Armut auf, die Sterblichkeit war hoch und auch die Weggabe und Versorgung der Kinder durch Ammen war gängige Praxis. Im Vordergrund der Erziehung standen Disziplinierung, Zwang und die körperliche Bestrafung durch die jeweiligen Bezugspersonen.
Mit der Aufklärung (1650 – 1780) ging ein weiterer gesellschaftlicher Paradigmenwechsel einher. Das Verhältnis von Erziehung und Lebensführung wurde nun nicht mehr nur auf einer philosophisch-theologischen Abstraktionsebene diskutiert, sondern mit konkreten Reformen im Bereich des Bildungswesens verknüpft. Jean-Jacque Rousseau (1712 – 1778) hatte in seinen Schriften darauf aufmerksam gemacht, dass sich Erziehung nicht mehr an einer zukünftigen Bestimmung des Kindes ausrichten lässt, sondern dass die Entwicklung von Heranwachsenden prinzipiell unvorhersehbar verläuft. Vor diesem Hintergrund galt es pädagogische Überlegungen anzustellen, wie unter diesen Bedingungen Konzepte und Maßnahmen der Erziehung auszugestalten sind. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist nach Rousseau die Sichtweise des Kindes und nicht die normative Zugangsweise eines gesellschaftlichen Ideals der Gesinnung und Vorbestimmtheit. Die Phase des Kindseins wurde abgelöst durch ein Bewusstsein von Kindheit als eigenständigem Lebensabschnitt.