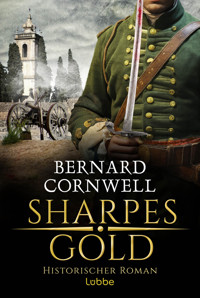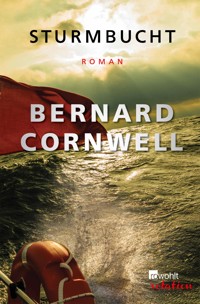
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Segel-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der Morgen dämmert auf den Bahamas, als Nick Breakspear und seine Freundin Ellen von Bord der «Wavebreaker» aus das Schiff entdecken: die von Kugeln durchsiebten Überreste der Yacht «Hirondelle», vormals unterwegs zur Privatinsel Murder Cay. Der Vorfall wird vertuscht. Wenig später übernimmt Nicks Crew den Auftrag, die kokssüchtigen Zwillinge von US-Senator Crownshield auf See clean zu bekommen. Kein einfacher Job: Der Sohn des Senators sabotiert die Reise, wo es nur geht. Bis Bewaffnete seine Schwester und ihn entführen und die «Wavebreaker» versenken – Nick findet sich mitten in einem Drogenkrieg wieder. Als auch noch Ellen verschwindet, sind der Skipper und Senator Crownshield zu allem bereit, um die drei zurückzubekommen – Nick Breakspear setzt erneut Kurs auf Murder Cay …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernard Cornwell
Sturmbucht
Roman
Über dieses Buch
Der Morgen dämmert auf den Bahamas, als Nick Breakspear und seine Freundin Ellen von Bord der «Wavebreaker» aus das Schiff entdecken: die von Kugeln durchsiebten Überreste der Yacht «Hirondelle», vormals unterwegs zur Privatinsel Murder Cay. Der Vorfall wird vertuscht. Wenig später übernimmt Nicks Crew den Auftrag, die kokssüchtigen Zwillinge von US-Senator Crownshield auf See clean zu bekommen. Kein einfacher Job: Der Sohn des Senators sabotiert die Reise, wo es nur geht. Bis Bewaffnete seine Schwester und ihn entführen und die «Wavebreaker» versenken – Nick findet sich mitten in einem Drogenkrieg wieder. Als auch noch Ellen verschwindet, sind der Skipper und Senator Crownshield zu allem bereit, um die drei zurückzubekommen – Nick Breakspear setzt erneut Kurs auf Murder Cay …
Vita
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC. Nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen: dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Bernard Cornwells Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage liegt bei mehr als 20 Millionen Exemplaren.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der gedruckten Ausgabe, die 1995 unter dem Titel «Schnee in der Karibik» im Bastei-Lübbe Verlag erschien
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel «Crackdown».
«Crackdown» Copyright © 1990 by Bernard Cornwell
«Schnee in der Karibik» Copyright © 1993 by Paul List Verlag in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung shutterstock.com
ISBN 978-3-644-40266-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Danksagung und Widmung
Es ist üblich – und weise – zu behaupten, dass die Gestalten eines Romans keinerlei Vorbilder in der Wirklichkeit haben. Auf «Sturmbucht» trifft diese Behauptung mit Sicherheit zu, wenn auch die fiktive Insel Murder Cay Ähnlichkeiten mit der tatsächlich existierenden Insel Norman’s Island aufweist, die zu den Bahamas gehört; und für Informationen über diese Insel bin ich, sowie für viele andere Details über die narcotraficantes, dem Buch «The Cocaine Wars» von Paul Eddy, Hugo Sabogal und Sara Walden zu Dank verpflichtet.
Darüber hinaus habe ich Dr. Laura Reid meinen Dank abzustatten, der früheren Medizinischen Direktorin des Gosnold Treatment Center in Falmouth auf Cape Cod, Massachusetts, die mir Informationen über Kokain gab und von den Problemen berichtete, die ihre Patienten bewältigen müssen, um von ihrer Abhängigkeit loszukommen.
Ich bin der Meinung, dass die wahren Helden des Krieges gegen die Drogen Menschen wie Laura Reid und ihre Kollegen sind, deren Kämpfe und Siege nur selten Schlagzeilen machen. Ihnen und allen ihren Patienten, die das Übel besiegt haben, widme ich «Sturmbucht» in großer Hochachtung.
Teil Eins
Der Tod lässt sich nicht hintergehen. Er ist keine Illusion. Er löst sich auch nicht in Luft auf. Er ist vielmehr eine schwerfällige Angelegenheit der Nacht, die im Morgengrauen entdeckt wird.
Und im Morgengrauen, in einer sanften Morgendämmerung der Bahamas, entdeckte ich die Hirondelle.
Sie war eine Kreuzeryacht gewesen, eine hübsche 38 Fuß lange Fiberglas-Slup, ein schmuckes Boot, aber nun war sie ruiniert.
Als ich die Hirondelle entdeckte, war sie ein Wrack, kaum noch schwimmfähig, das so tief im Wasser lag, dass ich es fast übersehen hätte, doch ein (träges) Heben ihres Rumpfes erzeugte auf einem polierten Deckbeschlag eine Reflexion des blassen Lichtes der aufgehenden Sonne. Ich war müde und nahm zuerst an, das Aufblitzen stamme von einer dahintreibenden Bierdose. Doch irgendetwas bewog mich dann doch, zum Fernglas zu greifen. Und da war es: Ein lebloses Wesen, das in einer morgendlichen Kabbelsee dahintrieb.
An Bord des schlingernden Bootes war niemand auszumachen. Die Tatsache, dass es offensichtlich aufgegeben worden war, hätte mich bei meiner Ermüdung fast dazu bewogen, das Ruder nach Steuerbord zu legen, um so an dem angeschlagenen Boot vorbeizusegeln. Es wäre dann wie jedes andere Treibgut nach wenigen Minuten außer Sichtweite und innerhalb weniger Stunden vergessen gewesen. Doch ich war neugierig, und mein Verantwortungsgefühl ließ es nicht zu, das Wrack zu ignorieren. Immerhin hätte es sein können, dass sich noch ein verletzter Segler an Bord befand. Also war es nötig, das wellengeschüttelte Wrack näher zu erkunden. Ich musste an Bord gehen.
Wenigstens war das Wetter gut. Die See war ruhig, und es gab keine böigen Winde, die es erschwert hätten, den wasserüberspülten Rumpf zu entern. Stattdessen war die Morgendämmerung der ruhige, prachtvolle Schlusspunkt einer perfekten Tropennacht, in der ich unter Vollzeug – Klüver, Fock, Groß- und Schonersegel – nach Norden gesegelt war. Die Wavebreaker muss in diesem geisterhaften Sonnenaufgang unaussprechlich schön ausgesehen haben – bis zu dem Moment, als ich sie in den Wind drehte und auf die Schalter der Elektromotoren drückte, die ihre Segel einrollten. Es war für mich noch immer merkwürdig, ein Boot zu segeln, auf dem alles so mechanisiert, elektrifiziert und computerisiert war, denn von Neigung und Einkommen her bin ich ein Seemann einfacheren Geschmacks. Doch ich war der angestellte Skipper der Wavebreaker, eines luxuriösen Charter-Schoners, und die Art von Leuten, die sie charterten, erwartete ganz einfach, dass sie mit ebenso vielen Mätzchen ausgestattet war wie ein Raumschiff.
An dem Morgen, an dem ich die Hirondelle entdeckte, hatten wir keine Charterer an Bord. Es handelte sich um eine «Leerfahrt», das heißt, die Wavebreaker war nur mit ihrer Crew unterwegs. Wir hatten gerade vier Wochen vor der Westküste von Andros verbracht, wo die Wavebreaker für einen Fernseh-Werbespot für Katzenfutter gechartert worden war. Der Spot handelte davon, dass eine ungeheuer reiche Katze den Schoner gemietet hatte, um auf der Suche nach dem Fisch, der Katzen am besten schmeckte, über die Weltmeere zu schippern, nur um dann festzustellen, dass Pussy-Cute-Katzenfutter den Wohlgeschmack längst eingefangen und eingedost hat. Die Werbung muss Pussy-Cute Millionen gekostet haben, denn die Wavebreaker war überschwemmt gewesen von Kameraleuten, Designern, Maskenbildnern, Drehbuchschreibern, Katzenabrichtern, Fischabrichtern, Regisseuren, Rechnungsprüfern, Friseuren, Gagschreibern, Produzenten-Assistenten, echten Produzenten sowie den Freunden, Freundinnen aller Beteiligten. Seriöse erwachsene Menschen hatten leidenschaftlich über die Motivation der reichen Katze gestritten, und selbst ich, der ich mich für immun gegenüber den Verrücktheiten der Filmwelt gehalten hatte, war erstaunt gewesen, als ein betagter Schauspieler eigens aus New York eingeflogen wurde, um das Maunzen des Tieres zu imitieren, da die Laute des Originals für nicht ausreichend authentisch befunden worden waren. Als der ältliche Mime zum ersten Mal an Bord der Wavebreaker kam, hatte er mich verblüfft angestarrt und dann, obwohl er mich noch nie in seinem Leben gesehen hatte, seine Arme zu einer vertraulichen und überschwänglichen Begrüßung ausgebreitet. «Liebster Tom», redete er mich mit dem Namen meines Vaters an. Ich lächelte dünn und gestand, in der Tat Tom Breakspears Sohn zu sein. «Wie könnten Sie nicht?», hatte der New Yorker Schauspieler erklärt. «Sie sind sein genaues Ebenbild. Sind Sie so freundlich, mich dem alten Gauner in Erinnerung zu bringen?» Von jedermann hörte ich immer wieder, wie sehr er doch meinen Vater schätzte und verehrte. Jedermann versicherte mir, wie ähnlich ich meinem Vater war, wenn sich auch nur wenige zu fragen trauten, welche der Frauen meines Vaters für mich verantwortlich war.
Doch jetzt war ich Gott sei Dank von den miauenden Thespis-Jüngern erlöst, und die Wavebreaker segelte zu ihrem Heimathafen auf Grand Bahama zurück, wo sie in genau vierundzwanzig Stunden ihre letzte Charterfahrt für die laufende Saison beginnen sollte. Doch dann tauchte die Hirondelle auf und verpatzte mir die wundervolle Morgendämmerung.
Als ich das Wrack entdeckte, war ich allein an Deck. Ellen schlief im Riesenbett der Heckkabine, und Thessy schnarchte in einer der vorderen Fahrgastkabinen. Nur auf Leerfahrten war es uns gestattet, die klimatisierten Luxuskabinen des Bootes zu benutzen. Im Werbeprospekt wurde unseren Charterern der «authentische Seesalzgeschmack tropischer Seefahrt» versprochen, obwohl das Segeln auf der Wavebreaker ungefähr so authentisch war wie das Maunzen von Pussy-Cute.
Das Jaulen der Motoren, mit denen die Segel eingeholt wurden, brachte einen beunruhigten Thessy an Deck. Blinzelnd stand er im jungen Licht des Tages und starrte dann verblüfft auf das wasserüberflutete weiße Boot, das träge an unserer Leeseite schlingerte. Inzwischen waren wir nahe genug, um seinen Namen am Heckwerk lesen und feststellen zu können, dass das Wrack Hirondelle hieß und aus Ostende stammte. Die kleinen Wellen schwappten und spritzten über die blauen Schriftzüge. Es kam mir schrecklich sinnlos vor, dass die Hirondelle von diesem düsteren Nordseehafen aus sicher über den Atlantik gekommen war, um in diesem sonnenbeschienenen Paradies der geschützten seichten Gewässer der Bahamas ein so furchtbares Ende zu erleiden.
Und der Hirondelle war etwas Furchtbares zugestoßen. Sie war eine mastlose Ruine, die einen Wirrwarr übergegangener Takelage hinter sich herschleppte. Ihr Kajütaufbau und das Deck waren von Löchern durchsiebt, von so vielen Löchern, dass einige von ihnen dunkle gezackte und zerrissene Krater bildeten. Mein erster Gedanke war, dass da jemand mit einem Bohrer Amok gelaufen war, doch dann entdeckte ich das Schimmern von Messing im Speigatt der Hirondelle, erkannte eine leere Patronenhülse und wusste, dass ich auf Schusslöcher starrte. Die Hirondelle war mit einem Maschinengewehr zusammengeschossen worden. Jemand hatte sie unter Beschuss genommen, aber sie war flott geblieben, weil sie eines der wenigen Fabrikate war, die als unsinkbar galten. Zwischen ihre Fiberglasschichten war Schaumstoff eingeschweißt und in jeden ungenutzten Raum ihres Rumpfes gepresst worden, und dieser Schaumstoff hielt sie nun über Wasser und trug den Sieg über das Gewicht ihres Ballastkiels, ihres Motors, der Winschen und sonstiger Ausrüstung davon.
«Hilf mir mit dem Beiboot», sagte ich zu Thessy.
«Glaubst du, dass noch jemand an Bord ist?», fragte er mit einer Beklommenheit, die auch ich empfand. Wer wusste schon, welche Schrecken sich im Dunkel der Kabinen verbergen mochten.
Thessy und ich machten das Beiboot los, das im Heckdavit hing, ich kletterte hinein, und Thessy bediente den Elektromotor, der mich aufs Wasser hinunterhievte.
Gerade als ich ablegte, erschien Ellen an Deck. Sie steckte in einem Winnie-the-Pooh-T-Shirt, das ihr als Nachthemd diente. Sie gähnte und blickte dann missmutig zu der Yacht hinüber.
«Guten Morgen!», rief ich fröhlich.
Sie sah mich finster an, sagte aber nichts. So früh am Morgen war Ellen selten guter Laune.
Ich startete den Außenborder des Beibootes und tuckerte hinüber zu der Yacht. Beim Näherkommen sah ich, dass ihr Rumpf auch unter Wasser von Kugeln durchlöchert war, die von innen abgefeuert worden sein mussten, da alle Aufsplitterungen nach außen getrieben waren, sodass der Rumpf aussah wie ein riesiger exotischer Seeigel mit roten und weißen Fiberglasstacheln.
Ich befestigte die Fangleine des Beibootes an einer der Klampen der Hirondelle und kletterte schnell auf das Vordeck, um dort behutsam das anzuheben, was von der Vorderluke zur Bugkabine noch übrig war. Fast rechnete ich damit, eine Leiche zu sehen, doch da unten schwappte nur dunkles Wasser ein paar Zentimeter unterhalb des Decks. Blut schien sich keines in dem Wasser zu befinden, jedenfalls konnte ich nichts Entsprechendes feststellen. Vorsichtig bahnte ich mir meinen Weg nach hinten und betrat die Hauptkabine. Aber ich hätte mir keine Sorgen zu machen brauchen, denn der Salon war ebenfalls bar jeden Schreckens wie die vordere Kabine. Die Hirondelle enthielt nichts als Treibgut; so viel Treibgut, dass das Wasser in ihrer Hauptkabine wie eine Müllhalde aussah. Meine Augen gewöhnten sich an das Dämmerlicht, und ich erkannte, dass der Schlamm in Wirklichkeit eine dichte Schicht treibender Cornflakes, Zigaretten und einer Million Schaumstoffpartikel war, die vermutlich durch die Geschossgarben aus dem Rumpf geplatzt waren. Eingebettet in diese wogende Masse waren ein Plastikbecher mit ein paar hölzernen Wäscheklammern, ein zerbrochener Bleistift, ein rotes Hemd und eine halbzerrissene Seekarte. An der Decke des Kajütaufbaus war ein kleiner dunkler Fleck zu sehen, der Blut hätte sein können, aber ebenso gut ein Lackspritzer.
«Was ist mit ihr passiert?», rief Ellen. Die Wavebreaker war inzwischen so nahe an die Hirondelle herangetrieben, dass der riesige Rumpf des Schoners einen Schatten auf mich warf.
«Weiß der Himmel.» Ich fischte die ramponierte Seekarte aus dem Wasser.
«Werden wir sie bergen?» Ellen beugte sich über die Reling der Wavebreaker, und die hinter ihr aufgehende Sonne verwandelte ihr üppiges rotes Haar in einen glühenden Schleier.
«Ihr ist nicht mehr zu helfen!», rief ich zurück. Die lecke Hirondelle war viel zu schwer, um von der Wavebreaker abgeschleppt werden zu können, und ich hatte weder die Zeit noch die nötige Ausrüstung, um den Rumpf zu flicken und ihn leer zu pumpen. Abgesehen davon war die Hirondelle so schwer beschädigt, dass keine Werft je auf den Gedanken käme, sie zu reparieren. Das belgische Boot war nicht nur von Kugeln durchsiebt, sondern ich konnte auch große Furchen sehen, wo jemand mit einer Axt die Decksplanken bearbeitet hatte. Das alles kam mir so unsinnig vor. Eindeutig war die Hirondelle ein herrliches Boot gewesen, und doch hatte irgend jemand mutwillig versucht, sie zu zerstören.
Ich warf die klatschnasse Karte ins Beiboot und bückte mich, um zu sehen, ob vielleicht noch etwas in der Kabine war, das ich mitnehmen konnte. Ich wollte keineswegs plündern, sondern suchte nach irgendeinem Hinweis auf den Besitzer des Bootes oder darauf, was zu seiner Zerstörung Anlass gegeben haben könnte. Ich fand nichts, doch als ich vom Niedergang zurücktrat, traten meine nackten Füße hart und schmerzhaft auf irgendetwas Scharfes. Ich duckte mich ins Cockpit, tastete auf der Gräting unter meinen Füßen und fand eine Handvoll Patronenhülsen. Einige waren aus Messing, aber die meisten aus grünlackiertem Stahl. Es waren 7,62-Millimeter-Patronen militärischer Produktion, und ich erinnerte mich vage an jene träge Phase, in der ich die oberflächlichen Vorträge über Eigen- und Besonderheiten des Warschauer Vertrages verdämmert hatte, in denen es hieß, dass einige osteuropäische Länder ihre Stahlpatronen grün lackiert hatten.
Das alles war sehr sonderbar. Ein belgisches Boot in den Gewässern der Bahamas mit Patronen des Warschauer Paktes? Aber unzweifelhaft hatte jemand in diesem Cockpit gestanden und mit einem Maschinengewehr durch den Niedergang in die Hauptkabine geschossen. Offenbar hatte dieser Jemand gehofft, den Rumpfboden so zerstört zu haben, dass die Hirondelle hätte sinken müssen. Aber er hatte nicht mit der Schaumstoffverarbeitung gerechnet, und daher war der Beweis seines Verbrechens, falls es überhaupt ein Verbrechen war, noch immer vorhanden.
Thessy hatte den Motor der Wavebreaker gestartet. Der Wind hatte den großen Schoner bedenklich nahe an die Hirondelle getrieben, daher gab Thessy mit dem Motor der Schraube des Schoners einen Kraftstoß, der die See weiß aufschäumen ließ und das Schiff in sicheren Abstand brachte. Der Schatten des Schoners verschwand, und die Sonne des neuen Tages traf mich mit strahlender Gewalt durch eine Reihe von Kugellöchern, die beide Seiten des Kajütaufbaus der Hirondelle durchsiebt hatten. Die Strahlen der Sonne hingen wie goldene Speere im düsteren Zwielicht der Kabine. Ich überlegte, ob ich das Wrack noch weiter untersuchen sollte, sagte mir dann aber, dass eine derartige Überprüfung Sache der Polizei sei.
Ich warf die Patronenhülsen in das Beiboot und ging über das überflutete Deck der Hirondelle nach vorn, wo ein unbeschädigter Spinnakerbaum in seinen Vordeck-Clips steckte. Ich befestigte das rote Hemd an der Spitze des Baumes und rammte diesen behelfsmäßigen Mast in eines der Schusslöcher, damit der gefährliche Rumpf des Wracks für andere Schiffe sichtbar war. Dann kletterte ich wieder in das Beiboot und fühlte mich eigenartig niedergeschlagen. Sinnlose Zerstörung ist immer deprimierend, besonders die eines Bootes.
Ich ging wieder an Bord der Wavebreaker, und während Thessy das Beiboot versorgte, rief ich die Royal Bahamian Defence Forces über Funk. Ich nannte den Streitkräften unsere Position und berichtete, dass die Hirondelle meiner Meinung nach eine Gefährdung der Schifffahrt darstellte. Schließlich enthüllte ich sehr gewissenhaft meine Entdeckung der Patronenhülsen sowie meinen Verdacht, dass das belgische Boot, unter Umständen auch die Crew, ein finsteres Schicksal erlitten hatten. Der Funker der Streitkräfte wirkte nicht sonderlich interessiert.
Ellen, die heruntergekommen war, um sich Shorts und ein Hemd anzuziehen, hörte die letzten Worte meines Funkspruches. «Das war reine Zeitverschwendung», meinte sie spöttisch.
«Warum?» Ich hatte längst gelernt, über Ellens sarkastische Bemerkungen nicht beleidigt zu sein. Sie hatte eine irisch-amerikanische Mutter und einen polnisch-amerikanischen Vater, und diese volatile Mischung hatte eine Frau von atemberaubender Schönheit, aber leicht entzündbarem Temperament hervorgebracht.
«Was glaubst du denn, was mit dem Boot geschehen ist?», fragte sie mich höhnisch. «Glaubst du, es handelt sich um etwas so Simples wie einen Versicherungsbetrug? Oder um einen tölpelhaften Versuch der Abfallbeseitigung?» Sie brach ab, wartete auf eine Antwort, erhielt aber keine. «Drogen», antwortete sie an meiner Stelle.
«Das wissen wir nicht», protestierte ich.
«O Nick!» Ellen war außer sich. «Wir sind hier in den Gewässern der Bahamas! Wer auch immer auf dem Boot gewesen ist, war dumm genug, sich mit Drogen einzulassen, und wenn du dich auf das Schicksal dieses Bootes einlässt, bist du genauso dämlich. Und das heißt, dass du diese Seekarte und die Patronen über Bord schmeißen solltest. Auf der Stelle.»
«Ich sollte sie besser den zuständigen Behörden übergeben», entgegnete ich störrisch.
«Gott bewahre mich vor schwachköpfigen Männern.» Sie wandte sich der Kombüse zu. «Möchtest du einen Kaffee?»
«Das vorrangige Ziel der Streitkräfte ist es, die Freiheit der Schifffahrt in den Gewässern um die Bahamas zu garantieren», erklärte ich großspurig.
«O ja!» Ellen lachte, während sie Wasser in den Kessel laufen ließ. Thessy war noch an Deck, wo er die Segel der Wavebreaker wieder gesetzt und das Ruder übernommen hatte. Ich warf einen Blick auf den Kompass über dem Kartentisch und sah, dass wir wieder nach Norden segelten. Ellen setzte den Kombüsenherd in Betrieb und schraubte das Glas mit dem Pulverkaffee auf. «Das vorrangige Ziel der Bahamian Defence Forces …», sie deutete mit einem Teelöffel auf mich, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, «… besteht darin, den Augenschein zu erwecken, unablässig und unerschütterlich den Drogenhandel zu bekämpfen. Und dieser Anschein von Fleiß und Emsigkeit zielt allein auf die amerikanische Regierung, die sonst veranlasst sein könnte, ihre Bürger öffentlich vor einem Besuch der Bahamas zu warnen, da diese kein besonders sicheres Urlaubsziel mehr sind. Und das würde den Tourismus und das Casino-Geschäft der Inseln in echte Bedrängnis bringen, die nach den Drogen die gewinnträchtigsten Wirtschaftsbereiche der Bahamas sind.» Sie zeigte mir das mitleidige und selbstzufriedene Lächeln eines Menschen, der gerade einen Punkt unwiderlegbar bewiesen hat. «Daher wird dir kaum jemand dafür dankbar sein, dass du die Aufmerksamkeit auf eine ausländische Yacht voller Schusslöcher lenkst. Solche Dinge sind schädlich für den Tourismus.»
«Ergebensten Dank für die Belehrung, Frau Professor», sagte ich ironisch.
Sie schnitt eine Grimasse. Miss Ellen Skandinsky, Doktorin der Philosophie, wurde nicht gern daran erinnert, dass sie eine Professur für Frauenstudien aufgegeben hatte und zur See gegangen war; ein Entschluss, den sie gern als idealistisch bezeichnete, von dem ich aber annahm, dass er durch die schiere Langeweile und Wichtigtuerei des akademischen Lebens befördert worden war. Ellen schwor, dass sie den Wechsel vorgenommen hatte, um das «wirkliche Leben» zu entdecken, etwas, das es auf einer Universität offenbar nicht gab und das sie für ihre wahre Ambition – das Schreiben – für unverzichtbar hielt. Für Ellen hatte sich das «wirkliche» Leben als Einzimmer-Apartment mit fließendem, aber kaltem Wasser hinter dem Straw Market entpuppt, einer unbezahlten Mitarbeit an einem Bildungsprojekt der Bahamas sowie einem bezahlten Job als Schiffsköchin, einem Job, der ihrem früheren Leben und ihren feministischen Überzeugungen so fremd war, dass es sie selbst verblüffte, wie viel Spaß er ihr machte. Ich glaube, noch verblüffter war Ellen über die Tatsache, dass wir in den Monaten unserer Zusammenarbeit Freunde geworden waren – nicht mehr als Freunde, aber immerhin befreundet genug, dass sie ernsthaft überlegte, mit mir um die Welt zu segeln. Nicht auf der Wavebreaker, sondern auf meinem eigenen Boot, das erst noch instand gesetzt werden musste, bevor ich mit ihm über den Südpazifik segeln würde.
Ich hörte das Aufjaulen eines Servomotors und nahm an, dass Thessy den Autopiloten eingeschaltet hatte. Er kam die Kajütstreppe mit der Seekarte herunter, die ich von der Hirondelle geborgen und auf dem Deck der Wavebreaker zum Trocknen ausgebreitet hatte. Das eingerissene Papier war noch immer klatschnass. «Nick?» Seine Stimme klang bestürzt. «Weißt du, wo sie vor zwei Nächten gewesen sind?» Thessy hatte den eigenartigen Dickens-Akzent der Bewohner der äußeren Inseln der Bahamas. Er war siebzehn Jahre alt, dürr wie eine streunende Katze und der erste und einzige Maat der Wavebreaker, was ihn auch zum Steward, Leibwächter, Schiffsjungen, Maskottchen und zur Dienstmagd machte. Sein richtiger Name war Thessalonian, und er war genauso fromm, wie es dieser Name anhand der Briefe des Paulus an die Thessalonicher vermuten ließ. «Siehst du, Nick?» Er zeigte auf die nasse Karte, die er auf den Tisch in der Messe gelegt hatte. «Da waren sie vor zwei Tagen. Vor nur zwei Tagen!»
Die Karte hatte im Meerwasser gelegen, doch das Salz kann Bleistifteintragungen auf einer Karte nicht zerstören, und wer auch immer die Hirondelle gesegelt hatte, war mit Sicherheit ein gewissenhafter und penibler Navigator gewesen. Eine Bleistiftlinie zog sich von der No Name Bay südlich von Miami aus durch den Golfstrom und hinein in das Gebiet der Bahamas. Der Navigator der Hirondelle war den größten Teil der Strecke nach Koppel-Navigation gesegelt, hatte dann aber einige genaue Peilungen vorgenommen und festgestellt, dass er die Nordströmung des Golfstroms unterschätzt hatte. Allerdings so wenig, dass die belgische Yacht nur fünf Seemeilen vom geschätzten Kurs abgewichen war. Dieser Kurs führte südlich an Bimini vorbei auf eine winzige Insel zu, die ganz allein zwischen den Biminis und den Berrys lag und den wenig sympathischen Namen Murder Cay trug. Dort endete die Bleistiftlinie, betont durch einen Kreis, der einen Punkt umschloss, neben den der Navigator das Datum und den Zeitpunkt der Ankunft der Hirondelle notiert hatte. Und diese Ankunft lag, wie Thessy richtig bemerkt hatte, nur zwei Tage zurück. Die Abfahrt der Hirondelle von dem Eiland mit dem verhängnisvollen Namen war durch eine Bleistiftlinie vermerkt.
Mir war die Insel trotz ihres Namens noch nie aufgefallen. Es war eine sehr kleine Insel, nur ein Fliegendreck, der etwa zwanzig Meilen südöstlich der derzeitigen Position der Wavebreaker lag, und das war exakt die Richtung, aus der Strömungen und Wind ein leckgeschlagenes Boot treiben würden.
Ich holte das Segelhandbuch, fand aber keinen Eintrag für die Insel. «Versuch’s mal mit Sister Island», schlug Ellen lakonisch vor.
Es schien ein unsinniger Vorschlag zu sein, doch Ellens scheinbare Unsinnigkeiten stellten sich häufig genug als durchaus sinnvoll heraus. Daher schlug ich brav unter Sister Island nach und stellte fest, dass das der neue Name für Murder Cay war. Das Segelhandbuch bot keine Erklärung für die Namensänderung, sie war aber mit Sicherheit auf Probleme zurückzuführen, die die Bewohner einer der kleinsten Inseln der Bahamas mit der früheren Bezeichnung ihrer Heimatinsel gehabt haben mochten. Sister Island war nur drei Meilen lang und an keiner Stelle breiter als eine halbe Meile. Die Südspitze der Insel war durch ein weißes Leuchtfeuer markiert, das alle fünfzehn Sekunden dreimal aufblitzen und bis zu einer Entfernung von fünf Meilen sichtbar sein sollte, doch das Handbuch verwies darauf, das Leuchtfeuer sei «unzuverlässig». Die gesamte Insel war von Korallenriffen umgeben, die den Namen Devil’s Necklace trugen, und ich fragte mich, welcher unglückliche Seemann der Insel und ihren Riffen diese makabren Namen gegeben hatte. Der beste Zugang war eine enge, gekrümmte Passage ohne Bojenbezeichnung im Westen der Insel. Der einzige Hinweis auf die Passage schien ein hoher Radiomast aus Stahlbeton zu sein, der sich bequemerweise gegenüber dem Beginn der Passage befand und angeblich mit roten Warnlichtern für den Flugverkehr versehen sein sollte. Es gab auch eine Start- und Landebahn auf der Insel, die über weiße und grüne Lichter verfügte, doch ebenso wie das weiße Leuchtfeuer und die Warnlichter für den Flugverkehr sollten auch die grünen und weißen Lichtsignale unzuverlässig sein. Der östliche Teil der Lagune war offenbar sehr geschützt, doch im Segelhandbuch hieß es, dass es auf der Insel keinerlei Einrichtungen für fremde Segelyachten gab. Mit anderen Worten: Den Yachten wurde empfohlen, sich von Murder Cay fernzuhalten. Aber die Bleistiftlinie auf der Karte der Hirondelle führte geradewegs zu dieser Insel und endete dort.
«Die Regierung kam zu der Auffassung, dass der alte Name dem Tourismus abträglich war», bemerkte Ellen. Ihre Stimme klang eigenartig; ganz so, als wollte sie mit der erneuten Feststellung einer Selbstverständlichkeit von den düsteren Implikationen der Bleistiftlinie auf einer Seekarte ablenken.
«Vielleicht haben die Inselbewohner die Crew erschossen», vermutete ich, aber mit wenig überzeugter Stimme, denn trotz der verschwundenen Crew und der vielen Patronenhülsen konnte ich im Grunde nicht wirklich glauben, dass auf Murder Cay ein Mord geschehen war. Ich wollte nicht daran glauben. Ich wollte, dass das Schicksal des Bootes eine ganz einfache Lösung fand, eine, die mich nicht erschreckte. Und das wünschte ich mir nicht nur für das Boot, sondern für das Leben überhaupt. Ich war in einem Haus aufgewachsen, in dem ich immer wieder erschreckt wurde. Deshalb war ich fortgelaufen und zu den Royal Marines gegangen. Die Marines hatten mich hart gemacht, hatten mich gelehrt zu fluchen und zu kämpfen, zu vögeln und zu trinken, aber sie hatten mir keinen Zynismus beigebracht, noch hatten sie in mir die unschuldige Hoffnung auf unschuldige Erklärungen ausgelöscht. «Vielleicht», ergänzte ich meine vorangegangene Vermutung, «handelt es sich auch nur um einen Unfall.»
«Was auch immer geschehen ist», entgegnete Ellen knapp, «es geht uns nichts an.»
«Und außerdem hat Mister McIllvanney angeordnet, dass wir uns von der Insel fernhalten», fügte Thessy hinzu.
Ich erinnerte mich an keine derartige Anordnung, aber Thessy kramte in den Regalen unter dem Kartentisch und fand eines von McIllvanneys Informationsblättern. Ich las McIllvanneys pompöse Mitteilungen an seine Angestellten nur höchst selten, daher war mir diese Warnung garantiert entgangen. Sie war knapp und unmissverständlich: «Halten Sie sich von Sister Island fern. Die Royal Bahamian Defence Forces haben unzweideutig darauf hingewiesen, dass die neuen Besitzer der Insel eine Abneigung gegen unbefugtes Betreten haben, und ich möchte deswegen kein Boot verlieren. Aus diesem Grund haben alle Cutwater-Charter-Boote bis auf weiteres einen Mindestabstand von fünf Seemeilen von Sister Island einzuhalten.»
Ich dachte an die Schusslöcher in dem einst so eleganten Bootskörper der Hirondelle. «Die armen Hunde», sagte ich leise.
«Es geht uns nichts an, Nick», sagte Ellen warnend.
Ich blickte wieder auf McIllvanneys Info-Blatt. «Glaubst du, dass die neuen Besitzer mit Rauschgift zu tun haben?», wollte ich wissen.
Ellen seufzte. Sie hat einen Hang zu tiefen Seufzern, denn sie sind ihr Ausdrucksmittel, den Männern dieser Welt klarzumachen, dass sie ausnahmslos unverbesserliche Schwachköpfe sind. «Glaubst du, dass sie Autoteile schmuggeln, Nick? Oder Klopapier? Selbstverständlich sind sie im Drogengeschäft, du Traumtänzer. Und genau deshalb geht uns das alles absolut nichts an!»
«Ich habe nie gesagt, es ginge uns etwas an», verteidigte ich mich. «Dann wirf diese Patronen über Bord und sieh zu, wie du diese Seekarte loswirst», riet mir Ellen schroff.
«Eigentlich sollten sie der Polizei übergeben werden», beharrte ich.
«Du bist ein Dummkopf, Nicholas Breakspear», erklärte Ellen, aber es klang nicht unfreundlich.
«Ich habe den Defence Forces gegenüber bereits betont, dass das ein Fall für die Polizei ist», erklärte ich.
Ellen ließ einen weiteren ihrer Seufzer hören. «Die Drachen haben gewonnen, Nick, und die fahrenden Ritter verloren. Weißt du das denn nicht? Du hast deine Information übermittelt, nun lass die Sache auf sich beruhen. Keine Seekarte. Keine Patronen. Es ist vorbei. Spiel nur nicht den Helden!»
Sie meinte es gut, aber ich konnte die Hirondelle nicht vergessen, weil in diesem Paradies der Strände, Lagunen und palmenbedeckten Inseln das Böse sein Haupt erhoben hatte und ich wollte, dass die zuständigen Behörden die feuchte, eingerissene Seekarte nahmen und feststellten, was am Ende der sorgfältig gezeichneten Linie lag. Also tat ich Ellens zynische, aber sicherlich vernünftige Bitte mit einem Schulterzucken ab und ging an Deck, um das Ruder zu übernehmen. Die Wavebreaker lag weiß und prächtig auf der sonnenbestrahlten See, auf der ich weit im Westen eine Reihe grauer Kriegsschiffe erkennen konnte. Es waren Schiffe der US-Marine, die zu einem Manöver mit dem Namen «Stingray» zu den Bahamas kamen. Der Anblick der Flotte erinnerte mich an meine Zeit bei den Royal Marines, und ich empfand jämmerliche Neidgefühle gegenüber den amerikanischen Marines, denen diese tropische Spielwiese mit ihrem warmen Meer und den Palmen für ihr Training zur Verfügung stand. Ich hatte das Handwerk des Tötens im scharfen Peitschen norwegischen Graupels und schottischen Schnees gelernt, aber das alles lag weit zurück. Jetzt war ich ein freier Mann, und ich hatte nur noch eine Charterfahrt zu absolvieren, nach der ich mich um mein eigenes Boot kümmern, es instand setzen und auf neuen Wegen über alte Ozeane kreuzen konnte.
So wie die Hirondelle in ihr Abenteuer gesegelt war und stattdessen eine kleine Insel mit Korallenriffen und dem Namen Murder Cay gefunden hatte. Und dort das Ende ihrer Reise fand.
Gegen Mittag legten wir an. Die verlassene Bootswerft brütete in der Hitze. Die Saison für das Chartergeschäft war im Grunde vorüber, daher waren die meisten Cutwater-Yachten entweder in den Norden gesegelt oder ruhten auf Stellagen oberhalb des Wasserspiegels. Einige unserer Yachten waren noch auf See, und die Wavebreaker hatte noch einen Auftrag vor sich, doch sonst lag über McIllvanneys Werft die träge Atmosphäre des tropischen Sommers. Sogar Stella, McIllvanneys duldsame Sekretärin, hatte den Tag freigenommen und das Büro verschlossen. Daher musste ich in die Stadt gehen, um mir eine Telefonzelle zu suchen, von der aus ich die Polizei der Bahamas anrief. Ich berichtete ihr von der Hirondelle und fügte zum Schluss hinzu, dass ich eine Seekarte und eine Handvoll Patronenhülsen von dem leckgeschlagenen Boot geborgen hatte. Der Polizist klang überrascht, dass ich mir die Mühe gemacht hatte, ihn anzurufen, und als ich zur Werft zurücklief, kam ich mir recht dümmlich vor.
Ellen lachte über meine Gewissenhaftigkeit. Zweifellos reagiere nun die Polizei auf meinen Anruf mit einem Schärfen ihrer Entermesser und dem Laden der Musketen, um sich auf eine Invasion auf Murder Cay vorzubereiten, spöttelte sie.
«Murder Cay habe ich gar nicht erwähnt», stellte ich klar. «Ich habe ihnen lediglich von den Schussspuren am Boot und von der Seekarte erzählt.»
«Nachdem du schnell und prompt den Drogenkrieg gewonnen hast, könntest du vielleicht auch mal was Nützliches tun. Beispielsweise das Deck schrubben», war die Antwort. Uns blieb nur dieser eine Tag, um die Wavebreaker für ihre letzte Charterfahrt vorzubereiten, und das hieß, dass Treibstoff und Proviant geladen, die Teppichböden gesaugt, die Bilgen gegen Kakerlaken besprüht und die Kombüse pieksauber geputzt werden mussten. Darüber hinaus war das Deck zu schrubben und das Messing zu polieren.
Am Nachmittag, als alles danach aussah, als könnten wir die Arbeit nie und nimmer rechtzeitig schaffen, erschien Bellybutton auf der Werft. Bellybutton war McIllvanneys Vorschoter, und wenige Sekunden lang gab ich mich der Hoffnung hin, er wäre gekommen, um uns zu helfen, doch stattdessen teilte er mir mit, dass eine 33-Fuß-Yacht in Schwierigkeiten steckte. «Der Mann hat gefunkt, sein Motor wäre im Eimer», grummelte Bellybutton. «Also muss ich diesen Trottel mit der Starkisser holen.» Er tat ganz so, als wäre dieser Auftrag die reine Plage, grinste aber gleichzeitig begeistert über die Vorstellung, mit McIllvanneys nagelneuem Motorflitzer hinausfahren zu können. Der mitternachtsblaue Rumpf der Starkisser bestand aus Fiberglas, in das Metallflocken eingebettet waren, sodass das schnittige Boot ein inneres infernalisches dunkelblaues Licht zu versprühen schien. Es musste eines der schnellsten Fabrikate auf der Insel sein. Ihre Zwillingsmotoren konnten den drei Tonnen schweren keilförmigen Bootskörper mit einer Geschwindigkeit von mehr als achtzig Meilen in der Stunde über die Wellen fetzen lassen, und es beunruhigte weder McIllvanney noch Bellybutton, dass ein Mensch bei einer derartigen Geschwindigkeit seine eigenen Schreie nicht hören konnte und dass schon die kleinste Welle ihm das Fleisch von den Knochen schüttelte.
«Die Frau muss erst noch geboren werden, die nach einer Fahrt mit der Starkisser nicht dahinschmilzt», protzte Bellybutton gern. Sein richtiger Name war Benjamin, doch kein Mensch nannte ihn so, noch nicht einmal Ben. Auf der ganzen Insel hieß er nur Bellybutton. Es ging das Gerücht, dass er sich den Spitznamen damit verdient hatte, einer Hure den Nabel herausgebissen zu haben, die seinen Wünschen gemäß nicht hinreichend gefügig gewesen war. Ich fand das Gerücht durchaus glaubhaft, da Bellybutton kein sehr angenehmer Mensch war. Im Grunde war er eine schwarze Version von McIllvanney: schlaksig, durchtrieben, hoch gewachsen und sarkastisch. «Mister Mac will dich heute Abend sehen», grinste mich Bellybutton anzüglich an, als wisse er, dass das Treffen kein Vergnügen sein würde. «Er sagt, du sollst gegen Sonnenuntergang zu ihm kommen.»
«Warum ist er heute nicht auf der Werft?», wollte ich wissen.
«Mister Mac hat sich einen Tag frei genommen», stellte Bellybutton indigniert fest, als hätte meine Frage McIllvanneys Ehre beschmutzt. «Er hat zu tun. Er muss ein Boot nach Miami bringen, und deshalb hat er mir auch die Schlüssel für die Starkisser gegeben. Vielleicht würdest du gern eine Spritztour mit Miss Ellen machen?» Er ließ die Schlüssel verführerisch vor meiner Nase baumeln. «Ich werde Mister Mac nichts sagen, wenn du mir eine Fahrt mit Miss Ellen gestattest, nachdem du fertig bist.» Er lachte und wackelte obszön mit seinen schmalen Hüften.
«Du bist ein Scheißkerl, Bellybutton», sagte ich zuckersüß, aber er hatte seine Aufmerksamkeit bereits von mir abgewandt, weil ein Auto auf das Werftgelände fuhr. Es war ein langer, weißer Lincoln mit dunkelgetönten Fenstern. Der Wagen glitt geräuschlos zwischen den aufgebockten Yachten hindurch und hielt am Pier der Wavebreaker. Abgesehen von dem Knirschen der Reifen war das Herankommen des Lincoln leise und eigenartig unheimlich gewesen.
Die Beifahrertür öffnete sich, und ein sehr großer und sehr dunkelhäutiger Mann stieg langsam ins Sonnenlicht. «Ein Freund von dir?», fragte ich Bellybutton, doch dessen Augen weiteten sich, er murmelte einen Fluch und stürzte, ohne zu antworten, auf den Ponton der Starkisser zu.
Der große Schwarze, der dem Lincoln entstiegen war, trug einen eleganten dunkelblauen Dreiteiler, der für einen so heißen Tag unpassend wirkte, dazu ein weißes Hemd und eine alte Eton-Krawatte. Er hatte einen beeindruckenden Körperbau – schmale Hüften und breite Schultern – wie ein Boxer, der hart zuschlagen, aber auch elegant tänzeln kann. Er blickte sich gelassen auf der Werft um und setzte eine verspiegelte Sonnenbrille auf, bevor er die Autotür zuschlug.
Bellybutton hatte die Leinen der Starkisser gelöst und ließ das Motorboot vom Ponton abtreiben, während er ihr pechschwarzes Cockpitverdeck abnahm. Dann, offensichtlich in großer Hast, dem eleganten Mann zu entkommen, setzte er die Motoren der Starkisser in Betrieb. Das Echo der Zwillingstriebwerke hallte wie das Getöse eines Kampfpanzers von den umstehenden Gebäuden wider. Aufgeschreckte Pelikane flatterten davon, und Ellen kam aus der Kombüse, um nachzusehen, was diesen höllischen Lärm verursacht hatte. Bellybutton warf einen letzten Blick auf den Mann, der inzwischen das Dock entlangging, und schob die Gashebel weit in den roten Drehzahlbereich, sodass das dunkelblaue Motorboot mit einem Satz aufs Meer hinausdüste, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen.
«Ein schlechtes Gewissen ist doch eine furchtbare Sache.» Der hochgewachsene Schwarze lachte kehlig und kam dann über die Laufplanke der Wavebreaker geschlendert. An Deck angelangt, hielt er kurz inne, um Ellen in ihren knappen Shorts und einem ausgeblichenen Tank Top zu bewundern. Selbst mit ihren zu einem Knoten zusammengebundenen Haaren, seifeverschmierten Gesicht und Händen und verschwitzt von den Ausdünstungen des Kombüsenherds sah sie überaus verführerisch aus. Der Schwarze nahm kurz seine Sonnenbrille ab, als könne er so Ellen genauer begutachten. Seine sehr harten und sehr zynischen Augen richteten sich unvermittelt direkt auf mich. «Sie müssen Breakspear sein.»
«Ja.»
«Mein Name ist Deacon Billingsley …» Er brach ab, als müsse mir der Name bereits alles sagen. «Ich bin Polizeibeamter.»
Der Auftritt von Deacon Billingsley hätte mir die Genugtuung geben müssen, dass mein Anruf ernst genommen worden war, und dennoch hatte ich das unbestimmte Gefühl, als würde mir dieser Polizist ganz und gar keine Genugtuung vermitteln. Er hatte sehr ausdruckslos gesprochen, und das hatte seine Worte fast wie eine Drohung klingen lassen. Die Sonne, die sich im undurchdringlichen Glanz seiner Sonnenbrille spiegelte, blendete mich vorübergehend. «Was haben Sie unternommen, nachdem Sie die Hirondelle entdeckt hatten, Breakspear?», fragte Billingsley.
«Fahrt aufgenommen.»
«Fahrt aufgenommen», äffte er meinen britischen Akzent nach. Dann drehte er sich zu Ellen um, die an Deck geblieben war, um die Unterhaltung nicht zu verpassen. «Woher kamen Sie, Lady?»
«Hey! Lassen Sie mich aus dem Spiel, okay? Nicht ich habe die verdammte Kavallerie angerufen. Wenn Sie irgendetwas über dieses Boot wissen wollen, dann fragen Sie Nick, nicht mich.» Sie schwenkte verächtlich auf den Niedergang zu.
Billingsley sah ihr nach. «Sie ist Amerikanerin?» Ellens Abfuhr schien ihn mehr zu erheitern als zu verstimmen.
«Sie ist Amerikanerin», bestätigte ich.
Ellen verschwand, und Billingsley wandte sich wieder mir zu. «Ficken Sie die Amerikanerin, Breakspear?» Ich war über die Frage so erschüttert, dass ich ihn mit offenem Mund anstarrte. «Vögeln Sie das Mädchen?», variierte Billingsley seine unverschämte Frage für den Fall, dass ich die erste Version nicht verstanden hatte. Sein Tonfall war so beiläufig, als hätte er nach Einzelheiten der Seetüchtigkeit der Wavebreaker gefragt.
«Die Antwort ist nein», sagte ich. «Verschwinden Sie.»
Billingsley zündete sich eine Zigarre an. Sie hatte eine rot-gelbe Bauchbinde, auf der ich gerade noch das Wort Cuba lesen konnte. Er ließ sich Zeit. Erst kappte er die Spitze, dann setzte er die Zigarre mit mehreren Streichhölzern in Brand, die er nachlässig und provozierend auf das geschrubbte Deck der Wavebreaker fallen ließ. Dann trat er sie mit der Spitze seiner teuren Schuhe fest in die Teakholzplanken, dass die verkohlten Zündholzköpfe schwarze Schlieren auf dem hellen Holz hinterließen. Schließlich zog er an der Zigarre, bis sie rot glühte, und warf das letzte Streichholz weg. Er hob den Blick, um mir ins Gesicht zu starren, und ich verspürte eine Woge der Angst. Es war nicht Billingsleys Körpergröße, die diese Furcht bewirkte, denn ich war genauso groß wie er. Auch sein Beruf flößte mir kein Unbehagen ein, vielmehr war es die Aura von Gewalt, die er verströmte wie ein glühender Hochofen. «Wenn Sie sich Mätzchen mit mir erlauben», sagte er mit trügerisch sanfter Stimme, «ziehe ich Ihnen glatt das Rückgrat zum Arschloch heraus.»
Ich wollte verdammt sein, wenn ich mir meine Angst anmerken ließ. «Haben Sie einen Dienstausweis?», fragte ich ihn stattdessen.
Eine Sekunde lang nahm ich an, er würde mich schlagen, doch dann griff er in die Brusttasche und holte eine Brieftasche heraus, klappte sie auf und hielt sie mir gerade so lange entgegen, dass ich erkennen konnte, dass er den Rang eines Chief Inspectors bekleidete, eine der höchsten Positionen bei der Polizei der Bahamas. Dann wurde die Brieftasche zugeklappt, und Deacon Billingsley trat dicht an mich heran. So dicht, dass ich den Zigarrenrauch in seinem Atem riechen konnte. «Wo ist die Seekarte, die Sie von der Hirondelle mitgenommen haben?»
«Unter Deck.»
«Dann holen Sie sie», ordnete er an.
Ich gehorchte. Die Karte war inzwischen getrocknet, stocksteif und gefaltet, aber Billingsley sah sie sich gar nicht an, sondern faltete sie weiter zusammen und steckte sie in eine Tasche seines teuren Jacketts.
«Die hier habe ich ebenfalls gefunden», sagte ich und streckte ihm die Handvoll Patronenhülsen entgegen.
Er ignorierte meine ausgestreckte Hand. «Was hatten Sie auf Sister Island zu suchen, Breakspear?»
Die Frage verblüffte mich, denn ich hatte weder Sister Island noch den alten Namen Murder Cay erwähnt – weder der Polizei noch den Defence Forces gegenüber, und Billingsley hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Bleistiftlinie auf der Seekarte anzusehen, aber trotzdem hatte er die Hirondelle irgendwie mit der geheimnisvollen Insel in Verbindung gebracht. «Ich fragte Sie, was Sie auf Sister Island gemacht haben», wiederholte Billingsley drohend.
«Wir sind der Insel nicht einmal nahe gekommen», protestierte ich. «Davon können Sie sich selbst überzeugen. In meinem Funkspruch habe ich die Koordinaten genannt, wo wir die Hirondelle gefunden haben, und diese Koordinaten befinden sich zwanzig Meilen nordwestlich von Sister Island. Näher sind wir zu keinem Zeitpunkt an die Insel herangekommen.»
Ein paar Sekunden lang sagte er kein Wort, und ich spürte, dass ich ihn unter Umständen verunsichert hatte. Ich hatte ihn auch verärgert, doch dieser Ärger schien sich gegen ihn selbst zu richten. Er war aufgrund eines Missverständnisses hier, hatte angenommen, die Wavebreaker hätte Murder Cay angelaufen, aber in Wahrheit waren wir nicht einmal in Sichtweite der mysteriösen Insel gewesen.
Doch Billingsley war eindeutig über den Besuch der Hirondelle auf Murder Cay informiert, und ich begriff, dass dieser hohe Polizeibeamte nicht gekommen war, um ein Verbrechen aufzuklären, sondern um es zu vertuschen. Und dann meinte er zungenflink, die Eigner der Hirondelle hätten beschlossen, nach Hause zu fliegen. Und da sie sich vergebens bemüht hatten, die Yacht auf einem gesättigten Markt loszuschlagen, hätten sie sie schlicht aufgegeben. Dann habe offensichtlich jemand das Boot als Schießscheibe benutzt. «Vielleicht waren es die Amerikaner», meinte Billingsley abschließend. «Sie wissen, dass gerade ein Seemanöver stattfindet? Vielleicht haben die das Boot durchsiebt.»
«Diese Patronen stammen nicht aus amerikanischer Produktion», sagte ich und zeigte ihm die grünlackierten Hülsen. Ich hätte besser meinen Mund gehalten, denn meine Worte signalisierten nur meine Skepsis gegenüber Billingsleys haarsträubender Erklärung.
Diese Skepsis war eine Herausforderung, und Deacon Billingsley war ein Mann, der einer Herausforderung nicht widerstehen konnte. Er packte meine Hand mit festem Griff, drehte sie um und schüttete sich die Patronenhülsen auf seine Handfläche. Dann warf er sie eine nach der anderen über Bord. «Sie haben ein Boot in den Gewässern der Bahamas.» Es war keine Frage, sondern eine knappe Feststellung. «Eine Ketsch namens Masquerade. Im Moment liegt sie auf Straker’s Cay herum.»
«Sie liegt nicht herum», empörte ich mich. «Sie wird überholt und instand gesetzt.»
Er überhörte meine Korrektur und fuhr fort, die Patronenhülsen über das Dollbord zu werfen. «Wie wollen Sie Ihr Boot reparieren oder auch nur von hier fortbringen, Breakspear, wenn Ihr Name auf der Stop List steht? Sie wissen doch, was die Stop List ist?»
Ich wusste es nur zu gut. Es war eine Namensliste unerwünschter Ausländer, denen die Einreise auf die Bahamas verweigert wurde. Und wenn mein Name auf die Stop List kam, würde ich mein Boot höchstwahrscheinlich nie wieder sehen. Die Drohung war direkt und wirksam.
«Haben Sie mich verstanden?», fragte Billingsley, als er die letzte Hülse ins Meer warf. Ich nahm an, dass er die Seekarte gleichermaßen vernichten würde, sobald er die Bootswerft verlassen hatte. Zweifellos war die Hirondelle bereits in die Luft gejagt worden, wie auch mein Boot zerstört werden würde, wenn ich diesen Mann weiterhin herausforderte. «Haben Sie mich verstanden?», fragte er noch einmal.
«Ja.» Wie bitter die Demütigung schmeckte.
«Halten Sie noch immer irgendetwas an den Umständen Ihrer Entdeckung der Yacht Hirondelle für verdächtig?», fragte Billingsley mit höhnischer Gewissenhaftigkeit. Er wollte mich zu Kreuze kriechen lassen, aber die Erniedrigung hatte ich mir selbst zuzuschreiben, da ich seine Lüge in Frage gestellt hatte.
«Nein», sagte ich und verabscheute mich für diese Unwahrheit. Aber ich dachte an mein Boot, das aufgebockt im Sand von Straker’s Cay lag, dachte an all die Arbeit, die ich in die Masquerade gesteckt hatte, an die Sorgfalt, Zeit und Liebe, die ich ihr hatte angedeihen lassen, und stellte mir vor, wie sie unter der tropischen Sonne langsam verrottete, wie ihre Farbe abblätterte, ihre Decksplanken rissen, ihre Spanten von Termiten durchlöchert wurden. Und so log ich und sagte, ich fände absolut nichts Ungewöhnliches am Auffinden eines zusammengeschossenen Bootes, das leck durch die Karibik treibe.
Chief Inspector Deacon Billingsley hob seine rechte Hand und tätschelte siegesgewiss, gönnerhaft und sehr freundlich meine Wange, sodass ich das kalte Metall seiner schweren, goldenen Ringe spüren konnte. «Guter Junge», meinte er spöttisch. «Und wenn Sie Bellybutton zu Gesicht bekommen, so sagen Sie ihm, ich wüsste, wo sein Bruder ist. Ich würde mir den Bastard zu einem mir genehmen Zeitpunkt holen und dann mit dem Kopf voran in den Häcksler stecken.» Er drehte sich abrupt um, wartete gar nicht erst auf eine Reaktion. Die Laufplanke vibrierte unter seinem selbstsicheren Schritt. Er ging den Kai hinunter, ohne sich umzublicken. Doch er musste gewusst haben, dass ich ihm nachsah, denn ein paar Meter vor seinem Wagen blieb er stehen und holte sehr ostentativ die belastende Seekarte aus seiner Jacketttasche. Eine Sekunde lang glaubte ich, er würde sie verbrennen, doch stattdessen zerriss er sie in kleine Stücke und warf die Fetzen in den warmen Wind.
«Dieser Mistkerl!», murmelte ich. In diesem Augenblick waren die Hirondelle und ihre Crew für immer verschwunden.
Der Fahrer des Lincoln war ein uniformierter Polizist, der nun ausstieg, um Billingsley die Tür zu öffnen. «Ich habe dir gesagt, du sollst dich da raushalten», sagte Ellen geringschätzig, während sie die Kajütstreppe heraufkam. Ich vermutete, dass sie meine Unterhaltung mit Billingsley vom Oberlicht der Hauptkabine aus belauscht hatte, denn es stand offen. Sie stellte sich neben mich und sah zu, wie der weiße Lincoln das Werftgelände verließ. «Habe ich dir nicht gesagt, du würdest nur deine Zeit verschwenden?»
«Zum Teufel mit meiner Zeit», sagte ich wütend. «Hast du gehört, was er über dich und mich gesagt hat?»
«Selbstverständlich habe ich es gehört.» Sie wirkte ziemlich unbeeindruckt von Billingsleys unverschämter Frage, ob wir miteinander schliefen. Offenbar sah sie in der merkwürdigen Neugierde des Polizisten nur eine weitere Bestätigung der Männern innewohnenden Verwahrlosung. Ellen war über meine Antwort mehr irritiert als über Billingsleys Frage. «Warum hast du ihm denn nicht einfach die Wahrheit gesagt?»
«Das habe ich getan.»
«Ich meine die wirkliche Erklärung.» Und die bestand darin, dass sich Ellen für die Zeit ihrer Tätigkeit als Köchin dem zölibatären Leben verschrieben hatte; eine Entscheidung, die für mich ebenso exzentrisch wie auch unverständlich und frustrierend war.
«Ich hätte diesem arroganten Hund gar nichts erzählen sollen.» Ich starrte auf die Stelle der Werft, wo eben noch Billingsleys Wagen gestanden hatte. «Himmel! Ich sollte mich über ihn beschweren! Ich weiß, was ich machen werde. Ich werde verdammt noch mal die Britische Botschaft anrufen!»
«Sei doch nicht so töricht, Nick!» Ellen hatte aufrichtige Angst um mich. «Beschwer dich ruhig über ihn – doch in weniger als einer Woche haben sie dich des Landes verwiesen. Begreifst du denn wirklich nicht, was gespielt wird? Bist du denn völlig blind? Willst oder kannst du nicht verstehen, dass sich in kleineren Staaten die Macht in den meisten Fällen unverhüllt zeigt, weil es in ihnen noch nicht genügend gesellschaftlichen Überbau gibt, um die Realitäten institutioneller Brutalität durch die Fiktion der Respektabilität zu kaschieren?»
Aber ich hörte nicht auf die Vorträge der Professorin. Ich ekelte mich vor mir selbst. Es kam mir so vor, als hinge der Geruch von Billingsleys Zigarre am Boot wie der Schwefelgestank der Hölle. Und damit wirkte die Erkenntnis nach, dass ich so schnell zur Unaufrichtigkeit verleitet worden war, wie man ein Tau zu einem Bunsch aufschießt. Ich hatte gelogen, ich hatte mich vom Bösen verleiten lassen. Aber nur für die Masquerade.
Die Masquerade ist mein Boot. Sie ist eine Schönheit, eine 40-Fuß-Ketsch aus Mahagoni auf Eiche. Sie wurde vor dem Zweiten Weltkrieg in Hampshire von Männern gebaut, die stolz auf ihrer Hände Arbeit waren. Doch dann hatte das Fiberglas Holzboote überflüssig gemacht, und die Masquerade war aufgelegt und auf einer Bootswerft am Exe dem Verrotten preisgegeben worden.
Ich hatte sie entdeckt, als ich Ausbilder im Camp Lympstone der Royal Marines in Devon gewesen war. Ich kaufte sie für ein Butterbrot und ein Ei und gab dann ein Vermögen für ihre Instandsetzung aus. Und als meine Dienstzeit dem Ende zuging und ich es mir leisten konnte, mich auf der See herumzutreiben, wie ich es schon immer hatte tun wollen, verließ ich die Marines und machte die Masquerade zu meinem neuen Zuhause. Ein paar Jahre lang trieb ich mich mit ihr im Mittelmeer herum, dann segelten wir über den Atlantik. Die Überquerung war die erste Etappe einer geplanten Weltumsegelung, doch dieser Traum wurde grausam zerstört, als die Masquerade von ihrem Liegeplatz vor den Keys von Florida gestohlen wurde. Zehn Tage später tauchte sie wieder auf, gestrandet an einem Korallenriff inmitten der Bahamas. Der größte Teil ihrer Ausstattung fehlte, die scharfen Korallenspitzen hatten ihre Steuerbordseite halb aufgerissen. Die Diebe wurden nie gefunden.
Das alles war vor gut einem Jahr geschehen. Mühsam von Thessys Vater, einem Fischer, geborgen, stand die Masquerade nun im sandigen Garten hinter Thessys Haus, wo sie zwischen Kasuarinen und Palmen aufgebockt war und Hühner in ihrem Cockpit schliefen. Sie hatte Reparatur und Zuwendung nötig. Sie hatte es nötig, endlich wieder die See unter ihrem langen und tiefen Kiel zu spüren. Ihre Planken hatten das Salzwasser nötig. Sie hatte mich nötig. Deshalb hatte ich mich dem Diktat von Deacon Billingsley gebeugt, denn sonst hätte ich sie verloren.
Und ich hätte auch die Chance verloren, mit Ellen über den Pazifik zu segeln, denn Ellen war fast bereit, mit mir zu kommen. Und wenn ich mich nicht auf die Erpressung des Polizisten eingelassen hätte, hätte ich Ellen ebenso verloren wie mein Boot.
Und so hatte ich gelogen.
Kurz vor Sonnenuntergang zog ich das Klapprad der Wavebreaker aus seinem Verschlag am Heck des Bootes, mühte mich fluchend mit den eingerosteten Scharnieren ab und radelte dann über die Midshipman Road zu dem prächtigen Apartmentblock, in dem unser Boss wohnte.
Matthew McIllvanney war nicht der wirkliche Chef von Cutwater Yacht Charters (Bahamas) Limited. Das Unternehmen gehörte einem früheren Theaterdirektor, der seinen Ruhestand auf den Bahamas verlebte und ein langjähriger Freund meines Vaters war. Diese Freundschaft hatte mir den Job als Skipper auf der Wavebreaker gesichert, nachdem die Masquerade gestrandet war. Doch McIllvanney kümmerte sich um den täglichen Ablauf des Chartergeschäftes. Buchungen für Charterboote von Cutwater wurden für gewöhnlich in Niederlassungen in Miami und London vorgenommen und von dort an McIllvanneys Werft in Freeport geleitet, wo die Boote im Hafen lagen und instand gehalten wurden. McIllvanney hielt sich auch ein paar eigene Motorboote, die er vermietete, und seine Werft bot einen sehr effizienten Yacht-Service sowie ein umfangreiches Angebot für seemännischen Bedarf. Das verwischte die Grenzen zwischen seinen Unternehmungen und Cutwater, und im Grunde konnte man sagen, dass er Cutwater leitete. Er hatte auch die Leitung einer Reihe weiterer Geschäfte inne, die mit Booten nichts zu tun hatten, aber vermutlich sehr viel profitabler waren.
Irgendwo machte McIllvanney mit Sicherheit Geld. Die Starkisser musste ihn an die 100 000 US-Dollar gekostet haben und das Penthouse-Apartment in Lucaya mit privatem Anlegesteg und Aussicht auf Silver Point Beach wahrscheinlich zehnmal so viel. In seiner Garage standen ein BMW und ein alter MG mit Schiebedach, aber sein Lieblingsgefährt war eine schwere Kawasaki. Selbst im Vergleich zu den amerikanischen Ruheständlern, die um ihn herum lebten, war Matthew McIllvanney ein reicher Mann.
Ich schloss das Fahrrad an einen schmiedeeisernen Zaun vor McIllvanneys Apartmentblock an und konnte den uniformierten Gorilla davon überzeugen, dass ich kein Terrorist war. Der Sicherheitsmann schickte mich mittels seines Schlüssels mit dem Fahrstuhl ohne Zwischenaufenthalt direkt ins oberste Stockwerk, wo sich die Lifttür direkt in McIllvanneys Apartment öffnete. Ich war schon mindestens ein Dutzend Mal in der Wohnung gewesen, fand aber die Tatsache, dass ein Fahrstuhl unmittelbar in ein Wohnzimmer eindrang, noch immer ungeheuer beeindruckend. Es war ein ähnlich überzeugender Beweis für Reichtum wie der Besitz von goldenen Wasserhähnen oder Nerzteppichen oder der jungen Frau, die mich an der Lifttür begrüßte. Sie war sehr hoch gewachsen, sehr blond und verwirrend schön, ihr Teint neigte unter der Wucht von McIllvanneys Klimaanlage zur Gänsehaut. Die Anlage war auf eine Temperatur eingestellt, die selbst einen Pinguin zum Erschauern gebracht hätte. «Hi!», sagte die Frau enthusiastisch. «Sie müssen Nick sein! Matt erwartet Sie schon. Er ist draußen.» Sie sah aus, als wäre sie im Himmel aus Pfirsichen und Sahne erschaffen worden, trug ein paar Schnüre als Bikini arrangiert, hohe Absätze, die Gänsehaut und sonst nichts. Sie nickte zur gazeumspannten Veranda hinüber, die aufs Meer hinausführte. «Möchten Sie vielleicht einen Drink, Nick?»
«Irish Whiskey», sagte ich. «Ohne Eis, aber mit ein bisschen Wasser, und vielen Dank.»
«Liebend gern. Ich heiße Donna.» Donna reichte mir eine schlaffe Hand und schlug mit wiegendem Gang den Weg zur Hausbar ein. Schon ihren Bewegungen zu folgen konnte einem das Herz brechen. Sie wedelte mit der Hand umfassend durch McIllvanneys Apartment. «Ist das nicht die wundervollste Behausung, die Sie je zu Gesicht bekommen haben?»
«Sie ist in der Tat ganz außerordentlich», stimmte ich höflich zu. Das Apartment war wirklich attraktiv. Das lag vielleicht daran, dass es so gar nichts von McIllvanney hatte. Die früheren Besitzer hatten eine teure Innenarchitektin aus New York kommen lassen und ihr aufgetragen, den Räumen die Atmosphäre eines altenglischen Landhauses mit Pferdegeruch und Geheimagententouch zu verpassen, was mit erstaunlicher Perfektion gelungen war. Doch McIllvanney hatte so gar nichts davon. McIllvanney war ein protestantischer Schlägertyp aus der Shankill Road in Belfast, der seine Brutalität in der harten Schule nordirischer Vorurteile gelernt, sie bei der Britischen Armee vervollkommnet hatte und sie nun auf den Bahamas zu welchem Nutzen auch immer anwandte. Wäre ich aufgefordert worden, eine Wohnung einzurichten, die McIllvanneys Charakter widerspiegelte, so hätte ich ihr das Aussehen einer Kneipe in East Belfast gegeben, mit Sägespänen auf dem Fußboden, King Billy an der Wand und Blutspritzern an der nikotinbraunen Decke.
«Warum gehen Sie nicht einfach durch, Nick», schlug Donna vor. «Ich bringe Ihnen und Matt die Drinkies dann raus.»
Ich ging einfach durch, schob die schwere Glastür zur Seite und trat auf die schwüle Veranda hinaus, wo ein mürrisch dreinblickender McIllvanney in einem Rohrsessel lümmelte und durch die Gaze auf das Meer hinausblickte, das immer dunkler wurde. «Ach, Sie sind’s», begrüßte er mich wenig begeistert und so, als hätte er jemand anderes erwartet.
«Sie wollten mich sprechen», stellte ich fest. Meine Zeit mit McIllvanney zu verbringen, entsprach nicht unbedingt meinen Vorstellungen von Entspannung, und sein fehlender Enthusiasmus stimmte mich nicht heiterer.
«Setzen Sie sich doch, Eure Heiligkeit», sagte er brummig. Mich «Eure Heiligkeit» zu nennen, war einer von McIllvanneys Scherzen. Es lag weniger daran, dass ich besonders fromm gewesen wäre, sondern vielmehr an meinem Namensvetter Nicholas Breakspear, dem einzigen Engländer, der je den Stuhl Petri bestiegen hatte. Er hatte den Namen Hadrian IV. angenommen und die Kirche im 12. Jahrhundert regiert. Eine Tatsache, die außer mir nur wenigen anderen bekannt war, aber eine, die ich in einem unbedachten Moment McIllvanney erzählt hatte, dessen Hass auf taigs, Katholiken, dafür sorgte, dass er meine päpstliche Verbindung nicht vergaß. Aber in Wahrheit gab es da gar keine Verbindung, da mein ursprünglicher Familienname Silitoe war. Doch lange vor meiner Geburt hatte mein Vater den Künstlernamen Breakspear angenommen, und ich hatte eigentlich keinen anderen gekannt.
«Hat dieser Hund Bellybutton die Starkisser zurückgebracht?», wollte McIllvanney mit seinem Belfaster Akzent plötzlich von mir wissen.
«Sogar in einem Stück.»
«Er wird allmählich ein bisschen groß für seine gottverdammten schwarzen Stiefel, der Bursche.» Die Beschwerde war ein Ritual, nicht ernst zu nehmen, eine rein gewohnheitsmäßige Feststellung, die mir lediglich deutlich machen sollte, wie hart und unerbittlich McIllvanney doch war. Wenn er sich zwischen mir und Bellybutton entscheiden müsste oder Bellybutton und seiner Mutter, hätte er ohne Zögern Bellybutton gewählt. Sie waren vom selben Schlag.
McIllvanney war ein großer, narbenbedeckter, aber überraschend gutaussehender Mann mit einem harten, schlauen Gesicht und einem trügerisch dünnen Körper. Trügerisch, weil er brutal kräftig war. Er konnte aber auch ein hervorragender Unterhalter sein, mit einem reichen Fundus an Geschichten, die er mit einem sicheren Gespür für Pointen erzählte, aber solche guten Momente waren selten, denn er zog es vor, über die Ungerechtigkeiten des Lebens zu sinnieren, deren größte die unbegreifliche Existenz der römisch-katholischen Kirche war.
«Bist du katholisch?», fragte er Donna, als sie mit den Drinks herauskam. Ich vermutete, die Frage sollte mehr meinem Amüsement dienen als seiner Erleuchtung.
«Himmel, nein! In unserer Familie sind wir alle episkopalisch.» Sie lächelte ihn strahlend an. «Aus Philadelphia», fügte sie zu meiner Information hinzu und beglückte auch mich mit einem Lächeln. Donna war ein Cheerleader des Lebens; ihre Zähne waren ein Triumph der Zahnheilkunde, ihre Haare eine Mischung aus Gel, Spray und Hitze und ihr Körper ein Tribut an gesunde amerikanische Ernährung und sportlichen Einsatz. «Ich habe schon so viel von Ihnen gehört», teilte sie mir mit, als wolle sie sich auf ein ausführliches, behagliches Geplauder einlassen.
«Schieb ab und schlag ihn dir aus dem Sinn», knurrte McIllvanney.
«Es war ganz bezaubernd, Ihre Bekanntschaft zu machen, Nick!» Donna schenkte mir ein letztes blendendes Lächeln, und dann klapperte sie, offenbar unempfindlich für McIllvanneys übellaunigen Spott, auf ihren absurd hohen Absätzen davon.
Ich wartete, bis Donna außer Hörweite war. «Ist sie Ihre Neueste?» Hübsche Frauen gab es in verblüffender Zahl in McIllvanneys Leben. Die letzte, die einen Rekord von sechs Monaten aufgestellt hatte, war gerade vor wenigen Wochen verschwunden.
Er schüttelte den Kopf. «Sie ist eines der Mädchen. Sie würde Sie zweitausend US-Dollar am Tag kosten, Nick, plus Flugticket, Verpflegung und Geschenk. Ich musste sie heute aus Miami holen, weil die dumme Kuh nicht fliegen wollte. Ist es zu glauben? Hat angeblich Angst vor Flugzeugen. Also musste ich sie mit der Junkanoo abholen.»
Die Junkanoo war eins von McIllvanneys Booten, zweifellos mit den Profiten aus seinem Callgirl-Service erworben. Er betonte gern, dass sein Service überaus elegant war und keineswegs so ordinär wie der Halbtags-Kuppler-Dienst, den Bellybutton mit seinen Zähnen erzwang. Nein, McIllvanney war der Bahamas-Agent eines Unternehmens mit Sitz in Miami, das den Anspruch erhob, jedem die schönsten Frauen der Welt zu vermitteln, der das Geld hatte, sie zu bezahlen. McIllvanney arrangierte die Besuche der Frauen bei Klienten auf den Bahamas und garantierte für deren Sicherheit, solange sie sich auf den Inseln aufhielten. Das machte McIllvanney zu einem vergoldeten Zuhälter, auch wenn er bevorzugte, sich als «Freizeitagent» zu bezeichnen. Normalerweise brachte er so viel Takt auf, bei dieser Bezeichnung zu lächeln. Jetzt zeigte er eine ähnliche Erheiterung. «Wie ich höre, hat Ihnen dieser schwarze Scheißkerl Billingsley heute gründlich den Tag versaut?»
McIllvanney genoss es. Er konnte mich nicht leiden. Ich war der Sohn eines reichen und berühmten Mannes, und für McIllvanney hatte der Zufall der Geburt den korrupten Klang geklauter silberner Löffel. Es spielte keine Rolle, dass ich die Lebensweise meines Vaters ablehnte, dass ich zur See gefahren und arm wie eine Kirchenmaus war, während McIllvanney mit Fug und Recht als reicher Mann bezeichnet werden konnte. Der Geruch von Privilegien hing mir an, und McIllvanney liebte es, mich deswegen zu piesacken. «Woher wollen Sie wissen, was sich heute zwischen Billingsley und mir abgespielt hat?», fragte ich ihn.
«Woher wohl? Raten Sie mal! Er hat es mir gesagt.»
Ich hätte wissen müssen, dass zwei Männer wie McIllvanney und Billingsley auf einer so kleinen Insel wie Grand Bahama einander kennen würden. McIllvanney musste Billingsleys Quelle dafür gewesen sein, dass die Polizei über mein Boot und meine Pläne, es instand zu setzen, Bescheid wusste. Zweifellos hatte Billingsley mit McIllvanney gesprochen, bevor er auf der Werft erschien, und ich vermutete, dass er den Mann aus Ulster danach mit einer genauen Schilderung meiner Feigheit ergötzt hatte. Plötzlich empfand ich eine ungeheure Erleichterung, dass ich nur noch eine Charterfahrt für Cutwater zu absolvieren hatte, um diese Männer danach endgültig los zu sein.
«Also was hat Ihnen Billingsley gesagt?» McIllvanney schien sich über mein Schweigen zu amüsieren. «Dass die belgischen Eigner urplötzlich vom Segeln die Nase voll hatten und nach Hause gelaufen sind?»
«Ja.»
«Billingsley ist ein schwarzer Lügenbold. Diese Belgier müssen zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht sein und haben vermutlich etwas gesehen, das nicht für ihre Augen bestimmt war. Also hat ihnen jemand das Maul gestopft. Sie wären nicht die ersten Touristen, die an die Haie verfüttert wurden, und sie werden nicht die letzten bleiben.»
«Wollen Sie damit andeuten, dass sie ermordet wurden?» Ich empfand heftige Gewissensbisse, so schnell Billingsleys Erpressung nachgegeben zu haben.