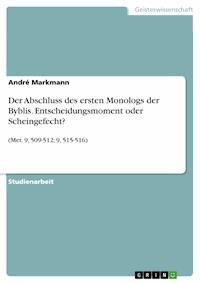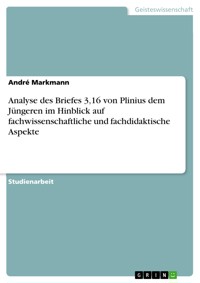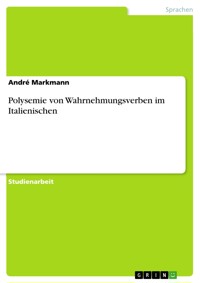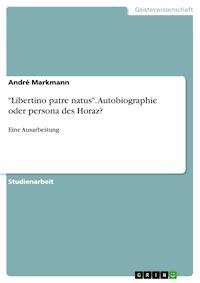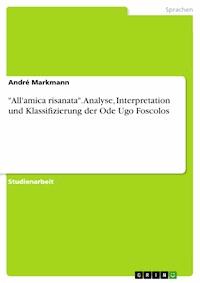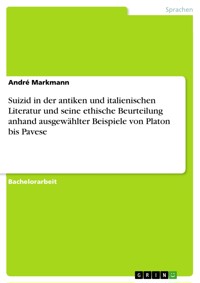
Suizid in der antiken und italienischen Literatur und seine ethische Beurteilung anhand ausgewählter Beispiele von Platon bis Pavese E-Book
André Markmann
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Romanistik - Italianistik, Note: 2,1, Universität Münster (Romanische Philologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Suizid und seiner ethischen Betrachtungweise beziehungsweise deren Entwicklung von der Antike bis in die Moderne. Anhang weniger ausgewählter Beispiele sollen gewisse Tendenzen, wiederkehrende Prinzipien und konstrastierende Ansichten herausgearbeitet werden. Um dieses zu bewerkstelligen, ist es unabdingbar, sich kurz mit der Theorie des Themas sowie den Begrifflichkeiten auseinander zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Die ethische Betrachtung des Suizid in der Antike
2.1. Platon
2.2. Seneca und die Stoiker
2.3. Plotin und die Neuplatoniker
3) Christliche Zeit und Mittelalter
3.1. Augustinus
3.2. Dante Alighieri
4) Moderne
4.1. Giacomo Leopardi
4.2. Cesare Pavese
5) Fazit und Ausblick
6) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
„Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord“
(Albert Camus, Der Mythos des Sisyphos)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Suizid und seiner ethischen Betrachtungsweise, bzw. deren Entwicklung von der Antike bis in die Moderne. Anhand weniger ausgewählter Beispiele sollen gewisse Tendenzen, wiederkehrende Prinzipien und kontrastierende Ansichten herausgearbeitet werden. Um dieses bewerkstelligen zu können, ist es unabdingbar sich kurz mit der Theorie des Themas sowie der Begrifflichkeit auseinander zu setzen.
Der französische Soziologe Émile Durkheim definiert Suizid in seinem Werk Le Suicide wie folgt:
Man nennt Selbstmord jeden Todesfall, der direkt oder indirekt auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die vom Opfer selbst begangen wurde, wobei es das Ergebnis seines Verhaltens im Voraus kannte. (…)[1]
Zwar ist die Definition an sich sehr plausibel und zutreffend, aber sie bleibt in gewisser Weise unkonkret. Durkheim macht keinen Unterschied zwischen erzwungenem Suizid (wie beispielsweise im Falle Senecas) und frei gewähltem Suizid. Allerdings darf man jedoch bei der Untersuchung der moralischen Sichtweise auch den Faktor der ‚Freiwilligkeit‘ dessen, der sich schlussendlich für den Freitod entscheidet, nicht gänzlich außer Acht lassen.
Welche Motive den Akt der Selbsttötung hervorgerufen haben bzw. inwiefern diese die ethische Betrachtungsweise in Bezug auf das Thema beeinflussen können, wird in der vorliegenden Arbeit noch zu diskutieren sein.
Interessant und von großer Bedeutsamkeit ist auch die Begrifflichkeit. Obwohl im Volksmund der Begriff ‚Selbstmord‘ vermutlich der gebräuchlichste ist, soll im Rahmen dieser Abhandlung diese Bezeichnung keine Verwendung finden, da ‚Selbstmord‘ durch den Wortteil ‚-mord‘ unbewusst den Gedanken einer Straftat impliziert und somit direkt eine stigmatisierende Wertung vornimmt, auf die jedoch bei der Benennung des Vorgangs erst einmal verzichtet werden sollte.
Wahrscheinlich deshalb findet dieser Begriff mittlerweile aber auch immer weniger Verwendung zugunsten des scheinbar weniger wertenden Ausdrucks ‚Suizid‘. Dieser Terminus leitet sich ab vom lateinischen suicidium, das allerdings weder in der Antike noch in der Spätantike auftaucht[2]. Vermutlich handelt es sich bei der Bildung des Wortes um eine Analogie zu Wörtern wie homicidium (Mord) oder parricidium (Verwandtenmord) mit dem Wortstamm, der sich von caedere ableitet und dem Genitiv des Reflexivpronomens der 3. Person Singular. Dagmar Hofmann zufolge ist dieses Wort eine Erfindung zu Zeiten des Mittelalters, während der antike Sprachgebrauch sich beispielsweise freierer Wendungen wie mors voluntaria bediente[3]. Da ‚Suizid‘ auch in der Forschungsliteratur durchaus eine weitreichende Resonanz aufweist, wird es neben Begriffen wie ‚Freitod‘ oder ‚Selbsttötung‘, die frei sind von jeglicher moralischer Wertung, in dieser Arbeit Verwendung finden.
Im Fortlauf der Bearbeitung sollen also anhand ausgewählter Beispiele gewisse ethisch-moralische Anschauungen zu diesem Thema dargelegt, analysiert und schlussendlich miteinander verknüpft oder einander gegenübergestellt werden.
Diesem corpus zugrunde liegen etwaige diesbezügliche Ausarbeitungen des antiken Philosophen Platon. Seine Ausführungen werden im Laufe der Jahrhunderte noch einigen Literaten und Geisteswissenschaftlern als Grundlage und Beispiel dienen, sodass eine kurze Erarbeitung seiner Schlussfolgerungen unumgänglich ist.
Dabei soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass auch Platons Standpunkt durch bestimmte Faktoren bzw. Einschränkungen eine Art Wandel erfährt, den fast alle hier folgenden Persönlichkeiten in ihre Anschauung aufnehmen oder in ähnlicher Weise in ihrer Betrachtungsweise verarbeiten.
Nachdem am Rande auf Platons Schüler Aristoteles eingegangen werden wird, soll kurz auch ein Aspekt der Position Ciceros beleuchtet werden, bevor dann etwas ausführlicher die Lehre der Stoa und dessen wichtigster Vertreter Seneca in den Vordergrund rücken werden.
Deren ethische Betrachtung zum Thema Suizid verdient insofern besondere Aufmerksamkeit als dass die Stoiker eine grundlegend neue Sichtweise in dieser Debatte etablieren, die eine komplett andere Konzeption des Freiheitsbegriffs und dessen Relevanz für die ethische Beantwortung der Frage zugrunde legt, ob der selbstgewählte Tod in die Entscheidungsgewalt eines Gottes oder des Menschen selbst fällt. Dass damit eine fundamental andere Ethik und Philosophie im Allgemeinen einhergeht, kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur mit Bezug auf das konkrete Thema behandelt werden.
Dennoch ist diese Position äußerst spannend und in ihrer Grundidee auch zugleich prägend für moderne Literaten wie Cesare Pavese, die gewisse Aspekte der stoischen Lehre (und dabei besonders der von Seneca artikulierten Ideen) in ihrer Beschäftigung mit dieser Thematik voraussetzen und sich somit in eine stoische Tradition stellen. Wie diese jedoch genau zu verstehen ist, soll in der folgenden Analyse erarbeitet werden.
Nach der Stoa hingegen tut sich wieder eine gänzlich andere Denkrichtung hervor, die der Neuplatoniker. Diese rekurrieren, wie der Name bereits andeutet, auf gewisse Inhalte der platonischen Denkweise. Als typischer Repräsentant jener Gruppe soll an dieser Stelle Plotin herangezogen werden. Daher wird im Folgenden untersucht werden, inwieweit die platonische Anschauung auch dessen Sichtweise geprägt hat und welche Weiterentwicklungen oder Veränderungen eventuell mit dem Fortlauf der Zeit in jene Diskussion Einzug gehalten haben.
Anhand des christlichen Kirchenlehrers Augustinus werden dann verstärkt die religiösen Aspekte dieser Problematik unter die Lupe genommen werden. Während bisher vor allem moralische Komponenten zur Diskussion standen, wird mit dem Aufkommen des Christentums eine nochmals andere Perspektive eröffnet, der im Zuge dieser Abhandlung natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit gebührt. Ob und inwieweit auch (eventuell bereits bekannte) ethische Gesichtspunkte in dieser religiösen Auseinandersetzung Platz finden, wird im Folgenden noch zu klären sein.
Ebenfalls von großer Bedeutung für diese Thematik ist die Zeit des Mittelalters, die in diesem corpus besonders durch Dante Alighieri vertreten wird. Da dieser in seiner Divina Commedia gewissen Leuten, die durch eigene Hand gestorben sind, einen ganzen canto des Inferno widmet, wird es interessant sein herauszuarbeiten welchen ethischen Standpunkt er diesbezüglich vertritt und warum er anderen Figuren, die den Freitod wählten, einen anderen Ort als denjenigen im genannten 13. canto zuweist. Dabei ist besonders Cato der Jüngere hervorzuheben, da an seinem konkreten Beispiel analysiert werden soll, inwiefern die Art des Motivs für den Suizid eine entscheidende Rolle spielt im Hinblick auf die ethische Beurteilung der Thematik vonseiten der ausgewählten Literaten und Philosophen.