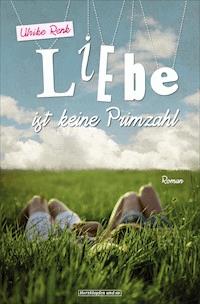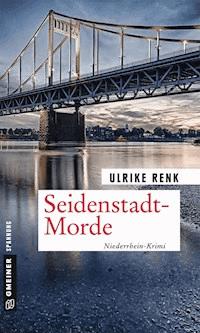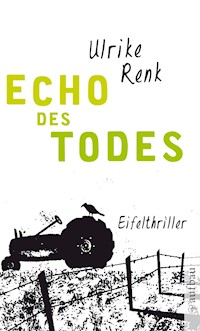9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Seidenstadt-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Hoffnung dieser Tage.
England, 1939. Ruth hat es geschafft – sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die endlich nach England ausreisen darf. Zusammen wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre Verwandten noch nachzuholen. Aber dann erklärt England Deutschland den Krieg. Ruth wähnte sich bislang in Sicherheit, aber was geschieht, wenn die Deutschen das Land nun angreifen? Sie setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der Krieg droht ihre Pläne zunichtezumachen ...
Bestsellerautorin Ulrike Renk erzählt eine dramatische Familiengeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga und ihre Ostpreußen-Saga sowie zahlreiche historische Romane vor.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
Informationen zum Buch
Die Hoffnung dieser Tage.
England, 1939. Ruth hat es geschafft – sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die endlich nach England ausreisen darf. Zusammen wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre Verwandten noch nachzuholen. Aber dann erklärt England Deutschland den Krieg. Ruth wähnte sich bislang in Sicherheit, aber was geschieht, wenn die Deutschen das Land nun angreifen? Sie setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der Krieg droht ihre Pläne zunichtezumachen ...
Bestsellerautorin Ulrike Renk erzählt eine dramatische Familiengeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Tage des Lichts
Das Schicksal einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Ulrike Renk
Informationen zum Buch
Newsletter
Personenverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Nachwort
Danksagung
Impressum
Für
Ruth Meyer-Elcott und Ilse Meyer-Wolfson
Eure Geschichte wird nicht vergessen werden.
Personenverzeichnis
Familie Meyer
Martha Meyer (geb. Meyer) Karl Meyer
Ruth
Ilse
Großeltern
Wilhelmine Meyer (Omi) Valentin Meyer (Opi) → Karls Eltern
Emilie Meyer (Großmutter) → Marthas Mutter
Hedwig Simons (geb. Meyer)
Hans Simons
Werner und Hilde Kappels, Tochter Marlies (England)
Freunde und Bekannte der Familie Meyer
Hans Aretz (ehemaliger Chauffeur)
Josefine Aretz (Finnchen)
Helmuth
Rita
Familie Kruitsmanns (Holland)
Edith und Jakub Nebel (England)
Freddy und Olivia Sanderson
Jill
Jack und Daisy Norton → Knecht und Magd auf der Farm
Susan und Lydia → Helferinnen in der Küche
Evakuierte
Ms Florence Jones → Lehrerin
Matilda Smith
Ruby Taylor
Harriet Roberts
Kapitel 1
England, August1939
Um achtzehn Uhr dreißig fuhr der nächste Zug von London nach Frinton-on-Sea, das hatte Ruth sich gemerkt. Sie verließ das Bloomsbury House und eilte zum Bahnhof. Um sie herum herrschte emsiges Treiben, die meisten Menschen hatten Feierabend. Manche schlenderten durch die Straßen, genossen den herrlichen Sommerabend. Andere hatten es eilig, mit schnellen Schritten und manchmal ohne Rücksicht zu nehmen, liefen sie durch die Menge. Auch Ruth beeilte sich, obwohl sie eine bleierne Müdigkeit verspürte. Nach und nach fiel die Aufregung von ihr ab, und eine Leere machte sich in ihr breit. Der Glockenschlag von Big Ben riss sie aus ihren Gedanken. Sie lauschte – zwei Tonfolgen, zehn Takte –, das bedeutete, dass es halb sechs war. Gut vierzig Minuten brauchte sie vom Bloomsbury House bis zum Bahnhof. Um diese Zeit mit all den Menschen auf der Straße würde es vielleicht sogar etwas länger dauern. Zum Glück hatte sie heute Morgen schon eine Rückfahrkarte gelöst. Sie musste den Zug unbedingt erreichen, die Rückfahrt würde weitere drei Stunden dauern, und Mrs Sanderson war bestimmt böse, dass sie so lange fort war, und würde mit Tadel nicht sparen. Doch das nahm Ruth gerne in Kauf. Wichtig war nur, dass die Mitarbeiter des Bloomsbury House ihr Versprechen hielten und die Formulare nach Deutschland kabelten. Heute noch. Es hing so viel davon ab – das Leben ihres Vaters stand auf dem Spiel. Nur die Einreiseerlaubnis nach England konnte ihn jetzt noch retten.
Ruth beschleunigte ihren Schritt, wich den anderen Leuten aus. Ihre Kehle war trocken, ihr Magen knurrte, und dennoch verspürte sie keinen Appetit. Den ganzen Tag hatte sie im Bloomsbury House verbracht, hatte gehofft, gebetet, gefleht und schließlich geschrien – sie hatte nur diesen Tag, diese vierundzwanzig Stunden, um zu erreichen, dass die Papiere nach Deutschland gekabelt wurden.
Wochenlang hatte sie alle wichtigen Dokumente zusammengetragen. Edith Nebel, eine deutsche Jüdin, die schon lange in England lebte und sich nun um jüdische Flüchtlinge kümmerte, hatte ihr dabei geholfen. Außerdem hatte Edith sich bereit erklärt, Ruths Cousin Hans zu adoptieren. Die Papiere waren schon beim Roten Kreuz, doch Bürokratie dauerte – immer und überall. Sie hatte sogar das Gefühl, dass es immer schlimmer würde, England schien sich in einer Starre zu befinden und der Krieg mit Deutschland unvermeidbar zu sein. Gerade deshalb, dachte Ruth seufzend, ist es doch so wichtig, jetzt noch Anträge zu genehmigen und auszuführen. Bald schon könnte es zu spät sein. Aber sie hatte getan, was sie konnte, jetzt blieb ihr nur noch, zu hoffen.
Sehnsüchtig schaute Ruth zu den Straßencafés, an denen die Tische gut besetzt waren und fröhliche Menschen kalte Getränke vor sich stehen hatten. Sosehr sie eine Limonade herbeisehnte, die Zeit reichte einfach nicht.
Je näher sie dem Bahnhof kam, umso dichter wurde das Gewühl auf den Straßen. Viele Leute arbeiteten in London, wohnten aber außerhalb. Mittlerweile war es so voll, dass die Menge kaum mehr vorankam. Schnell drückte sie sich an einem Paar vorbei, das laut debattierend direkt vor ihr stehen geblieben war, stolperte und fing sich gerade noch rechtzeitig. Wieder hörte sie den Glockenschlag der großen Turmuhr, es war schon Viertel nach sechs.
So voll hatte sie den Bahnhof noch nie erlebt, aber es war auch erst das dritte Mal, dass sie in London war. Energisch schob sie sich durch die Massen, erreichte den Bahnsteig und seufzte erleichtert auf.
»Limonade!«, rief eine Frau, die einen Bauchladen trug und ein kleines Wägelchen hinter sich herzog. »Frisch gepresste Limonade.«
»Ich nehme eine«, sagte Ruth eilig. Sie zog ihre Börse aus der Tasche und nahm einige Münzen hervor. Die Frau gab ihr eine klebrige Flasche, die sich warm anfühlte. Frisch war das sicherlich nicht, aber das war Ruth nun egal.
»Na«, sagte die Frau, »geht es fürs Wochenende aufs Land? Haste ’nen Liebsten dort?« Sie zwinkerte Ruth zu.
Ruth schoss das Blut in die Wangen. »Nein«, sagte sie, doch die Frau hatte sich schon abgewendet.
Dampfend und pfeifend fuhr der Zug ein und blieb ächzend stehen. Kaum einer stieg aus, doch viele wollten einsteigen. Zu viele, dachte Ruth erschrocken und schloss schnell den Korken der Flasche und steckte sie in ihre Tasche. Gleich würde das Gedränge losgehen und der Kampf um die Plätze. Doch entgegen ihren Befürchtungen blieb es geordnet und ruhig. Es bildete sich eine Schlange, nach und nach stiegen die Passagiere ein. Ruth hatte das schon zuvor erlebt, aber noch nie bei einem solchen Andrang. Als der Zug anfuhr, hatte Ruth sogar einen Sitzplatz gefunden. Im Gang stand eine ältere Dame mit einem staubigen Hut und einer Reisetasche aus Teppichresten.
»Ich fahre nur bis zur nächsten Station«, sprach die junge Frau, die neben Ruth saß, sie an. »Sie können gerne meinen Platz haben.«
»Danke, Darling. Das ist sehr aufmerksam.«
Verlegen sah Ruth sich um. Es gab noch mehr ältere Leute. Sollte sie ebenfalls aufstehen und ihren Platz anbieten? Aber ihre Fahrt dauerte länger, fast drei Stunden würde sie unterwegs sein. Was, wenn es so voll blieb? Die ganze Zeit zu stehen, das konnte sie nicht, das würde sie nicht mehr schaffen. Die Anspannung der letzten Wochen, all die schlaflosen Nächte, die sie in Gedanken an ihre Lieben in Krefeld verbracht hat, hatten an ihren Kräften gezehrt. Dennoch plagte sie das schlechte Gewissen. Ein Mann schob sich durch den Gang. Er umklammerte einen Koffer, schnaufte.
»Wollen Sie sich setzen?«, platzte es aus Ruth heraus.
Das Gesicht des Mannes war sonnengegerbt und von Falten durchzogen.
»Wo musst du denn hin?«, fragte er sie.
»Nach Frinton-on-Sea.«
»Das ist aber ein ganzes Stückchen.« Nachdenklich schaute er sie an.
»Und wohin wollen Sie?«
»Ich will nach Maldon und steige in Chelmsford um.«
»Dann können Sie bis dorthin diesen Platz haben.« Ruth stand auf. Sie lebte jetzt in England, auch wenn sie vermutlich nie wirklich Engländerin werden würde, so wollte sie sich doch an die Sitten und Gebräuche halten.
»Wo kommst du her?«, fragte der Mann sie und schob seinen Koffer unter die Bank. »Du bist keine Engländerin.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Ich bin Deutsche«, sagte Ruth leise. Sie schämte sich, Deutsche zu sein, das wurde ihr immer wieder schmerzlich bewusst. Der Mann und auch die Umstehenden sahen sie prüfend an.
»Bist du auf der Rückreise? Noch gibt es ja die Fähre in Harwich.«
»Noch?«, fragte Ruth erschrocken.
»Es wird Krieg geben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, sagte ein Mann zwei Reihen weiter. »Und sobald Krieg ist, wird es keine zivile Seefahrt mehr geben. Die Deutschen haben aufgerüstet – man munkelt von Zerstörern und U-Booten, die sich schon jetzt auf den Weg in den Ärmelkanal gemacht haben.«
Ruth schluckte. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte und senkte den Kopf.
»Bist du Jüdin?«, fragte die alte Frau mit der Teppichtasche. Sie hatte einen schweren Akzent – es klang nach Osteuropa.
Automatisch hielt Ruth die Luft an. Würde sie nun angefeindet werden? Immer noch war sie sich nicht ganz im Klaren darüber, was die Briten den Juden gegenüber empfanden. Es gab einen Unterschied zwischen den Religionen, das hatte sie schon gemerkt. Allerdings wurden Juden nicht öffentlich abgelehnt wie in Deutschland.
»Keine Angst«, sagte die Frau. »Bin auch Jüdin. Gut, dass du hier bist. Bleibst doch hier, oder?«
»Ja, ich habe hier eine Stellung.«
»Gut so, Sweetheart«, meinte der alte Mann, »denn Krieg wird es geben.«
»Nur noch eine Frage der Zeit«, warf jemand ein. »Schließlich haben sie die Wehrpflicht eingeführt. Mein Sohn muss für ein halbes Jahr eine militärische Ausbildung machen und wird dann Reservist.«
»Hoffentlich bleibt er das auch«, seufzte eine Frau. »Mein Sohn wurde auch eingezogen – wie so viele andere Zwanzigjährige. Dabei haben wir doch eine Berufsarmee.«
»Na, wir haben ja im letzten Krieg gesehen, wie weit wir damit kommen.«
»Außerdem hat sich die Welt verändert – auch die Waffen und die Rüstung. Ich bin mir sicher, dass es einen Luftkrieg geben wird.«
»Einen Luftkrieg? Schlimmer noch als im Großen Krieg?«
»Wollen wir mal hoffen, dass die Regierung uns in letzter Minute noch davor bewahren kann. Chamberlain wird alles dafür tun, dass wir nicht in einen Krieg gezwungen werden.«
»Chamberlain und seine Appeasement-Politik – das kann doch gar nicht gut gehen. Wir haben ein Abkommen mit Polen«, sagte der Mann, dessen Sohn eingezogen worden war, »und daran werden wir uns halten müssen. Und davon, dass Hitler sich Polen einverleiben will, gehe ich aus.«
»Doch nur die Gebiete des polnischen Korridors und Danzig, oder?«
»Das sagt er jetzt. Aber hat er nicht auch Anfang des Jahres gesagt, dass er nur das Sudetenland haben will?«
»Russland wird ihm nie Polen überlassen.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher. Stalin ist genauso größenwahnsinnig wie Hitler!«
Inzwischen hatte der Zug im Bahnhof von Brentwood gehalten. Schon in Stratford und Ramford waren die meisten Pendler ausgestiegen, und nur wenige Passagiere kamen neu hinzu. Die meisten schienen Ausflügler zu sein, die offensichtlich auf dem Weg zur Küste waren und sich auf ein warmes Wochenende an der See freuten. Sie hatten Taschen und Picknickkörbe dabei, in den Gepäckwagen wurde so manches Fahrrad gehoben. Doch die Stimmung war nicht so ausgelassen und fröhlich, wie man es erwarten sollte. Ruth spürte die Anspannung der Leute, auch wenn sich nun die Gespräche um das Wetter drehten und nicht mehr um den drohenden Krieg.
Inzwischen hatte Ruth wieder einen Sitzplatz gefunden, lehnte ihren Kopf an das Fenster und schloss die Augen. Ihr Magen knurrte, und ihr war flau. Sie hatte seit dem frühen Morgen nichts gegessen.
»Na, Darling?« Die alte Frau mit der Teppichtasche setzte sich neben sie und schnaufte. »Biste allein hier, ohne Familie?« Sie rollte das R sehr stark und verschluckte einige Buchstaben.
»Meine Familie ist noch in Deutschland. Aber ich hoffe, dass sie bald nachkommen wird.« Ruth biss sich auf die Lippe. Sie spürte wieder, wie sich die Angst in ihr ausbreitete – die bange Furcht, dass all ihre Bemühungen zu spät kommen würden.
Die alte Frau nickte. »Die Familie sollte zusammen sein in Tagen wie diesen. Aber manchmal geht das nicht.« Sie schien ein wenig in sich zusammenzusacken, und die Falten um ihren Mund wurden tiefer. Dann lächelte sie, ein gezwungenes Lächeln. Sie tauschte mit Ruth einen wissenden Blick, und auch Ruth nickte. Es bedurfte keiner Worte, beide hatten das Grauen der Nazis erfahren.
Wieder schloss Ruth die Augen. Sie sah die schöne Landschaft nicht, durch die der Zug nun rollte, die Wiesen und Felder im milden Abendlicht des Spätsommers. In ihrem Kopf spielten die Gedanken Fangen. War sie zu spät dran gewesen? Würden die Männer vom Amt wirklich die Einreiseerlaubnis nach Deutschland kabeln? Und wenn ja, dann wirklich noch heute? Die Zeit lief ihr davon, und ihr Vater saß in Dachau. Sie war die Einzige, die ihm nun noch helfen konnte.
Der Krieg war wie eine dunkle Gewitterwolke, die immer näher und näher zog. Als Achtzehnjährige hatte Ruth keinen Krieg erlebt, aber die Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern hatten sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Krieg war immer schrecklich, aber dieser jetzt drohende Krieg würde noch schrecklicher sein als alles zuvor – vor allem für Juden. Der Gedanke machte sie schwindelig. Sie merkte, dass ihr übel wurde und die Angst und Sorge sich wie schwerer Schlamm in ihrem Magen verteilten.
»Darling, siehst nicht gut aus«, sagte die ältere Frau besorgt. »Bist so blass und fahl.« Sie musterte Ruth, die ihre Augen aufriss und versuchte, ihren rebellierenden Magen zu beruhigen.
Aus dem Fenster konnte sie nicht schauen, dort fehlte ihr ein Fixpunkt, die grünen Felder und Weiden verschwammen zu einem leuchtenden Teppich, der hin und her zu schwanken schien. Ruth schaute auf das Gepäckgitter über ihr, versuchte ihren Blick festzumachen, doch dort lag ein Ball aus Leder, er rollte mit den Bewegungen des Zuges hin und her. Ruth schloss die Augen und kniff die Lippen zusammen.
Ich darf jetzt nicht ohnmächtig werden, sagte sie sich. Ich darf mich jetzt nicht hier vor allen Leuten übergeben. Während des Gespräches war ihr eins bewusst geworden: Sie war viel mehr als nur ein achtzehnjähriges Mädchen auf der Flucht vor den Nazi-Schergen. Sie trug die Verantwortung – nicht nur für ihre Familie, sondern in gewissem Sinn auch für alle anderen deutschen Juden. Hier im Ausland, wo sie um Schutz baten und Unterschlupf suchten, durften sie nicht negativ auffallen. Überhaupt nicht auffallen am besten und keinesfalls negativ. Diese Erkenntnis traf sie mit voller Wucht. Sie schluckte, schluckte erneut, holte tief Luft und versuchte, die Übelkeit zu verdrängen.
»Hast du nichts zu trinken, Darling?«, fragte die alte Frau.
Ruth fiel die Limonade ein, die sie im Gewühl des Bahnhofs in ihre Tasche gesteckt hatte. Sie zog die Flasche heraus, trank gierig. Das süße, zitronige Wasser war warm und klebrig, aber es belebte sie.
»Hier.« Die Frau reichte ihr eine weitere Flasche. »Trink. Man sollte viel trinken, wenn es so warm ist.« Sie musterte Ruth erneut. »Wann hast du gegessen das letzte Mal?«
Ruth senkte den Kopf.
»Das habe ich mir gedacht«, sagte die Frau nur und wühlte in ihrer Tasche. Sie zog eine Papiertüte hervor und reichte sie Ruth. Darin waren gekochte Eier. »Nimm, nimm. Ich fahre zu einer Cousine aufs Land. Die hat Hühner. Werde Eier reichlich die nächsten Tage haben.«
Ruth nahm ein Ei in die Hand. Eigentlich hatte sie gar keinen Hunger, zumindest dachte sie das bis eben. Aber nun knurrte ihr Magen, sie aß das Ei und trank noch einen Schluck.
Dann holte die Frau eine weitere Tüte heraus. Sandwiches – mit Gurken und Corned Beef. An das englische Dosenfleisch, das auch Mrs Sanderson liebte, hatte sich Ruth bisher nicht gewöhnen können, aber nun war ihr der Geschmack egal. Fast schon gierig aß sie die Brote und noch ein gekochtes Ei, trank von dem verdünnten Tee, der in der Flasche war. Sie kaute lange, trank, kaute wieder und endlich beruhigte sich ihr Magen.
»Siehste. Musst trinken und essen«, sagte die Frau zufrieden. »Sonst kippste um, und niemandem ist geholfen.« Sie lächelte, diesmal war es ein echtes Lächeln, das alle Falten, die ihr Gesicht prägten, mit einbezog.
Der Zug fuhr durch Chelmsford. Hier leerte sich der Zug fast zur Hälfte. Auch die alte Frau stieg aus. Sie drückte Ruths Hände. »Alles Glück der Welt wünsche ich dir. Bist so jung, hast es verdient.«
»Danke«, sagte Ruth. »Danke für das Essen und den Tee – das hat mir vermutlich das Leben gerettet.«
»Wenn Leben immer so einfach zu retten wären, wie schön wäre dann die Welt.« Die Frau seufzte, drückte ihre Teppichtasche an ihre Brust und nickte Ruth zu. Ruth sah ihr hinterher. Welche Lebensgeschichte trug sie wohl mit sich herum? Ruth hatte nicht gefragt. In ihrer Seele war im Moment kein Platz für andere Schicksale.
Bis Frinton-on-Sea waren es noch weitere zwei Stunden. Die hitzigen Diskussionen im Abteil hatten sich gelegt, die Gespräche waren leiser geworden – ein Summen im Hintergrund, wie ein Sommerflieder voller Bienen und Hummeln.
Ruth lehnte den Kopf an das Fenster, schloss die Augen. Ihre Tasche presste sie eng an ihren Bauch, umarmte sie wie einen großen Teddy. Schon bald döste sie ein, doch ihre Gedanken kamen nicht wirklich zur Ruhe. Sie dachte an ihre Eltern, an ihren Vater Karl … was würde dann mit ihm geschehen? Ruth hatte schon einige Berichte von Leuten gehört, die in Konzentrationslagern gewesen waren. Das waren keine Gefängnisse, nein, es waren schreckliche Orte, an denen Menschen gequält wurden. Sie hungerten, lebten in unwürdigen Verhältnissen, dicht an dicht gedrängt. Es gab kaum Hygiene, dafür aber umso mehr Krankheiten, die auch nicht behandelt wurden. Die Insassen mussten hart arbeiten – Steine schleppen oder andere Dinge tun. Diese Vorstellungen waren furchtbar, und plötzlich hatte sie wieder das böse Lachen und die wütenden Stimmen der Nazis in den Ohren. Sie erinnerte sich an Aufmärsche der Hitlerjugend, an Jungen, die auf einmal zu Bestien wurden, die Leute beschimpften, bespuckten und schlugen. Das waren nur Jungs gewesen, die Älteren waren noch schlimmer. Bei dem Gedanken grauste es ihr, und ein Schauer lief ihr, trotz der Hitze, über den Rücken. Diese Menschen waren zu allem fähig, das hatten sie in der Pogromnacht deutlich gezeigt.
Ihr Vater war Vertreter für Schuhe gewesen. Mit dem schwarzen, immer auf Hochglanz polierten Adler war er, gefahren von Hans, seinem Chauffeur – er selbst besaß keinen Führerschein, da er unter einer schweren Augenkrankheit litt –, durch die Lande gereist und hatte seine Schuhkollektionen verkauft.
Hans Aretz, seine Frau Josefine und ihre Kinder Helmuth und Rita waren im Lauf der Jahre ein Teil der Familie geworden. Ohne Aretz hätte ihr Vater sein Geschäft nicht ausbauen können. Bis die Nazis das Regime ergriffen, liefen die Geschäfte gut, doch vor drei Jahren hatte er sein Unternehmen aufgeben und Aretz entlassen müssen. Als Jude war es ihm unmöglich gewesen, weiter beruflich tätig zu sein. Karl, Ruths Vater, war kein handwerklich begabter Mann. Er war auch nicht stark. Reparaturen hatte Aretz immer mit viel Geschick ausgeführt und auch die ein oder andere Arbeit im Garten oder am Haus übernommen. Und nun saß Karl Meyer in Dachau und musste dort sicherlich schwer arbeiten. Lange würde er das nicht durchhalten, das wusste Ruth. Er war auch kein junger Mann mehr, er war schon über fünfzig. Ruths Herz pochte voller Sorge, als sie daran dachte.
Und dann war da ihre Mutter, Martha. Martha war neun Jahre jünger als ihr Mann. Sie war bisher zum Glück noch nicht verhaftet worden. Doch die Pogrome, die gesellschaftliche Ächtung und die Übergriffe, die Juden in den letzten Jahren immer mehr zu fürchten hatten, setzten ihr schwer zu. Sie hatte mehrere Nervenzusammenbrüche erlitten, ihre Gemütslage war bedenklich. Zunächst hatte Ruth lange mit sich gehadert, ob sie ihre Familie alleinlassen konnte. Und es dann dennoch gewagt. Für sie war es die einzige Chance gewesen, ihren Lieben zu helfen. Sie hatte eine Stelle in England angenommen – und das, obwohl sie erst siebzehn gewesen war. Und die Stellen als Haushaltshilfen und Bedienstete waren für junge Frauen ab achtzehn ausgeschrieben. Ruth hatte ihre Papiere gefälscht, und der Schwindel war zum Glück nicht aufgeflogen. Die Sandersons, eine Bauernfamilie aus Frinton-on-Sea kümmerten sich nicht um die wenigen fehlenden Monate. Sie waren froh, Ruth als Hilfe auf dem Hof zu haben.
Ruth hatte ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt, dass sie ihre Familie würde nachholen können und alles, was in ihrer Macht stand, dafür getan. Sie hatte die Unterlagen besorgt und ausgefüllt, Geld war auf ein Anderkonto geflossen, und es gab einen Besuchsantrag für ihre Eltern und ihre Schwester. Dieser war heute auch im Bloomsbury House genehmigt worden, nun musste nach Deutschland gekabelt werden und dann … dann … könnte ihre Familie ausreisen. Dann endlich wären sie wieder vereint.
Ruths Magen zog sich zusammen. So viele Stunden, Tage, Wochen hatte es sie gekostet, um diese Anträge auszufüllen, alle Bedingungen zu erfüllen, um alles richtig zu machen. Nun hatte sie die Verantwortung an die Verwaltung übertragen und alles aus den Händen gegeben. Kein schönes Gefühl, nicht zu wissen, ob diese Leute auch wirklich taten, was sie ihr versprochen hatten.
Mutti, dachte sie, Mutti, komm und erzähl mir eine Geschichte. So wie früher. So wie wir es am Freitagabend immer gemacht haben. Du und Ilse und ich auf dem Sofa, die Sabbatkerzen brannten, und du hast erzählt. Wir haben uns meist eine traurige Geschichte gewünscht, Ilse und ich. Damals. Du konntest so gut traurige Geschichten erzählen. Später wollten wir lieber lustige Geschichten hören. Traurig war das Leben um uns herum sowieso. Und dann, Mutti, dachte Ruth, hast du gar keine Geschichten mehr erzählt. Weil du selbst zu traurig warst, zu verzweifelt und zu hoffnungslos. Ich würde alles dafür geben, jetzt mit dir auf einem Sofa zu sitzen und eine Geschichte von dir zu hören. Mutti, ach Mutti, ich sehne mich so nach dir.
Das Schütteln und Rütteln des Zuges wiegte Ruth in einen unruhigen Schlaf. Bei jedem Halt schreckte sie hoch, um doch nur wieder festzustellen, dass es noch dauerte, bis sie Frinton-on-Sea erreicht hatten.
Als sie endlich angekommen war, dämmerte es bereits. Im Bahnhof beleuchtete eine Gaslampe den Weg. Mit Ruth stiegen einige weitere Personen aus. Ein paar Urlauber hatten hier Quartier über das Wochenende gebucht, zwei oder drei Bauern erkannte Ruth vom flüchtigen Sehen. Müde ging sie zu ihrem Fahrrad, das sie vor dem Bahnhof abgestellt hatte. Gut eine halbe Stunde würde die Fahrt zur Farm durch die Felder dauern, über die Straße war es noch weiter. Sie hatte keine Lampe, und der Weg war nicht beleuchtet. Vor drei Tagen war Neumond gewesen, doch nun nahm der Mond wieder zu. Der Himmel war zum Glück wolkenlos, und Ruth kannte die Strecke gut. Dennoch musste sie langsam und aufmerksam fahren, und die Kirchturmuhr der All Saints Church schlug schon Mitternacht, als Ruth kurz vor der Farm war. Charly, der Hofhund, der aussah, als würde er jeden Menschen, der sich ihm näherte, zerfetzen, schlug an. Sein Bellen erkannte Ruth inzwischen blind. Froh seufzte sie auf, sie war zu Hause. Die letzten Meter gingen schnell. Sie öffnete das quietschende Hoftor, das dringend geölt werden musste, begrüßte Charlie, der ihr freudig entgegensprang.
Zu Hause, dachte sie. Seltsam, dass ich in diesem Moment diesen Ort als Zuhause betrachte. Das ist er nicht. Ich bin hier nicht zu Hause, aber es ist eine Zuflucht. Hier darf ich sein.
Sie biss sich auf die Lippen und grinste schief. Ich darf hier sein, bis Mrs Sanderson es anders entscheidet. Und vielleicht schmeißt sie mich ja heute Nacht noch raus. Möglich wäre es.
Sie schloss das Hoftor hinter sich, schob das Fahrrad zum Schuppen und stellte es dort ab. In der Küche brannte noch Licht. War Mrs Sanderson etwa aufgeblieben und wartete noch auf sie? Heute Nacht fühlte Ruth sich nicht fähig, eine große Diskussion auszuhalten. Sie seufzte, zog die Schultern hoch und wappnete sich für die Auseinandersetzung. Diskussionen mit ihrer Arbeitgeberin waren nie gut. Olivia Sanderson erwartete von ihren Angestellten absoluten Gehorsam und bedingungslose Aufopferung, so erschien es zumindest Ruth. Freie Tage waren selten und harte Arbeit der Standard. Das machte ihr nichts aus – aber diesen freien Tag hatte sie sich genommen, nehmen müssen, es ging ja schließlich um das Leben ihrer Familie.
Bevor sie ins Haus ging, streichelte sie Charly über den Kopf. Charly war ein Senfhund, wie Mr Sanderson es nannte – ein Hund, zu dem jeder Hund aus dem Dorf vermutlich seinen Senf dazugegeben hatte. Er war ein kniehoher Mischling und nicht wirklich schön. Sein Fell war struppig, ein Ohr stand hoch, das andere hing schlapp neben dem Kopf. Die Rute konnte sich nicht entscheiden, ob sie sich über den Rücken kringeln sollte oder nicht. Aber er war ein guter Wachhund und zur Familie immer freundlich. Außerdem liebte er Jill, die zweijährige Tochter der Sandersons. Für Jill hätte er vermutlich sein Leben gegeben.
Charly erinnerte Ruth ein wenig an Spitz, den Hund, den sie früher gehabt hatte. Er war genauso treu. Vor einigen Jahren war bei ihnen in Krefeld eingebrochen worden – in das Souterrain, wo Ruths Vater, der damals noch ein erfolgreicher Schuhvertreter gewesen war, sein Büro, seine Musterkoffer und auch seine Kasse hatte. Ihr Vater war, wie so häufig, auf Tour und ihre Mutter mit ihnen allein gewesen. Spitz, der auf einer Decke im Flur schlief, hatte angeschlagen, er hatte wie verrückt gebellt, war ins Souterrain gelaufen und hatte den Einbrecher angegriffen. Obwohl er so klein war. Um ihn abzuwehren, hatte der Einbrecher ihm ein Messer ins Auge gerammt und war dann geflohen.
Ruth hörte immer noch, wie Spitz vor Schmerz gewinselt hatte, es war schrecklich gewesen, Spitz da liegen zu sehen, blutend und schwer verletzt.
»Wir müssen mit ihm zum Tierarzt«, hatte sie geschrien. »Sofort!«
»Aber wie sollen wir dahin kommen?«, hatte Martha verzweifelt gefragt. »Vati und Aretz sind doch nicht da …«
»Ich laufe rüber zu den Merländers!« Ohne weiter darüber nachzudenken, hatte Ruth ihren Mantel übergezogen und war zu den Nachbarn gelaufen, um das Haus herum zu der Wohnung der Sanders. Rosi Sander war ihre Freundin seit Kindestagen. Ihr Vater war der Chauffeur von Richard Merländer, dem Seidenfabrikanten, dem die Villa gehörte. Ruth klopfte und klingelte Sturm, Hermann Sanders öffnete ihr verschlafen und sah sie erschrocken an. »Ruthchen, Kind, ist etwas passiert?«
»Bei uns wurde eingebrochen.« Plötzlich schossen Ruth die Tränen in die Augen.
»Ist jemand verletzt? Ist der Einbrecher noch da? Habt ihr schon die Polizei gerufen?«
»Uns geht es gut«, stammelte Ruth schluchzend. »Der Einbrecher ist weg, aber Spitz ist schwer verletzt. Und Vati und Aretz …«
»Ich komme!« Ohne zu zögern, griff Sanders nach seinem Mantel und eilte über die Straße, die von den Gaslaternen nur schummrig beleuchtet wurde.
Martha hatte den wimmernden Hund in seine Decke gewickelt und nach oben in den Hausflur getragen. Ilse saß ganz bleich mit aufgerissenen Augen auf der Treppe und zitterte.
»Guten Abend, Frau Meyer«, sagte Sanders. »Kann ich helfen?«
»Spitz ist verletzt. Er muss zum Tierarzt«, sagte Martha, auch ihr liefen die Tränen über die Wangen. »Der tapfere Hund hat den Einbrecher vertrieben.«
»Sind Sie sich sicher, dass er weg ist?« Sanders ging vorsichtig nach unten, schaltete überall das Licht ein »Es sieht so aus, als wäre der Mistkerl weg. Zum Glück! Haben Sie ihn gesehen?«
Martha schüttelte den Kopf. »Der Hund muss zum Tierarzt. Sein Auge …«
In Spitz’ Auge steckte der dünne, silberne Brieföffner, den Karl immer auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Ruth sah es erst jetzt und zuckte zusammen. »Sollen wir ihn nicht rausziehen?«, fragte sie beklommen.
»Nein«, sagte Martha. »Ich habe mal gelesen, dass man Stichwaffen stecken lassen soll, bis ein Arzt sie entfernt – ansonsten könnte Spitz verbluten. Das Messer schließt die Wunde auch.«
»Dann los«, sagte Sanders. »Sind Sie auch bei Doktor Schneider in Bockum? Dorthin gehen die Merländers immer mit ihren Hunden. Wir haben gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich weiß, wo er wohnt, war schon oft da – der Pekinese hat ja immer etwas … Kommen Sie, ich fahre Sie hin.« Er drehte sich zu den Mädchen um. »Und ihr geht rüber, zu meiner Frau. Allein bleibt ihr hier nicht. Wir sollten auch die Polizei rufen. Darum kann sich meine Schwester kümmern.« Seine Worte ließen keinen Widerspruch zu, aber das war in der Situation auch gut so, dachte Ruth nun, als sie sich zurückerinnerte. Sie alle hatten unter Schock gestanden. Die Nacht hatten Ilse und sie bei Rosi verbracht, Lisa Sanders, Hermanns Schwester, hatte die Polizei gerufen, und ihre Mutter hatte mit dem Chauffeur zusammen Spitz zum Tierarzt gebracht.
Der Einbrecher wurde nie gefasst. Allerdings hatte er – vermutlich dank Spitz – nichts entwendet. Die Tür wurde verstärkt und bekam ein Sicherheitsschloss. Und Spitz überlebte. Er hatte zwar von da an nur noch ein Auge, aber das schien ihn nicht zu stören.
Wie lange war das jetzt her?, fragte sich Ruth, als sie zum Haus der Sandersons ging. Es muss vor 1936 gewesen sein, bevor die Rassengesetze in Kraft traten, und ihr Vater nach und nach sein Geschäft hatte aufgeben müssen. Die Nazis waren auch Diebe und Einbrecher – sie waren in ihr Leben eingebrochen und hatten ihnen fast alles genommen: das Haus, die Sicherheit, die Heimat, jedwedes Glücksgefühl. Natürlich auch materielle Dinge, Geld und andere Sicherheiten. Was sie noch hatten, war ihr Leben. Und das galt es nun zu retten.
Kapitel 2
Ruth straffte die Schultern und öffnete die Tür, die in die große Küche führte. Ein riesiger, mit schwarz-weißen Kacheln im Schachbrettmuster gefliester Raum, an dessen einer Seite Schweinehälften und große Stücke von geschlachteten Rindern abhingen. Auf der anderen Seite stand der große Herd. Ein Teil war gemauert, ein Teil aus Gusseisen – eine Küchenhexe mit Wasserkessel und Backofen. Hier stand auch der große Holztisch, an dem sich alle zum Essen versammelten, und die Anrichte, in der das tägliche Geschirr verstaut war. Das gute Geschirr wurde im Esszimmer aufbewahrt, das auf der anderen Seite des Hauses lag – direkt neben dem Salon und der kleinen Bibliothek, die Mr Sanderson aber nur selten nutzte.
Die Petroleumlampe über dem Tisch leuchtete noch, und ein dumpfes Brummen erfüllte den Raum. Am Küchentisch saß nicht, wie Ruth befürchtet hatte, Olivia Sanderson, um ihr eine Standpauke zu halten, sondern Freddy Sanderson. Sein Kopf war nach vorne gesunken, und er schnarchte. Doch das Brummen kam von woanders. Sie sah sich um. Im anderen Bereich der Küche hing ein Kalb, in zwei Hälften geteilt. Auf dem Fliesenboden war eine große Blutlache, von dort kam auch der metallische Geruch, vermischt mit einer unangenehmen Süße – wie Lilien, die schon fast verwelkt waren und noch mal alles gaben, um die Luft zu erfüllen. Ein Geruch, von dem Ruth übel wurde. Um das Kalb, die beiden Schinken und die Schweinehälfte surrten Millionen von Fliegen. Fast schien es, als ob sich das Fleisch, das an großen Haken hing, bewegte.
Ruth schrie entsetzt auf. Das Kalb hatte heute früh, als sie bei Sonnenaufgang das Haus verlassen hatte, noch nicht hier gehangen. Es musste im Lauf des Tages geschlachtet worden sein. Aber niemand hatte das Fleisch mit Essiglösung abgerieben und die Fliegenmaden abgesammelt.
Ruth stellte ihre Tasche auf einen Stuhl und sah sich um. Im Spülbecken stand das gebrauchte Geschirr des Tages. Die Küchenhexe war ausgegangen, also gab es auch kein heißes Wasser mehr. Auf dem Herd stand ein Kessel mit dem Eintopf, den sie gestern vorgekocht hatte. Er war so gut wie leer, und die Reste waren angebacken, es roch ein wenig verbrannt, als sie den Deckel anhob. Schnell zog sie den Kessel vom Feuer und schüttete kaltes Wasser hinein.
Sie war so müde und fühlte sich so erschöpft und leer, aber wenn sie jetzt nicht aufräumte, würde sie es morgen machen müssen. Und das Fleisch war nicht mehr verwendbar.
Ruth sah an sich herunter. Sie trug das einzige gute Kleid, das sie noch besaß. Auch die guten Schuhe hatte sie an. Sie hatte im Bloomsbury House Eindruck machen wollen, aber so konnte sie weder die Maden vom Fleisch absuchen noch putzen oder spülen, ohne den Stoff zu beschmutzen. Schnell schlüpfte Ruth aus den Schuhen, lief die schmale Hintertreppe nach oben in die Mansarde, wo sie ihr Zimmer hatte, um sich umzuziehen. Als sie kurz darauf wieder die Küche betrat, fiel die Tür krachend ins Schloss, Freddie Sanderson setzte sich verwirrt auf und schaute sich verschlafen um.
»Guten Abend«, sagte Ruth und öffnete die Tür nach draußen. Allmählich kühlte es sich ein wenig ab. Zwar würden jetzt einige Nachtfalter hereinkommen, aber vielleicht würden auch Fliegen den Weg nach draußen nehmen – der Misthaufen im Hof roch für sie hoffentlich verlockender als das Fleisch. »Es tut mir leid«, sagte Ruth mit dünner Stimme und ein wenig ängstlich, »dass ich so spät komme. Es ging nicht früher.«
Freddy schaute auf die große Kaminuhr, die ungerührt vor sich hin tickte.
»Es ist fast Mitternacht«, sagte er und gähnte. »Ich muss eingeschlafen sein.«
Ruth lächelte verzagt. »Das sind Sie.« Sie schaute sich um. Auf dem gemauerten Ofen stand noch der Wasserkessel. »Soll ich Ihnen noch einen Tee kochen?«
Sanderson nahm den Becher, der vor ihm auf dem Tisch stand, schüttete, ohne nachzudenken, den Rest auf den Boden. »Ja, ich nehme gerne noch eine Tasse Tee. Muss aber erst einmal nach der Kuh schauen. Sie hat heute Nachmittag gekalbt.« Er seufzte. »Zwillinge – ein Kalb ist gestorben. Ich habe es direkt geschlachtet.« Er zeigte in den hinteren Bereich der Küche.
»Habe ich schon gesehen«, sagte Ruth. »Das Fleisch ist voller Fliegen.«
»Kommt vom Schwein.« Sanderson stand auf und reckte sich. »Meine Frau meinte, die Maden abzusammeln ist deine Aufgabe. Sie war nicht begeistert, dass du weggefahren bist.«
Ruth senkte den Kopf. Freddy sah sie an.
»Warst du erfolgreich? Hast du die Anträge für deine Eltern einreichen können?«
»Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie noch rechtzeitig weitergegeben werden und meine Familie ausreisen darf. Ich hoffe es so sehr.«
»Ich wünsche dir, dass es klappt. Du bist ein tapferes Mädchen.« Er musterte sie. »Und du siehst müde aus. Willst du nicht ins Bett gehen?«
»Aber … das Fleisch verdirbt dann. Niemand hat es mit Essig abgewaschen. Und niemand hat die Maden abgesammelt …«
»Das Schwein kommt morgen in den Rauch. Ein paar Maden machen da nichts. Die Pökellauge für die Schinken habe ich schon angesetzt.« Er sah zum Fleisch. »Die lege ich gleich noch ein – muss aber erst nach der Kuh sehen.« Er stapfte nach draußen.
Der Schachbrettküchenboden war voller Dreck. Ruth holte tief Luft und dachte nach – den Küchenboden nun zu putzen machte wenig Sinn. Sanderson würde wieder zurückkommen, und er zog nie seine dreckigen Stiefel aus. Die Blutlachen unter dem Fleisch sollte sie aber schnell aufwischen und sich um das Fleisch kümmern, zuerst musste sie aber das Wasserschiff der Küchenhexe befüllen und diese anheizen. Warmes Wasser würde sie noch brauchen. Sie nahm Zeitungspapier von dem Stapel, der neben dem Herd lag, und versuchte, damit das Blut aufzusaugen. So ging es am schnellsten. Bis sie einen Eimer heißes Seifenwasser hatte, würde es noch dauern. Zum Glück war im gemauerten Ofen die Glut noch nicht erloschen. Dann schüttete sie Essig in eine Schüssel, nahm einen sauberen Lappen und wischte die beiden Kalbshälften gründlich ab. Das Fleisch musste eine Weile abhängen, und der Erdkeller, in dem es normalerweise gelagert wurde, war kaputt – die Decke war zum Teil eingestürzt –, also kam es in die Küche. Im Sommer war das kein Vergnügen, außer für die Fliegen. Der stechende Geruch des Essigs überdeckte bald schon den süßlichen des Fleisches, aber Ruth wurde trotzdem übel. Sie hasste diese Arbeit, aber sie ermöglichte ihr einen Aufenthalt in diesem Land und ihren Eltern hoffentlich auch. Freiheit für die Familie, das war nun das höchste Gut, was sie hatten – Freiheit und ihr Leben.
Sie dachte daran zurück, wie sie vor ein paar Jahren, ja, noch vor ein paar Monaten gelebt hatte. In einem großen Haus mit Annehmlichkeiten, die zwar immer eingeschränkter wurden, aber mit dem Leben als Dienstmagd nichts zu tun hatten. Sie hatte sich zum Tanzen getroffen, war in den jüdischen Kulturtreff gegangen und hatte Filme angesehen, hatte Liebeskummer gehabt. Vor zwei Sommern war ihre größte Sorge das Wetter gewesen – würde es warm genug sein, um in den Niepkuhlen, einem Altrheinarm bei Krefeld, wo die Familie ein Wochenendhaus hatte, schwimmen zu gehen? Würde jemand die neusten Schallplatten besorgen können, damit sie tanzen konnten? Ruth liebte die neusten Lieder und Tänze, die allerdings verboten waren. Aber den Juden war ja sowieso fast alles verboten worden – der Besuch im öffentlichen Schwimmbad, im Lichtspielhaus, im Theater, öffentliche Veranstaltungen, der Beruf, der Besitz –, und jetzt wollten sie ihnen sogar das Leben nehmen. Die Nazis hassten die Juden, warum, das war Ruth immer noch nicht klar. Aber es machte sie wütend, und mit dieser Wut suchte sie die Schweinehälften ab, mit Wut zerdrückte sie die Maden und tat sie in eine Schüssel. Freddy würde sie mitnehmen und als Fischköder benutzen oder unter das Hühnerfutter mischen.
Inzwischen kochte das Wasser in dem Behälter der Küchenhexe. Vorn hatte das Wasserschiff einen Hahn. Ruth füllte die Teekanne, stellte sie zum Ziehen an die Seite, goss heißes Wasser in einen Eimer und dann in die Steingutspüle auf der anderen Seite der Küche und schüttete kaltes Wasser aus dem Brunnen wieder in das Wasserschiff. Zum Glück hatte einer der Knechte wenigstens die zwei Eimer mit Brunnenwasser gefüllt und in die Küche gestellt, sonst hätte sie das auch noch tun müssen. Während das Geschirr einweichte, ging sie zurück zum Fleisch und sammelte noch mal Maden ab, bis das Wasserschiff wieder dampfte. Inzwischen hatte der Tee lang genug gezogen, und sie nahm das Sieb mit den Teeblättern heraus, stellte die Kanne auf den Rand der Küchenhexe. Dort blieb er warm, ohne zu kochen.
Dann spülte sie das Geschirr und wusch es mit klarem Wasser ab, bevor sie es auf die Abtropffläche stellte. Eine Tätigkeit, bei der immer wieder ihre Gedanken abschweiften, über den Kanal nach Deutschland flogen. Zu gern hätte sie ihre Mutter jetzt umarmt, ihr gesagt, dass sie alles getan hatte, um Vati zu retten. Dass es nun nicht mehr in ihrer Macht lag und dass sie hoffte, dass sie sich alle bald wiedersehen würden.
Aber würden sie das? Seit einigen Monaten war Ruth nun in England, ihr Leben hatte sich drastisch verändert. Es war nicht leicht, hier bei den Sandersons zu leben, aber sie war aus der Reichweite der Nazis. Ihre Familie allerdings nicht.
Mutti, Vati, Ilse, Omi und Opi. Oma Emilie, Tante Hedwig und Hans – das waren nur die engsten Verwandten –, aber es gab noch so viele mehr. Und dann noch all ihre Freunde und Bekannten, alle ihre Freundinnen – was war mit ihnen? Zu den meisten hatte sie in den letzten Monaten den Kontakt verloren. Man konnte Briefe schreiben, aber sie wurden geöffnet und überprüft. Die Wahrheit durfte keiner sagen oder schreiben – jede Kritik am Regime konnte zur Verhaftung und somit zum Tod führen.
Warum also sollte sie belanglose Postkarten schreiben und ebenso nichtssagende und wahrscheinlich unehrliche Antworten erhalten? Aber ihre Gedanken wanderten trotzdem jeden Tag voller Sorge nach Krefeld, München und in andere Städte, in denen ihre Lieben wohnten. Wen würde sie wiedersehen? Und wo? Wann? Wie lange würde diese unerträgliche Situation noch andauern? Sie schaute auf die Uhr, inzwischen war es nach Mitternacht. An diesem Tag lief das Ultimatum für ihren Vater aus. Entweder würden die Nazis ihn ziehen lassen, oder er würde in Dachau bleiben müssen – als verurteilter Verbrecher, der nicht mehr gemacht hatte, als zu versuchen, sein Eigentum in Sicherheit zu bringen, um das Land verlassen zu können.
In Dachau würde er sterben, dass wusste Ruth, und bei dem Gedanken wurde ihr flau. Ihr Vati, sie wollte ihn so gern wiedersehen, in die Arme schließen und festhalten.
In diesem Moment öffnete sich die Küchentür. Freddy Sanderson kam herein, auch er sah erschöpft aus.
»Dort steht frischer Tee«, sagte Ruth und zeigte auf den Herd.
»Danke, du bist ein Engel.« Er füllte seinen Becher, trank, füllte den Becher erneut, gab aber nun einen Schuss aus dem Flachmann hinzu, den er aus der Hosentasche gezogen hatte. »Du auch?«, fragte er Ruth.
Sie überlegte kurz, nickte dann. Der Rum, der sich mit dem heißen Tee vermischte, tat ihr gut.
Freddy war zum Fleisch gegangen, nahm die beiden dicken Schinken ab. »Du hast doch die Maden abgesucht? Danke. Hättest du nicht machen müssen.«
»Es sind noch nicht alle«, gestand Ruth.
»Wird reichen. Ich leg das Fleisch jetzt in die Lake.« Er schaute sich um. »Gespült hast du auch schon. Dann geh jetzt ins Bett.«
»Ich sollte noch den Boden schrubben …«
»Das kannst du auch morgen tun. Meine Frau wird sicherlich nicht vor dir in der Küche sein.« Er schaute sie an, räusperte sich. »Und gönn dir eine halbe Stunde Schlaf mehr morgen früh, sonst kippst du uns noch um.«
»Aber ich muss noch …«
»Du musst jetzt schlafen, Ruth. Wirklich. Du machst schon alles sehr gut so.«
»Aber Ihre Frau wird böse sein, wenn ich …«
»Das wird sie. Aber sie wird sowieso sauer sein. Das ist nicht dein Problem, und wenn sie dich bestrafen will, kommst du zu mir. Olivia hasst das Leben auf diesem Hof. Aber dafür kannst du nichts, und du sollst es auch nicht ausbaden müssen. Nun geh zu Bett.«
Ruth musterte ihn, er nickte ihr zu. »Danke. Gute Nacht.« Sie wischte sich die Hände trocken, ließ das Wasser aus dem Spülbecken und kontrollierte noch einmal den Herd. Das Feuer brannte herunter, aber es war genug Holz im Ofen, so dass morgen früh noch Glut da sein würde. Das würde ihr schon einmal das mühsame Anfachen ersparen. Das Geschirr trocknete auf der Spüle, sie würde es morgens wegräumen. Dann würde sie auch die Küche wischen. Freddy hatte recht – alles, was nun noch zu tun war, konnte sie auch am nächsten Morgen machen.
Sie löschte das große Petroleumlicht und ging die steile Treppe nach oben. Sie stellte sich ans Fenster und sah durch die Dunkelheit in Richtung Meer. Dort drüben, dort auf dem Festland war ihre Familie. Ruth sprach ein stilles Gebet, bat voller Inbrunst darum, ihre Eltern und Ilse endlich wiedersehen zu können. Vielleicht würde sie morgen schon eine Nachricht aus Deutschland bekommen? Sie hoffte es so sehr.
Der Wecker schrillte, das Geräusch zersplitterte in ihren Ohren. Im ersten Moment wusste Ruth nicht, wo sie war. Dann aber fiel ihr alles wieder ein. Sie stellte den Klöppel aus, der wütend zwischen den beiden Metallglocken hin und her schwang und das ohrenbetäubende Geräusch verursachte. Immerhin hatte er seinen Dienst getan und sie rechtzeitig geweckt. Draußen war es noch dunkel, nur die Ahnung des Sonnenaufgangs zeigte sich am Horizont – ein diffuses Licht. Vor vier Wochen noch war es jetzt schon hell gewesen, doch jeden Tag wurde die Nacht länger.
Ruth wusch sich – das kalte Wasser erfrischte sie, dennoch hatte sie das Gefühl, jeden Knochen zu spüren, ihr Nacken war steif wie ein Brett, und sie merkte, dass sie die Zähne fest aufeinandergepresst hatte. Nachdem sie versucht hatte, Schultern und Kiefer zu lockern, ging sie nach unten in die Küche.
Obwohl Sanderson gestern noch die beiden Schinken mitgenommen und eingepökelt hatte, lag der Geruch von Verwesung wie eine klebrige Wolke in der Luft. Auch die Fliegen waren schon wach. Das Gefühl von Ekel stieg in Ruth hoch, doch sie drängte es beiseite. Sie machte Licht, schob Holz in den Ofen und füllte das Wasserschiff. Dann setzte sie den Kessel für Tee auf und weichte das Porridge ein.
Als Nächstes sammelte sie die Maden vom Schweine- und Kalbsfleisch, wusch es wieder mit der Essiglösung ab. Sanderson hatte ihr erklärt, dass sie normalerweise nicht im Sommer schlachteten, es sein denn, es müsse sein – so wie bei diesem Kalb. An dem Kälbchen war nicht viel Fleisch, es war winzig und dünn, fast noch kleiner als die Zicklein, die sie im Frühjahr geschlachtet hatten. Dennoch konnte es sich niemand leisten, das Fleisch und die Knochen nicht zu verwerten. Das Schwein, dessen Schinken Sanderson schon mitgenommen hatte, hatte ebenfalls außer der Reihe geschlachtet werden müssen. Sie war boshaft gewesen, hatte die anderen Sauen gebissen und angegriffen. Auch vor Menschen hatte sie nicht haltgemacht. Sanderson hatte Ruth erklärt, dass Schweine Allesfresser seien und tatsächlich auch Fleisch aßen, wenn sie es bekamen. Ein großes Schwein konnte ohne Probleme einem Menschen die Hand abbeißen. Das taten die Tiere, die grundsätzlich sehr sanft und freundlich waren, normalerweise nicht. Doch diese Sau war eine Gefahr gewesen, und Olivia hatte darauf bestanden, dass Freddy sie tötete. Nun mussten das Fleisch und die Knochen verwertet werden. Im Prinzip war Ruth froh darüber, denn frisches Fleisch gab es im Sommer nur von den Hühnern und Puten. Ansonsten musste sie eingekochtes, gepökeltes oder geräuchertes Fleisch verwenden. Da sie mittags auch für die beiden Knechte mitkochte und diese eine nährende Mahlzeit brauchten, war das gar nicht so einfach.
Den Topf, in dem das Essen, das sie zwei Tage zuvor vorgekocht hatte, jetzt angebrannt war, hatte sie über Nacht eingeweicht. Jetzt konnte sie die Reste herauskratzen und den Topfboden mit Sand wieder blank scheuern. Nachdem auch das erledigt war, schrubbte Ruth den Boden. Das war eine mühevolle Arbeit, denn auf den schwarz-weißen Fliesen sah man jeden Fleck, und Olivia Sanderson bestand darauf, dass der Boden zu jeder Tageszeit makellos aussah.
Kaum war Ruth damit fertig, kam Freddy in die Küche. Er war unrasiert und sah übernächtigt aus. Schwer ließ er sich an den Küchentisch fallen. Natürlich hatte er seine Stiefel, die voller Dreck und Dung waren, nicht ausgezogen. Die Fußspur von der Tür bis zum Tisch war nicht zu übersehen. Ruth unterdrückte ein Seufzen, stellte ihm eine Tasse heißen Tee und die Schale mit Zucker hin. Er sah sie dankbar an, schaufelte sich mehrere Löffel Zucker in den Tee, und trank, ohne umzurühren.
»Das zweite Kalb hat es geschafft«, sagte er mit müder Stimme. »Aber es stand lange auf der Kippe. Es ist ein Kuhkalb, und ich hoffe, es macht sich.« Er sah zur anderen Seite der Küche. »Ihren Bruder hätten wir in ein paar Monaten sowieso schlachten müssen. Ich kann weder Ochsen und schon gar keinen weiteren Bullen gebrauchen. Aber ein bisschen Fleisch hätte er schon noch ansetzen können.«
»Was wird aus dem Fleisch?«, fragte Ruth leise. »Ich werde der Fliegen nicht Herr.«
»Das soll Olivia entscheiden. Ich wäre dafür, es sofort in den Topf zu schmeißen, aber was verstehe ich schon vom Kochen?« Er lächelte schief. »Lange darf das nicht mehr hier hängen. Auch der Rest vom Schwein nicht. Ist nicht die beste Zeit, um zu schlachten.«
»Haben Sie gar nicht geschlafen?«
»Ein wenig im Stall«, sagte er und seufzte. »Ich gehe jetzt duschen, gleich kommt Jack zum Melken.« Er sah sich um. »Du hast ja alles gut hinbekommen. Prima.« Dann trank er noch einen Schluck Tee, stand auf und ging nach oben in den ersten Stock, wo das Badezimmer und die Schlafzimmer der Sandersons lagen. Wenn er oben duschte, würde seine Frau, die manchmal bis nach acht schlief, wach werden. Und dann würde sie herunterkommen. Schnell füllte Ruth wieder den Putzeimer und beseitigte die Fußspuren. Zum Glück hatte Sanderson seine Stiefel unten an der Treppe ausgezogen. Ruth nahm sie, stellte sie vor die Tür, nicht ohne sie vorher abgewaschen zu haben. Dann putzte sie den Herd, setzte einen große Topf auf und sah in der Speisekammer nach, was noch an Gemüse vorrätig war. Aber sie konnte kein Essen aufsetzen, bevor sie nicht mit Olivia Sanderson gesprochen hatte. Normalerweise besprachen die beiden die Mahlzeiten am Tag zuvor, aber gestern war Ruth ja nicht da gewesen. Nun hieß es also warten. Es gab aber trotzdem noch genug zu tun – das gab es immer. In der Vorratskammer stand ein großer Korb mit Bohnen, die geputzt werden mussten. Ruth nahm sich auch eine Tasse Tee, wie sehr vermisste sie echten Kaffee – aber den tranken die Sandersons nicht –, und setzte sich mit dem Korb und einer großen Schüssel auf die Bank im Hof. Charly kam und begrüßte sie schwanzwedelnd. Freddy fütterte den Hund, der immer zu dürr für seine Größe aussah, einmal am Tag. Aber hin und wieder schmuggelte sie auch einige Essensabfälle zu ihm hinaus. Doch jetzt hatte sie nichts und drehte ihre Hände bedauernd nach oben. Charly schnaufte, legte sich dann zu ihren Füßen.
Die Sonne war aufgegangen, und der Himmel leuchtete in einem blassen Rosa. Es sah wunderschön aus, aber das leichte Flirren am Horizont ließ erahnen, dass es ein heißer Tag werden würde.
Das ist schön, dachte Ruth, für all die Leute, die über das Wochenende an die See gefahren sind. Sie würden heute einen herrlichen Tag haben. Für die Bauern und die Tiere war große Hitze eher beschwerlich. Die Ernte hatte begonnen, und neben der Sorge um das Vieh musste sich Freddy auch noch darum kümmern.
Bisher hatte Ruth keine Ahnung von Landwirtschaft und Viehhaltung gehabt. Das Fleisch, das sie zu Hause gegessen hatten, kam in Wachspapier verpackt vom Metzger. Das Gemüse hatte die Köchin aus dem Geschäft oder vom Wochenmarkt geholt. Mutti war nie eine große Köchin gewesen, anders als Omi. Aber Omi kam vom Land, von einem Hof am Niederrhein. Sie hatte ihr und Ilse immer viel von früher erzählt, wie es auf dem Hof zugegangen war. Es waren spannende Geschichten gewesen – Geschichten, so ähnlich wie die, die Mutti am Freitag erzählt hatte, nachdem sie die Sabbatkerzen angezündet hatten. Erzählungen aus einer Zeit lange vor ihrer – fast wie Märchen. Omi hatte davon berichtet, wie das Getreide geerntet, Tiere geschlachtet, geräuchert und verwertet wurden. Darüber, wie die Kinder Kirschen ernten und dabei pfeifen mussten, damit sie nicht zu viel naschen konnten.
Natürlich hatte Ruth auch ihre Verwandtschaft in Anrath besucht, die immer noch einen großen Hof betrieb. Aber dass das hübsche Getreide mit seinen federigen Borsten, das auf den Feldern wuchs, später das Mehl sein würde, das entweder die Köchin Jansen oder der Bäcker zu Brot verwandelte, war ihr als Stadtkind nicht wirklich bewusst gewesen. Jetzt lernte sie das alles von der Pike auf. Es war anstrengend, aber auch interessant. Auf der Hachscharaschule in Wolfratshausen, die sie ein halbes Jahr besucht hatte, hatte es auch ein paar Unterrichtseinheiten über Getreideanbau gegeben. Doch das war ihr zu theoretisch gewesen und wirklich begriffen hatte sie es nicht. Zudem hatte der Schwerpunkt ihrer Ausbildung eher im hauswirtschaftlichen Bereich gelegen.
Ruth hörte Geräusche aus dem ersten Stock, die Fensterläden wurden aufgestoßen, die Fenster geöffnet. Sie hörte die keifende Stimme von Olivia Sanderson.
»Musst du so einen Krach machen, Freddy? Es ist noch so früh. Jetzt werde ich nicht mehr einschlafen können.«
»Ich kann auch nicht mehr schlafen. Du kannst mir ja beim Melken helfen.«
»Bist du wahnsinnig? Ich werde doch nicht in den Kuhstall gehen und dann den ganzen Tag stinken.« Sie schnaufte. »Ist wenigstens das Mädchen wieder da?«
Bei diesen Worten zuckte Ruth zusammen. Das Mädchen war sie. Ruth wusste, dass sie das Gespräch nicht mit anhören sollte, aber sie blieb.
»Ruth ist gestern Abend noch nach Hause gekommen und hat die Küche, die du ja in einem schrecklichen Zustand hinterlassen hast, aufgeräumt. Sie war den ganzen Tag in London, um sich um Aufenthaltsgenehmigungen für ihre Familie zu kümmern, nur so kann sie sie retten.« Freddy holte tief Luft. Ruth konnte sich vorstellen, wie er die Fäuste in die Hüften stemmte. »Ob sie Erfolg hatte, ist fraglich. Das Mädchen ist gerade achtzehn, sie arbeitet hart und gut – und sie hat berechtigte Angst um ihre Familie. Wage es nicht, sie heute zu tadeln.«
»Wir können nichts dafür, dass es Juden sind, Freddy«, sagte Olivia, »das ist ihre Sache. Sie hat eine Arbeit hier angenommen, und sie muss sie auch ausführen. Wir sind nicht die Samariter, die Mädchen einstellen, behausen und verköstigen, die aber dann ihre Zeit in London verbringen, um sich um ihre Familien im verdammten Deutschland zu kümmern.«
»Es war ein Tag, Olivia, ein einziger Tag, den Ruth sich genommen hat. Ich habe es erlaubt. Und jetzt möchte ich nichts mehr darüber hören. Das Mädchen tut seine Arbeit.« Wieder hielt er inne. »Im Gegensatz zu dir. Du bist die Frau eines Bauern. Du hast gewusst, wen du heiratest. Also benimm dich auch entsprechend. Heute Nacht ist ein Kalb kurz nach der Geburt gestorben. Ich habe es geschlachtet und aus der Decke gezogen. Es hängt in der Küche. Überleg dir, was damit geschehen soll. Und auch mit dem Rest vom Schwein. Es ist zu heiß für Fleisch in der Küche, das muss heute verarbeitet werden.«
»Heute? Beides? Wie stellst du dir das vor? Dafür brauche ich Hilfe. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Gläser haben, um Sachen einzuwecken. Und das Wursten … du weißt doch, wie sehr ich das hasse.«
»Ich sollte die Sau schlachten, das habe ich getan. Für den Rest bist du zuständig.«
Ruth hörte, wie eine Tür heftig ins Schloss fiel. Sanderson stapfte wütend die Treppe hinunter.
Auch wenn er für sie Partei ergriffen hatte, wollte sie ihm gerade nicht unter die Augen treten. Schnell nahm sie den Korb, der neben der Bank stand und lief zum Hühnerstall. Sie bezweifelte, dass Olivia gestern Abend die Eier aus den Legenestern abgenommen hatte.
Schnell ging sie zum Stall, es war jetzt auch hell genug, um die Hühner herauszulassen. Gackernd und nickend kamen ihr die Legehennen und der Hahn entgegen. Zwei oder drei Eier hatten die Hühner in der Nacht zerdrückt. Normalerweise sammelte Ruth oftmals mittags, aber auf jeden Fall abends, bevor die Hühner in den Stall kamen, die Eier ein. Mit dem vollen Korb kehrte Ruth zurück in die Küche, legte die Eier behutsam in das Drahtgestell, in dem sie aufbewahrt wurden.
Während sie bei den Hühnern gewesen war, musste Freddy zurück zum Vieh gegangen sein. Charly hatte vorhin kurz gebellt, vermutlich war der Knecht gekommen, der beim Melken half.
Ruth briet Speck an und bereitete Rührei zu. Dann hörte sie schon Olivias Schritte auf der Treppe.
»Guten Morgen«, sagte Ruth so freundlich, wie sie konnte. Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Morgen«, sagte Olivia. Ihre Haare waren onduliert, sie trug ein Kleid und eine Perlenkette, die nicht echt war, wie Ruth wusste. Dennoch sah sie so aus, als würde sie gleich in die Stadt gehen, statt einen Hof zu leiten.
»Jill schläft noch«, sagte Olivia. »Und das ist auch gut so. Sie hat den Schlaf der Engel und ist nicht wach geworden, als ihr Vater oben herumpolterte. Ich hatte nicht dieses Glück.«
Ruth wusste nicht, was sie sagen sollte, schenkte Olivia schnell eine Tasse Tee ein. Olivia sah sich um.
»Noch mehr Fleisch«, seufzte sie. »Und der Tag wird heiß werden. Wir müssen es heute verarbeiten.«
»Ich habe es gestern Nacht und vorhin mit Essiglösung abgewaschen. Aber dennoch sind die Fliegen überall.«
»Ich hasse Fliegen«, sagte Olivia. »Ich hasse Fliegen, ich hasse den Gestank von frischem Fleisch, ich hasse den ganzen Dreck hier. Ich wünschte, Freddy würde den Hof verkaufen und mit mir nach London ziehen.«
»Aber was sollte er in London machen?«, fragte Ruth verwundert. »Er ist doch Bauer.«
Der Blick, den Olivia ihr zuwarf, war eisig. »Man kann sich auch ändern. Wenn man als Bauer geboren wurde, muss man ja nicht als Bauer sterben. Es gibt in der Stadt genug Arbeit, wenn man das wirklich will.«
Ruth senkte den Kopf. In London, das hatte sie erst gestern wieder gesehen, gab es viele Bettler. Wie die Arbeitslage in England war, wusste sie nicht so genau, aber sie schätzte, dass auch dieses Land noch an der weltweiten Rezession zu knabbern hatte. Außerdem war Freddy von ganzem Herzen Bauer. In einer Fabrik würde er sich nicht wohlfühlen. Aber das sagte sie nicht – es stand ihr nicht zu.
»Was machen wir nun mit dem Fleisch?«, fragte sie stattdessen.
»Ich denke darüber nach und werde mir etwas einfallen lassen. Viel ist ja nicht dran an dem mickrigen Kadaver. Wahrscheinlich solltest du am besten das wenige Fleisch abschaben und daraus einen Eintopf kochen oder so etwas. Aus den Knochen können wir Soße machen und einwecken. Und Suppe. Viel mehr wird es nicht hergeben.«
»Und das Schwein?«
»Daraus werden wir wohl heute noch Wurst machen müssen.« Olivia stöhnte auf. »Ich werde Jacks Frau Daisy fragen, ob sie uns hilft. Ich hasse es, zu wursten. Kannst du das?«
Ruth schüttelte den Kopf. »Mein Großvater war Metzger. Früher«, sagte sie stammelnd. »Ich habe auch schon mal zugesehen, wie er Wurst gemacht hat. Aber da war ich noch klein, und wie das genau geht, weiß ich nicht.«
»Es ist viel Arbeit«, sagte Olivia. »Aber es muss wohl gemacht werden.« Sie wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht. »Diese Fliegen bringen mich um.« Sie trank ihren Tee, ging dann in den Hof. »Du kannst den Tisch decken und das Frühstück machen«, sagte sie über die Schulter hinweg zu Ruth. »Und hab ein Ohr auf Jill. Sie wird sicher gleich wach werden.«
»Ja, Mistress«, sagte Ruth und öffnete die Tür zum Treppenhaus, damit sie Jill hören würde.
Die zweijährige Tochter der Sandersons war ein reiner Sonnenschein, ein wahrer Lichtblick im tristen Alltag auf dem Hof, der von morgens bis abends mit Arbeit gefüllt war – Ruth liebte sie von ganzem Herzen.
Zum Glück hatte Daisy Norton, die Frau des Knechts, Zeit. Sie war immer über einen kleinen Zuverdienst froh und kam schon früh am Vormittag.
Auf Olivias Anweisung hin hatte Ruth das Fleisch von den Kalbsknochen geschnitten und geschabt. Anschließend setzte sie einen Topf auf, legte das Fleisch hinein, so wie es Olivia ihr gezeigt hatte.
Ruth hatte keine große Kocherfahrung gehabt, bevor sie nach England gekommen war. Aber sie hatte früher immer gern Zeit bei ihrer Köchin Frau Jansen verbracht oder ihrer Omi zugeschaut und hin und wieder geholfen. Das Erlernte war Ruth in den Monaten nach der schrecklichen Nacht am 9. November zugutegekommen. Martha war oft nicht imstande gewesen, für die Familie zu sorgen. Sie weinte viel und konnte sich zu nichts aufraffen, wurde immer melancholischer. Sofie Gompetz, bei der die Familie Meyer untergekommen war, brachte ihr bei, wie sie einfache Gerichte kochen konnte. Und beim Abschied hatte Omi Ruth ein altes Kochbuch mitgegeben. Das war in den letzten Monaten eine hilfreiche Lektüre gewesen.
Natürlich hatte ihr Olivia gezeigt, wie der Herd funktionierte, und ihr erklärt, welche Gerichte bevorzugt wurden. Aufwendig musste Ruth nicht kochen – nahrhaft sollte es sein. Nur am Sonntag wollte Olivia oft ein Menü mit Suppe, Hauptgang und Nachspeise, das die Familie dann im Esszimmer einnahm. Ruth blieb zum Essen in der Küche, aber das war ihr ganz recht, denn sie mochte Olivias affektiertes Gehabe nicht. Und so hatte sie wenigstens etwas Ruhe.
Ruth schnitt das Suppengemüse, schöpfte den Schaum von der Suppe und fügte gerade das Gemüse hinzu, als Daisy Norton in die Küche kam. Sie nickte Ruth freundlich zu.
»Wir beide sollen also heute wursten«, sagte sie und wusch sich die Hände. »Es ist nicht die beste Zeit, um Fleisch zu verarbeiten.« Missbilligend sah sie zu den Fliegenschwärmen.
»Es war eine Art Notfall«, versuchte Ruth zu erklären.
»Nun ja, machen wir das Beste daraus. Hast du Erfahrung mit Wurstmachen?«
Ruth schüttelte den Kopf.
»Wir werden das Kind schon schaukeln. Du bist fleißig und stellst dich nicht dumm an, sagte mir Olivia.« Sie ging in den Hof und hinüber zur Scheune, kam bald mit einem Eimer wieder, aus dem es entsetzlich stank. »Das ist der Darm«, erklärte sie. »Eigentlich hätte er direkt warm nach der Schlachtung gesäubert werden müssen. Freddy hat ihn wenigstens in Wasser eingelegt.« Sie ging zur großen Keramikspüle und schüttete den Inhalt des Eimers hinein. Dann goss sie einen Eimer frischen Wassers hinterher. »Ich brauche mehr Wasser.«
Eilig lief Ruth auf den Hof zum Brunnen und füllte zwei Eimer mit dem kalten Brunnenwasser.
Daisy Norton wusch den Darm, den sie in drei Stücke geteilt hatte, aus. Immer wieder musste Ruth frisches Wasser holen, so lange, bis das Wasser klar blieb. Dann wurden die Darmstücke auf links gedreht und mit einem stumpfen Löffel die Schleimhäute abgekratzt. Schließlich war Daisy zufrieden und legte die Därme in eine Schüssel mit einer Lauge aus Salz, Wasser und Essig.