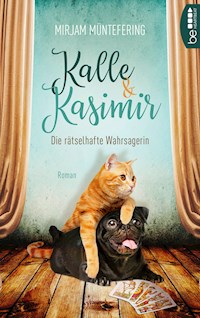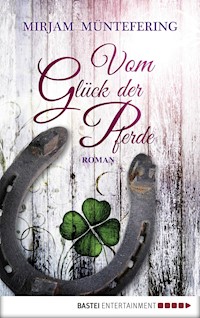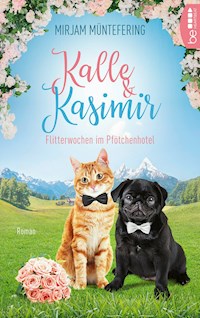6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiffy ist schockiert: Ihre beste Freundin Toni will sie ausgerechnet in einen Lesben-Single-Tanzkurs schleifen! Dabei geht es Tiffy mit ihrem Single-Dasein doch ganz gut. Außerdem wollte sie das Tanztrauma, das sie seit ihrer Kindheit mit sich herumschleppt, nie wieder ankratzen. Nur Toni zuliebe lässt sich Tiffy schließlich doch erweichen. Und ist überrascht - so übel ist das Tanzen gar nicht! Ob das an der wunderschönen Juliane liegt, die einfach hinreißend übers Parkett schwebt? Doch die wirkt so still und abweisend. Dafür hat die Tango-argentino-Lehrerin Ricarda eindeutig ein Auge auf Tiffy geworfen -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Epilog
Über die Autorin
Mirjam Müntefering, geboren 1969, veröffentlichte 1998 ihren ersten Roman. Im Jahr 2000 warf die Filmwissenschaftlerin und Fernsehredakteurin ihre Arbeit fürs Fernsehen hin und gründete ihre eigene Hundeschule. Seitdem lebt sie mit ihrer kleinen Familie und unterstützt von ihren zwei Traumberufen im Ruhrgebiet. Taktgefühle ist ihr sechster Roman bei Bastei Lübbe.
Mirjam Müntefering
TAKTGEFÜHLE
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2010 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anja Lademacher
Titelillustration: getty-images/Image Source
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin
Illustration, Gestaltung und Satz: Peter Frommann
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0240-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Liebe Tanzmädels, Ihr habt mich inspiriert!
Danke für die vielen schönen gemeinsamen Stunden.
Esther und Tanja von der Tanzbar Mona & Lisa – aller Anfang ist schwer, aber Ihr macht ihn zu etwas Unvergesslichem.
Bettina, ganz besonders für Dich, weil Tanzen Dir so viel bedeutet.
PROLOG
Meine Eltern erzählen, dass sie mit mir auf einer Hochzeit waren, als ich etwa zehn Monate alt war. Ich trug einen hellblauen Strampler, den meine Großtante geschenkt hatte, in der unbeugsamen Hoffnung, ich möge mich doch noch als Junge herausstellen.
Hübsch zurechtgemacht für das unvergessliche Fest ihrer Freunde, trugen meine Eltern ihren ersten Sprössling stolz mit sich herum. Sie standen auch mit mir an der Tanzfläche.
Mein Vater hielt mich, ich lag bäuchlings auf seinem starken Unterarm. Der Erzählung zufolge reckte ich den Kopf und sah mich mit meinen Babyaugen höchst interessiert um.
Vor uns auf der Tanzfläche rockte die Hochzeitsgesellschaft. Es war Anfang der Siebziger. Das früher übliche Standardgeschiebe war total out. Solitärtanz mit Headbanging war noch nicht in. Also schwoften und twisteten ihre Freunde in Paaren, aber ohne Anfassen. Leider wissen Mama und Papa beide nicht mehr, welches Stück gerade gespielt wurde. Sie sind sich aber einiglich sicher, dass es etwas von Elvis, den Beatles oder Catarina Valente war.
Da spürte mein Vater plötzlich, dass seine kleine Tochter unruhig wurde. So wie er es heute erzählt, klingt es, als sei ich kurz davor gewesen, von seinem Arm zu springen, um einen Flickflack hinzulegen. Ich neige eher dazu, meiner Mutter zu glauben, die stets selig lächelnd erklärt, ich hätte mit meinen kleinen Füßchen in dem hellblauen Strampelanzügchen gewippt – und zwar genau im Takt der Musik.
»Sie tanzt!«, freute sich mein Vater.
»Oh mein Gott! Genau wie Elsa!«, rief meine Mutter.
Und die beiden sahen sich an.
Mit Elsa war die fast zehn Jahre ältere Schwester meiner Mutter gemeint. Eine begnadete Tänzerin. Eine von der Sorte, die schon als Kleinkind der Star im Ballettunterricht ist und mit sechzehn Mitglied in einer Formationstanztruppe wird, mit der sie durch ganz Deutschland tourt. In ihrem Beruf lernte Elsa auch ihren späteren Mann Harald kennen, der ebenfalls Tänzer war. Mit ihm zusammen gewann sie viele nationale und internationale Wettbewerbe im Standard- und Lateinamerikanischen Tanz. Elsa hatte Rhythmus im Blut. Elsa war ein Naturtalent. Elsa war eine Göttin im Tanzen.
Außerdem war sie die Lieblingsschwester meiner Mutter. Ein Jahr, bevor ich geboren wurde, kam Elsa zusammen mit ihrem Mann bei einem Autounfall ums Leben.
1
»Du weißt nicht, was deine Bestimmung ist,
solange du nicht getanzt hast.«
(Feeling the Music)
Ich glaube an die große Liebe.
Diese Art von Liebe, die einen eiskalt und schwer erwischt und dann nie, nie, nie wieder loslässt. Elektrisierte Körper. Qualitativ hochwertiger Austausch für den Geist. Harmonierende Seelen. Hundert Prozent eben.
Das ist das eine, was man über mich wissen sollte.
Das andere ist: Ich trage gerne Boots.
Diese festen Schuhe, in denen man sich vorkommt, als könne nichts einen wirklich umhauen, solange man diese Dinger an den Füßen hat. Meine Mutter behauptet, mein klobiges Schuhwerk sei gefährlich für meine Haltung. Und für meine Sexualität. Denn sie findet meine Schuhe extrem unsexy und hält sie für den Kern des Übels meiner Beziehungslosigkeit. Außerdem hat sie neulich irgendwo gelesen, dass High Heels gut für den Beckenboden sind. Das hat sie natürlich mächtig angestachelt, sodass sie mal wieder mit mir Schuhe kaufen gehen wollte. Ich konnte sie nur davon abhalten, mir Zehn-Zentimeter-Absatz-Mörderteile zu schenken, indem ich sie darauf hinwies, dass ich doch erst sechsunddreißig sei. Und deswegen wirklich noch eine ganze Weile entfernt von möglicherweise auftretender Inkontinenz im Alter, und außerdem seien Pumps nun wirklich nicht geeignet für dieses Wetter.
Ich beobachte, wie die dicken Sohlen meiner Boots sicher wie ein Eisbrecher Haftung auf dem Schneematsch finden. Um mich herum rudert alles Weibliche auf dünnen Ledersöhlchen hilflos über glitschigen Untergrund. Ich aber gehe unbehelligt meines Weges. Und meine Haltung leidet kein Stück darunter. Ob meine Sexualität darunter leidet, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeit. Wer weiß denn schon, wie quantitativ und qualitativ hochwertig das Sexleben der Damenschühchen-Trägerinnen ist?
Kurz bevor ich das beeindruckende, gläserne Firmengebäude meines Arbeitsgebers erreiche, fährt ein kleiner knallroter Minicooper hupend an mir vorbei und spritzt mit seinen Allwetterrädern den Schneematsch bis über den Bordstein. Das ist Toni.
Sie kurvt geschickt mit ihrem kleinen Auto über den Angestelltenparkplatz und quetscht sich in die Lücke zwischen einem Mercedes und einem BMW. Ihr kleiner Roter mit den silbernen Sternchen sieht neben den riesigen Schlitten aus wie eine verirrte Christbaumkugel.
»Juhu!«, winkt Toni. Wir treffen uns vor dem Haupteingang. »Na, wie war dein Wochenende?«
»Super«, strahle ich. »Ich hab mir ein paar neue Filme ausgeliehen. Zwei habe ich noch nicht mal im Kino gesehen. Hab also viel auf dem Sofa rumgekuschelt. Dann gab’s noch Kaffeeschnack bei Mama und Papa. Lesen im Bett. Und eben viel Sofa und supercoole Filme. Kennst du diesen britischen über die Beerdigung des Familienpatriarchen, bei der dieser eine Typ aus Versehen LSD einwirft und irgendwann nackt auf dem Dach sitzt? Aber seine Freundin liebt ihn trotzdem. Sie liebt ihn so sehr, dass sie ihn gegen ihren herrischen Vater, den Bruder des Toten, verteidigt. Wirklich süß, wie diese Beziehung beleuchtet wird. Du musst dir vorstellen, sie haben …«
»Du hast meine SMS am Samstag ignoriert«, grinst Toni und knufft mich in die Seite. Meine beste Freundin hat durchaus nichts gegen einen gemütlichen DVD-Abend bei mir einzuwenden. Doch alles hat seine Grenzen. Und leider ist meine ausufernde Filmbegeisterung für sie das, was meine Boots für meine Mutter sind. Toni glaubt, ich kriege keine Frau ab, weil ich ständig nur im Kino oder auf meinem Sofa hocke und mir Movies reinziehe, in denen es um die große und einzige Liebe geht.
»Welche SMS?«, frage ich unschuldig und muss ihrer Faust ausweichen, die noch mal ordentlich ausholt. Gut, dass ich Boots trage. Mit jedem anderen Schuh wäre ich bei diesem Herumtänzeln auf dem Salz-Schneegemisch vor dem Eingang rettungslos verloren.
»Du weißt, welche ich meine. Die, in der ich dir geschrieben habe, dass du deinen süßen Hintern gefälligst zum Schwof bewegen sollst, um mich dort zu treffen. Es war dann aber übrigens auch ohne dich ein voll cooler Abend«, setzt sie lässig hinzu.
»Echt?«
»Sag das nicht so!«
Wir treten in die große Drehtür des Hauptgebäudes und latschen gesittet hindurch, bis wir im Foyer gelandet sind und unser festes Schuhwerk auf der gewaltigen Schmutzfangmatte abtreten können, so wie es etliche Kolleginnen und Kollegen um uns herum auch tun.
»Wie sag ich das denn?«, grinse ich.
»So, als ob ich den totalen Oberstuss erzählen würde, sobald ich auch nur anzudeuten wage, dass ein Schwof-Abend wirklich nett gewesen ist.«
Wir schreiten nebeneinander den Gang zu unserem Büro hinunter.
Toni trägt Herrenschuhe.
Die Sorte, die allen Lesben, die zierlich und feminin sind und deswegen zu kleine Füße für Herrengrößen haben, Tränen in die Augen treibt.
»Du hast aber nicht gesagt, dass der Abend ›wirklich nett‹ war. Du hast gesagt, er war ›voll cool‹«, korrigiere ich sie.
Jörg Bromhöfer kommt uns entgegen. Er ist unser gemeinsamer Chef und drückt jedes Mal, wenn er mir auf dem Gang begegnet, derartig den Rücken durch, als habe er sich am Morgen beim Erstkontakt mit dem Schreibtischstuhl versehentlich auf ein senkrecht stehendes Lineal gesetzt.
»Guten Morgen, ihr zwei«, lächelt er. Soll wahrscheinlich lässig klingen, ist dafür aber viel zu oberkorrekt.
»Morgen«, raunzt Toni. Sie findet, Jörg ist ein Weichei. Was sie bei Lesben kaum, bei Männern aber gar nicht zu dulden bereit ist.
»Guten Morgen«, flöte ich.
Jörg errötet leicht und biegt am Ende des Ganges nach rechts ab. Wahrscheinlich, um auf der Herrentoilette nach dem vermissten Lineal zu forschen.
»Der Abend war auch cool«, erklärt Toni mit Überzeugung. »Ich war mit Natascha und Anke unterwegs. Du weißt ja, was für Partykracher die beiden sind. Anke hat an dem Abend vier verschiedene Frauen angesprochen. Ich glaube, sie hat von allen die Telefonnummer bekommen. Natascha hat auch eine gefunden. Aber du kennst das ja. Sie hat sie den ganzen Abend angeschmachtet, traute sich aber nicht näher als vier Meter ran.«
Ich weiß schon, wieso ich die Flirtkanone Anke und die ewig anhimmelnde Natascha nur hin und wieder genießen kann. Die beiden sind unentwegt damit beschäftigt, sich nach angeblich rasend interessanten Frauen die Augen aus dem Kopf zu glotzen. Ich halte das für einen fragwürdigen Lebensinhalt.
»Klingt nach einem voll coolen Abend!«, pflichte ich Toni ironisch bei und nicke unseren Kolleginnen und Kollegen im Großraumbüro zu. Einige grüßen zurück. Andere sind bereits in die Arbeit auf ihren Bildschirmen vertieft.
Toni lässt sich mir gegenüber auf ihren Schreibtischstuhl fallen und pellt sich aus ihrer Daunenjacke, die sie einfach über die Stuhllehne gleiten lässt. Alles was sie tut, sieht aus, als sei sie die kleine Schwester von James Dean in … denn sie wissen nicht, was sie tun – sogar ihre Frisur.
»Das Beste war, als wir im Café saßen und überlegt haben, wie wir unser Single-Desaster überwinden können.«
»Psst«, zische ich und schaue mich um.
Wir arbeiten beide in einer der mächtigsten Firmen des Ruhrgebietes in diesem Großraumbüro im IT-Bereich. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eigentlich alle ganz o. k. Aber man spricht hier nicht viel über sein Privatleben. Und erst recht erwähnt man nicht, dass man das eigene Single-Dasein als ›Desaster‹ empfindet.
Ich entledige mich auch meiner Jacke, hänge sie ordentlich an den Garderobenständer hinter meinem Schreibtisch. Wir melden uns beide im Betriebssystem an. Ich öffne den E-Mail-Eingang und checke die Nachrichten, die den Bereich des Systems betreffen, für den ich verantwortlich bin. Dann lehne ich mich ein Stückchen vor und flüstere über die niedrige Trennwand zwischen den Schreibtischen hinweg: »Ihr seid doch nicht etwa wirklich auf eine Idee gekommen?«
Toni kichert. »Ich wusste, dass du gleich fragen würdest. Na klar sind wir das. Und ich finde, du solltest unbedingt mitmachen. Es geht gar nicht anders. Denn ich brauche dich dabei ganz dringend.«
Sie braucht mich? Toni braucht mich, ihre gute Freundin Tiffy, um ihr Single-Desaster zu überwinden? Jetzt bin ich aber neugierig. Zwischen den Bildschirmen hindurch kann ich sehen, wie Toni sich zu ihrem Rucksack hinunterbeugt und darin kramt. Dann reicht sie mir durch die schmale Lücke ein Stück Papier.
Ich nehme es.
Es handelt sich um einen Flyer. Diese typischen Dinger. Ein zweimal gefalztes DIN-A4-Blatt, das zu Werbezwecken genutzt wird. Einen Augenblick starre ich verständnislos auf das Bild der beiden Damen, die im Zwanzigerjahre-Look die Wangen aneinanderschmiegen. Dann lese ich ein bisschen. Und dann erst beginnt mein Hirn langsam zu arbeiten.
»Auf keinen Fall!«, schmettere ich.
Ein paar Kollegen im näheren Umkreis sehen von ihrer Arbeit auf. Ich lächele ihnen zu und deute auf den Bildschirm. »Ich mache doch keine Freigabe auf Zuruf! Benötige schon die richtigen Anträge der Abteilung!«, sage ich großspurig und tue so, als würde ich mich erneut auf den Monitor vor mir konzentrieren. Über die kleine Trennwand hinweg knurre ich Toni zu: »Auf keinen Fall mache ich bei einem Tanzkurs mit!«
Tonis braune Cockerspaniel-Augen erscheinen kurz über der Trennwand und gucken sehr traurig.
»Aber wieso denn nicht?«, flüstert sie.
»Wieso nicht? Wiiiesooo nicht?« Ich schaue mich rasch um, ob ich schon wieder zu laut geworden bin. Ich werfe noch mal einen Blick auf den provokanten Flyer vor mir. Dann antworte ich leise: »Toni, also jetzt mal ganz ehrlich. Du kennst mein Tanztrauma doch wohl ganz genau, das meine lieben Eltern mir beschert haben. Du kennst die Geschichte doch.«
Toni legt den Kopf schief und lässt jetzt nur noch ein Auge sehen, wie ein neugieriger Spatz.
»Aber kannst du das denn nicht voneinander trennen? Das mit deiner Tante ist doch so irre lange her. Du musst ja auch nicht gleich Turniere tanzen. Nur deiner lieben, einsamen Freundin beistehen, die eine neue Hoffnung gefasst hat …«
»Ich soll dir beistehen? Du meinst, ich soll deine Tanzpartnerin sein?«
»Yep.«
»Toni, das geht echt nicht. Ich wehre mich doch nicht seit fünfundzwanzig Jahren dagegen, in die Rolle des Tanztalents gedrängt zu werden, um dann ausgerechnet bei so einem Kurs schwach zu werden«, argumentiere ich. Das muss sie doch verstehen.
»Ausgerechnet bei so einem Kurs?«, wiederholt Toni dumpf. »Das klingt sehr abfällig.«
»Tut mir leid. Ist nicht so gemeint«, sage ich zerknirscht.
Doch Toni hört mich offenbar gar nicht. »Abfällig und diskriminierend«, brummt sie. »Ich leide sowieso schon genug darunter, allein zu sein. Da brauche ich solche abfälligen Bemerkungen nicht auch noch.«
Jetzt treibt sie es aber zu weit.
»Moment mal! Ich bin auch Single«, stelle ich fest. »Von Diskriminierung kann echt nicht …«
»Tiffy!«, jammert sie leise und schaut mich kläglich bittend an.
»Toni!«, erwidere ich und blicke streng zurück.
Sie sagt nichts, sondern sieht mich nur an – soweit das bei den eingeschränkten Sichtverhältnissen an unseren Arbeitsplätzen möglich ist.
»Toni …«, beginne ich schließlich, ohne den Satz zu beenden.
»Tiffy …«, säuselt sie leise.
Ich schüttele den Kopf.
»So geht das nicht.«
»Wir sollten uns andere Spitznamen ausdenken, falls wir solche Gespräche öfter führen wollen«, stimmt sie mir zu.
»Wollen wir das denn?«, frage ich rasch. »Öfter solche Gespräche führen?«
»Nein. Ich jedenfalls nicht. Du?«, antwortet sie.
»Unsinn.«
»Ich kann’s nicht leiden, wenn wir nicht gleicher Meinung sind«, gesteht Toni. »Wozu hat man schließlich eine beste Freundin. Doch um sich einig zu sein, oder?«
Da hat sie nun allerdings recht.
Wir grinsen uns an.
»Na klar«, lächele ich.
»Heißt das, du bist dabei?«, freut sich Toni.
Ich öffne den Mund, um ruhig und gelassen zu widersprechen, an ihren Verstand zu appellieren. Doch in diesem Augenblick wird die Glastür zum Büro geöffnet, und Jörg Bromhöfer erscheint auf der Bildfläche. So wie er geht, war das mit dem Lineal wohl nicht erfolgreich.
»Wir können ja später alles Nähere besprechen«, raunt Toni mir zu.
»Auf keinen Fall!«, erwidere ich und höre selbst, dass ich wieder viel zu laut bin.
Der Kollege hinter mir beugt sich zu seinem Nachbarn hinüber, und ich höre ihn flüstern: »Also, ich mache auch nie einfach so Freigaben. Du etwa?«
Ich bemühe mich, meine Stimme etwas zu senken. »Auf keinen Fall. Hörst du? Ich mache bei dieser Sache auf keinen Fall mit. Da bringen mich keine zehn Pferde hin. Damit das klar ist!«
2
»Ich habe eine Wassermelone getragen.«
(Dirty Dancing)
Ich heiße euch herzlich willkommen zum Anfängerinnenkurs«, strahlt die sympathische Frau vor uns. »Ich bin Mona, eine der beiden Chefinnen hier. Ich werde euch also einführen in die Welt des Langsamen und des Wiener Walzers, vom Foxtrott über Tango, Jive und Cha-Cha-Cha bis zur Samba. Uh, sagt ihr jetzt bestimmt, das ist aber ganz schön viel Zeug! Aber keine Bange, wir werden uns gemeinsam langsam rantasten an die Standard- und die Lateinamerikanischen Tänze.«
Auf allen neun Gesichtern am Tisch erscheint ein erleichtertes Lächeln.
Auf meinem nicht.
Ich vermute, ich werde heute gar nicht mehr lächeln. Vielleicht auch nie wieder.
Es ist Sonntagabend.
Ich sollte gemütlich auf meinem Sofa sitzen. Mit einem Tee. Etwas restlichem Spritzgebäck vom fast leer genaschten Weihnachtsteller, den meine Mutter uns Kindern immer noch jedes Jahr zusammenstellt. Ich könnte meine reichhaltige DVD-Sammlung durchforsten und aus Entscheidungsnot gleich zwei Filme schauen. Oder der Roman, den ich gerade lese, könnte superspannend werden. Ich sollte in meinem ganz normalen Leben sein, wie an allen anderen bisherigen Sonntagabenden.
Stattdessen sitze ich hier neben Toni in der Ecke dieses großen Saals. Nein, großer Saal ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Riesiger Saal würde es wahrscheinlich besser treffen. Und am besten wäre er beschrieben mit ›riesiger, verspiegelter Saal‹, denn an zwei Seiten, einer Längst- und einer Querseite ist die Wand vom Boden bis zu einer Höhe von etwa zwei Meter zehn komplett verspiegelt. Wenn ich rüberlunze, kann ich mich sogar sehen, wie ich inmitten der Schar dieser verschreckten Lesben hier hocke und meinem Schicksal entgegenhadere.
Nach einer erfrischend kurzen Vorstellungsrunde, in der ich den Ehrgeiz entwickele, mir alle fremden Namen zu merken, erklärt Mona uns kurz den Ablauf des jeweils neunzig Minuten dauernden Trainings, wann es Pausen gibt und so.
Sie wirkt freundlich und heiter. Gar nicht so verbissen ehrgeizig wie Tanzlehrerinnen sonst. Außerdem trägt sie ihre schulterlangen Haare offen und nicht zu einem strengen, faltenreduzierenden Extremzopf zurückgebunden. Sie ist auch kaum geschminkt. Dabei hat mir meine bisherige Erfahrung gezeigt, dass Tanzlehrerinnen mindestens einen knallroten, angsteinflößenden Lippenstift tragen, der Angelina Jolie schmallippig aussehen lässt. Zudem vermerke ich auf der überraschend langen Positivliste, dass Mona bisher nicht ein einziges Mal erwähnt hat, dass es sich bei diesem Kurs um einen »Tanzkurs für Singlefrauen« handelt.
Das muss sie aber wahrscheinlich auch gar nicht. Selbst ein blinder, orthodoxer Muslim würde mitbekommen, dass hier ein Haufen paarungsbereiter Frauen in den Dreißigern aufeinanderhockt und in kollektiver Schreckstarre darauf wartet, was geschehen wird.
Mona geht über das verlegene Räuspern und alle Übersprungs-am-Kopf-Kratzen-Handlungen souverän hinweg und fordert uns zunächst auf, ihr aufs Parkett zu folgen.
Der Saal streckt sich vor mir aus wie ein zugefrorener See.
»Wie ich sehe, haben sich die meisten von Euch mit der Wahl des Schuhwerks schon aufs Tanzen eingestellt«, sagt Mona, während sie uns ›untenrum‹ genau in Augenschein nimmt.
Tonis lederne Männerslipper scheinen bei ihr problemlos durchzukommen. Doch bei mir bleiben ihre Augen kleben. Sie sieht an mir herauf, mir ins Gesicht, und lächelt.
»Stefanie, richtig?«, sagt sie.
»Tiffy«, sage ich möglichst heiter.
»O. k., Tiffy. Also, dich würde ich bitten, zur nächsten Stunde andere Schuhe zu wählen. Boots sind nicht wirklich geeignet zum Tanzen. Das Gleiche gilt für Chucks (netter Blick zu der Hübschesten im Kurs, Michaela) und Sportschuhe (ebenfalls netter Blick zu der lässig Burschikosen, ich glaube Kati). Zum Tanzen brauchen wir leichte Schuhe mit Sohlen, die nicht zu sehr stoppen, aber auch nicht zu glatt und rutschig sind. Gummisohlen verhindern, dass der Fuß sich auf dem Parkett drehen kann. Sie wirken wie ein Gummistopper. Und schwere Schuhe haben in etwa den gleichen Effekt. Außerdem sind sie besonders ungeeignet für Anfängerinnen. Denn erfahrungsgemäß landet doch mal der eine oder andere Fuß da, wo er nicht landen sollte … auf dem Fuß eurer Tanzpartnerin.«
Alle außer mir lachen.
»So, dann kommen wir mal zum spannendsten Teil des heutigen Abends: der Einteilung der Gruppe in Tanzpaare. Wie ihr ja alle wisst, gibt es beim Paartanz immer eine, die die Führung übernimmt. Bei gemischten Paaren ist das der Mann. Keine einfache Rolle, denn dieser Part muss immer im Auge behalten, wo sich die anderen Paare im Saal befinden, damit es nicht zu einer Kollision kommt …« Allgemeines Gekicher. Nur ich gebe keinen Ton von mir. »Außerdem muss die Führende entscheiden, welche Figuren getanzt werden und so weiter. Sie hat also die Rolle derer, die entscheiden muss, welche Figuren getanzt werden.« Mona hält kurz inne und schaut sich in der Runde um. Ich drücke ein wenig die Schultern durch und versuche, extrem aktiv auszusehen. »Obwohl die Geführte natürlich auch aktiv die eigenen Schritte tanzen muss, hat sie es etwas einfacher, sie tanzt, was ihre Partnerin ihr vorgibt. Dann jedoch hat die Geführte meist etwas schwierigere Schritte zu tanzen. Sie kennt mehr Drehungen und kompliziertere Schrittabfolgen …«
»Nicht zu vergessen die Hebefiguren!«, wirft Kati mit den Sportturnschuhen ein und erntet Gelächter, auch von Mona. Nur nicht von mir. Hebefiguren finde ich echt nicht lustig.
»Also«, fährt Mona fort. »Vielleicht habt ihr euch ja auch im Vorfeld schon entschieden: Wer möchte führen?« Sie deutet auf ihre rechte Seite. »Und wer möchte geführt werden?« Diesmal zeigt sie nach links.
Es gibt ein kleines Geschiebe und Gerangel. Ich befürchte schon Allerschlimmstes. Ich meine, welche Lesbe stellt sich bei so einer Fragestellung schon links hin? Geführt werden. Passiv sein. Einfach etwas über sich ergehen lassen. Doch am Ende bin ich bass erstaunt, dass es einigermaßen hinzukommen scheint.
Die hübsche, brünette Michaela, die nun auf der rechten Seite steht, grinst zur anderen Seite hinüber und fragt die blonde, etwas spröde wirkende Heike: »Bevor mir eine zuvorkommt: Magst du mit mir tanzen?«
Boah, das geht hier ja zu wie beim Völkerball damals in den Schulpausen.
Wer wird als Erste in eine Mannschaft gewählt?
Heike strahlt und nickt eifrig. Um allen ganz klarzumachen, dass sie bereits vergeben sind, treten die beiden etwas zur Seite und bleiben dort verlegen grinsend nebeneinander stehen.
»Na, wir wissen ja schon, dass wir miteinander tanzen wollen«, sage ich laut zu Toni.
Die nickt zaghaft und schaut verlegen auf ihre Schuhspitzen.
»Was ist denn?«, frage ich.
»Fällt dir nichts auf?«, will Anke wissen.
Ich sehe sie verwundert an.
»Ihr steht beide auf der gleichen Seite«, erklärt Natascha, die auch bei uns rumlümmelt. Und im gleichen Moment tut sie einen kleinen Satz hinüber zu denen, die geführt werden wollen und schnappt sich Anke. Na, die beiden sind eh Busenfreundinnen, war ja klar.
Ehe Toni und ich uns versehen, haben sich die anderen Paare auch gefunden.
Kati mit den Turnschuhen steht neben einer kleinen, sehr blassen und schüchtern wirkenden Rothaarigen, die sich als Jutta vorgestellt hat. Und die recht forsch wirkende Kerstin neben der zierlichen Sandra.
Toni und ich schauen uns an.
Mona runzelt die Stirn.
»Ich bin größer als du«, stellt Toni fest. »Ich denke, es wäre besser, wenn ich führe.«
Ich öffne den Mund, um zu protestieren. Aber natürlich ist Mona Vollprofi und sagt: »Für diese Stunde können wir das so machen. Aber nächste Stunde probieren wir es mal andersrum. Dann werden wir ja sehen, in welcher Rolle ihr euch am wohlsten fühlt. Manche Paare machen es auch so, dass die eine den Walzer führt und die andere den Foxtrott und so weiter.«
Wir beginnen mit dem Langsamen Walzer.
Wie beim Aerobictraining stellt Mona sich mit uns vor den Spiegel und zeigt erst den Führenden, dann den Geführten ihre Schritte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
Das reicht eigentlich schon.
Mein Körper erinnert sich.
Es ist irre lange her. Ich war zwölf, als ich zuletzt getanzt habe. Doch meine Füße wissen sofort wieder Bescheid. Jede, die mal getanzt hat, kann den Langsamen Walzer auch nach Jahrzehnten noch im Schlaf.
Dann sollen wir in Sicherheitsabstandshaltung gehen. Das heißt, wir stehen unserer Tanzpartnerin zwar schon recht nah gegenüber, halten uns dabei aber erst mal an den Händen wie beim Ringelreihen. Lächerlich. Die paar Schrittchen werden doch wohl alle hinbekommen, ohne größere Kollisionen zu fabrizieren.
Doch Monas System scheint seine Berechtigung zu haben, stelle ich fest.
Denn als wir schließlich zum ersten Mal zur Musik unsere eins, zwei, drei Schrittchen wagen, wäre die eine oder andere bestimmt auf dem Fuß der jeweiligen Tanzpartnerin gelandet, würden wir alle schon in der üblichen Haltung tanzen. Dass bei uns alles glattläuft, begeistert Toni derart, dass sie ganz euphorisch wird. Ich verdrehe heimlich die Augen.
Als das Eins-Zwei-Drei mit Sicherheitsabstand funktioniert, zeigt uns Mona die korrekte Tanzhaltung.
»Die Führende hält die rechte Hand der Geführten in ihrer linken, ungefähr auf dieser Höhe. Ihre rechte Hand liegt unter dem linken Schulterblatt der Geführten, hier. Die linke Hand der Geführten liegt sacht auf der Schulter der Tanzpartnerin. Beide haben ihren eigenen Tanzbereich, nämlich links. Beide Tanzpartnerinnen schauen nach links, beide orientieren sich nach links – allerdings nur mit dem Kopf. Becken und Schultern bleiben der Partnerin zugewandt«, erklärt sie.
Ich schiebe Toni an die richtige Stelle, korrigiere rasch ihren schlappen Arm, der wie ein Fragezeichen in der Luft hängt, und dann bleibt massig Zeit, um den anderen bei ihren redlichen Bemühungen zuzusehen, Monas schlichte Worte umzusetzen.
Mona zieht unverdrossen im Saal ihre Runden, legt dort eine Hand etwas höher, wendet hier eine Schulter, dreht an anderer Stelle einen Kopf. Toni und mich betrachtet sie nur kurz und kritisch, lächelt uns dann an und geht weiter. Toni strahlt mich an. Ich atme langsam aus. Himmel, schenk mir Geduld und ein Übermaß an Liebe zu meiner besten Freundin!
»Was ist denn mit dem Tanzabstand?«, fragt piepsig die rothaarige, schüchtern wirkende Jutta, der ihre toughe Tanzpartnerin Kati offenbar zu nah auf die Pelle rücken will. Hier geht’s ja richtig heiß zur Sache!
Mona leiht sich mal eben Kati aus, die prompt eine knallrote Birne bekommt, und macht es mit ihr vor.
»So muss es aussehen, seht ihr? Der Oberkörper der Geführten lehnt sich zurück. Der untere Bereich jedoch (meine Mit-Kursteilnehmerinnen, inklusive Toni, registrieren, dass sie damit den Unterkörper meint und erstarren vor Schreck) tanzt in den Standardtänzen sehr eng. Blinddarmnarbe an Blinddarmnarbe.«
Mona entlässt Kati wieder, und ich beobachte, wie die dezent ihre Hand an der Jeans trockenreibt. Fast hätte ich zum ersten Mal an diesem Abend gegrinst. Aber nur fast. Als wir selbst uns nun derartig formieren sollen, versinkt der Großteil der Belegschaft in bodenloser Peinlichkeit.
»Bin ich froh, dass ich mit dir tanze«, flüstert Toni mir zu, denn als beste Freundinnen haben wir keine Berührungsängste. Wir wissen seit Langem, dass unsere Blinddarmnarben nichts voneinander wollen.
Die anderen versuchen krampfhaft, möglichst natürlich auszusehen, während sie sich ›oben zurücklehnen‹ und ›unten Kontakt halten‹. Ist eigentlich irgendeine schräge Filmemacherin schon mal auf den Gedanken gekommen, eine Dokumentation über einen Lesben-Single-Tanzkurs zu machen? Das Publikum würde sich in den Sitzen biegen.
Außer bei Toni und mir fällt Mona bei jedem Paar immer noch irgendwas auf, was nicht richtig ist. Für einen Augenblick überkommt mich eine Welle der Erleichterung. Wenigstens hat Toni sich für ihren Kampf gegen das Singledasein eine Sportart ausgesucht, bei der ich durch meine Erfahrung nicht blöd aussehen muss. Blöd auszusehen, ist nichts für mich. Auf dem Prüfstand zu stehen noch weniger. Nachdem ich mein Diplom als Fachinformatikerin gemacht und alle zusätzlichen Prüfungen bestanden hatte, die ich für meinen Job brauche, bin ich Situationen wie dieser ausgewichen. Es erinnert mich einfach zu sehr an damals. An die Zeit meiner Kindheit bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Die Zeit, in der ich alles mitmachte, was meine Mutter sich für mich ausdachte. Die Zeit, in der die strenge Musterung durch eine stark geschminkte, durch ein eng gewickeltes Kopftuch geliftete Tanzlehrerin in den Fünfzigern zu meinem Alltag gehörte.
»Lächel doch mal«, flüstert Toni mir zu.
Ich schnaube. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.
»Ich werde den ganzen Abend nicht ein einziges Mal lächeln«, teile ich ihr mit, wobei ich sie stoisch einfach geradeaus anschaue. »Ich glaub das nämlich nicht! Erst lass ich mich zu einem bekloppten Tanzkurs überreden. Und dann muss ich auch noch die Geführte geben. Nicht zu fassen!«
Von da an versucht Toni nicht noch mal, mich aufzumuntern, sondern konzentriert sich voll auf die Schritte, die Mona uns zeigt. Für mich ist es selbstverständlich und natürlich, die Unversehrtheit der Füße der Partnerin gewährleisten zu können. Für die anderen – einschließlich Toni – gilt das noch lange nicht.
Zur Pause sind alle ziemlich aufgedreht, stellen sich gegenseitig interessierte Fragen zu Berufen und (ich hab’s geahnt!) Sternzeichen und nippen an ihren Getränken.
Nach der Pause lernen die anderen die ersten Schritte des Cha-Cha-Cha. Ich tue so, als müsste ich sie mir auch einprägen. Dabei könnte ich doch problemlos ein ganzes Musikstück durchtanzen. Toni und ihre bekloppten Ideen!
Was ich allerdings feststelle, ist: Die neunzig Minuten dieser ersten Kursstunde gehen schneller rum als befürchtet. Zugegebenermaßen gibt es für mich jede Menge Interessantes und Lustiges zu beobachten. Es ist, wie durchs Programm zu zappen, wenn mal kein gescheiter Spielfilm greifbar ist, es ist unterhaltsam.
Als wir am Ende gemeinsam aus dem Tanzsaal ins Foyer der Tanzschule schlendern, sehen die anderen ziemlich geschafft aus. Was mich wundert. Schließlich sind sie alle freiwillig hier.
Die Mädels verabschieden sich winkend und mit einem »Bis nächste Woche!«. Wovon ich aber nur die Hälfte mitbekomme, denn ich muss noch mal dringend für ›Kleine Geführte‹.
Als ich das Örtchen wieder verlasse, sind die anderen Kursteilnehmerinnen alle aus dem Foyer verschwunden. Auch Natascha und Anke sind nicht mehr da. Das erleichtert mich ein bisschen. Bestimmt werden die beiden erst mal alle verfügbaren Kandidatinnen aus dem Kurs durchhecheln, um auszuloten, ob eine dabei ist, die für sie infrage käme. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Mir erklärt sich nie, was das Tolle an solchen Gesprächen sein soll. Um Liebe geht es dabei jedenfalls nicht, das ist ja wohl klar. Aber dazu habe ich wohl sowieso eine eher antiquierte Meinung, die sogar meine Mutter einmal als »lebensfeindlich« beschrieben hat. Nur, weil ich keine Lust habe, mich auf eine einzulassen, von der ich weiß, dass sie nicht meine Hundertprozent ist. Wenn ich mit den anderen darüber rede, behauptet Anke zum Beispiel immer, dass sie durchaus schon Hundertprozent gehabt hat – wenn sie alle ihre Freundinnen und Affären zusammenzählt. Also bin ich froh, dass nur noch Toni an dem Ständer für kostenlose Postkarten steht und sehr versunken in die Auswahl zu sein scheint.
»Also«, sage ich. »Gehen wir nächste Woche tatsächlich wieder hierhin?«
Toni sieht mich kurz verwundert an. »Wieso denn nicht?«
Ich grunze ungehalten. »Jetzt sag mir doch bitte mal, wieso wir diesen Kurs weiterhin belegen sollten. Du und Natascha und Anke, ihr seid doch auf diesen Schwachsinn gekommen, weil ihr euer Singledasein beenden wollt. Aber davon abgesehen, dass wir vier schon fast die Hälfte des Kurses stellen und schon vor Jahren geklärt haben, dass wir alle untereinander nix voneinander wollen … also davon mal ganz abgesehen, gibt es doch unter den anderen keine Einzige, die für so ein Unternehmen infrage käme. Also können wir doch auch gleich …« Ich sehe meiner Freundin ins Gesicht. Und verstumme.
»Toni?«, sage ich.
»Hm?«, macht sie und schaut total harmlos von dem Postkartenständer auf.
»Toni, du sagst ja gar nichts.«
»Was soll ich denn sagen?«, fragt sie.
»Na, zum Beispiel: ›Natürlich kommt keine von den anderen infrage!‹ oder: ›Tss, wo denkst du denn hin?!‹ oder so was halt.«
Toni zieht eine Postkarte aus dem Ständer und hält sie mir hin. »Wie findest du die hier?«
»Toni …«, mache ich und lege den Kopf schief. »Du willst doch nicht etwa sagen, dass irgendeine von den anderen Kursteilnehmerinnen dir so richtig gut gefällt? Ich meine, so richtig gut. Vielleicht sogar hundertprozentgut. So gut eben, dass du wegen ihr diesen bekloppten Kurs weitermachen wollen würdest?«
Toni schaut mich kleinlaut an.
Die Eingangstür wird aufgerissen und ein paar Frauen stürmen herein. Sofort ist das Foyer erfüllt mit ihren Stimmen und ihrem Gelächter. Zwei von ihnen haben einen Kinderwagen dabei.
Ich trete näher an Toni heran.
»Welche ist es?«, will ich wissen.
Toni guckt peinlich berührt.
Sie hebt den Kopf, um den vorbeieilenden Frauen grüßend zuzunicken.
Die Eingangstür wird wieder geöffnet.
Verdammt, das geht hier ja zu wie im Taubenschlag.
Ich sehe automatisch auf.
Und vergesse von einer Sekunde auf die andere, was ich Toni gerade gefragt habe. Denn ich traue meinen eigenen Augen nicht.
Auf uns zu kommt so etwas wie ein engelsgleiches Wesen.
Sie ist schlank. Sportlich. Obwohl sie in eine dicke Winterjacke eingemummelt ist, ist mir sofort klar, dass sie den perfekten Körper besitzt. Ihre langen dunklen Haare hat sie lässig in einen Knoten am Hinterkopf geschlungen. Ihre von der Kälte blassen Lippen sind leicht geöffnet. Und ihre Augen. Wow. Ich kann ihre Farbe nicht genau erkennen. Aber sie sind heller, als ich es bei diesen dunklen Haaren erwartet hätte. Voller Lebendigkeit. Voller Feuer.
Sie unterhält sich mit zwei Frauen, die händchenhaltend neben ihr gehen. Besser gesagt, sie hört einer der beiden Frauen zu, die sturzbachartig irgendetwas erzählt.
Als sie an uns vorbeigehen, dreht die dunkelhaarige Schönheit für drei Sekunden den Kopf.
Es sind ganz sicher drei Sekunden, nicht nur zwei oder gar nur eine.
Denn eine Sekunde braucht man schon, um zu registrieren, dass da jemand am Postkartenständer steht.
Noch eine Sekunde geht dabei drauf, genauer hinzuschauen.
Und die dritte Sekunde dann, die dritte Sekunde ist dafür da, um ganz zart, einer Andeutung gleich, zu lächeln.
Ich bin nicht mehr ich. Bin nicht mehr hier. Ich fühle mich wie dieser riesige Gong in der Kinderspielzeugwerbung, die es früher kurz vor Weihnachten immer gab. Dieser Gong, der von dem kleinen Jungen volle Kanne einen verbraten bekommt und dann nachhallt, als müsse er alle Mönche Tibets zum Abendessen rufen. Ich starre diesem überirdischen Wesen hinterher, das gerade durch die Tür in Richtung Tanzsaal entschwebt.
Toni neben mir kichert leise.
»Was ist?«, blaffe ich sie an.
»Du hast gelächelt!«, triumphiert meine beste Freundin. »Obwohl du vorhin gesagt hast, dass das heute Abend nicht drin ist. Ich hab’s aber gesehen! Du hast gelächelt.«
Tatsache. Wahrscheinlich hat sie sogar recht.
3
»Tu keinen Schritt,
bevor du ihn gefühlt hast.«
(Darf ich bitten)
Meine Mutter hat ganz sicher einen kleinen Schlag schräg sitzen.
Nicht besorgniserregend. Auch wurde sie wegen ihrer minimal lockeren Schraube nie von jemandem zu einer Therapie geschickt. Die Einzige, die unter ihrem Spleen hat leiden müssen, war ja schließlich ich.
Seit dem Erlebnis auf der Hochzeit ihrer Freunde war meine Mutter nämlich davon überzeugt, dass in mich eine Art reinkarniertes Tanztalent ihrer Schwester Elsa gefahren sein müsse.
Deswegen machte sie für mich den damals einzigen Kurs in musikalischer Früherziehung aus, der im Umkreis von hundert Kilometern zu finden war.
In diesem Kurs lernte ich zig Instrumente kennen, von den Schlaginstrumenten über die Bläser zu den Streichern und den Tasten. Meine Mutter behauptet heute noch, ich hätte eine besondere Affinität zu Saxofon, Cello und Klavier besessen. Was mich nicht wundert, denn das sind eindeutig die lesbischsten Instrumente. Das Saxofon wird äußerst reizvoll aus dem Unterbauch heraus gespielt. Das Klavier bedarf einiger Fingerfertigkeit von geschickten Händen. Und das Cello … also, wenn ein derartig tailliertes Instrument zwischen den eigenen Schenkeln gehalten werden muss, um ihm solch schöne Töne zu entlocken, muss ich da noch mehr zu sagen?
Sobald ich etwas wackelig auf meinen dicken Babybeinen stehen konnte, ging es los mit dem Tanzen. Meine Mutter tanzte mit mir abends vor dem Fernseher, wenn über den Bildschirm das inspirierende ZDF-Fernsehballett tobte. Sie tanzte mit mir morgens zu den Schlagern auf WDR 4. Sie tanzte mit mir zum Leierkastenmann auf dem Weihnachtsmarkt. Mit vier Jahren wurde ich in die örtliche Ballettschule aufgenommen, was mir ein lebenslanges Trauma und neurotische Störungen im Hinblick auf bodentiefe Spiegel und stark geschminkte, streng dreinblickende Lehrerinnen einbrachte.
Außerdem schien Ballett nicht das Richtige für mich zu sein. Mein Talent war weniger das grazile, sich selbst auf Spitzenschuhen geißelnde. Es war eher das Talent des Rhythmus, der Geschwindigkeit, der Beweglichkeit.
Und so wechselte ich nach einem Jahr in die Jazzdance-Klasse. Jazz-Dance machte mir Spaß. Wir Mädchen lernten Schrittfolgen, durften dabei mit bunten Bändern herumwedeln und unseren eigenen Ausdruck entwickeln. (Sofern man dazu mit fünf bis sechs Jahren in der Lage ist.) Doch den dortigen Ansprüchen war ich in den Augen meiner Mutter bald schon entwachsen.
»Sie hat so viel Taktgefühl«, hörte ich sie oft zu Nachbarinnen, Kindergärtnerinnen, Freundinnen und Verwandten sagen. »Offenbar liegt das also doch in unserer Familie. Auch wenn ich selbst es nicht geerbt habe. Sie sollte so bald wie möglich mit dem Formationstanz beginnen.«
So bald wie möglich bedeutete konkret die Vollendung meines neunten Lebensjahres.
Und Formationstanz bedeutete, mit einem zwei Jahre älteren, obercoolen Jungen Hand in Hand, Hand auf Schulter und Hand auf Rücken tanzen zu müssen. So was nennt man wohl frühkindliche Anti-Prägung. Ich kann meiner Mutter nur zugutehalten, dass sie sich (und mir) ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Tanzpartners einräumte. So blieben mir zumindest die kleinen Machos und eingebildeten Piefkes erspart. Und es war tatsächlich so, dass das Tanzen an sich mir nach wie vor Spaß machte. Ich mochte die Lieder, die Melodien und das Gefühl, wenn mein Körper sich dazu harmonisch bewegte. Meine Mutter war selig, da sich alles in ihrem Sinne entwickelte.
Doch als ich elf Jahre alt war, veränderte sich schlagartig meine Interessenslage. Vielleicht begann ich auch nur, eigene Interessen zu entwickeln und nicht mehr nur das zu tun, was meine Mutter für mich aussuchte. Ich entdeckte Fußball. Es begann ganz harmlos mit einem Spiel im Sportunterricht. Der Ball, die Geschwindigkeit, Tore schießen. Das alles machte auf mich solchen Eindruck, dass ich meiner Mutter in der schonungslosen Ehrlichkeit, die Kinder oft so an sich haben, mitteilte, dass ich nicht mehr Tänzerin werden wollte. Ich wollte Fußballspielerin werden.
Meine Mutter traf fast der Schlag. Eine Weile erlaubte sie mir dieses ›unsägliche Hinter-dem-Ball-her-Gerenne‹, da sie der Meinung war, dass sich mein Interesse daran schon bald verflüchtigt haben würde. Und sie vermutete sehr richtig, dass ein Verbot diese Sportart für mich nur umso spannender gemacht hätte. Doch meine Begeisterung für das runde Leder ließ nicht nach. Im Gegenteil. Und so gab es immer öfter Terminkonflikte, weil ich lieber mit meinen Kumpels auf dem Bolzplatz unserer kleinen Siedlung herumkicken wollte, statt zum Tanzunterricht zu fahren. Es gab Tränen. Es gab Füßestampfen. Es gab scharfe Worte. Bis mein Vater, der sich bisher wohlweislich aus dem ganzen Tanzdrama herausgehalten hatte, schließlich ein Machtwort sprach.
Und das lautete so: »Hanne, wir erziehen unsere Kinder zu einem freien Geist und freier Entfaltung!« (Mein Vater war Lehrer für Deutsch und Bio an der Oberstufe eines heftig alternativ angehauchten Gymnasiums.) »Stefanie kann selbst entscheiden, worauf sie Lust hat.« (Ich stand daneben und nickte eifrig.) »Und sie ist nicht Elsa!«
Bei den letzten Worten knickte meine Mutter in sich zusammen und weinte haltlos. Mein Vater hielt sie im Arm, strich ihr tröstend über den Rücken und machte zu mir gewandt mit dem Kopf ein Zeichen, dass ich mich verkrümeln solle. Das tat ich nur zu gern. Schnappte den schwarzweißen Ball und war verschwunden. Seitdem habe ich nie wieder einen Fuß in einen Tanzschuh gepresst.
Das klärende Gespräch zwischen meinen Eltern war in mein Hirn gebrannt. Und je älter ich wurde, desto mehr verstand ich, worum es darin eigentlich gegangen war. Daher tanzte ich einfach nicht mehr. Ich meine, klar tanze ich auf Partys, auf dem Frauen-Schwof oder auch mal, wenn irgendwo privat ein Fest steigt. Ich gehe mit allen anderen zusammen auf die Tanzfläche und rocke richtig ab. Immer wieder wird mir dann gesagt, dass ich Rhythmus im Blut habe, mich gut bewege und dass frau mir gerne zusieht. Sehr schmeichelhafte Dinge, die mir gesagt werden über etwas, das mir zusätzlich auch noch sehr viel Spaß macht. Aber auf keinen Fall lasse ich mich zu so was wie Walzer auf die Tanzfläche locken. Niemand, der mich zu Standard- oder Lateintänzen aufforderte, hatte je Erfolg. Auf Familienfesten, Geburtstagen von Onkeln, Tanten oder sonstigen Jubiläen verteilte ich Körbe, dass es nur so rappelte.
Alle wussten, dass ich mich als Dreikäsehoch schon mächtig begabt gezeigt hatte. Alle waren der Meinung, ich müsse nur das Parkett betreten und schon würden alle Zuschauer am Rande der Tanzfläche in »Aaahs« und »Ooohs« ausbrechen. Aber genau das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ihre Erwartungen erfüllen. Und ich wollte nicht, dass sie hinter meinem jivenden Rücken flüstern würden: »Genau wie Elsa, findest du nicht? Ach, genau wie Elsa.« Deswegen blieb ich standhaft. Ich blieb bei diesen Gelegenheiten sitzen.
Wie oft meine Mutter mich in meinen mittlerweile sechsunddreißig Jahren wehmütig angesehen und mich mit zarten Hinweisen zu meinem verschwendeten Tanztalent bedacht hat, kann ich nicht zählen. Deswegen ist der Freundschaftsbeweis gar nicht hoch genug zu bewerten, den ich Toni damit erbringe, indem ich sie tatsächlich auch zur zweiten Tanzstunde begleite. Die ganze Woche über haben wir nicht ein einziges Wort über den vergangenen Sonntagabend verloren. Wir trafen uns auf der Arbeit. Nahmen gemeinsam das Mittagessen in der Kantine ein. Wir zwinkerten uns über die Trennwand zwischen unseren Computerbildschirmen verschwörerisch zu, wenn Jörg Bromhöfer mit seinem Lineal vorüberging. Doch keine von uns erwähnte auch nur mit einer Silbe den Tanzkurs. Toni wich dem offenbar aus, um zu vermeiden, dass ich die Gelegenheit nutzen würde, sie doch noch auszuquetschen, welche der Tanzmädels sie denn derart betörend findet, dass sie sie dringend wiedersehen will.