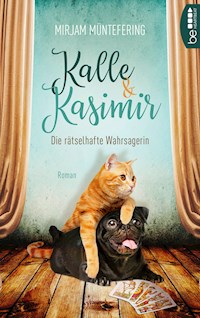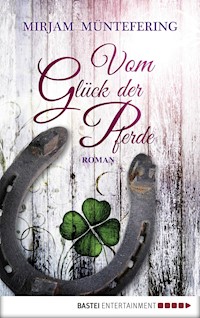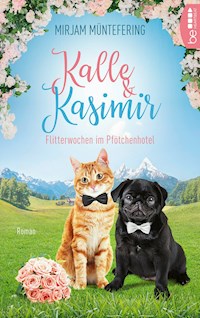16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Schulabschluss steht den beiden Freundinnen Cornelia und Maya die Welt offen. Was wollen sie studieren? Und wo werden sie leben? Eines ist sicher: Sie wollen den Weg in die Zukunft gemeinsam gehen. Doch dann passiert ein grausames Unglück, und dort, wo eben noch Vorfreude schwang und Möglichkeiten lockten, ist nichts als ein rabenschwarzes Loch. Gefühlvoll und mit Humor erzählt Mirjam Müntefering von Schuld, Vergebung und der Kraft der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mirjam Müntefering
Unversehrt
Roman
ULRIKE HELMER VERLAG
Hinweis auf Triggerwarnung.
ISBN (eBook) 978-3-89741-926-1
ISBN (Print) 978-3-89741-460-0
© 2022 eBook nach der Originalausgabe
© 2022 Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf b. Darmstadt Erstausgabe
© 2007 Piper Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL
unter Verwendung eines Fotos von © Salvia77 / photocase.de
Ulrike Helmer Verlag Blütenweg 29, 64380 Roßdorf b. Darmstadt
E-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
KÖRPER
Eine winzige Ader durchläuft die dünne Haut in der Kniekehle. Ein Finger fährt darüber. Vogelflug. Weichste Daunen. Seide. Hochklappen. Gefangener Finger. Wohlig in Warm und Samt. Lass mich nie wieder los.
Lass mich los. Hinauf. Zur sanften Rundung des Schenkels. Goldfarben im Kerzenlicht.
Winzig. Winzig kleine, sehr helle Haare. Sträuben sich unter der geflüsterten Bewunderung von Lippen.
Was sagen sie?
Dies ist der Geschmack von reifen Weizenfeldern im Wind. Den Wellen auf dem tiefen See. Einem Walrücken, der aus der Tiefe auftaucht.
Zwei Seiten. Die eine so stark, fest. Widerstand für sanft eingesetzte Zähne. Die andere zart. So zart, dass selbst die Zungenspitze zu sehr Berührung. Und nicht auszuhalten.
Aber der Duft. Das Erinnern. Bilder und Stimmen leben in den Händen. Streicheln die Körper dorthin zurück. Zum ersten Mal. Dem einzigen, das zählt.
Sanftes Zittern mit der Wange beruhigen. Hinlegen. Hineinatmen. Ruhig. Mit Lippen das Zittern erneut wecken.
Was sie sagen?
ERSTER TEIL
Welchen Sinn hat die Zuweisung von Schuld?
Meine Mutter war sechzehn Jahre alt, als sie mit mir schwanger wurde.
»Was lässt du dich auch mit so einem Ami ein?!«, sagte meine Großmutter dazu. 1968 war der Krieg mehr als zwanzig Jahre vorüber, die Menschheit stand kurz davor, zum ersten Mal auf dem Mond zu landen – doch meine Großmutter konnte nur schlecht verzeihen. Ihr Mann war als geistiger Krüppel mit einem schweren Hirntrauma heimgekehrt, erlitten durch eine Kopfverletzung. Für meine Großmutter stand fest, dass die Amerikaner, ein Volk per se, schuld daran waren, dass sie selbst keinen funktionstüchtigen Mann aus dem Krieg zurückbekommen hatte. Amerikanische Munition hatte ihn getroffen und zu dem gemacht, der er heute ist. Ein weiteres Kind, diesmal ein Mädchen, nämlich meine Mutter Gisela, hatten meine Großeltern zusätzlich zu ihren beiden Söhnen trotzdem noch hinbekommen. Schließlich waren von der Behinderung meines Opas nicht alle Körperteile betroffen. Und zu diesem Akt der Schöpfung bedurfte es nicht unbedingt hoher geistiger Kompetenz.
Dass meine Großmutter so wenig Verständnis aufbringen konnte für die Not ihrer sechzehnjährigen Tochter, hätte die beiden gewiss entzweit, wären sie sich vorher nahe gewesen.
Da sie aber auch in den vorangegangenen sechzehn Jahren keinen sonderlichen Draht zueinander hatten, fiel es kaum auf, dass sie von nun an kaum noch ein persönliches Wort aneinander richteten.
Als Kind habe ich meine Großmutter kennengelernt als diejenige, die Regeln aufstellte und streng, sachlich, mit verkniffenem Gesicht darauf achtete, dass sie eingehalten wurden.
Zieh beim Hereinkommen die Schuhe aus.
Setz dich so auf den Stuhl, dass dein Rücken die Lehne berührt.
Greif nicht mit den blanken Fingern nach dem Essen.
Füttre Opa nicht mit Pralinen.
»Gigi«, fragte ich als Vierjährige einmal (ich habe meine Mutter nie mit Mama oder Mutti angesprochen), »muss Oma auf dem Klo auch mal pupsen?«
Meine Mutter blickte mich einen Moment lang mit einer Mischung aus Schreck und Faszination an und platzte dann laut lachend heraus. Die arme Gigi. Sie wagte es nie, ihrer strengen Erziehung bewusst entgegenzuwirken. Aber sie wurde süchtig nach meinen kleinen, scheinbar kindlich unschuldigen Bemerkungen über Großmutter.
Ich hatte diese Vorliebe schnell heraus und wurde darin – Gigi zuliebe – sehr erfinderisch. Sie waren Gigis ganz spezielle Art der Rache, meine Erkenntnisse und Fragen zu Großmutters menschlichen Schwächen.
Zu Opa hatte Gigi ein ganz anderes Verhältnis. Sie war sehr liebevoll und zärtlich zu ihm. Was nicht schwerfiel, denn er nahm jede Zuwendung mit einem Leuchten in seinen himmelblauen Augen entgegen. Er liebte es, Bilderbücher anzuschauen und seine eigenen Geschichten dazu zu erfinden. Als Kind wunderte ich mich nie darüber. Opa war für mich kein Großvater, wie andere Kinder einen hatten. Diese mürrischen alten Männer, die an ihre Enkel nur dann ein Wort richteten, wenn es um Schulnoten ging, die beim Essen als Erste das Fleisch vorgelegt bekamen und als Süßigkeiten bestenfalls ein Eukalyptus-Hustenbonbon zur Verfügung stellten. Mein Opa war ein Spielkamerad, mein kleiner, manchmal auch großer Bruder, ein Komplize bei Streichen und der größte Bewunderer meiner selbst gemalten Bilder. Außerdem liebten wir beide Hasenwaffeln und Esspapier, richtig saure Brause und Eis mit Waldmeistergeschmack. Heute glaube ich, dass sein Kriegsunfall für ihn ein echter Glücksfall war. Er konnte sich an die Schrecken des Krieges nicht erinnern. Aus seinem tiefen Schlaf wachte er mit einem Lächeln auf und schreckte nie aus Albträumen hoch. Er stand nicht zur Verfügung für den Wiederaufbau, die Schweißarbeit, die Männermaloche. Er lebte sein Leben in der kleinen, überschaubaren Welt der Familie Jochheim. Er liebte seine Söhne als Kumpel, seine Tochter als kleine Schwester, seine Frau als Mutti, und Sex hatte er offenbar auch noch hin und wieder. Konnte sich ein Heimkehrender etwas Schöneres wünschen?
Manchmal saßen Gigi und er stundenlang auf der Terrasse und hielten sich einfach nur an der Hand.
Wir vier lebten also zusammen im eigenen Haus, das Opas Vater – mein Urgroßvater – gebaut hatte, bevor er mit seiner Frau und Opas älterem Bruder gleich zu Beginn des Krieges bei einem Großbrand ums Leben gekommen war.
Unser Zuhause liebte ich sehr und war der Meinung, es gebe keinen Ort neben der Zimmerstraßensackgasse, an dem ich lieber gelebt hätte.
Das Haus besaß zwei Stockwerke, kleine Räume und einen Keller, in dem es gemauerte Regale für die Winteräpfel und eine gemauerte Wanne für die eingekellerten Kartoffeln gab. Es roch erdig und immer ein wenig nach Rauch in diesem Haus. Wahrscheinlich deshalb, weil wir zur Unterstützung der teuren Ölheizung auch den kleinen Holzofen befeuerten, der entweder eine brüllende Hitze verströmte oder qualmte und alle Zimmer mit seinem würzigen Atem durchzog.
Großmutter kümmerte sich mit ein klein wenig Unterstützung von Opa (Bettenmachen), mir (Tischdecken, Abwaschen) und Gigi (abends Bügeln) beinahe allein um den kompletten Haushalt und den Gemüsegarten. Sie bereitete das Essen zu und kaufte ein, putzte Böden, Fenster und jeden Winkel, saugte die Teppichböden, bezog Betten neu, räumte Schränke ein, erledigte die Wäsche, hängte Gardinen ab und wieder auf, düngte die Beete und kochte das Obst von unseren verkrüppelten, aber üppig Früchte tragenden Bäumen in Gläser mit dicken roten Deckelgummis ein.
So wuchs ich auf in dem Glauben, dass Frauen in dieser Welt allein dastehen. Entweder sie hatten wie Großmutter kindlich verwirrte oder wie Gigi gar keine Männer an ihrer Seite.
War es da ein Wunder, dass ich mich so entwickelte, wie ich es tat?
Gigi hatte sich so sehr gefreut, ein kleines Mädchen zu bekommen! Sie war siebzehn, als ich geboren wurde. Und sie hatte sich vorgestellt, dass alles so werden würde wie in einem dieser tschechoslowakischen Märchenfilme. Sie würde mich verwöhnen und zärtlich umhegen wie eine Puppe. Ein hübsches, niedliches Mädchen wollte sie an mir haben, das sie in süße Kleidchen stecken und dem sie täglich eine neue Frisur ins lange, lockige Haar flechten würde.
Es stellte sich heraus, dass sie und Großmutter in dieser einzigen Frage tatsächlich einer Meinung waren und den gleichen Traum träumten.
Gigi nannte mich Cornelia, weil sie sich ausgedacht hatte, mich Nelli zu rufen. Eine Abkürzung, die selbst meine Großmutter gutheißen musste – auch wenn es deutlich amerikanisch klang.
Meine Großmutter kaufte rosafarbene Strampler, rosafarbene Decken, einen rosafarbenen Kinderwagen. Obwohl unsere Familie damals nicht viel Geld zur Verfügung hatte, gab es Schleifchen und Plüsch und Tüddel. Großmutter hatte sich vorgenommen, die Strafe, die sie Gigi zugedacht hatte, nicht auf das Kind zu übertragen. Daher stattete sie das Baby mit allem aus, was zur Verwirklichung des Prinzessin-aus-dem-Märchen-Traumes notwendig war. Und anfangs sah es auch so aus, als ginge dieser gemeinsame Wunsch in Erfüllung: Meine dunklen Haare lockten sich ganz nach Prinzessinnenart. Meine Augen waren groß, rehbraun und von dichten, langen Wimpern umrahmt. Rosa stand mir wunderbar.
Doch dann kam alles anders.
Ich. War anders.
So schlicht war es.
Zunächst fiel es niemandem auf. Wie auch? Ich war ein Säugling wie alle anderen auch. Ich schrie, ich machte in die Windeln, nuckelte an Fläschchen und wurde unter zuckersüßem Gesäusel von Arm zu Arm gereicht.
Doch dann zeigte es sich allmählich.
Laufen lernte ich schneller als andere Kinder.
Nicht das vorsichtige, wacklige Vorwärtsstolpern, bei dem die Füße nach einigen schmerzhaften Erfahrungen das Fallen nach vorn aufzufangen lernen.
Nein, ich lernte rasend schnell das Rennen. So wie das Gehen ein Vorwärtsfallen ist, ist das Rennen ein Vorwärtsspringen.
Ich sprang.
Über den Teppich, über die Wiese, von Punkt zu Punkt, über freies, weites Feld.
»Was habt ihr da für einen Wildfang!«, riefen Großmutters Freundinnen, nachdem sie mich mit dem kritischen Großmütterblick betrachtet hatten. »Die wird euch noch Probleme machen. Das sieht man doch jetzt schon.«
Gigi war gerade mal zwanzig und der Ansicht, dass nichts, was ich tat, je ein wirkliches Problem sein könnte.
Sie steckte mitten in ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau bei einem großen Elektrohersteller. Kurzschlüsse jeglicher Art, die ich zu Hause fabrizierte, konnten sie nicht schocken.
Sie war der Meinung, ich sei – unabhängig davon, dass ich schließlich ihre Tochter war – ein wunderbarer Mensch und war nicht erstaunt darüber, dass ich im Kindergarten von Anfang an Freunde fand.
Ich bin davon überzeugt, dass ihr unerschütterlicher Glaube an mich, ihre Bewunderung für jede kleine kindliche Heldentat mich nach und nach zu dem formten, was ein selbstbewusstes Kind genannt wird.
Das Wilde, das Ungezähmte, das aus meinen Augen blitzte, machten ihr keine Angst. Schließlich gab es auch temperamentvolle Prinzessinnen.
Doch eines Tages kam ich weinend aus dem Kindergarten nach Hause. Vor lauter Schluchzen und Brüllen verstand zunächst niemand ein Wort.
Großmutter kochte wie ein Hummer im Topf, wie immer, wenn sich etwas ihrer Kontrolle entzog.
Opa machte ein unglückliches Gesicht und bot mir zum Trost einen Schokoriegel an. Doch das war es nicht.
Gigi führte mich an der Hand hinüber in unser gemeinsames Zimmer und verschloss die Tür hinter uns.
Ich brüllte nur noch lauter.
Schließlich entnahm sie meinem Gestammel, dass ich Folgendes herausgefunden hatte: Mutige Kinder trugen kurze und Weicheier lange Haare. Meine rückenlangen schwarzen Locken standen dieser neuesten Erkenntnis zufolge also in krassestem Widerspruch zu meinem tatsächlichen Charakter. Eine Ungerechtigkeit, die mich in immer neue Tobsuchtsanfälle trieb.
Gigi besah sich kurz und gründlich die Bescherung, die eine Märchenprinzessin hatte werden sollen. Dann griff sie zur Papierschere auf dem Schreibtisch und schnitt mir die Haare eigenhändig immer kürzer – bis ich beim Blick in den Spiegel nicht mehr schrie, sondern die Augen auf sie richtete und lächelte.
Vielleicht hat es da angefangen.
Unsere Komplizenschaft.
Es hatte einen enormen Vorteil, eine junge Mutter zu haben: Gigi war beweglich.
Sie konnte mit mir nicht nur um die Wette rennen – selbst wenn sie, je älter ich wurde, immer häufiger verlor –, sondern ihre Gedanken auch in jede erdenkliche Richtung lenken, in die mein Geist sich entwickelte.
Für sie war alles ein kleines Wunder, was ich neu entdeckte. Jeder Streich war einzigartig. Jedes Wort, das ich lernte, sprach von meiner besonderen Begabung. Sie glaubte nicht, dass ich ein Wunderkind mit besonders hohem IQ sei. Sie glaubte nur daran, dass ich ein ganz besonderer Mensch sei. Jemand, der keine Fehler machen konnte, weil er aus dem tiefsten Grund seines Herzens heraus gut war.
Die Vorsätze, die sie für mich gefasst, die Träume, in denen sie meine Zukunft vorausgesehen hatte, warf sie über den Haufen, sobald sie merkte, dass dies alles für mich gar nicht passte.
Großmutter tobte.
Meine Haare sollten wachsen. Die Hosen sollten gegen Kleider ausgetauscht werden. Aber sie konnte sich nicht durchsetzen. Denn sosehr Gigi sich selbst auch immer wieder den mütterlichen Ansprüchen anpasste, so knallhart war sie, wenn es um meine freie Entwicklung ging.
Großmutter resignierte wie eine Dame: mit schmalen Lippen. Wenigstens spielte ich neben den wilden Renn- und Versteckspielen, zu denen meine Onkel und die Jungen aus der Nachbarschaft mich aufforderten, auch leidenschaftlich gern mit Puppen. Das stimmte Großmutter friedlich. Sogar die Tatsache, dass ich gemeinsam mit Opa dieses Puppenspiel zelebrierte, hieß sie gut. Bis sie eines Tages entdecken musste, dass in unserem Spiel Opa die Mama war, die zu Hause blieb, um die Puppenkinder zu hüten, während ich als Papa hinaus in die weite Welt zog, um das Geld zu verdienen oder mit Winnetou Bösewichter abzuknallen.
Außerdem bohrte sie aus Opa heraus, dass er einen Riesenspaß daran hatte, mit mir und den anderen Kindern aus der Nachbarschaft Robin Hood zu spielen. Opa liebte es, als König Löwenherz von den Kreuzzügen nach Hause zurückzukehren und seinen treuen Untertan Robin von Locksley (mich) fürstlich für seine Dienste zu entlohnen.
Da fasste Großmutter offenbar ein Misstrauen gegen meine Art, die Welt zu sehen, das sie nie wieder ablegen sollte und das vielleicht sogar seine Berechtigung hatte – zumindest, wenn jemand das Leben mit ihren Augen betrachtet.
Sie schob einen Riegel vor: »Es ist was anderes, wenn ihr hier miteinander spielt. Aber ich will nicht, dass Herbert wie ein Sechsjähriger durch die Büsche springt.«
Jedenfalls durfte Opa von da an nicht mehr mit mir in dem Waldstück hinter unserem Haus spielen.
Spaziergänge waren erlaubt.
Und Spaziergänge mit Opa waren wundervoll.
Irgendetwas musste bei ihm doch hängen geblieben oder nachhaltig wieder erlernt worden sein, sodass er in der Lage war, mir Dinge beizubringen, die sonst niemand zu wissen schien.
Zum Beispiel den Verlauf der Jahreszeiten, den er am Laub und am sprießenden Grün festmachte. Er konnte sämtliche Vögel des Waldes und die in unserem Garten auseinanderhalten, imitierte ihren Gesang und wusste zu jedem Tier die Farben des Gefieders von Weibchen und Männchen. Alle Bäume hatten bei ihm Namen. Blumen und Kräuter dufteten und ergaben einen Sinn an ihrem jeweiligen Standort. Er erklärte mir, wohin die Kraniche zogen, wieso sie bei ihrem langen Zug schrien und eine Eins als Formation bevorzugten. Käfer, Spinnen, Insekten waren eingeteilt in Jäger und Gejagte, Fresser und zu Fressende, fliegende, krabbelnde, laufende Mitgeschöpfe voller Leben, Wunder und Gefühl.
An diesen Krabbeltieren wurde mir klar, dass Opa zwar manchmal so wirkte, als sei er ein Kind, in Wahrheit aber einen viel weiteren Geist besaß: Ein kleiner Junge hätte vielleicht ausprobiert, wie es ist, einem Käfer ein Bein auszureißen, mit einem Stock in einem Ameisenhaufen herumzustochern, einen Regenwurm bis zum Zerreißen zu spannen. Opa tat so etwas nie. Er war zu allen Lebewesen, die ihm begegneten, freundlich und behandelte sie respektvoll.
Er war neben meiner Mutter Gigi, die mir Selbstvertrauen schenkte, mein zweiter großer Lehrer, denn er lehrte mich den Respekt vor dem Leben.
So staunte ich gemeinsam mit ihm darüber, wie Bucheckern auf und neben uns auf den Waldboden prasselten. Beide erschnupperten wir das höchste Dufterlebnis, wenn Regen auf die warme Erde fiel, das Moos sich entfaltete und alles nach Sommer und Leichtigkeit roch.
Großmutter und Gigi schienen sich über Opas umfassendes Wissen im Bereich der Natur nicht zu wundern. Und ich nahm es als Kind einfach hin, wie ein Kind Schönes eben hinnimmt, sich daran freut und keine Frage daran richtet.
Dadurch, dass ich sein Hobby teilte, kamen Opa und ich uns sehr nahe. Die Natur war unsere Verbindung, die nie abriss.
Er durfte mir alles erklären und sein Wissen an mich weitergeben. Zum Beispiel, dass Rotbuchen keine roten Blätter haben. Wenn ich eine Buche mit roten Blättern sah, dann war es eine Blutbuche.
Nur das Sammeln von Pilzen war uns nicht erlaubt. Obwohl Opa alle mit Namen kannte, die wir auf unseren Spaziergängen fanden. Er wusste genau, welcher davon lecker, welcher bitter und welcher tödlich giftig war. Ich vermutete, dass Großmutter seinem angeschossenen Hirn nicht mehr bis zum Letzten vertraute.
Eigentlich hätte ich mit Gigi und Opa an meiner Seite schon restlos glücklich sein können.
Doch dann tauchte irgendwann in meiner Grundschulzeit auch noch Susette auf.
Sie war die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Vollkommen anders als Gigis übrige Freundinnen, die selten etwas anderes taten, als kichernd große Zukunftspläne zu schmieden, die sich um ihre Karrieren als Sekretärin, Bürokauffrau oder Friseurin drehten. Diese Gespräche gipfelten meist im Ausmalen eines gewissen Details: Irgendwann würde ein wunderbarer Mann daherkommen und sie glücklich machen.
Worin genau dieses Glücklichmachen bestehen sollte, konnte auch Gigi mir nicht erklären.
Vielleicht wollte sie es auch nicht. Es war ihr schon in meinen Kleinkindzeiten zuwider gewesen, mich anzulügen.
Susette jedenfalls war eine Fammfatal, wie ich von Großmutter erfuhr.
Eine Frau also, an der ich mir auf keinen Fall ein Beispiel nehmen durfte. Bei Gigi war sowieso Hopfen und Malz verloren. Es war egal, mit wem sie sich herumtrieb. Aber mir wollte Großmutter den Weg zu Höherem ebnen – auch mit kurzen Haaren. Daher gab sie mir den dringenden Rat, mich in jedem Fall von Susette fernzuhalten.
Ich tat nur selten das, was Großmutter mir riet.
Susette war ein echtes Paket an Stärke und Energie. Sie hatte ihr Haar zu einem witzigen Bubikopf frisiert, schminkte sich die Augen, als wolle sie damit die Ringe imitieren, die Pfauen auf ihren Rädern tragen, und wenn sie mir einen Kuss auf die Wange drückte, blieb immer ein gewaltiger roter Mund auf meiner weichen Kinderhaut haften.
Den durfte niemand abwischen. Stattdessen stand ich lange vor Mamas Kommodenspiegel und betrachtete versunken den Abdruck von Susettes Lippen auf meinem Gesicht.
Meine Bewunderung für sie schweißte Gigi und ihre neue Freundin nur noch enger zusammen. Gigi liebte sowieso jeden, den ich liebte. Und ich liebte Susette von der ersten Begegnung an.
Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte Susette mir einen Ausflug ins Abenteuerland Fort Fun.
Und nicht nur das! Gigi und eine gute Freundin von Susette sollten auch mitkommen.
Es war ein heißer Tag. Um die überquellenden Abfalleimer schwirrten Schwärme von Wespen. Vor vielen Attraktionen gab es lange Warteschlangen. Aber davon ließen wir uns die Laune nicht verderben. Die drei Erwachsenen scherzten und lachten, gaben mir Eistüten und Sinalco aus und waren für jeden Spaß zu haben.
Ich fing so manchen halb neugierigen, halb neidischen Blick anderer Kinder auf, deren Eltern viel älter waren als Gigi und die ein wenig steif und sittsam die Kieswege entlangschritten, um dann und wann »He, nicht so schnell da vorne!« oder ähnlich Spaßbremsendes zu rufen.
Gigi, Susette und Susettes Freundin rannten mit mir gemeinsam zur nächsten Attraktion, kreischten in der Wildwasserbahn und versuchten, einander mit lautem Gebrüll auf der riesigen Sommerrodelbahn einzuholen.
Doch was die Stimmung am Ende doch ein wenig trübte, das war etwas ganz anderes.
Es war etwas, das ich mit meinen Kindersinnen erst viel zu spät bemerkte. Und da war es schon über uns hereingebrochen: Susettes Freundin hatte mit Tränen in den Augen unsere Pausenbank verlassen, auf der wir Bratwurst mit Pommes verspeisten. Sie war plötzlich aufgesprungen und einfach davongerannt. Nicht weit. Ich sah sie hinter einem Baum auf der angrenzenden Wiese stehen. Aber es reichte, um die gute Laune zu zerdeppern.
Gigi und Susette tauschten einen wissenden Freundinnenblick. Dann stand Susette auf und folgte ihrer Freundin.
Gigi stippte gedankenverloren eine Pommesstange in die Mayo.
»Was ist denn los?«, fragte ich, weil ich es von Susettes Freundin ziemlich blöde fand, uns das Mittagessen mit einem solchen Ausbruch zu vermiesen.
»Sie ist eifersüchtig«, erklärte Gigi mir und sah mich an. Ich kannte diesen Blick. Gigi war es zuwider, mir nicht alles sagen zu können, was sie wirklich dachte. Manchmal richtete sie daher diesen forschenden Blick auf mich, um zu entscheiden, ob meine kindliche Seele die gerade anstehende Wahrheit schon verkraften konnte. In solchen Situationen versuchte ich stets, möglichst erwachsen auszusehen – was in diesem Fall durch den Süßigkeitenschnuller um meinen Hals und die Kappe mit der Aufschrift I love Wild West erschwert wurde. Trotzdem schien Gigi zu der Ansicht zu gelangen, dass ich die Wahrheit verkraften könne.
»Susette und sie sind ein Paar. Verstehst du?«
Natürlich verstand ich. Ich war ja nicht blöd.
Nur hatte mir vorher noch nie jemand gesagt, dass auch zwei Frauen ein Paar sein können.
Ich tat so, als sei das für mich ein alter Hut, und zuckte die Achseln.
»Aber auf wen ist sie denn eifersüchtig? Etwa auf dich?«
Gigi nickte und suchte mit den Lippen den Strohhalm in unserer Gemeinschafts-Sinalco. »Sie hat Angst, dass Susette lieber mit mir zusammen sein will als mit ihr. Eben weil Susette und ich uns so gut verstehen. Und vielleicht auch deshalb, weil Susette dich so gern mag. Vielleicht denkt sie, dass Susette mit uns einen auf kleine Familie machen will.«
Wir sahen beide zur Wiese hinüber, auf der hinter dem ganzen Grünzeug zu erkennen war, dass Susette den Arm um ihre Freundin gelegt hatte und auf sie einredete.
Ich dachte daran, was Familie bedeutete. Familie, das waren für mich Gigi, Opa und Großmutter. In seltenen Ausnahmefällen, etwa zu einem besonderen Geburtstag, zählten auch Patrick und Christian dazu, meine beiden Onkel.
Als kleine Familie konnte ich mir also vermutlich ausschließlich Gigi, Susette und mich vorstellen.
Wir würden wahrscheinlich zusammenwohnen und jeden Tag miteinander zu Abend essen.
Vielleicht würde Susette auch anstelle meines Vaters, den ich nie kennengelernt hatte, zum Elternsprechtag gehen, wenn Gigi nicht konnte. Dann musste Großmutter das nicht tun und hätte somit auch nicht die Gelegenheit, mit meiner Lehrerin unangenehme Gespräche über die Sauberkeit meiner Schrift und die Ordnung in meinem Schulranzen zu führen.
»Vielleicht wäre das gar keine so üble Sache«, sagte ich aufgrund meiner kurzfristigen Überlegungen und schlug unschuldig die Augen auf. Natürlich sollte niemand auf den Gedanken kommen, ich fände diesen Vorschlag aus eigennützigen Gründen gut.
Gigi schaute etwas verdutzt drein. Dann lächelte sie.
»Das glaube ich dir, dass du das schön fändest. Die Sache ist nur die: Weder Susette noch ich sind auf diese Idee gekommen. Susette möchte mit uns gar keine Familie sein. Sie möchte einfach unsere gute Freundin bleiben.«
»Aber wieso weint Susettes Freundin dann? Wenn wir gar keinen auf kleine Familie machen wollen?«, wollte ich wissen. Das Ganze schien mir etwas sonderbar.
Gigi seufzte.
»Wenn man groß ist, kommt man eben manchmal auf echt dumme Gedanken«, erklärte sie.
Ich beschloss, mir diese Aussage gut zu merken, um sie bei passender Gelegenheit – wie zum Beispiel dem geforderten Zubettgehen um neun Uhr – als schlagkräftiges Argument in die Waagschale zu werfen.
Tatsache war: An diesem Tag im Fort Fun erfuhr ich zum ersten Mal, dass Frauen miteinander eine kleine Familie sein können. Ihr schlimmstes Problem dabei schien darin zu bestehen, ab und zu auf dumme Gedanken zu kommen. Und da diese neue Darstellung von Partnerschaft mit meinen bisherigen Erfahrungen der Männerlosigkeit Hand in Hand ging, machte ich mir weiter keine Gedanken zu dem Thema.
Das kam erst später wieder aufs Tapet.
Dafür umso doller.
Mein Taufname, somit der in meinem Pass, lautet Cornelia Jochheim. Ein normaler, durchschnittlicher Name, hinter dem sich alles (oder nichts) verbergen kann.
Genannt werde ich jedoch nicht Nelli, so wie Gigi es sich ausgedacht hatte, sondern David.
Ein ungewöhnlicher Name für ein Mädchen, eine junge und später immer älter werdende Frau.
Dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt so genannt wurde, hat drei miteinander korrespondierende Gründe.
Der erste liegt darin, dass ich als Kind also keine Prinzessin war. Hinter meinem Hang zu mutigem und wildem Verhalten standen viele meiner männlichen Spielgefährten deutlich zurück –sehr zum Bedauern ihrer Väter und nicht hirngeschädigter Großväter. Ich kletterte auf Bäume, verunglückte bei Seifenkistenrennen, nahm großen Hunden ihre Stöcke aus dem Rachen, fluchte, spuckte, schlug mit den Fäusten, übte mich im Steh-und-Weit-Pinkeln und trug meine Beulen und Schrammen (welche ich durch Unfälle bei Seifenkistenrennen und durch wenig verständnisvolle große Hunde sammelte) mit jener Würde und jenem Stolz, die nur einem echten Helden – Verzeihung, einer echten Heldin – gebührt.
Das allein hätte vielleicht dazu geführt, dass ichangesichts meines burschikosen Temperaments womöglich den lieblichen Teil meines Namens eingebüßt und nur noch Conni gehießen hätte.
Doch das Schicksal wollte es, dass bei der Einführung in die fünfte Klasse ein bemerkenswerter Zufall mir zu meinem tatsächlichen Rufnamen verhalf: Ein Cousin zweiten Grades, mir aufgrund unserer lässig gehandhabten Familienverhältnisse gänzlich unbekannt, wurde in die gleiche Stufe eingeschleust. Durch die Namensdoppelung geriet im Sekretariat etwas durcheinander, und die Kinder wurden vertauscht. Oder die Namen wurden vertauscht. So genau wusste das später niemand mehr herauszufinden. Tatsache war, dass Axel Jochheim in der 5a landete, in deren Klassenbuch ich veranschlagt war, und ich geriet im Strom der aufgeregten Schülerschar in die 5d, in der sich wiederum Axel hätte einfinden sollen.
In der 5a wurde das Versäumnis des falschen Vornamens mittels eindeutig möglicher Geschlechtsidentifizierung sogleich aufgedeckt. Axel konnte unmöglich Cornelia sein. Die zuständige Klassenlehrerin korrigierte den Eintrag im Buch, vergaß jedoch in der Aufregung der Einführung ihrer ersten eigenen Klasse prompt, diese Korrektur ans Sekretariat oder gar ins Lehrerzimmer weiterzugeben.
Der Klassenlehrer der 5d war zum damaligen Zeitpunkt Herr Wulff, der die eigentümliche Angewohnheit hatte, seine Schülerinnen und Schüler rein aus Scherzerei mit dem Nachnamen anzusprechen. Diese Eigenart wurde von der Schulleitung nicht gern gesehen und immer wieder kritisiert, doch sie schlug bei Wulff in so auffälliger Regelmäßigkeit immer wieder durch, dass sie ihm durchaus nicht mehr als Fahrlässigkeit, sondern eher als Willkür hätte angelastet werden können.
Sofern sich jemand beschwert hätte. Doch davon waren wir als Schüler weit entfernt. Zum einen hätten wir Winzlinge niemals gewagt, einen Lehrer zu kritisieren und uns über eine bestimmte Behandlung – wie sie auch ausfiele – zu beschweren. Zum anderen kam der alte Wulff bei uns super an. Wir fanden es spannend, vom Lehrer derart kumpelhaft nach alter Schule mit Umsteg, Meyer, Flörberg und so weiter aufgerufen zu werden, und machten begeistert mit.
So hieß ich am ersten Schultag nur Jochheim und ging happy über den coolsten Lehrer der Schule heim.
Am zweiten Schultag ging es bereits richtig zur Sache. Der Englischunterricht begann. Und da wir hierin von unserem Klassenlehrer Herrn Wulff unterrichtet wurden, bedeutete dies sicher eine Menge Spaß.
So war es auch, denn als Erstes durften wir uns für die Englischstunden einen englischen Namen aussuchen.
Jedes Kind konnte einen eigenen Vorschlag machen. Manchmal haute es damit hin. Meine Banknachbarin, Sandra Kipp, wollte unbedingt Nancy heißen wie die hübsche Tochter in Eine amerikanische Familie, und Peter Zerefsky bestand auf Gordon, weil irgendein englischer Fußballspieler so hieß. Bei anderen klappte es nicht so reibungslos, denn schließlich konnten Zafira (nach den Herrin-des-Dschungels-Comics) oder Flash (Andreas konnte selbst keine Auskunft darüber geben, woher er diesen Namen hatte) nicht als gute britische Anreden gelten. Aus Zafira wurde eine unglückliche Jill und aus Flash ein verlegener Patric.
Ich saß ziemlich in der Mitte des Klassenraums und hatte eine Weile Zeit, das Ritual des Vorschlagens, Akzeptierens oder Umbenennens der Namen zu beobachten.
Als die Reihe an mir war, schlug ich etwas atemlos Mary-Ann vor. So hieß die blonde, stets in Latzhosen steckende und mit leuchtenden Augen rennende Figur aus Die Waltons, die – wie ich insgeheim fand – meine Schwester hätte sein können.
Herr Wulff stutzte kurz, musterte mich unauffällig über seinen Brillenrand hinweg und spähte dann ins Klassenbuch.
Dort sagte ihm die Inschrift des Sekretariats im Grunde genau dasselbe wie seine Musterung meines Outfits. Das bestand wie üblich aus einer kurzen Hose, Turnschuhen und einem schlichten blauen Sweatshirt. Mein Dreimarks-Haarschnitt war nach der üblichen Mode kurz gehalten.
Dies alles summiert, veranlasste Herrn Wulff dazu, ein wenig mit den Lippen zu schmatzen, um ein amüsiertes Lächeln zu verbergen, und dann feierlich zu erklären, mein englischer Name für den Unterricht laute David!
Irgendwo im Klassenraum wurde verhalten gekichert. Ich selbst blickte bestimmt auch ein wenig verdutzt drein. Doch Lehrer war Lehrer. Englisch war Englisch. Und wenn David besser war als Mary-Ann, dann war es eben so.
Als bei einem – mir leider nicht näher bekannten – Gespräch im Lehrerzimmer etwa zwei Wochen später die Sprache auf die beiden entfernt miteinander verwandten Kinder in 5a und 5d kam, müssen Herrn Wulff ein paar Schuppen von den Augen gefallen sein.
In der nächsten Englischstunde erhielt ich eine offiziell klingende und mich äußerst verlegen machende Entschuldigung, die Klasse eine Runde Schokoschaumküsse, und es wurde feierlich erklärt, dass von nun anMary-Ann mein English-Lesson-Name sei.
Doch die ganze Geschichte amüsierte meine Klasse so sehr, dass ich von nun an meinen Spitznamen weghatte – und das nicht nur im Unterricht.
Gigi und Susette machten bei meiner Namensänderung gleich begeistert mit, als sie feststellten, wie viel Spaß ich an dieser kleinen Verdrehung der Tatsachen hatte.
Sogar Opa konnte sich der Neuerung nicht verweigern und schloss sich dem Trend mit der für ihn typischen Euphorie an.
Nur Großmutter nannte mich weiterhin Cornelia.
Der dritte Grund, weshalb mein ungewöhnlicher Rufname mir anhängt wie Pech und Schwefel, ist gewissermaßen eine geheime Information, die weiterzugeben ich eigentlich nicht berechtigt bin, weil ich sie genau genommen gar nicht wissen dürfte. Es gab und gibt ein gewisses Munkeln und Wispern, das nur hinter meinem Rücken weitergetragen und verbreitet wird. Es rankt sich um die Tatsache, dass Michelangelo eine Statue geschaffen hat, die vielen als der Inbegriff der Schönheit erscheint und die genau diesen Namen trägt.
Michelangelos David besitzt weiche, androgyne Gesichtszüge mit einem sinnlichen Mund und geschwungenen, vollen Lippen. Dazu wunderschönes, wahrscheinlich kräftiges, leicht lockendes Haar. Sein Körper strahlt Stärke, Ruhe und Eleganz aus und verführt geradezu zum Handausstrecken und Berühren. Diese weltbekannte Statue ist Sinnbild dafür, dass etwas Kleines, wenig Mächtiges – David – über Großes – Goliath – siegen kann.
Muss ich mehr dazu sagen?
Die fünfte Klasse führte nicht nur dazu, dass ich fortan einen für ein Mädchen ausgesprochen ungewöhnlichen Rufnamen trug, sondern sie brachte mich auch mit meinem besten Freund zusammen.
Henning.
Er saß mir in der Klasse gegenüber und fiel mir dadurch auf, dass sein Mäppchen ein aus Grundschulzeiten stammender, bereits verblassender Aufkleber von Willi zierte.
Willi, die dicke Drohne aus dem Zeichentrickfilm Die Biene Maja.
Zufällig war Willi auch mein Liebling in dieser Serie, und bald konnte ich feststellen, dass Henning diverse Überschneidungspunkte mit seinem Idol besaß: Er war etwas übergewichtig, er liebte Süßigkeiten, er war langsam, er sprach mit einer leicht näselnden, plärrigen Stimme, und er war sehr beliebt.
Auch wenn es allgemein heißt, dass dicke Kinder keine Freunde finden, so war es bei Henning vollkommen anders.
Er zog Menschen an wie ein Magnet. In kürzester Zeit war er der Liebling der kompletten Klasse, einschließlich Lehrerschaft.
Vermutlich lag es an seiner positiven Ausstrahlung. Er besaß große schwarze Augen, ein schelmisches olivfarbenes Gesicht und weiße Zähne, die besonders blitzten, wenn er den Mund aufriss, um sein ansteckendes Lachen anzustimmen.
Was das anging, war er schlimmer als ein Lachsack. Wenn Henning lachte, bog sich in null Komma nichts jeder, der sich in Hörweite aufhielt. Sein Lachen war so zuverlässig mitreißend, wie eine Prise Pfeffer in der Nase zum Niesen führt.
Da ich durch meine Aufgabe, für Gigi naive Bemerkungen über Großmutter zu erfinden, gut im Training war, hatte ich rasch heraus, was Henning lustig fand. Wir wurden zu einem Duo, wie es die Schule noch nie gesehen hatte: Ich brachte die Witze, Henning das Lachen.
Keine Party ohne uns!
»Kommen Henning und David auch?«, hieß es bei jeder Einladung zu einer Geburtstagsfeier. Und beim Nicken war die Zusage des Gastes sicher.
Henning und ich klebten zusammen wie Pech und Schwefel.
»Hast du eigentlich keine netten Mädchen in deiner Klasse?«, fragte Großmutter mich einmal, nachdem Henning und ich den ganzen Nachmittag über in der Garage gehockt und vergeblich versucht hatten, unsere Fahrräder zu frisieren.
»Eine ganze Menge«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
»Warum bringst du nicht mal eins von denen zum Spielen mit? Du hast doch diese wunderschöne Barbie, die sich bestimmt über eine Freundin freuen würde.«
Ich zog ein Gesicht. »Nur Babys spielen noch mit Barbies, Großmutter.«
Sie sah mich einen Augenblick lang skeptisch an und schüttelte dann den Kopf. »Stimmt. Ich vergesse immer, wie groß du schon geworden bist. Was spielst du denn, wenn du mit Mädchen in deinem Alter spielst, nachdem doch Puppen nicht mehr gefragt sind? Die schrauben doch nicht alle an Fahrrädern herum, oder?«
Ich zuckte die Achseln. »Och, wir spielen zum Beispiel Internat.«
»Internat?« Großmutter hob die Brauen.
»Ja, eine von uns ist die Lehrerin, und die anderen sind die Internatsschülerinnen. Wie bei Dolly, weißt du?«
Enid Blyton war Großmutter ein Begriff.
»Sogar Henning spielt dann eine Schülerin«, erzählte ich weiter und kostete es aus, mich der gefährlichen Klippe so dicht zu nähern.
»Tatsächlich? Macht es ihm denn nichts aus, ein Mädchen zu spielen?«, wollte sie verwundert wissen.
»Quatsch! Mädchen sind doch spitze!«, erklärte ich überzeugt.
Das war der Zeitpunkt, an dem Opa sich von der anderen Seite her einschaltete. »Wenn du sie nicht mehr brauchst, kann ich dann deine Barbie haben?«, fragte er höflich.
Großmutter stieß einen tiefen Seufzer aus.
Was ich Großmutter niemals erzählt hätte, war der tatsächliche Ablauf unserer Internatsspiele.
Henning und ich hatten ein paar Mädchen aus der Klasse davon überzeugen können, dass es in allen Internaten so ähnlich zuging wie in Mädchen in Uniform mit Romy Schneider.
Das hieß, dass so gut wie jedes Mädchen für jedes schwärmte.
Wir dachten uns ganze Lebensläufe zu den Figuren aus, die wir spielten. Ich war zum Beispiel ein adliges Fräulein, dessen Vater im Krieg verschollen war und das deswegen immer sehr traurig war. Henning war eine kleine persische Prinzessin, die irgendwann einmal das ganze Königreich würde regieren müssen. Andrea war die Tochter der Internatsleiterin. Pamela war ein bettelarmes Mädchen, das ein Stipendinium – oder wie das hieß – bekommen hatte, weil sie so schlau war. Susanne war eine junge Baroness und Evelyn das Kind einer steinreichen Mörderin. Außerdem hatten wir eine Menge Lebensläufe vorrätig. Falls mal ein weiteres Mädchen mitspielen wollte, konnte es ohne Schwierigkeiten einsteigen. Das Internatsspiel hatte einen besonderen Reiz, denn wir konnten ganz in die jeweiligen Rollen hineinschlüpfen. Es schwappte sogar bis in die Schule hinein. Dort schrieben wir uns mit unseren erfundenen Namen kleine Liebesbriefe, und wenn wir uns zu einem dieser besonderen Spielenachmittage trafen, endete alles meist in einer wilden Knutscherei.
Es gab dabei nur zwei Regeln: Niemals knutschten Henning und ich. Und niemals hatte ein anderer Junge als er Zugang zu unserer auserwählten Runde.
Henning, so sagten die anderen Mädchen, sei durch die enge Freundschaft mit mir so gut wie ein Mädchen. Dennoch rissen sie sich regelmäßig darum, mit der kleinen persischen Prinzessin auf dem Sofa zu landen.
Ich erzählte auch Gigi nichts von diesen Internatsabenteuern – obwohl ich sicher war, dass sie nichts dagegen gehabt hätte. Schließlich fand sie im Grunde alles, was ich tat und unternahm, lebens- und lobenswert.
Irgendwie hatte ich aber im Hinterkopf, dass Knutschen mit Mädchen eventuell auch eine Partnerschaft und demzufolge eine ganze Menge dummer Ideen zur Folge haben könnte, und wollte nicht, dass Gigi mich auf der Suche nach Hinweisen zu diesen intensiver beobachtete.
Wie alle Kinder hasste ich es, genau unter die Lupe genommen zu werden.
Ich wollte frei sein und meinen Spaß haben. Und da ich in der Schule gut mitkam und auch sonst keinen Ärger machte, haute es genauso hin.
Meine Großmutter triumphierte heimlich über ihre miesepetrigen Freundinnen, die Schlimmes für mich vorausgesagt hatten, und machte ein großes Geschiss um jede gute Note, die ich nach Hause brachte, und um jeden Auftritt in einem Schultheaterstück.
Gigi aber war nach und nach immer stiller geworden.
Da ich mit mir selbst und meinen aufwallenden Hormonen so viel zu tun hatte, fiel es mir zunächst nicht auf.
Aber irgendwann – vor meinem zwölften Weihnachtsfest – machten wir einen Einkaufsbummel.
Ich wollte in jedem zweiten Laden ein Geschenk für Henning, Susette, Großmutter, Opa, Onkel Patrick und Onkel Christian kaufen und in allen anderen etwas Schönes für Gigi und natürlich auch für mich selbst.
Als wir uns schließlich zur Mittagszeit erschöpft in einer kleinen Pizzeria niederließen, fiel mir auf, dass Gigi kaum etwas sagte und kummervoll aussah.
»Alles okay?«, fragte ich wie nebenbei und betrachtete ihre Hände, die nervös mit der Speisekarte spielten.
»Hm?«, machte sie und sah mich verwirrt an.
»Du bist so … anders«, sagte ich vorsichtig.
Gigi sah mich lange an. So lange, dass mir schon angst und bange wurde unter ihrem nachdenklichen Blick.
Ich überlegte, ob ich etwas ausgefressen haben könnte, das ich schon wieder vergessen hatte. Gewöhnlich war Großmutter für Rügen bei etwaigen Vergehen zuständig. Aber wer wusste schon, ob Gigi nicht auch mal über irgendeinen Streich sauer sein konnte?
Henning und ich hatten letzte Woche versucht, den Kaugummiautomaten am Tante-Emma-Laden in seiner Straße mit Spielchips zu betrügen. Aber es hatte nicht hingehauen. Der Automat war nur verstopft worden.
War es womöglich das, was Gigi bekümmerte?
»Im nächsten Jahr werde ich dreißig«, sagte Gigi schließlich und sah mich immer noch ernst an.
»Echt?«, staunte ich. »Schon?«
Sie lächelte und wandte endlich den Blick ab.
»Dreißig Jahre, und ich wohne immer noch in der Zimmerstraße.«
Ich war verwirrt. Was hatte unser Zuhause mit ihrem Alter zu tun?
»Wo sollst du denn sonst wohnen?«
»Na, in einer eigenen Wohnung. Nicht mehr mit Großmutter unter einem Dach, die ja doch nur ständig etwas an mir auszusetzen hat.« Für einen Moment sah sie mich wieder an, ihre Augen glänzten verräterisch. »Manchmal denke ich, dass ich kaum noch Luft zum Atmen finde. Alles ist so eng, so festgefahren, so alt und vorbestimmt. Sie kümmert sich um alles. Sie ist da, wenn du von der Schule nach Hause kommst. Sie kocht, sie wäscht, sie bügelt, sie kauft für uns ein. Ohne sie wäre das Leben für mich wesentlich anstrengender, weißt du? Du kriegst ja mit, wie die Arbeit mich oft schlaucht. Dann bin ich froh, dass ich nicht noch putzen und all das machen muss, wenn ich endlich daheim bin. Aber manchmal frage ich mich, ob der Preis für diese Bequemlichkeit nicht doch zu hoch ist. Ob es sich nicht doch lohnen würde, auf den ganzen Luxus zu verzichten und stattdessen lieber irgendwo Miete zu zahlen und dafür … ein eigenes Leben zu haben.«
Ich war beunruhigt. Ihre Worte klangen so, als wolle sie ausziehen. Als wolle sie frei und unabhängig sein, ohne Großmutter und Opa und … ohne mich.
Ich musste kräftig schlucken.
Antworten konnte ich nicht.
Wir schwiegen so lange, bis Gigi plötzlich ein steifes, künstliches Lächeln aufsetzte und mir die Hand tätschelte.
»Aber hab mal keine Angst. Ich weiß ja, wie wichtig dir das alles ist.« Sie wies mit dem Kopf auf die vielen Taschen und Tüten. »Das könnten wir uns nämlich nicht mehr leisten, wenn wir eine eigene Wohnung hätten, weißt du.«
Diesmal kam meine Antwort sehr rasch: »Wir? Du würdest mich mitnehmen?«
Gigi wandte den Kopf und starrte mich entgeistert an.
»Abernatürlich!« Sie griff nach meiner Hand. »O Gott, Schätzchen, du hast doch nicht gedacht, ich ginge ohne dich?!«
Ich schluckte wieder und konnte nicht verhindern, dass mir vor lauter Erleichterung ein paar Tränen die Wangen hinabliefen.
Gigi war bestürzt.
Sie kramte nach einem Taschentuch für mich, das ich verschämt und mit vorsichtigen Blicken zu den Nachbartischen entgegennahm.
Dann sah sie mir zu, wie ich mir leise und möglichst unauffällig die Nase putzte, und plötzlich trat ein wild entschlossener Ausdruck auf ihr Gesicht.
»Weißt du was?«, sagte sie. »Drauf geschissen!«
»Was?«, fragte ich verdutzt.
»Drauf geschissen!«, wiederholte sie lauter, ohne auf die irritierten Blicke vom Tisch nebenan zu achten. »Wenn ich schon so kreuzunglücklich bin, dass wir zwei uns so weit voneinander entfernen, und du denkst … dann ist es wirklich mehr als höchste Zeit! Deswegen frage ich dich jetzt ganz feierlich: Willst du mit mir zusammen in eine eigene Wohnung ziehen, auch wenn wir weniger Geld haben werden und du nicht mehr so viele schöne Sachen haben kannst?«
Ich kam mir vor wie bei einem Heiratsantrag.
»Ja«, lächelte ich.
Und dann mussten wir beide weinen.
Großmutter stand auf, ging zur Anrichte hinüber und wandte sich dann wieder um. Ihre Gesichtszüge hatten sich verhärtet.
Gigi und ich saßen am Tisch wie zwei Kinder, die eine Schandtat gebeichtet hatten und nun auf die Strafe warteten.
»So«, sagte Großmutter und stand sehr aufrecht. »So einfach stellst du dir das also vor. Und wie willst du das ganz allein schaffen? Eine Mietwohnung bekommst du nicht umsonst, weißt du. Und wer wäscht die Wäsche, wer kocht das Essen, wer putzt und saugt und … wer kümmert sich um das Kind?«
»Ich bin kein kleines Kind mehr«, warf ich mutig ein. »Ich kann meine Hausaufgaben allein machen in der Zeit, bis Gigi nach Hause kommt.«
»Mit einer Backofenpizza jeden Tag und in der Gesellschaft eines Küchenradios?«, spottete Großmutter.
Auf dieses Argument war Gigi vorbereitet. Wir hatten vorher alles genauestens besprochen.
»Ich habe schon mit Möller gesprochen«, sagte sie betont ruhig, aber mit zittriger Stimme. »Ich kann demnächst früher anfangen. Gleitzeit. Dann bin ich früher zu Hause und kann für uns beide kochen.«
Sie sah mich an, und ich lächelte ihr aufmunternd zu. Es war furchtbar zu sehen, wie sie sich von der mutigen Drauf-geschissen-Revolutionärin in ein ängstliches Kind verwandelte, sobald sie Großmutter gegenübersaß. Ich hätte mich gern vor sie gestellt und diesen kleinen Kampf für sie ausgefochten, denn ich hatte nicht halb so viel Schiss vor Großmutter wie sie. Aber natürlich gibt es einfach Dinge, die jeder selbst tun muss. Und das stand für Gigi gerade an.
»Und was die Miete angeht, gibt es bestimmt auch Wohnungen, die nicht so teuer sind. Susette hat erzählt, dass drüben im Westwohnpark noch Wohnungen frei sind. Sie sind zwar nicht riesig, aber billig, und für uns reichen sie«, fuhr sie nun fort.
Ich nickte bekräftigend dazu.
Doch Großmutter beachtete mich gar nicht.
Verächtlich stieß sie die Luft durch die Nase aus und verzog die Lippen zu einem dünnen Strich. »Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ihr lieber inmitten von diesem Gesindel lebt als hier bei uns … aber!«, sagte sie sehr laut, denn Gigi hatte bereits den Mund geöffnet, um etwas zu erwidern. »Aber! Ich halte euch nicht auf. Macht nur. Wir werden sehen, was ihr davon habt.«
Damit verließ sie den Raum.
Wir hörten, wie sie ins Bad ging, wo Opa in der Wanne saß, und geräuschvoll die Tür hinter sich schloss.
Gigi und ich sahen uns verstohlen an.
Wir hatten beide mit wesentlich mehr Widerstand gerechnet. Für alle möglichen Argumente und Forderungen hatten wir uns Erwiderungen überlegt.
Dass die Umsetzung unseres Plans nun so einfach gelingen sollte, machte uns beinahe misstrauisch.
Es stellte sich jedoch heraus, dass durchaus noch andere Probleme als nur eine knurrige Großmutter auf uns warteten.
Zunächst musste Gigi feststellten, dass der Westwohnpark tatsächlich keine geeignete Gegend für uns war. Sie selbst hätte über die schmuddelige Nachbarschaft mitsamt ihren unzähligen rotznasigen Kindern, betrunkenen Ehemännern, Müllbergen vor den Türen und eingeworfenen, notdürftig geflickten Fenstern hinweggesehen. Doch für mich sei das kein geeignetes Umfeld, fand sie.
Also mussten wir uns auf die Suche nach einem anderen Zuhause machen, das groß genug für zwei, gut in Schuss, nicht zu teuer war und das nicht zu weit entfernt von Gigis Arbeitsstelle lag.
Abend für Abend traten wir durch die unterschiedlichsten Wohnungstüren in Fuchsbauten oder Wohnklos, mit uns abschätzig musternden Vermietern, Zugtrassen vor dem Schlafzimmerfenster oder schlecht ziehenden Kohleöfen.
Ich war verblüfft, wie viele Wohnungen es geben konnte, in denen wir auf keinen Fall wohnen wollten.
»Du hast gar keine Zeit mehr«, beschwerte sich Henning nach etlichen Wochen, die ich so verbrachte. »Immer nur Besichtigung, Besichtigung. Und alles bloß, damit du am Ende irgendwo im Nordend sitzt und wir uns nachmittags gar nicht mehr sehen können.«
Er vermisste mich, das war klar. Wahrscheinlich fand er es auch blöd, dass wir durch meine dauerhafte Abwesenheit derzeit keine Nachmittage im Internat verbringen konnten.
»Denk doch einfach dran, dass wir ständig sturmfreie Bude haben werden, wenn Gigi und ich erst mal was gefunden haben. Das wird voll cool. Wart’s nur ab!«, beschwichtigte ich ihn.
»Jaja«, maulte mein bester Freund. »Vielleicht solltet ihr euch überlegen, einfach bei Eckberts’ einzuziehen. Die Oma ist doch gestorben.« Eckberts wohnten ein paar Straßen entfernt, quasi auf der Hälfte zwischen Henning und unserem bisherigen Zuhause. Evelyn Eckberts war im Internat die Tochter einer göttlich reichen Frau, die an ihr Geld nur deswegen gekommen war, weil sie bereits vier Millionäre geehelicht und dann recht bald über den Jordan geschickt hatte.
In Wahrheit waren ihre Eltern die Besitzer des größten, weil einzigen Bettengeschäftes unserer kleinen Stadt und ziemlich öde.
»Quatsch!«, sagte ich. »Wir können doch nicht einfach hingehen und ›Herzliches Beileid‹ sagen! ›Ach, übrigens: Können wir in Omas Wohnung ziehen?‹«
»Und wieso nicht?«, antwortete Henning.
Evelyn versprach, bei ihren Eltern ein gutes Wort für uns einzulegen.
Als Gegenleistung verlangte sie das Recht, bei den nächsten drei Internatsnachmittagen als Erste entscheiden zu dürfen, welche Spielpartnerin sie bekommen sollte. Die Not, in der Gigi und ich uns inzwischen befanden, war gar keine schlechte Verhandlungsbasis für eine solche Forderung. Offenbar hatte Evelyns erfundene Schwarze-Witwen-Mutter bereits auf sie abgefärbt.
Natürlich sprach nichts gegen ihren Wunsch. Evelyn war eine der hübschesten in unserer Klasse, und Henning rieb sich schon heimlich die Hände, denn es war sehr wahrscheinlich, dass Evelyn ihn als Internatsliebe auswählen würde.
Gigi staunte nicht schlecht, als Frau Eckberts kurze Zeit später bei uns anrief und vorschlug, ob man sich nicht zum näheren Kennenlernen auf einen Kaffee verabreden wolle. Nachdem doch die Kinder in die gleiche Klasse gingen und sich außerdem auch hin und wieder zum so harmonischen Spielen trafen.
Aufgewühlt kehrte Gigi von diesem Sonntagsnachmittagsplausch zurück.
»David!«, raunte sie mir zu und winkte mich ins Zimmer, in dem wir immer noch zu zweit schliefen.
Nachdem sie die Tür hinter uns geschlossen hatte, sagte sie feierlich: »Ich glaube, ich habe unsere Wohnung gefunden!«
»Was?«, tat ich erstaunt und lauschte ihrer Erzählung mit weit aufgerissenen Augen.
»Cool!«, sagte ich dann. »Ein Zimmer für jede von uns und ein Wohnzimmer?«
»Und eine kleine Küche. Viel Platz ist da nicht. Aber ein Tisch mit zwei Stühlen passt auf alle Fälle rein. Und wenn wir mal Besuch bekommen von Susette oder sonst wem … dann räumen wir einfach im Wohnzimmer alles zusammen. Und das Tolle daran ist, dass die Eckberts’ von sich aus auf uns zugekommen sind! Ist das nicht irre? Evelyn hat wohl mitbekommen, dass du in der Schule von unseren vergeblichen Besichtigungen erzählt hast.«
Gigi schwebte auf Wolke sieben. Und ich war mächtig stolz darauf, bei dieser Freude Vorschub geleistet zu haben. Ich beschloss, unser Kindergeheimnis für mich zu behalten.
Ich hatte gedacht, dass ich spätestens dann, wenn wir eine Wohnung gefunden hätten, wehmütig werden würde. Schließlich liebte ich das alte Haus in der Zimmerstraße. Hier war ich aufgewachsen, hier hatte ich immer gelebt und viele schöne Stunden verbracht.Aber seltsamerweise stellte sich diese erwartete Traurigkeit nicht ein. Ich freute mich auf das Neue, das Unbekannte, das … Freie.
»Ein paar Straßen weiter. Tzzz …«, wusste Großmutter zu der Neuigkeit zu sagen.
Opa half uns, unsere Sachen sorgfältig in Papier einzuschlagen und in Bananenkisten zu verpacken.
Am Ende hatten wir beinahe fünfzig Bananenkisten und ein paar Koffer, in denen Kleidung verstaut war.
»Das müssen die Bücher sein«, murmelte Gigi am Tag des Umzugs und betrachtete stirnrunzelnd die Stapel, die sich inzwischen in vier Stockwerken durch den langen Flur zogen.
Wir waren zu sechst beim Hinuntertragen und Einladen der Sachen in das gemietete Umzugsauto: Gigi, Susette, Susettes neue Freundin Anja, Henning, Opa und ich.
Großmutter weigerte sich, etwas zu tragen. Aber sie stand mit fest zusammengepressten Lippen in der Küche und kochte in einem großen Topf eine Gulaschsuppe für uns alle.
Nachdem unser Hausrat – einschließlich des Kleiderschranks, der Betten und einer Kommode – im LKW verladen war, machten wir Pause.
Niemand sprach.
Großmutter verbreitete eine Atmosphäre wie im Schloss der Schneekönigin.
Niemand traute sich, zu lachen oder einen Witz zu machen.
Mir fiel auf, dass Susette und Anja, die sonst oft Händchen hielten oder einen flüchtigen Kuss auf den Mund der anderen platzierten, sehr steif und ohne jeglichen Körperkontakt nebeneinander saßen.
Als unsere Teller geleert waren und nur noch ein paar Krümel von den aufgefutterten Brötchen kündeten, legte Gigi die Hände auf den Küchentisch.
»Vielen Dank …«, begann sie.
Doch Großmutter kam ihr zuvor. »Na, das fehlte mir noch, dass du jetzt eine Rede hältst, weil ich dich und meine Enkeltochter beherbergt habe. Undank ist der Welten Lohn, so sagt man doch, nicht? Und jetzt macht gefälligst, dass ihr wegkommt.«
Damit verließ sie die Küche und verschwand im Schlafzimmer.
Opa sah verwirrt aus.
»Eigentlich hatte ich sagen wollen: ›Vielen Dank für die Suppe!‹«, murmelte Gigi. Aber wir konnten sie alle gut verstehen. Und plötzlich breitete sich auf unseren Gesichtern ein Grinsen aus.
Und das hielt sich dort eine ganze Weile.
Bei Eckberts’ erwarteten uns bereits unsere neuen Vermieter mit einer Tochter, die ganz wild darauf war, Kartons in den ersten Stock zu schleppen.
Derweil wir die Kartons, die wir in der alten Wohnung hinuntergetragen hatten, hier wieder hinauftrugen und im Wohnzimmer stapelten, schufteten Susette und Anja in den Schlafzimmern und der Küche, werkelten an Anschlüssen herum, bauten die Betten und den Schrank zusammen.
Frau Eckberts versorgte uns mit Schnittchen, Kaffee und Kakao. Es war ein Gefühl wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.
Als in meinem Zimmer die Daunendecke mit dem so vertrauten gestreiften Bezug aufs Bett gezaubert wurde, als die Stehlampe, das kleine Bücherregal, der neu gekaufte Billigschreibtisch plus Drehstuhl alles immer mehr zu meinem Zimmer machten, war ich nahe am Weinen. Gut, dass Henning und Evelyn da waren. So musste ich mich zusammenreißen.
»Wenn du abends mal allein bist, weil deine Mutter ausgehen will, kannst du ruhig Bescheid sagen. Entweder du kannst dann zu uns runterkommen, oder ich darf zu dir hoch. Ist gar kein Problem!«, lächelte Evelyn mich an.
Das fand ich unheimlich nett.
Gigis und mein Leben schien sich plötzlich wie eine wunderbar weiche, bunte Decke vor uns auszubreiten, mit ausschließlich angenehmen Seiten.
Henning hatte super Laune, weil er jetzt nur die Hälfte des Weges würde laufen müssen, wenn er mich besuchen wollte. Und sogar Anja, Susettes neue Freundin, lachte und scherzte und schien keine einzige dumme Idee im Kopf zu haben.
Als ich abends im Bett lag, mit zwölf Jahren zum ersten Mal in einem eigenen Zimmer, saß Gigi noch eine ganze Weile auf der Matratze und hielt meine Hand.
»Jetzt wird alles anders«, sagte sie ruhig und sah auf mich herunter.
»Jetzt wird alles gut«, antwortete ich lächelnd.
Leider sollte vorerst nur Gigi Recht behalten.
Die nächsten Tage hatte sie sich freigenommen. Gemeinsam mit Susette räumte sie alle Kartons aus, hängte Bilder auf, rückte Möbel und arbeitete so viel, dass unsere Wohnung schon bald supergemütlich war.
Und dann begann der Alltag.
Ich erhielt an einem hübschen blauen Band einen Schlüssel für die Haustür, einen für die Wohnungstür und einen winzig kleinen für den Keller, in dem mein Fahrrad untergebracht war.
Das benutzte ich momentan nicht, denn obwohl wir bereits März hatten, war es noch höllisch kalt, und die Straßen waren immer wieder verschneit und rutschig.
Außerdem begleitete mich Evelyn zur Schule.
Sie schien völlig aus dem Häuschen zu sein, eine Klassenkameradin Tür an Tür wohnen zu haben, und erzählte jedem, der es wissen wollte, dass wir nach der Schule auch gemeinsam nach Hause gingen.
»Ich find sie echt nett«, bemerkte Henning betont nebensächlich und richtete es so ein, dass Evelyn auf dem Heimweg zwischen uns ging.
Natürlich war das Leben zu zweit für Gigi und mich eine gewaltige Umstellung.
Wenn ich nach der Schule in unsere Wohnung kam, war es dort seltsam still und kalt.
Ich drehte das Radio an und die Heizung hoch und pfiff allein eine Melodie, während ich Hausaufgaben-Position am ersten eigenen Schreibtisch bezog.
Alles war anders. Das stimmte.
Kein Opa, der darauf wartete, dass ich endlich mit den Aufgaben fertig wäre, damit ich mit ihm ein bisschen Zeit verbrächte.
Keine Großmutter, die über meine unordentliche Schrift meckerte oder sich über die Zwei im Englischtest freute.
Irgendwann kam Gigi aus dem Büro nach Hause gehetzt, warf ihre Klamotten in die Ecke und stellte sich sofort an den Herd.
Sie hatte sich vorgenommen, viele gesunde Gerichte zu kochen und sich auf keinen Fall auf Tiefkühlkost zu verlegen. Das hielt sie auch tatsächlich ein paar Wochen lang durch.
Wenn sie mit dem Kochen fertig war, aßen wir und spülten gemeinsam ab. Sie war sehr bemüht, Neuigkeiten aus der Schule zu erfahren, über meine Erzählungen angemessen zu lachen, zu staunen oder sich mit mir zusammen zu ärgern. Ich spürte, dass sie aufholen wollte, was ich ihrer Meinung nach in den Stunden des Alleinseins vermisst haben musste.
Danach war sie viel zu kaputt, um noch irgendetwas zu tun.
Wir hingen also vor dem Fernseher, sahen populäre Sendungen wie Disco mit Ilja Richter, knisternde Krimis von Edgar Wallace oder Heimatfilme, über die wir genüsslich spotteten, in deren Verlauf wir uns aber dennoch hin und wieder gegenseitig die Taschentücher reichen mussten. Aktenzeichen XY ungelöst war mir entschieden zu real. Dann saß ich lieber in meinem Zimmer, hörte im Radio Mel Samuels Hitparade, las Britta siegt auf Silber und Geheimagent Lennet oder schrieb Tagebuch.
Es war sehr geruhsam.
Es war sehr ruhig.
»Es ist wie in einer Gruft«, nannte Susette es bei einem ihrer Besuche.
»Du gehst nicht mehr raus, du verabredest dich nicht mehr. Ich glaube, du wolltest sogar mir heute lieber absagen. So kann das nicht weitergehen.«
Das war eine Bemerkung, über die Gigi sonst nur geseufzt hätte.
Aber in den letzten Wochen hatte sie sich verändert. Sie war nicht mehr traurig, still, in sich gekehrt. Sie war nervös und unruhig geworden.
Jetzt lief sie auf und ab und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht.
»Ich bin einfach total erschossen. Die ganze Hausarbeit, das frühe Aufstehen. Das muss sich erst mal richtig einpendeln.«
»Dann pass nur auf, dass sich nichts Falsches einpendelt. Du bist doch nicht in eine eigene Wohnung gezogen, nur um sie auf keinen Fall mehr zu verlassen – außer für die Arbeit. Warum isst du zum Beispiel nicht in der Kantine? Das würde dir viel Arbeit und Mühe ersparen. Es ist ungesund, den ganzen Tag nichts zu essen und sich dann abends im Stress den Bauch vollzuschlagen«, meinte Susette.
Gigi blieb vor dem Fenster stehen, sah jedoch nicht hinaus, sondern warf mir einen Seitenblick zu. Ich tat so, als wäre ich in mein Vokabelheft vertieft, mit dem ich mich zu den beiden ins Wohnzimmer gesetzt hatte.
»Du weißt, dass die Kantine nicht praktikabel ist«, sagte sie dann eindringlich zu Susette und nahm ihren Tigergang im Zimmer wieder auf.
»Wieso nicht? Du könntest vorkochen, und David macht sich das Essen dann mittags portionsweise warm. Das ginge doch, oder?«
»Klar«, sagte ich und vergaß, dass ich eigentlich so getan hatte, als hörte ich nicht zu.
Aber der Vorschlag schien Gigi auch nicht zu trösten.
Sie ließ sich aufs Sofa fallen, auf dem auch Susette saß, und schien in tiefe Grübeleien zu versinken.
Eine ganze Weile gab sie nichts von sich.
Dann hörte ich sie deutlich schlucken.
»Sie hat noch nicht einmal angerufen«, sagte sie.
Susette schnaubte. »Die altbewährte Zermürbungstaktik. Trotzdem ist sie durch deinen Vater immer auf dem Laufenden. Den kann sie ja prima vorschicken. Und immer, wenn ihr mit ihm telefoniert, weiß sie auch gleich, wie es euch hier geht.«
Sie sprachen über Großmutter.
Das wunderte mich.
Denn mit mir sprach Gigi überhaupt nicht über Großmutter. Kein einziges Wort. So als wären wir durch unseren Umzug in eine andere Welt gelangt, in der es Großmutter nicht gab.
Gigi atmete rasch, als rege das Thema sie furchtbar auf. »Mich trifft es ja gar nicht, dass sie nicht wissen will, wie es mir geht. Viel schlimmer finde ich, dass sie so gar kein Interesse zu haben scheint an …« Wieder der rasche Blick zu mir, den ich spürte, auch wenn ich sie nicht ansah. Gigis Blicke spürte ich immer.
»Unsinn!«, erwiderte Susette energisch. »Natürlich hat sie Interesse. An euch beiden! Ich wette, sie platzt vor Neugier. Aber sie darf es nicht zugeben, um das Gesicht zu wahren.«
Doch Susettes Worte erreichten nur mich.
Gigis Miene hatte sich versteinert.
Auch wenn Susette der Meinung war, Großmutter platze mittlerweile vor Neugierde, war die Einzige, die jetzt platzte: Gigi.
»Es läuft wieder auf die alte Schiene hinaus!«, sagte sie laut. Ihre Stimme klang schrill. »Immer schon hat sie mir die Schuld zugeschoben dafür, dass unser Verhältnis nicht gut war. Das mit Greg damals kam ihr gerade recht. Und der Umzug kommt ihr auch recht. Jetzt kann sie wunderbar mir die Schuld daran geben, dass sie und ihr Enkelkind keinen Kontakt mehr haben. Ich soll schuld sein an allem. Dabei kann ich am allerwenigsten etwas dazu, dass sie Papa das halbe Hirn weggeschossen haben.«
Ich sah erschrocken vom Vokabelheft auf. Solche Ausbrüche kannte ich von Gigi nicht.
Susette starrte Gigi einen Augenblick lang an. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Du irrst dich bestimmt. Ich bin sicher, dass sie das nicht so sieht. Bestimmt …«
»Du kennst sie nicht!«, rief Gigi und brach plötzlich sturzartig in Tränen aus. »Natürlich sieht sie das so. Ganz genau so sieht sie es!«
Susette rutschte auf dem Sofa näher zu Gigi, legte den Arm um sie und zog sie eng an sich. Gigi schluchzte durch die Hände, hinter denen sie das Gesicht verbarg. »Das hat ihn vertrieben. Vielleicht wäre er bei mir geblieben. Vielleicht hätte ich das nicht alles allein durchmachen müssen. Aber sie hat ihn vergrault mit ihrer vertrockneten Art und ihrer Biestigkeit. Sie ist schuld, dass ich allein bin!«
»Du bist so komisch«, bemerkte Evelyn kurze Zeit später, als wir mal wieder zu dritt zur Schule gingen.
Henning zog ein bisschen den Kopf zwischen die Schulterblätter. Ich hatte ihm erzählt, was bei uns zu Hause passiert war. Dass Gigi Großmutter die Schuld an allem gab. Und dass Großmutter Gigi die Schuld an allem gab.
Mein Vater war wahrscheinlich abgehauen, weil Großmutter ihn vergrault hatte. Und wenn Großmutter und sie sich nicht wieder versöhnen würden, würde Gigi – trotz neuer Wohnung – weiterhin kreuzunglücklich bleiben, und ich würde Opa vermissen, bis meine Seele nur noch ein verkümmerter kleiner Schrumpelhaufen wäre, etwa so groß und aktiv wie eine Rosine.
Natürlich hatte ich Henning davon erzählt. Aber dass Evelyn etwas von meinem Kummer mitbekäme, damit hatte ich nicht gerechnet.
Als ich zwei bis drei Minuten lang beharrlich nicht geantwortet hatte und Henning trotz seiner stets leicht gebräunten Haut rot wie eine Tomate geworden war, beschloss Evelyn offenbar, meine Schweigsamkeit zu respektieren.
»Was haltet ihr davon, wenn wir die anderen anrufen und fragen, ob sie Lust aufs Internat haben?«, schlug sie anstelle von weiterem Bohren vor.
Sie wollte mich tatsächlich aufheitern.
Ich war gerührt und sagte sofort zu.
Henning bemühte sich, seine Begeisterung zu verbergen, was ihm nur mäßig gelang.
Noch bevor einer von uns sich an die Hausaufgaben setzen konnte, organisierten wir eine Telefonkette. Alle versprachen zu kommen.
Nun konnten wir uns zum ersten Mal in einer Wohnung ausbreiten, die uns ganz allein zur Verfügung stand.
Von Gigi hatte ich die ausdrückliche Erlaubnis, Freundinnen zu uns einzuladen, auch wenn sie selbst nicht daheim war.
Die seltsam prickelnde Vorfreude, die mich immer dann erfasste, wenn wir Internat spielten, ergriff diesmal schon Besitz von mir, als noch niemand eingetrudelt war.
Ich kramte zwei Tüten Salzstangen und eine Tafel Schokolade aus dem Schrank, arrangierte Saft und Gläser auf einem kleinen Tablett.
Früher als erwartet klingelte es an der Wohnungstür.
Es war Evelyn.
»Du bist die Erste«, sagte ich und ließ sie herein.
»Echt?«, erwiderte sie gespielt verwundert und sah sich um.
Wir lachten beide etwas verlegen.
Dann stellten wir uns ans Fenster und blickten gemeinsam hinaus, um zu beobachten, wer als Nächstes käme.
Wir spielten noch nicht.
Wir waren ganz wir selbst.