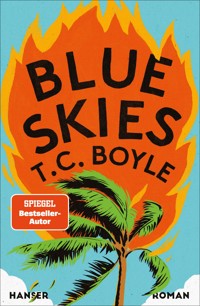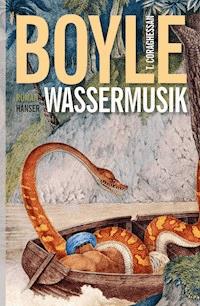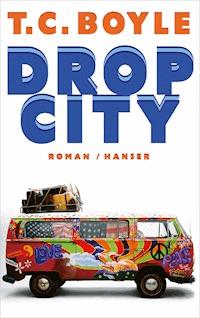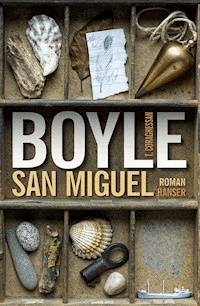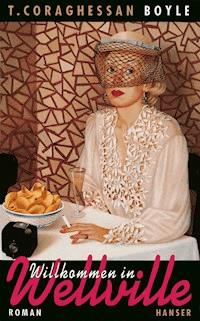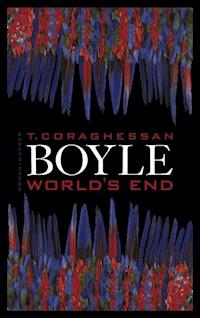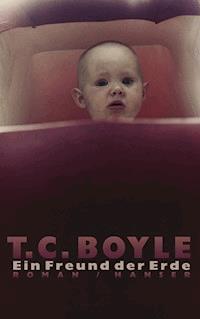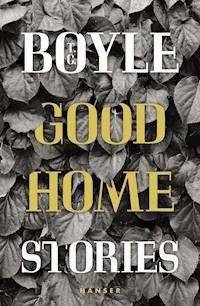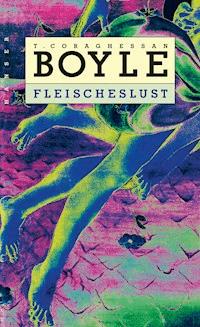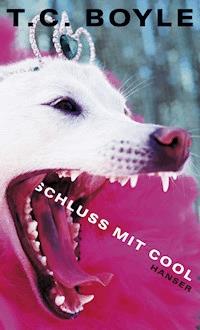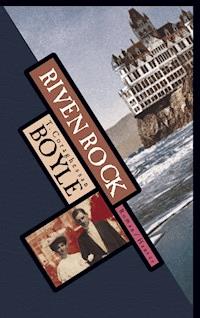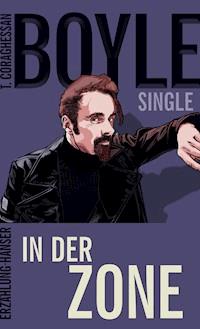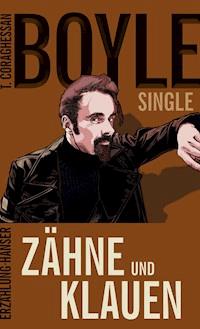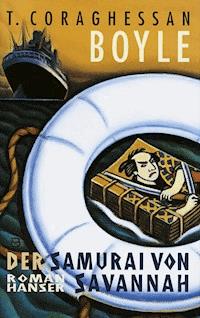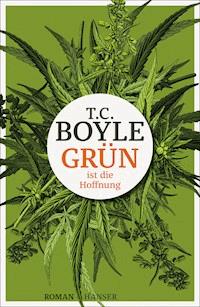Hanser E-Book
T. Coraghessan Boyle
Talk Talk
Roman
Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren
Carl Hanser Verlag
Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel Talk Talk bei Viking in New York.
ISBN-13: 978-3-446-24660-7
© T. C. Boyle 2006
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München Wien 2006/2014
Die Erzählung “La Conchita” ist dem Band „A death in Kitchawank” entnommen, der im Frühjahr 2015 in der deutschen Übersetzung von Anette Grube beim Hanser Verlag erscheinen wird.
© der Originalausgabe: 2013 by T. Coraghessan Boyle
© der Übersetzung: 2014 Carl Hanser Verlag München
2. E-Book-Auflage 2017
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Für Russell Timothy Miller und im Gedenken an Jack und Geraldine
DANKSAGUNG
Ich danke Marie Alex, Jamieson Fry, Susan Abramson und Linda Funesti-Benton für ihren Rat und ihre großzügige Hilfe.
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Mit Ausnahme der Passagen, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, habe ich nicht versucht, die Gebärdensprache wörtlich in die Lautsprache zu übersetzen, wie es andere Autoren auf bewundernswerte Weise getan haben, sondern Gehalt und Bedeutung der Gebärden in einen gesprochenen Dialog übertragen.
VORBEMERKUNG DES ÜBERSETZERS
Talk talk, Ausdruck aus der Amerikanischen Gebärdensprache (ASL), in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) »gebärden«, bedeutet ein entspanntes Gespräch unter Gehörlosen mittels Gebärden.
Wir sind unsere Sprache, aber unsere wirkliche Sprache, unsere eigentliche Identität liegt in der inneren Sprache, in jenem unablässigen Strom, jenem ständigen Hervorbringen sinnhafter Zusammenhänge, das den individuellen Geist bestimmt.
L. S. Wygotski: Denken und Sprechen
Der Menschen Sprache lernte ich und zwängte die Gedanken Ins steinige Idiom des schalen Hirns... Des Wollens Worte lernte ich und hatte mein Geheimnis; Auf meiner Zunge lag der Code der Nacht; Was eins gewesen war, sprach nun mit vielen Stimmen.
Dylan Thomas: From love’s first fever to her plague
INHALT
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Epilog
La Conchita
ERSTER TEIL
EINS
Sie war spät dran, sie war immer spät dran, es war einer ihrer Fehler, das wußte sie, aber dann konnte sie ihre Handtasche nicht finden, und als sie sie endlich gefunden hatte (am Garderobenständer im Flur, unter der dunkelblauen Kordjacke), mußte sie die Schlüssel suchen. Die hätten in der Tasche sein sollen, aber da waren sie nicht, und so drehte sie eine Runde durch die ganze Wohnung –zwei Runden, drei –, bevor sie auf den Gedanken kam, in den Taschen der Jeans nachzusehen, die sie gestern getragen hatte, aber wo war die? Keine Zeit für Toast. Kein Toast, kein Frühstück. Sie hatte keinen Orangensaft mehr. Keine Butter, keinen Frischkäse. Die Zeitung auf der Fußmatte war nur ein weiteres Hindernis. Pißwarmer – war das ein angemessenes Wort? Ja! – pißwarmer Kaffee aus einem fleckigen Becher, eine kurze Überprüfung von Frisur und Lippenstift im Rückspiegel, und dann ließ sie den Wagen an und setzte zurück auf die Straße.
Ein Lieferwagen kam ihr entgegen, und vielleicht hinterließ er einen flüchtigen Eindruck, ebenso wie der Hund, der an einem dunklen Fleck auf dem Bürgersteig schnupperte, oder ein Rasensprenger, der das Licht in einem Schimmern aus durchscheinenden Perlen einfing, doch das unaufhörliche Vibrieren des Adrenalins – vielleicht waren es auch die Nerven oder sonst irgendwas – ließ nicht zu, daß sie das alles wirklich wahrnahm. Außerdem blendete sie die Sonne – wo war ihre Sonnenbrille? Sie hatte sie doch noch auf dem Schreibtisch gesehen, mitten in einem Durcheinander aus Halsketten und Ohrringen – oder auf dem Küchentisch, neben den Bananen, und sie hatte noch überlegt, ob sie eine Banane mitnehmen sollte, Fast food, Kalium, Kohlehydrate, hatte dann aber doch keine eingesteckt, denn bei Dr. Stroud war es besser, gar nichts im Magen zu haben. Luft. Luft allein würde genügen.
Losstürzen, sich hetzen, sich aufreiben – Wörter mit germanischen Wurzeln und dieser traurigen Konnotation. Sie dachte nicht klar. Sie war gestreßt, sie war übermäßig gestreßt, sie war spät dran. Aber als sie am Ende des Blocks an die Kreuzung mit dem Stoppschild kam, hatte sie das Gefühl, doch noch ein bißchen Glück zu haben, denn es war niemand in Sicht, für den sie hätte halten müssen – doch als sie tat, als würde sie bremsen, mit einem routinierten Tippen aufs Gas in den zweiten Gang hinunterschaltete und über die Kreuzung fuhr, sah sie den parkenden Streifenwagen im dunkelvioletten Schatten eines Geländewagens.
Für einen Augenblick stand die Zeit still. Der Polizist saß starr am Steuer seines Wagens, sie warf ihm einen hilflos entschuldigenden Blick zu, und dann war sie auch schon an ihm vorbei und verfluchte sich selbst, als sie sah, daß er träge wendete und die Blinklichter auf dem Dach einschaltete. Mit einemmal nahm sie die Welt als Ganzes wahr: die Palmen mit ihren Ananasstämmen und den sich abschälenden Röcken, die stachlig aufragenden Yuccas, die sich die Hügelflanke hinaufarbeiteten, gelbe Felsen, rote Felsen, einen anthrazitgrauen Pick-up, dessen Fahrer langsamer fuhr, um ihr einen neugierigen Blick zuzuwerfen – sie hatte inzwischen auf dem erdbraunen Seitenstreifen gehalten –, rechts unterhalb von ihr war der Hang mit den Ziegeldächern, in der Ferne die blaue Verheißung des Pazifiks. Keine Eile jetzt, überhaupt keine Eile mehr. Sie sah im Außenspiegel, wie der Polizist seine Tür öffnete, den Gürtel hochzog (das taten sie alle, als wäre dieser Gürtel mit dem Reizgasspray, den Handschellen und dem harten schwarzen Revolver die einzig nötige Legitimation) und mit steifen Schritten zu ihrem Wagen kam.
Sie hatte Führerschein und Zulassung in der Hand und bot sie ihm dar wie eine Opfergabe, doch er nahm sie nicht, noch nicht. Er sagte etwas, sein Kiefer bewegte sich, als kaute er auf einem Stück Knorpel, aber was sagte er? Es war nicht Führerschein und Fahrzeugpapiere, aber was war es dann? Ist das da oben die Sonne? Was ist die Wurzel aus hundertvierundvierzig? Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Ja, das war es. Und sie wußte es. Sie hatte ein Stoppschild nicht beachtet. Weil sie so in Eile war – in Eile, zum Zahnarzt zu kommen, ausgerechnet – und weil sie spät dran war.
»Ich weiß«, sagte sie, »ich weiß, aber... aber ich hab runtergeschaltet...«
Er war jung, dieser Polizist, nicht älter als sie, ein Gleichaltriger, ihre Generation, im Velvet Jones oder in einem anderen Club an der State Street hätte sie neben ihm – oder mit ihm – tanzen können. Seine Augen waren zu groß und standen vor wie bei einem Boston Terrier – wie war noch mal der Fachausdruck dafür? Exophthalmus. Trotz der vertrackten Situation verspürte sie kurz eine warme Befriedigung. Aber der Polizist... Zusammen mit den wäßrigen, weinerlichen Augen verlieh das weiche Kinn seinem Gesicht etwas Unfertiges, als wäre er gar kein Gleichaltriger, sondern ein Bürschchen, ein Jüngelchen mit einem zu großen Kopf, das sich, herausgeputzt mit einer geschniegelten Uniform, zum Vertreter der Staatsgewalt aufwarf. Sie sah, wie sein Ausdruck sich veränderte, als sie sprach, aber daran war sie gewöhnt.
Er sagte noch etwas, und diesmal erriet sie es gleich und reichte ihm den laminierten Führerschein und die Zulassungskarte, und im selben Augenblick rutschte ihr die Frage heraus, was denn eigentlich los sei, obwohl sie wußte, daß ihr Gesicht sie verraten würde. Wenn sie jemanden etwas fragte, zog sie immer die Augenbrauen zusammen und sah dann vorwurfsvoll oder gar wütend aus – sie hatte versucht, das abzustellen, allerdings ohne großen Erfolg. Er trat einen Schritt zurück und sagte noch etwas – vermutlich, daß er zu seinem Wagen gehen, die Standardüberprüfung ihrer Papiere vornehmen und den Standardstrafzettel ausstellen würde, weil sie ein Standardstoppschild überfahren hatte –, aber diesmal hielt sie den Mund.
In den ersten paar Minuten merkte sie gar nicht, daß die Zeit verging. Sie dachte nur daran, was sie das kosten würde, an die Punkte im Verkehrssünderregister, den Aufschlag bei der Versicherung – war das mit dem Strafzettel für zu schnelles Fahren letztes oder vorletztes Jahr gewesen? – und daran, daß sie jetzt unweigerlich zu spät kommen würde. Zum Zahnarzt. Das alles nur wegen dem Zahnarzt. Und wenn sie zu der Behandlung, die mindestens zwei Stunden dauern würde – das hatte man ihr, zur Vermeidung von Mißverständnissen, schriftlich mitgeteilt –, zu spät kam, würde sie nicht rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in der Schule sein, und niemand würde sie vertreten. Sie überlegte, wie sie das Problem des Telefonierens lösen könnte – wahrscheinlich müßte die Sprechstundenhilfe das übernehmen, aber dennoch: Was für ein Theater! Warum dauerte das so lange? Am liebsten hätte sie sich umgedreht und einen vernichtenden Blick auf die gleißende Windschutzscheibe geworfen, aber sie beherrschte sich und senkte die linke Schulter, um in den Außenspiegel zu sehen.
Nichts. Sie erkannte nur eine Gestalt, die Gestalt des Polizisten, ein massiger Schatten mit gesenktem Kopf. Sie sah auf die Uhr im Armaturenbrett. Seit zehn Minuten saß er jetzt schon in seinem Wagen. Sie fragte sich, ob er lernbehindert war, ein Legastheniker, einer, der sich nur schlecht an den Paragraphen erinnerte, gegen den sie verstoßen hatte, der den Bleistiftstummel mit ungeschickten Fingern hielt und besonders fest aufdrückte, wegen des Durchschlags. Ein Dussel, ein Trottel, ein Schwachkopf. Ein Neandertaler. Sie ließ das Wort über ihre Zunge rollen, Silbe für Silbe – Ne-an-der-ta-ler –, und betrachtete im Rückspiegel die Bewegungen ihres Mundes.
Sie dachte an den Zahnarzt, diesen unermüdliche Plauderer mit Augenbrauen, die über sein Gesicht zu kriechen schienen, wenn er sich über sie beugte, und der offenbar gar nicht merkte, daß sie nur mit Grunzern antworten konnte, weil die Wattebäusche ihre Zunge behinderten und der Absaugschlauch an der Lippe zerrte, als die Tür des Polizeiwagens blitzend aufschwang und der Polizist ausstieg. Etwas war nicht in Ordnung. Seine Körpersprache war verändert, ganz und gar verändert: Die Beine waren nicht mehr steif, er hatte die Schultern nach vorn gezogen, und seine Schritte wirkten übertrieben vorsichtig. Sie sah in den Rückspiegel, bis das Gesicht des Mannes ihn ganz ausfüllte – sein Mund war hart und schmal, die zusammengekniffenen Augen blickten unsicher –, und dann wandte sie ihm den Kopf zu.
Das war der erste Schock.
Er stand drei Schritte von ihrer Tür entfernt, zielte mit dem Revolver auf sie und sagte irgendwas über ihre Hände – er bellte sie an, sein Gesicht war wutverzerrt –, und er mußte es mehrmals wiederholen und wirkte immer wütender, bis sie endlich verstand: Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann!
Zuerst hatte sie vor lauter Angst nichts sagen können. Sie hatte stumpf gehorcht, eingeschüchtert von der elementaren Gewalt des Augenblicks. Er hatte sie, noch immer den Revolver in der Hand, aus dem Wagen gezerrt, ihr Gesicht an das heiße Blech und Glas gepreßt, ihre Arme auf den Rücken gedreht, um ihr die Handschellen anzulegen, sich mit seinem ganzen Gewicht gegen sie gelehnt und mit dem Amboß seines Knies ihre Beine auseinandergedrückt. Dann hatte er sie abgetastet, erst die Knöchel, dann die Beine hinauf bis zu den Hüften, dann den Bauch, die Achselhöhlen, prüfend, forschend. Sie hatte seine scharfe männliche Ausdünstung gerochen, die Verachtung und Wut, und bei den Frikativ- und Plosivlauten hatte sie seinen heißen Atem am Ohr gespürt. Er war energisch, geradezu brutal gewesen und hatte ihr nichts erspart. Vielleicht hatte er ihr Fragen gestellt oder Anweisungen gegeben, vielleicht hatte er seinen Ton gemäßigt, doch sie hatte ihn weder hören noch sein Gesicht sehen können, und ihre Hände waren zusammengebunden wie gefangene Fische.
Jetzt, im Streifenwagen, auf dem zum Käfig umgebauten Rücksitz – genau wie die Käfige, in die man streunende Hunde sperrte –, fühlte sie sich, wie sie sich fühlen sollte: klein, hilflos, hoffnungslos, ausgeliefert. Ihr Herz klopfte wie rasend. Sie war den Tränen nahe. Leute starrten sie an und fuhren langsamer, um sie zu mustern, und sie konnte nichts tun, außer sich entsetzt und schamerfüllt abzuwenden und zu beten, daß nicht zufällig einer ihrer Schüler vorbeikam – oder sonst jemand, den sie kannte, ein Nachbar oder ihr Vermieter. Sie beugte sich vor und senkte den Kopf, bis die Haare ihr Gesicht wie ein Vorhang verdeckten. Sie hatte sich immer gefragt, warum Angeklagte auf den Stufen des Gerichtsgebäudes ihre Gesichter verbargen, warum sie sich so sehr mühten, ihre Identität zu verheimlichen, wenn doch ohnehin jeder wußte, wer sie waren. Jetzt verstand sie es, jetzt wußte sie, was für ein Gefühl das war.
Die Röte stieg ihr ins Gesicht – sie war festgenommen worden, noch dazu in aller Öffentlichkeit –, und für einen Augenblick war sie wie gelähmt. Sie konnte nur an die Schande denken, und die schmerzte wie eine Verletzung, wie ein Insektenstich, wie die Stiche Tausender von Insekten, die sie umschwirrten – sie spürte noch immer die Wärme seiner groben Hände an den Knöcheln und Oberschenkeln. Es war, als hätte er sie versengt oder mit Säure verbrannt. Sie musterte die Sitzlehne, die Fußmatten, und ihr rechter Fuß wippte im Rhythmus des Flatterns ihrer Nerven. Und dann, als wäre in ihrem Kopf ein Schalter umgelegt worden, spürte sie Wut in sich aufsteigen. Warum sollte sie sich schämen? Was hatte sie denn getan?
Es war der Polizist. Er war es. Er war verantwortlich. Sie hob den Blick, und da saß er, der Idiot, das Schwein: zwei eckige Schultern in einer engen, schwarzblauen Uniformjacke, ein Genick, so flach und steif wie ein Paddel, und er hielt sich das Mikrofon vor den Mund und sagte etwas hinein, während er den schaukelnden Wagen vom Seitenstreifen auf die Straße lenkte und sie wie ein Mehlsack nach vorn in den Sicherheitsgurt fiel. Plötzlich war sie fuchsteufelswild, kurz vor dem Explodieren. Was hatte er eigentlich? Wofür hielt er sie – für eine Drogendealerin oder so? Für eine Diebin? Eine Terroristin? Sie hatte ein Stoppschild überfahren, das war alles – ein Stoppschild. Herrgott!
Bevor sie sich besinnen konnte, war es schon heraus: »Sind Sie verrückt?« Und es war ihr egal, ob ihre Stimme zu laut war, tonlos oder so häßlich, daß die Leute das Gesicht verzogen. Hier und jetzt war es ihr egal, wie ihre Stimme klang. »Ob Sie verrückt sind, hab ich gefragt.«
Doch er hörte nicht, er verstand nicht. »Bitte«, sagte sie, »hören Sie«, und sie beugte sich so weit vor, wie der Gurt es zuließ, und bemühte sich, die Worte möglichst sorgfältig zu artikulieren, obwohl sie nach Atem ringen mußte, obwohl die Handschellen zu eng waren und ihr Herz klopfte, als wollte es flatternd aus dem Gehäuse ihres Mundes entkommen, »das muß ein Irrtum sein. Wissen Sie denn, wer ich bin?«
Mit einem wilden, harten Gleiten flog die Welt vorüber. Der Wagen schaukelte unter ihr. Sie suchte sein Gesicht im Rückspiegel, wollte sehen, ob seine Lippen sich bewegten, ob sie irgendeinen kleinen Hinweis darauf erkennen konnte, was hier eigentlich los war. Bestimmt hatte er ihr ihre Rechte vorgelesen, als er ihr die Handschellen angelegt hatte: Sie haben das Recht zu schweigen und so weiter, die üblichen Sätze, die sie hundertmal im Fernsehen gesehen hatte. Aber warum? Was hatte sie getan? Und warum schweifte sein Blick immer wieder von der Straße zum Rückspiegel, als wäre sie in diesem Käfig und mit gefesselten Händen noch immer gefährlich, als rechnete er damit, daß sie ihre Gestalt verändern, Galle speien, Flüssigkeiten und Gestank absondern würde? Warum dieser Haß, diese Erbitterung?
Das Blut brannte in ihren Adern, ihr Gesicht war rot vor Scham, Wut und Hilflosigkeit, und schließlich begriff sie: eine Verwechslung. Natürlich. Was denn sonst? Eine Frau, die aussah wie sie – irgendeine andere schlanke, zierliche zweiunddreißigjährige Gehörlose mit dunklen Augen, die nicht mit einem Stapel Hausarbeiten, die noch vor Unterrichtsbeginn durchgesehen und benotet werden mußten, unterwegs zum Zahnarzt war –, hatte eine Bank überfallen, in der Nachbarschaft herumgeballert, ein Kind überfahren und Fahrerflucht begangen. Das war die einzige Erklärung, denn sie hatte noch nie gegen ein Gesetz verstoßen, höchstens auf ganz und gar alltägliche, geradezu unschuldige Weise: Sie war, wie Hunderte anderer Fahrer vor, neben und hinter ihr, zu schnell gefahren, sie hatte als Teenager mal einen Joint geraucht (sie war mit Cherry Cheung und später mit Richie Cohen durch die Gegend gezogen, stoned wie ein Ei, aber das hatte niemand gewußt und niemanden interessiert, am allerwenigsten die Polizei), sie hatte ein paar Strafzettel wegen falschen Parkens bekommen, aber die waren allesamt bezahlt und hatten keine Punkte gekostet. Das nahm sie jedenfalls an. Neulich, in Venice, die sechzig Dollar, als sie nur zwei Minuten zu spät gekommen war und die Politesse trotz ihrer inständigen Bitten ungerührt den Strafzettel ausgefüllt hatte – die hatte sie doch bezahlt, oder?
Nein, es war wirklich die Höhe! Diese ganze Sache, der Schock, die Angst. Aber dafür würden sie büßen, o ja, sie würde sich einen Anwalt nehmen – polizeiliche Brutalität, Inkompetenz, Freiheitsberaubung, das ganze Programm. Gut. Bitte. Wenn sie es so haben wollten... Der Wagen schaukelte unter ihr. Der Polizist saß da wie eine Schaufensterpuppe. Sie schloß die Augen – eine alte Angewohnheit – und zog sich aus der Welt zurück.
Sie notierten ihre Personalien, nahmen ihre Fingerabdrücke, nahmen ihr das Handy, ihre Ringe, den Jadeanhänger und die Handtasche ab und stellten sie – erniedrigt, verzweifelt, mit hängenden Schultern und leerem Blick – vor eine Wand, wo sie der weiteren, anhaltenderen Demütigung des Fotografiertwerdens ausgesetzt war. Und noch immer nichts. Keine Anklage. Kein Sinn. Die Lippenbewegungen der Beamten waren nicht zu entziffern, und schließlich ließ sie ihre Stimme los, bis es war, als bekäme diese Flügel, als flatterte sie durch den Raum mit den stumpfgrauen Wänden, den gerahmten Auszeichnungen und der Fahne, die in schlaffer Bestätigung dieses korrupten, wankenden Systems an einem Flaggenstock aus schimmerndem Messing hing. Sie war außer sich. Verletzt. Wütend. Aufgebracht. »Es muß ein Irrtum sein«, beharrte sie. »Ich heiße Dana, Dana Halter. Ich bin Lehrerin an der Gehörlosenschule in San Roque, und ich habe niemals... Sehen Sie nicht, daß ich taub bin? Sie haben die Falsche.« Sie wandten sich ab und zuckten die Schultern, als wäre sie eine Verirrung der Natur, ein sprechender Delphin oder die Puppe eines Bauchredners. Aber keine Erklärung. Für sie war sie bloß irgendeine Kriminelle, eine Täterin, ein hoffnungsloser Fall, den man am besten wegsperrte und ignorierte.
Aber man sperrte sie nicht weg, noch nicht. Sie war mit Handschellen an eine Bank in einem Korridor hinter dem Tresen gefesselt, doch warum, das hatte sie nicht verstanden. Der Polizist – es war der wachhabende Beamte, ein Mann von Mitte Dreißig, der ein beinahe bedauerndes Gesicht machte, als er ihren Arm nahm – hatte sein Gesicht abgewandt, als er sie sanft, aber mit Nachdruck zum Sitzen aufgefordert und angekettet hatte. Die Sache klärte sich, als ein ausgebleichtes Männlein mit unsicherem Gesicht und einem blassen Strich von einem Schnurrbart eintrat und gestikulierend auf sie zukam. Sein Name – den er ihr mit Fingerzeichen buchstabierte – war Charles Iverson, und er war Gebärdendolmetscher. Ich unterrichte auch manchmal an der Gehörlosenschule in San Roque, teilte er ihr mit. Ich habe Sie dort gesehen.
Sie erkannte ihn nicht – oder vielleicht doch. Seine adrette kleine Erscheinung kam ihr irgendwie bekannt vor, vielleicht hatte sie ihn im Flur gesehen, mit gesenktem Kopf und zielstrebigen Schritten. Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ich bin froh, daß Sie da sind«, sagte sie laut und hob die gefesselten Hände in dem Versuch, Gebärden zu machen, wie sie es immer tat, wenn sie aufgeregt war. »Ein Riesenirrtum. Ich hab bloß ein Stoppschild überfahren... und die, die...« Sie spürte den Schmerz und die Wut über diese Ungerechtigkeit aufwallen und mühte sich, ihre Mimik zu beherrschen. Und ihre Stimme. Die war anscheinend entgleist, denn die Leute starrten herüber: der wachhabende Beamte, eine Sekretärin mit ausladender Figur und hartem Gesicht, zwei junge Latinos mit schräg aufgesetzten Baseballmützen und riesigen Shorts, die vor dem Tresen standen. Ihrer aller Körpersprache sagte: Jetzt krieg dich mal wieder ein.
Iverson ließ sich Zeit. Seine Gebärden waren eckig und wenig elegant, aber gut verständlich, und sie konzentrierte sich auf ihn, während er ihr erklärte, was man ihr vorwarf. Es liegen mehrere Haftbefehle vor, begann er, und zwar aus Marin County, aus Tulare und diversenL. A.Countys, außerdem aus Nevada, nämlich aus Reno und Stateline.
Haftbefehle? Was für Haftbefehle?
Er trug ein Sportjackett über einem T-Shirt mit dem Namen einer Basketballmannschaft. Seine Haare waren mit Spray oder Gel behandelt, allerdings nicht sehr erfolgreich – sie standen hoch wie die Flaumfedern der Küken, die sie in der Grundschule unter einer Wärmelampe gehalten hatten, und sie waren fast farblos. Er zog ein gefaltetes Stück Papier aus der Innentasche des Jacketts, schien einen Augenblick nachzudenken und wog es wie ein Messer in der Hand, bevor er es auf seinen Schoß fallen ließ und in Gebärdensprache sagte: Nichterscheinen vor Gericht in mehreren Fällen, zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Gerichten im Verlauf der vergangenen zwei Jahre. Ungedeckte Schecks, Autodiebstahl, Besitz von staatlich kontrollierten Substanzen, Angriff mit einer tödlichen Waffe – die Liste ist noch nicht zu Ende. Er sah ihr unverwandt in die Augen. Sein Mund war fest geschlossen – kein Mitgefühl. Da merkte sie, daß er es glaubte. Er glaubte, sie habe ein Doppelleben geführt, jede Regel des Anstands verletzt und die Gemeinschaft der Gehörlosen in Verruf gebracht. Wieder einmal war ein Vorurteil der Hörenden bestätigt worden. Ja, sagte sein Blick, die Gehörlosen leben nach ihren eigenen Regeln, und die sind minderwertig und verwässert, sie leben von uns und auf unsere Kosten. Dieser Blick hatte sie ihr Leben lang begleitet.
Er gab ihr das Papier, und da stand alles: Daten, Orte, Polizeidienststellen, zur Last gelegte Tatbestände. Der Name irgendeines höheren Gerichtes, darunter: »Anklage wegen schwerer Vergehen«, und darunter, unglaublich, ihr Name, in Großbuchstaben, unleugbar und unauslöschlich, und am Rand des Blatts waren untereinander die Nummern der Haftbefehle aufgeführt.
Sie sah auf, und es war, als hätte man sie ins Gesicht geschlagen. Ich bin überhaupt noch nie im County Tulare gewesen – ich weiß nicht mal, wo das ist. Und in Nevada auch nicht. Das ist verrückt. Es ist ein Fehler, ein Irrtum, weiter nichts. Sagen Sie ihnen, daß es ein Irrtum ist.
Ein kalter Blick, eine knappe Gebärde. Sie dürfen ein Telefongespräch führen.
ZWEI
Bridger arbeitete. Der Morgen war in Starbucks-Kaffee und der dämmrigen Unwirklichkeit des Studios ertrunken, und Bridger sah, hörte und atmete die virtuelle Welt auf dem Monitor. Der Frame war in einer Düsternis aus Mahagoni- und Kupfertönen erstarrt, und Bridger arbeitete an einem neuen Kopf. Sein Boß Radko Goric, ein achtunddreißigjähriger Unternehmer mit 200-Dollar-Designer-Sonnenbrillen, Pierro-Quarto-Jacketts in seltsamen Farben und klotzigen Vinylschuhen vom Wühltisch, hatte drei andere Special-Effects-Firmen unterboten, um den Auftrag für die Nachbearbeitung dieses Films zu bekommen, des letzten Teils einer Trilogie, die auf einem weit entfernten, lebensfeindlichen Planeten spielte, wo an Saurier erinnernde Kriegsherren um die Macht kämpften und menschliche Söldner einem uralten Kriegerethos gehorchten und wechselnde Bündnisse eingingen. Alles schön und gut. Bridger war ein Fan dieser Filme – die ersten beiden hatte er sechs- oder siebenmal gesehen und den Detailreichtum, das Tempo und den Flow der Special Effects bewundert –, und er war mit den besten Absichten, ja geradezu mit Euphorie in das Projekt eingestiegen. Aber der Boß (der darauf bestand, mit »Rad« angeredet zu werden und nicht mit »Radko«, »Mr. Goric« oder »Königliche Hoheit«) hatte ihnen im Hinblick auf die zeitlichen Vorgaben nicht einen Millimeter Spielraum gelassen. Die Premiere sollte in weniger als einem Monat sein, und Bridger und seine fünf Kollegen arbeiteten zwölf Stunden täglich, sieben Tage die Woche.
Lange starrte er bloß auf den Bildschirm, das Kinn auf zwei bleiche Fäuste gestützt, deren Knochen sich für den Augenblick aufgelöst zu haben schienen. Die Welt war da, direkt vor ihm, viel unmittelbarer und wirklicher als sein Arbeitsplatz, diese Wände, diese Decke, dieser lackierte Betonboden, und er trat in sie ein, ließ sich treiben, träumte, schlief mit offenen Augen. Er war erledigt. Fix und fertig. Seine Finger waren steif, sein Hintern tat weh. Seit drei Tagen hatte er die Socken nicht gewechselt. Und jetzt zogen Streßkopfschmerzen auf wie die kackbraunen Wolken über Drex III, dem Planeten, den er mit Hilfe seiner Discreet-Software und der abgegriffenen Maus bearbeitet, schattiert und mit dem letzten Schliff versehen hatte. Kaffee half nicht mehr. Banjo war an der Reihe gewesen, in der Kaffeepause zu Starbucks zu gehen, und Bridger hatte sich einen Venti mit einem Schuß Espresso bestellt. Da stand der Becher, halb ausgetrunken, und trotzdem fühlte er sich bloß flau. Und schläfrig, müde, narkoleptisch. Wenn er doch nur den Kopf hinlegen könnte, bloß für eine Minute...
Aber er hatte eine Nachricht. Von Deet-Deet. Das Icon erschien in einer Ecke des Bildschirms, und als er es anklickte, war da das Bild eines Piraten mit Holzbein, der ein Entermesser schwenkte und mit dem überproportional großen Kopf von Radko versehen war. Der Text lautete: Har, har, har, ihr Drückeberger! Kein Nickerchen am Arbeitsplatz – wenn das Projekt am 30. nicht durch ist, geht ihr allesamt über die Planke!
So bewahrten sie sich davor, durchzudrehen. Es war mühselige Kleinarbeit, Paint-and-roto für fünfundzwanzig Dollar zweiundsiebzig die Stunde, brutto, und obwohl es Augenblicke künstlerischer Befriedigung gab – zum Beispiel wenn man die Drähte an den kleinen Gestalten wegretuschierte, die von irgendeiner außerirdischen Explosion in den schorfigen Himmel geschleudert wurden –, war es im Grunde ein Knochenjob. Bei dem neuen Kopf, an dem Bridger gestern den ganzen Tag und die Nacht hindurch bis zu diesem müdigkeitsgetränkten Morgen gearbeitet hatte, mußte er das dreidimensional fotografierte Gesicht des Actionhelden Kade (oder vielmehr TheKade, wie es jetzt auf den Vorankündigungen stand) über den weißen Helm eines Stuntmans legen, der auf einem futuristischen, von Klingen starrenden Chopper über die am Rand einer Klippe aufgebaute Rampe raste und in hohem Bogen über einen der Feuerseen und mitten ins Lager der Feinde sprang, wo er einen unbeholfenen Echsenkrieger nach dem anderen zerhackte, aufschlitzte und ins Gesicht trat. Es war nicht ganz der Ort, wo Bridger sechs Jahre nach seinem Abschluß an der Filmhochschule hatte sein wollen – er hatte mehr an eine Karriere wie die von Fincher oder Spielberg gedacht –, aber es ernährte seinen Mann. Und zwar recht gut. Außerdem arbeitete er in der Filmindustrie.
Jetzt legte er Kades Kopf über den von Radko – er ließ ihn zwinkern, grinsen, eine Grimasse schneiden (das Gesicht, das Kade machte, als das Motorrad mit einem kreuzbeinstauchenden Rums mitten unter den der Echsenkriegern aufsetzte) und schließlich noch einmal zwinkern – und tippte seine Antwort: Versenk das Schiff und bring mir Kaffee. Mein Königreich für einen Becher Kaffee, noch einen, bitte. Er setzte ein PS hinzu, sein Lieblingszitat aus Miss Lonelyhearts, das er zum Einsatz brachte, wann immer es zu passen schien: Wie ein Toter konnte er nur durch Reibung erwärmt und nur durch Kraftanstrengung bewegt werden.
Dann meldete sich, aus der räumlichen Distanz bis zur übernächsten Nische und den weglosen Weiten des Cyberspace, Plum zu Wort, und dann gaben Lumpen, Pixel und Banjo ihren Senf dazu, und alle waren wieder wach, und der neue Tag, der nicht anders war als der gestrige oder vorgestrige, nahm seinen Lauf.
Er retuschierte die überstehenden weißen Flächen rings um Kades Kopf und begann gerade, sich Gedanken über das Frühstück (Bagel mit Frischkäse) oder vielleicht das Mittagessen (Bagel mit Frischkäse, Lachs, Sprossen und Senf) zu machen, als sein Handy vibrierte. Radko wollte während der Arbeitszeit keine Klingeltöne oder Melodien hören, denn seine Angestellten sollten nicht durch persönliche Telefonate abgelenkt werden, ebensowenig wie sie im Internet surfen, Chatrooms besuchen und auf Instant Messengern eingeloggt sein sollten, und darum hatte Bridger den Summer seines Handys aktiviert, das er immer in die rechte Hosentasche steckte, damit er das eigenartige Schnurren gleich spürte und den Anruf diskret annehmen konnte. »Hallo?« sagte er und hielt seine Stimme im Bereich eines Bühnenflüsterns.
»Ja, hallo. Hier ist die Polizei von San Roque, Charles Iverson. Ich bin Gehörlosendolmetscher und habe Dana Halter hier.«
»Polizei? Was ist passiert? Hatte sie einen Unfall?«
»Hier ist Dana«, sagte die Stimme, als gehörte sie einem Medium, durch das ein Geist sprach. »Du mußt herkommen und eine Kaution stellen.«
»Warum? Was hast du gemacht?«
»Ich weiß nicht«, sagte die Stimme, die Männerstimme. Sie war tief und rasselnd wie eine Handvoll Kies. »Ich hab ein Stoppschild überfahren, und jetzt denken sie, daß ich –«
Pause. Vom Bildschirm starrte Kade ihn an – die linke Seite seines Kopfes war noch von dem weißen Heiligenschein eingerahmt. Das kümmerliche Neonlicht wurde kurz heller und dann wieder schwächer, irgendwo flackerte immer eine Röhre. Plum, die einzige Frau unter ihnen, stand auf und ging in Richtung Toilette.
Iversons Stimme fuhr fort: »– sie denken, daß ich all diese Verbrechen begangen habe, aber« – wieder eine Pause – »das hab ich nicht.«
»Natürlich nicht«, sagte er und stellte sich Dana in einer Polizeiwache vor, das Gesicht vom Telefonapparat abgewandt, während der Mann mit der Stimme Gebärden machte, im Hintergrund Fahndungsfotos und Steckbriefe. Alles an diesem Bild war falsch. »Ich dachte, du wolltest zum Zahnarzt«, sagte er. Und dann: »Verbrechen? Was für Verbrechen?«
»Ich war ja unterwegs zum Zahnarzt«, sagte Iverson. »Aber ich hab ein Stoppschild überfahren, und der Polizist hat mich verhaftet.« Da war noch mehr – Bridger konnte Danas Stimme im Hintergrund hören –, aber Iverson gab ihm die Kurzfassung. Ohne weitere Erklärung las er die Anklageliste vor, als wäre er ein Kellner, der die Tageskarte herunterbetete.
»Aber das ist doch verrückt«, sagte Bridger. »Du hast doch nie... Ich meine, sie hat doch nie im Leben –«
»Die Zeit ist um«, sagte Iverson.
»Okay, ich bin gleich da. In zehn Minuten, vielleicht früher.« Bridger sah auf, als Plum sich wieder auf ihren Stuhl setzte, und senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Wie hoch ist die Kaution? Ich meine, was kostet es?«
»Was? Sprechen Sie lauter. Ich kann Sie nicht verstehen.«
Radko erschien am Ende des Gangs, und Bridger beugte sich weiter vor, um das Handy abzuschirmen. »Die Kaution – wie hoch?«
»Die ist noch nicht festgesetzt worden.«
»Gut«, sagte Bridger. »Okay. Bin gleich da. Ich liebe dich.«
Wieder eine Pause. »Ich dich auch«, sagte Iverson.
Er war noch nie in der Polizeiwache von San Roque gewesen und mußte die Adresse erst im Telefonbuch nachschlagen, und als er in die Straße einbog, stellte er überrascht fest, daß auf beiden Seiten Streifenwagen geparkt waren, einer hinter dem anderen. Es dauerte eine Weile, bis er einen Parkplatz gefunden hatte. Er mußte einige Runden um den ganzen Block drehen, bis endlich einer wegfuhr, und dann setzte er gewissenhaft den Blinker und parkte mit großer Sorgfalt zwischen zwei schwarz-weißen Polizeiwagen. Er war aufgeregt. Er war in Eile. Aber dies war weder die Zeit noch der Ort für einen verbeulten Kotflügel oder auch nur einen Stups mit der Stoßstange.
Eine aufgeschwemmte, schnaufende Frau, um deren Augen Ringe aus getrocknetem Blut waren – oder war das ihr Make-up? – stapfte vor ihm die Treppe hinauf, und er war geistesgegenwärtig genug, ihr die Tür aufzuhalten, was ihm Gelegenheit gab, sich kurz zu sammeln. Seine Kontakte zur Polizei waren bisher durchweg formaler Natur gewesen (»Okay, aussteigen!«), und er war genau zweimal festgenommen worden, einmal mit vierzehn, wegen Ladendiebstahls, und einmal als Collegestudent, weil er betrunken gefahren war. Rein theoretisch war ihm klar, daß die Polizei die Gesellschaft (also auch ihn) zu schützen und ihr zu dienen hatte, aber dennoch war er jedesmal, wenn er einen Polizisten sah, plötzlich beunruhigt und verspürte ein gewisses Schuldgefühl. Selbst Wachmänner waren ihm nicht geheuer. Aber egal: Er trat hinter der aufgeschwemmten Frau durch die Tür.
Drinnen trennte ein taillenhoher Tresen den für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum (die Fahnen Kaliforniens und der USA, grelles Deckenlicht und Linoleum, das glänzte, als wollte es dem Straßenschmutz und den Ausscheidungen trotzen, mit denen es täglich in Berührung kam) vom Allerheiligsten, wo die Streifen- und Kriminalbeamten ihre Tische hatten, und dem unauffälligen Korridor, der vermutlich zu den Arrestzellen führte. Wo Dana war. Als er an den Tresen trat, spähte er dorthin, als könnte er einen Blick auf sie erhaschen, aber das konnte er natürlich nicht. Sie steckte bereits in irgendeiner Zelle, zusammen mit Prostituierten, Säuferinnen und Frauen, die gewalttätig geworden waren, und bei dem Gedanken daran überlief es Bridger kalt. Sie würden über sie herfallen. Sie war ja nicht hilflos – er kannte keine selbständigere Frau –, aber sie war naiv, zu mitfühlend, und sobald die herausgefunden hatten, daß sie taub war, hatten sie etwas, womit sie sie fertigmachen konnten. Er dachte daran, wie Penner sich an sie hängten, wann immer er mit ihr irgendwohin ging: als wäre Dana ihre Sonderbotschafterin, als stünde sie aufgrund ihrer Behinderung – halt, ihrer Andersartigkeit – auf dem Niveau einer Obdachlosen. Oder auf einem noch niedrigeren.
Aber das hier war ein Mißverständnis. Offensichtlich. Und ganz egal, was sie haben wollten – er würde sie hier rausholen, bevor die ihre Krallen in sie schlagen konnten. Er wartete hinter der dicken Frau und sah reflexhaft alle paar Sekunden auf die Uhr. Zehn nach elf. Elf nach elf. Zwölf nach elf. Die dicke Frau beklagte sich über den Hund ihres Nachbarn: Sie könne nicht schlafen, nicht essen, nicht denken, weil der Köter ununterbrochen belle, und sie habe bereits zweiundzwanzigmal die Polizei angerufen, dieses Revier, und zum Beweis die Telefonrechnungen der letzten fünfzehn Monate mitgebracht. Was gedenke man nun zu unternehmen? Oder müsse sie hier stehenbleiben, bis sie tot umfalle? Denn das werde sie tun. Einfach hier stehenbleiben.
Radko war nicht erbaut, als Bridger es ihm sagte. »Es ist wegen Dana«, erklärte Bridger, als er ihn auf dem Weg zum Kühlschrank abfing. Er klopfte bereits seine Taschen nach dem Wagenschlüssel ab. »Sie ist verhaftet worden. Es ist ein Notfall.«
Das Licht flackerte und wurde schwächer. Drex III leuchtete bedrohlich auf dem Bildschirm – noch siebenundzwanzig Tage, bis der Planet seinen Platz unter den anderen Himmelskörpern einnehmen mußte. Radko trat einen Schritt zurück und kniff die Augen mit den schweren Lidern zusammen. »Notfall?« wiederholte er. »Wieso Notfall? Werden jeden Tag Menschen in Gefängnis gesteckt.«
»Nein«, sagte Bridger, »du hast mich falsch verstanden. Sie hat nichts getan. Es ist ein Irrtum. Ich muß... also, ich weiß, das klingt blöd, aber ich muß hinfahren und sie rausholen. Sofort.«
Schweigen. Radko preßte die Lippen zusammen und bedachte ihn mit einem Blick, dem Pixel, einer unvermittelten Inspiration folgend, den Titel »Paranoia überfällt Frosch« gegeben hatte.
»Ich meine, ich kann sie doch nicht da drin lassen. In einem Gefängnis. Würdest du gern in einem Gefängnis sitzen?«
Falsche Frage. »In meinem Land«, erwiderte Radko, »die Menschen werden geboren im Gefängnis, kriegen Kinder im Gefängnis, sterben im Gefängnis.«
»Und ist das gut?« wollte Bridger wissen. »Bist du nicht darum hergekommen?«
Doch Radko drehte sich einfach um und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Pah!« war alles, was er dazu sagte.
»Ich gehe jedenfalls«, sagte Bridger und sah, daß Plum sich weit zurücklehnte, um das Spektakel besser verfolgen zu können. »Nur damit du Bescheid weißt – ich muß einfach.«
Radkos eine Hand ruhte auf dem Griff der Kühlschranktür, die andere beschrieb einen raschen Bogen und zeigte mit einem mahnenden Finger auf Bridger. »Eine Stunde«, knurrte er mit tiefer Stimme. »Maximal. Nur damit du Bescheid weißt.«
Der wachhabende Beamte – beginnende Glatze, ergraute Koteletten, milchige, verärgerte Augen, Lesebrille auf der Nasenspitze – versuchte, die Frau mit sanften Worten zu beschwichtigen, aber sie war nicht gekommen, um sich beschwichtigen zu lassen. Nein, sie wollte, daß etwas geschah. Je sanfter der Beamte sprach, desto lauter wurde die Stimme der Frau, bis er sich schließlich abwandte und jemanden herbeiwinkte. Wenige Sekunden später stand ein wesentlich jüngerer Beamter – ein gertenschlanker Latino in einer wie maßgeschneidert wirkenden Uniform – an dem Durchgang mit der Schwingtür, der zum Bürobereich führte. »Das ist Officer Torres«, sagte der wachhabende Beamte. »Er wird Ihnen helfen. Er ist unser Hundeexperte. Stimmt’s, Torres?«
Der andere verzog keine Miene. »Genau«, sagte er, »das stimmt. Ich bin der Hundeexperte.«
Der wachhabende Beamte wandte sich zu Bridger. »Ja?« sagte er.
Bridger trat in seinen Nikes von einem Fuß auf den anderen, richtete den Blick auf einen Punkt knapp links vom Kopf des Polizisten und sagte: »Ich komme wegen Dana, Dana Halter.«
Zwei Stunden später wartete er noch immer. Es war Freitag, inzwischen Freitag nachmittag, und die Dinge kamen nicht in Gang. Man schlingerte gemütlich auf das Wochenende und die durchgeknallte Parade von Betrunkenen und Streitlustigen zu, die nur kommen und schön auf den Putz hauen sollten – das war diesen Männern und Frauen mit den teigigen Gesichtern vollkommen gleichgültig, diesen Schreibtischhengsten und Bürokraten, diesen Schlafwandlern mit dem abwesenden Blick. Sie würden um fünf nach Hause fahren und die Beine hochlegen, und bis dahin würden sie zu Aktenschränken schlurfen und mit zwei Fingern auf Computertastaturen tippen, und das alles in einer Zone, wo niemand, schon gar nicht Bridger, sie erreichen konnte. Es war ihm gelungen, dem Beamten mit den grauen Koteletten ein paar wertvolle Informationen zu entlocken. Ja, man hatte sie eingeliefert. Nein, eine Kaution war noch nicht festgesetzt. Nein, er konnte sie nicht sehen. Nein, er konnte auch nicht mit ihr sprechen. Und danach hatte Bridger sich auf eine Bank am Eingang gesetzt. Er hatte nichts zu lesen, er konnte nur warten.
Außer ihm warteten noch vier andere: ein sehr alter Mann, der in einem dicken Anzug so kerzengerade dasaß, daß sein Jackett die Sitzfläche nicht berührte; eine arabisch wirkende Frau unbestimmten Alters, die einen Kaftan oder eine Art religiöses Festgewand trug, und neben ihr ein unablässig die Beine schlenkernder Junge, ihr Sohn, der ungefähr fünf war, auch wenn Bridger sich mit Kindern nicht gut auskannte und merkte, daß er in Hinblick auf das Alter des Jungen immer unsicherer wurde, je öfter er ihn ansah – eigentlich hätte er ebensogut drei oder zwölf Jahre alt sein können; schließlich, am weitesten entfernt von Bridger, eine junge Frau um die Zwanzig, deren Gesicht und Figur nicht sonderlich attraktiv waren, die jedoch nach zwei Stunden verstohlenen Beobachtens langsam einen gewissen Reiz bekam. Etwa hundert Leute waren in diesem Zeitraum gekommen und gegangen. Die meisten hatten leise und ehrerbietig mit dem wachhabenden Beamten gesprochen und waren unter Verbeugungen wieder verschwunden. Die dicke Frau war längst in ihre Bellzone zurückgekehrt.
Bridger langweilte sich gründlich. Er konnte ohnehin nicht gut stillsitzen, es sei denn, er war in ein Computerspiel vertieft oder in die giftgashaltige Atmosphäre von Drex III oder irgendein anderes digitales Szenario eingetaucht, und er ertappte sich dabei, daß er beinahe soviel herumzappelte wie der Junge (der mit den Beinen schlenkerte, als wäre die Bank eine übergroße Schaukel, auf der er sie alle immer höher hinauf- und aus diesem Ort des Stumpfsinns hinausschaukeln wollte). Minutenlang starrte Bridger vor sich hin und dachte an nichts, aber dann tauchten seine Ängste um Dana wieder auf, und er sah ihr Gesicht vor sich, die süße Verwirrung um ihren Mund oder die Art, wie sie die Brauen zusammenzog, wenn sie eine Frage stellte – Wieviel Uhr ist es? Wo, hast du gesagt, ist die Omelettpfanne? Wie viele Schnapsgläser Triple Sec? –, und sein Magen zog sich vor Sorge zusammen. Und vor Hunger. Ihm fiel ein, daß er weder den Frühstücks- noch den Mittagsbagel gegessen hatte – er hatte nichts im Magen außer Starbucks, und er spürte die Säure in die Kehle steigen. Was war eigentlich los mit diesen Leuten? Konnten sie nicht mal eine einfache Frage beantworten? Ein Formular ausfüllen? Eine Information zügig weitergeben?
Er ermahnte sich, ruhig zu bleiben, auch wenn es ihm schwerfiel angesichts der Tatsache, daß er Radko bereits sechsmal angerufen hatte und dieser zunehmend ungeduldig geworden war. »Ich arbeite bis Mitternacht«, hatte Bridger versprochen, »ich schwöre es.« Radkos Stimme, kiellastig und voller knüppelnder Konsonanten, hatte die Bedeutung seiner Worte mit kleinen Explosionen transportiert. »Ich hoffe«, hatte er gesagt. »Bestimmt. Aber ganze Nacht, nicht bloß Mitternacht.« Sei nicht egoistisch, rief Bridger sich zur Ordnung. Denk an Dana, denk daran, was sie durchmacht. Er schob das Bild beiseite: Dana in einer Zelle mit einem halben Dutzend fremder Frauen, die sie verspotteten, irgend etwas von ihr wollten, sie angriffen. In einer solchen Situation war Dana praktisch wehrlos – das seltsame, flache, tonlose Flattern ihrer Stimme, das er so liebenswert fand, würde auf die anderen, diese wütenden, harten Frauen, nur provozierend wirken. Das Ganze war ein Irrtum. Es konnte nur ein Irrtum sein.
Er starrte ins Leere. Der wachhabende Beamte hinter dem Tresen, die Leidgenossen in diesem Fegefeuer, die trostlosen Wände und der schimmernde Boden verschwammen, und er dachte daran, wie er Dana vor etwas über einem Jahr zum ersten Mal gesehen hatte. In einem Club. Er war nach der Arbeit mit Deet-Deet ausgegangen, sie waren beide ziemlich fertig gewesen und hatten, trotz der Augentropfen, zwinkernde, geschwollene Augen, weil sie von zehn Uhr morgens bis acht Uhr abends ununterbrochen auf ihren Bildschirm gestarrt hatten. Zuerst aßen sie Sushis und kippten sich ein paar Schalen kalten Sake hinter die Binde, und weil sie unbedingt etwas Entspannendes tun mußten, beschlossen sie, eine Runde durch die Clubs zu drehen und zu sehen, was sich ergab – dabei war es erst Montag, und vor ihnen lag die ganze trostlose Woche wie eine Szenerie aus Dune – Der Wüstenplanet. Deet-Deet hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt, und Bridger war ebenfalls ungebunden (seit drei fruchtlosen Monaten), und daher schien das, vor allem nach den Sakes, ein guter Plan zu sein.
Sie warteten in der Schlange vor dem Doge, es war halb elf, der Nebel schob sich vom Meer heran, wälzte sich durch die Straßen und ließ den Asphalt im Scheinwerferlicht der dahinkriechenden Wagen schimmern, als Deet-Deet seinen Monolog über die Fehler und Unmäßigkeiten seiner Exfreundin unterbrach, um sich eine Zigarette anzuzünden, und Bridger die Gelegenheit nutzte und sich umblickte, um ihre Chancen abzuschätzen. Dieser Club hatte Fenster zur Straße, und das Pulsieren der Musik und das zuckende Blitzen des Stroboskoplichts drangen hinaus, so daß man einen Eindruck bekam und entscheiden konnte, ob es die fünf Dollar Eintritt lohnte. Es war das übliche Gewurle von Menschen, die unter der Wucht der Musik (oder jedenfalls der Baßläufe, denn die waren so ziemlich das einzige, was man hören konnte) auf und ab wogten. Glieder wurden ausgestreckt und angezogen, Köpfe wurden vom Zucken des Stroboskops abgeschlagen und im nächsten Augenblick wieder aufgesetzt, Knie wurden gehoben, Hintern aneinandergestoßen – es war das gleiche Szenario wie gestern, wie morgen und übermorgen. Bridgers Augen brannten. Der Sake setzte ihm zu. Er wollte Deet-Deet gerade sagen, er habe sich die Sache mit dem Club anders überlegt, er bekomme jetzt schon Kopfschmerzen, und außerdem sei es erst Montag, und sie müßten morgen früh um zehn wieder die Drähte in dem endlosen Kung-Fu-Film retuschieren, den sie seit drei Wochen bearbeiteten, als er Dana sah.
Sie stand am Rand der Tanzfläche, gleich neben einer mannshohen Box, stampfte im Baßrhythmus mit den Füßen – den nackten Füßen – und bewegte die Ellbogen, als machte sie Aerobic-Übungen, als stünde sie auf einem Stepper. Vielleicht war sie im Geist auch bei irgendeinem Volkstanz – jupidu, schwing deinen Partner im Kreis. Sie hatte die Augen fest geschlossen, die Knie zuckten, die Füße hoben und senkten sich. Rotes Scheinwerferlicht fiel auf ihr Haar und setzte es in Brand.
»Tja, was meinst du – irgendwas Interessantes?« fragte Deet-Deet. Er war fünfundzwanzig, eins sechsundsechzig groß und favorisierte den Gothic Style, auf den die meisten in der Special-Effects-Branche setzten. In Wirklichkeit hieß er Ian Fleischer, doch bei Digital Dynasty wurden alle nur mit ihren Webnamen angeredet, ob sie wollten oder nicht. Bridger war unter dem Namen »Sharper« bekannt, weil er damals, als er noch ein Staubwischer gewesen war, als er noch mit Hingabe und Sorgfalt zu Werk gegangen war und seine Arbeit aufregend gefunden hatte, immer zu den Computerfuzzis gerannt war und sie um schärfere 3-D-Bilder gebeten hatte. »Weil ich nämlich noch nicht weiß, ob ich lange aufbleiben will«, schob Deet-Deet als Erklärung nach, »und ich glaube, dieser Sake haut ganz schön rein. Was trinkt man denn überhaupt auf Sake? Bier, oder? Ab jetzt nur noch Bier?«
Bridger hörte nicht zu. Er gestattete den Lichtern, etwas in ihm auszulösen, er ließ die Musik in sich einsickern und seine Stimmung verändern. Die Schlange rückte vor – zwischen ihm und dem Türsteher waren noch etwa zehn Leute. Jetzt konnte er diese Frau aus einer neuen Perspektive betrachten – da stand sie am Rand der Tanzfläche und kämpfte heldenhaft gegen die Musik. Hoch mit den Knien, runter mit den Fäusten, raus mit den Ellbogen. Ihre Bewegungen waren weder ruckartig oder spastisch noch aus dem Takt – jedenfalls nicht ganz. Es war, als hörte sie einen tieferen Rhythmus, einen Gegenrhythmus, ein unter der Oberfläche der Musik verborgenes Muster, dessen sich niemand sonst bewußt war – weder die anderen Tänzer noch der DJ oder die Musiker, die diese Stücke im Studio eingespielt hatten. Es faszinierte ihn. Sie faszinierte ihn.
»Sharper? Bist du noch da?« Deet-Deet sah zu ihm auf wie ein Kind, das sich auf dem Jahrmarkt verlaufen hat. »Ich hab gerade gesagt, daß ich nicht weiß, ob ich... Siehst du da drin irgendwas Lohnendes?« Er stellte sich auf die Zehenspitzen, die Musik erstarb plötzlich und formierte sich dann um den Baßlauf des nächsten Stücks. »Die da? Die hast du im Auge?«
Sie waren jetzt beinahe an der Tür. Hinter ihnen standen fünfundzwanzig oder dreißig andere, die reinwollten, und der Nebel schlug sich überall nieder: auf den Straßenlaternen, den Palmen, den Haaren der Leute.
Deet-Deet machte einen letzten Versuch. »Willst du rein? Meinst du, die fünf Dollar lohnen sich?«
Bridger reagierte nicht gleich, denn er war abgelenkt – oder nein, er war gebannt. Er hatte bisher zwei bedeutsamere Beziehungen gehabt: eine auf dem College und dann die mit Melissa, die vor drei Monaten ihr Ende gefunden hatte, mit dem Krachen eines Baums, der im Wald umfällt, wo keiner da ist, der es hören könnte. Etwas zog ihn, eine Kraft, eine Intuition, die über der abgeschürften Ebene seines Bewußtseins leuchtete wie das Blitzen des Stroboskoplichts. »Klar«, sagte er, »ich geh da rein.«
Als er jetzt aus dem Nebel der Erinnerung auftauchte und feststellte, daß die Frau mit dem Kind verschwunden und der Polizist mit den weißen Koteletten durch eine Frau mit möglicherweise mitfühlenden Augen ersetzt worden war, erhob er sich. Wie spät war es? Nach vier. Radko würde einen Anfall kriegen. Er hatte bereits einen Anfall gekriegt. Er hatte in diesem Augenblick den nächsten. Bridger hatte einen ganzen Nachmittag nicht gearbeitet, gerade jetzt, wo man ihn am dringendsten brauchte – und was hatte er erreicht, abgesehen von einem hübschen Nickerchen auf einer von vielen Hintern polierten Bank in der Polizeiwache von San Roque? Nichts. Überhaupt nichts. Dana war noch immer eingesperrt, irgendwo dort hinten, und er selbst hatte noch immer keine Ahnung, um was es ging. Er spürte den Ärger in sich aufsteigen, einen Stachel der Wut, die er kaum bezähmen konnte, und um sich zu beruhigen, schlenderte er zu einem Ständer voller Merkblätter – Wie Sie sich auf der Straße schützen können; Wie Sie Ihr Heim einbruchsicher machen können; Was ist Identitätsdiebstahl? – und tat, als nähme er diese wertvollen Informationen in sich auf.
Er blieb einen Moment dort stehen und drehte sich dann wie zufällig zum Tresen um. »Hallo«, sagte er, und die Frau sah von dem Formular auf, das sie gerade ausfüllte. »Mein Name ist Bridger Martin, und ich warte hier schon seit kurz nach elf – heute morgen, meine ich. Vielleicht könnten Sie mir helfen...«
Sie sagte nichts. Wozu auch? Er hatte ein Anliegen, er war ein Bittsteller, ein Wesen voller Wünsche und Bedürfnisse und Forderungen, nicht anders als Tausende vor ihm, und er würde es irgendwann von allein einsehen, das wußte sie. Diese Tatsache schien sie zu langweilen. Der Tresen und die Computer und die Wände und der Boden und das Licht langweilten sie ebenfalls. Bridger langweilte sie. Ihre Kollegen. Ihre Schuhe, ihre Uniform – alles langweilte sie, alles war eine eintönige, ritualisierte Mühsal ohne Anfang oder Ende. Das verrieten ihm ihre Augen, die aus der Nähe nicht annähernd so mitfühlend aussahen, wie er gedacht hatte. Und ihre Lippen... ihre Lippen waren fest zusammengepreßt, als kämpfte sie gegen ein nervöses Zucken an.
»Es geht um meine... meine Freundin. Sie ist festgenommen worden, und wir wissen nicht, warum eigentlich. Ich hab mir den ganzen Nachmittag freigenommen, um herzukommen und« – es war der reinste Filmdialog, und die Worte klebten ihm am Gaumen – »sie auf Kaution rauszuholen, aber keiner kann mir sagen, wie hoch die Kaution ist und was ihr überhaupt vorgeworfen wird.« Er ließ es wie eine Frage klingen, wie ein Bittgesuch.
Sie überraschte ihn. Ihr Mund entspannte sich. Die Menschlichkeit – das Mitgefühl – kehrte in ihre Augen zurück. Sie würde ihm helfen. Sie würde ihm also doch helfen. »Name?« sagte sie.
»Dana«, antwortete er. »Dana Halter. H-a-l-t-e-r.«
Noch während er überflüssigerweise den Namen buchstabierte, tippte sie ihn bereits ein. Bridger beobachtete ihr Gesicht, als sie auf den Bildschirm sah. Für eine Frau in mittleren Jahren war sie jetzt, da sie ihre Lippen nicht mehr so zusammenkniff, hübsch oder wenigstens beinahe hübsch. Er wollte, daß sie sich erbarmte, daß sie ihm half, ihn bemutterte und an der Hand nahm – sie war eine Schönheit, im Strahlenkranz der Wahrheit führte sie das Schwert der Gerechtigkeit. Jedenfalls während der wenigen Sekunden, die es dauerte, bis die Information auf dem Bildschirm war. Sogleich erlosch alles Leben in ihr, und sie war wieder alles andere als hübsch. Ihre Augen wurden hart, und der Mund war klein und verbittert. »Wir wissen noch nicht genau, was wir hier haben«, sagte sie knapp. »Es kommt erst nach und nach rein. Und wegen der Sache in Nevada wird sich wohl das FBI einschalten.«
»Der Sache in Nevada?«
»Überschreitung der Staatsgrenzen zum Zweck eines Verbrechens. Scheckfälschung.«
»Scheckfälschung?« wiederholte er ungläubig. »Aber sie ist doch nie in –« begann er und besann sich eines Besseren. »Hören Sie«, sagte er, »helfen Sie mir bitte. Ich verstehe das nicht ganz – es ist offenbar ein Irrtum, eine Verwechslung oder irgendwas in der Art. Ich muß jetzt bloß wissen, wann ich sie auf Kaution rausholen kann und wo ich die Kaution stellen soll.«
In ihren Mundwinkeln zuckte die zarte Andeutung eines amüsierten Lächelns. »Aus mindestens zwei Countys haben wir Haftbefehle mit Kautionsausschluß, weil sie trotz Kaution abgehauen ist, und das heißt, daß sich vor Montag wohl nichts ergeben wird.«
»Montag?« sagte er. Seine Stimme quietschte beinahe, er konnte nichts dagegen tun.
Eine Sekunde. Zwei. Dann bewegten sich ihre Lippen wieder: »Frühestens.«
DREI
Man steckte sie in eine Zelle, die kürzlich geputzt worden war. Die vergitterte Lampe tauchte alles in gleißendes Licht, ein fächerförmiger Rest von trocknenden Mopstrichen umgab die Edelstahltoilette, die wie ein Ausstellungsstück mitten im Raum stand. Der Geruch des Desinfektionsmittels, ein ätzender Gestank, hing in der stickigen Luft und trieb Dana die Tränen in die Augen. Während der ersten Minuten versuchte sie, nur durch den Mund zu atmen, aber das schien es nur schlimmer zu machen. Sie lehnte sich an die die graue Betonwand mit den blassen Graffiti-Hieroglyphen und rieb sich die Augen – nein, das waren keine Tränen, ganz bestimmt nicht, denn sie war weder eingeschüchtert noch ängstlich oder im mindesten besorgt. Sie war – wie hieß das Wort? – frustriert, das war alles. Zornig. Wütend. Warum hörte ihr niemand zu? Sie hätte eine schriftliche Aussage machen können, wenn jemand daran gedacht hätte, ihr Papier und einen Stift zu geben. Und dieser Dolmetscher, Iverson – in seinen Augen war sie schuldig bis zum Beweis ihrer Unschuld, und das war falsch, einfach grundfalsch. Sie brauchte jemanden, der Mitgefühl hatte. Sie brauchte einen Anwalt. Einen Verteidiger. Sie brauchte Bridger.
Er war hier – sie spürte es. Er war in diesem Gebäude, er war vorn, in der Wache, wo die Polizisten mit den leeren Gesichtern und die Sekretärinnen mit den scharfen Kanten saßen, und brachte alles in Ordnung. Er würde es ihnen erklären, er würde für sie sprechen und alles tun, um sie hier rauszuholen: Er würde zur Bank gehen, zu einem Kautionsbürgen, er würde mit dem Richter und dem Staatsanwalt reden, mit jedem, den er dazu bringen konnte, ihm zuzuhören. Wenn er ihnen vor Augen führte, daß sie sich geirrt hatten – die gesuchte Person war eine andere Dana Halter, und man mußte schon blind sein, um das nicht zu erkennen –, dann würden sie verstehen und sie freilassen. Jeden Augenblick. Jeden Augenblick würde sich der Wärter durch die Stahltür am Ende des Korridors schieben, die Zelle aufschließen und sie hinaus ins Tageslicht führen, und sie würden sich vor Entschuldigungen überschlagen: der wachhabende Beamte, der Polizist, der sie festgenommen hatte, Iverson mit seinem pedantischen Mund und anklagenden Blick, seinen unverzeihlich schlampigen Gebärden...
In ihrer Erregung – in ihrer Wut und Verzweiflung – stellte sie fest, daß sie immer im Kreis um die Toilette herumging, die in diesem minimalistisch funktionalen Raum der einzige Einrichtungsgegenstand war, abgesehen von den beiden an der Wand befestigten Pritschen, auf die sie sich aber noch nicht setzen wollte. Sie führte Selbstgespräche, redete sich gut zu, sich zu beruhigen, und vielleicht bewegte sie dabei die Lippen, vielleicht sprach sie laut, schon möglich. Nicht daß das irgendeinen Unterschied machte. Es war niemand da, der sie hätte hören können. Freitag morgen war eine ungewöhnliche Zeit, um verhaftet und eingesperrt zu werden. Die wirklichen Verbrecher lagen noch im Bett, und die anderen – die Frauenverprügler, die Säufer, die Motorradtypen – waren in der Arbeit und freuten sich auf den Abend. Thank God it’s Friday! Sie dachte ans College und daran, daß damals der Freitagabend der Höhepunkt der Woche gewesen war, die einzige Zeit, in der sie wirklich locker und unbeschwert hatte sein können, viel mehr als am Samstag, denn nach dem Samstag kam der Sonntag, und der war entwertet durch die Aussicht auf den Montag, wenn das ganze Theater mit Seminaren, Hausarbeiten und Prüfungen weiterging. Sie war mit ihren Freundinnen ausgegangen, hatte ein paar Bier und ein Glas Cuervo getrunken und dann getanzt, bis der Rhythmus der Musik von ihren Fußsohlen aus durch den ganzen Körper geströmt war und sie beinahe das Gefühl gehabt hatte, hören zu können wie alle anderen. Sie hatte sich nach diesem Loslassen gesehnt, nur danach, denn sie hatte sich so anstrengen müssen, um ihre Behinderung auszugleichen – und noch heute arbeitete sie härter als alle, die sie kannte; sie trieb sich mit ihrer inneren Peitsche an, die all ihre Kindheitswunden offen und den Schmerz lebendig gehalten hatte. In der Schule hatte sie den Spott ihrer Klassenkameraden erduldet, sie hatte es ertragen, daß man sie als »langsam« brandmarkte. Taubstumm. Doof. Man hatte sie als doof bezeichnet – sie, die es mit jedem Hörenden aufnehmen konnte, mit jedem jenseits dieser Mauern. Die waren die Idioten. Die Polizisten. Die Richter. Die Dolmetscher.
Freitag abend. Bridger und sie wollten irgendwo thailändisch essen und sich dann einen Film ansehen, an dem er gearbeitet hatte, irgendeine wilde Kung-Fu-Geschichte, in der die Schauspieler an unsichtbaren Drähten durch die Luft flogen wie Peter Pan. Sie hatte sich die ganze lange, verrückte Arbeitswoche hindurch darauf gefreut. Die Studenten hatten ihre Arbeiten abgegeben, sie hatte an endlosen Konferenzen und Fakultätssitzungen teilnehmen müssen und kaum Zeit gehabt, sich auf das zu konzentrieren, was sie selbst schreiben wollte, und dabei türmten sich die Rechnungen, und sie war nicht dazu gekommen, sich hinzusetzen und Schecks auszustellen, ganz zu schweigen davon, daß die Elektrizitäts- und Gasgesellschaft und American Express und Visa durch Zahlungen besänftigt werden mußten, und obendrein hatte sie noch diesen Backenzahn unten links, der unablässig wütend pochte – und sie fragte sich, ob irgend jemand Dr. Stroud Bescheid gegeben hatte.
Da war die Toilette. Der Thron, wie ihre Mutter immer gesagt hatte. Unwillkürlich dachte sie über dieses Wort nach (war das Knastsprache? Stammte dieser bildhafte Ausdruck von Gefangenen?), bis sie merkte, daß sie sie benutzen mußte, denn der pißwarme Kaffee war in Urin – in Pisse – verwandelt worden, und sie blickte zur Nachbarzelle und den leeren Korridor entlang zu der großen Stahltür. Hatten die hier Kameras? Wartete in irgendeinem miefigen Büro irgendein schmutziger Wärter oder infantiler Polizist darauf, daß sie den Rock hob und sich auf das Edelstahlbecken hockte? Allein bei dem Gedanken wurde ihr wieder ganz heiß. Das Vergnügen würde sie ihnen nicht machen – eher würde sie ihre Körperausscheidungen resorbieren oder an einem Blasenriß sterben. Sie ging um die Toilette herum, zwang sich, nicht daran zu denken, und tröstete sich mit dem Gedanken, daß sie sehr bald wieder frei sein würde, und dann würde sie, wie jede andere unschuldige Bürgerin, die Damentoilette im Gerichtsgebäude benutzen.
Die Zeit verging. Sie wußte nicht, wie spät es war. Die Zelle hatte kein Fenster, die Uhr hatten sie ihr abgenommen, und in ihrer Welt gab es keine Kirchturmuhren, die die Viertelstunden schlugen, und keine Vögel, die den Tag mit Gesang verabschiedeten. Für sie war es in der Hauptverkehrszeit so still wie für einen Hörenden mitten in der Nacht – nein, noch stiller, viel stiller. Die anderen hörten immerhin die Grillen. Sie hörten Hintergrundgeräusche: das Brummen des Kühlschranks, das entfernte hohe Geheul eines Kojoten, der Beute gemacht hatte, den Motor eines Wagens irgendwo im klebrigen Netz der Nacht. In Büchern hörten sie es. Im Fernsehen und in Horrorfilmen. Lautes Geräusch, stand dann im Untertitel. Das Klirren von Glas. Ein Schrei. Dana hörte es nicht. Sie hörte nichts. Sie lebte in einer anderen Welt, einer eigenen, besseren Welt, die Stille war ihre Zuflucht, ihr hartes, unveränderliches Gehäuse, und von tief aus diesem unnachgiebigen Kern sprach sie zu sich selbst. Das war ihr wahres Ich, die Stimme, die niemand hören konnte, selbst wenn sie die leistungsstärksten Hörgeräte oder Cochlea-Implantate trug oder lautstark durch die Welt der Hörenden stapfte. Da kam niemand hin.
Irgendwann blieb sie stehen. Sie war plötzlich müde, völlig am Ende, und ließ sich auf die Kante einer Pritsche sinken. Lange saß sie zusammengesunken da, wippte mit einem Fuß und schlüpfte aus dem Schuh und wieder hinein, hinaus und hinein. Es war einfach zuviel. Hier war sie nun, eingesperrt wie ein Tier, und warum? Wegen Dummheit. Wegen Inkompetenz. Weil irgendein Bürokrat einen Fehler gemacht hatte. Was sie am meisten ärgerte, mehr als die Ungerechtigkeit und Dämlichkeit dieser ganzen Sache, mehr als Iverson und die Polizisten und alle anderen, die an dieser dahinstolpernden, verdrehten, schwachsinnigen Bürokratie mitwirkten, war die Zeitverschwendung. Die Arbeiten ihrer Studenten waren im Wagen – den man inzwischen zweifellos beschlagnahmt hatte –, und sie konnte das Abendessen und den Film und den Plan, die Nacht bei Bridger zu verbringen, vergessen, denn nun würde sie die halbe Nacht damit verbringen dürfen, die Arbeiten durchzusehen. Eigentlich könnte sie das gleich hier tun, in ihrer erzwungenen Abgeschiedenheit. Und ihr Buch. Sie hatte sich – und Bridger – geschworen, daß sie dranbleiben und jeden Tag eine Seite schreiben würde. Was für ein Witz! Sie war schon den ganzen Monat im Rückstand – sie hatte, wenn es gut gelaufen war, eher einen Absatz pro Tag geschrieben – und hatte sich darauf gefreut, diesen Rückstand am Wochenende aufzuholen: Während Bridger ausschlief, würde sie auf dem Notebook tippen, neben sich eine Tasse Chai, um das Räderwerk zu ölen, der Morgen würde sich, begleitet von einem steten Fluß der Inspiration, entwickeln, und am Horizont stünde die Verheißung der Sommerferien.
Oder auch jetzt. Warum nicht jetzt? Hatte Jean Genet sein Notre-Dame-des-fleurs nicht im Gefängnis geschrieben? Auf Klopapier sogar? Sie wäre am liebsten aufgestanden und hätte am Gitter gerüttelt wie James Cagney oder Edward G. Robinson in diesen alten Filmen, die sie so liebte und die Bridger haßte, hätte am liebsten so lange geschrien, bis jemand mit einem Kugelschreiber und einem Notizblock gerannt käme. Es war beinahe zum Lachen. Und es wäre wirklich urkomisch, ihre persönliche Reality-Show: »Fahr mit dem Auto und lande im Gefängnis.« Dr. Stroud, der zwei Stunden herumgesessen hatte, würde es sicher rasend witzig finden. Und ihre Studenten. Und Dr. Koch, der Direktor – er würde sich bestimmt den Bauch halten vor Lachen: Eine seiner Lehrerinnen saß nicht im Seminarraum, sondern im Gefängnis.
Zum Brüllen, ja. Aber sie mußte pinkeln. Es war jetzt wirklich dringend, kein bloßes Unbehagen, kein unbestimmter innerer Druck – wenn sie nicht sofort pinkelte, würde sie es nicht mehr zurückhalten können, und wie würde Bridger sich fühlen, wenn er sie vor all diesen Polizisten und Sekretärinnen in den Arm nahm und sie auf ihrem Rock einen großen, dunklen Fleck hatte?