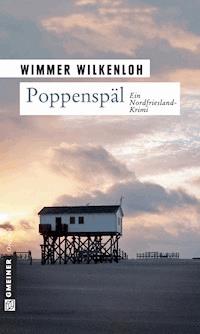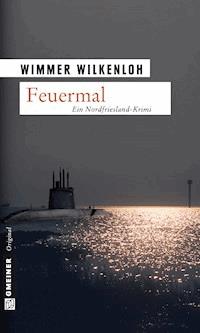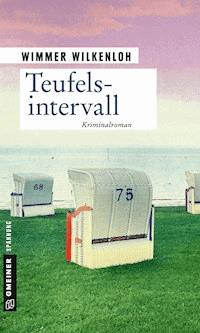
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Jan Swensen
- Sprache: Deutsch
Der vermeintliche Unfalltod des Kommando-Soldaten Gerd Lutze wird von einem Erfolgsregisseur als Spielfilm umgesetzt. Merkwürdige Vorfälle während der Dreharbeiten sollen von Jan Swensen und seinen Kollegen von der Husumer Kriminalpolizei aufgeklärt werden. Im Filmteam wird von Verschwörung gesprochen, doch erst als ein Mord geschieht, wird auch wirklich ermittelt. Aber was hat das alles mit dem Deutschtürken Gülcan Bayar aus Husum zu tun, der von den USA als Terrorist nach Guantanamo verschleppt wurde? Und was macht der Autor Wimmer Wilkenloh in seinem eigenen Roman? Findet sich eine Antwort in dem Film, dessen brisante Story bis ins Kanzleramt zu Frank-Walter Steinmeier führt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wimmer Wilkenloh
Teufelsintervall
Der siebte Fall für Jan Swensen
Zum Buch
Nichts ist, wie es scheint Der vermeintliche Unfalltod des Kommando-Soldaten Gerd Lutze wird von dem Erfolgsregisseur Detlev Rehmke in einen Spielfilm umgesetzt. Merkwürdige Vorfälle während der Dreharbeiten sollen von Jan Swensen und seinen Kollegen von der Husumer Kriminalpolizei aufgeklärt werden, doch die finden nichts Verdächtiges. Im Filmteam wird von Verschwörung gesprochen, doch erst als ein Mord geschieht, wird Swensen in eine dramatische Ermittlung verstrickt, die ihn bis an den Rand der Erschöpfung bringt. Aber was hat das alles mit dem Deutschtürken Gülcan Bayar aus Husum zu tun, der von den USA als Terrorist nach Guantanamo verschleppt wurde? Der Mordfall führt Hauptkommissar Swensen auch zu dem Autor Wimmer Wilkenloh, der das Drehbuch für Detlev Rehmkes Film verfasst hat. Der redet ebenfalls von einer Verschwörung und fühlt sich verfolgt. Die Spirale zieht sich zusammen, offensichtlich ist selbst der Geheimdienst an der brisanten Story von Rehmkes Film interessiert und eine heiße Spur führt bis ins Kanzleramt zu Frank-Walter Steinmeier.
Wimmer Wilkenloh, von der Nachkriegszeit, dem Wirtschaftswunder und den 68igern geprägt, ist seit frühster Jugend kreativ. Nach einer langen Reise durch den mittleren Osten über Afghanistan nach Indien und Nepal, entdeckt er seine Spiritualität noch einmal anders, studiert an der Kunsthochschule Hamburg und arbeitet danach als freier Autor beim NDR-Fernsehen. All diese Erfahrungen finden sich in seinen Kriminalromanen wieder, die allesamt auf der Halbinsel Eiderstedt spielen. Seit über 20 Jahren hält sich der Autor nicht nur zum Recherchieren dort sehr gerne auf, er fotografiert auch die Details der einzigartigen Küstenregion. Das Wattenmeer, die sich stetig verändernde Landschaft, bildet den Hintergrund für den buddhistisch geprägten Hauptkommissar Jan Swensen.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Hungergeist (2015)
Spurensuche am Meer (Postkartenbuch zu Donnergrollen, 2012)
Donnergrollen (2012)
Eidernebel (2011)
Poppenspäl (2009)
Feuermal (2006)
Hätschelkind (2005)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Stockimo/shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-5692-3
Zitat
Das vierte Viertel im Norden aber ließ ich leer. Weder Sonne noch Mond scheint dort. Aus diesem Grunde ist an jenem Ort, fern von allen weltlichen Gegebenheiten, die Hölle, die weder ein Dach darüber noch einen Boden darunter hat. Hier ist es, wo reine Düsternis regiert, doch steht diese Düsternis gleichzeitig im Dienste all der Lichter meines Ruhmes.
Hildegard von Bingen
Zitat
Wie lang soll ich als Leib ohn’ Seele klagen,
Blattstreuend, gelb von Gram, gleich Herbstestagen?
Von Leid und Kummer ist mein Herz verbrannt –
Wie lang verberg ich noch des Feuers Plagen?
Feindschaft vom Freund – wie lang? Brichst Leib und Seele!
Wie lang soll ich, zerbrochnen Herzens, zagen?
Kommt früh dein Traumbild zu mir, Mond: durch Wellen
Von mir vergoßnen Bluts, wie kann sich’s wagen?
Mein Gram macht Stein zu Wasser – ich bin, leider,
Kein Stein: dies Wort lässt Flammen aus mir schlagen!
Dschelaladdin Rumi
Der Autor
Das Wort ward Fleisch
Wenn ich eine Geschichte wirklich ernst nehme, stehe ich vor dem Problem, dass jeder Anfang, den ich setzen möchte, mir mit der Zeit willkürlich vorkommt. Ist die von mir erdachte Geschichte aber zwingend genug, wird das weiße Blatt Papier, das meinem Fleisch Worte abverlangt, wie ein Spiegel meines selbst erzeugten Begehrens. Die erbarmungslose Leere drängt zu einer Zäsur in die Quantität der Möglichkeiten, denn selbst der größte Stern verdankt seine Substanz nur einer Zäsur in die unendlichen Eventualitäten von Kohlenstoffatomen; genauso wie dieselben Kohlenstoffatome eine Zäsur in der Druckerschwärze symbolisieren, die meinen Buchstaben in dem fertigen Buch einmal die Form verleihen werden. Aber ist etwas Niedergeschriebenes deshalb auch gleich real? Bleibt eine Geschichte nicht letztendlich immer fiktiv? Oder ist beides gleichzeitig beides? Hat Intuition etwas Zufälliges? Dann wäre eine Geschichte nur eine Reihung von Zufällen! Oder ist Intuition eine besondere Fähigkeit, sich mit der Wirklichkeit zu verbinden? Dann könnte einer Geschichte möglicherweise gelingen, auf eine zukünftige Entwicklung hinzuweisen, sie sogar zu beeinflussen.
Was ich mir allerdings zu dem Zeitpunkt, als ich diese Gedanken ziemlich naiv niederschrieb, noch nicht vorstellen konnte, war die Tatsache, dass selbst die Buchstaben der Geschichte, die ich gerade beginnen wollte, auf natürliche Weise mit dem Gewebe allen Lebens verflochten waren. Denn mit jedem neuen Wort, das ich auf die erste leere Seite setzte, drang ich auf ein mir unbekanntes Feld vor, das sich durch mein Handeln veränderte und dadurch auf mich persönlich zurückwirkte. Das Fleisch produzierte eben nicht nur die Worte, diese Worte hatten schon im selben Moment wieder Einfluss auf das Fleisch. Als mir die Tatsache dieser Interaktion erst sehr viel später bewusst wurde, ich sie als real anerkennen musste, war es für mich kaum noch möglich, die Folgen abzuwenden. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem ich fast am Ende der Geschichte angekommen war, befand ich mich durch mein eigenes Dazutun plötzlich in einer prekären, wahrscheinlich sogar lebensbedrohlichen Situation.
Ich schrieb sie im Jahr 2006. Mein Name: Hans-Walter Wilkenloh, als Kriminalautor nannte ich mich »Wimmer Wilkenloh«, und ich war 58 Jahre alt. Aber bevor ich nochmals abschweifen konnte, setzte ich ins Hier und Jetzt meine angekündigte Zäsur:
2003 Teufelsintervall
Es ist nasskalt, schwarze Quellwolken kriechen vor einem Vollmond über den stumpfen Himmel. Der Winter kommt früh in diesem Jahr, findet Gert Lutze, schaut zu den Dächern hinauf und atmet die feuchte Abendluft tief in seine Lungen ein. Er ist erschöpft, seine Haut leichenblass. Die müden Augen liegen tief in ihren Höhlen und haben dunkle Ränder. Es ist 17.30 Uhr, als er sich auf den Weg macht. Das Auftreten bereitet ihm ziehende Schmerzen im rechten Bein. Er bemerkt, dass er bereits eine Schonhaltung eingenommen hat, beißt die Zähne zusammen und versucht, möglichst natürlich zu gehen. Die rechte Fahrbahn der Nordhusumer Straße ist vollgeparkt. Er wechselt auf die andere Straßenseite, damit er sich nicht in dem beengten Raum zwischen Hausmauern und Autoblech bewegen muss. Als er an einem der typischen vierstöckigen Ziegelhäuser mit Giebelerkern vorbeigeht, schnellt ein Schatten nurwenige Zentimeter an seinem Gesicht vorbei. Er spürt den kurzen Windzug, als im selben Moment ein explosionsartiger Knall seine Gedanken sprengt. Direkt vor seinen Füßen ist eine Bierflasche auf dem Bürgersteig aufgeschlagen und in tausend Stücke zersprungen.
Der Schock, der ihn erstarren lässt, fühlt sich an wie ein Stromschlag, der seine Muskeln lähmt. Ihm wird schwummrig. Ungläubig betrachtet er die sternförmig verteilten Glassplitter, den verspritzten Bierschaum, der auch in langen, weißen Streifen an seinen Hosenbeinen hängt. Auf dem abgebrochenen Flaschenhals, der links an die Hauswand gerollt ist, sitzt noch der Kronenkorkenverschluss.
Lutze weiß nicht, wie lange er nach dem Aufprall ohne eine Regung dasteht, wann er seinen Kopf hebt, um hochzuschauen. Als er es endlich macht, sind alle Fenster an der Hausfassade geschlossen und die Scheiben so blind wie die Nacht, die sich in ihnen spiegelt. Es gibt nichts zu sehen, was darauf schließen ließe, woher die volle Bierflasche gekommen ist, die nur um Haaresbreite seinen Kopf verfehlt hat. Bei der Wucht, mit der sie aufgeschlagen ist, muss sie aus einem der oberen Stockwerke geworfen worden sein. Da oben gibt es einen Menschen, der mutwillig auf Fußgänger zielt, denkt er angestrengt, und sein Gedankengang ist so gewichtig wie Blei.
Aber wer sollte so etwas machen?
Und warum?
Verdammt, wenn dieser Hirnrissige mich getroffen hätte!
Er spürt seine Beine zittern, fühlt, wie sein Herz bis zum Hals schlägt. Wie auf Knopfdruck springt in seinem Hirn ein Projektor an, wirft altbekannte Albtraumbilder, die er aus seiner Zeit im siebenten Kreis der Hölle mitgebracht hat, an die angespannte Leinwand seines Bewusstseins, völlig real und dreidimensional.
Er sieht, wie der olivfarbene Bus, der das Gepäck transportiert, in eine Kurve fährt. Kurz dahinter, im zweiten Fahrzeug, sitzen 32 uniformierte Männer. Der rötliche Hof um die aufgehende Sonnenscheibe sickert durch den schmutziggrauen Dunst, als sie den Stadtrand von Kabul erreichen. Es riecht nach Schweiß, Müll und Smog. Zerlumpte Kinder mit zerzausten schwarzen Haaren und knochige Männer mit Turban bleiben an den Straßenrändern stehen, schauen neugierig, während die Fahrzeuge wie Fremdkörper an ihnen vorbeirollen.
Er sieht, wie er den Arm zum Winken hebt, als im gleichen Augenblick eine Druckwelle die Frontscheibe, einer Seifenblase gleich, nach Innen drückt und zerbersten lässt. Das letzte Bild sind seine verschwitzten Hände, dann trifft der blendende Lichtblitz in einer Flutwelle auf seine Augen und schleudert seinen Kopf gegen eine Mauer aus tiefvioletter Dunkelheit.
Auf dem Weg dorthin fliegen zeitlupenartig Glas- und Metallspitzen durch die Luft auf ihn zu, dringen unter seine Haut und tätowieren stumm seine unsterbliche Seele.
Er sieht sich erwachen, unter dem verdrehten Fensterrahmen in seinem Blut liegen und auf die spitzen Glaszähne starren, die aus der Gummidichtung ragen.
»Alles wird gut, alles wird wieder gut«, sagt eine Gestalt dicht neben seinem Ohr.
Die Gestalt des Mannes wirkt schattenhaft, seine Stimme klingt unwirklich, kommt von weit entfernt, als spräche jemand aus dem Jenseits. Um ihn herum herrscht Chaos. Vier Körper liegen unter blutigen Leinen auf der staubigen Straße. Aus seinem Ober- und Unterarm ragen Splitter durch den Stoff, die aussehen wie Pfeilspitzen. Die Fahrerseite des Busses ist aufgerissen, scharfe Blechteile deuten wie Zeigefinger in den schleierverhangenen Himmel. Es ist Samstag, der 7. Juni 2003.
Afghanistan kriecht unter seine Haut. Ein Trigger beschwört die alte, existenzielle Angst. Darüber gerinnt seine Wut zu blasigem Schaum, den er sich von der Hose wischt. Und dann spürt er, dass er sich wieder bewegen kann, die Glassplitter der Bierflasche mit dem Fuß in den Rinnstein kickt, die Muskeln spannt, die Fäuste ballt und erneut den Kopf hebt. Sein Blick verharrt auf dem obersten Stockwerk, auf den Fenstern im Giebelerker, hinter denen kein Licht brennt. Da oben hält sich ein abgedrehter Spinner verschanzt, da ist er sich sicher, steht im Dunkeln hinter den Gardinen und lacht sich eins.
Du musst hier weg! Hau ab hier! Sofort!
Die Worte scheinen ihn nicht zu erreichen, brüllen nur bedeutungslos auf ihn ein, dröhnen durch seinen Kopf, bleiben in seinen Ohren, bis er endlich den Rückzug antritt. Erst jetzt bemerkt er, dass er seine Tasche mit Notenheften, Badezeug und Handtuch fallen gelassen hat. Sie liegt bespritzt auf dem Bürgersteig, mitten zwischen Bierschaum und Glassplittern, und muss ihm, ohne dass er es bemerkt hat, von der Schulter geglitten sein. Lutze kommt jedoch nicht mehr dazu, sie aufzuheben. Als er sich gerade herunterbeugen will, tritt eine Person an seine Seite. Eine zierliche Hand greift nach dem Tragegurt und hebt die Tasche vom Boden auf.
»Ist dir nicht gut, Gert?«, fragt eine besorgte Stimme, die er kennt und die ein wenig an Zarah Leander denken lässt.
Lutze wendet seinen Kopf zur Seite, neben ihm steht Marga Obermayr, die erst seit Kurzem mit im Chor singt. Sie ist ein Alt, wie es im Theodor-Storm-Chor heißt. Aber Marga kann auch tiefer singen, beherrscht die seltene Stimmlage des Kontraalt, und so besetzt sie, wenn mal wieder Tenöre am Probeabend fehlen, ohne Weiteres auch diesen männlichen Gesangspart.
Die Obermayr ist ihrem Äußeren nach das typische Urbild einer Altistin, ein wenig mollig, melancholisch und dunkelhaarig. Lutze nimmt aus ihren Händen wortlos seine Tasche entgegen, versucht mit seiner Bassstimme ein »Dankeschön« zu formen, doch sie versagt ihm, muss in seinem Schock verschollen sein. Marga schaut ihm eindringlich in die Augen. Ihr Blick pendelt zwischen verwirrt und bestimmt hin und her, bis sie schließlich sagt: »Du willst doch auch zur Chorprobe, oder?«
»Doch, ja! Natürlich!«, findet er seine Sprache wieder und hängt sich die Tasche um. »Es ist nur gerade was passiert …, da hat … jemand hat eine Bierflasche nach mir geworfen.«
»Die kaputte Flasche da?«
»Genau! Muss von irgendwo dort oben gekommen sein, glaube ich.«
»Wer macht denn so was?«
»Weiß ich nicht, irgend so ein feiges, hirnamputiertes Arschloch wollte mir anscheinend den Kopf spalten.«
»Du meinst, mit Absicht, Gerd? Bist du dir sicher?«
»Nein, natürlich nicht. Aber wonach sieht es denn aus?«
»Soll ich die Polizei rufen?«, sagt Marga und zieht ihr Handy aus der Tasche.
Gerd Lutze schüttelt den Kopf, macht eine abwehrende Handbewegung. Das ist genau das, weswegen er die Obermayr lieber auf Abstand hält, sie ist distanzlos, geradezu übergriffig. Ständig mischt sie sich in seine Dinge ein, will immer alles von ihm wissen.
»Nee, keine Polizei, bloß nicht!«, wehrt er ihr Vorpreschen ab. »Lass uns einfach von hier verschwinden, wir sind sowieso zu spät dran.«
»Ganz wie du willst«, zischt die Obermayr einsilbig, der beleidigte Unterton ist unüberhörbar. Sie dreht sich abrupt um und geht mit zügigen Schritten einfach los. Lutze ist erleichtert und trabt hinterher, weg von dem Vorfall, der seine alten Geister geweckt hat. Er holt aus, versucht sich wieder einzukriegen und ist an der Ecke Nordhusumer Straße/Gurlittstraße mit der Obermayr wieder gleichauf. Sie marschieren eine Weile schweigend nebeneinanderher, passieren am oberen Ende der Straße einen langen Flachbau, und Lutzes Blick schweift beiläufig zur Hauswand, an der sich vier hölzerne Reklametafeln reihen. ›Völkerverständigung‹ verkündet das Großplakat auf der ersten, ohne dass ersichtlich für ein Produkt geworben wird. Auf der nächsten Fläche ist gar kein Text, dafür vier identische Minirockschönheiten in weißen Männerhemden mit Krawatte. Eine überdeutliche Anspielung auf die FDJ-Uniformiertheit in der ehemaligen DDR. Lutze stößt es jedes Mal sauer auf, wenn er hier vorbeikommt.
Keiner dieser naiven Werbewessis würde solch eine platte Anspielung witzig finden, wenn er im anderen Teil Deutschlands aufgewachsen wäre, denkt er geladen, während er die dritte Plakatfläche in Augenschein nimmt, auf der neben einem roten fünfzackigen Sowjetstern die Textzeile steht: ›Bei uns sind alle gleich‹ und ein Pfeil dahinter die Richtung vorgibt: ›gleich um die nächste Ecke‹. Das letzte Plakat ›Uns gehört die Nacht – Husums Kultdiskothek Nachtschicht‹ würdigt er schon keines Blickes mehr, weil er hier schon öfter vorbeigekommen ist und die blöde Botschaft bereits in- und auswendig kennt.
Und uns gehört der Husumer Theodor-Storm-Chor, meldet sich ein abstruser Widergedanke, der Lutze verstört und der ihn fragen lässt, warum sich seine ganze Bitterkeit auf einen harmlosen Jugendtreff richtet. Allerdings trägt diese Disko, wenn auch nur indirekt, eine gewisse Mitschuld an dem Zustand seiner Ausweglosigkeit. Nun ja, dann wäre sie natürlich auch daran beteiligt, dass er in diesem Augenblick zum Singen geht.
Er verwirft die Überlegungen, noch bevor er zu Ende gedacht hat. Vielleicht sollte er seinen Therapeuten lieber darum bitten, ihm bei der nächsten Sitzung kräftig sein Hirn durchzukneten.
Es ist einzig und allein seine Entscheidung, dass er seinem Leiden mit Pauken und Trompeten Paroli bietet. Und nur deshalb ist er auch bei dem spektakulären Konzert mit dabei, das zum Jahresende auf dem Spielplan steht. Chorleiter Jens Eberlein hat es sich in den Kopf gesetzt, dieses Jahr in Husum das Weihnachtsoratorium zur Aufführung zu bringen, und darum wird seit mehreren Wochen bereits besonders ausgiebig geprobt.
»Ich hoffe, du hältst mich jetzt nicht für verrückt, Marga«, glaubt Lutze sein schweigendes Insichgekehrtsein erklären zu müssen, als sie die Neustadt erreichen und auf Höhe des Theodor-Storm-Hotels in die Schlossstraße in Richtung Innenstadt abbiegen.
»Meinst du das mit der Bierflasche?«
»Nicht nur! Ich weiß, ich wirke vielleicht ab und zu etwas angespannt, aber ich hab gerade einiges an der Hacke, und die Abende mit dem Chor sind auch nicht immer ganz einfach für mich.«
»Beichtest du mir das, weil du keine Noten lesen kannst?«, sagt Obermayr in ihrer direkten Art und grinst verschmitzt.
»Eeeh, woher weißt du das?« In Lutzes Stimme schwingt eine unterschwellige Verunsicherung mit.
»So etwas entgeht mir halt nicht.«
»Ja, aber woher weißt du das? Hat Eberlein so was angedeutet?«
»Gott bewahre, nein!«
»Falls der Wind davon kriegt, geht mein Platz im Weihnachtsoratorium wahrscheinlich den Bach runter. Das wäre bestimmt nicht gut für mich.«
»Eberlein hat keine Ahnung, glaub mir, Gerd, der ist ein Wichtigtuer, ein echter Piefke, wie die Österreicher sagen. Solange du deine Einsätze nicht verpatzt, ist der allemal froh, wenn du im Chor bist. Bei mir hat er auch nicht gemerkt, dass ich musikalischer Analphabet bin.«
»Du willst mich verschaukeln! Ich hab noch nie gesehen, dass du beim Singen nicht auf die Noten schaust.«
»Sich die Noten anzusehen kann durchaus nützlich sein. An den Noten erkennt man, ob die Melodie die Tonleiter rauf- oder runtergeht; und durch das elende Durcheinander von Achteln und Vierteln wird man gewarnt, dass gleich eine schwierige Passage kommt. Aber käme jemand auf die Idee, mir Noten einer Arie oder von einem unbekannten Volkslied in die Hand zu drücken, und würde dann auch noch verlangen, dass ich vom Blatt singe, ich würde nicht einen einzigen richtigen Ton treffen.«
»Du singst alles auswendig? Und du meinst, das funktioniert auch beim Weihnachtsoratorium?«
»Du singst einfach den anderen hinterher. Warte ab, es dauert nicht lange, und selbst die anspruchsvollen Passagen sitzen fest in deinem Kopf. Dann strömt alles wie von selbst aus dir heraus, egal wo du gerade stehst oder gehst.«
»Dein Wort in Eberleins Ohr.« Lutze grinst verkniffen. Dass er und die Obermayr ab jetzt dasselbe Geheimnis hüten, ist ihm nicht geheuer. Wahrscheinlich bringt es ihn noch mehr gegen sie auf. Angenommen, rumort es in seinen Eingeweiden, sie streut ihr Wissen absichtlich unter die anderen Chormitglieder, das könnte seine mühsamen Fortschritte mit einem Schlag zunichtemachen.
Sein Magen krampft sich zusammen, fast bis zum Brechreiz. Er geht neben Obermayr den menschenleeren Schlossgang zum Marktplatz hinunter, beobachtet sie dabei heimlich aus dem Augenwinkel und kommt zu dem Schluss, dass er bei der nächsten Gelegenheit mit seinem Therapeuten über die Obermayr reden sollte.
Oder ist alles Unsinn, was er sich da zusammenreimt, grübelt er und befürchtet, dass er seine Gedanken selber zu deckeln versucht. Wenn einer das beantworten kann, dann sein Seelenklempner. Der war es letztlich auch gewesen, der ihm das Singen im Kirchenchor als eine Möglichkeit ins Blickfeld gerückt hatte.
»Jeder Mensch hat ein kreatives Potenzial in sich, Herr Lutze«, hatte er ihm in einer Sitzung erklärt, »auch wenn bei Ihnen im Moment die Sicht eingeschränkt ist. Denken Sie drüber nach, wozu Sie Lust hätten, egal ob laufen, tanzen, singen, alles ist im Moment gleich gut für Ihren Heilungsweg.«
Nach dieser Therapiestunde war Lutze der hiesige Kirchenchor eingefallen, der einfachste und naheliegendste Entschluss, jedenfalls glaubte er das, bis Marga ihm eben abrupt eines seiner Geheimnisse präsentiert hatte.
Ein anderes Geheimnis: Schon als kleiner Junge hatte er im Kinderchor der Sankt-Trinitatis-Kirche in Wiesa gesungen, seiner Geburtsstadt in der ehemaligen DDR. Und ein musikalischer Mensch ist er bis heute geblieben, trotz allem, wohin ihn das Leben gebracht und was es mit ihm gemacht hat. Ein Leben ohne Musik ist für ihn nie ein Leben gewesen, auch wenn es zum richtigen Musiker nicht gereicht hat. Deshalb ist jeder Probenabend für das Weihnachtsoratorium zu einem unerwarteten Geschenk geworden, auf das er sich wie ein kleines Kind freut. Und es hat wirklich etwas Erhabenes, ein musikalisches Werk von dieser Länge einzustudieren. Diese Aufführung, wenn er denn dabei sein darf, wäre ein verspäteter Ritterschlag.
Gerade beim Singen von Bach, das hat er in der kurzen Zeit des gemeinsamen Probens bereits begriffen, wird ein Chor zu einem Gemeinschaftswesen. Mal verkörpert er mit seiner Stimme eine geifernde Volksmasse, mal einen lobpreisenden Engelschor.
Als Lutze sechs Jahre alt war, wollten seine Eltern unbedingt, dass er ein Instrument erlernt. Natürlich die obligatorische Geige, der Herzenswunsch seiner Mutter. Er schlug sie gegen eine Mauer und sagte, er wäre gestürzt. Dann bekam er Klavierstunden. Doch der Klavierlehrer wollte das Geld nicht mehr annehmen, weil keinerlei Fortschritt bei ihm festzustellen war. Es folgte die Flöte, dann die Gitarre. Er stand auf Kriegsfuß mit den Noten. Bei einer Saxofonistin hielt er es dann immerhin zwei Monate aus.
Später trauerte er der vertanen Zeit hinterher, bereute seine damalige Faulheit und seine mangelnde Bereitschaft, sich wirklich auf etwas einzulassen. Das Einzige, was er bis in die Gegenwart gerettet hatte, war seine Stimme. Er hat eine sehr schöne Bassbaritonstimme. Wie oft hatte er schon »Tosca« in den CD-Player geschoben, sich dann wie der Polizeichef Scarpia persönlich gefühlt und aus voller Kehle die Arie »Ha più forte sapore« geschmettert. Seine Stimme ist sein ganzer Stolz, mit ihr darf er jetzt wieder dabei sein, Musik zu machen, ganz große Musik.
Während er seinen Gedanken nachhängt, tackern Margas Schritte im synchronen Rhythmus über das rote Ziegelpflaster des schmalen Mittelstreifens, der den Schlossgang der Länge nach durchzieht. Von den Straßenlaternen fällt nur ein sparsamer Lichtschein auf das Pflaster. Die ganze Zeit über zieht Marga anstandslos über Jens Eberlein her. Der wäre der typische Mann ohne Eigenschaften, bemerkt sie abfällig, und dazu noch mit einer verschwiegenen DDR-Vergangenheit belastet.
Lutze ist genervt und gleichzeitig unsicher, ob sie bei anderer Gelegenheit nicht auch über ihn so herziehen würde, etwa: »Dieser Lutze ist nur ein Schmalspursänger, der keine Ahnung von Noten hat!«
In ihm köchelt eine Wut auf Sparflamme, die er sich aber nicht anmerken lässt. Er hält Eberlein nämlich für einen Profi mit musikalischem Verstand. Und seine Vergangenheit verheimlicht er überhaupt nicht, wie Marga behauptet hat. Wie er selbst, kommt Eberlein ursprünglich aus Wiesa, drei Kilometer nördlich von Annaberg. Das hat er ihm nach einer Probe ohne Umschweife verraten, völlig offen. Außerdem weiß Lutze aus seinem Mund, dass er als Kind Mitglied des berühmten Thomanerchors in Leipzig gewesen ist.
Durch den Torbogen des alten Rathauses wehen ihnen die Glockentöne von Sankt Marien entgegen, die die 18. Stunde schlägt. Jetzt ist es amtlich, sie kommen zu spät. Im Laufschritt traben sie die letzten Meter über den Marktplatz und fegen in Windeseile die Treppe vom Eingangsportal zur Kirchentür hinauf. Lutze atmet noch einmal tief die kalte Luft ein, bevor er die Klinke drückt und mit Marga eintritt.
»Hff! Tss! Sch!«
Eine sich wiederholende Flut von Zischlauten hallt durch das von zwei Säulenreihen gestützte Kirchenschiff, sie prasselnvon der Empore herab und tönen wie eine leise stampfende Dampflokomotive, die immer schneller in Fahrt kommt. Der Chor über ihren Köpfen ist in der Aufwärmphase. Behutsam setzen Obermayr und Lutze ihre Füße auf die Treppenstufen, die hinauf in den Olymp führen, wie die Probeplattform von allen ehrfurchtsvoll betitelt wird. Trotz aller Bemühungen von Lutze knarrt das Holz wie ein wachsamer Schwellenhüter, kündigt ihr Zuspätkommen bereits an, bevor sie leibhaftig oben angekommen sind. Obwohl der Chor die Nachzügler beflissentlich übersieht, allerdings Lücken in der Formation freigelassen hat, haftet ihrer Ankunft etwas Unangenehmes an; sie sind es, die stören.
»A-e-i-o-u-o-a-e-i!«, formt Eberlein die Töne mit dem Mund vor, paddelt dabei mit schlackrigen Handgelenken durch die Luft und meint lakonisch: »Denkt einfach an die Muppet Show!«
Die jetzt 42 Sänger und Sängerinnen stimmen in das Buchstabengewirr mit ein, bis der Chorleiter in die Hände klatscht und alle herzlich begrüßt. Er ist ein großer, durchtrainierter Mann mit Krähenfüßen um die Augen, zwei Leberflecken auf der Stirn und spärlichem Haar mit reichlich grauen Strähnen.
»Nummer 21!«, verkündet Eberlein, und nachdem er die gewünschte Aufmerksamkeit hat, hebt er demonstrativ die Arme und legt seine feingliedrigen Finger locker in der Luft ab. Lautlos füllen sich die Lungen der Sängerinnen und Sänger. Alle Hände klammern sich an die vom häufigen Umwenden abgewetzten Notenblätter.
»Eh – re sei Gott – in der – Hö – – he.«
Nur ein paar Takte lang ertönt der Lobpreis aus vollen Kehlen der himmlischen Heerscharen, da bricht Eberlein schon wieder ab.
»Nicht langsamer werden, meine Damen! Und die Herren? Ihr schaut mir viel zu gebannt in die Noten. Hört auf die anderen, ihr sollt euch in den Gesamtklang einfügen. Also, volle Aufmerksamkeit bitte – noch mal!«
Das »Eh – re sei Gott« beginnt von vorn, und beim zweiten Versuch ist das Tempo schon besser, dafür hat Marga zu früh eingesetzt. Eberlein gibt einige Takte des Alt-Solos »… die lobten Gott und sprachen« vor, bis er jede Fraktion mit ihrem höchst eigenen Timbre mit seinen Dirigentenhänden zusammenfügt. Alles wäre harmonisch, würden sich nicht auf Margas Gesicht Anzeichen von Eingeschnapptsein abzeichnen. Bei einem kurzen Blickkontakt glaubt Lutze ihren vielsagenden Schmollmund zu erkennen.
Wahrscheinlich ist sie mit ihren Ohren wieder bei den Sopran-Zicken, die mit ihren Stimmen über den anderen schweben dürfen und alle dunkleren Töne verächtlich unter sich lassen können. Der Neid gehört seit ewigen Zeiten zum dem Chor immanenten Kleinkrieg, bei dem der rechte Block der Altistinnen hinterlistig gegen den linken Block der Sopranistinnen schießt, die mit ihrem hohen »A« bis kurz vor die Himmelspforte kommen und deswegen vermeintlich auch mühelos das Herz eines jeden Chorleiters erobern können.
Die Treppenstufen künden knarrend einen weiteren Nachzügler an. Es ist Ludwig Thiel, der auf der Orgel den Schlusschoral »Nun seid ihr wohl gerochen« begleiten soll. Als er nach einigem Gewusel vor den Tasten sitzt und alle Register zieht, findet Eberlein sein Tempo zu getragen. Er entledigt sich seiner Jacke und lässt die Stelle noch mal und noch mal wiederholen. Dann bricht er abrupt ab, wendet sich an den Chor.
»Lasst euch die Worte auf der Zunge zergehen: ›Tod, Teufel, Sünd und Hölle‹. Was ich euch damit sagen will: Vergesst mir die Konsonanten nicht. Die müssen knallen wie die Sektkorken! Bei den T-Lauten müssen eure Stimmbänder gespannt sein wie Flitzebögen, da muss eure ganze Abscheu gegenüber der Verdammnis zum Ausdruck kommen.«
Der Bass neben Lutze ist einer von den jungdynamischen Männern mit Zopf. Er heißt Ferdinand Wollesen und Lutze hält ihn insgeheim für einen dieser verspannten Bürohengste, wahrscheinlich Filialleiter eines Supermarkts. Er ist nicht viel jünger als Lutze selbst. Während der gesamten Ansprache von Eberlein blättert er heimlich im Terminkalender seines Handys und steckt das Ding erst in die Tasche, als der Dirigent die Hände wieder demonstrativ in die Höhe hebt. Die Damen des Soprans lassen ihre Stimme flirren, der Bass kriecht in die tiefsten Ecken der Empore.
»Nun seid ihr wohl gerochen – an eurer Feinde Schar.«
»Tempo halten, nicht langsamer singen, weil es leiser wird. Der Raum muss erobert werden«, unterbricht Eberlein. »›Nun seid ihr wohl gerochen‹ hat nichts mit Körperpflege zu tun, verstanden?«
Er lässt neu beginnen, gebraucht den ganzen Körper und alle Arme, die ihm zur Verfügung stehen, um schnelle, langsame, laute und leise Passagen aus den Stimmen herauszuholen.
Auch wenn’s Bach ist, der Text ist grottenschlecht, findet Lutze, während er sich verzweifelt bemüht, dass die atemberaubenden Achtelläufe ihm nicht im Wechselnotenhals steckenbleiben, und seine dunkle Baritonstimme sich in die nötige Höhe schwingt.
Denn Christus hat zerbrochen,
Was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
Sind ganz und gar geschwächt;
Bei Gott hat seine Stelle
Das menschliche Geschlecht.
Der letzte Ton verebbt wie das meditative Zirpen der Zikaden im letzten Lichtschein eines warmen Sommertages. Dann ist Stille, zwei Taktschläge lang, in denen selbst der Atem stockt.
»Das können wir für heute so stehenlassen«, sagt Eberlein und öffnet die Augen, nachdem er genügend Platz für die Ehrfurcht eingeräumt hat.
Der komplette Chor bleibt wie angewurzelt stehen, die Blicke weiterhin in die Noten versenkt. Mucksmäuschenstill tickt die Zeit und das Ensemble verharrt immer noch bewegungslos, bis es dem konsternierten Chorleiter endlich dämmert, dass sein Satz bewusst allzu wörtlich genommen wurde. Lautes Gelächter kommentiert seine Erkenntnis, die alle an seinem gequälten Grinsen ablesen können.
Auch Lutze hat bei dem spontanen Joke mitgemacht, aber mit den anderen darüber zu lachen, war ihm dann zu viel gewesen. Der böse Klang, die übermäßige Quarte als offen bekundete Schadenfreude hatte etwas von einem teuflischen Hohngelächter. Der Teufel steckt halt immer im Detail, wie es so schön heißt. Eberlein selbst war es gewesen, der den Chor während einer Probe auf dieses musikalische Phänomen hingewiesen und eine solche Abfolge dreier Ganztöne als »Tritonus« bezeichnet hatte, der in der Musikwelt auch unter dem Begriff »Teufelsintervall« bekannt ist.
So hört sich kein harmloser Spaß an, da ist Lutze sich sicher, dieses Gelächter war gezieltes Aufbegehren, der unterschwellige Wunsch, wenigstens einmal die vermeintliche Macht ihres Dirigenten öffentlich bloßzustellen. Wahrscheinlich, um klammheimlich alte, offene Rechnungen zu begleichen oder den unausgesprochenen Ärger über ungerechte Zurechtweisungen zu rächen.
Da ist es wieder, das Krampfen in seinem Magen, gefolgt von einem zwingenden Brechreiz. Und er hat dabei auch noch mitgemacht, obwohl er Eberlein als Musiker doch so schätzt.
Während er sich noch über sein Versagen grämt, werden schon zischend die Verschlüsse der ersten Wasserflaschen geöffnet, als würde im ganzen Raum ein Feuerwerk entzündet.
Er fühlt sein Unvermögen und die zunehmende Unfähigkeit, sich in der Welt noch zurechtfinden zu können. Alles das zu beherrschen, was für ihn als Soldat einmal eine Selbstverständlichkeit gewesen war.
Warum musst du auch ausgerechnet in einem Chor mitsingen? Warum spielst du nicht lieber Tennis oder läufst Marathon, grübelt er wehmütig und gibt sich selbst die Antwort: Nur, weil du verdammten Schiss hast, Schiss, dass der ewige Einzelkämpfer in der Einsamkeit an seiner Angst erstickt. Deshalb diese Flucht in eine musikalische Gemeinschaft. Dort bist du dir sicher, dass du deiner kranken Seele aus der Bredouille helfen kannst.
»Teil einer Gemeinschaft zu sein, macht jede noch so große Angst kleiner«, hört er den Therapeuten beteuern.
Er muss daran glauben, dass das so ist. Der Chor hat ihm eine neue Struktur gegeben, in die er sich nur in eine gebündelte Kraft einfügen muss, die ein höheres Ziel anstrebt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, lautet eine Devise im Chor. Das hört sich für ihn vertraut an, damit kennt er sich aus. So könnte auch der Tagesbefehl an einen Soldaten der Kommando-Spezialkräfte lauten. Das Gesetz einer Partitur ähnelt verblüffend einer präzise durchdachten Angriffsstrategie auf das Böse. Als er auf diesen Vergleich gekommen war, hatte sich die Hölle in seinem Kopf langsam erträglicher angefühlt. Das gilt nicht für immer, aber immer mal wieder.
Dafür ist er Jens Eberlein dankbar, denn keine der Personen aus seinem Chor steht mehr im Dienst des Ganzen als der Dirigent. Lutze hat am eigenen Leib erfahren, wozu ein Vorgesetzter in der Lage ist. Ohne seinen Zugführer wäre er wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Dieser Mann war es gewesen, der bei ihm gesessen und seine Hand gehalten hatte, als er nach der Explosion im Lazarettzelt wieder zu sich gekommen war. Dieser Mann hatte dafür gesorgt, dass er so schnell wie möglich mit einer Transall ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht worden war, weg aus der Hölle Afghanistan.
»Alles wird gut«, hatte der Zugführer gesagt. Und vielleicht behält er ja auch recht. Er hofft es.
In der allgemeinen Aufbruchstimmung hält Lutze sich absichtlich abseits, zieht seine Daunenjacke an, hängt die Tragetasche über die Schulter und ist auf der Hut, dass er nur nicht in ein Gespräch verwickelt wird. Er möchte verhindern, dass es Marga gelingt, ihn auf dem Heimweg zu begleiten. Bewusst verabschiedet er sich von niemandem und verschwindet unauffällig aus dem Gewusel und Geschnatter der Gruppe, die sich am Ende der Probe immer um Eberlein scharrt. Vor der Kirchentür liegt das menschenleere Husum. Mit klagenden Obertönen streift der Wind um die Mauer der Westfassade der Marienkirche. Er ist erleichtert, stellt fest, dass die Temperatur empfindlich gefallen ist. Der Himmel gleicht einem dunklen Vorhang, der hinter den Häusern herunterhängt; im diffusen Schein der Schaufensterbeleuchtungen und Straßenlampen wirken sie wie überdimensionales Kinderspielzeug.
Die Stille, über der nur die schwingende Frequenz des Windes singt, macht ihm Angst. In der Luft breitet sich urplötzlich der süßliche Geruch von verbranntem Nitrocellulose-Pulver aus. Er will diese Erinnerung nicht haben, die ihn bedrängt, penetrant, ohne dass er etwas dagegen tun kann. In solch einem Moment springt ihn die Angst von vorn an; und wenn er sie fühlt, fürchtet er sich vor dem panischen Zustand, der ihn selbst nach bald eineinhalb Jahren nicht aus den Klauen lässt. Es ist genau diese Angst vor der Angst, die ihn die meiste Kraft kostet.
Fröhliche Stimmen dringen in sein verklebtes Gedankenvakuum. Zwei aufgekratzte Pärchen steigen gerade die Treppe aus dem »Ratskeller« hinauf, einem Restaurant im unterirdischen Gewölbe des alten Rathauses gleich gegenüber. Das Timbre ihres Gelächters hat etwas von malträtierten Violinen.
Lutze ist dankbar, dass sie die Stille aufgehoben haben, denn die Geräusche des Lebens ziehen ihn weg vom Rand des Abgrunds. Ohne nachzudenken, geht er los, quer über die Straße, folgt den beiden Paaren im Feld ihrer Stimmen. Als sie in den Schlossgang abbiegen, bleibt er ihnen auf den Fersen, erleichtert darüber, dass sie in seine Richtung gehen. Er ist ein Verfolgter, der andere verfolgt, um seinem Schatten zu entkommen. An der Ecke Neustadt/Gurlittstraße schlendern die Paare geradeaus weiter. Er holt tief Luft, weil er nach links abbiegen muss. Die unheimliche Stille greift erneut nach ihm. Der Wind, der den korpushaften Raum um ihn herum durchkämmt, erzeugt einen wimmernden Ton, fein und schrill wie eine ferne Kreissäge. Er kommt an den Resten der zersplitterten Bierflasche vorbei, die unverändert auf dem Bürgersteig liegen. In den oberen Fenstern brennt kein Licht. Wenige Schritte später erreicht er seinen Wagen, den er gestern etwas entfernt von seinem Hauseingang geparkt hat.
Das Badezeug hat Lutze nur deshalb zur Chorprobe mitgenommen, damit er es jetzt nicht noch aus der Wohnung holen muss, bevor er zu der Landzunge am Ende vom Dockkoog hinausfährt. Draußen, vor den Toren der Stadt, liegt eine Badestelle am Mettgrund, die in den späten Abendstunden zu einem Geheimtreffpunkt für hartgesottene Wasserratten geworden ist. Vom gepflasterten Badestrand aus können Schwimmer das ganze Jahr über gezeitenunabhängig in die Fluten der Nordsee steigen.
Der Berufssoldat steigt in seinen weinroten Fiat Punto und ist wenig später auf der Dockkoogstraße, die schnurgerade neben dem Außenhafen von Husum durch eine flache Wiesenlandschaft führt, vorbei an der Hafenschleuse bis zum einsamen Nordseehotel vor der Küste. Als Lutze das rechteckige Ziegelgebäude erreicht, das wie ein aufgestellter Tortenkarton neben dem Außendeich in die Höhe ragt, sind es noch knapp 20 Minuten bis 23.00 Uhr. Hier endet die befahrbare Asphaltstraße. Er steuert sein Fahrzeug auf die um diese Jahres- und Uhrzeit kaum genutzte Parkfläche für Badegäste, als seine Autolichter den zerbeulten Opel von Matthias Backauf erfassen. Lutze kennt den Mann noch nicht sehr lange, er hat ihn vor einigen Wochen beim Winterbaden kennengelernt. Backauf, wie immer überpünktlich, hebt den Arm zur Begrüßung, als der Fiat neben seinem Wagen zum Stehen kommt.
Der Mann ist groß, muskulös, hat ein auffällig fliehendes Kinn und hohe Wangenknochen. Und obwohl es vor der offenen See, abseits der Stadt, meistens empfindlich kalt ist, trägt er keinen Wintermantel, sondern nur eine kurze Fleecejacke. Was Backauf beruflich macht oder was er für Interessen hat, will Lutze gar nicht wissen. Aber dass er seit einigen Wochen bei jedem Wetter hier zum Baden herausfährt, daran hat Backauf einen großen Anteil. Auf einem seiner Spaziergänge waren sie sich zufällig über den Weg gelaufen. Er hatte beobachtet, wie Backauf bei eisigem Wind ins Meer hinausgeschwommen war, und war beeindruckt gewesen. Deshalb waren sie ins Gespräch gekommen und Backauf hatte ihm erklärt, beim Winterbaden gehe es nicht um sportliche Ambitionen, sondern ausschließlich darum, seinen inneren Schweinehund zu überwinden.
»Der Sprung in eiskaltes Wasser ist wie ein wahnsinniger Adrenalinkick«, hatte er ihm vorgeschwärmt. »Die Haut prickelt und du kommst in einem völlig euphorischen Zustand wieder an Land.«
Sofort wusste Lutze, dass diese Beschreibung ihn an seine Gefühle bei seiner Ausbildung und an die Einsätze gegen die Taliban erinnerte, Gefühle, die er unbedingt wieder fühlen wollte, und er hatte sich spontan mit Backauf zum Schwimmen verabredet.
Über sein eigentliches Motiv hat er bis heute mit keinem Menschen gesprochen, nicht mit Backauf, nicht mit irgendeinem aus seinem Chor, nicht einmal mit seinem Therapeuten. Der hat keine Ahnung, dass er überhaupt hier draußen schwimmen geht.
Er ist davon überzeugt, dieses Geheimnis vor allen anderen wahren zu müssen, um den Rest seiner verbliebenen Identität nicht auch noch zu verlieren. Es ist seine ganz persönliche Sache, warum es ihn immer wieder aufs Neue, fast schon süchtig, hier hinaus zum Husumer Badestrand treibt. Nur hier kann er seine eigene Kraft wieder fühlen, diese Kraft, die ihn an der Oberfläche halten kann, ohne dass es seinem Trauma gelingt, ihn in die Tiefe hinabzuziehen.
Backauf hat keine Ahnung von Lutzes Trauma. Sie sehen sich zwar fast jede Woche, aber miteinander gesprochen haben sie nie besonders viel, und wenn sie doch ein paar Worte wechseln, bleiben sie an der Oberfläche wie er beim Schwimmen.
Auch heute schlendern die beiden Männer, wie gewohnt mundfaul, nebeneinanderher über den schmalen geteerten Fußweg auf der Deichkrone. Im Sommer tobt an diesem Ort das Leben. Jetzt ist das auf Pfählen errichtete Holzgebäude mit dem Café, Kiosk und Restaurant geschlossen. Gegen den Nachthimmel hebt es sich, genauso wie der angrenzende Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft-Aussichtsturm, nur als eine schwarze Silhouette hervor. Die beiden Männer suchen sich einen trockenen Platz unter einer Treppe, legen ihre Kleidung ab und schlüpfen in ihre Badehosen. Der Holzsteg ist um diese Jahreszeit schon abgebaut. Auf Zehenspitzen trippeln sie zu einer Badetreppe hinüber, deren Stufen und Geländer bis zu den herantreibenden Wellen herabreichen. Die Flut hat bald ihren Höchststand erreicht.
Lutze lässt sich als Erster ins Wasser gleiten und taucht langsam bis zum Hals ab. Ihm ist, als würde er von einem kalten Schlund verschluckt, der sich eisig um seine Haut legt. Für einen kurzen Moment bleibt ihm fast die Luft weg, doch dann schüttet der Körper Adrenalin aus und er fühlt sich wie berauscht, merkt, dass sein Blut schneller zirkuliert. Er macht ein paar kräftige Züge hinaus ins offene Meer, schwimmt, ohne sich umzudrehen, ins Nichts, während die Gischt über sein Haar leckt.
Backauf muss weit hinter ihm zurückgeblieben sein, er kann ihn nicht mehr hören. Ein violetter Schimmer liegt über dem Horizont. Rechts kann er die blauvioletten Schlieren von Nordstrand erkennen, deren lockere Lichterkette die unsichtbaren Sterne ersetzt. Er fühlt sich plötzlich durch und durch von Leben erfüllt und schwimmt einige Züge mit geschlossenen Augen.
Wenn das Meer ihn einhüllt, hat er noch nie Angst bekommen, dann fühlt er sich sicher vor seinem Horrorkino im Kopf. Es muss etwas von dem glückseligen Zustand haben, den ein Embryo im Fruchtwasser der Gebärmutter haben soll, denkt er. Das ist wie ein Urvertrauen, dass alles gut ist.
Etwas packt seinen Fuß. Etwas anderes klammert sich um sein Handgelenk. Eine überlegene Kraft zieht ihn hinab. Der Mund taucht ab ins Nass, die Nase folgt. Da ist eine fremde Kraft unter Wasser, er kann es spüren. Er reißt die Augen auf und starrt in ein unendliches Nichts. Er will sich befreien, versucht, den Atem anzuhalten. Ein glattes, froschhäutiges Wesen klebt an ihm fest, zieht seinen Körper unaufhaltsam nach unten. Intuitiv greift seine freie Hand nach einer imaginären Leiter, an der er sich hochhangeln könnte. Aber es gibt keine. Panik erfasst seine physische Existenz, nackte Todesangst. Die Atemnot wird immer größer, er inhaliert Wasser, verschluckt sich, hustet, und noch mehr Wasser dringt in seine Lunge. Ein Strudel von Luftbläschen entweicht aus seinem Mund, perlt hinauf an die Wasseroberfläche und wird in die Gischt einer heranbrandenden Welle integriert. Wasser strömt durch seine Luftröhre, es brennt in der Brust. Er gibt auf. Alles Schwere fällt von ihm ab. Ein Ruhegefühl durchzieht seinen Körper, breitet sich aus. Er verliert das Bewusstsein, das Herz hört auf zu schlagen und er gleitet langsam hinab zum Meeresgrund.
2006 High Angle Shot
»Cut!« Die Stimme von Detlev Rehmke schnellt wie der nasale Schrei einer Sturmmöwe über das seichte Geplätscher der Nordseewellen. Helmut Brattenberger, der Mann hinter der Arriflex D-20, löst sein Auge von der Okularmuschel des Suchers, kräuselt ärgerlich die Brauen und schaut den Regisseur an, der direkt neben ihm in der Kanzel sitzt. Der schaut mit einem Anflug von Geringschätzung zu der Stelle im Wasser, an der Luftblasen an die Oberfläche steigen. Im nächsten Moment erscheint der gerade erst abgetauchte Darsteller wieder aus der Tiefe und atmet keuchend die kalte Abendluft ein.
»Das geht besser! Wir wiederholen das Ganze!«, ruft Rehmke so laut, dass es ja keiner der Mitglieder der Filmcrew überhört, die circa zehn Meter entfernt auf einem fest in der Nordsee verankerten Ponton steht. Als er sieht, dass seine Worte die gewünschte Hektik erzeugen, grinst er mit verschmitztem Gesichtsausdruck in sich hinein. Klaus Weiss, der die Rolle des Lutze verkörpert, hat mit einigen Schwimmzügen die Plattform erreicht und hebt den Arm. Ein spindeldürres Männchen im Pelzmantel zerrt am Oberarm eines Set-Runners und deutet befehlend auf den hochgestreckten Arm im Wasser. Augenblicklich stürzt der Mitarbeiter zu dem Schwimmer hinüber, beugt sich über den Rand und packt ihn an der Hand. Mit eisernem Griff zieht er den breitschultrigen Weiss mit einiger Mühe hoch auf festen Boden. Harald Schmidt-Boye, der Maskenbildner im Pelz, ist im selben Augenblick zur Stelle. Er reicht dem Schauspieler, dessen nackter Körper mit einer Gänsehaut überzogen ist, einen Bademantel und führt ihn schnurstracks zu einem Stuhl. Dort beginnt er, mit dem Handtuch seine nassen Haare trockenzurubbeln.
Währenddessen fährt mit Hilfe der Hydraulik der Teleskoparm des Krans lautlos zusammen und setzt die Kanzel mitsamt Regisseur, Kameramann und Assistenz sanft auf dem Beton des mächtigen Schwimmkörpers ab. Die Beleuchtungsanlage auf der künstlichen Arbeitsinsel schaltet sich wieder ein, setzt einen Lichtschein gegen die grellen Halogenscheinwerfer, die, aufs Meer gerichtet, die sanfte Vollmondnacht zum Tage machen.
»Bist du völlig übergeschnappt?«, kommt dem Regisseur die wütende Stimme von Kai Uwe Kahlheim in den Sinn, als er seine Beine schwungvoll über das Geländer der Kanzel schwingt und auf den festen Boden der Plattform stellt. In seinen Gedanken klingt dessen aufgeregtes Vibrato: »Was sage ich da, übergeschnappt ist untertrieben! Du bist verrückt, Detlev!«
Der Produktionsleiter war vor vier Tagen, während einer Motivtour mit dem Locationscout und seinem Kameramann, ohne Ankündigung am Husumer Badestrand aufgetaucht und hatte beim Sprechen wild mit den Händen in der Luft gefuchtelt.
»Du willst ein Ungetüm von 1,5 Tonnen vor die Küste schleppen, einen riesigen Teleskopkran daraufmontieren, nur um eine Kamerafahrt von einem Mann in Badehose zu machen, der mitten in der Nacht aufs Meer hinausschwimmt? Hast du dir Gedanken gemacht, was dieser ›Nachtgestalt-im-Wasser-Spaß‹ den Produzenten kosten wird?«
»Ich bin dafür da, dass meine Bilder das Publikum ins Kino holt. Das Budget liegt in deinem Aufgabenbereich, Kai Uwe, und das soll auch so bleiben«, hatte Rehmke dagegengehalten und dabei vielsagend die Augen verdreht.
»Und?« Kahlheim war abweisend gewesen, hatte gereizt an den Bügeln seiner blau-versiegelten Sonnenbrille herumgefingert und sie trotz magerer Wintersonne nicht abgenommen. »Diese paar Szenen müssen nicht unbedingt an der Original-Location gedreht werden! Es gibt an der Küste überall Ecken, an denen ihr es mit einfacherer Technik billiger machen könnt.«
»Wenn die Produktion es einfacher möchte, dann lasst uns Kühe auf der Weide abfilmen. Ich drehe keinen billigen Film, kapiert? Falls nicht, erklär ich’s dir noch mal, Kai Uwe, wir drehen die Bilder, die kommen, wenn der Vorhang aufgeht, die sollen den Zuschauer in seinem noch nicht angewärmten Kinosessel abholen und mit in die Handlung ziehen. So was braucht Aktion und spektakuläre Bilder!«
»Der kalte Arsch der Zuschauer ist nicht mein Problem, Detlev. Aber ich lass es dich wissen, wenn deine Extravaganzen uns in den Ruin getrieben haben.«
»Die Fahrt war perfekt, Detlev. Warum sie wiederholen?«, fragt der Kameramann. Sein Blick wandert mit offenen Augen übers Wasser. »Ich wüsste nicht, was ich verbessern könnte. Es sei denn, dir schwebt etwas völlig anderes vor?«
Rehmke, der innerlich noch bei Kahlheim ist und sich Gedanken zu dessen Status, Herold der Produktionsfirma zu sein, macht, hat Brattenberger nur mit halbem Ohr zugehört und seine Frage ist nicht in der Tiefe bei ihm angekommen. Wenn er eines hasst, dann Pfennigfuchserei und Geldgefeilsche. »Sorry, ich war einen Moment abwesend. Was hast du noch gefragt?«
»Was falsch an der Fahrt war«, wiederholt Brattenberger angesäuert.
»Wir bleiben die ganze Zeit dicht am Schwimmer, das ist mir zu statisch. Das Bild baut keine Spannung auf, fürchte ich. Erst am Ende, als er unter Wasser gezogen wird, nun ja, da wird’s einen Moment dramatisch. Aber gleich danach ist die Szene wieder fade.«
Rehmke kneift seine Augen zu Schlitzen zusammen. »Wir sollten den gesamten Raum mit einbeziehen. Ich denke an so was wie Leonardo DiCaprios Wahnsinnsszene in ›Titanic‹, als der mit dampfendem Atem durchs eiskalte Wasser paddelt.«
Brattenberger kann sich ein spöttisches Grinsen nicht verkneifen. »Das hier ist die Nordsee, Detlev, nicht der Nordatlantik. Willst du dich zum Gespött machen oder unter der Rubrik ›Bescheuertster Filmfehler‹ bei YouTube auftauchen?«
»Ich denke erst mal nur laut nach«, wehrt der Regisseur ab und kaut auf seinen Lippen herum. »Trotzdem, auch die Nordsee ist ein raues Meer. Wir brauchen eine geniale Idee.«
»Was hältst du davon, wenn Weiss auf die Kamera zuschwimmt. In ›Nah‹ fallen wir dann mit einem Schwenk in seinen Rücken und haben das breite Panorama des Meeres genau in dem Moment vor uns, bevor er unter Wasser gezogen wird.«
»Deswegen bist du mein erster Kameramann, Helmut! Man braucht nur ein wenig an deinem Talent zu kratzen, und schon sprudeln genau die Bilder aus dir heraus, die mir die ganze Zeit vorschweben.«
»Und gleich nachdem Weiss im Wasser verschwunden ist, fahren wir hoch hinauf in den ›High Angle Shot‹, um in einem ›Long Shot‹ auf Meer und Küste zu enden«, ereifert sich Brattenberger. »Ist das was?«
»Irgendwie hast du hellseherische Fähigkeiten, Helmut, so machen wir das, ganz genauso machen wir das!«
Rehmke winkt hektisch, bis er die Aufmerksamkeit der Aufnahmeleiterin hat, und ruft ihr von Weitem zu: »Ich will, dass das gesamte Equipment drüben an der Küste weiträumig aus unserem Blickfeld verschwindet. Die kleinen Fahrzeuge hinter das Holzgebäude, die großen auf den Parkplatz beim Nordseehotel. Für den nächsten Shot muss das gesamte Panorama für eine Supertotale menschenleer sein. Kümmere dich drum!«
Sahra Hubrich-Messow nickt nur knapp, spricht schon wenige Sekunden später ins Walkie-Talkie und ihre Anweisungen krächzen aus dem Lautsprecher, für alle hörbar, weit über den Ponton hinaus. Direkt gegenüber am Küstenstreifen setzt ein geschäftiges Treiben ein. Motorengeräusch und kaum hörbare Befehlsfetzen hallen über das Wasser herüber. Brattenberger spricht derweil mit dem Oberbeleuchter Weber, gibt ihm seine Wünsche bekannt, wie er das Führungslicht auf der Wasseroberfläche verändert haben möchte.
»Wir brauchen scharfes Low-Key-Licht. Du weißt schon, das typische Film-Noir-Feeling. Das Ganze muss so dunkel und düster daherkommen wie in ›Die Spur des Falken‹.«
»Dafür muss genügend Weißreferenz im Bild sein«, entgegnet Weber skeptisch. »Mit dem bisschen Gischt auf dem Wasser wirst du deine Vorstellung nicht umsetzen können, Helmut.«
»Was schlägst du vor?«
»Das Gesicht von Weiss weiß schminken. Es muss aussehen, als wenn es vom Mondlicht beschienen wird.«
Nur wenige Meter entfernt überprüft der Tonassistent das Funkrichtmikrofon, das unterhalb der Arriflex am Geländer der Kanzel befestigt ist. Detlev Rehmke und Regieassistent Jerker Lauri reden mit dem Bühnenmann, der für den Kamerakran verantwortlich ist. Sie tüfteln gemeinsam den exakten Moment aus, in dem der Teleskoparm mit der Kanzel in die Höhe gesteuert werden muss.
»Genau 15 Sekunden, nachdem die Taucher Weiss unter Wasser gezogen haben, muss der Teleskoparm in den ›Long Shot‹ gebracht werden, wobei die Kanzel sich um 90 Grad in Richtung Küste drehen muss. Lass uns das zusammen mit Helmut kurz antesten, bevor wir den Dreh fortsetzen.«
Während Rehmke den Kameramann zu sich ruft und mit ihm in die Kanzel klettert, geht der Finne Lauri zum Rand der Plattform. Er winkt die Männer vom Sicherungsteam herbei, die in glänzenden Neoprenanzügen in einem Schlauchboot mit Außenbordmotor sitzen, das in einiger Entfernung sanft in der See vor sich hin dümpelt.
»Was gibt es?«, ruft einer herüber.
»Einer von euch wird hier gebraucht!«, ruft er zurück. »Und der soll eine Tauchausrüstung mitbringen!«
Der Außenbordmotor wird angeworfen, das Schlauchboot macht einen kurzen Bogen und stoppt neben einer kleinen Eisentreppe, die vom Ponton ins Wasser hängt. Lauri reicht einem der Neoprenmännern die Hand, zieht ihn hoch und lässt sich eine Pressluftflasche reichen. Der Froschmann hängt sie über die Schulter und folgt dem Finnen, der ihn zu Weiss bringt.
»Was soll das hier eigentlich werden, Lauri?«, zetert der Schauspieler, während der Maskenbildner letzte Hand an ihn legt. »Nur weil ich Weiss heiße, muss ich doch nicht weiß geschminkt werden, oder?«
»Auf Wunsch des Beleuchters, Klaus. Die letzte Szene wird übrigens vom Ablauf her komplett geändert«, informiert der Regieassistent. »Du darfst, nachdem die Taucher dich unter Wasser gezogen haben, nicht sofort wieder auftauchen.«
»Ich kann aber nicht gerade sensationell lange die Luft anhalten«, wehrt sich Weiss hörbar ungehalten und mustert argwöhnisch die Froschmanngestalt mit ihrer Ausrüstung, als wäre sie ein Alien aus dem Weltall.
»Die Regie will, dass die Kamera am Schluss der Szene nach oben zieht und in der Supertotalen endet. Wir möchten, dass die Stelle im Wasser, an der du abtauchst, die ganze Zeit im Bild bleibt. Dafür musst du für mindestens vier bis fünf Minuten unter der Oberfläche verschwinden.«
»Ihr spinnt doch, Jerker! So lange kann kein Mensch die Luft anhalten!«
»Der Weltrekord in Apnoetauchen liegt bei neun Minuten und vier Sekunden«, sagt Lauri und grinst spitzbübisch. »Aber keine Panik, Klaus, es wird ein Froschmann unter Wasser auf dich warten und dir sofort Luft geben.«
»Du sagst das so beiläufig, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Ich sage dazu nur, du und eure Regie, ihr dreht völlig durch!« Weiss unterstützt seine Stimme mit der Theatralik eines Burgschauspielers. »Ich soll abtauchen und ihr wollt, dass mir ein Luftschlauch in den Mund gesteckt wird? Unter Wasser? Auf keinen Fall! Wir drehen hier doch keinen James-Bond-Film, oder sollte mir irgendwas entgangen sein?«
»Solange du im Bild bist, kannst du gerne die Diva raushängen lassen, Klaus. Aber unter Wasser gibt es keine Starallüren mehr, da wirst selbst du zum Statisten!« Lauris Stimme klingt kompromisslos. »Und jetzt hörst du dir an, was dir unser Aquaworker zu sagen hat. Dem bezahlen wir nämlich dafür, dass dir nichts passiert, eine Menge Kohle.«
Bevor der verdutzte Weiss antworten kann, ist der Regieassistent ohne ein weiteres Wort verschwunden. Der Mann im Taucheranzug hat solange in gebührendem Abstand gewartet. Die Anspannung hängt noch in der Luft, da macht der Schauspieler eine unwirsche Handbewegung und sagt in gönnerhaftem Tonfall: »Na, dann klären Sie mich halt auf. Die Sache ist doch hoffentlich nicht lebensgefährlich?«
»Es ist alles halb so schlimm, Herr Weiss. Sie sind ein intelligenter Mensch, das lernen Sie im Handumdrehen.«
Er hält dem Schauspieler das Mundstück des Atemreglers vor die Nase.
»Zuerst werde ich jetzt Ihren Wasser-Nase-Reflex testen. Sie atmen über den Mund ein und über die Nase wieder aus.«
Weiss nimmt das Mundstück zaghaft zwischen die Lippen, atmet tief ein und mit einem zischenden Ton durch die Nase aus.
»Wunderbar«, lobt der schwarze Frosch einschmeichelnd. »Wenn mein Kollege und ich Sie unter Wasser gezogen haben, drücke ich Ihnen das Mundstück nach unten gedreht in die Hand. Genauso führen Sie es zum Mund, und mit einem kurzen Atemstoß blasen Sie dann das Mundstück leer, nehmen es in den Mund und beginnen ruhig zu atmen.«
»Und so was geht wirklich?«
»Der Regler liefert immer minimal Luft. Das reicht allemal, um es freizublasen. Wir sind höchstens einen Meter unter der Wasseroberfläche. Wenn es nicht klappen sollte, tauchen Sie einfach auf. Dann ist zwar die Szene verpatzt, aber der Dreh kann ja wiederholt werden. Ich gehe davon aus, dass Sie das problemlos hinkriegen. Glauben Sie mir, Sie schaffen das auf Anhieb.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr«, knurrt Weiss und lässt sich den Vorgang sicherheitshalber noch ein paarmal ausführlich zeigen.
»Achtung, alle Personen im Set auf die Plätze!«
Aus einem Megafon tönt die blecherne Stimme der Aufnahmeleiterin. Schmidt-Boye zupft Weiss in Maskenbildnermanie noch einige Haarsträhnen zurecht, während der schon auf dem Weg zum Schlauchboot ist. Vorsichtig steigt er die Treppe hinab und wird von zwei Neoprenmännern mit einem Ruck an Bord gezogen. Sein Tauchlehrer folgt ihm ohne Mühe. Im Boot legt er mit routinierten Griffen seine Ausrüstung an, setzt sich mit einem weiteren Taucher rücklings auf den Gummiwulst und nimmt eine zusätzliche Pressluftflasche in Empfang. Auf ein Zeichen lassen sie sich hintenüber ins Wasser fallen. Der Motor heult auf und das Boot zieht in einem großen Bogen aufs Meer hinaus. Weiss sitzt wie eine Galionsfigur im Bug, sein roter Bademantel und seine weiße Haut leuchten magisch im Mondlicht.
In der Zwischenzeit schwebt die Kanzel des Teleskopkrans bereits durch die Luft auf ihre angestammte Ausgangsposition dicht über dem Wasser, zehn Meter vom Ponton entfernt. Als sie zum Stehen kommt, geht dort die Arbeitsbeleuchtung aus. Jetzt strahlen nur noch die Scheinwerfer ihr grelles Licht in die Nacht. Weiss legt den Bademantel ab und lässt sich mit Hilfe zweier Männer vorsichtig über den Gummiwulst in die Fluten gleiten. Auch der Komparse an der Küste ist bereits vom Badestrand aus an seinen Einsatzpunkt geschwommen.
»Ruhe am Set!«, tönt das Megafon über die Szenerie.
Der Kameraassistent lehnt sich mit dem Oberkörper über die Brüstung der Kanzel und hält am langen Arm die elektronische Timecode-Klappe vor die Optik der Kamera. »57/4 die Zweite!«, ertönt sein Ruf in der Stille.
Rehmke wirft einen flüchtigen Blick auf den Kontrollmonitor, auf dem er und der Assistent den Bildausschnitt des Kameramanns verfolgen können, und stellt fest, dass Weiss einsatzbereit auf der angewiesenen Stelle im Wasser paddelt. Er hebt den Arm in die Höhe und verkündet lauthals sein altbekanntes »Und Action!«.
Weiss wird augenblicklich zum absoluten Schwimmer. Er streckt die Arme unter Wasser nach vorn, dreht die Hände und zieht sie kraftvoll nach hinten, um sie locker unter der Brust wieder zusammenzuführen. Zug um Zug, jede Bewegung von ihm ist hochkonzentriert, damit er sich im Timing synchron zur Kamerafahrt befindet, als im entscheidenden Moment Kameramann, Assistent und Regisseur in der Kanzel an ihm entlangschweben und der Bühnenmann den Teleskoparm des Krans exakt in seine Rückenposition bringt.
Rehmkes Augen kleben unentwegt am Kontrollmonitor. Das Bild, das sich ihm dort bietet, lässt sein Herz vor Begeisterung schneller schlagen. Die hellen Umrisse des Schwimmers vor dem offenen Meer, das sich schwarz wie Samt bis zum Horizont spannt. Darüber, genau mittig, steht der Vollmond und die Lichtreflexe tänzeln auf den Wellen.
Atemberaubend, Helmut ist ein Genie, denkt er, und genau im richtigen Moment versucht eine unsichtbare Kraft, Weiss unter Wasser zu ziehen. Der schlägt wild mit den Armen um sich, peitscht das Wasser, dass die weiße Gischt wie kochende Milch schäumt. Der Kopf des Schauspielers taucht unter, kommt noch mal kurz an die Oberfläche und verschwindet dann endgültig. Der Kran hebt die Kanzel langsam in die Höhe, dreht in einem 45-Grad-Winkel zur Küste, während Brattenberger die Stelle des Verschwindens, an der noch Luftblasen aufsteigen, die gesamte Fahrt über in seinem Bildausschnitt behält. Dann zoomt er kaum spürbar, wobei der Kameraassistent präzise die Schärfe zieht, in die Supertotale.
»Gert! Gert! Verdammte Scheiße, Gert!«, tönt die Stimme des Komparsen aus der Ferne herüber, der auf dem Monitor nur stecknadelkopfgroß in den Wellen schwimmt. Dahinter erhebt sich im Lichterschein der Straßenlampen die Stadtkulisse von Husum.
»Cut!« Wieder treibt die markige Stimme von Rehmke wie ein Möwenschrei über dem Geplätscher der Wellen. »Der Take ist im Kasten!« Dann steht er auf, klopft Brattenberger demonstrativ auf die Schulter. »Du bist ein Magier des Lichts, Helmut. Diesmal hast du dich selbst übertroffen!« Auf der Plattform brechen Beifall und Jubel aus.
Trotz vereinzelter Reibereien ist sein Kameramann die Seele seiner Filme. Rehmke arbeitet schon seit Jahren mit ihm zusammen, besonders, weil er nicht nur in Bildern denken kann, sondern auch die innovative Technik der »360-Grad-Kamerafahrt« erfunden hat. Er erinnert sich noch gut daran, wie er ihn vor langer Zeit auf der Hochschule für Fernsehen und Film in München kennenlernte, kurz bevor Roland Emmerich ihn nach Los Angeles holte, um ihn an seinem großen Hollywood-Blockbuster »Independence Day« mitarbeiten zu lassen. In Amerika bekam Brattenberger alle Kniffe des Handwerks beigebracht. Er entwickelte ein besonderes Talent für Filter und kehrte als Meister des Lichts nach Deutschland zurück. Für das jüngste Projekt war er Rehmkes erste Wahl.
Besonders dankbar ist er ihm für den unvergessenen Satz, der auch zu seinem persönlichen Motto geworden ist: »Hollywood kann auch nur mit Wasser kochen, aber es hat mehr Wasser und größere Töpfe.«
Seitdem hat Rehmke die Angewohnheit, von jedem neuen Produktionsleiter grundsätzlich mehr Wasser und größere Töpfe zu fordern.
Sein eigener Werdegang ist eine Geschichte mit vielen Umwegen. Rehmke war nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Schon am Beginn seiner Karriere hatte er sich mit seinem Abschlussdokumentarfilm »Jubelperser« für die Film- und Fernsehakademie nicht nur Freunde gemacht. Bei der historischen Demonstration gegen Schah Reza Pahlavi vor dem Rathaus Schöneberg filmte er aus nächster Nähe, wie Männer des persischen Geheimdienstes mit ihren Pro-Schah-Transparentholzlatten auf deutsche Demonstranten einprügelten und Dutzende von ihnen verletzten. Die Anerkennung, die er damals in Studentenkreisen der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin für seinen Streifen einheimste, blieb ihm später als Drehbuchautor in den Gremien der Filmförderungsanstalten verwehrt. Egal welches Filmprojekt er auch in Berlin einreichte, jede Filmförderungsanstalt lehnte alles kategorisch ab. Es führte kein Weg daran vorbei, dass er vorübergehend in die zweite Reihe zurückmusste. Am Jungen Theater in Hamburg bekam er endlich die Chance, die Regiearbeit bei verschiedenen Kinderaufführungen zu übernehmen. 1971 hatte er plötzlich seinen ersten Erfolg. Seine Tatort-Folge für den NDR »Die Nacht des Klabautermanns« ist bis heute die quotenmäßig erfolgreichste Ausstrahlung eines Tatort-Films geblieben. Es folgten zwei Fernsehfilme für den WDR und danach begannen die Produktionsfirmen sich um ihn zu reißen.
Der Bühnenmann setzt die Kanzel auf dem wieder beleuchteten Ponton ab, während Brattenberger das gerade gedrehte Material zum zweiten Mal ablaufen lässt. In den Augen von Kameraassistent und Regisseur zeichnet sich Glanz ab.
»Großartig!«, sagt Rehmke, dreht sich begeistert zur Crew, die sich mittlerweile um die Kanzel schart, und streckt einen Arm mit geballter Faust senkrecht in die Höhe, als wäre er Rocky Balboa. »Ihr habt alles gegeben, Leute! Und wir haben ein erstklassiges Ergebnis. Lasst uns Feierabend machen! Ich danke euch allen für euren tollen Einsatz.«
»Und nach der Arbeit ist vor der Arbeit«, erhebt sich Hubrich-Messows glockenhelle Stimme und bremst die allgemeine Euphorie. »Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Wegen der fortgeschrittenen Zeit beginnen wir morgen erst um 11.00 Uhr. Wir drehen die Chorprobe in der Marienkirche.«
Unter das Geräusch der Wellen mischen sich Aufbruchsgemurmel, kurze Lachsalven und die monotonen Anordnungen der Aufnahmeleiterin, die per Handy das Boot ordert, welches die Crew und das gesamte Equipment an Land bringen soll.
Jauchzet, frohlocket
Ein kühler Märztag beginnt. Die ersten Sonnenstrahlen fluten über die mittelalterlichen Stufengiebel des Herrenhauses und erhellen die gegenüberliegenden Häuserfassaden. Der Marktplatz um den Tine-Brunnen ist vollgeparkt mit Transportern, Lastwagen und Bussen. Zwischen den Fahrzeugen herrscht geschäftiges Treiben, als Sahra Hubrich-Messow die Steintreppe zum klassizistischen Eingangsportal der Marienkirche hinaufsteigt. Die Pilaster mit dem dreieckigen Dachfirst erinnern sie an ihren letzten Griechenlandurlaub und auch der geometrische Bezug zu den Linden entlang der Seitenmauern des Gebäudes erregt kurz ihre Aufmerksamkeit. Die Aufnahmeleiterin geht davon aus, dass die Männer der Filmcrew, die gerade Stative und Kabelrollen durch die sperrangelweit geöffnete Eingangstür schleppen, kein Auge für solche Kleinigkeiten haben. Sie erledigen nur ihren Job, damit dieser Film gedreht werden kann.
Selbst wenn sich täglich alles um Film dreht, denkt Hubrich-Messow herablassend, sind die meisten blind für die alltägliche Ästhetik, die nichts mit unserem Film zu tun hat.
Sie betritt den Innenraum des Gotteshauses und betrachtet ihn mit ihrem über allen anderen stehenden Bühnenbild-Studium-Blick. Zu beiden Seiten der grauen Kirchenbänke markieren dorische Säulen, die eine mächtige Empore tragen, eine Fluchtlinie zu einem weiteren Portal hinter dem Altar. Es ist fast das identische Abbild des Außenportals, nur die Pilaster sind kanneliert und haben ionische Kapitelle. Gläubige sollen anscheinend von Portal zu Portal schreiten, um zum Reich Gottes zu finden, meint sie die Absicht des Architekten zu erkennen und bewertet sie als eine typisch männliche Unterwürfigkeit.
Und schon ist ihr Ehrgeiz erloschen, sie wird wieder zur professionellen Aufnahmeleiterin und steuert auf die größere Schar von Menschen zu, die sich bereits rechts im Altarbereich versammelt hat. Sie kommt allerdings nicht weit, der Mittelgang ist versperrt. Im vorderen Bereich verlegen Helfer auf Filzbahnen Schienen für den Dolly, während andere auf Leitern stehen und dunkle Folien vor die hohen Kirchenfenster hängen, durch die zu helles Tageslicht fallen könnte. Am linken Rand ist ein Leichtbaukran für die Fahrten mit der zweiten Kamera in Betrieb genommen worden, und ein Techniker lässt gerade den Teleskoparm im Testversuch über die Köpfe der Anwesenden schweben.
»Gut, dass du kommst, Sahra!«, ruft Jerker Lauri ihr bereits aus der Ferne zu und zwängt sich mühsam durch die schmalen Holzbänke, bis er direkt vor ihr steht. »Der Dirigent und einige Chormitglieder mucken rum, dass wir die Chorprobe für den Dreh vor dem Altar stattfinden lassen. Ich kann mich selbst nicht drum kümmern, muss dringend mit Rehmke und dem Script Doctor reden, bevor wir hier starten.«
Hubrich-Messow quält ein »I do my very best« über ihre Lippen und bugsiert ihren Körper in einer Art Krebsgang durch die enge Gasse zwischen den Bänken zur rechten Seite hinüber, um das Gewusel in der Mitte des Kirchenschiffs zu umgehen. Neben dem Altar steht ein hochgewachsener, grau melierter Herr im zerknitterten Anzug, der wie ein Messias von einer Schar Frauen und Männer umringt wird. Er steht mit dem Rücken zu ihr, ist ihrer Einschätzung nach der Chorleiter, mit dem sie telefoniert hat; zumindest glaubt sie ihn an seiner Stimme zu erkennen.