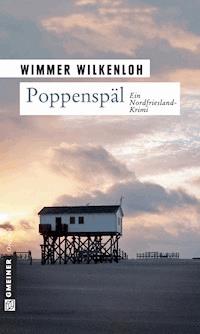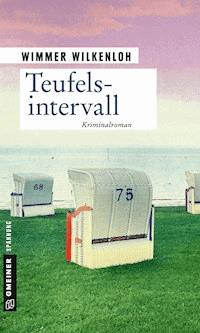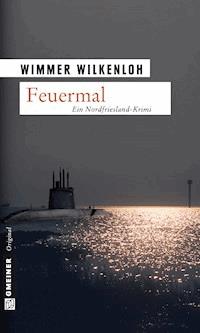
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hauptkommissar Jan Swensen
- Sprache: Deutsch
7. September 2001: Der Tunesier Habib Hafside wird an seinem Arbeitsplatz in einer Kieler U-Boot-Werft von seinen Kollegen beleidigt. Bisher waren die Anfeindungen eher unterschwelliger Art, jetzt wird er als Fremder in Deutschland öffentlich beschimpft und belästigt. Kurz darauf wird Hafside auf offener Straße von mehreren Männern überwältigt, in ein Auto gezerrt und verschleppt. Als wenig später eine abgehackte Hand in das türkische Kulturzentrum in Husum geworfen wird, beginnt für Kommissar Jan Swensen ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Terror ist mit einem Mal zum Greifen nah …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Wimmer Wilkenloh
Feuermal
Thriller
Impressum
Handlung und Personen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit toten oder lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2008
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von photocase.de
Gesetzt aus der 9,8/13 Punkt GV Garamond
ISBN 978-3-8392-3258-3
Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Widmung
Für Steffen,
der immer jede Form von Dogmatismus abgelehnt hat
und verstarb, während ich an diesem Buch schrieb.
Zitat
Wenn in die Posaune gestoßen wird, so werden sich beim ersten Posaunenschall die Erde und die Berge emporheben und mit einem Schlage zerschmettert werden, und an diesem Tage wird die unvermeidliche Stunde hereinbrechen, und die Himmel werden sich an diesem Tage spalten und herabfallen, zu seiner Seite stehen die Engel, und deren acht tragen an diesem Tage den Thron deines Herrn über sich.
An diesem Tage werdet ihr vor Gericht gestellt, und nicht das Verborgenste euerer Handlungen bleibt verborgen.
Koran, neunundsechzigste Sure.
Prolog
Als Kind fieberte er der Zeit entgegen, wenn wieder ein Hammel geschlachtet werden sollte. Stand im Freundeskreis der Eltern eine Hochzeit bevor, zogen die Männer am Vorabend auf die Weide, streiften durch die Herde und griffen eines der Tiere heraus. Spätestens dann begann sein Herz schneller zu schlagen, und es kribbelte in seinem Nacken. Die gesamte Herde ahnte bereits, was bevorstand. Auf ihren Stöckelbeinen rieben sich die Tiere aneinander und blökten gegen den Tod. Blitzschnell packten die Männer den ausgewählten Hammel an den Beinen und warfen ihn auf den Rücken. Die Angst drückte dem Tier die Augen aus den Höhlen. Es folgten ein kurzer Schnitt mit dem Messer und das Röcheln des Tieres. Der dicke Blutschwall spritzte stoßweise ins Gras.
Nun war aus dem kleinen Jungen Kemal Güldünya ein Elitesoldat in der türkischen Armee geworden, ein Kämpfer mit Leib und Seele, der gelernt hatte, Waffen einzusetzen und ohne zu zögern Menschen zu töten. Er liebte diesen Beruf, war aber trotz der engen Gemeinschaft des Militärs immer ein Einzelgänger geblieben, unnahbar. Seine Gesichtszüge waren kantig und hart, die eng zusammenstehenden Augen wirkten versteinert, ließen kaum eine Gefühlsregung nach außen dringen. Eines Tages hatten seine Kameraden ihm, am Anfang zwar nur scherzhaft, den Namen Azra’il (Todesengel) gegeben, obwohl seine körperliche Ausstrahlung nicht im Geringsten mit der Lichtgestalt eines Engels zu vergleichen war.
Was habe ich mit Azra’il zu tun, war sein Gedanke gewesen und ihm war eine Vision vom Erzengel Dschibril (Gabriel) gekommen, der mit seinen sechstausend Flügeln Muhammad bis vor den Thron Gottes geführt hatte. Was ist meine Willenskraft gegen solch ein übernatürliches Wesen?
Doch Azra’il hatte sich über die Zeit hartnäckig gehalten und wenn ihn heute jemand mit dem Namen ansprach, klang es nicht mehr scherzhaft, sondern ehrfürchtig. Die Anrede weckte eine schlafende Bestie in ihm und etwas Fremdes, Bösartiges machte sich in seinem Körper breit. Dann begann sein Blut zu pulsieren, wie damals in seiner Kindheit, wenn die Männer den Hammel schlachteten, und sein Wunsch wurde nahezu übermächtig, endlich einen wirklichen Feind an der Gurgel zu packen, um ihm blitzschnell die Luft abzuwürgen.
Die respektvollen Blicke, die der Name bei den Kameraden auslöste, registrierte er mit heimlichem Stolz. Es schmeichelte ihm, wenn das Wort Azra’il sie zusammenzucken ließ und er fühlte sich für einen Moment als ein Auserwählter.
Vor zwei Jahren war er zwanzig geworden. Danach meldete er sich freiwillig zu einer Eliteeinheit der Infanterie. Als der Einberufungsbescheid in der Post lag, holten seine Brüder ihre Jagdflinten und feuerten auf der Straße vor dem Haus in den Himmel. Mehrere Freunde waren mit ihren Autos vorbeigekommen. Kurze Zeit später fuhren sie im Konvoi unter lautem Gehupe durch die Stadt und weiter bis nach Ankara, um ihn zum Sammelpunkt für die neuen Rekruten zu bringen. Mehrmals stoppten sie mitten auf der Strecke, stießen Freudenschreie aus und ballerten ausgelassen in die Luft.
Erst ein Soldat war in seinen Augen ein richtiger Mann. So lange er zurückdenken konnte, wollte er schon für dieses Land kämpfen. In der Schule war dieser Wunsch noch größer geworden, denn die Lehrer der Grundschule ließen alle Schüler militärisch strammstehen, bevor der Unterricht begann, oder es wurden zu jeder Gelegenheit feierliche Fahnenappelle abgehalten.
Er konnte sich genau daran erinnern, wie stolz er das Holzgewehr, das sein Vater für ihn gebaut hatte, seinen Mitschülern präsentierte. Er exerzierte damit in jeder freien Minute über den staubigen Schulhof. Dem Vaterland schien seine freiwillige Schinderei zu gefallen. »Jeder Türke wird als Soldat geboren« stand auf allen Schulbüchern. Dieser Feststellung hätte es nicht bedurft.
Bereits nach der Grundausbildung gehörte er zu den Harten der Harten. Er wollte unbedingt so schnell wie möglich Offizier werden, unterzog sich jedem militärischen Drill voll Eifer und Begeisterung, erlernte ohne Murren die Grußrituale, das Reinigen der eigenen Kleidung und der Waffen, ertrug Erniedrigungen und Zurechtweisungen der Vorgesetzten, übte Gefechtsausbildung und marschierte bis an seine körperlichen Grenzen. Er ließ selbst Prügel und Schläge ohne mit der Wimper zu zucken über sich ergehen. Aber diese schonungslose Haltung gegen sich selbst hatte ihm den Namen Azra’il nicht eingebracht. Azra’il war ein Hinweis auf ein Feuermal unter seinem rechten Auge, ein Feuermal, das dem Flügel eines Engels ähnelte.
Heute, am Freitag, dem 19. Juli 1974, war es endlich so weit. Aus seiner Ausbildung wurde der Ernstfall. Den ganzen Tag hatte ein sengender Feuerball am Himmel gestanden. Die Luft war drückend und schwer. Erst am späten Nachmittag wurde die unangenehme Wartezeit beendet. Der Einsatzbefehl kam um Punkt 17.30 Uhr. Die Abendsonne tauchte den Hafen von Mersin bereits in ein orangerotes Licht, als die türkische Flotte kurz vor der einbrechenden Nacht aufs Meer hinausglitt.
Kemal hatte bis um 21.00 Uhr an der Reling gestanden und sehnsüchtig die heranziehenden Wolkenfetzen beobachtet, doch der wohltuende Regenschauer blieb aus. Im Schlafraum war die Luft zum Schneiden dick. Er konnte einfach nicht einschlafen, warf sich gegen seine Gedanken in der Koje hin und her, so lange, bis die Kameraden zu zischen begannen. Ab da war er noch verkrampfter, lag bewegungslos auf dem Rücken, starrte an die graue Eisendecke und hörte auf das Knarren im Schiffsrumpf. Endlich fiel er in ein tiefes Schwarz.
Kurze, knallende Geräusche rissen ihn aus dem Schlaf. Jemand polterte die Metalltreppe herunter, eine Trillerpfeife gellte durch den engen Schlafraum. In Sekunden war er hellwach und auf den Beinen. Seine Armbanduhr zeigte 4.00 Uhr.
Als er an Deck kam, fetzten kurze Befehle quer über das Schiff. Der Morgen hatte keine Abkühlung gebracht. Im Osten kündigte ein feiner Lichtschein den nahenden Sonnenaufgang an. Er nahm seine antrainierte Position ein und wies die Gruppenführer an die richtigen Plätze. Immer mehr Rekruten stürmten an Deck, die sofort in Reihen antreten mussten. Dann kam das Kommando: »Aufsitzen!« Ein Landungsboot nahm einen Zug von dreißig Soldaten auf. Ketten rasselten über Eisen. Mit dumpfen Schlägen klatschte ein Rumpf nach dem anderen auf die Wasseroberfläche.
Die Operation Attila war jetzt in vollem Gang. Hunderte Boote, die großen, trapezförmigen Zigarrenkisten ähnelten, schoben sich unaufhaltsam durch die glatte See auf die Nordküste Zyperns zu. Die erste Angriffsoffensive hatte den Auftrag, am Strand einen Brückenkopf zu errichten und eventuelle Gegenangriffe zurückzuschlagen.
In einem der vordersten Boote saß Kemal. Er kauerte im hinteren Teil in einer Ecke und hörte, wie die Wellen rhythmisch an die Eisenwand schlugen. Unaufhaltsam kam das Ufer näher. Er lugte über die Bordwand. Steuerbord konnte man schon eines der überdachten Förderbänder erkennen, die weit bis ins Meer hineinragten. Damit wurden Mineralien aus den Bergwerken auf die Schiffe verladen. Kemal kaute unwillkürlich auf seiner Unterlippe. Sein Hals brannte trocken. Er gab dem Hustenreiz nach und kläffte dreimal laut. Hinter ihm murmelte jemand: »Allãhu Akbar (Allah ist groß).« Von rechts schoss geräuschlos ein Düsenjäger heran und durchbrach direkt über dem Landungsboot mit einem scharfen Knall die Schallmauer. Im Tiefflug hielt er auf eine Siedlung am Berghang oberhalb von Karavostási zu. Ein Rauchpilz quoll in den Himmel. Ihm folgte einige Sekunden später der dumpfe Detonationsdonner. Kemal spürte seine feuchten Finger, die das G3-Schnellfeuergewehr umklammerten. Von Nordwesten dröhnten mehrere Transportflugzeuge über ihn hinweg und verschwanden in Richtung Nikosia. Die Stahltrossen rollten mit einem metallisch zirpenden Geräusch von der Winde. Die Rampe kippte ins Wasser. Der Sandstrand, der Five Mile Holiday Beach hieß, lag knapp hundertzwanzig Meter vor ihnen. Am Ufer herrschte eine bedrückende Stille.
*
Zum selben Zeitpunkt, in dem Kemal über die Rampe ins Wasser sprang, nahm Jan Swensen im Schweizer Tsurphu-Tempel an der morgendlichen Meditation teil. Erst in siebenundzwanzig Jahren würden sich die Wege der beiden Männer kreuzen.
Nach einer gewissen Zeit wurde die Stille für den buddhistischen Schüler zur Nebensache. Der linke Fußknöchel hatte vor mindestens einer Viertelstunde zu schmerzen begonnen. Erst war es nur ein fast unscheinbares Ziehen im rechten Kniegelenk gewesen. Dem folgten ein massives Ziehen im linken Kniegelenk und ein Stechen in der linken Wade, das an feine Nadelstiche erinnerte. Jetzt wurde alles von dem Schmerz im linken Knöchel überlagert, einem quälenden Schmerz, der von der Knöchelspitze in alle Richtungen ausstrahlte. Swensen versuchte, seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Atem zu lenken.
»Du bist ganz bei dir. Du bringst dein inneres Geschwätz zum Schweigen und richtest deine Achtsamkeit auf deinen Atem.«
»Reite auf dem Atem«, hatte Lama Rhinto Rinpoche vor Beginn der Meditation gelehrt, »sei wie ein Reiter auf seinem Pferd – treibe es vorwärts ohne Ablenkung und ohne seitwärts gerichtete Blicke.«
»Du nimmst den Atem hinein«, sagte Swensen zu sich, »du spürst die Luft in die Nasenlöcher eindringen, spürst wie die Bauchdecke sich vorwölbt. Dann lässt du los. Du gehst mit dem Ausatmen hinaus, spürst wie der Atem sich auflöst. Einatmen, Pause, ausatmen, Pause. Mist! Mist! Mist!«
Der Schmerz war stärker. Er schob sich über jede Konzentration, ließ nur noch einen einzigen Gedanken zu. Schmerz!
Es war ihm, als wenn Luzifer persönlich seinen Finger durch die Erdkruste hindurch gegen seinen Knöchel drückte, drückte und drückte. Er wusste aus Erfahrung, dass eine Sitzkorrektur nichts bringen würde. Das war eindeutig eine Sache des Kopfes. Schließlich hatte er in den letzten Wochen genau so ohne jede Form von Schmerz dagesessen.
»Schmerz ist ein guter Lehrmeister«, sickerten ihm die Worte von Meister Rinpoche in den Kopf. »Richtet die Aufmerksamkeit auf ihn. Erkundet ihn genau. Nehmt ihn an wie einen Freund.«
Kurz darauf hörte er nichts mehr. Der Schmerz machte seine Gedanken taub, brüllte ihm seine ganze Existenz entgegen. Sein Nacken verspannte sich. Es hämmerte, pochte, zog hinunter bis zu den Zehen. Je mehr er versuchte, in seinen Körper hineinzuspüren, umso intensiver steigerte sich die Qual. Jeder Gedanke wurde zu einem ewigen Schmerz. Er selbst wurde zum Schmerz. Ein Martyrium. Er hätte schreien mögen. Plötzlich zog es ihn hinab. Er versank in ein schwarzes Loch, aus dem ihm ein feines goldenes Rautenmuster entgegenstrahlte. Das Bild erschien so realistisch, dass er glaubte, nach dem erhabenen Relief greifen zu können. Bevor er es berühren konnte, zerfiel es zu feinem Goldstaub, rieselte zu Boden und formte eine farblose Totenmaske, die sich in ein lebendiges Gesicht verwandelte. Swensen erkannte es sofort. Es war das Antlitz eines Polizisten, den er einmal allein vor einer Horde von Demonstranten stehen gesehen hatte. »Enteignet Axel Springer«, klang es in seinen Ohren. »Enteignet Axel Springer!«, hörte er sich selbst in den Chor der Menge einstimmen.
Bei einem Dokusan (Einzelgespräch) vor einigen Wochen berichtete er dem Meister von dieser Begebenheit. Es war in der wilden 68er Zeit gewesen. Ein Protestmarsch bewegte sich auf das Axel-Springer-Haus in Hamburg zu. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Swensen brachte sich mit einer größeren Gruppe in einer Seitenstraße in Sicherheit. Ein einzelner Polizist hatte sich bei der Verfolgung eines Demonstranten aus seiner Einheit gelöst und war in diese Seitenstraße geraten. Unerwartet stieß er dabei mit erhobenem Schlagstock auf eine Horde von Männern und Frauen, die ihm wie eine Front gegenüberstand. Swensen hatte dem jungen Beamten einen kurzen Moment in seine entsetzten Augen gesehen, bevor dieser panisch, unter dem Gejohle der Meute, die Beine in die Hand nahm und flüchtete.
Seit dem Dokusan war das Gesicht fast regelmäßig bei seinen Sitzmeditationen aufgetaucht. Irgendwie wollten ihn die weit aufgerissenen Augen nicht mehr loslassen. Für ihn wurden es die Augen eines kleinen Jungen, der die Gewalt in der Welt nicht begreifen konnte. Sie wurden zu seinen Augen, seinem naiven Blick, kurz nachdem er aus Husum in die Welt hinausgestürmt war und in Hamburg Philosophie studiert hatte, bis die Welt plötzlich über ihn hinweggestürmt war. Als Benno Ohnesorg auf einer Demonstration gegen den Schah von Persien erschossen worden war, hatte er sich in diesem tibetischen Tempel in der Schweiz verkrochen. Hier glaubte er Erlösung zu finden, Erlösung von dieser gewaltvollen Welt. Doch er musste lernen, dass selbst sein Meister Rinpoche mit dieser Welt verwoben war.
1959 musste er schon als junger Mönch mit zweiundzwanzig Jahren, über den Himâlaya nach Indien flüchten. Es gab damals deutliche Anzeichen, dass Chinas Kommunisten gewaltsam in Tibet einfallen wollten. Die Odyssee des kleinen Mannes führte über Nepal nach Indien und endete in der Schweiz. Hier im Exil erreichte ihn die Nachricht, dass sein geliebter Meister Naramgyal an den Grausamkeiten im chinesischen Gefängnis gestorben war.
»Die Welt ist wahr, offen, scharf, genau und überaus farbig. Du kannst versuchen, dich ihr zu entziehen, vor ihr Reißaus zu nehmen. Du kannst alles Mögliche versuchen, aber die Welt ist da, wo du dich gerade befindest«, hatte der Meister den Bericht über seine Flucht beendet.
Kaum waren die Worte durch Swensens Kopf gezogen, musste er an sein Gespartes denken, das nach drei Jahren Tempelaufenthalt langsam zur Neige ging. Es stand ein Entschluss an. Der Weg zur Erlösung führte zunächst zurück in die Welt. Am selben Abend bat er um ein Gespräch bei Meister Rinpoche.
»Ich werde den Tempel verlassen, ehrwürdiger Rinpoche«, begann er nach langem Schweigen das Gespräch. »Ich habe über meine Zukunft nachgedacht. Es wird Zeit mir einen Beruf zu suchen. Ich möchte endlich etwas Konkretes anpacken, etwas für andere Menschen tun!«
»Die Absicht, anderen zu helfen, ist lobenswert! Was verstehst du aber unter konkret? Frage dich, was du die ganze Zeit anderes machst?«
»Von dem, was ich hier mache, kann ich später nicht leben! Was würde der ehrwürdige Rinpoche sagen, wenn ich zur Polizei gehen würde?«
»Es ist wichtig, die eigenen Konzepte zunächst einmal zu respektieren!«, sagte der Meister mit einem milden Blick und schaukelte seinen runden Kopf leicht hin und her.
»Was meint der ehrwürdige Rinpoche mit zunächst?«
»In der buddhistischen Lehre betrachten wir Konzepte allgemein als Hindernisse. Aber ein Hindernis heißt nicht, dass es etwas unmöglich macht. Ein Hindernis kann auf deinem Weg auch zu einem Fahrzeug werden. Nirvâna, die Erleuchtung, ist nicht besser als der Kreislauf des Lebens, Samsâra. Samsâra ist Nirvâna und Nirvâna ist Samsâra.«
1
Sein Zorn hat eine feste Substanz. Er fühlt sich an wie ein zusätzliches Organ, das wie ein Herz schlägt, wie ein Magen ohne Nahrung schmerzt und giftig wie eine kranke Leber sein kann. Das ist keine Einbildung, er fühlt es deutlich. Es ist aus dem feinen Hass gewachsen, dem Hass, der ihm über die Jahre in der Fremde entgegenschlug. Immer, wenn er im morgendlichen Gedränge der Busfahrt aus dem Gleichgewicht geraten war, dabei in eine fremde Zeitung gestürzt und Schläge angedroht bekommen hatte, war das Organ in seiner Brust wieder ein Stück gewachsen. Wie oft wurde er auf der Straße angepöbelt, ohne ersichtlichen Grund, allein weil er nicht wie diese blasse Masse in Deutschland aussah.
»Scheiß-Türke, verpiss dich!« gehörte zu den harmlosen Beschimpfungen, die er immer wieder zu hören bekam. Dabei ist er gar kein Türke. Er ist Tunesier und lebt seit über sechs Jahren in seiner Kieler Wahlheimat. Er spricht perfekt deutsch, hat nach neun Semestern sein Schiffbaustudium immerhin mit der Note 1,3 abgeschlossen und würde manchen deutschen Bildungsbürger locker in die Tasche stecken. Er kennt sich aus mit ihrer Wiege des Abendlandes: Plato, Descartes, Hegel, Nietzsche. Selbst nicht so geläufige Philosophen wie Lyotard oder Whitehead gehören zu seinem Wissensstand. Besonders überzeugt ist er vom kategorischen Imperativ. Für ihn sollte jeder Mensch verpflichtet sein, nach dieser Maxime Kants zu handeln. Eine gültige Moral und Menschenwürde für alle. Wenn er daran denkt, spuckt sein Organ Gift.
Kein Wunder, der heutige Tag ist der Gipfel aller bisherigen Demütigungen. Wie immer hatte er am Morgen als Erster das Konstruktionsbüro betreten, den Computer hochgefahren und das MegaCAD-Programm geladen, um mit einer 3D-Animation für die U-Boot-Schlafräume zu beginnen. Eine halbe Stunde später waren fast alle Arbeitsplätze um ihn herum besetzt gewesen und es war wie immer, bis ihm aufgefallen war, dass er heimlich aus allen Richtungen mit erwartungsvollen Blicken beobachtet wurde. Jedes Mal nur kurz, fast wie beiläufig. Er hatte es bemerkt, weil sich um seine Anwesenheit sonst kaum ein Mitarbeiter kümmerte. Besonders in dem Moment, als er die Schreibtischschublade aufgezogen hatte, war die Anspannung der Kollegen förmlich mit den Händen zu greifen gewesen. Dort lag ein kleines Kamel. Es war geschickt aus einem Klumpen brauner Masse modelliert worden. Neben der Figur ein kleiner Zettel, auf dem mit rotem Filzstift geschrieben stand:
»Zur Bekundung unserer Hochachtung vor Habib Hafside haben wir dieses Dromedar aus dem Land seiner Abstammung geformt. Wir möchten ihm damit sagen, dass er zu einer noch niedrigeren Lebensform gehört als dieses Stück Hefe.«
Er hatte den Zettel minutenlang ungläubig angestarrt. Sein Organ musste Säure produziert haben, denn es lag ein bitterscharfer Geschmack auf der Zunge, bleischwer. Erst nach mehrmaligem Durchlesen war der Inhalt wirklich in sein Bewusstsein gestiegen. Im Raum hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Er hatte die Schublade mit einem Ruck zugestoßen und einfach weitergearbeitet, als wäre nichts gewesen.
Kurz vor 19.00 Uhr hatte er Feierabend gemacht. Seitdem brennen Herz, Magen und Leber. Ziellos schlendert er durch die Straßen von Kiel, vorwärts, immer dem Bürgersteig hinterher. Links, links, rechts, den Schritten auf der Spur, zieht er ein Geflecht aus Linien durch seinen Kopf, umwickelt seine Gedanken zu einem festen Kokon. Auf den langen Reihen der Mietsblöcke hockt die Niedertracht. Die grauen Mauern bedrängen ihn, reiben sich aufdringlich an seinem Körper. Er weiß, es gibt nur ein Mittel, nicht von dieser Steinhölle erdrückt zu werden. Sein Verstand muss Kontakt zum Organ aufnehmen, es mit Poesie besänftigen. Er rezitiert innerlich Worte des moslemischen Dichters Dschelaleddin Rumi: »Die Hölle ist das Haus, das ohne Fenster ist – Fenster bauen o Gottesdiener, ist die Grundlage der Religion!«
In der ersten Zeit des Studiums war er noch religiös gewesen und manchmal in die Moschee gegangen. Doch unmerklich wurde er sozusagen von dieser westlichen Lebensweise überwältigt. Er wünschte sich, einer von ihnen zu werden, lebte aber weiterhin zwischen Baum und Borke, blieb ein Entwurzelter.
Gestern Abend hatte er in Adornos Minima Moralia gelesen und einen merkwürdigen Satz gefunden, der ihn auf irgendeine Weise besonders angesprochen hatte. Er versucht, sich die Aussage erneut ins Gedächtnis zu rufen.
»Das Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, dem man, damit es nicht zu einem Streit kommt, auf ein paar Sätze zustimmt, von denen man weiß, dass sie schließlich auf den Mord hinauslaufen müssen, ist schon ein Stück Verrat.«
Bin ich schon zum Verräter an meiner Kultur geworden, denkt er, ohne zu ahnen, wie nah dieser Satz bald mit seinem Schicksal verstrickt sein wird.
Er schiebt sich die Chechia (Wollmütze) aus der Stirn. Sie ist das letzte Zugeständnis an seine Heimat Tunesien. Schlagartig wird ihm klar, dass er in Deutschland immer ein Fremder bleiben wird. Eine tiefe Sehnsucht überfällt ihn. Unwillkürlich spürt er die ewige Sonne von Djerba auf seiner Haut, denkt an seine Heimatstadt Houmt-Souk und an die wolkenweiß getünchten Mauern des vornehmen Menzel (Gehöft) seiner Eltern. Von seinem Zimmerfenster aus konnte er direkt auf den Hafen blicken, auf die vielen bunten Holzboote der Fischer. Er sieht sich als kleiner Junge bei den Zimmerleuten stehen, die im kargen Schatten der Olivenbäume in ihren leichten Jebbas (Gewänder) nach einem gezeichneten Plan Holzplanken zurechtsägen. Schon damals träumte er davon, eines Tages auch solche Pläne herzustellen.
Und was wurde daraus, grübelt er. Jetzt bist du Ingenieur, hast aber bis heute keinen noch so klitzekleinen Plan für ein Holzboot gezeichnet. Man hat dich geködert, einer von ihnen zu werden. Du warst dankbar, weil man dich U-Boote bauen ließ, die modernsten der Welt, und du warst stolz, weil du sogar in den topsecret Bereich durftest. Eifrig konstruiertest du mit den Kollegen an diesen Schalldämmungsmodulen, die elastisch in die Bootsstruktur eingelagert werden konnten. Ehrgeizig hattest du dich an der Entwicklung der neuartigen sechsblättrigen Propeller beteiligt, die nahezu kein Schraubengeräusch mehr verursachen. Du warst fest überzeugt gewesen, es zu etwas gebracht zu haben, bis urplötzlich alles anders gewesen war. Bei der Arbeit am geheimen Brennstoffzellenantrieb wurdest du prompt ausgeschlossen und als Sicherheitsrisiko eingestuft. Typisch.
Natürlich brannte jeder Konstrukteur darauf, bei dieser wirklich revolutionären Technik mit dabei zu sein. Mit dem Ergebnis der Forschung werden konventionelle U-Boote wochenlang unter Wasser bleiben können, wie Atom-U-Boote, wenn alles so verläuft wie geplant. Sein Rausschmiss aus dem Projekt war eine persönliche Kränkung gewesen, die ihn sehr wütend gemacht hatte. Danach war das Organ das erste Mal spürbar gewesen.
»Na, Süßer! Wie wär’s mit uns beiden?«
Er schreckt aus seinen Gedanken und blickt in ein pausbackiges Gesicht, das ihn grell geschminkt anlächelt. Die füllige Frau lehnt an der Hauswand und wippt aufreizend mit dem rechten Bein. Sie trägt schwarze Leggings und knallrote Schaftstiefel. Ihren Körper hat sie in einen pinkfarbenen Bodystocking gezwängt, durch den sich der Rettungsring um ihre Hüfte besonders deutlich abzeichnet. Darunter trägt sie eine schwarze Spitzenbluse aus der ihre prallen Brüste quellen. Verlegen bleiben seine Augen an ihrer glitzernden Handtasche hängen.
»Nun komm schon Mustafa! Es wird dir gefallen!«
»Mein Name ist Habib«, sagt er mit harter Stimme.
»Habib, ein schöner Name! Kommst du aus der Türkei?«
»Nein, ich bin Tunesier!«
»Ana Almania (Ich bin Deutsche)!«
»Du sprichst arabisch?«
»Nein, nur ein paar Brocken. Guten Morgen, S’bâh ei-cheir, guten Abend, m’sâ el-cheir, gute Nacht, liltek saida. Bin letzten Winter mit TUI nach Djerba geflogen, an die Küste von Sidi Maharès. Wunderschön, besonders die Halbinsel mit den Flamingos.«
»Gleich nebenan liegt Houmt-Souk, meine Heimatstadt.«
»Da war ich auch! Mit der Reisegruppe! Der Basar im Soukviertel!«
Er strahlt sie an, und sie weicht etwas zurück.
»Gehst du nun mit?« Ihre Stimme klingt merklich kühler.
Er nickt kurz. Sie dreht sich um, geht zur nächsten Haustür und öffnet sie mit dem Schlüssel. Er steigt hinter ihrem wiegenden Gang das schmutzigdunkle Treppenhaus hinauf. Ihr Zimmer besteht nur aus einem Bett, einer kleinen Kommode, einem Stuhl und einem Waschbecken.
»Wie ist dein Name?«
»Anita!«
»Können wir nicht ein wenig miteinander reden, Anita?«
»Was du möchtest, wenn du bezahlst. Jede angefangene halbe Stunde hundert Mark.«
Er zieht sein Portemonnaie aus der Tasche, nimmt einen Schein heraus und legt ihn auf die Kommode. Während sie sich aufs Bett setzt, nimmt er auf dem Stuhl Platz.
»Warum tust du das, Anita?«, versucht er irgendwie das Gespräch zu beginnen. Ihr Mundwinkel verzieht sich. Ihm ist sofort klar, dass er sie verärgert hat.
»Oh, nee! Jetzt bloß keine dieser üblichen Moralpredigten, mein Lieber«, knurrt sie, springt mit einem Satz auf die Beine, geht zur Tür und reißt sie auf. »Da kannst du gleich wieder abhauen.«
Als er wieder auf der Straße steht, denkt er verwirrt darüber nach, was ihm gerade passiert ist. Die Frau wollte lieber mit ihm schlafen, als nur ein wenig reden. Eine dumme Idee zu glauben, in ihrer Nähe etwas Heimat spüren zu können. Seine Zunge ist wie Staub.
Zum ersten Mal hatte er solch massiven Zorn außerhalb von sich selbst erlebt. Doch ihre Wut war anders gewesen, es gab keine direkte Seelenverwandtschaft zwischen ihnen.
»Frag doch mal, warum ihr Männer das hier macht!«, hatte sie ihn angebrüllt, als er beruhigend auf sie einreden wollte. Es folgte eine Geschichte aus ihrem Alltag, von einem Mann, der in Windeseile seine Nummer erledigen wollte, weil seine kleine Tochter im Auto vor der Tür solange auf ihn warten musste.
»Ich geh nur schnell was einkaufen, hat er dem armen Kind gesagt. Nur schnell einkaufen! Stell dir so was vor! So, und jetzt hör auf mich zu löchern! Raus!«
Ihr Befehl war unmissverständlich. Er hatte sich hinausgeschlichen wie ein feiger Hund, ohne ein Wort der Widerrede. Doch er konnte die Hure nicht zurücklassen, sie sitzt ihm seitdem im Nacken, ihr Gesicht verfolgt ihn über den Bürgersteig. Scham steigt auf. Ihm wird heiß. Er will nur noch weg aus diesem Viertel, weg aus der Beleuchtung in das Dunkel einer Seitengasse. Während er die Küterstraße in Richtung Innenstadt entlang eilt, bemerkt er nicht, dass sich heimlich eine Gestalt an seine Fersen geheftet hat. Er schaut auf die Uhr. 20.04 Uhr.
Wir sind erst ein paar Tage im September, und schon wird es früher dunkel, denkt er.
Im selben Moment hört er hinter sich quietschende Reifen. Ein weißer Mercedes Vito saust vorbei und stoppt direkt vor ihm auf der Straße. Die Seitentür wird aufgerissen, ein mittelgroßer Mann mit schwarzer Wollkapuze über dem Kopf springt heraus. Er spürt Gefahr, bleibt stehen und starrt erschrocken auf die braunen Augen, die ihn aus dem Sehschlitz anblicken. Keuchender Atem dringt von hinten an sein Ohr. Gleichzeitig werden seine beiden Hände gepackt und mit einem massiven Griff seine Arme auf den Rücken gedreht. Ein Knie trifft seine Magengrube. Schmerzverzerrt krümmt er sich zusammen und sackt auf den Bürgersteig. Ein Stich in den Oberarm lässt ihn zusammenzucken. Sein Blick vernebelt sich. Er will um Hilfe schreien, doch die Stimme versagt. Er merkt noch, wie die kräftigen Männer ihn unter den Achseln packen. Als man ihn zum Auto schleift, ist er bereits betäubt. Es ist Freitag, der 7. September 2001.
*
»Sie sind doch Polizist?«, fragt der braune Lockenkopf mit aufgesetzt charmantem Lächeln. Der dickleibige Mann sitzt neben Jan Swensen auf der Holzbank, trägt ein knallbuntes Hawaiihemd, weiße Shorts, weiße Socken und Sandalen. Swensen nickt knapp. Im Stillen bedauert er gleichzeitig, der Urlaubsbekanntschaft jemals etwas von seiner Arbeit bei der Husumer Kripo erzählt zu haben. Er schaut auf die krummen Männerbeine, die in einer viel zu engen Hose stecken und ahnt sofort, was auf ihn zukommt. Irgendein alberner Witz über Polizisten, den er überhaupt nicht lustig finden wird. Am liebsten würde er laut »ich bin im Uuurlaub« schreien, aber wer kann zu aufdringlichen Landsleuten schon so unhöflich sein. Also lässt er dem, was kommt, einfach seinen Lauf.
»Ich wette, das werden sie nicht glauben, nech Peter!«, verkündet die zierliche Blondine, die neben dem Lockenkopf sitzt, als dieser gerade den Mund öffnen will.
Peter und Doris Heinzmann kommen aus Düsseldorf. Swensen und Anna Diete hatten das aufdringliche Ehepaar gleich am ersten Tag nach der Ankunft aus Deutschland am Strand von Dalyan getroffen. Den beiden war es mit ihrem direkten Befragungsstil in Nullkommanix gelungen, alle privaten Details von Anna und Jan offenzulegen, zum Beispiel, dass sie sich den Türkeiurlaub gemeinsam geschenkt hatten, weil sie am gleichen Tag Geburtstag haben, dem 2. September. Dass sie seit sieben Jahren in einer festen Beziehung leben, Jan vierundfünfzig Jahre alt und Anna acht Jahre jünger ist und eine psychologische Praxis betreibt.
Nach der Begegnung war es schwer geworden, den Heinzmanns nicht mehr über den Weg zu laufen. Sie trafen das Ehepaar überall im Ort, und die Düsseldorfer klebten an ihnen wie Sekundenkleber. Vor einer Viertelstunde hatten die beiden wie zufällig an der Anlegestelle der Dolmusboote gestanden und spontan beschlossen, mit Jan und Anna an Bord zu kommen.
Jetzt sitzen sie direkt neben ihnen auf einer Holzbank im Heck, und Heinzmann reagiert auf die Unterbrechung seiner Frau sichtbar genervt.
»Doris, ich erzähl das hier jetzt!«, fährt er ihr über den Mund.
Oliver Hardy und Stan Laurel, denkt Swensen. Er wirft Anna einen spöttischen Blick zu, doch die schaut demonstrativ an ihm vorbei zum Bootssteg. Langsam füllen sich die Holzbänke des kleinen Kahns. Die tratschende Gesellschaft besteht zum größten Teil aus Türken und einigen Engländern. Alle warten darauf, dass der Holzkahn ablegt und die Tour zu den Badebuchten an der Küste endlich startet. Das Ehepaar Heinzmann, Anna und Swensen bleiben anscheinend die einzigen Deutschen an Bord.
»Also«, beginnt der Lockenkopf seine unvermeidliche Geschichte, »ich habe ihnen doch schon davon erzählt, dass man gleich nach der Ankunft bei uns eingebrochen hat. Unsere Ferienwohnung liegt nämlich im Parterre, und der Dieb brauchte das Fliegengitter nur wegzubiegen und war schon drin. Wir hatten dummerweise das Fenster offen gelassen, wegen der Hitze hier. Fünfhundert Mark in bar hat der mitgehen lassen. Und nun passen Sie auf! Vor drei Tagen haben sie den Ganoven geschnappt, in flagranti, beim Einbruch in eine andere Ferienwohnung. Und wer war’s? Ein Deutscher aus Viersen! Ein Landsmann, der bei uns gleich um die Ecke wohnt. Und jetzt halten Sie sich fest!«
»Hoş geldiniz (Herzlich willkommen)!«, unterbricht ihn ein athletisch gebauter Türke in ausgefransten Jeans. Seine schwarzen Haare sind akkurat kurz geschnitten. Aus dem halboffenen, beigefarbenen Hemd protzt der behaarte Oberkörper hervor. »Ismin (ich heiße) Faruk! Faruk Özalp!«, sagt er und deutet mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf seine Brust, während er mit der linken die Fahrscheine hochhält. »Bilet!«
Swensen hält ihm zwei Finger vor die Nase und deutet auf Anna und sich. Der junge Türke zieht Zettel und Filzstift aus der Hosentasche und schreibt 22.000.000 auf den Zettel. Anna kramt aus ihrem Stoffbeutel ein kleines Vokabelbuch hervor, in dem sie den Wechselkurs von Türkischer Lira zu DM notiert hat, und verkündet nach kurzem Rechnen »so um die dreißig Mark«. Swensen blättert dem Sohn des Bootsführers die Scheine in die Hand, der Düsseldorfer schließt sich ihm an.
»Also wie gesagt, ein Landsmann hat uns beklaut«, setzt er erneut an, nachdem Faruk weitergezogen ist. »Und nun halten Sie sich fest! Die türkische Polizei schleppt den Kerl doch tatsächlich leibhaftig in unsere Ferienwohnung und lässt sich von ihm den Einbruch demonstrieren. Dann kommen die Polizisten allein wieder raus und geben uns per Handzeichen zu verstehen, wir könnten jetzt rein gehen und dem Kerl eine reinhauen. Was sagen Sie nun!«
Der Lockenkopf guckt Swensen mit sprühenden Augen erwartungsvoll an.
»Andere Länder, andere Sitten!«, sagt der lakonisch und zuckt übertrieben mit der Achsel.
»Das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Das kann man doch nicht machen! Er ist zwar ein Lump, aber so was sind Polizeistaat-Methoden! Wir wussten im ersten Moment gar nicht, wie wir uns verhalten sollten.«
»Na, Sie haben hoffentlich nicht zugeschlagen?«
»Was denken Sie von mir?«, ereifert sich der Düsseldorfer und sieht Swensen eindringlich an. »Sagen Sie bloß, das ist auch bei der deutschen Polizei gang und gäbe?«
»Natürlich nicht!«
»Das wär ja auch ein Ding!«
Swensen atmet innerlich durch. Er freut sich aufs Baden und hat keine Lust auf eine Diskussion über Rechtsstaatlichkeit.
Zugegeben, die Polizeimaßnahme war nicht die feine englische Art, aber man ist hier in der Türkei. Ich bin schließlich nicht für unterlassene türkische Disziplinarverfahren verantwortlich.
Faruk macht die Leine los, balanciert mit dem Tau in der Hand über einen Holzbalken zurück an Bord und zieht die provisorische Gangway danach aufs Boot. Jetzt wirft der Kapitän den Motor an. Gleichzeitig ertönt aus einem Lautsprecher der türkische Sommerhit Bebek von der Sängerin Izel. Der Ohrwurm des Shootingstars wird im Moment Tag und Nacht an jeder Ecke der Stadt gedudelt. Die Sonne brennt vom Himmel. Swensen flüchtet unter das gespannte Leinendach und lehnt sich neben Anna über die Reling. Es duftet nach Amberbäumen. Die Özalp, offensichtlich nach dem Kapitän und seinem Sohn benannt, tuckert im Disco-Rhythmus langsam den brauntrüben Dalyan-Flussarm hinunter, der sich in großen Bögen durch ein Sumpfgebiet schlängelt. Beide Uferseiten sind mit hohem Schilf zugewuchert. Schon vor dem Urlaub hatte Anna lange in ihrem Türkeiführer herumgeblättert und herausgefunden, dass Dalyan übersetzt Fischreuse heißt.
Am Ende des Mündungsdeltas führt die Wasserstraße durch einen natürlichen, etwa dreißig Meter breiten Kanal ins Mittelmeer. Links kann man den vorgelagerten Îztuzu-Strand liegen sehen, dessen östlicher Teil zur Brutzeit der Carretta carretta, der Wasserschildkröten, für Touristen gesperrt wird. Swensen sehnt sich nach Abkühlung und lässt seine Hand ins Wasser gleiten. Irgendwie bekommt er die makabere Story des Düsseldorfers nicht mehr aus dem Sinn. Die türkische Polizei scheint nicht zimperlich zu sein, sinniert er und muss unwillkürlich an eine unangenehme Situation denken, an der er selbst beteiligt war.
Damals hatte die deutsche Exekutive sich ebenso wenig mit Ruhm bekleckert. Das Ganze lag über zwanzig Jahre zurück, Herbst 1977. Später hieß dieser Zeitabschnitt nur noch Deutschland im Herbst. Hanns-Martin Schleyer war im September entführt worden. Die Täter hatten seinen Wagen mit Maschinenpistolen angegriffen und dabei drei Polizisten und den Fahrer ermordet. Der Arbeitgeberpräsident wurde in einen weißen VW-Bus gezerrt und verschleppt.
Swensen war Schutzpolizist in Hamburg gewesen. Eine Woche nach der Entführung hatten die Täter der Bundesregierung bereits das fünfte Ultimatum gestellt. Der Gefangene Baader und alle in Stammheim Inhaftierten sollten bis 24.00 Uhr freigelassen werden. Mit sechs Beamten machte die Polizeidirektion West am selben Tag eine Verkehrskontrolle am Pferdemarkt, Ecke Stresemannstraße. Aus der stadtauswärts rollenden Autoschlange sollten verdächtige Fahrzeuge herausgepickt und überprüft werden. Die Bild hatte an diesem Tag auf der ersten Seite das Foto vom verängstigten Schleyer abgedruckt. Vor ihm stand ein Schild mit der Aufschrift »Seit 7 Tagen Gefangener der RAF«. Links über ihm der Stern, die Buchstaben der RAF und ein Maschinengewehr. Schon bei Dienstantritt wünschten einige Kollegen, die Zeitung in der Hand, den Terroristen den Tod an den Hals. Swensen war das sehr unangenehm gewesen, obwohl er diese Zurschaustellung des Opfers auch nicht richtig fand. Mit dem Foto im Kopf, der Maschinenpistole im Anschlag, lauerte er mit zwei Kollegen in Schutzwesten hinter dem Dienstfahrzeug, einem zivilen VW-Bus. Sie sicherten die beiden anderen, die mit der Kelle die Fahrzeuge herauswinkten.
Es passierte völlig unerwartet. Polizeimeister Dörsing und Polizeihauptmeister Zechser lotsten einen gelben VW-Bus auf eine Busspur. Dörsing trat an die Fahrertür. Swensen folgte seinem Kollegen Wesener und baute sich mit der MP vor der Frontscheibe auf. Er sah, wie der langhaarige Fahrer wild gestikulierend auf Zechser einredete. Alles Weitere ging sehr schnell. Zechser riss die Fahrertür auf, packte den Mann am Arm und zerrte ihn hinaus. Der wehrte sich mit Händen und Füßen. Zu zweit warfen sie ihn zu Boden, drehten ihm die Arme auf den Rücken und drückten ihm die Knie in die Seite. Der Mann brüllte laut um Hilfe. Im selben Moment kletterte eine Frau aus dem Laderaum über den Fahrersitz. Sie stürzte sich von hinten auf Zechser, schlang ihm die Arme um den Hals und versuchte, ihn nach hinten zu ziehen. Swensen war wie erstarrt, während Wesener nach vorn stürmte. Er packte die Frau an ihren Handgelenken, drehte sie zur Seite, bis ihr Griff sich lockerte, zog sie hoch und schleudert sie gegen den VW-Bus. Ihr Kopf knallte hart gegen das Blech, eine Augenbraue platzte auf, und das Blut floss über Auge und Wange. Mittlerweile äußerten die Passanten an der Bushaltestelle lauthals ihren Unmut.
»Lassen Sie die Frau los!«, »Schlägertruppe!«, »Bullenpack!«, tönte es herüber.
Swensen konnte es kaum ertragen, wäre am liebsten getürmt. Die aufgerissenen Augen des Polizisten waren plötzlich wieder aufgetaucht, als wenn sie ihn verfolgen würden. Sie starrten ihn angstverzerrt an, als wollten sie sagen: »Swensen, jetzt bist du auf der anderen Seite!«
Es kribbelt im Kopf. Der Urlauber Swensen versucht, die unangenehmen Erinnerungen auszublenden, zumal die Überprüfung der beiden damals ergeben hatte, dass sie nur harmlose Studenten waren. Außerdem fuhren wirkliche Terroristen um diese Zeit schon lange BMW und Mercedes und liefen kurzhaarig herum.
Das brüllende Geheul eines Kampfjets reißt seine Gedanken endgültig mit sich. In kurzen Abständen jagen zwei weitere Maschinen dicht über ihre Köpfe. Anna schließt die Augen und legt die Hände schützend über die Ohren.
»Hier ist ein Urlaubsgebiet!«, stöhnt sie mit verzogenem Gesicht.
Swensen sieht die drei Maschinen als kleine Punkte in Richtung Osten verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er nicht, dass er jedes noch so kleine Ereignis dieses Tages, selbst seine Gedanken und Gefühle, ein Leben lang nicht mehr vergessen wird.
Die Özalp erreicht das offene Mittelmeer. Der Kahn schippert nach rechts die lykische Küste hinauf. Es wird immer heißer, kein Lüftchen weht. Swensen hat sich bis auf die Badehose von aller Kleidung befreit. Anna trägt noch ihr sonnengelbes Baumwollhemd über ihrem grünen Bikini. Der Kapitän lässt den Motor hochfahren und stellt ihn ab. Mit dem letzten Schub schippert der Holzkahn um eine pinienbewachsene Felswand. Schräg vor dem Bug erscheint eine malerische Badebucht mit kristallklarem Wasser und einem menschenleeren Sandstrand. Das Boot driftet aufs Ufer zu. Kurz bevor der Kiel im flachen Wasser auf Grund läuft, hat Swensen sich mit Taucherbrille und Schwimmflossen vom Heck ins Wasser gestürzt. Mit kraftvollen Beinbewegungen taucht er hinab in die Stille, fernab vom Disco-Sound und Stimmengeschnatter. Sandboden gibt es nur in Ufernähe, gleich dahinter beginnt ein felsiger Untergrund mit bizarren Formationen. Swensen steigt kurz an die Oberfläche, holt Luft und arbeitet sich wieder hinab zu dem Seegrasfeld, das sich über eine Art Steinplatte zieht. Vor ihm kreuzt ein Schwarm Goldstriemen. Die gestreiften Fische gucken aus gelben Knopfaugen, grasen den winzigen Bewuchs der Seegrasblätter ab und weichen geschlossen zurück, wenn er ihnen allzu nahe kommt. Der Salzgehalt des Wassers zieht ihn an die Oberfläche. Er schwebt wie in Schwerelosigkeit, pendelt mit dem linken Arm, macht eine Drehung und bekommt einen Riesenschrecken. Keinen halben Meter vor ihm treibt der braune Rückenpanzer einer Meeresschildkröte an seinem Kopf vorbei. Der hakig gebogene Kiefer ähnelt einem gelben Papageienschnabel. Die Vorderbeine haben Flecken im gleichen Gelb. Das Tier schwingt sie wie Flügel und fliegt ins offene Meer zurück. Es ist wie eine Begegnung mit dem Anbeginn unserer Welt.
Swensen ist völlig aus dem Häuschen, als er wieder an Land kommt. Immer wieder erzählt er Anna begeistert die gleiche Geschichte und das fliegende Urtier nimmt von Mal zu Mal an Größe zu. Einige Zeit später riecht es nach Sonnenöl und Kreischen und Lachen erfüllen die Luft. Er liegt neben Anna im heißen Sand. Während sie ein Buch hervorkramt, wie immer ein dicker Schinken von mindestens fünfhundert Seiten, gibt er sich genussvoll dem Nichtstun hin, lässt seinen Blick über das Meer schweifen, lauscht dem Klang der Wellen und kann dann doch nicht umhin, heimlich aufs Buchcover zu schielen: ›Die Musik der Wale‹ von Wally Lamb. Es bleibt der einzige Rückfall aus seiner Trägheit, bis weißer Rauch quer über den Strand treibt. Der Kapitän und sein Sohn haben einen Holzkohlegrill angeworfen. Der Duft von Kebab und Fisch breitet sich aus. Das sieht zwar alles verlockend aus, aber Swensen bleibt seiner vegetarischen Seele treu. Er nimmt eine große Portion Salat, dazu geröstetes Fladenbrot, Schafskäse und schwarze Oliven. Anna kaut genüsslich an einem Stück Dorade. Vor der Bucht taucht eine riesige, schwarze Motorjacht auf und geht vor Anker. Das Ausflugsboot wirkt dagegen wie eine Nussschale. An Bord ist niemand zu sehen. Vielleicht haben sie die Pest an Bord, denkt Swensen, oder sie sind alle an Reichtum gestorben. Bis zu ihrer Abfahrt rührt sich auf dem schwimmenden Monstrum kein Mensch.
*
Als die Anlegestelle in Dalyan in Sicht kommt, fällt das Licht der Sonne bereits schräg. Es ist kurz vor 17.00 Uhr. Swensen schüttelt den Sand von den Strandsachen ins Wasser und packt sie in den Rucksack. Da klingelt das Handy einer älteren Türkin. Die mondän wirkende Dame trägt einen modischen Strohhut, ein elegantes rotes Sommerkleid und schwere Goldketten um den Hals. Er sieht ihr zufällig direkt ins Gesicht, als sie das Gespräch annimmt. Ihre braunen Augen weiten sich einen unscheinbaren Moment. Die fragende Stimme wirkt stakkatoartig, das Gesicht versteinert sich zunehmend und zuletzt steht sie stocksteif an der Reling. Der Song von Izel hämmert über der Szene. Einige Landsleute reden auf die Dame ein und beginnen wild zu gestikulieren. Ein Wortschwall nach dem anderen wogt durch die türkische Touristengruppe. Ein Engländer versucht Auskunft zu bekommen. Man hört immer wieder das Wort »Amerika«.
»Da scheint irgendwas los zu sein!«, ereifert sich der Düsseldorfer.
Swensen geht auf den sommersprossigen Engländer zu und fragt: »What’s the matter?«
Der zuckt nur mit der Schulter: »I don’t really know! The woman said, America was just attacted!«
»Was meint der Typ?«, fragt der Düsseldorfer.
»Jemand greift Amerika an!«
»Unsinn!«, fährt Anna dazwischen. »Das ist doch Unsinn! Wer sollte denn Amerika angreifen?«
Ihre Frage wirkt auf Swensen plötzlich merkwürdig beunruhigend. Unterschwellig nimmt er eine dubiose Bedrohung wahr. Irgendetwas scheint dort in Amerika vorzugehen, denkt er, aber was?
»Wahrscheinlich haben die Amis wieder jemanden angegriffen!«, sagt er mit einem gezwungenen Lächeln zu Anna. »Aber wer sollte das sein? Es gab vor unserem Urlaub keinerlei Anzeichen!«
So schlagartig wie die Unruhe sich an Bord ausgebreitet hatte, verebbt sie auch wieder. Selbst die Düsseldorfer verstummen. Die Menschen sitzen zusammen und reden ruhig miteinander, als wenn nichts gewesen wäre. Mit einem klammen Gefühl im Magen beobachtet Swensen Kapitän Özalp dabei, wie er seinen Kahn mit kleinen Manövern exakt zwischen zwei andere steuert und mit dem Bug am Holzsteg andockt. Sofort springt sein Sohn mit einem Satz von Bord, verankert das Schiffstau an einem Poller. Der Kapitän schiebt den Holzbalken zum Steg hinüber.
Ohne großes Palaver strömt die Gruppe auseinander. Das Ehepaar Heinzmann hebt synchron den rechten Arm und latscht mit einem breiten »Tschauuu!« zur Promenade hinüber, am Denkmal der fliegenden Bronzeschildkröte vorbei, weiter in Richtung Moschee. Swensen schultert den Rucksack und marschiert mit Anna in entgegengesetzter Richtung, die Einkaufspromenade hinauf. Gleich hinter der Nectar-Bar kommen sie an einem kleinen Teehaus vorbei. Drinnen steht eine Traube Männer und einige Frauen, den Rücken zum Eingang. Es fällt kein Wort, von außen ist nur das bläuliche Flimmern eines Fernsehers zu erkennen. Im Hintergrund hört man die überdrehte Stimme eines TV-Moderators.
Klingt selbst auf Türkisch so überkandidelt wie in Deutschland, denkt Swensen. Er stellt sich auf die Zehenspitzen. Nichts. Das Blut pocht in seiner Schläfe. Er dreht sich um, Annas graublaue Augen blicken durch ihn hindurch. Wortlos gehen sie weiter. In der Internet-Bar neben dem Cool-Chilli-Restaurant wiederholt sich die gleiche Szene nochmal. Wieder hat sich eine Traube stummer Männer und Frauen vor einem unsichtbaren Fernseher weit hinten im Raum gebildet.
»Es muss was passiert sein!«, sagt Swensen scharf.
»Na, so schlimm wird’s schon nicht sein«, versucht Anna sich zu beruhigen. Er registriert, dass ihre Stimme unterschwellig bebt. Sein Körper reagiert völlig überdreht. Ihm ist heiß, Schweiß rinnt seine Brust hinab. Er merkt, wie der ungewisse Zustand seinen Blick auf den Ort verändert. Seine Gedanken haben einen diffusen Druck über die vertraute Urlaubsidylle gelegt.
Dabei ist alles genauso, wie heute Morgen, denkt er. Was hatte er gestern über den Geist im neuen Buch seines Meisters gelesen?
»Was wir Geist nennen, ist ein immerwährender Strom von Wahrnehmung. Die Ursache für deinen jeweiligen Augenblick ist der vorhergegangene geistige Augenblick dieses Stroms. Da dein Geist aber nicht materiell ist, gibt es außerhalb von dir auch keine materiellen Objekte für deinen geistigen Zustand. Der Geist ändert sich stetig und so verändert er auch deine Gefühle. Er ist wie eine Flagge im Wind, die wechselnden Umstände halten ihn in Bewegung.«
Swensen versucht, sich nicht weiter von seinen Gedanken überwältigen zu lassen, übt den neutralen Blick. Fast in jedem Erdgeschoss der zweistöckigen Häuser befinden sich Souvenirläden, voll mit bunten Schwimmreifen, Postkarten und Schildkrötenkitsch. Anna und er lassen den Ortskern hinter sich. Wenig später erreichen sie ihre Ferienanlage. Rechts fließt der Daylan-Fluss. Die Felswand gegenüber liegt bereits im Schatten. Die dort in den Stein gehauenen Königsgräber erscheinen düster und unwirklich. Die Giebel und Säulen ähneln griechischen Tempeln. Jeden Morgen beim Frühstück blicken sie von der Terrasse ihrer Ferienwohnung aus direkt darauf. Dann erstrahlen die Überreste des antiken Kaunos im Sonnenlicht.
Çapkin, der kleine schwarze Mischlingsrüde des Vermieterehepaars Günes, stürmt ihnen mit dem Schwanz wedelnd am Eingang zur Anlage entgegen.
»Çapkin heißen Casanova«, hatte Frau Günes augenzwinkernd bei der Ankunft erklärt. »Immer jagen hinter Hündinnen!«
Der Hund trabt neben ihnen her und kläfft übermütig. Da öffnet sich ein Fenster in dem Haus der Günes. Ein untersetzter älterer Türke mit leichtem Glatzenansatz ruft zu ihnen herüber: »Frau Diete, Herr Swensen, Sie müssen die Nachrichten schauen!«
Swensens beklemmendes Gefühl ist sofort wieder da. Anna hatte dem Mann scherzhaft den Namen Konsul gegeben, als sie erfahren hatten, dass er bis zur Rente im türkischen Konsulat in Köln tätig gewesen war.
Der Konsul ist eine elegante Erscheinung und spricht perfekt deutsch. Einen Moment später steht er mit Herrn Günes vor der Haustür, der die Deutschen hereinbittet. Es geht durch einen kleinen Raum, in dem eine alte, rotbraune Kommode mit einem mächtigen Frisierspiegel steht, ins Wohnzimmer. Der Fernseher läuft. Braunschwarze Wolken quellen unablässig aus den oberen Stockwerken eines Hochhauses. Das unwirkliche Bild auf dem Schirm springt Swensen buchstäblich an. Sein Atem stockt. Im selben Moment, als er einen Turm des New Yorker World Trade Center erkennt, sieht er, wie das Gebäude zuerst unmerklich, dann immer schneller, nach unten wegsackt. Es verschwindet in einem gigantischen Pilz aus Rauch und Staub. Trümmerteile werden herausgeschleudert. Swensen ist starr vor Schreck. Ein Unglück, denkt er, während sich der Staubpilz wie ein riesiges Maul an der Fassade nach unten frisst und in die Häuserschluchten explodiert. Menschen, das blanke Entsetzen im Gesicht, rennen um ihr Leben, werden von der Wolke eingeholt und verschwinden im schmutzigen Nichts. Er steht benommen im Türrahmen. Frau Günes nimmt Anna an die Hand und setzt sich mit ihr auf ein dunkelgrünes Plüschsofa. Swensen bleibt stehen. Auf dem Bildschirm erscheint ein türkischer Nachrichtensprecher. Der Konsul übersetzt in abgehackten Intervallen ins Deutsche.
»Heute Morgen um 8.45 Uhr … steuerte eine Boeing 767 … in den Nordturm des World Trade Center. Achtzehn Minuten später … schlug ein baugleicher Jet in den Südturm.«
Am linken Rand des Bildschirms taucht ein Spielzeugflugzeug auf und verschwindet in der Fassade, als würde es in ein Stück Butter gleiten. Der Turm zerfetzt in einem riesigen Feuerball.
Seine Gedanken sind plötzlich hohl. Immer wieder spricht eine Stimme: Das kann nicht sein, unmöglich, das kann nicht wahr sein.
Er sieht eine Szene aus Independence Day, in der ein unermesslich großes Raumschiff mit einem Laser-Strahl das Empire State Building in sich zusammenstürzen lässt.
Verdammt! Das ist keine Sciencefiction, denkt er, während die Übersetzung des Konsuls monoton in sein Vakuum eindringt.
Die aufgerissenen Betonstreben sehen auf dem kleinen Bildschirm wie zerbrochene Streichhölzer aus. Dahinter bewegen sich kleine Strichmännchen. Die Kamera fährt heran. Arme winken aus den rauchenden Trümmern. Menschen stürzen kopfüber aus der Höhe.
Swensen sieht, dass Anna ihre Hände zu Fäusten geballt in den Sofastoff drückt. Tränen laufen ihr die Wangen hinab. Frau Günes hat ihr den Arm um die Schulter gelegt.
»Auch die Zentrale … der US-Militärmacht ist von einer entführten Boeing … getroffen worden«, übersetzt der Konsul. »Eine vierte Maschine scheint … über Pennsylvania abgestürzt zu sein!«
Eine halbe Stunde später sitzt Swensen mit einem grünen Tee, den er eigens aus Deutschland mitgebracht hat, auf der Terrasse ihrer Ferienwohnung. Er sieht schweigend zu den Felsengräbern hinüber. Sein Blick nimmt nichts wahr, verliert sich in unscharfen Umrissen.
»Hallo, Jan! Bist du noch da?«
Annas liebevolle Stimme durchdringt die Bilder des Grauens, die sich in seinem Kopf festgesetzt haben. Er dreht den Kopf und sieht ihr direkt ins Gesicht. Die letzten Sonnenstrahlen leuchten durch ihre roten Haare. Unerwartet ist Frieden in ihm. Sie ist so schön, denkt er, sagt aber nichts.
»Ich hab Sabine übers Handy angerufen.«
»Sabine?«, fragt er, als ob jemand anderer fragen würde.
»Sabine, Jan! Meine Freundin Sabine Meinert!«
»Ja klar, natürlich, Sabine!«
»Ich wollte hören, was in Deutschland so los ist.«
»Und?«
»Es herrscht das blanke Entsetzen. Auf allen Nachrichtenkanälen laufen ununterbrochen nur diese Bilder aus Amerika. Man rechnet mit mehreren tausend Toten. Es soll dieser Terrorist Osama bin Laden gewesen sein. In vielen Ländern gibt es erhöhte Alarmbereitschaft. Das hört sich alles nicht gut an, oder?«
»Es wird Krieg geben!«
»Jan, mach mir keine Angst!«
»’schuldigung, das wollte ich nicht. Andererseits nützt es auch nichts, die Augen zuzumachen, Anna! Amerika wird doch nicht eine Einzelperson festnehmen und das war’s dann. So ein Angriff muss schließlich überboten werden.«
»Da hat Deutschland doch nichts mit zu tun!?«
»Du vertrittst also das Prinzip: Lieber Sankt Florian …!«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich hab nun mal einen Riesenschiss! Du sagst selbst immer, ein Buddhist sollte keine negativen Gedanken unausgegoren in die Welt setzen!«
»Du hast recht, ich sollte achtsamer sein«, sagt er und nimmt Anna in die Arme. »Weiß du was? Ich hab Hunger.«
Ihr schmaler Mund verzieht sich zu einem gequälten Lächeln. Sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter.
»Ich glaube, ich hab auch Hunger.«
»Gehen wir doch rüber ins Sini. Die haben diese riesige TV-Leinwand. Vielleicht erfahren wir was Neues.«
Zwanzig Minuten später sitzen sie im Gartenrestaurant unter dem Blätterdach eines riesigen Gummibaums und studieren die Speisekarte. Vor der Großbildleinwand sitzt eine Schar Türken und verfolgt das Fußballspiel zweier Mannschaften. Ab und zu schallt ein kollektives »Aaaah!« und »Ooooh!« herüber.
»Champions League!«, sagt der Ober, als er die Bestellung aufnehmen will. »Galatasaray gegen Lazio Rom!«
Swensen kommt ein Gemälde von Magritte in den Sinn, auf dem unzählige Männer mit Melonen auf dem Kopf und in schwarze Mäntel gehüllt vor und über einer grauen Häuserzeile schweben. Plötzlich verändert sich seine Sichtweise. Die Männer schweben nicht mehr, sie regnen vom Himmel. Nichts ist surrealistischer als die Wirklichkeit, denkt er.
*
»Da ist er raus!«, japst der pummelige Mann im weißen Kittel. Er deutet mit hochrotem Kopf auf das geöffnete Fenster und will gerade darauf zusteuern, als Swensen ihm mit seinem ausgestreckten Arm den Weg versperrt.
»Halt! Nichts anfassen, bevor die Spurensicherung hier war, Herr …?«
»Schudt, ich bin der Filialleiter.«
»Gut, Herr Schudt. Ich bin Hauptkommissar Swensen. Können Sie schon ungefähr sagen, was abhanden gekommen ist?«
»Der Tresor wurde aufgebrochen, die gesamten Tages-einnahmen, Scheine und Wechselgeld sind verschwunden! Das wird sich so um die fünfzehntausend Mark handeln! Genau weiß ich das noch nicht! Außerdem fehlen noch drei Laptops aus meinem Büro!«
»Die Alarmanlage ist um 6.13 Uhr losgegangen«, sagt der Schutzpolizist aus Tönning, der neben Swensen steht. »Zirka zehn Minuten später waren wir da. Nichts. Der Täter war schon getürmt. Wir haben die Fahndung eingeleitet und euch benachrichtigt.«
»Wann kann ich den Laden endlich aufmachen?«, fragt der Filialleiter und bläst seine Pausbäckchen auf. »Es ist schon acht! Vor der Tür warten bereits Kunden!«
»Ganz langsam mit den jungen Pferden, Herr Schudt! Wir sind vor zehn Minuten erst aus Husum hier angekommen! Die Spurensicherung ist schon an der Arbeit! Wir können nicht hexen!«
»Und wer kommt für den Verdienstausfall auf?«, knurrt der Filialleiter und unterstreicht seine Worte mit übertriebener Gestik.
»Wir nicht, Herr Schudt! Damit alles möglichst schnell geht, melden Sie sich bitte im VW-Bus, gleich neben dem Eingang. Dort sitzt Hauptkommissarin Haman, und der erzählen Sie den gesamten Ablauf nochmal bis in alle Einzelheiten. Das kommt dann alles ins Protokoll.«
Nachdem der weiße Kittel hinter der Hausecke verschwunden ist, atmet Swensen erleichtert durch. Der furchtbare Abschluss des Urlaubs steckt ihm immer noch in den Knochen.
Letzten Sonntagmittag waren er und Anna in Hamburg gelandet und mit dem Zug nach Husum weitergereist. Vor dem Bahnhof hatten sie sich getrennt und waren mit Taxis jeder in seine Wohnung gefahren. Swensen hatte seinen Koffer ungeöffnet in die Ecke gestellt, sich aufs Sofa fallen lassen und war den ganzen Abend in einem merkwürdigen Desinteresse versackt. Ein undefinierbares Gefühl sagte ihm, dass sich die Welt unwiederbringlich zum Schlechteren verändern würde. Er musste ununterbrochen an die letzten Tage in der Türkei denken. Der Konsul hatte nach dem Anschlag jeden Tag die türkische Bildzeitung Hürriyet mitgebracht und die Schlagzeilen übersetzt. Die Zeitungsbilder von den Trümmerresten des World Trade Center, die wie filigrane Scherenschnitte aus dem Schutt ragten, waren unfassbar gewesen.
Heute Morgen hängt eine graue Wolkendecke über dem trostlosen Industriegelände am Stadtrand von Tönning. Vor dem Lidl-Markt gleich gegenüber kommt mittlerweile eine gewisse Hektik auf. Eine längere Schlange hat sich vor den angeketteten Einkaufswagen gebildet. Der geschlossene Wandmaker treibt die Kunden zur Konkurrenz hinüber, obwohl einige Hartgesottene weiterhin vor dem Eingang ausharren. Zwei Schutzpolizisten geraten sichtbar genervt in ein Rededuell mit einer robusten Bäuerin, die unbedingt ihr Recht auf Einkauf durchsetzen will. Swensen beobachtet alles aus sicherer Entfernung und schlendert über den riesigen Parkplatz auf den dunkelroten Ford Fiesta zu, der gleich neben einem Grillstand steht. Es ist der Privatwagen von Peter Hollmann, dem Leiter des Spurenteams. Swensen lehnt sich an den Kotflügel. Es riecht penetrant nach altem Fett und gegrillten Hähnchen.
Der zweite Arbeitstag hat gerade erst angefangen und du machst auf phlegmatisch, denkt er.
Am liebsten würde er einfach nur regungslos dastehen und ausharren. Er hat den Eindruck, als würde er hinter einer milchigen Glasscheibe stehen und sich selbst beobachten, wie er behutsam näher tritt. Die Sicht wird klar. Ihm schwindelt. Sein Blick stürzt aus dem 107. Stock hinab in die Häuserschluchten zu seinen Füßen. Der West Broadway gleicht einer Ameisenstraße, die Autos winzigkleinen Insekten, die durch ein von Wolkenkratzern umsäumtes Gitternetz krabbeln. Selbst die New Yorker Taxis sind nur noch als gelbe Tupfer auszumachen. In Richtung Lower Manhattan kann er die Freiheitsstatue in der Ferne entdecken. Seit dem 11. September tauchen die Bilder immer wieder vor seinem inneren Auge auf.
Eine Woche New York, Annas Geschenk zum 50., war für ihn zu seiner Offenbarung geworden. Noch nie zuvor hatte er sich in einer so manisch überdrehten Stadt aufgehalten. Grand Central Station! Rockefeller-Center! Empire State Building! Broadway! Orte, aus unzähligen Filmen schon lange bekannt, wurden mit großen Kinderaugen wieder entdeckt. Vom ersten Moment an fühlte er sich hier zu Hause, hatte schon immer hier gelebt. Hollywoods Hochglanz verblasste in dieser Wirklichkeit. Der Big Apple war nicht nur marmorblank, sondern ziemlich angebissen. Weiße Stretch-Limousinen versanken in den Schlaglöchern der Fifth Avenue, weißer Wasserdampf zischte aus abgefahrenen Gullydeckeln, ausgebeulte Plastiktüten türmten sich vor dem Royal Canadian Pancake House. New York hatte ihn elektrisiert und willenlos in seinen Bann gezogen. Er trieb hin und weg im Hier und Jetzt, leuchtete vor Van Goghs Sternenhimmel im Museum of Modern Art, vibrierte nach auf Mülltonnendeckeln getrommelten, schwarzen Rhythmen, sprühte bei Annas Dessousshopping um 22.00 Uhr im überfüllten GAP. Mitten in der Nacht standen sie Arm in Arm am Hotelfenster im 47. Stock und schauten durch die hell erleuchteten Glasfassaden in die menschenleeren Büros gegenüber. Den ganzen Tag über hatte die Stadt zu ihnen gesprochen, an einer Ecke italienisch, dort spanisch, da schwedisch, chinesisch, arabisch und sogar deutsch.
Swensen merkt, wie sein Gesicht feucht wird. Ein feiner Sprühregen nieselt vom Himmel. Zum zigsten Mal stürzen die Türme vor seinem inneren Auge in sich zusammen. Abrupt wandelt sich die Staubwolke in einen Sandsturm, rast über ihn hinweg und eine weite Wüstenebene erstreckt sich bis zum Horizont. Mittendrin wächst ein neuer Turm in den Himmel, Babel.
›Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vornehmen zu tun. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe!‹
»Wir sollten unseren Geist von den unbeherrschten, weltlichen Handlungen wie sinnloses Gerede fernhalten«, hört er die Stimme seines Meisters. »Die innere Kraft kommt aus dem schinä, wie wir Tibeter sagen, dem Geist der in Frieden (schi) verweilt (nä).«
Swensen weiß, dass er sich einen Ruck geben muss, sonst wird er in seiner selbst erzeugten Schwermut hängen bleiben. Wie ferngesteuert setzt er seine ersten Schritte, an den Beamten vorbei, durch den Kassenbereich bis in den hinteren Teil des Supermarkts. In Höhe der Fleischtheke entdeckt er Hollmann im Gespräch mit einem Kollegen der Spurensicherung. Er winkt und eilt auf ihn zu.
»Na, könnt ihr schon was sagen?«
»Das Übliche, Jan! So wie das hier aussieht, hat der Kerl sich nach Geschäftsschluss vom Personal einschließen lassen. Er hat die Tür zum Büro aufgebrochen und den Tresor in Ruhe mit ’ner Flex aufgemacht. Danach ist er zum Fenster raus.«
»Der Alarm ist um 6.13 Uhr losgegangen! Brauchte der eine ganze Nacht, um den Tresor aufzukriegen?«
Hollmann zuckt mit den Achseln. Der Mund unter seinem buschigen Schnauzer verzieht sich zu einem Grinsen.
»Gute Frage! Bloß die Spurensicherung kann da wohl kaum weiterhelfen. Das ist dein Job, mein Lieber. Ich sage nur, die Wege der Ganoven sind unergründlich!«
»Dauert’s noch lange bei euch?«
»Nee, wir kehren nur die letzten Spuren zusammen, und dann sind wir schon weg!«