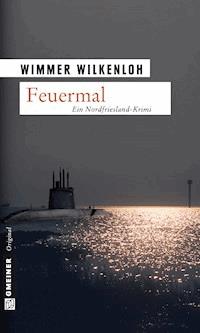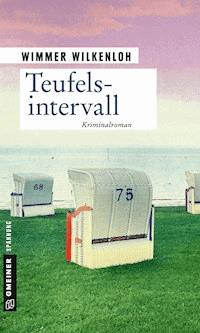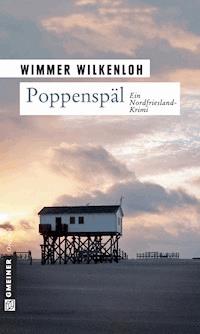
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Jan Swensen
- Sprache: Deutsch
Ein Montag, im September. Im Husumer Schlosspark werden drei Frauen erschossen. Sie gehören alle zum Organisationsteam des Pole-Poppenspäler-Festivals, dem großen alljährlichen Kulturereignis in der Region. Der grausame Dreifach-Mord schockiert die gesamte Stadt. Selbst Kommissar Jan Swensen, dem bereits eine mysteriöse Einbruchsserie Kopfzerbrechen bereitet, verliert fast seine buddhistische Gelassenheit. Das Ermittlungsteam steht unter Hochdruck, es gibt zu viele Verdächtige und es scheint, als könnte jeder der Mörder sein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wimmer Wilkenloh
Poppenspäl
Der dritte Fall für Jan Swensen
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Website des Autors:
www.wimmer-wilkenloh.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von aboutpixel.de / st. peter-ording 1 ©mel1607
ISBN 978-3-8392-3000-8
Vorwort
Die Pole-Poppenspäler-Tage, vor deren Hintergrund der folgende Roman spielt, sind keine Fiktion. Das Festival der Puppenspieler findet seit über 25 Jahren im Herbst in Husum statt. Deshalb möchte ich alle Leser daran erinnern, dass dieser Krimi zwar vor einem realen Ereignis spielt, die Handlung jedoch bis ins Detail frei erfunden ist. Aus eigener Erfahrung musste ich feststellen, dass einige meiner Freunde, obwohl sie wussten, dass sie eine ausgedachte Geschichte lesen, plötzlich gewisse Ähnlichkeiten zwischen mir und meinem Hauptkommissar entdeckten. Das ist sicher sehr reizvoll, entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Um diesem Missverständnis vorzubeugen, versichere ich dem Leser noch einmal ganz eindringlich, dass alle Personen dieses Krimis von mir frei erfunden worden sind. Die Menschen des Förderkreises Pole Poppenspäler leisten jedes Jahr eine bemerkenswerte Arbeit, damit dieses Festival stattfinden kann. Ich persönlich freue mich jedes Jahr auf das ungewöhnliche Programm und möchte daher nicht, dass dieser Roman in irgendeiner Weise mit toten oder lebenden Personen in Verbindung gebracht wird. Allen Lesern empfehle ich eindringlich, sich auf keinen Fall die Pole-Poppenspäler-Tage in Husum entgehen zu lassen. Allen Menschen, die an der Organisation der Tage beteiligt sind, wünsche ich, dass sie hochbetagt und eines natürlichen Todes sterben mögen.
Das kleinste Schaf der Welt
Eine fabelhafte Erzählung
Im hohen Norden Irlands erstreckt sich eine hügelige Ebene mit saftiggrünem Gras. Diese fruchtbare Ebene grenzt an einen großen, dunklen Wald und davor stand einmal ein schmucker Bauernhof. Heute sind davon nur ein paar verfallene Mauerreste übriggeblieben.
Dort kam, als der Hof noch von einem alten Ehepaar betrieben wurde, vor langer, langer Zeit ein kleines Schaf zur Welt. Es war ein ganz besonderes Schaf, denn es war sehr, sehr klein. Es hatte ein zierliches Gesicht, eine schmale Schnauze und auffällig große, braune Augen.
»Hast du schon einmal so ein kleines Schaf gesehen?«, fragte der Bauer gleich nach dessen Geburt die Bäuerin, während er das schwache Tier auf eine Schubkarre lud und in den warmen Stall fuhr.
»Das ist bestimmt das kleinste Schaf der Welt!«, antwortete ihm die Bäuerin und wischte mit einem Schwamm den blutigen Schleim vom zierlichen Körper. »Was hältst du davon, wenn wir es Seba nennen?«
»Seba? Wieso denn Seba?«
»Nach Sebastian, unserem Kleinsten!«
Und so kam es, dass Seba von der Bäuerin mit der Flasche großgezogen wurde und erst lange nach Pfingsten auf die Wiese zu den anderen Schafen kam. Das Mutterschaf Lotte war zuerst überglücklich. Es liebte Seba von ganzem Herzen. Doch mit der Zeit musste sie feststellen, dass die Herde ihr Gefühl für Seba nicht teilte. Im Gegenteil, das kleinste Schaf der Welt wurde von den anderen Schafen beflissentlich ignoriert. Seba konnte nicht so übermütig in die Luft springen wie all die anderen Jungschafe, seine Beinchen waren doch so zerbrechlich. Niemand wollte mit dem kleinsten Schaf der Welt spielen. Es wurde kurzerhand, trotz seiner besonders weißen Wolle, zum schwarzen Schaf der Herde erklärt, unentwegt gehänselt und gequält.
Eines Nachmittags war das kleinste Schaf der Welt wieder einmal von den anderen stundenlang angerempelt worden. Seba lag verzweifelt im Schatten einer mächtigen Buche, als er die tiefe Stimme seiner Mutter Lotte hörte.
»Sebaaaaah!«, blökte sie aus einiger Entfernung. »Seeebaaaah! Seeebääääh! Wo bist du denn schon wieder?«
Kurze Zeit später tauchte ihr zotteliges Fell hinter dem Hügel auf, und sie trabte gemächlich auf Seba zu.
»Was liegst du hier allein rum, Seba? Warum spielst du nicht, wie es sich für ein kleines Schaf gehört, mit den anderen Lämmern?« In ihrer Stimme klang ein vorwurfsvoller Unterton mit. Das kleinste Schaf der Welt hasste diese Fragen und schaute sehnsüchtig zum Himmel hinauf. Dort zogen weiße Schäfchenwolken über den blauen Grund, eine schöner gekräuselt als die andere.
»Ich mag nicht mit den anderen spielen!«
»Aber spielen ist doch etwas Schönes, Seba!«
»Nein, ist es nicht! Ich schaue mir lieber die Wolkenschäfchen an!«
Nur einmal möchte ich wie eine große Wolke sein, dachte Seba, nur nicht so blöd weiß und gekräuselt wie die meisten dort oben. Ich will mächtig aufgebläht sein und schwarz. Und dann werde ich mit Absicht gegen alle anderen Wolken stoßen, damit ein feuriger Blitz vom Himmel fällt und mitten in diese gemeine Herde fährt.
»Du kannst jetzt nicht hier bleiben und in den Himmel starren!«, sagte Lotte.
»Warum nicht, Mama?«
»Der weise Widder ist gekommen, um zu der ganzen Herde zu sprechen. Da musst auch du dabei sein!«
»Der weise Widder? Was ist ein weiser Widder?«, fragte Seba neugierig.
»Das ist ein sehr, sehr, sehr altes Schaf, über 100 Jahre alt, älter als alle Schafe in der Herde zusammen. Er lebt ganz allein in dem großen, dunklen Wald neben unserer Weide. Und weil der Widder schon so uralt ist, weiß er auch mehr als alle Schafe in der Herde zusammen!«
Seba war plötzlich richtig aufgeregt und trabte gespannt neben seiner Mutter über den Hügel in die weite Ebene zu der Herde. Es dämmerte bereits. Die untergehende Sonne brachte den Himmel zum Glühen. In einem großen Kreis hatte sich die Herde vor dem weisen Widder formiert, dessen schwarzer Umriss mit den gedrehten Hörnern imponierend vor dem runden Feuerball stand.
»Versammelte Widder, Schafe und Lämmer«, sagte er mit langgezogener Stimme, »ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen, die das bisherige Leben von euch allen auf den Kopf stellen wird. Der böse Wolf ist tot! Ich habe sein Fell im großen, dunklen Wald gefunden!«
Ein jubelndes Geblöke brach los und rollte wie eine tosende Welle über den weisen Widder hinweg.
»Halt, stopp, liebe Freunde!«, brachte er die Herde zum Schweigen. »Es gibt keinen Grund, ausgelassen zu sein!«
»Wieso denn nicht?«, riefen einige junge Widder. »Der Wolf ist doch tot! Wovor sollen wir noch Angst haben?«
»Richtig!«, blökte die Gruppe Mutterschafe zustimmend. »Warum sollen wir Angst haben?«
»Weil der böse Wolf ein sehr, sehr alter Wolf war!«, antwortete der weise Widder mit eindringlicher Stimme. »Die alten Wölfe leben meistens einsam und allein, weit, weit entfernt vom nächsten Rudel. Sie haben das eigene Revier mit ihrer Duftmarke markiert. Kein Wolf aus einem Rudel würde sich auch nur in seine Nähe trauen. Doch jetzt gibt es unseren Wolf nicht mehr, also gibt es auch sein Revier nicht mehr, in das sich kein anderer Wolf hineintraut!«
»Blääh, Blöök, Blääblöök!«, tönte es wild durcheinander aus der Herde. Dann wurde es mucksmäuschenstill. Die meisten Schafe standen unbeweglich, mit weit aufgerissenen Augen und zitterten am ganzen Leib.
»Hast du schon einen dieser Wölfe gesehen, die in so einem Rudel leben?«, fragte ein Schaf vorsichtig.
»Nein«, antwortete der Widder laut, »aber das sagt noch gar nichts. Ihr müsst ab heute immer auf der Hut sein. Die Gefahr lauert überall und das zu jeder Zeit, egal ob am Tag oder in der Nacht.«
In dieser Nacht schlief das kleinste Schaf der Welt das erste Mal in seinem Leben sehr unruhig. Es träumte von der großen Versammlung am Abend. Es sah den mächtigen Kopf des weisen Widders direkt vor seinen Augen, sah seine gedrehten Hörner, deren spitze Enden ihm bis zur Nase reichten, sah seine riesige Schnauze mit den gelben Zähnen, die unentwegt Worte absonderte, die allen in der Herde Angst einjagten. Seba konnte zwar nicht so richtig verstehen, was der weise Widder ihnen alles gesagt hatte, doch er war trotzdem überaus beeindruckt. Er wünschte sich, dass die Herde auch einmal so ehrfurchtsvoll zu ihm aufblicken würde. Und wenn das nicht, dann sollten alle zumindest einmal von Seba, dem schrecklichsten Schaf der Welt, so richtig in Angst und Schrecken versetzt werden.
Als das kleinste Schaf der Welt am nächsten Morgen aufwachte, hatte es für sich beschlossen, ab heute nicht mehr das kleinste Schaf der Welt zu sein. Nachdem es zum Frühstück mit Mutter Lotte ausgiebig gegrast hatte, schlenderte es entschlossen zu den anderen Lämmern hinüber.
»Hey, guckt mal«, sagte das älteste der Lämmer, »da kommt unser zerbrechliches Stöckelbeinchen!«
»Passt bloß auf, dass ihr unserem empfindlichen Wesen nicht aus Versehen gegen die Wolle stoßt!«, stichelte das nächste Lamm.
»Genau, sonst fällt das kleine Knäuel noch auf seine zierliche Schafsschnute!«
»Na, ihr aufgeblasenen Blökwolle!«, entgegnete Seba spöttisch. Er hatte sich seine Worte genau überlegt. Sie verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Jungschafe waren sprachlos und guckten ziemlich belämmert.
»Wo ist denn mit einmal euer stupides Geplärre geblieben?«
»Du hältst dich wohl für besonders stark«, tönte das Älteste und rannte Seba mit voller Wucht in die Flanke. Das kleinste Schaf der Welt stürzte zur Seite, rollte, indem es sich mehrmals überschlug, einen Hügel hinab und blieb auf dem Rücken liegen. Von oben hörte es das wilde Geblöke der Lämmer, von denen einige ausgelassen in die Luft sprangen.
»Na wartet, das werdet ihr noch bereuen!«, rief Seba zu ihnen hinauf. Vom Hügel tönte ein wieherndes »Bläähäähäähää« zurück. Das kleinste Schaf der Welt wartete so lange, bis die Horde Lämmer nicht mehr zu sehen war. Dann schlich es über den nächsten Hügel und den nächsten und nächsten. Jetzt konnte es schon die großen, schwarzen Bäume in der Ferne liegen sehen. Seba trottete zügig weiter, bis er den Waldesrand erreicht hatte und blickte sich noch einmal trotzig um. Weit und breit war niemand von der Herde zu sehen. Er atmete einmal tief durch, nahm seinen ganzen Mut zusammen und trat in den Wald hinein. Noch am Morgen, gleich nach dem Aufwachen, war dieses Unternehmen dem kleinsten Schaf der Welt ganz einfach erschienen. Doch der Wald war in Wirklichkeit viel größer und viel, viel dunkler, als es sich dies vorher in seinem kühnen Traum ausgemalt hatte. Die dicken Stämme waren mit grünem Moos bewachsen und schauten unheilvoll auf Seba herab. Er hätte am liebsten laut nach seiner Mama gemäht, aber er wusste genau, dass ihn hier niemand mehr hören würde. So guckte er ängstlich auf den Boden und setzte tapfer einen Schritt vor den anderen. Ein Rabe krächzte monoton im Wipfel einer Buche. Plötzlich wurde es taghell. Seba erschrak, zog seinen Hals zwischen die Schultern und hob vorsichtig den Kopf. Vor seinen Augen lag eine weite, von der Sonne beschienene Lichtung. Seine düsteren Gedanken verschwanden, und er fasste wieder neuen Mut und schaute sich ein wenig in der Gegend um. Ein leises Brummen zog seine Aufmerksamkeit an. Es war ein Schwarm Fliegen, der in einer dunklen Wolke über einem umgestürzten Baumstamm stand. Neugierig trat es näher heran. Hinter dem Baumstamm lag ein ausgedörrter Kadaver.
Der alte Wolf, durchschoss es Seba, und er stapfte entschlossen darauf zu. Da lag das gefürchtete Ungeheuer, alle viere von sich gestreckt und konnte keiner Fliege mehr etwas zuleide tun. Dafür hatten die Fliegen ganze Arbeit geleistet und nur noch das Fell übergelassen. Das kleinste Schaf schnupperte vorsichtig an den zotteligen, dunkelbraunen Haaren. Mit der Schnauze schob es sich Stück für Stück unter den Wolfspelz, bis von seinem Körper nichts mehr zu sehen war.
Ich werd ihm schon Beine machen, dachte das Schaf und indem es sich aufrichtete, erweckte es den bösen Wolf zu neuem Leben. Als es so als Ungeheuer durch den Wald schritt, fühlte Seba eine ungeahnte Kraft in sich aufsteigen. Er war nicht mehr das harmlose Schaf, er war der böse Wolf persönlich, vor dem die Schafe erzitterten, wenn sie ihn nur in der Ferne sahen. Der einzige Nachteil dieser Angst einflößenden Hülle war, dass Seba durch die beiden Augenlöcher im Fell nicht besonders gut sehen konnte. Doch er achtete sowieso nicht mehr auf den Weg. In seinen Gedanken war er bei den anderen Lämmern, denen er den Schreck ihres Lebens bereiten wollte. Als das kleinste Schaf der Welt den großen, dunklen Wald wieder verließ, merkte es nicht, dass der grüne Hügel, der vor ihm lag, gar nicht der altbekannte Hügel war. Es war nämlich von Süden her in den Wald gegangen und hatte ihn nun im Norden wieder verlassen. Als Seba den Hügel erklommen hatte, war von der Herde nichts zu sehen. Ein kleines Stück weiter links lag noch ein Hügel.
Das muss unser Hügel sein, dachte er und stapfte entschlossen weiter. Doch auf der nächsten Höhe war auch wieder nichts von der Herde zu sehen. Seba stoppte verwirrt und schaute sich um. Das kleinste Schaf der Welt hatte gänzlich die Orientierung verloren. Alles sah mit einem Mal völlig gleich aus. Da vorn sah es den nächsten Hügel und dahinter noch einen. Als es noch darüber nachdachte, ob es einfach zurückgehen sollte, tauchte endlich ein fremdes Schaf auf dem nächsten Hügel auf. Seba kannte es zwar nicht, hatte es vorher auch noch nie gesehen, aber er stürmte erleichtert auf das andere Schaf zu, um es nach dem Weg zu fragen. Das Wolfsfell hatte er ganz vergessen.
Kurze Zeit später standen sich beide Tiere Aug in Aug gegenüber. Plötzlich lief es Seba eiskalt die Rückenwolle hinunter.
Ich bin doch ein Wolf, fiel es ihm fröstelnd ein. Wieso hat dieses Schaf nicht den kleinsten Versuch gemacht, dem Wolf zu entkommen?
»Hey, Schaf! Hast du denn überhaupt keine Angst vor mir?«, fragte Seba.
»Nein, ich bin das mutigste Schaf der Welt!«, antwortete das andere Schaf mit dunkler Stimme.
»Aber ein Wolf ist der Erzfeind aller Schafe! Er hat große, scharfe Zähne, mit denen er jedes Schaf mit einem Biss töten kann!«
»Du bist aber ein merkwürdiger Wolf!«
»Bin ich nicht! Ich bin ein sehr, sehr gefährlicher Wolf!«
»Bist du nicht! Weshalb stehst du denn die ganze Zeit da und beißt mich nicht!«
Mit dieser Frage hatte Seba nicht gerechnet. So lange das kleinste Schaf der Welt auch nachgrübelte, es fiel ihm keine überzeugende Antwort ein, nur die Frage: »Wie bist du denn zum mutigsten Schaf der Welt geworden?«
»Ganz einfach, weil in mir eine alte Wolfsseele steckt!«, sagte das Schaf bedrohlich und zog sich mit einem Ruck das Schafsfell über die Ohren. »Ich bin nämlich der berühmte Wolf im Schafspelz!«
Seba erstarrte vor Schreck und zitterte dabei am ganzen Körper wie Espenlaub. Dabei rutschte dem kleinsten Schaf der Welt nach und nach das Wolfsfell herunter, bis es in seiner nackten Schafsexistenz dastand. Der Wolf machte einen mächtigen Satz, packte Seba gnadenlos am Nacken und biss zu. Danach warf er einen flüchtigen Blick auf das Wolfsfell und lächelte.
Das ist doch das Fell vom alten Wolf, dachte er, während er genüsslich das kleinste Schaf der Welt verspeiste. Wenn der Alte endlich tot ist, dann wird aus seinem Revier jetzt mein Revier.
Und die Moral von der Geschicht? Rache ist süß, doch bitter sind die Folgen.
1
Das Mondlicht fällt durch die Baumkrone der Buche auf seine rechte Handfläche. Die Haut schimmert wie bleiches Pergament. Mörderhand, spricht eine befremdliche Stimme in seinem Kopf. Er bewegt seine Finger, biegt sie leicht nach vorn. Es ist eine Kralle.
Mörderhand.
Er streift ein Paar hellbraune Wildlederhandschuhe über beide Hände. Die Stimme im Kopf bleibt. Sie klingt sphärisch, als käme sie von weit entfernt aus dem Jenseits und würde mahnend seine präzisen Handgriffe kommentieren.
Mörderhand, Mörderhand.
Doch sein Entschluss ist gefallen.
Gestern war er bereits schon einmal hier gewesen, hatte sich über zwei Stunden im Park herumgetrieben. Er brachte aber nicht den Mut auf, die geplante Tat wirklich auszuführen. Irgendetwas war ihm nicht geheuer vorgekommen. Auch in der Stadt herrschte den ganzen Tag über eine ungewohnte Aktivität, für einen Sonntag waren viel zu viele Menschen auf den Beinen. Später konnte er sich die rätselhafte Tatsache erklären, in den Nachrichten wurde über die stattgefundene Bundestagswahl berichtet. Die hatte er in seiner Organisation vollkommen vergessen gehabt.
Seine rechte Hand greift in die Jackentasche. Die Fingerkuppen tasten nach der Waffe, spüren durch das dünne Leder den geriffelten Bakelitgriff. Die Finger legen sich darum und ziehen die Waffe heraus. Sie fühlt sich hart und schwer an.
Mörderhand!
Ein intensiver Blick kontrolliert, ob das Magazin fest eingerastet ist. Im hellen Mondlicht kann er die feine, eingravierte Schrift auf dem hinteren Pistolenlauf lesen.
›CZ 75, CAL 9, Brünner.‹
Daumen und Zeigefinger pressen sich fest gegen den Schlitten und ziehen ihn nach hinten. Der Riegelkamm am Ende des Laufs wird aus den Nuten des Schlittens gedreht. Lauf und Patronenlager sind nun vom Schlitten getrennt. Der Mann zieht ihn bis zum Anschlag und lässt ihn wieder los. Auf seiner Stirn sickert Schweiß durch die Poren. Kleine Perlen bilden sich.
Mörderhand!
Die gespannte Verschlussfeder drückt den Schlitten zurück. Die Unterkante greift in die Rille am Boden der Patronenhülse und streift sie über die Rampe ins Patronenlager. Der Schlitten verriegelt sich mit Lauf und Patronenlager. Gleichzeitig wird der Schlagbolzen gespannt. Die Waffe ist scharf.
Die Stimme im Kopf verstummt. Er drückt seinen Körper an die Rinde der Buche, richtet den Lauf der Waffe auf den Boden und schaut auf die Armbanduhr. Es ist genau 23.13 Uhr.
Im Husumer Schlosspark ist kein Mensch zu sehen. Vor zwei Tagen war Vollmond, und das diffuse Licht wirkt gespenstisch. Scherenschnittartig stehen die alten Bäume um ihn herum, recken ihre bizarr gewachsenen Äste zum Himmel hinauf. Ein entferntes Lachen lässt seinen Kopf herumfahren. Rechts von ihm, Richtung Erichsenweg, biegen drei Gestalten auf den breiten Sandweg und schlendern direkt auf ihn zu. Einen Moment später kann er erkennen, dass es Frauen sind. In seiner Brust beginnt sein Herz zu hämmern, als würde es zerspringen. Er möchte schlucken, doch sein Hals ist zu trocken. Das Blut sackt aus dem Kopf. Sein Körper funktioniert wie von selbst.
Die Finger der linken Hand tasten nach der Wollmütze, die in der Innentasche seiner Jacke steckt, und ziehen sie heraus. Mittel-, Ring- und kleiner Finger der rechten Hand halten die Pistole, während Daumen und Zeigefinger der linken Hand helfen, die Mütze über den Kopf zu ziehen. Für die Augen hat er zwei kleine Löcher mit der Schere hineingeschnitten. Die Frauen auf dem Sandweg haben ihn fast in seinem Versteck erreicht, er kann ihr Gespräch beinahe verstehen. Vorsichtig späht er hinter dem Baumstamm hervor. Die Gesichter der drei sind deutlich zu erkennen.
Ein tiefer Atemzug.
Volle Anspannung.
Ein Ruck fährt durch seinen Körper. Nach sieben Schritten steht er mit gestreckten Armen, die Pistole in den Händen, mitten auf dem Sandweg. Die Frauen bleiben wie angewurzelt stehen, das Entsetzen spiegelt sich in ihren Augen wider. Für mehrere Sekunden herrscht Totenstille, bis die Ältere mit der Brille einen spitzen Schrei ausstößt und die junge Frau rechts von ihr ein schrilles »Nein!« schreit.
Die Fingerkuppe seines Zeigefingers presst auf den leicht gebogenen Abzug der Waffe, zieht ihn nach hinten. Der abgerundete Metallsteg drückt einen roten Striemen in die Haut.
Im Bruchteil einer Sekunde läuft der tödliche Mechanismus ab. Der Schlagbolzen schnellt nach vorn. Seine runde Metallspitze trifft auf das Zündhütchen, das in einer Vertiefung in der Mitte des Patronenbodens sitzt. Der Aufschlag verformt das Weißblech und reibt dabei die Kristalle der Zündmasse aneinander. Eine Stichflamme zündet die Pulverkörnchen in der Patronenhülse. Rasend schnell und rauchlos frisst sich eine gelbliche Flamme durch die Nitrozellulose. Ein Gasdruck von mehreren tausend Bar drückt die Kupfer-Zink-Legierung der Patronenhülse auseinander, presst sie an die Wand des Patronenlagers und verschließt die Waffe nach hinten gasdicht. Im Inneren der Hülse werden es über 2000º Celsius heiß. Das mit Messing überzogene Bleigeschoss wird abgesprengt und vorwärts in den Lauf getrieben. Im Schusskanal wird das Projektil über eine feine, spiralenförmige Rille, die in das Metall gefräst ist, in eine Rechtsdrall-Rotation um die eigene Achse gezwungen, schnellt mit 1600 Stundenkilometern aus der Pistolenmündung und dreht sich im Flug weiter durch die Luft in Richtung Ziel.
Als der Mann den trockenen Knall hört und seine Hände von der Waffe hochgerissen wird, blickt ihn die junge Frau aus weit aufgerissenen Augen an. Sie steht keine fünf Meter vor ihm, das schmale Gesicht ist aschfahl und ihre vollen Lippen sind halb geöffnet, als wenn ihr das zweite »Nein!« im Hals stecken geblieben ist. Er sieht, wie sie in sich zusammenknickt und langsam zu Boden sackt.
*
Das blanke Entsetzen springt Petra Ørsted an und rast den Rücken hinauf. Im Kopf läutet eine Alarmglocke Sturm, panische Angst erfasst ihren Körper, Angst vor physischer Vernichtung.
Eine Gestalt steht plötzlich auf dem Fußweg, aus dem Nichts kommend wie ein scharfer Luftzug. Der Vermummte hält eine Waffe in der Hand und richtet diese stumm auf sie. Im gleichen Moment hört Petra zwei Schüsse und sieht, wie die Patronenhülsen seitlich aus der Waffe geschleudert werden.
Der Ablauf hat sich schlagartig verlangsamt. Ungläubig versucht sie das zu erfassen, was in Zeitlupe vor ihren Augen abläuft. Drei Schritte entfernt liegt die junge Ronja Ahrendt auf dem Bauch ausgestreckt am Rand des Fußwegs. Direkt neben ihr stürzt ihre Freundin Hanna Lechner auf die Knie, kippt nach vorn und schlägt mit dem Gesicht hart auf den Erdboden. Die Brille springt von der Nase und hüpft in mehreren Sätzen nach vorn. Der Kopf bleibt auf der rechten Wange liegen. Augen und Mund stehen offen, die rotbraunen Haare mit den grauen Spitzen schimmern irreal im Mondlicht. Aus einem kleinen Loch auf der linken Rückenpartie ihrer Leinenjacke sickert Blut.
Mit einer geisterhaften Drehung wendet sich die schwarze Gestalt ihrer Person zu, zielt mit seiner Waffe direkt auf ihren Oberkörper. Wie elektrisiert blickt sie in das kleine Loch im Pistolenlauf. Das starrt eiskalt zurück, ein unbarmherziges Auge des Todes, das ihr ohne Mühe die Kehle zusammenschnürt. Es gibt kein Entrinnen mehr. Sie merkt, dass ihre Knie weich werden, die Lippen vibrieren. Ihr Atem wird flach, beginnt zu rasen. Sie friert. Gänsehaut zieht sich über ihre Arme und Beine. Im Kopf ist es taub. Ihre innere Stimme scheint für immer zu verstummen.
Es gibt keinen Grund mehr zur Flucht, sie fügt sich bereitwillig in ihr Schicksal. Gleichzeitig wird sie von der Erkenntnis durchströmt, dass die Seele ihren gesamten Körper ausfüllt und alle ihre gelebten Widersprüche aufhebt. Das ist das wahre Sein, ein Sein, das selbst zum Bewusstsein wird. Ihr letzter Atemzug ist der Mittelpunkt der Welt.
Für die Zeitspanne dieses Augenblicks rasen Impulse von ihrer Haut, aus ihren Blutgefäßen, Eingeweiden, Muskeln und Gelenken durch das Rückenmark zum Hirnstamm und von dort durch den Thalamus, Hypothalamus in die Hirnrinde der Scheitel- und Schläfengegend. Hier, in den Schaltkreisen des visuellen Cortex, läuft innerhalb einer Hundertstel Millisekunde der eigene Lebensfilm vor ihrem geistigen Auge ab.
Sie schwebt in einem zeitlosen Universum, in dem Planeten und Sonnen sie umkreisen. Dann schrumpft der weite Raum um sie herum unmerklich zusammen, und weiche, elastische Höhlenwände pressen sich fest an ihren Körper. Ihr Kopf wird in eine enge Öffnung gedrückt, Atemnot, Erstickungsgefühl, Todesangst. Sie kämpft mit aller Kraft, arbeitet sich langsam voran. Am Ende des Tunnels blendet ein grelles Licht.
Die Bilder wirken erschreckend real, rasen an ihrem inneren Auge vorbei und werden von gespürten Gefühlen begleitet.
Über ihrem Gitterbettchen äugen verzerrte Grimassen, unbekannte Riesen mit überdimensionalen Händen greifen nach ihrem Gesicht. Sie tritt in die Pedale eines Dreirads, fährt im Kreis, ihre Eltern stehen in der Haustür und winken. Kreidezahlen füllen eine Schiefertafel, und sie saugt an ihrem Finger, schaut ängstlich zum Lehrer hinauf. Sie steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen, und ein junger Mann gibt ihr Feuer. Die Eingangstreppe des Unigebäudes. Der Hörsaal. Ein See im Sonnenuntergang. Liebevolle Blicke. Ein Kuss. Das weiße Hochzeitskleid. Ein Schlag ins Gesicht. Verheulte Augen im Spiegel. Ein Telefon klingelt. Der Schreibtisch im Büro. Laute Worte. Streit. Menschen in einer Schlange. Die angeleuchtete Bühne in einem Saal. Holzpuppen an Fäden. Eindringliche Stimmen: In Bulemanns Haus, in Bulemanns Haus, da gucken die Mäuse zum Fenster hinaus.
Das glühendheiße Projektil brennt unterhalb der linken Brust ein kleines Loch in den Blazer ihres Hosenanzugs, reißt einige goldfarbene Leinenfäden mit sich in den Wundkanal, durchschlägt die Kammerscheidewand und dringt in die rechte Herzkammer ein. Der AV-Knoten wird zerfetzt, das Herz hört augenblicklich auf zu schlagen. Das Geschoss tritt aus der Rückseite des linken Vorhofs aus, durchtrennt das Rückenmark der Wirbelsäule und bleibt deformiert im Knochen stecken. Der Körper ist sofort gelähmt, schlägt mit ungebremster Wucht auf den Boden auf.
Die Schallwelle der Waffe erreicht ihre Sinne nicht mehr. Sie hat das Gefühl, außerhalb ihres eigenen Körpers zu sein und wie eine Feder im Wind langsam nach oben getragen zu werden. Sie ist bereits eineinhalb Meter über dem Boden.
Was willst du hier oben, denkt sie erschreckt und blickt auf ihren vertrauten Körper, der unter ihr am Boden liegt. Sie will es nicht glauben, hat noch immer den Eindruck, weiterhin ihre Körpergestalt zu besitzen.
Mein Gott, so muss es sein, wenn man tot ist! Bin ich etwa schon tot?
Sie spürt den unbändigen Drang, endlich wieder in diesen Körper zurückzukehren. Gleichzeitig beobachtet sie aus sicherer Distanz die makabere Szene, die sich dort unten abspielt, sieht, wie die schwarze Gestalt verloren zwischen den drei ausgestreckten Körpern hin und her tritt. Haltet ihn! Das ist ein Mörder! Er scheint nach etwas zu suchen, kniet mehrmals nieder, um etwas aufzuheben. Jetzt zertritt er Hannas Brille. Das Glas zersplittert. Wenig später rennt er Hals über Kopf davon, verschwindet blitzschnell zwischen den dichten Büschen, die den Sandweg säumen.
Von hier oben wirken seine Bemühungen völlig sinnlos und aberwitzig. Sie muss unwillkürlich lächeln, eine unbeschreibliche Leichtigkeit erfüllt ihren Geist, Frieden. Große Gelassenheit breitet sich in ihr aus. Leere berührt sie sanft. Ihr ist, als würde sie durch einen altbekannten Tunnel gehen, dessen glatte Wände durch einen einfallenden Schein in der Ferne smaragdgrün schimmern. Sie schreitet voran. Ein goldenes Licht kommt näher, strahlt mit überirdischer Helligkeit. Sie kommt an eine unsichtbare Grenze, eine Scheidelinie zwischen ihrem irdischen Leben und dem Leben danach. Ohne die geringste Furcht tritt sie hinüber.
*
19. September 2002, 8.42 Uhr. Es sind keine fünf Tage mehr bis zu den Morden. Petra Ørsted dreht den Zündschlüssel mit voller Kraft nach rechts. Ihre Nasenflügel beben leicht, und eine unbändige Wut treibt ihr die Röte ins ovale Gesicht. Die zerbrechlich wirkende Frau tritt das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Der Motor heult laut auf.
Was ist da wieder passiert, denkt sie mit knirschenden Zähnen und lässt die Szene, die sich vor wenigen Minuten in der Küche abgespielt hat, vor ihrem inneren Auge Revue passieren.
Die beiden Kinder waren gerade aus dem Haus gewesen, als sie bemerkte, dass sie das Klappen der Badezimmertür im ersten Stock noch immer nicht gehört hatte. Sie legte das gezackte Messer auf die Anrichte, schichtete die abgeschnittenen Brotscheiben in den Bastkorb auf dem Küchentisch und stieg aufgebracht die Treppe zum Schlafzimmer hinauf. Oben fand sie ihren Mann Sören schlafend vor, auf dem Bauch quer über die Matratze ausgestreckt. Der Wecker lag am Boden. Er hatte ihn anscheinend vom Nachttisch gefegt. Sie trat ans Bett, fasste seine Schulter und schüttelte sie vorsichtig.
»Du musst aufstehen, Liebling! Es ist schon 8 Uhr vorbei!«
Er knurrte unwillig, bevor er die Augen öffnete. Sein erster Blick hatte etwas Vernichtendes. Ohne etwas zu sagen, war er im Badezimmer verschwunden. Zehn Minuten später kam er mit finsterer Miene die Treppe herab, setzte sich übertrieben langsam an den Tisch und schlug theatralisch das Frühstücksei auf die Tischplatte.
»Ich kann deine vorwurfsvollen Blicke nicht mehr ertragen«, sagte er mit ruhiger Stimme, ohne dabei aufzublicken. »Was ist schon großartig dabei, wenn man im Tiefschlaf aus Versehen gegen den Wecker stößt und der herunterfällt!«
»Ich hab’ überhaupt nicht vorwurfsvoll geguckt. Wieso behauptest du so was?«
»Ich denke, ich bin noch ganz gut in der Lage zu beurteilen, was vorwurfsvolle Blicke sind!«
»Du hast mich doch noch nicht mal richtig angeguckt, seitdem du runtergekommen bist!«
»Meinst du etwa, das wäre jetzt der richtige Moment, um einen Grundsatzstreit vom Zaun zu brechen?«
»Sag mir doch einfach nur, was du an mir auszusetzen hast!«
»Das ist ja mal wieder typisch! Für dich bin ich gleich wieder an dieser Situation schuld!«
»Stimmt doch gar nicht! Wann habe ich gesagt, dass du an irgendwas Schuld hast?«
»Du hast schließlich gerade eben von mir verlangt, dass ich einfach sage, was mir an dir nicht passt!«
»Natürlich sollten wir darüber reden, was zwischen uns nicht klappt. Noch sind wir schließlich ein Paar!«
»Das Wort Paar stammt so was von aus der Mottenkiste!«
»Was willst du von mir? Was soll ich machen?«
»Gar nichts! Es gibt nicht für alles und jedes eine Lösung! Du willst nur immer alles in meinem Leben kontrollieren!«
Sie steuert den schwarzen Volvo S 40 rasant aus der Einfahrt, tritt aufs Gas und biegt an der nächsten Kreuzung mit quietschenden Reifen nach links auf die Hauptstraße. Mit über 80 Stundenkilometern prescht sie an dem kleinen Ort Padelackhallig vorbei und weiter nach Finkhaus. Wenige Meter hinter dem Ortseingang prophezeit ihr ein greller Blitz, dass demnächst wieder ein Strafmandat ins Haus flattern wird. Sie drosselt sofort die Geschwindigkeit, würde am liebsten lauthals ihren geballten Ärger diesem schon verkorksten Tag entgegenbrüllen.
So geht diese elende Scheiße zu Hause nicht mehr weiter, denkt sie und kaut nervös auf ihrer vorgestülpten Unterlippe. Ich kann nicht ständig die Kinder vorschieben, um an dieser bescheuerten Ehe festzuhalten. Er schert sich seit Jahren einen feuchten Kehricht um die Kids. Es ist ihm sogar völlig schnuppe, wie die mit unseren dauernden Streitereien zurechtkommen.
Petra Ørsted steuert den Volvo auf die nächste Tankstelle. Der Liter Diesel kostet 88 Cent, was sie noch tiefer in ihren Ärger treibt.
»Das sind ja über 1,70 in DM!«, flucht sie leise vor sich hin. »Diese beknackte Euroumstellung!«
An der Kasse ist natürlich jemand ein Bruchteil schneller. Er fummelt umständlich seine EC-Karte aus der Brieftasche. Der Mann hinter dem Tresen zieht sie ohne Eile durch den Schlitz, druckt den Kassenzettel aus und lässt ihn unterschreiben. Petra Ørsted kaut nervös auf den Lippen. Als sie die Tankstelle verlassen will, passiert gerade ein Getreidelaster die Ausfahrt und schleppt eine Schlange von Pkws hinter sich her. Sie wettert leise vor sich hin, trommelt ungeduldig aufs Lenkrad und kann sich erst am Ende einreihen, von wo aus es nur im Schritttempo vorangeht.
Petra Ørsted hat noch 110 Stunden zu leben.
Nach drei riskanten Überholmanövern klebt sie am Heck des Anhängers. Zwei Minuten später kriecht sie hinter dem Laster durch den Innendeich des Südermarschkoogs. Die Silhouette von Husum kommt ins Blickfeld. Rechts liegt der Windpark, die großen Rotoren ziehen stoisch imaginäre Kreise in die Luft. Gleich dahinter liegt die Kläranlage. Jetzt biegt der Laster links ab in Richtung Außenhafen. Umrahmt von mehreren schmutziggrauen Betonklötzen, ragt die weiße Getreidesiloanlage der Raiffeisengenossenschaft aus der flachen Landschaft.
Sie soll 1936 erbaut worden sein. Während der Nazi-Zeit hieß das Gebäude nur das Reichsnährstand-Silo, hatte ihr der Geschäftsführer der Getreidehandelsfirma Asmussen einmal erzählt. Die Firma Asmussen gehört mit zu ihren besten Kunden.
Den Rest der Strecke legt sie fast im Tran zurück, unter der Eisenbahnbrücke hindurch, rechts Poggenburgstraße, links Herzog-Adolf-Straße. Schräg gegenüber vom Finanzamt hält sie in der Einfahrt einer Backsteinvilla. Im Erdgeschoss befindet sich ihr Steuerberatungsbüro. Als sie über den Flur auf ihr Zimmer zusteuert, sitzen ihre beiden Mitarbeiterinnen bereits hinter den Computern und wälzen sich durch Aktenordnerberge. Kaum sitzt sie hinter dem Schreibtisch, klingelt schon das Telefon.
»Steuerbüro Ørsted, moin, moin!«
»Hallo Petra! Hanna hier, du musst heute Abend unbedingt in den neuen Laden kommen, in dem das Museum eingerichtet werden soll! Ich starte gerade einen Rundruf. Es gibt noch einiges zu organisieren, bevor es morgen Abend wieder losgeht. Uns wächst die Arbeit jetzt schon über den Kopf.«
Die unterschwellig fordernde Stimme ihrer Freundin bringt Petra Ørsted endgültig aus der Fassung. Ihr schießen Tränen in die Augen, und sie schluchzt.
»Hallo Petra? Bist du noch da?«
»Natürlich bin ich noch da«, antwortet sie wieder gefasst. »Mir geht’s im Moment einfach nicht so gut, Hanna, rasende Kopfschmerzen.«
»Das tut mir leid, aber kannst du nicht einfach zwei Aspirin nehmen? Du musst unbedingt kommen. Dr. Kevele aus der Kulturabteilung der Kieler Staatskanzlei hat sich zur Eröffnung des Festivals angesagt.«
»Könnt ihr nicht diesen Abend ohne mich auskommen?«
»Petra, du kannst mich nicht hängen lassen!«
»Ich finde, du setzt mich ganz schön unter Druck, Hanna! Aber gut, dir zuliebe versuche ich es einzurichten.«
»Wir sind doch langjährige Freundinnen, natürlich können wir offen miteinander reden! Und wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich auch mit meiner Kritik nicht hinterm Berg halten. Versteh das bitte nicht falsch, aber du hast dich im Vorfeld der diesjährigen Organisation auch nicht besonders fair verhalten, meine Liebe!«
»Was soll das denn nun heißen?«
»Ich sage nur, das Schnipp-Schnappmaul-Puppentheater!«
»Also, Hanna, jetzt nicht das schon wieder. Ich weiß bis heute nicht, was du gegen dieses hervorragende Puppentheater einzuwenden hast. Wiktor Šemik gehört zu den international renommiertesten Puppenspielern.«
»Eben, und deshalb verlangt er auch einen renommierten Preis für seine werte Anwesenheit. Dafür könnten wir drei andere Puppentheater auf unser Festival einladen.«
»Gut, Hanna, ich will mich nicht mit dir streiten. Ich schmeiß mir ’ne Aspirin rein und komm nach Feierabend, obwohl ich mir immerhin schon die gesamte nächste Woche für das Festival freigehalten hab.«
*
»Was meint ihr wohl, warum die Griechen schon vor 2500 Jahren das Wollen in den Mittelpunkt ihrer Ethik gestellt haben?«, fragt Hanna Lechner, während sie langsam vor ihrer Klasse auf und ab geht. Die letzte Viertelstunde ist immer die schwierigste. Kaum einer der Schüler sucht noch Blickkontakt mit der Lehrerin. Die meisten der Jungen hängen bereits in Hab-Acht-Stellung auf ihren Stühlen, und die Mädchen schieben sich gegenseitig kleine Zettel zu.
»Normalerweise wird bei moralischen Fragen, und eure Lehrerin macht da keine Ausnahme, meistens vom Sollen gesprochen und nicht vom Wollen. Du sollst nicht stehlen! Keiner würde sagen, du wirst es doch nicht wollen, dass du zum Dieb wirst, oder? Hallo, hört hier noch jemand zu? Ihr sollt dem Unterricht aufmerksam folgen, bis die Stunde vorbei ist.«
Niemand scheint ihren gezielten Scherz zur Kenntnis zu nehmen. Hanna Lechner ahnt, dass sie persönlicher werden muss und schreitet seitwärts an den Tischen vorbei.
»Auch wenn du es möglicherweise gar nicht willst, bist du dem Moralbegriff der Griechen im Moment wesentlich näher, als du denkst, wenn du denn denkst! Oder sollte das etwa nicht so sein, Peter?«
Der Angesprochene sitzt plötzlich kerzengerade, hebt den Kopf und schaut mit angestrengtem Blick zur Decke hinauf.
»Du machst zu meinem Bedauern mal wieder nicht das, was du sollst. Unser lieber Peter macht eben nur das, was er will!«
Der Junge grinst die Lehrerin verlegen an, die sich mit ihrer robusten Gestalt vor seinem Tisch aufgebaut hat.
»Wenn du das vor der Klasse schon so eindrucksvoll demonstrierst, kannst du mir bestimmt auch sagen, warum der Satz: Ich tue, was ich will nur eine Redensart ist.«
»Eine Redensart? Keinen blassen Schimmer!«, entgegnet der Schüler trotzig.
»Denk nach, ich bleibe hier stehen, bis ich was Brauchbares höre!«
»Ich tue, was ich will? Eine Redensart? Jeder Normalo macht nur das, was er will!«
»Wenn das wirklich so wäre, würde ich die Frage stellen: Warum will der Mensch denn etwas?«, wirft Hanna Lechner ein und nimmt mit Genugtuung wahr, dass die Aufmerksamkeit in der Klasse wiederhergestellt ist.
»Weil alle nur das tun wollen, wozu sie Lust haben!«, ruft ein Mädchen aus der hinteren Reihe.
»Richtig!«, bestätigt die Lehrerin, »das ist unser übliches Handeln nach dem Lustprinzip. Bloß jedes Lustprinzip ist unweigerlich an das Realitätsprinzip gekoppelt. Stellt euch vor, ein Räuber bedroht jemanden und sagt ihm, er soll sofort sein Portemonnaie rausrücken. Würde derjenige das etwa machen, weil er es soll?«
Hanna Lechner macht eine gezielte Pause und lässt ihren Blick fragend über die Klasse schweifen. Niemand antwortet.
»Nein!«, fährt sie fort. »Sehr wahrscheinlich würde er es nur deshalb machen, weil er sein Leben retten will. Er will also etwas! Und was sagt uns das? Wer nichts will, an den kann keine Forderung gestellt werden, bei dem geht jedes Sollen ins Leere.«
Ein langer Klingelton kündigt das Ende der Ethikstunde an. Schlagartig kehrt Leben in die neunte Klasse zurück. Stühle werden lautstark nach hinten geschoben, alle beginnen gleichzeitig zu reden.
»Hallo! Haalloo! Ruhe bitte!«, schneidet die scharfe Stimme von Hanna Lechner in den Lärmpegel. »Noch beende ich hier die Stunde!«
Es braucht geraume Zeit und wiederholte Appelle, bis wieder eine annehmbare Lautstärke einkehrt.
»Da ihr nun hoffentlich verstanden habt, dass jedes Sollen ein vorheriges Wollen voraussetzt, appelliere ich deshalb an euer Wollen und gebe euch zwei Fragen für die nächste Stunde mit auf den Weg: Was ist das letzte Ziel unseres Strebens? Und was ist das höchste Gut?«
Mit schrillem Gejohle stürzen die Ersten in Richtung Tür. Davor staut sich kurz eine Traube Schüler und Schülerinnen, bis nach heftigem Gedrängel das Klassenzimmer leer ist. Hanna Lechner packt kopfschüttelnd ihre Unterlagen in die Aktentasche und schlendert gedankenverloren auf den Flur hinaus.
Hanna Lechner hat noch 108 Stunden zu leben.
Sie freut sich auf die kommende Woche, hat extra möglichst viele Freistunden in die Zeit gelegt. Ab Morgen werden die Pole-Poppenspäler-Tage sie ziemlich in Beschlag nehmen. Aber das wird kein unangenehmer Stress, das wird Befriedigung pur bedeuten. Für die Lehrerin ist das Festival immer der persönliche Höhepunkt des Jahres. In dieser Zeit bekommt sie von allen Seiten Anerkennung, mehr als in der Schule. Die Poppenspäler-Tage holen Hanna Lechner aus ihrem sonstigen Einsiedlerleben, in dieser Zeit fühlt sie sich gebraucht und lebendig. Immerhin gehört sie zu den Frauen der ersten Stunde, hat Jahr für Jahr ihre gesamte Freizeit dafür geopfert, um bekannte Puppenspieler und Figurentheater hier in die Poppenspälerstadt des Theodor Storm zu holen.
Das liegt jetzt bereits 19 Jahre zurück. Als wenn es erst gestern gewesen wäre, kann sie sich noch genau daran erinnern.
An dem historischen Tag hatte sie mit Frieda Meibaum im Storm-Café zusammengesessen. Es war bereits früh am Abend gewesen, als sie über die Novelle ›Pole Poppenspäler‹ sprachen. Frieda arbeitete zu der Zeit noch als Sekretärin im Storm-Archiv und besaß ein profundes Wissen rund um den Dichter der deutschen Nordseeküste. Sie selbst regte sich im Laufe des Gesprächs darüber auf, wie stiefmütterlich die Stadtväter von Husum ihren großen Dichter in der Vergangenheit behandelt hatten.
»Mir geht es einfach nicht in den Kopf, warum das alte Stormhaus in der Wasserreihe erst vor neun Jahren zum Museum gemacht wurde«, hatte sie ärgerlich gesagt. »Schließlich hat Storm dort in seinem Arbeitszimmer die berühmte Geschichte vom Puppenspieler geschrieben.«
»Bei uns im Norden gehen die Uhren langsamer, Hanna. Das kannst du nicht wissen, du kommst aus dem Süden. Der Menschenschlag hier ist so ’n büschen träge und schwerfällig. Die Stadtoberen haben sogar schon mal in Betracht gezogen, Storms Elternhaus in der Hohlen Gasse abzureißen.«
»Unfassbar! Dabei ist Storm doch ein Zugpferd für den Tourismus in der Stadt. ›Pole Poppenspäler‹ ist zum Beispiel die Lieblingsnovelle aus meiner frühesten Jugend, wahrscheinlich wegen Lisei, der Tochter des Puppenspielers, die darin bayerisch spricht.«
»Ja, Pole Poppenspäler hat auch mich begeistert.«
»Weißt du was? Ich finde, wir sollten was mit Puppenspiel organisieren, einfach ein Wochenende lang, oder vielleicht eine ganze Woche. Das wäre doch was, oder? Möglichst viele Puppenspieler aus ganz Deutschland spielen auf dem Markplatz in Husum Stücke für Schulkinder, so eine Art Kasperle-Festival, oder so was Ähnliches!«
»Nee, Hanna, bloß kein Kasperle-Theater! Das ist was für den Jahrmarkt. Aber deine Idee finde ich gut. Wir sollten aber etwas Außergewöhnliches aus der Taufe heben, etwas Anspruchsvolles, großes Puppentheater eben!«, hatte Frieda sich ereifert und ihren Vorschlag damit untermauert, dass sie der Freundin den Rest des Abends von einem Besuch bei ihrer Schwester in Stuttgart vorschwärmte. Dort hatte sie den berühmten Marionettenspieler Albrecht Roser spielen gesehen.
»Der hat den Clown Gustav kreiert, eine Holzpuppe mit legendärer Beweglichkeit. Wenn du gesehen hättest, wie die Klavier spielt, du hättest geglaubt, sie lebt.«
»Jetzt übertreibst du aber wieder maßlos, Frieda!«
»Nein, ehrlich, Hanna! Die Puppe hat eine Seele!«
»Ich kenne nur das Puppenspiel vom Doktor Faust, das wurde damals in meiner Schule aufgeführt. Darin will der Mephistopheles dem Hanswurst seine Seele abschwätzen. Rat mal, was der Hanswurst darauf gesagt hat?«
»Na?«
»›Leute, der Trottel will meine Seele, obwohl ich nur eine aus Holz geschnitzte Puppe bin! Das zum Thema Seele!‹«
»Das ist doch nur ein dummer Scherz! Ob du es nun glaubst oder nicht, es gibt Puppenspieler, die ihren Puppen eine Seele einhauchen können. Und deswegen wird es mit mir nur ein Puppenspieler-Festival geben, wenn wir Puppenspieler mit dieser Qualität nach Husum holen!«
Hanna Lechner steigt die mit Jugendstilornamenten verzierte Holztreppe zum Lehrerzimmer im zweiten Stock hinauf. Die Zeit, als sie mit Frieda ihre Idee des Festivals in Husum an den Mann bringen wollte, steht ihr noch lebhaft vor Augen.An den Mann bringenwar dabei im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, denn egal, in welche Behörde sie damals kamen und egal, welches Dienstzimmer sie betraten, überall saß einer dieser geschniegelten Beamten. Alle schauten interessiert, wenn sie von ihrem Projekt erzählten, schüttelten am Ende aber mit dem Kopf. Sie marschierten von Pontius zu Pilatus und wieder zurück, sammelten nebenbei die ersten Spenden, suchten nach brauchbaren Räumen zu annehmbaren Konditionen, rekrutierten die ersten ehrenamtlichen Mitstreiterinnen – denn seinerzeit wollte keiner der Männer mit Puppenspiel in einen Topf geworfen werden. 1979 gründeten sie endlich den Förderverein ›Husumer Figurentheater‹.
Eine verrückte Zeit war das, denkt sie stolz. Aber im Nachhinein hat es sich gelohnt, was allein die Anzahl der Besucher beweist, die jedes Jahr aus ganz Norddeutschland nach Husum kommen. Nur die Meinungsverschiedenheit mit Frieda besteht bis heute weiter. Ich möchte möglichst viel Puppenspiel für Kinder und Frieda lieber dieses anspruchsvolle Figurentheater für ein künstlerisch interessiertes Publikum.
»Auf ein Wort, Hanna!«
Die Frauenstimme im Rücken reißt Hanna Lechner abrupt aus ihren Erinnerungen. Sie dreht sich etwas zu überstürzt herum und wäre beinah auf der glatten Stufe gestrauchelt.
»Vorsicht!«, warnt die Stimme, und die Lehrerin spürt eine Hand, die ihren Oberarm stützt. Erst jetzt erkennt sie Helga Anklam, die neue Geschichtslehrerin.
»Das wäre ja beinah schiefgegangen, Helga«, sagt Hanna Lechner und nickt der Kollegin dankend zu. »Du möchtest mich sprechen?«
»Ja, schooon, Hanna! Obwohl mir bei der Sache nicht so ganz wohl ist!«, sagt die etwas beleibte Frau zögerlich, die trotz ihres noch jungen Alters das blonde Haar zu einem biederen Knoten festgesteckt hat.
»Nun lass dieses Rumgeeiere, Helga!«, treibt Hanna Lechner ihre Kollegin an.
»Du kennst doch Peter, Peter Ørsted!«
»Selbstverständlich, der Junge hatte grade bei mir Ethikunterricht!«
»Also, dieser Peter Ørsted war vor zwei Tagen bei mir und machte verschwommene Andeutungen über den Sportlehrer.«
»Florian Werner? Der ist unser Englischlehrer, Sport unterrichtet der nur im Nebenfach!«
»Egal, um den geht es! Also, der Ørstedjunge druckste ziemlich rum bei mir, meinte, er hätte da was beobachtet. Erst als ich ihm zusicherte, ich würde alles vertraulich behandeln, rückte er mit der Sache raus. Im Umkleideraum der Mädchen soll Werner sich einer Schülerin genähert haben.«
»Wahrscheinlich? Was soll das heißen? Und was hat der Junge im Umkleideraum der Mädchen zu suchen?«
»Deswegen wollte er auch erst nichts sagen. Ich nehme an, es handelt sich um das übliche pubertäre Gespanne. Er behauptet natürlich, nur zufällig durch die offene Tür geguckt zu haben!«
»Und was will er nun konkret gesehen haben?«
»Nun, der Kollege soll so etwas wie eine Art sexuelle Annäherung versucht haben!«
»Mein Gott, Helga! Das wäre eine schwere Anschuldigung!«
»Ich gebe nur weiter, was ich gehört habe.«
»Und von welchem Mädchen sprechen wir hier?«
»Die kleine Melanie, Melanie Ott.«
»Hast du schon mit dem Mädchen gesprochen?«
»Nein! Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das auch wirklich alles stimmt. Gleichwohl bin ich nach reichlicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, es nicht für mich zu behalten.«
»Das ist ja auch richtig, erst mal! Aber natürlich bringt mich die Information ganz schön in die Bredouille. Jeder im Kollegium weiß, dass Kollege Werner und ich nicht gerade Busenfreunde sind.«
»Du meinst, weil er hinter deinem Rücken schon ganz offen auf dein Rektorenamt aus ist?«
»Bis zu meiner Rente ist noch reichlich Zeit! Das sind noch ein paar Jährchen hin! Dessen ungeachtet ist es ziemlich interessant, was bereits alles hinter meinem Rücken gekungelt wird!«
*
Mit einem tiefen Seufzer lässt Ronja Ahrendt die Tür von Zimmer 312 ins Schloss fallen und rennt mit ausholenden Schritten über den Flur in Richtung Schwesternzimmer. Die Spätschicht sitzt bereits vollzählig mit der Frühschicht am kleinen Tisch zusammen, als sie hereinstürmt.
»Wäre schön, die Übergabe heute ausnahmsweise etwas zügiger zu machen«, bittet sie ein wenig kurzatmig. »Ich hab gleich einen wichtigen Termin!«
»Wieso das denn?«, stichelt Nicole Hauser mit gedämpfter Stimme, sodass es alle Schwestern in ihrer unmittelbaren Nähe hören können. »Der Oberarzt hat doch heute Bereitschaft!«
Barbara Reimer grinst breit über ihr rundes Gesicht und zwinkert Nicole auffällig zu, während Hellwig Gehrmann lauthals losprustet.
»Hey, Leute, könnt ihr diesen Kinderkram nicht hinten anstellen?«, motzt Ronja scharf in die Runde, wohl wahrnehmend, dass über ihre Person hergezogen wird.
Hellwig verstummt abrupt und grinst nur noch verlegen. Nicole ergreift das Wort, bevor eine peinliche Pause entstehen kann.
»Dann leg ich los! Also, Frau Wagner in der Eins ist mit ihrem Digitalis und dem Diuretikum neu eingestellt, es geht ihr schon viel besser. Sie kriegt wieder besser Luft, die Dyspnoe ist deutlich rückläufig. Dafür hat sie sich bei der Visite darüber mokiert, dass sie so häufig pinkeln muss. Unser lieber Dr. Mehlert, in seiner unnachahmlichen Art, ist mal wieder besonders einfühlsam darauf eingegangen. Er hat ihr gesagt, sie solle sich doch freuen, dass sie überhaupt wieder Luft bekommt, und ist dann weitergegangen.
»Ich finde, das ist wieder ganz schlimm mit ihm in letzter Zeit«, schlägt Barbara in die gleiche Kerbe. »Ich weiß auch nicht, was der immer hat.«
»Ich finde, das passt super zu Dr. Mehlert«, ergänzt Hellwig, »überall schwafelt er rum, wie gern er im Krankenhaus arbeitet, wie sehr er Arzt aus Überzeugung ist, das Einzige, was ihn zu stören scheint, sind die Patienten!«
Ein schrilles Lachen schwappt wie eine La-Ola-Welle einmal um den Tisch herum.
»Vielleicht hat er ja ein Burn-Out, der soll …«
»Können wir bitte weitermachen, mich interessiert der Seelenzustand von unserem Doktor überhaupt nicht«, unterbricht Ronja genervt, »ich möchte heute pünktlich hier raus.«
»Seit wann ist denn unsere Ronja nicht interessiert?«, zischt Barbara Nicole ins Ohr.
»Zumindest gilt das nicht für einen gewissen Dr. Keck!«, stichelt die Schwester zurück, um ihre Stimme gleich wieder auf normale Lautstärke zu heben. »Okay, zurück zu Frau Wagner, die geht jetzt wieder ohne Begleitung zur Toilette. Frau Michalski daneben ist mit ihrem Zucker immer noch völlig durcheinander.«
Ronja Ahrendt schließt die Augen, lässt den Wortbrei in weiter Ferne durch den Kopf brabbeln und versucht, ihre Verspannung zu lösen. Das ewige Getuschel hinter ihrem Rücken bleibt nicht ohne Wirkung.
Du bist aber auch selbst schuld an deiner blöden Misere, denkt sie. Ist doch klar, dass der Scheiß mit dem Oberarzt nicht unbemerkt bleibt. Wie kriegst du das bloß immer wieder hin? Ständig steckst du in irgendeiner aussichtslosen Affäre. Ronja Ahrendt, wach endlich auf!
Vor ihrem inneren Auge läuft der uralte Film ab, diese elende Beziehungsklamotte von der ewig wartenden Geliebten, die ohne zu murren, den Blick hartnäckig auf die schleichenden Zeiger der Uhr gerichtet, ihre ganze Hoffnung auf den kommenden Abend ausrichtet.
Drei Stunden hatte sie gestern mit einem syrischen Rezept in der Küche gestanden, Zwiebeln gewürfelt, Gehacktes mit Haselnüssen vermengt, Zimt und Curry angebraten, mit Tomatensaft abgelöscht, alles mit gekochten Nudeln in eine Auflaufform gegeben und mit Käse überbacken.
Der trockene Ciclos wurde von ihr eigens in eine Glaskaraffe umgefüllt, weil Michael ihr unentwegt in den Ohren liegt, Wein müsse atmen können. Doch wer hatte sie letztendlich mit dem ganzen Kram sitzen gelassen? Michael Keck! Erst zwei Stunden über der Zeit kam sein obligatorischer Anruf. Seine Frau habe unverhofft den Kinoabend mit ihrer Freundin abgesagt, er könne auch nicht länger mit ihr reden und würde sich wieder melden.
»Hey, Ronja, du bist dran! Aufwachen! Erst geht dir alles nicht schnell genug und jetzt verpasst du deinen Einsatz«, bringt Nicoles herablassende Stimme sie in den Raum zurück.
»Schon gut, schon gut! Also, Herr Pauli ist konstant mit seinem Druck, Kontrolle wie immer; bei Herrn Zetlach ist erneut das Antibiotikum gewechselt worden, er hat immer noch Temperatur, und Herr Wulf ist Herr Wulf, da gibt’s wie immer nichts Neues«, spult sie ihren Text herunter und wirft einen vernichtenden Blick zu Nicole hinüber.
»Das war rekordverdächtig, jetzt darf die nächste Schicht getrost übernehmen«, hört Ronja Hellwig flachsen, während sie schon in Richtung Umkleideraum aus der Tür eilt.
20 Minuten später verlässt die Krankenschwester das Husumer Kreiskrankenhaus durch den Hinterausgang. Das Licht der Nachmittagssonne fällt in die mickrige Parkanlage. Patienten sitzen, jeder für sich, verstreut auf den Holzbänken und rauchen. Mittendrin steht eine kleine Bronzeskulptur, die in groben Umrissen das Abbild eines Mannes in Regenzeug und mit Südwester zeigt. Er stemmt sich, nach vorn gebeugt, gegen den Sturm. Als Ronja darauf zugeht, bläst ein kräftiger Windstoß eine leere Einkaufstüte durch die Luft, die am Kopf der Skulptur kleben bleibt.
Kunst und Husumer Wetter, denkt die Krankenschwester grinsend und erinnert sich, dass der Künstler am Sockel ein Schild mit der Aufschrift ›Sturm‹ angebracht hat.
Es braucht nur wenige Schritte über die schmale Straße. Dort nimmt sie einen Schleichweg durch die Büsche und ist schon auf dem Sandweg im Husumer Schlosspark.
Ronja Ahrendt hat noch 105 Stunden zu leben.
Sie fühlt sich völlig aufgekratzt. In zwei Minuten hat sie das Sandsteinportal auf der anderen Seite der Anlage erreicht. Sie passiert das offene Eisentor und erreicht die Kopfsteinstraße, die links hinauf zum Schlosshof führt. Der Bürgersteig ist übersät mit Eicheln. Bei jedem Schritt zerbersten sie knackend unter ihren Schuhsohlen. Die Schlossfront liegt im prallen Sonnenlicht.
Für Ronja Ahrendt ist es eindeutig das schönste Bauwerk in ganz Husum. Soweit sie sich noch auf ihren Heimatkundeunterricht verlassen kann, dürfte das Schloss gerade in diesem Jahr 425 Jahre alt geworden sein.
Bauherr ist meines Wissens Herzog Adolf, ruft sie ihr altes Schulwissen ab. Der erbte mit 18 Jahren die Stammherzogtümer Schleswig und Holstein von Vater König Friedrich dem I. von Dänemark. Erst 33 Jahre später, 1577, errichtete er das ehemalige Renaissancegebäude und nutzte es später als Wohnsitz. Im 18. Jahrhundert wurde das Schloss im Barockstil umgestaltet und in den letzten Jahrzehnten mehrmals restauriert. Immer noch ein Prachtbau. Dazu das einzige Zeugnis fürstlicher Kultur an der gesamten Westküste.
Die Krankenschwester geht schnurstracks über den Innenhof. Direkt vor dem viereckigen Hauptturm mit dem doppelzwiebelförmigen Turmhelm steht ein geparkter Mercedes-Kleinbus. Die weiße Lackierung ist mit unzähligen Rostflecken überzogen, sodass einige der blauen Buchstaben der Seiteninschrift bereits abgeblättert sind. ›Seelenfaden-Puppentheater Karlsruhe‹, entziffert die Krankenschwester mit einiger Mühe. Die Schiebetür ist geöffnet. Im Inneren des Wagens ist niemand.
Sie betritt das Gebäude und steigt wenig später die alten Treppen zur oberen Etage hinauf. Der geräumige obere Treppenabsatz dient als Vorraum zum Rittersaal. Rechts an der Wand hängt ein alter Ölschinken, der die Schlacht um Troja zeigt. Ein Holzkeil steckt unter der offenen Saaltür. Sie guckt in den Raum. Im Scheinwerferlicht bauen zwei Männer auf einer erhöhten Bühne ein dunkles Arbeitszimmer in Miniaturgröße auf.
Morgen Abend soll dort die Eröffnungsvorstellung ›Bulemanns Haus‹ von Theodor Storm stattfinden. Ronja hat sich auf leisen Sohlen in den Schatten der grellen Beleuchtung geschlichen und beobachtet den schlanken, jungen Mann rechts auf der Bühne. Ein gepflegter Dreitagebart umrahmt sein ovales Gesicht. Er hat schwarze Haare, die straff nach hinten gekämmt sind. Seine Hände haben auffällig langgliedrige Finger, mit denen er eine zirka 50 Zentimeter große Marionette an einem Doppelkreuz durch die noch unfertige Kulisse führt.
Der Kopf der Holzpuppe wurde mit wenigen, groben Schnitten modelliert. Die hängenden Augen und die spitze Nasenform verleihen dem länglich-spitzen Gesicht die Züge einer Ratte. Eine weiße Zipfelmütze fällt ihm weit über die Ohren. Die Figur, die an sieben Fäden hängt, ist in einen braunen Schlafrock gekleidet und schleppt sich mühsam über die Bühne.
»Frau Anken, mich hungert«, lässt der Puppenspieler die Marionette mit piepsender Stimme jammern. »So hören Sie doch, Frau Anken!«
Das Marionettenkreuz liegt locker in seiner rechten Hand. Wie beiläufig spannt eine kleine Bewegung des Zeigefingers einen Faden der Aufschnürung. Die Rattenpuppe hebt drohend den Arm.
»Hexe, verfluchte, da treibt sich doch jemand vor meiner Haustür herum. Das ist bestimmt der Knabe meiner Schwester. Er will sich meinen goldenen Becher holen, mich bestehlen, meine Schätze wegschleppen.«
Ronja Ahrendt erkennt sofort die dramatische Schlussszene aus dem Märchen ›Bulemanns Haus‹ von Storm und klatscht vor Begeisterung in die Hände. Die Puppe sackt mitten in der Bewegung in sich zusammen, hängt schlaff in den Fäden. Der Puppenspieler blickt erstaunt in den Raum. Jetzt kann sich die Krankenschwester nicht mehr abseits halten und eilt direkt vor die Bühne.
»Sie spielen einfach großartig!«, ruft sie verzückt, wobei ihre Stimme sich fast überschlägt. »Ich freue mich schon so sehr auf Ihre Aufführungen, Herr Pohlenz! Sie sind doch Peter Pohlenz, oder?«
»Woher kennt das junge Ding deinen Namen?«, fragt die Puppe, während sie sich langsam wieder aufrichtet. Der Rattenmann wackelt dabei sanft mit dem Kopf und schaut zu seinem Spieler hinauf. Die Augen von Ronja Ahrendt leuchten, sie fühlt sich wie die kleine Alice, die unverhofft ins Wunderland geraten ist.
»Seit wann interessierst du dich für schöne Damen, du geizige, alte Ratte?«, fragt der Puppenspieler hinab.
»Niemand redet zu mir in diesem unverschämten Ton«, knurrt der Rattenmann hinauf. »Werde doch erst einmal erwachsen, anstatt hier mit Puppen zu spielen. Und außerdem befindest du dich hier in meinem Haus, in Bulemanns Haus!«
Der Rattenmann geht bis an den Bühnenrand, beugt sich etwas vor und schaut auf Ronja Ahrendt herab.
»Sind Sie etwa wegen dem da oben gekommen?«, fragt der Rattenmann.
»Ja, mein Lieber!«, schmeichelt die Krankenschwester, indem sie das Spiel des Puppenspielers mitmacht. »Ich bin Ronja Ahrendt und soll dich und den Chef vom Seelenfaden-Puppentheater während eurer Vorstellungen betreuen.«
»Ronja Ahrendt! Ich freue mich außerordentlich«, piepst der Rattenmann und macht für eine Holzfigur eine formvollendete Verbeugung.
»Wollen Sie etwa unverfroren mit mir herumflirten?«, kokettiert Ronja und zieht demonstrativ die linke Augenbraue hoch, während sie dem Puppenspieler unverhohlen in die Augen schaut. Der lässt die Marionette auf den Boden sinken, kniet sich galant an den Bühnenrand und hält ihrem Blick mühelos stand.
»Was glauben Sie denn? Selbstverständlich flirte ich mit Ihnen rum«, turtelt er mit sanfter Stimme. »Welcher fahrende Komödiant könnte bei einem so schönen Gesicht wohl widerstehen?«
2
Hauptkommissar Jan Swensen macht einen ausholenden Schritt über die zerbrochenen Glasstückchen, die vor der geöffneten Schiebetür auf dem Parkettboden liegen, und geht auf die Terrasse hinaus. Mit geschultem Blick untersucht er das Loch im Glas der Schiebetür, das mit einem Glasschneider direkt neben der Türklinke herausgeschnitten und nach innen gedrückt wurde. Danach schaut er sich draußen um. Die Terrasse ist mit Natursteinplatten ausgelegt. Über der Fensterfront ist ein Bewegungsmelder installiert, es scheint aber keine Alarmanlage zu geben. Ein gepflegter Rasen erstreckt sich um die Villa herum. Der wird von einer mannshohen, dichten Hecke umrahmt, die einen freien Blick von der Straße auf die Terrasse verhindert. Die Fenster rings ums Haus sind alle unversehrt, nichts deutet auf einen Versuch, an anderer Stelle ins Innere zu gelangen.
Der erste Eindruck am Tatort, davon ist der Husumer Kommissar zutiefst überzeugt, ist noch immer der wichtigste. Je unvoreingenommener er als neutraler Außenstehender die vorhandenen Spuren wahrnehmen kann, umso präziser kann er später die Handschrift des Einbrechers bestimmen.
Das ist nun bereits der achte Einbruch in dieser Gegend, spricht er zu sich selbst. Es deutet einiges darauf hin, dass der Täter die Örtlichkeiten genau kennt. Aber ist das wirklich so? Er scheint ohne Umschweife auf die Terrassentür zugesteuert zu sein. Zufall, oder sagt uns das schon, dass er sich hier auskannte? Die Villa ist von außen kaum einzusehen, das macht es schwer, sie vorher auszukundschaften.
Sein inneres Frage- und Antwortspiel stoppt abrupt. Ihn beschleichen Zweifel, ob seine Beurteilung der Wirklichkeit nicht viel zu stereotyp gerät.
Swensen, du beschäftigst dich doch nur mit deiner Sichtweise, willst dir wohl mal wieder beweisen, dass dein ICH auch wirklich existiert.
In solchen Momenten erinnert er sich fast immer an die Zeit, als er vor jetzt 28 Jahren sein Philosophiestudium in Hamburg hinschmiss und sich für drei Jahre in einen tibetischen Tempel in die Schweiz absetzte, um das Meditieren zu lernen. Ehe er sich versah, wurde sein bis dahin fest gefügtes Weltbild gründlich auf den Kopf gestellt. Während er noch Descartes Satz ›Ich denke, also bin ich‹ hinterherhing, lehrte Lama Rhinto Rinpoche ihn das krasse Gegenteil: ›Ich denke, also bin ich nicht‹. Ungläubig versuchte er, sich an die Kernaussage des tibetischen Buddhismus heranzutasten.
»Die Erscheinung der Dinge, dazu gehört das eigene ICH, besteht aus dem Dharma, dem Zusammenspiel des Daseins«, lehrte der Meister bei seinem ersten Einzelgespräch, dem traditionellen Dokusan. »Alle Dinge der Welt sind dementsprechend im Kern leer und nur eine Illusion deiner Sinne.«
»Das glaube ich nicht«, hatte Swensen gegen die befremdliche Auffassung rebelliert. »Wenn alles, was ich da draußen sehen kann, in Wirklichkeit nur leer wäre, würde es ja so was wie eine Realität überhaupt nicht geben. Ich kann mir das alles doch nicht nur einbilden?«
»So solltest du meine Worte nicht verstehen!«, entgegnete Meister Rinpoche ruhig und drehte bedeutungsvoll den Kopf zur Seite. »Wenn ich sage, die Dinge sind leer, meine ich nicht, sie wären nicht existent. Leer sein besagt nur, dass jede Erscheinung ohne Eigennatur ist und sie deshalb nicht so bleibt, wie sie ist, sondern vergänglich ist. Wir können die Dinge der Welt mit unseren Sinnen nur subjektiv erfassen, trotzdem haben sie eine Realität. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, und wir müssen mit dieser Realität fertig werden. Aber dass Alles ist, zeigt nur eine Seite unseres Daseins. Die andere Seite besagt, dass Alles nicht ist. Unsere Aufgabe ist es, den eigenen Weg zwischen diesen beiden Polen zu finden.«
Swensen sieht die kleine, hutzlige Gestalt seines Meisters vor seinem inneren Auge, sieht den immer fröhlichen Ausdruck auf seinem runden Gesicht, den ewig milden Blick der braunen Augen und muss unwillkürlich lächeln. Erst nach vielen Jahren in seinem Beruf als Kriminalkommissar ist nur ein Hauch des gelebten Gleichmuts von Lama Rinpoche in seinen Arbeitsalltag eingedrungen.
Das ist ein wichtiger Grund, warum der Kriminalist heute möglichst kritisch mit seinen fünf Sinnen umgeht, dem ersten Blick nicht traut. Er muss daran denken, dass seine Kollegen schon öfter versucht haben, ihm einen sechsten Sinn anzudichten. Das amüsiert ihn jedes Mal, zumal die Buddhisten dem Menschen schon immer einen sechsten Sinn zugesprochen haben, nämlich das Denken.
Swensens Augen streifen gründlich über das breite Blumenbeet, das die Terrasse von der Rasenfläche trennt. Trotz der langen Trockenphase in diesem Monat sehen die Pflanzen gepflegt aus. Neben den Sommerblumenrabatten wird er fündig, ein prachtvoller Schuhabdruck. Das Riffelmuster der Sohle ist überdeutlich in die fette Erde eingestanzt.
»Jan! Bist du noch da draußen?«, ruft eine laute Stimme aus dem Innern der Villa. Bevor Swensen antworten kann, steht sein Kollege Stephan Mielke im Rahmen der Terrassentür. Das kantige Gesicht des Oberkommissars ist von kräftigen Backenknochen geprägt. Seine schwarzen Haare sind wie immer extrem kurz geschnitten zu seiner typischen Bürstenfrisur, und er riecht penetrant nach ›Russisch Leder‹.
»Ich mach mich auf die Socken und marschier los zum Klinkenputzen. Vielleicht hat in der Nachbarschaft zufällig jemand etwas mitgekriegt. Wäre gut, wenn du in der Zwischenzeit die Hausbesitzer übernehmen könntest! Silvia hat sie in die Küche gebracht!«
»Okay!«, bestätigt Swensen. Der muskulöse Oberkommissar tippt flüchtig mit dem Zeigefinger an die Stirn und verschwindet wieder im Wohnzimmer. Dem Hauptkommissar fällt auf, dass der Oberkörper des Kollegen in den letzten Monaten auffällig breiter geworden ist.
Wahrscheinlich trainiert er neuerdings im Fitnessstudio, denkt er und überlegt, ob er den Kollegen nicht einfach fragen könnte, ihm bei seinem geplanten Umzug Ende nächster Woche zu helfen. Gleichzeitig erzeugt die Überlegung ein Kribbeln in seiner Magengegend.
Merkwürdig, immerhin ist es deine Idee gewesen, den Umzug in die Tat umzusetzen. Irgendetwas Unbewusstes muss dich da angetrieben haben.
Manchmal ist er sich sicher, dass seine aktuelle Entscheidung im direkten Zusammenhang mit Annas Hoffnung steht, von ihm geheiratet zu werden.
Sie hatte diesen Wunsch vor einem knappen Jahr geäußert. Da waren sie gerade sieben Jahre zusammen gewesen, und es sprach eigentlich überhaupt nichts dagegen, mit ihr die Ehe einzugehen. Trotzdem war er dem Thema erst mal innerlich ausgewichen, hatte es stillschweigend auf die lange Bank geschoben. Obwohl Anna bis heute nicht wieder davon gesprochen hat, ist ihm ihr Wunsch immer im Kopf geblieben. Seine Gedanken führten letztendlich aber zu keinem wirklichen Entschluss. Dann hatte er Anna während des obligatorischen Freitagstermins bei ihrem Lieblingsitaliener aus heiterem Himmel mitgeteilt, dass er seine Wohnung aufgeben und gern bei ihr einziehen würde. Im Nachhinein war er selbst am meisten überrascht.