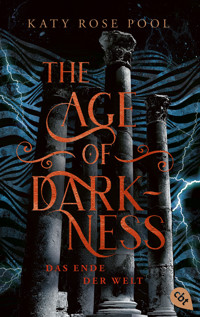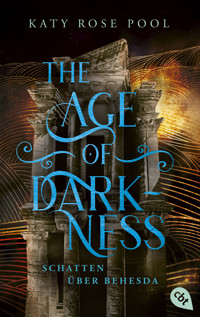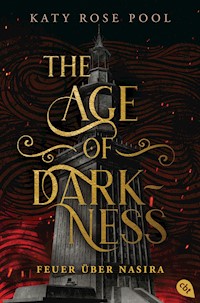
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Age-of-Darkness-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Fünf Schicksale, eine Prophezeiung, ein Auserwählter: Nur einer kann die Welt retten – oder in den Untergang stürzen ...
Einst lenkten sieben Propheten die Welt, doch sie sind längst verschwunden. Geblieben ist nur ihre letzte, geheime Prophezeiung. Sie sagt ein Zeitalter der Dunkelheit voraus und die Geburt eines neuen Propheten, der die Welt entweder retten oder ihr Untergang sein wird. Fünf junge Menschen führt die Prophezeiung zusammen: einen Prinzen in der Verbannung, eine Mörderin, die ihre Opfer mit der »Blassen Hand« zeichnet, einen getreuen Paladin zwischen Pflichtgefühl und Herz, einen Spieler mit der Gabe, alles und jeden zu finden, und ein sterbendes Mädchen, das kurz davor ist, aufzugeben. Einer von ihnen hat die Macht, die Welt zu retten – oder sie in den Untergang zu stürzen.
Alle Bände der „Age of Darkness“-Trilogie:
The Age of Darkness – Feuer über Nasira (Band 1)
The Age of Darkness – Schatten über Behesda (Band 2)
The Age of Darkness – Das Ende der Welt (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Ähnliche
KATY ROSE POOL
FEUER ÜBER NASIRA
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Galić
Für Erica. Wen sonst?
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Text © 2019 Katy Pool Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »There Will Come a Darkness. An Age of Darkness Novel« bei Henry Holt and Company. Henry Holt® is a registered trademark of Macmillan Publishing Group, LLC, 120 Broadway, New York, NY 10271. © 2020 für die deutschsprachige Ausgabe cbj/cbt Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München, Neumarkter Straße 28, 81673 München Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Galić Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: © Shutterstock.com (Michael Rosskothen; atk work; Krasovski Dmitri; CPD-Lab; MG Drachal) Kartenillustration auf dem Vorsatz: Maxime Plasse kk · Herstellung: UK
Inhalt
I Die Vorboten
II Das Gelübde
III Der Turm
Glossar
Die Vier Inneren Gaben
Die Gabe des Herzens
Verleiht außergewöhnliche Stärke, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Sinneswahrnehmung
Ausgeübt durch: Elitekämpfer
Die Gabe des Blutes
Verleiht die Fähigkeit, Energie zu übertragen oder zu entziehen, die heilende oder schädigende Wirkung hat
Ausgeübt durch: Heiler
Die Gabe des Geistes
Verleiht die Fähigkeit, Objekte mit einer besonderen Funktionsweise anzufertigen
Ausgeübt durch: Alchemisten & Konstrukteure
Die Gabe Des Sehens
Verleiht die Fähigkeit, alles Lebende
zu erspüren und zu orten
Ausgeübt durch: Seher
I
DIE VORBOTEN
KAPITEL 1
EPHYRA
In einem mondbeschienenen Raum über den Dächern von Pallas Athos, der Stadt des Glaubens, kniete ein Priester vor Ephyra und flehte um sein Leben.
»Bitte. Ich verdiene es nicht, zu sterben. Ich schwöre, sie nie wieder anzurühren. Bitte hab Erbarmen.«
In dem prächtigen Privatgemach des Priesters in der Herberge Gärten von Thalassa herrschte ein wüstes Durcheinander. Zu Boden gefallene Servierplatten und umgekippte Trinkbecher aus feinstem Silber zeugten von den Resten eines üppigen Festmahls, der weiße Marmorboden war mit reifen Beeren und den wie Juwelen glitzernden Scherben etlicher kleiner Fläschchen übersät. Eine Lache vergossenen Weins, rot wie Blut, bahnte sich langsam ihren Weg auf den knienden Priester zu.
Ephyra ging in die Hocke und legte ihm eine Hand an die Wange. Seine Haut fühlte sich trocken wie Pergament an.
»Oh, ich danke dir!« Dem Priester traten Tränen in die Augen. »Danke, gesegnet sei …«
»Ich frage mich«, unterbrach sie ihn, »ob deine Opfer dich je um Gnade angefleht haben? Ob sie je Behesda angerufen haben, wenn du deine Male auf ihren Körpern hinterlassen hast?«
Er hielt entsetzt die Luft an.
»Nein, ich glaube nicht, dass sie das getan haben. Du hast sie dir mit deinem abscheulichen Trank gefügig gemacht, damit du ihnen wehtun konntest, ohne jemals ihren Schmerz mit ansehen zu müssen«, sagte sie. »Aber du sollst wissen, dass jede Narbe, die du ihnen zugefügt hast, auch bei dir ein Zeichen hinterlassen hat.«
»Bitte …«
Durch die offen stehenden Balkontüren hinter ihr wehte eine Brise, als sie sein Kinn anhob. »Du trägst das Zeichen des Todes auf dir. Und der Tod ist gekommen, um einzufordern, was ihm gehört.«
Er starrte sie mit nacktem Grauen an, als sie ihre Hand zu seiner Kehle gleiten ließ. Sie spürte seinen rasenden Puls unter ihren Fingerspitzen, richtete ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, lauschte, wie das Blut durch seine Adern rauschte. Dann entzog sie seinem Körper das Esha.
Das Licht in den Augen des Priesters erlosch, während seine Lungen ihren letzten Atemzug ausstießen. Er sackte zu Boden. Auf der bleichen Haut seiner Kehle leuchtete ein Handabdruck, blass wie der Mond. Das einzig sichtbare Zeichen dafür, dass er umgebracht worden war.
Sie zog einen Dolch aus ihrem Gürtel und beugte sich über ihn. Er war nicht allein gewesen, als sie ihn fand. Die beiden Mädchen, die er bei sich gehabt hatte – Mädchen mit tief in den Höhlen liegenden Augen und blauen Blutergüssen an den Handgelenken –, waren sofort davongelaufen, als sie es ihnen befohlen hatte. Sie hatten gehorcht, als hätten sie ihr ganzes junges Leben lang nichts anderes getan.
Mit ruhigen, routinierten Bewegungen stieß Ephyra ihm die Spitze des Dolchs durch den blassen Handabdruck tief in die Kehle. Sobald das dunkle Blut zu fließen begann, zog sie ihn wieder heraus, öffnete ein kleines Geheimfach im Griff und entnahm ihm eine Ampulle, mit der sie etwas von dem Blut auffing. Die letzten Worte des Priesters waren eine Lüge gewesen – er hatte den Tod verdient. Aber das war nicht der Grund, warum sie ihm das Leben genommen hatte.
Sie hatte ihm das Leben genommen, weil sie es brauchte.
Plötzlich flogen die Türen zu dem Gemach so unvermittelt auf, dass ihr vor Schreck die Ampulle aus der Hand glitt. Sie konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen, bevor ihr Inhalt verschüttet wurde.
»Keine Bewegung!«
Drei Männer stürzten herein, einer mit erhobener Armbrust, die beiden anderen mit Säbeln. Stadtwächter. Ephyra war nicht überrascht. Die Herberge Gärten von Thalassa lag am Rand des Elea-Platzes, gerade noch innerhalb der Tore der Oberstadt. Sie hatte sich kundig gemacht und wusste, dass die Wächter jeden Abend zu Fuß über den Platz patrouillierten. Aber sie hatten sie schneller aufgespürt, als sie gedacht hatte.
Der Anführer hielt jäh inne und starrte auf den am Boden liegenden Priester. »Er ist tot!«
Sie verschloss die Blutampulle und versteckte sie wieder im Griff des Dolchs. Während sie sich aufrichtete, vergewisserte sie sich, dass das schwarze Seidentuch noch an seinem Platz saß und die untere Hälfte ihres Gesichts verbarg.
»Ergib dich oder wir müssen dich mit Gewalt in Gewahrsam nehmen«, sagte der Wächter langsam.
Ihr schlug das Herz bis zum Hals, aber sie zwang ihre Stimme, ruhig zu klingen. Furchtlos. »Wenn ihr auch nur einen Schritt näher kommt, wird es in diesem Gemach mehr als nur einen Toten geben.«
Der Wächter zögerte. »Sie versucht, uns zu täuschen.«
»Nein«, sagte der Armbrustträger mit einem nervösen Blick auf den Priester. »Schaut euch den Handabdruck an. Genau wie bei den Toten, die in Tarsepolis gefunden wurden.«
»Die Blasse Hand«, wisperte der dritte Wächter und starrte Ephyra an.
»Das sind doch bloß Märchen«, sagte der erste Wächter, aber seine Stimme zitterte leicht. »Niemand ist so mächtig, dass er allein durch die Gabe des Blutes töten kann.«
»Was hast du in Pallas Athos zu suchen?«, fragte der dritte Wächter. Er stand breitbeinig und mit vorgeschobener Brust vor ihr, als versuchte er, eine Bestie niederzustarren. »Warum bist du hier?«
»Ihr nennt diesen Ort Stadt des Glaubens«, sagte Ephyra. »Aber hinter ihren weißen Mauern herrschen Verderbtheit und Ruchlosigkeit. Ich werde sie zeichnen, so wie ich alle meine Opfer zeichne, damit der Rest der Welt sieht, dass die Stadt des Glaubens die Stadt der vom Glauben Abgekommenen ist.«
Das war eine Lüge. Sie war nicht in die Stadt des Glaubens gekommen, um sie mit Blut zu beflecken. Doch es gab nur zwei andere Menschen auf der Welt, die den wahren Grund kannten. Und einer von ihnen wartete auf sie.
Sie bewegte sich rückwärts auf den Balkon zu. Die Stadtwächter spannten die Muskeln an, versuchten aber nicht, ihr zu folgen.
»Du hast einen Priester getötet, damit wirst du nicht so einfach davonkommen«, sagte einer von ihnen. »Wenn wir dem Konklave berichten, was du getan hast …«
»Nur zu.« Sie zog sich ihre schwarze Kapuze über den Kopf. »Sagt seinen Mitgliedern, die Blasse Hand sei gekommen, um den Priester von Pallas zu holen. Und sie sollen beten, dass sie nicht die Nächsten sind, die ich holen komme.«
Sie drehte sich um und riss die Seidenvorhänge zur Seite. Der Mond hing wie das Blatt einer Sense am Nachthimmel.
Die sich überschlagenden Stimmen der Wächter hinter sich lassend, lief sie auf den Balkon und schwang sich über die Marmorbalustrade. Die Welt neigte sich – vier Stockwerke tiefer schimmerten die Eingangsstufen der Herberge wie Elfenbeinzähne im Mondlicht. Ihre Finger bekamen den unteren Rand der Balustrade zu fassen, und ein Blick nach links sagte ihr, dass sich das Dach des Badehauses gerade noch in erreichbarer Nähe befand.
Sie nahm Schwung und sprang. Die Augen zusammengekniffen, die Arme um die Knie geschlungen, wappnete sie sich für den Aufprall, landete hart und rollte sich ab. Sobald sie wieder festen Halt hatte, rappelte sie sich auf und lief los, und die Stimmen der Wächter und die Lichter der Herberge verloren sich in der Nacht.
Ephyra bewegte sich wie ein Schatten durch das Mausoleum. Stille und Dunkelheit herrschten an dem heiligen Ort, die Morgendämmerung war nur zu erahnen. Sie bahnte sich einen Weg zwischen den Trümmern hindurch, vorbei am gefliesten Orakelbecken in der Mitte, das Einzige in dieser heiligen Stätte, dem das Feuer nichts hatte anhaben können. Über ihr gab die eingestürzte Decke den Blick auf den Nachthimmel frei.
Die Ruine des Mausoleums lag direkt vor den Mauern der Stadt und war wie dafür geschaffen, sich unbemerkt in die Unterstadt zu stehlen. Sie wusste nicht, wann das Mausoleum niedergebrannt worden war, aber nun war es verlassen und bot ein perfektes Versteck. Die Stufen in die Krypta hinunter knarzten und ächzten unter ihren Schritten, und es brauchte wie stets einen kräftigen Stoß, um die vermoderte Holztür zu der winzigen Kammer zu öffnen, die seit zwei Wochen ihr Zuhause war. Sie zog das schwarze Tuch vom Gesicht und warf ihren Umhang ab, bevor sie eintrat.
Die Kammer hatte den Akolythen, die sich früher um das Heiligtum kümmerten, als Vorratskeller gedient. Nun war sie den Ratten, der Verrottung und Menschen wie Ephyra überlassen, die sich nicht an den beiden anderen Dingen störte.
»Du kommst spät.«
Ephyra spähte durch den dämmrigen Raum zu der Schlafstatt in der Ecke, über der behelfsmäßig zwei zerschlissene Laken angebracht waren, um einen Hauch Privatsphäre zu schaffen. Die dunklen Augen ihrer Schwester spähten zu ihr zurück.
»Ich weiß.« Ephyra legte das schwarze Tuch und den Umhang über die Lehne eines Stuhls am Ende der Schlafstatt.
Beru setzte sich auf und streckte sich wie eine zu groß gewachsene Katze. Ein Buch glitt von ihrer Brust und landete mit flatternden Seiten auf dem Laken. Ihre kurzen, lockigen Haare waren auf der einen Seite ihres Kopfs vom Liegen platt gedrückt. »Ist alles gut gegangen?«
»Ja.« Es gab keinen Grund, ihr zu erzählen, wie knapp sie entkommen war. Ihre Mission war erfüllt. Sie zwang sich ein Lächeln ins Gesicht. »Du weißt doch, die Zeiten, in denen ich von den Dächern von Spelunken heruntergefallen bin, sind längst vorbei. Ich habe mittlerweile einiges dazugelernt.«
Als Ephyra die Identität der Blassen Hand angenommen hatte, waren ihre Kletterkünste noch recht bescheiden gewesen. Die Tatsache, dass sie die Gabe des Blutes besaß, bedeutete nicht, dass sie sich unbemerkt in Lasterhöhlen schleichen oder die Balkone reicher Kaufleute erklimmen konnte. Diese Fertigkeiten hatte sie sich auf herkömmliche Art aneignen müssen und unzählige Nächte damit verbracht, sowohl ihren Gleichgewichtssinn, ihre Reaktionsschnelligkeit und ihre Muskelkraft zu verbessern, als auch ihre Opfer auszukundschaften. Beru hatte sie begleitet, als es ihr noch besser ging, und mit ihr darum gewetteifert, wer schneller über einen Zaun klettern oder geräuschloser von einem Dach zum nächsten springen konnte. Sie hatten sich viele Nächte lang durch die Schatten gestohlen und an die Fersen möglicher Opfer gehängt, um ihre Laster und Gewohnheiten zu studieren. Nachdem Ephyra jahrelang trainiert hatte und einige Male nur knapp einer Ergreifung entgangen war, wusste sie, wie sie sich aus gefährlichen Situationen, in die sie als die Blasse Hand geriet, herausmanövrieren konnte.
Beru erwiderte ihr Lächeln, aber es fehlte ihm an Kraft.
Ephyra spürte, wie ihr eigenes Lächeln verblasste, als sie den Schmerz in den Augen ihrer Schwester sah. »Steh auf«, sagte sie sanft.
Beru schlug die raue Decke zurück. Sie zitterte und ihre dunkle Haut wirkte in dem dämmrigen Licht fahl. In ihren blutunterlaufenen Augen lag ein erschöpfter Ausdruck.
Stirnrunzelnd beugte Ephyra sich über die flache Schale, die auf der Kiste neben der Schlafstatt stand, nahm die Ampulle aus dem Geheimfach im Griff ihres Dolchs und gab den Inhalt hinein. »Wir haben viel zu lange gewartet.«
»Mir geht es gut«, sagte Beru mit zusammengebissenen Zähnen und wickelte einen Stoffstreifen von ihrem linken Handgelenk. Darunter kam ein schwarzer Handabdruck zum Vorschein.
Ephyra benetzte ihre Hand mit dem Blut in der Schale und legte sie anschließend auf das dunkle Mal, das Berus Haut entstellte. Dann schloss sie die Augen und richtete all ihre Sinne darauf, das Esha, das sie dem Priester entzogen hatte, durch sein Blut in den Körper ihrer Schwester zu lenken.
Das Blut diente als Medium. Wäre sie eine ordentlich ausgebildete Heilerin gewesen, hätte sie Wege gekannt, das Esha ihrer Opfer direkt auf Beru zu übertragen. Sie hätte kein Blut dafür nutzen müssen.
Andererseits wäre sie erst gar nicht dazu gezwungen gewesen, zu töten, wenn sie eine ordentliche Ausbildung genossen hätte. Heiler mit der Gabe des Blutes legten einen Eid ab, der es ihnen verbot, jemals das Esha anderer anzurühren.
Aber es war die einzige Möglichkeit, ihre Schwester am Leben zu erhalten.
»Siehst du.« Ephyra legte Beru eine Hand an die Wange, wo die Haut bereits anfing, ihre besorgniserregende gräuliche Färbung zu verlieren. »Schon viel besser.«
Für den Moment zumindest. Beru sprach es nicht aus, aber Ephyra konnte die Worte in ihren Augen lesen. Beru griff an ihr vorbei nach einem dünnen schwarzen Griffel, der auf der Kiste neben der Schlafstatt lag. Mit anmutigen, geübten Bewegungen malte sie eine kurze, gerade Linie auf ihr Handgelenk, in das bereits dreizehn andere Linien für alle Ewigkeit mit alchemistischer Tinte hineingeätzt worden waren.
Vierzehn getötete Menschen. Vierzehn Leben – ausgelöscht, damit Beru leben konnte.
Es entging Ephyra nicht, wie ihre Schwester jedes Mal, wenn sie ein Opfer gezeichnet hatte, ihre eigene Haut zeichnete. Wie nach jedem Tod Schuldgefühle an ihrer Schwester nagten. Dass die Menschen, die sie tötete, weit davon entfernt gewesen waren, unschuldig zu sein, schien für Beru keine Rolle zu spielen.
»Vielleicht war es das letzte Mal«, sagte Ephyra leise. »Das letzte Mal, dass wir das tun mussten.«
Deswegen waren sie nach Pallas Athos gekommen. Irgendwo in dieser Stadt des verloren gegangenen Glaubens und der zerfallenen Tempel gab es jemanden, der wusste, wie Beru für immer geheilt werden konnte. In den letzten fünf Jahren hatte sie sich an diese Hoffnung geklammert.
Beru wandte den Blick ab.
»Ich habe dir noch etwas anderes mitgebracht.« Ephyra zwang sich, unbekümmert zu klingen. Sie griff in den kleinen Beutel an ihrem Gürtel und zog den gläsernen Verschluss einer Flasche heraus, den sie im Gemach des Priesters vom Boden aufgelesen hatte. »Ich dachte, du könntest ihn vielleicht für das Armband verwenden, an dem du gerade arbeitest.«
Beru nahm den Glaspfropfen und drehte ihn in ihrer Hand. Er sah aus wie ein kleines Juwel.
Ephyra legte ihre Hand auf die ihrer Schwester. »Ich lasse nicht zu, dass dir irgendetwas geschieht.«
»Ich weiß.« Beru schluckte. »Immer machst du dir Sorgen um mich. Manchmal kommt es mir vor, als würdest du nichts anderes tun. Aber du bist nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Jedes Mal, wenn du dort draußen bist, habe ich Angst um dich.«
Sie tippte vorwurfsvoll mit dem Finger gegen Berus Wange. »Mir wird nichts passieren.«
Beru strich mit dem Daumen über die vierzehn Linien an ihrem Handgelenk. »Das meine ich nicht.«
Ephyra zog ihre Hand wieder weg. »Du solltest jetzt schlafen.«
Beru ließ sich auf ihr Lager zurücksinken und Ephyra legte sich neben sie. Während sie dem gleichmäßigen Atem ihrer Schwester lauschte, dachte sie an die Angst, die Beru zwar aussprach, aber nicht benannte. In Nächten wie dieser, wenn sie spürte, wie der Puls ihrer Opfer langsamer schlug und schließlich verstummte, wenn sie ihnen das letzte bisschen Leben entzog, fühlte sie diese Angst ebenfalls. Sobald deren Blick erlosch, empfand sie eine süße, satte Erleichterung – und gleichzeitig eine tiefe, unentrinnbare Furcht davor, dass das Töten von Monstern sie selbst zu einem machte.
KAPITEL 2
HASSAN
Auf seinem Weg die Heilige Straße hinauf zupfte Hassan an seiner Tunika. Der Diener, von dem er sie sich ausgeliehen hatte, war ein kleines bisschen größer als er, und Hassan hatte das Gefühl, in ihr zu versinken. Er war die fließenden Gewänder, die man sich in Pallas Athos um den Körper drapierte, nicht gewohnt und sehnte sich nach der Robustheit der schweren Brokatstoffe aus Herat zurück. Kleidung, die sich fest um den Körper schmiegte und Brust und Kehle bedeckte.
Aber in seinen eigenen Kleidern wäre er zu sehr aufgefallen, und hätte man ihn auf der Straße erkannt, wäre die ganze Anstrengung, die es ihn gekostet hatte, sich heimlich davonzustehlen, umsonst gewesen. Ganz zu schweigen von der Gefahr, in die er geraten könnte.
Das war zumindest die Begründung seiner Tante Lethia gewesen, als sie ihm verboten hatte, die Mauern ihrer an den Klippen gelegenen Villa zu verlassen.
»Du bist zu deiner eigenen Sicherheit in diese Stadt gekommen«, hatte sie ihn eindringlich ermahnt. »Die Zeugen können nicht mit Gewissheit sagen, ob der Prinz von Herat sich noch in Nasira aufhält oder bereits über die Landesgrenzen entkommen ist, und ich habe vor, sie so lange wie möglich in Unkenntnis zu lassen. Der Einfluss des Hierophanten reicht selbst bis hierher, und ich fürchte, seine Anhänger würden alles daransetzen, dich aufzuspüren und an ihn auszuliefern, wenn sie wüssten, dass du geflohen bist.«
Nachdem er zwei Wochen lang vergeblich versucht hatte, sie umzustimmen, hatte Hassan beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Als seine Tante heute aufgebrochen war, um den Nachmittag in der Stadt zu verbringen, hatte er nicht lange gezögert und die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Er wollte herausfinden, was in seinem Königreich vor sich ging, seit er es verlassen hatte. Von seiner Tante erfuhr er nämlich so gut wie nichts darüber – entweder weil sie es nicht wusste oder weil sie ihn schonen wollte.
Es war ein warmer Nachmittag und auf der Heiligen Straße herrschte geschäftiges Treiben. Die breite, mit Kalkstein gepflasterte Allee wurde von Olivenbäumen – dem Wahrzeichen von Pallas Athos – gesäumt und führte vom Hafen bis zur Agora und dem über der Stadt thronenden Tempel von Pallas hinauf. In den Säulengängen, die zu beiden Seiten der Straße verliefen, reihten sich Geschäfte, Schankstuben und Badehäuser aneinander.
Der kalte Marmor und karge Kalkstein um ihn herum ließen ihn die leuchtenden Farben von Nasira, der Hauptstadt Herats, umso schmerzlicher vermissen – schimmerndes Gold, warmes Ocker und Karmesinrot, saftiges Grün und leuchtendes Blau.
»He, du! Bleib stehen!«
Hassan erstarrte. Er war noch nicht einmal eine Meile von der Villa entfernt und hatte sich schon erwischen lassen. Vor Scham und Reue stieg ihm die Röte in die Wangen.
Doch als er sich zu der Stimme umdrehte, begriff er, dass gar nicht er gemeint war. Ein Metzger war hinter seinem Marktstand hervorgelaufen und deutete hektisch auf jemanden in der Menge. »Haltet den Dieb!«
Ein paar Leute blieben stehen und schauten sich um. Im nächsten Moment flitzte ein kleiner Junge zwischen ihnen hindurch, und bevor Hassan entscheiden konnte, was er tun sollte, rannte der Junge mitten in ihn hinein.
Hassan stolperte ein paar Schritte rückwärts, schaffte es aber, den Jungen aufzufangen, ohne der Länge nach mit ihm hinzuschlagen.
»Das ist er!«, schrie der Metzger. »Das ist der Dieb!«
Hassan hielt den Jungen an den Schultern fest und ließ den Blick über seine zerrissenen knielangen Hosen und sein schmutziges Gesicht wandern. Er hielt ein in braunes Papier gewickeltes Päckchen an die Brust gepresst. Seine dunklen Züge und seine bronzefarbene Haut zeugten eindeutig von seiner heratischen Herkunft – er war ein Kind aus Hassans Heimat. Hassan schaute zu dem Metzger zurück, der schnaufend und mit hochrotem Kopf auf sie zugelaufen kam.
»Hast wohl gedacht, du kannst dich einfach so davonmachen, was?«, fuhr er den Jungen an. »Aber du wirst schon sehen, wie man in dieser Stadt mit dreckigen kleinen Dieben wie dir umgeht.«
»Ich bin kein Dieb!«, gab der Junge zurück und befreite sich aus Hassans Griff. »Ich habe dafür bezahlt.«
Hassan sah den Metzger an. »Ist das wahr?«
»Der kleine Halunke hat mir ein paar lumpige Münzen in die Hand gedrückt, dabei ist dieses prächtige Stück Lammfleisch mehr als doppelt so viel wert!«, gab der Metzger entrüstet zurück. »Dachtest, ich merke es nicht und du könntest dich einfach aus dem Staub machen, was?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich wusste nicht, dass es zu wenig war«, sagte er entschuldigend. »Ich habe die Münzen gezählt, aber die sehen hier so anders aus, dass ich durcheinandergekommen bin.«
»Klingt, als wäre das alles nichts weiter als ein Missverständnis.« Hassan setzte sein diplomatischstes Lächeln auf und griff nach dem Münzbeutel an seinem Gürtel. »Ich zahle, was er dir noch schuldet. Wie viel ist es?«
Der Metzger warf dem Jungen einen verschlagenen Blick zu. »Drei Tugenden.«
Hassan zählte drei mit einem Olivenbaum geprägte Silbermünzen ab und hielt sie dem Metzger hin.
Der Mann schloss feixend die Hand darum und sagte abfällig: »Ihr Flüchtlinge glaubt wohl, ihr könntet euch bis in alle Ewigkeiten auf unserer Mildtätigkeit ausruhen.«
Hassan kochte innerlich. Am liebsten hätte er sich dem Metzger zu erkennen gegeben und ihn in aller Öffentlichkeit dafür züchtigen lassen, dass er es wagte, so mit dem Prinzen von Herat zu sprechen. Stattdessen zwang er sich, lächelnd zu erwidern: »Eure Mildtätigkeit erfüllt uns alle mit tiefer Bewunderung.«
Im Kiefer des Metzgers zuckte ein Muskel, als wäre er sich nicht sicher, ob Hassan es ernst meinte oder sich über ihn lustig machte. Schließlich grunzte er etwas Unverständliches, nickte und kehrte an seinen Stand zurück.
Kaum hatte der Metzger ihnen den Rücken zugekehrt, wollte sich der Junge aus dem Staub machen, aber Hassan hielt ihn an der Schulter fest. »Nicht so schnell. Wir sind hier noch nicht fertig. Das stimmt gar nicht, dass du mit den hiesigen Münzen durcheinandergekommen bist, habe ich recht?«
Der Junge hob bestürzt den Blick.
»Schon gut«, sagte Hassan lächelnd. »Ich nehme an, du hattest gute Gründe dafür.«
»Ich wollte meiner Mutter eine Freude machen.« Der Junge ließ die Schultern hängen. »Weil Lammeintopf doch ihr Lieblingsgericht ist. Aber den hat es bei uns nicht mehr gegeben, seit … seit wir von zu Hause fort sind. Ich dachte, wenn ich ihr einen koche, fühlt sie sich vielleicht, als ob wir noch zu Hause wären, und würde nicht mehr so viel weinen.«
Hassan musste unwillkürlich an seine eigene Mutter denken, die noch zu Hause war, auch wenn er alles dafür gegeben hätte, sie bei sich zu haben, um sie zu trösten, so wie dieser Junge, der kaum älter als zehn Jahre sein konnte, seine Mutter trösten wollte. Um ihr zu sagen, dass alles gut werden würde. Vielleicht auch, um aus ihrem Mund zu hören, dass alles gut werden würde. Wenn sie überhaupt noch lebte. Sie lebt, dachte er. Sie muss einfach.
Er schluckte und sah den Jungen an. »Dann sollten wir nicht länger hier rumstehen, sondern uns schleunigst auf den Weg zu ihr machen. Ihr seid im Lager untergebracht, nehme ich an?«
Der Junge nickte. Sie gingen los und Hassan spürte, wie seine erwartungsvolle Aufregung mit jedem Schritt wuchs, den sie auf dem letzten Stück der Heiligen Straße zurücklegten. Die Oberstadt von Pallas Athos schmiegte sich an einen Berghang und setzte sich aus drei übereinanderliegenden Ebenen zusammen, die wie eine Krone in die Höhe ragten. Durch das Heilige Tor gelangten sie auf die höchste Ebene, wo sich die Agora vor ihnen ausbreitete, von der aus man die ganze Stadt überblickte.
Dahinter erhob sich der prächtige Marmorbau des Tempels von Pallas, der größer war als sämtliche Tempel in Nasira. Ein breiter, von Pfeilern gesäumter Treppenaufgang führte den Hang hinauf zum Säulenvorbau des Tempels. Gleißendes Licht ergoss sich über seine schweren Pforten.
Der Tempel zählte zu den sechs großen Weltmonumenten. Von hier aus hatte der Gründer dieser Stadt, der Prophet Pallas, einst die regierenden Priester geleitet und seine Prophezeiungen in der restlichen Welt verbreitet. Gemäß den Überlieferungen der Geschichte der Sechs Prophetischen Städte waren früher Menschen aus dem ganzen Pelagos-Kontinent zur Agora in der Stadt des Glaubens gepilgert, um sich selbst mit geweihtem Salböl zu segnen und auf den Stufen des Tempels Opfergaben wie Weihrauch und Olivenzweige darzubringen.
Doch seit die Propheten vor hundert Jahren verschwunden waren, hatte kein Pilger mehr seinen Fuß hierhergesetzt. Die Gebäude der Agora, bestehend aus Lagerräumen, Badehäusern, einer Arena und dem Wohnquartier der Akolythen, verfielen allmählich und waren von Unkraut und hohem Gras überwuchert.
Jetzt wimmelte es auf dem großen Versammlungsplatz wieder vor Menschen und es herrschte reges Treiben. Während der zwei Wochen seit dem Umsturz waren Menschen aus ganz Herat hierhergeflüchtet und standen nun unter dem Schutz des Archon basileus und des Priesterkonklaves von Pallas Athos. Das war der Grund, warum Hassan sich aus der Villa seiner Tante gestohlen hatte – um sich endlich mit eigenen Augen ein Bild von den Lebensumständen der anderen Menschen zu machen, die wie er aus Nasira geflohen waren. Menschen wie dieser Junge.
Hassan stieg der würzige Geruch von Holzrauch in die Nase, als er dem Jungen durch das Heilige Tor in das behelfsmäßig errichtete Lager folgte. Zwischen den verwitterten Bauten waren Zelte, Unterstände und notdürftig zusammengezimmerte Bretterverschläge errichtet worden. Abfälle lagen herum, aus allen Richtungen erklangen Kindergeschrei und Bruchstücke hitziger Streitgespräche, und direkt vor ihnen kam aus einem Säulengang eine lange Schlange von Menschen, die Krüge und Eimer mit Wasser schleppten und vorsichtig darauf bedacht waren, keinen einzigen Topfen des kostbaren Nasses zu verschütten.
Hassan blieb stehen und nahm den Anblick in sich auf. Er hatte keine genaue Vorstellung davon gehabt, was ihn auf der Agora erwarten würde, aber damit hatte er nicht gerechnet. Voller Scham dachte er an den idyllischen Garten und die palastähnlichen Gemächer in der Villa seiner Tante, während sein Volk nur eine Meile entfernt zusammengepfercht zwischen Tempelruinen hausen musste.
Trotz der niederschmetternden Zustände empfand Hassan eine schmerzhafte Vertrautheit mit den Bewohnern des aus allen Nähten platzenden Lagers. Sie setzten sich aus dunkelhäutigen Wüstensiedlern und dem braun gebrannten Delta-Volk zusammen, dem auch er entstammte. Ihm schoss der Gedanke durch den Kopf, dass es für ihn zu Hause unmöglich gewesen wäre, einfach so an einen Ort wie diesen zu gehen. Natürlich gab es Feierlichkeiten wie das Flammen- oder das Flutfest, aber selbst bei diesen Gelegenheiten waren Hassan und der Königshof von den feiernden Menschenmassen abgeschirmt worden und hatten das Spektakel aus der sicheren Entfernung der Palaststufen oder einer königlichen Barke vom Fluss Herat aus verfolgt.
Eine seltsame Mischung aus freudiger Erregung und nervöser Beklommenheit erfasste ihn. Dies war nicht nur das allererste Mal, dass er sein Volk seit dem Umsturz wiedersah – es war das allererste Mal, dass er es als einer von ihnen sah.
»Asisi!« Eine aufgelöste Stimme erhob sich über den Lärm vor dem Brunnenhaus. Eine Frau mit dunklen, zu einem Kranz geflochtenen Haaren kam auf sie zugelaufen, gefolgt von einer weißhaarigen Alten, die ein Kleinkind auf der Hüfte trug.
Asisi rannte stolpernd auf die dunkelhaarige Frau zu, die eindeutig seine Mutter war und ihn ungestüm in die Arme riss, sobald er bei ihr angekommen war. Dann hielt sie ihn eine Armlänge von sich weg und schalt ihn mit Tränen in den Augen aus, bevor sie ihn erneut, so fest sie konnte, an sich drückte.
»Tut mir leid, Mutter«, murmelte Asisi gerade reumütig, als Hassan zu ihm aufschloss.
»Ich habe dir doch gesagt, dass du das Lager nicht verlassen sollst!«, schimpfte seine Mutter weiter. »Ich will mir gar nicht ausmalen, was dir alles hätte zustoßen können.«
Asisi biss sich auf die Unterlippe, als kämpfte er wacker gegen seine Tränen an.
Die ältere Frau trat zu Hassan. »Wo hast du ihn gefunden?«
»Auf dem Marktplatz vor dem Heiligen Tor«, antwortete er. »Er hat Lammfleisch gekauft.«
Die Frau schnalzte sanft mit der Zunge, als das Kleinkind sich aus ihrem Griff winden wollte. »Er ist ein guter Junge«, sagte sie und fügte ohne Überleitung hinzu: »Bist du auch hierhergeflohen?«
»Nein«, sagte Hassan hastig. »Ich war bloß zur richtigen Zeit am richtigen Ort.«
»Aber du bist ein Herati.«
»Ja.« Er suchte fieberhaft nach einer Erklärung, was er hier machte, ohne ihr Misstrauen zu wecken. »Ich wohne in der Stadt und bin in das Lager gekommen, um herauszufinden, ob es irgendwelche Neuigkeiten aus Nasira gibt. Ich … ich habe Familie dort. Ich muss wissen, ob sie in Sicherheit sind.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte die Frau ernst. »Viel zu viele von uns wissen nicht, was aus ihren Liebsten zu Hause geworden ist. Die Zeugen haben den Hafen abgeriegelt und lassen so gut wie keine Schiffe mehr durch. Die einzigen Nachrichten, die uns erreichen, stammen von Landsleuten, denen es gelungen ist, nach Osten, in die Wüste und über das Südmeer zu fliehen.«
Hassan wusste genau, wovon sie sprach. In seinen Gemächern in der Villa bewahrte er ein ledergebundenes Buch auf, in dem er akribisch festhielt, was er über die Geschehnisse in seiner Stadt in Erfahrung bringen konnte. Er wusste immer noch nicht, was mit seinen Eltern passiert war – ob seine Tante Lethia genau wie er im Unklaren war oder ob sie ihn vor der Wahrheit schützte.
Er wollte nicht beschützt werden. Er wollte einfach nur Gewissheit. Sich innerlich gegen die Antwort wappnend, fragte er: »Was ist mit dem König und der Königin? Weiß man, was mit ihnen geschehen ist?«
»Der König und die Königin leben«, sagte die Frau. »Der Hierophant hält sie irgendwo fest, aber seit dem Umsturz sind sie mindestens zwei Mal in der Öffentlichkeit gesehen worden.«
Er stieß die Luft aus, die er, ohne es zu bemerken, angehalten hatte. Vor Erleichterung wurde ihm schwindelig. Wie sehr er sich nach diesen Worten gesehnt hatte. Seine Eltern lebten. Sie waren immer noch in Herat, auch wenn sie weiterhin in der Gewalt des Hierophanten, des Oberhaupts der Zeugen, waren.
»Über den Prinzen ist nichts bekannt«, sprach die Frau weiter. »Seit dem Umsturz wurde er nicht mehr in Nasira gesehen. Als wäre er vom Erdboden verschluckt. Aber viele von uns glauben, dass er überlebt hat. Dass ihm die Flucht gelungen ist.«
Es war reines Glück gewesen, dass er sich nicht in seinen Gemächern aufgehalten hatte, als der Hierophant den Palast stürmen ließ. Er war in der Bibliothek über einer Ausgabe von Der Niedergang des Nowogardischen Reichs eingeschlafen und von lauten Schreien und beißendem Rauchgeruch aufgewacht. Einer der Leibwächter seines Vaters hatte ihn dort gefunden und über die Gartenmauer zum Hafen hinuntergeschmuggelt. Er sagte ihm, seine Mutter und sein Vater würden auf einem der Schiffe warten. Als Hassan begriff, dass der Wächter ihn belogen hatte, hatte das Schiff bereits abgelegt, und er hatte nur noch zusehen können, wie seine Stadt und der am Hafen aufragende Leuchtturm immer kleiner wurden.
»Was hat der Hierophant mit dem König und der Königin vor?«, fragte er.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Manche sagen, er würde sie am Leben lassen, um das Volk zu beschwichtigen, andere, dass er sie als Demonstration seiner Macht benutzt – sowohl gegenüber seinen Anhängern als auch gegenüber den Begnadeten von Nasira.«
»Seine Macht?«, wiederholte Hassan, weil er das Gefühl hatte, dass sie damit mehr als den Einfluss des Hierophanten auf seine Anhänger meinte.
»Die Zeugen behaupten, der Hierophant könne die Begnadeten daran hindern, ihre Gabe zu benutzen«, sagte die Frau. »Er könne sie durch seine bloße Anwesenheit ihrer Fähigkeiten berauben. Seine Anhänger glauben, dass der Hierophant sie an dieser Macht teilhaben lassen wird, wenn sie sich als würdig erweisen.«
Hassan mahlte mit den Kiefern. Bei dem Gedanken, seine Mutter und sein Vater könnten einer solchen Machtdemonstration unterzogen worden sein, bebte er innerlich vor Wut. Er konnte nicht anders, als es sich bildlich vorzustellen – seine stolze, hochgewachsene Mutter, die sich weigerte, sich zu unterwerfen. Sein sanftmütiger und bedächtiger Vater, der seinem Volk zuliebe seine eigene Furcht und Sorge verbarg. Der Hierophant, der mit seiner goldenen Maske vor ihnen stand.
Er hatte den Mann, der sein Land an sich gerissen hatte, noch nie mit eigenen Augen gesehen, aber aus Erzählungen wusste er von der goldenen Maske mit der auf der Stirn eingeprägten schwarzen Sonne, hinter der er sich versteckte.
Aus den Gerüchten, die über den Mann mit der goldenen Maske kursierten, hatte sich während der letzten fünf Jahre ein vages Bild zusammengesetzt: ein fremder Prediger, der durch den Osten von Herat gewandert war, ein meisterhafter Redner, der mit einer einzigen Geste eine Menschenmenge zum Verstummen bringen oder mit einem einzigen Wort einen Aufstand anzetteln konnte. Es hieß, der Hierophant hätte einst als Akolyth im Tempel von Pallas gedient, sich jedoch eines Tages von den Propheten abgewandt und begonnen, seine eigene Botschaft zu verkünden. Er wiegelte die Bewohner in den Städten auf, indem er sie glauben machte, die Fähigkeiten der Begnadeten seien widernatürlich und gefährlich, und scharte so Anhänger um sich, die den Begnadeten nur allzu bereitwillig die Schuld an allem Unglück gaben, das sie in ihrem Leben erdulden mussten.
Hassan erinnerte sich noch gut daran, wie besorgt sein Vater gewesen war, als aus allen Winkeln des Königreichs – sogar aus Nasira selbst – Nachrichten von Übergriffen auf Begnadete den Palast erreichten. Die Angreifer rechtfertigten ihre Taten stets auf dieselbe Weise: Der Hierophant hätte ihnen aufgetragen, den Dorftempel zu entweihen. Der Hierophant hätte ihnen aufgetragen, das Haus des Heilers niederzubrennen. Der Hierophant hätte sie entsendet, um die Welt von den Begnadeten zu reinigen.
Der Hierophant.
»Du solltest mit den Akolythen aus Herat sprechen«, sagte die Frau und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung des Tempels. »Sie haben auch schon anderen Geflüchteten weiterhelfen können und wissen bestimmt, ob deine Familie es hierhergeschafft hat.«
Hassan wollte ihr gerade danken, als ein ohrenbetäubendes Kreischen die Luft zerriss. Die Leute rundum erstarrten. Ohne nachzudenken, lief Hassan durch die Menge auf den Tempel zu. Zwei Jungen rannten in entgegengesetzter Richtung an ihm vorbei.
»Holt die Stadtwächter! Holt die Stadtwächter!«, schrie einer von ihnen.
Hassan beschleunigte seine Schritte. Als er den Fuß der Tempeltreppe erreicht hatte, sah er, dass sich dort eine kleine Menschenmenge gebildet hatte.
»Aus dem Weg, alter Mann!«, bellte eine Stimme von den oberen Stufen.
Hassan reckte den Kopf, um zu sehen, wem sie gehörte. Ungefähr zwei Dutzend Männer hatten sich entlang der Tempeltreppe aufgereiht. Sie waren mit Spitzhacken, Stöcken und Knüppeln bewaffnet und trugen Gewänder, deren Säume mit einem schwarz-goldenen Muster bestickt waren. Ihre in den Nacken geschobenen Kapuzen enthüllten kurz geschorene Haare. Derjenige, der gesprochen hatte, trug einen kurzen grauen Bart.
Zeugen – Anhänger des Hierophanten. Ihr bloßer Anblick brachte sein Blut zum Kochen und er schob sich wütend durch die Menge nach vorn. Dort angekommen, entdeckte er einen alten Mann auf dem obersten Treppenabsatz, der in den lindgrün-blassgoldenen Chiton eines Herati-Akolythen gehüllt war und sich den Zeugen entgegenstellte.
»Dieser Tempel ist ein heiliger Zufluchtsort für Notleidende.« Die Stimme des Akolythen war leiser als die des bärtigen Zeugen. »Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn im Namen eurer Lügen und eures Hasses schändet.«
»Die Einzigen, die hier Zuflucht suchen, sind die Begnadeten«, zischte der Zeuge. »Sie besudeln mit ihren widernatürlichen Fähigkeiten die heilige Energie der Welt.«
Die letzten Worte schienen sich an zwei der anderen Zeugen zu richten. Sie waren noch etwas jünger; der eine von ihnen klein gewachsen, mit einem rundlichen Gesicht, der andere groß und hager. Der kleinere umklammerte mit zitternder Hand eine Spitzhacke. Er wirkte fast ängstlich. Von dem großen dagegen ging eine geradezu unheimliche Ruhe aus, nur seine grauen Augen leuchteten vor Aufregung. Im Gegensatz zu der schwarz-goldenen Robe des Bärtigen trugen sie weiße Kutten, vermutlich waren sie so etwas wie Novizen.
Die restlichen Zeugen erwarteten offenbar von ihnen, dass sie sich hier bewährten.
Die Stimme des bärtigen Zeugen wurde lauter, als er fortfuhr. »Diese Stadt ist der Beweis für die Verderbtheit der Begnadeten. Männer, die sich selbst Priester nennen, verlangen von den Menschen dieser Stadt, ihnen Tribut zu zollen, während sie den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, sich ihren fleischlichen Begierden hinzugeben. Unter den Begnadeten gibt es einen Mörder, der nachts sein Unwesen treibt. Und nun strömen auch noch all diese feigen Begnadeten hierher, die vor dem Unbefleckten und seiner Wahrheit geflohen sind.«
Der Unbefleckte. Hassan hörte diesen Namen nicht zum ersten Mal. So nannten die Zeugen ihren Anführer.
»Der Tag der Vergeltung naht«, rief der bärtige Zeuge. »Bald schon wird es euren lasterhaften Königen und falschen Priestern wie dem Abschaum ergehen, der auf dem Thron von Herat saß. Und der Unbefleckte wird seine Getreuen belohnen, oh ja, er wird selbst diejenigen belohnen, die sich ihm erst jüngst angeschlossen haben. Jedem, der seinen unerschütterlichen Glauben an seine Botschaft unter Beweis stellt, wird die Ehre zuteil, sein Zeichen zu tragen.« Der Zeuge schob den Ärmel seines Gewands hoch. In seinen von Adern durchzogenen Handrücken war ein Symbol eingebrannt – ein Auge, dessen Pupille eine schwarze Sonne darstellte. »Zeigt ihm, dass ihr würdig seid, sein Zeichen zu tragen«, fuhr er an die beiden Novizen gewandt fort. »Sorgt dafür, dass diese Abarten der Natur seinen Namen fürchten. Haltet ihnen allen den Spiegel vor, sodass sie ihre eigene Verderbtheit darin sehen und keiner von ihnen mehr den Blick abwenden kann!«
Die anderen Zeugen folgten seinem Beispiel und schoben ihre Ärmel ebenfalls hoch, um das in ihre Haut eingebrannte Zeichen zu enthüllen.
Der alte Akolyth trat auf den Novizen mit dem rundlichen Gesicht zu. »Du musst das nicht tun«, sagte er sanft. »Der Hierophant hat dir Lügen gepredigt, aber niemand zwingt dich, sie dir anzuhören.«
Der Novize festigte den Griff um seine Spitzhacke, sein Blick zuckte vom Sprecher der Gruppe zu der Menge hinter ihm.
Der große, hagere Novize neben ihm sah den Akolythen voller Verachtung an. »Es sind deine Propheten gewesen, die Lügen gepredigt haben. Ich werde dem Unbefleckten meine Treue beweisen.« Er holte aus und schlug dem alten Mann mitten ins Gesicht. Der Hieb war so hart, dass er auf die Knie fiel.
Die Menge schrie entsetzt auf. Wutentbrannt stürmte Hassan die Stufen nach oben. Als der hagere Novize sich umdrehte und auf den Akolythen spuckte, sah Hassan rot. Er packte ihn an seiner Kutte und rammte ihm die Faust ins Gesicht.
Alle schienen die Luft anzuhalten, als der Novize rückwärtstaumelte.
Der bärtige Zeuge schob sich vor ihn und baute sich vor Hassan auf. »Im Namen des Hierophanten – wer bist du?«
»Jemand, den du lieber nicht reizen solltest«, entgegnete Hassan. »Wobei es dafür längst zu spät ist.«
Alles in ihm sehnte sich nach einem Kampf, und die Zeugen schienen mehr als bereit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Sie gehörten den Fanatikern an, die sein Königreich besetzt und seine Eltern eingesperrt hatten. Näher konnte er dem Hierophanten in diesem Augenblick nicht kommen.
Der hagere Novize trat auf ihn zu und verzog höhnisch den Mund. »Noch so ein dreckiger Begnadeter, der glaubt, er hätte das Recht, uns seiner durch Willkür errungenen Macht zu unterwerfen. Eure Propheten haben euch mit einem Fluch belegt, als sie euch eine Gnadengabe verliehen haben.«
Wut trieb Hassan die Röte ins Gesicht – und Scham. Weil Hassan nicht begnadet war. Was seinen Zorn auf die Zeugen und ihre verdrehte Ideologie aber nicht schmälerte. Es drängte ihn, den Novizen zu korrigieren – gleichzeitig gefiel es ihm, von ihm gefürchtet zu werden, indem er ihn in dem Glauben ließ, einer der auserwählten Begnadeten zu sein.
Die Begnadeten wurden in den Sechs Prophetischen Städten und über ihre Grenzen hinaus für ihre besonderen Fähigkeiten verehrt. Die allerersten Begnadeten hatten ihre mächtige Gabe von den Propheten verliehen bekommen. Obwohl jedes Jahr nur wenige Tausend von ihnen geboren wurden, hatten viele von ihnen einflussreiche Positionen inne.
Jede Königin und jeder König, der bisher auf dem Thron von Herat gesessen hatte, waren begnadet gewesen. Ausnahmslos. Hassan wartete immer noch darauf, dass sich in ihm eine der Vier Inneren Gaben offenbarte. Dass er mit der Gabe des Blutes heilen oder mit der Gabe des Sehens weissagen konnte. Dass er wie sein Vater mit der Gabe des Geistes Gegenstände anfertigen konnte, die von heiligem Esha durchdrungen waren und wundersame Funktionen erfüllten. Oder dass er wie seine Mutter mit der Gabe des Herzens im Dunkeln sehen und aus tausend Fuß Entfernung einen Herzschlag hören konnte.
Mit jedem Jahr, das vergangen war, hatte Hassan sich verzweifelter danach gesehnt. Die Gabe offenbarte sich den meisten im Alter von siebzehn Jahren, seine Eltern und Großeltern hatten ihre jedoch schon mit elf entdeckt. Mittlerweile war Hassan sechzehn. Seine Hoffnung, begnadet zu sein, hatte er schon vor einer ganzen Weile begraben, und nun hatte der Novize mit seinen Worten das niederschmetternde Gefühl, versagt zu haben, wieder an die Oberfläche gezerrt.
Blindwütig stürzte er sich auf den hageren Jungen, danach lechzend, ihm die Hände um die Kehle zu legen, aber bevor er ihn zu fassen bekam, wurde er zur Seite gestoßen und hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Hastig richtete er sich wieder auf und sah den anderen Novizen vor sich, der gerade zu seinem nächsten Schlag ausholte. Hassan duckte sich darunter hinweg und sah aus dem Augenwinkel, wie der Hagere den Akolythen an seinem Gewand packte.
»Ich werde dem Unbefleckten meinen unerschütterlichen Glauben an seine Botschaft beweisen!«, schrie er und zog ein Messer aus seinem Gürtel. »Die Propheten sind tot, und die Begnadeten werden ihnen folgen!«
»Nein!« Hassan lief los, stieß den Akolythen zur Seite und warf sich auf den hageren Novizen, der ihm jedoch geschickt auswich und seine blitzende Klinge nun auf ihn richtete.
Auch wenn Hassan die begnadete Schnelligkeit und Stärke seiner Mutter fehlte, hatte sie ihm immerhin beigebracht, sich selbst zu verteidigen. Er wirbelte herum und hob schützend einen Arm, um die Klinge abzuwehren. Sie fuhr direkt über dem Ellbogen in das ungeschützte Fleisch seines Oberarms. Ein scharfer Schmerz durchzuckte ihn, aber er ließ sich davon nicht beirren, sondern griff mit der anderen Hand nach dem Messer und zwang es nach oben von sich weg.
Warmes Blut tropfte auf seine Schulter und sein ganzer Arm pochte vor Schmerz, während er mit dem Novizen um das Messer rang, bis er es ihm schließlich, getrieben von all der Wut, die seit zwei Wochen in ihm gärte, aus den Fingern wrang.
Hassan schaute auf die Klinge in seiner Hand, überwältigt von dem Verlangen, sie dem anderen mitten ins Herz zu stoßen. Ihn mit seinem Blut für all den Schmerz bezahlen zu lassen, den seinesgleichen und ihr Anführer seinem Land angetan hatten.
Aber bevor er handeln konnte, bekam er von hinten einen heftigen Schlag versetzt. Das Messer fiel klirrend zu Boden und die Welt drehte sich, als er die Tempelstufen hinunterfiel. Schützend hob er die Arme über sich, denn schon kamen die anderen Zeugen auf ihn zu und schwangen drohend ihre Knüppel und Spitzhacken.
Doch die Hiebe blieben aus. Stattdessen hörte Hassan ein lautes Ächzen, gefolgt von drei dumpfen Aufprallgeräuschen.
Als er aufschaute, sah er nichts als ein gleißendes Licht.
Ein Mädchen stand zwischen drei niedergestreckten Zeugen auf den Stufen. Sie war unverkennbar eine Herati, kleiner als er, aber mit sehnigen Muskeln, schimmernder dunkelbrauner Haut und dichten schwarzen Haaren, die zu einem Knoten hochgesteckt und nach Art der Herati-Legionäre an den Seiten kurz geschoren waren. Erst jetzt wurde ihm klar, dass er vom Licht der Nachmittagssonne geblendet worden war, das sich in der Klinge des Krummschwerts in ihren Händen spiegelte.
Rechts und links von ihr standen zwei weitere Herati-Schwertkämpfer, die die hastig zurückweichenden Zeugen mit zusammengekniffenen Augen im Blick behielten.
»Verschwindet«, sagte die Legionärin. Ihre Stimme war fest und befehlsgewohnt. »Wenn ihr noch einmal einen Fuß in diesen Tempel setzt, wird das der letzte Ort sein, den ihr zu Gesicht bekommt.«
Die Zeugen, die ziemlich mutig gewirkt hatten, als sie es mit einem alten Akolythen und einer Schar unbewaffneter Flüchtlinge zu tun gehabt hatten, waren eindeutig weniger gewillt, sich mit drei begnadeten Herati-Legionären und ihren Krummschwertern zu messen. Sie flohen die Tempelstufen hinunter und warfen dabei immer wieder ängstliche Blicke über die Schulter.
Nur der bärtige Zeuge war zurückgeblieben und rappelte sich nun von den Stufen auf. »Der Tag der Vergeltung naht und keiner von euch wird ihm entkommen!«, stieß er an die Menge gewandt hervor, bevor er sich umdrehte und den anderen folgte.
»Du hast sie in die Flucht geschlagen«, sagte einer der beiden Schwertkämpfer zu dem Mädchen.
Sie schüttelte den Kopf. »Die kommen wieder, wie die Ratten. Aber wir werden gewappnet sein.«
»Ach, wen haben wir denn da?«, sagte der andere Schwertkämpfer und zeigte zum Fuß der Tempelstufen. »Die Stadtwache rückt an. Genau dann, wenn der Spuk vorbei ist.«
Hassan drehte sich um und sah die vertrauten hellblauen Uniformen der Stadtwache, die sich einen Weg durch die sich zerstreuende Menge bahnte. Zu Zeiten der Propheten hatten die Stadt und ihr Tempel unter dem Schutz der Paladine des Ordens des Letzten Lichts gestanden – den begnadeten Elitekämpfern, die den Propheten dienten. Doch zusammen mit den Propheten verschwand auch der Orden und seitdem oblag es den Stadtwächtern – einem zusammengewürfelten Haufen unbegnadeter Söldner –, Pallas Athos zu beschützen.
»Kommst du zurecht?«, fragte die Herati-Legionärin.
Hassan brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass die Frage an ihn gerichtet war. Er wandte sich ihr zu und folgte ihrem Blick, der auf seinen blutverschmierten Arm gerichtet war.
»Bloß ein Kratzer«, antwortete er. Sein Zorn hatte den Schmerz in Schach gehalten, aber beim Anblick der Wunde wurde ihm plötzlich flau und sein Kopf begann zu pochen.
»Das eben war nicht sonderlich klug von dir.« Sie steckte ihr Krummschwert mit einer einzigen fließenden Bewegung in den Gürtel zurück. »Nicht klug, aber mutig.«
Hassans Magen schlug einen kleinen Salto.
»Bist du neu im Lager?«, fragte sie und neigte den Kopf zur Seite. »Ich habe dich noch nie hier gesehen.«
»Ich bin kein Geflüchteter«, erklärte er schnell. »Ich bin Schüler der Akademie.«
»Ein Schüler«, sagte das Mädchen nachdenklich. »Ist die Akademie nicht ziemlich weit von hier entfernt?«
Der alte Akolyth tauchte neben Hassan auf und bewahrte ihn davor, sich um Kopf und Kragen zu reden.
»Emir!«, rief das Mädchen. »Du bist doch hoffentlich nicht verletzt?«
Der Akolyth winkte ab. »Keine Sorge, Khepri, mir geht es bestens.« Er sah Hassan an. »Ich glaube, du hast in dem Handgemenge vorhin etwas verloren«, sagte er und streckte die Hand aus.
»Mein Kompass!« Hassan griff danach.
»Die außergewöhnliche Richtung, in die seine Nadel zeigt, ist mir sofort aufgefallen«, sagte Emir. »Es ist der Leuchtturm von Nasira, habe ich recht?«
Hassan nickte langsam. Der Leuchtturm war das Symbol von Nasira der Weisen, der Prophetin, nach der die Hauptstadt von Herat benannt worden war und deren Weissagung zu ihrer Gründung geführt hatte.
Hassans Vater hatte ihm den Kompass an seinem sechzehnten Geburtstag geschenkt. Er konnte sich noch genau an das erinnern, was er damals zu ihm gesagt hatte – er wisse, dass er bei Hassan in guten, sicheren Händen sei, so wie auch das Königreich bei ihm in guten, sicheren Händen sein würde, wenn seine Zeit gekommen war. Damals hatte Hassan die Hoffnung, seinem Vater eines Tages auf den Thron von Herat zu folgen, bereits aufgegeben.
»So weit wird es nicht kommen«, hatte er unglücklich entgegnet. »Ich bin nicht … ich habe keine Gabe. Die Gelehrten sagen zwar, es bleibt noch genügend Zeit, in der meine Gabe sich offenbaren kann, aber wir wissen beide, dass sie sich irren.«
Sein Vater hatte mit dem Daumen die Umrisse des Leuchtturms nachgezeichnet, die in den Kompass eingraviert waren. »Als die Prophetin Nasira diese Stadt gegründet hat, hatte sie eine Vision von diesem Leuchtturm als Symbol der Gelehrsamkeit und Vernunft. Sie sah, dass die Linie der Seif über das Königreich von Herat regieren wird, solange der Leuchtturm von Nasira steht. Schon morgen könnte deine Gabe sich offenbaren. Oder vielleicht nie. Aber ganz gleich, wie es kommt, du bist und bleibst mein Sohn. Der Erbe der Seif-Linie. Solltest du jemals den Glauben an dich selbst verlieren, wird dieser Kompass dich zu ihm zurückführen.«
Die Worte seines Vaters hallten in seinem Kopf wider, als Hassan den Kompass einsteckte und dem aufmerksamen Blick des Akolythen begegnete. War es schlichtes Interesse, das er in seinen Augen las, oder wusste er mehr, als er zu erkennen gab? Hatte er ihn womöglich erkannt?
»Du bist aus Nasira?«, fragte das Herati-Mädchen.
»Der Kompass gehört meinem Vater«, antwortete er. Das war keine Lüge. »Er ist dort geboren.«
Beim Gedanken an seinen Vater wurde ihm das Herz schwer. Was würde er sagen, wenn er wüsste, wie sein Sohn sich heute verhalten hatte? Wie er sich von seinem Zorn hatte leiten lassen. Heiße Scham durchflutete ihn.
»Ich … ich sollte jetzt gehen.«
»Bevor du gehst, solltest du lieber zu einem Heiler gehen«, sagte das Herati-Mädchen. »Hier im Lager gibt es welche. Sie haben bestimmt nichts dagegen, sich deinen Arm anzuschauen, erst recht nicht, wenn sie erfahren, wie du …«
»Nein«, unterbrach Hassan sie. »Danke. Das ist sehr freundlich, aber ich muss wieder zurück.«
Es war kühler geworden, schon beinahe Abend, und Hassan wusste, dass ihm nicht einmal mehr eine Stunde blieb, bis seine Tante ihn zum Essen rufen und bemerken würde, dass er nicht in seinen Gemächern war. Er musste es vorher zurück zur Villa schaffen und seine Wunde selbst versorgen.
»Vielleicht kommst du ja bald wieder«, sagte der Akolyth mit einem warmen Lächeln.
»Ja«, sagte Hassan und sah dabei das Herati-Mädchen an. »Ich meine … ich werde es versuchen.«
Er wandte sich eilig zum Gehen, ließ den Tempel hinter sich und kehrte zur Heiligen Straße zurück. Doch als er das Tor erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um und blickte zur Agora und dem notdürftig errichteten Lager zu Füßen des Tempels von Pallas hinauf. Hinter ihm versank die Sonne im glitzernden Türkis des Meeres, und vor ihm wurden die ersten Lagerfeuer entzündet, deren Rauch wie Gebete zum Himmel aufstiegen.
KAPITEL 3
ANTON
In der Herberge Gärten von Thalassa musste irgendetwas vorgefallen sein.
Anton war es zwar gewohnt, mehr patrouillierende Stadtwächter zu sehen, sobald er eines der Tore passierte, die die Unterstadt von der Oberstadt trennten, aber heute wimmelte es hier geradezu von ihren hellblauen Uniformen, auf denen ein weißer Olivenbaum prangte. Zu Dutzenden standen sie auf dem von Schankstuben, Gasthäusern und Badehäusern gesäumten Elea-Platz, und vor dem Thalassa hatte sogar ein ganzer Trupp Stellung genommen.
Anton bahnte sich einen Weg an aufgeregt tuschelnden Ladenbesitzern und anderen neugierigen Schaulustigen vorbei zu einer kleinen Gruppe von Leuten, die die gleiche olivgrüne Livree wie er trugen.
»Da bist du ja endlich!«, rief eine fröhliche Stimme, und im nächsten Moment zog eine Hand Anton durch das Gewühl zu einem Seiteneingang der Herberge. »Du hast dir einen schrecklichen Tag ausgesucht, um zu spät zur Arbeit zu kommen.«
»Cosima, warte.« Anton sah die junge Frau, die sich wie er als Bedienstete in den Gärten von Thalassa verdingt hatte, blinzelnd an. »Was ist denn passiert?«
Cosima nahm einen Zug von ihrem Zigarillo und blies ihm eine dicke, nach Baldrian duftende Rauchwolke ins Gesicht. Ihre hellbraunen Augen funkelten sensationslüstern. »Es ist jemand umgebracht worden.«
»Was … hier?«, sagte Anton fassungslos. »Ein Gast?«
Cosima nickte und schnippte Asche von ihrem Zigarillo. »Ein Priester. Armando Curio.«
»Wer?«
Sie verdrehte die Augen. »Natürlich, du bist ja nicht von hier, hatte ich jetzt glatt vergessen. Curio ist einer der Priester des Tempels von Pallas gewesen, dem hier in der Gegend aber ein gewisser Ruf vorausgeeilt ist.«
Den Gärten von Thalassa waren Angehörige der Priesterkaste mit »einem gewissen Ruf« nicht fremd. Seit der Stadtgründung war das Betreiben von Spielhäusern, Spelunken und anderen Lasterhöhlen ausschließlich in der Unterstadt, wo auch Anton sein Quartier hatte, erlaubt. Die vorwiegend von Priestern und höhergestellten Bürgern bewohnte Oberstadt sollte ein leuchtendes Vorbild an Tugendhaftigkeit und Frömmigkeit sein. Möglich, dass dem einst so gewesen war. Doch mittlerweile schien die Priesterkaste nur noch daran interessiert zu sein, sich zu bereichern und in feudalen Herbergen wie dem Thalassa – in denen die Fassade der Ehrbarkeit aufrechterhalten wurde – ihren Lastern hinzugeben.
Cosima nahm einen weiteren Zug von ihrem Zigarillo. »Ist wohl keine große Überraschung, dass er ausgewählt wurde.«
»Was meinst du mit ›ausgewählt‹?«, fragte Anton stirnrunzelnd.
»Es geht das Gerücht …«, begann sie in dem gedehnten Tonfall, den sie immer anschlug, wenn sie ihn dazu bringen wollte, an ihren Lippen zu hängen, »… dass die Blasse Hand ihn auf dem Gewissen hat.«
»Sagt wer?«
Cosima wedelte flüchtig mit der Hand durch den Rauch ihres Zigarillos. »Stefanos hat erzählt, er habe gesehen, wie sie seine Leiche rausgetragen haben. Mit einem blassen Handabdruck auf der Kehle, genau wie bei den Toten in Tarsepolis.«
»Stefanos ist ein Schwachkopf«, erwiderte Anton, bekam aber trotzdem eine Gänsehaut. Dies war das erste Mal, dass er in Pallas Athos von der Blassen Hand hörte, doch als er noch in der Nähe von Tarsepolis gewohnt hatte, hatten Gerüchte über mysteriöse Todesfälle die Runde gemacht, deren Opfer angeblich von einem blassen Handabdruck gezeichnet gewesen waren. Und in Charis sollte es bereits vor knapp fünf Jahren zu ganz ähnlichen Vorfällen gekommen sein.
Worüber sich alle einig waren: Die Blasse Hand tötete nur diejenigen, die es verdient hatten.
»Was glaubst du, warum sie ausgerechnet ihn ausgewählt hat?«, fragte er. »Was hat er getan?«
»Das Übliche«, antwortete Cosima.
Soll heißen, Reichtümer aus den Tempeln der Stadt plündern und damit rauschende Orgien feiern, bei denen die Priester sich der Völlerei hingaben und mit allen Männern und Frauen Unzucht trieben, die ihnen gerade über den Weg liefen.
»Und noch viel schlimmere Dinge«, fuhr sie fort. »Curio hatte die Gabe des Geistes und soll ein besonderes Talent für Alchemie gehabt haben. Nur dass er keine Heilmittel oder Glückstinkturen herstellte. Seine Spezialität war den Gerüchten nach ein Trank, der gefügig macht. Er soll in der Unterstadt immer wieder nach Jungen und Mädchen gesucht haben, die er damit köderte, dass sie auserwählt seien, im Tempel zu dienen. Dann brachte er sie in sein Privatgemach im Thalassa, verabreichte ihnen den Trank und … tja, den Rest kannst du dir denken.«
Antons Magen krampfte sich zusammen. Er wusste über die grauenvollen Dinge Bescheid, die mächtige Männer wehrlosen Kindern antun konnten.
»Was flüstert ihr beiden da?«
Anton fuhr herum und sah Stefanos auf sie zukommen. Stefanos, ein Wichtigtuer mit einfältigem Lächeln, war einer der Leibdiener im Thalassa. So beliebt er bei den Gästen zu sein schien, so inbrünstig verabscheute ihn der Rest der Bediensteten. Ständig lungerte er in irgendeiner Küche herum und verlangte, die Speisen vorzukosten – angeblich, um sich zu vergewissern, dass sie die Erwartungen der Gäste erfüllten –, oder prahlte lautstark damit, welchem Priester oder reichen Kaufmann er an diesem Abend zu Diensten war. Das Einzige, was für ihn sprach, war seine Neigung, all seine Münzen an Anton zu verlieren, wenn die Dienerschaft nach getaner Arbeit ein paar Runden Canbarra spielte.
Es überraschte Anton nicht, dass Stefanos die Ermordung des Priesters zum Anlass nahm, sich mal wieder wichtigzumachen.
Neugierig war er trotzdem. »Cosima hat erzählt, dass du den Leichnam des Priesters gesehen hast?«
Stefanos volle Lippen verzogen sich zu einem überheblichen Grinsen. »So, hat sie das?«
»Und?« Anton zog die Brauen hoch. »Hast du ihn gesehen?«
Stefanos schlang ihm vertraulich einen Arm um die Schultern. »Ich habe in meinem Leben schon eine Menge schreckliche Dinge gesehen, das kannst du mir glauben. Aber das? Hier, in der Herberge? Das war beim Tarseis noch mal mit Abstand das Schaurigste, was mir jemals untergekommen ist. Der Mann hatte keinen einzigen Kratzer. Eine einzige Berührung hat gereicht, um ihn …« Er fuhr sich mit dem Finger über die Kehle. »Wenn du mich fragst … vielleicht ist es langsam an der Zeit, dass wir endlich die Augen aufmachen und erkennen, wie gefährlich die Begnadeten wirklich sind.«
Anton unterdrückte ein Schaudern.
»Du bist ein Schwachkopf«, zitierte Cosima Antons Worte von eben.
Stefanos warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Wenn du es selbst gesehen hättest, dann wüsstest du, wovon ich rede.«
»Du klingst schon genauso wie diese kapuzentragenden Fanatiker«, gab Cosima zurück und stieß erneut den Rauch ihres Zigarillos aus. »Fehlt nur noch, dass du dir wie sie die Haare scheren lässt.«
»Seit die Propheten verschwunden sind, gibt es niemanden mehr, der den Begnadeten ihre Grenzen zeigt«, sagte Stefanos. »Du weißt so gut wie ich, was sich die Priester hier alles rausnehmen, nur weil sie begnadet sind und sich deswegen einbilden, sie wären was Besseres als wir. Und jetzt treibt auch noch jemand wie diese Blasse Hand in unseren Straßen ihr Unwesen und tötet mit ihren widernatürlichen Fähigkeiten, wen sie will.«
»Was denn nun?«, erwiderte Cosima herausfordernd. »Willst du damit sagen, dass Curio den Tod verdient hat oder dass die Blasse Hand aufgehalten werden muss?«
Stefanos Augen funkelten. »Ich will damit sagen, dass die Zeugen vielleicht recht haben und es an der Zeit ist, dass die Welt endlich von den Begnadeten befreit wird.«
Anton schnürte es die Kehle zu. Stefanos ging ihm auf die Nerven, Angst hatte er vor ihm aber noch nie gehabt. Jetzt allerdings fröstelte es ihn beim Anblick seiner von Hass verzerrten Miene. Er wusste nicht – konnte nicht wissen –, dass Anton zu denen gehörte, die er und die Zeugen am liebsten ausgetilgt sehen würden. Dass Anton – genau wie die Priester von Pallas Athos und die Blasse Hand – begnadet war.
Cosima boxte Stefanos in die Schulter.
»He!«, rief Stefanos und hielt sich den Arm. »Wieso schlägst du mich?«
»Damit du dein dummes Mundwerk hältst«, entgegnete Cosima. »Was kommt als Nächstes? Willst du einen Tempel niederbrennen, um dem Hierophanten deine Treue zu beweisen? Es heißt, dass jeder, der sich den Zeugen anschließen will, zeigen muss, dass er nicht davor zurückschreckt, mit Gewalt gegen die Begnadeten vorzugehen.«
»Sie setzen sich gegen die Begnadeten zur Wehr«, sagte Stefanos. »Irgendjemand muss es ja tun.«
»Ach ja?«, sagte Cosima. »Und was ist mit dieser Geschichte, die Vasia uns letzte Woche beim Canbarra erzählt hat? Von diesem Mann, der mitten in der Nacht seine eigenen begnadeten Kinder niedergemetzelt hat, um von den Zeugen aufgenommen zu werden? Oder bist du vielleicht der Meinung, dass solche Kinder es nicht anders verdient haben, weil sie begnadet sind?«
Stefanos schüttelte geringschätzig den Kopf. »Das ist doch bloß ein Gerücht. Nichts davon ist wirklich passiert.«
»Ich bitte dich«, entgegnete Cosima. »Der Hierophant bringt seine Anhänger dazu, sich ein Auge in die Haut einbrennen zu lassen, und redet ihnen ein, die Begnadeten würden die Welt verderben. Willst du mir ernsthaft erzählen, diese Fanatiker wären zu so einer Gräueltat nicht fähig?«
Stefanos winkte bloß verächtlich lächelnd ab und marschierte zu einer anderen Gruppe Bediensteter, um sich mit seiner Geschichte aufzuspielen. Als er weg war, warf Cosima Anton einen Blick zu. Auf ihrem scharf geschnittenen Gesicht lag ein besorgter Ausdruck.
Anton setzte ein unbekümmertes Lächeln auf. »Dieser Kerl ist wirklich ein Schwachkopf.«
»Sieht ihm ähnlich, dass er den Zeugen den ganzen Mist abkauft, den sie predigen«, sagte Cosima und schnippte den Stummel ihres Zigarillos weg. »Sie sind genau wie er – denken sich irgendeinen Pferdemist aus, um Beachtung zu finden, und tun alles, um sich bei denen einzuschmeicheln, die behaupten, sie hätten die Macht.«
»Genau.« Anton lachte. Es klang aufgesetzt, aber Cosima schien es nicht zu bemerken.
»Na los.« Sie gab ihm einen spielerischen Klaps auf den Hinterkopf. »Lass uns reingehen, bevor wir eine Strafpredigt bekommen. Besser gesagt, bevor ich eine Strafpredigt bekomme. Dich erwischt es ja anscheinend nie.«
Anton duckte sich unter ihrer Hand weg. »Das liegt daran, dass ich so beliebt bin.«
»Keine Ahnung, warum.«
Das geschäftige Geschirrklappern der Essensvorbereitungen für den Abend begleitete sie auf ihrem Weg durch die Küche zu ihrem Platz an den Spülbecken. Anton drehte den Kupferhahn auf und ließ warmes Wasser einlaufen, während er versuchte, die Blasse Hand und die Zeugen aus seinem Kopf zu verbannen. Sie hatten nichts mit ihm zu tun. Niemand in dieser Stadt wusste, dass er begnadet war. Es gab keinen Grund, warum sich daran irgendetwas geändert haben sollte.
»Da bist du ja, Anton!«, flötete eine Stimme neben ihm. »Ich habe auf dich gewartet.«
»Oh, wirklich?«, flötete Cosima zurück.
Darius’ Pausbacken färbten sich dunkelrot. Er arbeitete noch nicht lange im Thalassa, war der Jüngste in der Dienerschaft und hatte sich umgehend an Antons Rockzipfel gehängt. Was Anton nicht im Geringsten gestört hätte, wenn Darius sich nicht jedes Mal, wenn er in seiner Nähe war, aus unerfindlichen Gründen in einen schrecklichen Tollpatsch verwandeln würde. Es verging kaum ein Tag, ohne dass Darius in Antons Gegenwart ein Tablett fallen ließ oder gegen einen Tisch lief.
»Ich … ich meine nur, weil ein Gast hier ist …«, stammelte Darius und wich Antons Blick aus, »der nach dir gefragt hat.«
»Ein Gast?«, rief Cosima entzückt. »Der nach Anton gefragt hat? Was für ein Gast?«
Abgesehen von den Stammgästen, die gelegentlich hierherkamen und ein bisschen mehr als nur ein Abendessen wollten, war noch nie jemand im Thalassa gewesen, um Anton zu besuchen. Zur grenzenlosen Enttäuschung Cosimas, für die es nichts Schöneres gab, als ihre Nase in die Angelegenheiten anderer zu stecken.