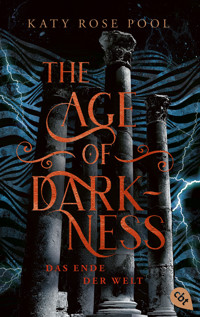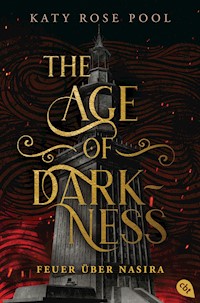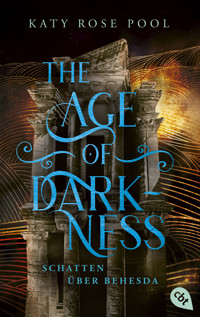
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Age-of-Darkness-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Ende der Welt beginnt
Die fünf Helden haben einen ersten Sieg errungen: Der Letzte Prophet ist gefunden. Doch er sieht noch keinen Weg, die Dunkelheit aufzuhalten. Jude ist sein machtvolles Schwert genauso abhandengekommen wie seine mächtige Gabe, und Anton ist nicht bereit, sich den Regeln des Ordens zu unterwerfen. Ephyra schreckt vor nichts zurück, um den Eleasarkelch zu finden und ihre Schwester Beru zu retten, und Prinz Hassan geht einen gefährlichen Pakt ein, um den Thron Herats zurückzuerobern und sein Volk zu befreien.
Das Schicksal führt sie alle an einem Ort zusammen, neue Allianzen werden gebildet – und das Ende der Welt beginnt.
Katy Rose Pool begeistert ihre Leser*innen mit einem atemberaubenden Plot und großartigem Worldbuilding. Vor allem aber überzeugen ihre wunderbar menschlichen Figuren. Perfekte Lektüre für Fans von Leigh Bardugo und Sarah J. Maas.
Alle Bände der »Age of Darkness«-Reihe:
The Age of Darkness – Feuer über Nasira (Band 01)
The Age of Darkness – Schatten über Behesda (Band 02)
The Age of Darkness – Das Ende der Welt (Band 03)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Ähnliche
KATY ROSE POOL
SCHATTEN ÜBER BEHESDA
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Galić
Für Lucy, die gesagt hat: Love is the message.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Text © 2020 Katy Pool
© 2021 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Originalausgabe erschien erstmals unter dem Titel »As the Shadow Rises. An Age of Darkness Novel« bei Henry Holt and Company, New York.
Henry Holt® is a registered trademark of Macmillan Publishing Group, LLC,
120 Broadway, New York, NY 10271
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Galić
Covergestaltung: semper smile
Covermotiv: semper smile, München Umschlagmotiv: © Shutterstock.com (matias planas; klyaksun; Vector_Artist; SeamlessPatterns; Marti Bug Catcher)
kk · Herstellung: UK
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-24096-7V003
www.cbj-verlag.de
I
GABE UND FEUER
KAPITEL 1
EPHYRA
Niemand in der rauchgeschwängerten Spielhöhle ahnte, dass eine Mörderin unter den Gästen war. Ephyra ließ den Blick über die Meute grölender Seeleute und Falschspieler wandern. Sie drängten sich um Tische, die mit Würfeln, Münzen und Karten übersät waren, und wenn sie rau lachten oder wüste Beschimpfungen ausstießen, blitzten im dämmrigen Licht ihre Goldkronen auf. Keiner nahm Notiz von ihr, und wäre sie hierhergekommen, um jemanden zur Strecke zu bringen, hätte sie ein leichtes Spiel gehabt.
Aber Ephyra war heute Abend nicht auf der Jagd nach einem Opfer. Sie war auf der Jagd nach Antworten.
Nachdem sie über eine Woche damit verbracht hatte, in jeder Spielhöhle und in jedem Lasterhaus von Tel Amot Gerüchten über den Meisterdieb nachzugehen, hatte sie von einer Frau, bei der sie auf dem Nachtmarkt Wein gekauft hatte, endlich einen Hinweis bekommen. Viel war es nicht, bloß ein Ort und ein Name – sie sollte in der Spelunke ZumLachenden Schakal nach Shara fragen.
Der Boden unter ihren Füßen klebte, als sie sich einen Weg zum Schanktresen bahnte und dabei Leuten auswich, die beim Kartenspielen in Streit geraten waren.
»Weißt du, wo ich meine Freundin Shara finde?«, fragte Ephyra den Kellner, der sich hinter dem Tresen aufrichtete und sie erwartungsvoll ansah. »Ich soll sie heute Abend hier treffen. War sie heute schon da?«
Der Kellner warf ihr einen ungerührten Blick zu. »Sehe ich vielleicht aus wie ein Botenjunge? Bestell was zu trinken oder verzieh dich.«
Zähneknirschend legte Ephyra zwei Kupfertugenden auf sein Tablett. »Also gut. Einen Palmwein.«
Der Kellner steckte die Münzen ein und verschwand im Hinterraum. Während sie ihm nachschaute, griff sie in ihre Tasche und tastete nach dem Tagebuch ihres Vaters. Sie hatte immer wieder über den Aufzeichnungen gebrütet und versucht, noch weitere Hinweise zu finden, abgesehen von dem kurzen, an ihren Vater gerichteten Brief auf der Rückseite der Karte, auf der vermutlich all die Orte verzeichnet waren, die er auf seiner Suche nach dem Eleasarkelch bereist hatte.
Demselben Artefakt, nach dem Ephyra schon seit einer Weile suchte. Das Einzige, was ihre Schwester retten konnte.
Sie hatte aufmerksam die Zeichnungen ihres Vaters und seine knappen, an den Rand der Seiten gekritzelten Notizen studiert. Besonders aufgefallen war ihr dabei nur eines – sechs Worte unter der Porträtskizze eines gut aussehenden Mannes.
Der Meisterdieb besitzt den Schlüssel dazu.
Während der letzten Woche hatte sie herausgefunden, dass der »Meisterdieb« ein in Ungnade gefallener Gelehrter der Großen Bibliothek von Nasira war, der seine Studien aufgegeben hatte, um nach einem legendären Artefakt zu suchen – dem Weißen Schild von Pendaros. Den Namen Meisterdieb hatte er sich selbst gegeben, nachdem ihm klar geworden war, dass er ein außergewöhnliches Talent dafür besaß, sagenumwobene Schätze aufzuspüren. Es ging das Gerücht, dass er und seine Gefolgsleute neben dem Weißen Schild noch eine ganze Reihe anderer legendärer Artefakte gestohlen hatten, darunter den Rubinroten Schleier, die Flammenpfeile von Lyria und das Wüstenauge.
Aber nicht den Eleasarkelch, wie dem Brief aus dem Tagebuch ihres Vaters zu entnehmen war.
Ephyra wurde unsanft aus ihren Gedanken gerissen, als der Kellner geräuschvoll den Wein vor ihr abstellte. Das Glas hatte Scharten.
Er deutete mit dem Kinn über Ephyras Schulter. »Deine Freundin ist da drüben.«
Das Geräusch von splitterndem Holz ließ Ephyra herumfahren. Kein zehn Fuß entfernt stand ein Mädchen mit dem Rücken zu einem der Kartentische. An ihren Handgelenken klirrten etliche Armreifen und über die eine Schulter fiel ihr ein locker geflochtener dunkler Zopf. Rechts und links von ihr standen zwei Männer, zu deren Füßen die Reste eines zertrümmerten Stuhls lagen.
»Ich hätte wissen sollen, dass man nichts auf das Wort eines winselnden Schwachkopfs wie dir geben darf«, schimpfte das Mädchen. »Du gibst mir jetzt sofort mein Geld zurück oder ich werde …«
»Oder du wirst was?« Der Mann grinste höhnisch. »Uns auf die Nerven gehen, bis wir …«
Das Mädchen verpasste ihm einen Fausthieb ins Gesicht, packte ihn am Kragen und zog ihn zu sich heran. »Gib. Mir. Mein. Geld. Zurück.«
»Das wirst du mir büßen«, knurrte er und gab ihr eine schallende Ohrfeige, die sie nach hinten taumeln ließ. Der andere Mann rückte ihr währenddessen bedrohlich näher.
Ephyra fluchte leise. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn die Spur, die sie verfolgte, sie nicht zu einer ausgemachten Idiotin geführt hätte. Sie hängte sich die Tasche quer über die Schulter, trat zwischen Shara und ihre Kontrahenten und schob das Mädchen hinter sich.
»Zeit, nach Hause zu gehen«, sagte Ephyra zu den Männern.
»Wer in Behesdas Namen bist du denn?«, gab der eine finster zurück.
»Genau!«, stimmte das Mädchen mit ein. »Wir sind hier gerade mitten in einer Verhandlung! Also, was willst du?«
»Jetzt, in diesem Moment? Dich vor einer möglichen Verstümmelung bewahren«, antwortete Ephyra. »An deiner Stelle würde ich also lieber den Mund halten.«
»Komm uns nicht in die Quere und schwirr ab.« Der Mann fuhr seine fleischige Pranke aus, um sie wegzustoßen.
Ephyra duckte sich unter seiner Hand weg und hielt ihm ihren Dolch an die Kehle, bevor er auch nur blinzeln konnte. »Ich schlage vor, du kommst mir nicht in die Quere.«
Sie hielt dem verblüfften Blick des Mannes stand, wartete ab, was er tun würde. Ob er glaubte, dass sie nur bluffte, und es darauf ankommen lassen würde, oder ob ihm die bloße Existenz des Dolchs reichte, um das Risiko nicht einzugehen.
Natürlich war es nicht der Dolch, wovor er Angst haben sollte. Doch das konnte er nicht wissen.
Er hob resigniert die Hände. »Von mir aus.« Dann setzte er Shara den Finger auf die Brust. »Aber wir zwei sind noch nicht fertig miteinander.«
Ephyra wartete noch einen kurzen Moment ab, dann griff sie Sharas Arm und zog sie von den Männern fort.
Sie waren kaum ein paar Schritte weit gekommen, da schubste Shara sie ohne Vorwarnung in einen der Kartentische. Ephyra stieß hart mit der Hüfte gegen die Tischkante und ruderte mit den Armen, um ihr Gleichgewicht nicht zu verlieren.
»Sag mal, hast du –« Der Rest der Schimpftirade blieb Ephyra im Hals stecken, als sie sah, dass der Mann, den sie bedroht hatte, ein abgebrochenes Stuhlbein in der Hand hielt. Shara hatte Ephyra offenbar aus dem Weg gestoßen, damit sein Schlag sie nicht treffen konnte.
»Ich hätte wissen müssen, dass du auch in einer Rauferei eine hinterhältige Ratte bist«, zischte Shara. »Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Behalt das Geld. Du bist meine Zeit nicht wert.«
Sie ging langsam rückwärts, bis sie gut zehn Schritte zwischen sich und die Männer gelegt hatte, dann drehte sie sich um und rannte los.
Ephyra setzte ihr nach und holte sie kurz vor dem Hinterausgang ein.
»Kleiner Tipp fürs nächste Mal«, sagte Shara. »Kehr solchem Gesindel niemals den Rücken zu.«
Bei jedem Schritt klirrten ihre Armreifen aneinander. Erst jetzt bemerkte Ephyra auch die glänzenden Ringe an ihren Fingern und die Perlenketten um ihren Hals.
»Laufen deine Verhandlungen immer so ab?«
»Du bist anscheinend neu hier«, entgegnete Shara. »Also, was willst du?«
Dann würde sie eben sofort zur Sache kommen. »Ich suche nach dem Meisterdieb. Mir wurde gesagt, dass du mir vielleicht weiterhelfen kannst.«
Sharas Brauen schossen in die Höhe. »Tatsächlich?«
»Und? Kannst du?«
Shara runzelte die Stirn. »Es gibt nur zwei Gründe, warum du nach dem Meisterdieb suchen könntest.« Sie hob den Daumen. »Entweder du suchst nach etwas oder«, sie nahm den Zeigefinger dazu, »dir ist was gestohlen worden. Was von beiden ist es?«
»Dann kennst du ihn also.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Ist aber so«, gab Ephyra zurück. »Kannst du mich zu ihm bringen?«
Shara unterzog sie einer ausgiebigen Musterung, ließ den Blick über ihre abgetragenen Stiefel und den fadenscheinigen Umhang wandern und blieb an der Narbe auf ihrer Wange hängen. Hector Navarros Abschiedsgeschenk, kurz bevor sie ihn getötet hatte. »Kommt drauf an.«
»Auf was?«
»Ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen.«
Ephyra lief ein Schauder über den Rücken. »Was für einen Preis?«
»Das, was jeder Dieb will.«
Ephyra wurde schwer ums Herz. »Ich habe nicht viel Geld.«
»Kein Geld«, sagte Shara. »Etwas Wertvolles.«
»Tja, damit kann ich leider auch nicht dienen.«
»Doch, bestimmt«, erwiderte Shara. »Jeder besitzt etwas Wertvolles. Wertvoll muss es nur für den sein, der es aufgibt.«
Ephyra dachte darüber nach, was sie besaß. Es waren nur wenige Habseligkeiten. Von dem Tagebuch ihres Vaters konnte sie sich nicht trennen, da es vielleicht noch mehr unentdeckte Hinweise enthielt. Ihren Dolch wollte sie genauso wenig hergeben. Schon jetzt hatte Tel Amot sich als nicht vertrauenswürdige Stadt erwiesen, und wenn sie hier unbeschadet wieder verschwinden wollte, und zwar ohne irgendwelche neuen Opfer der Blassen Hand zu hinterlassen, brauchte sie etwas, um sich zu verteidigen. Blieb nur noch eine Möglichkeit, doch bei dem Gedanken, sich davon zu trennen, krampfte sich Ephyras Herz zusammen.
»Hier.« Sie streifte das Armband von ihrem Handgelenk. Es war das letzte Schmuckstück, das Beru angefertigt hatte, bevor sie Pallas Athos verlassen hatte. Aufgefädelte Tonscherben mit einem kleinen Glaskorken in der Mitte, den Ephyra ihr von einem ihrer nächtlichen Streifzüge mitgebracht hatte. Sie hatte das Armband unter dem zertrümmerten Tisch in ihrem damaligen Unterschlupf gefunden, der Kammer in der Krypta des niedergebrannten Mausoleums. Sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie Panik in ihr aufgestiegen war, als ihr klar geworden war, dass Beru fort war. Dieselbe Panik schluckte sie nun hinunter, als Shara das Armband nahm und es um ihren schlanken Zeigefinger im Kreis drehte.
»Was?«, sagte Ephyra ungeduldig. »Brauchst du vielleicht auch noch eine rührselige Geschichte dazu?«
Shara hob den Blick. »Nein. Solange es eine rührselige Geschichte gibt. Komm mit.«
Sie öffnete die Hintertür, die in einen von Dattelpalmen gesäumten Hof führte. Ein paar Gestalten lungerten dort herum, einige waren eindeutig zu betrunken, um sich noch auf den Beinen zu halten. Shara führte sie vom Hof weg und einen Pfad entlang.
»Was hast du ausgefressen?«, fragte Shara im Plauderton. Sie fuhr sich mit dem Finger dort über die Wange, wo Ephyras Narbe war. »An so was erkennt man hier in der Gegend von Behesda Halunken.«
»Ich bin nicht aus Behesda.« Jetzt verstand Ephyra die vielen argwöhnischen Blicke, die man ihr zugeworfen hatte. Bis jetzt hatte nur noch niemand den Mut gehabt, sie darauf anzusprechen.
Sie erreichten das Ende des Pfads, von wo ein paar Stufen unter die Erde führten.
»Wir sind da.« Shara deutete auf die Treppe.
Ephyra blieb zögernd stehen.
»Ach, komm schon«, sagte Shara und verdrehte die Augen. »Du bist schließlich die mit dem Dolch.«
Ephyra stieg hinab und Shara folgte ihr. Am Fuß der Treppe befand sich eine geöffnete, leicht schief in den Angeln hängende Holztür, hinter der ein rechteckiger Raum mit einer niedrigen Decke lag. Ein Schreibtisch und ein Ledersessel in der Mitte des Raums waren von zahlreichen Regalen umgeben, in denen sich Bücher und alles Mögliche stapelten.
Außer ihnen schien niemand da zu sein.
Ephyra trat ein und schaute sich um, während Shara die Tür hinter ihnen schloss. »Wie lange müssen wir wohl warten?«
»Worauf?« Shara ging um den Schreibtisch herum und schenkte sich aus einer Kristallkaraffe einen Becher Wein ein.
»Du hast gesagt, dass du mich zum Meisterdieb bringst.«
»Ach ja, richtig«, sagte Shara, einen gelangweilten Unterton in der Stimme. Sie setzte sich in den Ledersessel und legte ihre schweren Stiefel auf die Tischplatte. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
Ephyra stemmte die Hände auf den Tisch und beugte sich drohend zu Shara vor. »Du verschwendest meine Zeit. Ich weiß, dass du nicht der Meisterdieb bist. Der Meisterdieb ist ein Mann. Ein ehemaliger Gelehrter der Großen Bibliothek von Nasira.«
»Der Meisterdieb war ein Mann«, sagte Shara und hielt ihr Handgelenk ins Licht, als würde sie Ephyras Armband bewundern. »Jetzt ist er tot.«
»Nein.« Ephyra stieß das Wort mit mehr Nachdruck aus, als sie beabsichtigt hatte. »Das kann nicht sein. Ich muss mit ihm sprechen. Es ist wichtig.«
»Oh, es ist wichtig«, sagte Shara. »Warum hast du das nicht gleich gesagt? Dann werde ich ihn mal schnell ausgraben gehen, damit wir ihn wiederauferstehen lassen können.«
Ephyra sog erschrocken die Luft ein. Wusste Shara etwa aus irgendeinem Grund, was Ephyra war? Dass sie die Toten wiederauferstehen lassen konnte und es bereits getan hatte? Aber das war unmöglich.
»Wenn der Meisterdieb tot ist«, erwiderte Ephyra, nachdem sie ihre Fassung wiedergefunden hatte, »warum nennst du dich dann so?«
Shara zuckte mit den Achseln. »Mir ist kein besserer Name eingefallen.«
Ephyra zog eine Braue hoch.
»Die Wahrheit?«, fragte Shara. »Der Meisterdieb hat einen gewissen Ruf. Worüber du dir eindeutig im Klaren bist, sonst würdest du nicht so verzweifelt nach ihm suchen. Nach seinem Tod dachte ich, dass es doch eine Schande wäre, diesen Ruf mit ihm sterben zu lassen. So was ist ein Riesenvorteil – nützliche Kontakte, Abschreckung und dergleichen.«
»Du hast dich einfach als er ausgegeben?«, fragte Ephyra. »Hast in seinem Namen legendäre Artefakte gestohlen?«
»So in etwa.«
»Hast du ihn gekannt?«
Sharas Gesichtsausdruck wurde plötzlich hart. »Ja. Das habe ich.«
Ephyra kannte diesen Ausdruck gut – es war der eines Menschen, der verzweifelt versucht, seine Trauer zu verbergen.
»Dann kannst du mir ja vielleicht doch helfen.« Sie holte das Tagebuch ihres Vaters aus der Tasche. »Dein Vorgänger hat meinem Vater einen Brief geschickt.«
Sie blätterte zu einer bestimmten Stelle und nahm ihn heraus. Shara griff argwöhnisch danach.
Ephyra kannte den Inhalt mittlerweile auswendig. Aran, ich fürchte, wir können dir in dieser Angelegenheit nicht helfen. Falls dieser Kelch existiert, begib dich besser nicht auf die Suche nach ihm. Das Einzige, was du finden wirst, ist ein schneller Tod.
»Und?«, fragte Shara und blickte vom Brief auf.
»Und was?«
»Dein Vater«, sagte Shara. »Hat er einen schnellen Tod gefunden?«
»Nein«, antwortete Ephyra. »Er starb einige Zeit, nachdem er diesen Brief bekommen hatte. Aber er war krank. Es war ein langsamer Tod.« Sie wollte nicht mit Shara darüber sprechen. »Weißt du, ob dieser Brief wirklich vom Meisterdieb stammt?«
Shara schaute wieder auf den Brief und runzelte die Stirn. »Sieht nach seiner Handschrift aus. Dieser Kelch, von dem er spricht – ist das der Eleasarkelch?«
»Du hast von ihm gehört?«
Sharas Lächeln glitzerte wie die Schneide eines Messers. »Es gibt auf der ganzen Welt keinen Schatzjäger, der nicht vom Eleasarkelch gehört hat.«
»Und hat ihn jemals einer gefunden?«
Shara lachte. »Du hast den Brief selbst gelesen. Mein Vorgänger hat seinen Namen zu Recht getragen. Er war der verwegenste und ausgefuchsteste Dieb von allen. Und er wollte keinen Fuß in die Nähe dieses Dings setzen. Also, was sagt dir das?« Sie wartete nicht auf Ephyras Antwort. »Warum hat dein Vater nach so einem gefährlichen Artefakt gesucht?«
»Um das herauszufinden, bin ich hier«, sagte Ephyra. »Ich glaube, dass mein Vater deinen Vorgänger gekannt hat – ihn vielleicht sogar ziemlich gut gekannt hat. Er hat mir zwar nie von ihm erzählt, aber der Brief klingt, als hätten sie schon mal miteinander gearbeitet. Mein Vater war ein Händler.«
Shara nickte. »Wir arbeiten öfter mit Händlern zusammen. Sie vermitteln uns geeignete Käufer für die Artefakte.«
»Dann glaubst du, dass mein Vater für jemand anderen nach dem Kelch gefragt hat?«
»Es wäre möglich«, antwortete Shara. »Aber das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Ostküste von Pelagos auch nur einen einzigen Hehler gibt, der verrückt genug wäre zu versuchen, damit Geld zu machen.«
Ephyra schauderte. Sie konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass ihr Vater tatsächlich für jemand anderen nach dem Kelch gesucht hatte – für sie. Aber sie verstand nicht, warum er das hätte tun sollen. Ihre Mutter und ihr Vater hatten ihr stets verboten, ihre Gabe zu benutzen – es war nicht sehr wahrscheinlich, dass sie ausgerechnet nach dem Gegenstand gesucht haben sollten, der ihre Gabe noch verstärken würde.
Vielleicht … vielleicht hatte ihr Vater aus irgendeinem Grund gewusst, dass Ephyras Gabe verdorben war. Dass sie falsch war. Vielleicht hatte er gewusst, wozu sie in der Lage war, und vielleicht hatte er geglaubt, der Kelch könnte sie heilen.
Du musst zu Ende führen, was dein Vater begonnen hat. Das waren die Worte gewesen, die Frau Tappan in Medea zu Ephyra gesagt hatte. Wenn sie weiter darauf hoffen wollte, Beru zu retten, dann musste sie den Kelch finden.
»Du bist nicht die Erste, die nach dem Eleasarkelch fragt«, riss Shara sie aus ihren Gedanken. »Es kommt immer mal wieder irgendein ein Narr hier vorbei, der auf der Suche danach ist.«
»Mein Vater war kein Narr«, zischte Ephyra.
»Ich mein ja nur.« Shara hob beschwichtigend die Hände. »Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand auf der Suche nach dem Kelch den Tod gefunden hat.«
»Ich sagte doch, dass mein Vater krank war.«
Shara zog eine Braue hoch. »Es gibt viele Arten, jemanden umzubringen.«
»Du glaubst, es gibt jemanden, der versucht zu verhindern, dass auch nur einer den Kelch findet?«
»Ich hab da so meine eigenen Theorien«, antwortete Shara. »Und wenn ich es mir recht überlege, hat es in letzter Zeit ziemlich viel Gerede um diesen Kelch gegeben. Mehr als sonst.«
Ephyra zuckte innerlich zusammen. Wer außer Frau Tappan konnte sich noch für den Eleasarkelch interessieren? Das konnte kein Zufall sein.
Shara musterte sie aufmerksam. »Hinter der ganzen Sache steckt mehr, als du mir verrätst, oder?«
Ephyra hielt ihrem Blick stand. Sie konnte diesem Mädchen nicht den wahren Grund für ihre Suche nach dem Kelch nennen. Dass er ihre einzige Hoffnung war, Beru zu retten. Dass Ephyra jahrelang getötet hatte, um ihre Schwester am Leben zu erhalten, bis sie schließlich zu weit gegangen war – sie hatte Hector Navarro getötet und Beru hatte ihr das nicht verzeihen können. Sie ging fort, fest entschlossen, lieber zu sterben, als zuzulassen, dass Ephyra weiter Menschen tötete. Und jetzt war der Kelch Ephyras einzige Chance, um genau dies zu verhindern.
»Du hast recht«, sagte Ephyra. »Ich möchte nicht nur herausfinden, warum mein Vater nach dem Kelch gesucht hat. Ich möchte ihn selbst finden. Ich muss ihn finden.«
»Und du willst, dass ich dir dabei helfe?« Shara überkreuzte die Füße auf dem Tisch. »Trotz allem, was ich dir gerade gesagt habe?«
»Du bist jetzt der Meisterdieb, oder?«
»Das bin ich«, erwiderte Shara. »Aber ich habe dir doch gesagt, dass nur Narren sich auf die Suche nach dem Kelch machen.«
Ephyra pochte der Herzschlag in den Ohren und Verzweiflung schnürte ihr die Kehle zu.
Plötzlich schwang Shara die Füße vom Tisch, stand auf und faltete den Brief von Ephyras Vater zusammen. »Du hast Glück. Ich gehöre nämlich selbst zu diesen Narren.«
Ephyra sah Shara blinzelnd an, als diese vor sie trat und ihr die Hand hinstreckte. »Auftrag angenommen.«
»Auftrag?«, echote Ephyra. »Ich sagte doch, dass ich nicht viel Geld habe.«
Shara zuckte mit den Achseln. »Das klären wir später. Also, bist du dabei oder nicht?«
Ephyra verengte die Augen. »Warum solltest du mir helfen wollen, nach allem, was du mir gerade erzählt hast?«
Shara winkte ab. »Ich verpasse nicht gern eine Gelegenheit, mich mit Ruhm zu bekleckern, und ich habe einen Hang dazu, mich nicht um die Konsequenzen zu scheren. Außerdem ist gerade nicht viel los und ich langweile mich schnell. Also, willst du weiter hier rumstehen und debattieren oder willst du diesen Kelch finden?«
Ephyra schwoll das Herz in der Brust an, als sie nach Sharas Hand griff. Heute Morgen noch hatte sie nichts weiter gehabt als einen Namen, einen Ort und ihre langsam schwindende Hoffnung. Jetzt hatte sie eine echte Schatzjägerin auf ihrer Seite und glaubte zum allerersten Mal wirklich daran, dass sie es schaffen konnte. Halte durch, Beru, bat sie inständig. Bleib nur noch ein kleines bisschen länger am Leben.
Shara lächelte, als sie sich die Hände schüttelten. »Auf gute Zusammenarbeit.«
KAPITEL 2
JUDE
Es war das erste Mal in Judes neunzehn Jahre währendem Leben, dass im Kastell von Kerameikos ein Tribunal einberufen wurde.
Das letzte Tribunal war vor Judes Geburt abgehalten worden, den Grund dafür kannte er jedoch nicht. Sämtliche über einen Prozess geführten Protokolle wurden unter Verschluss gehalten. Zugang hatte außer dem Tribunal selbst nur der Hüter der Botschaft – wobei Jude kaum Zeit gehabt hatte, von seinem Recht Gebrauch zu machen.
Der Eingang zur Tribunalkammer wurde von zwei Statuen flankiert – die eine stellte Tarseis den Gerechten dar, die andere Temara, die erste Hüterin der Botschaft, die ihren Eid, den Propheten zu dienen, vor fast zweitausend Jahren abgelegt hatte. Jude hielt einen Moment neben der Statue seiner Ahnherrin inne. Sie leuchtete im Morgenlicht, ihr entschlossener Blick war auf das Kastell gerichtet. Sie war eine Kriegerin, eine Soldatin, genau wie Jude, und hatte sich wie er einer Sache verschrieben, die größer war als sie selbst. Er fragte sich, ob es ihr leichtgefallen war, alles Warme und Behagliche für eine Rüstung aus kaltem Stahl aufzugeben.
»Jude.« Die Stimme seines Vaters ertönte hinter ihm.
Der frühere Marschall Weatherbourne stand in der Mitte des Gangs, der in die Tribunalkammer führte, und füllte mit seinen Schultern die ganze Breite aus. Sein dichter Bart färbte sich allmählich grau, und obwohl er nun nicht mehr den goldenen Wendelring des Hüters um den Hals trug, sah er noch immer durch und durch wie einer aus.
»Du dürftest gar nicht hier sein«, platzte Jude heraus. »Oder haben sie dir erlaubt, an der Anhörung teilzunehmen?«
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Ich bin nur hier, weil ich dich vorher noch einmal sehen wollte. Was auch immer die Anhörung ergeben wird – das ist eine Sache zwischen dir und dem Tribunal.« Er legte Jude eine Hand auf die Schulter. »Und ich mache mir keine Sorgen um dich, mein Sohn. Es gibt lediglich noch offene Fragen in Bezug auf Navarro und was ihn dazu verleitet hat, die Garde zu verlassen.«
Jude waren einige der Gerüchte zu Ohren gekommen. Manche von ihnen machten ihn zorniger, als er es für möglich gehalten hätte. Wie etwa die Behauptung, Hector hätte den Orden verlassen, um ein Kind großzuziehen, das er gezeugt habe, bevor er seinen Eid abgelegt hatte. Und manche Gerüchte … manche davon kamen der Wahrheit viel zu nahe.
»Wenn das Tribunal zu dem Schluss kommt, dass Hector sich der Fahnenflucht schuldig gemacht hat –« Jude verstummte. Er wollte nicht daran denken, was dann passieren würde. Er konnte sich noch gut an den grimmigen Ausdruck in den Augen seines Vaters erinnern, als dieser Jude erklärt hatte, dass es zu seiner Pflicht als Hüter der Botschaft gehörte, dafür zu sorgen, dass die Paladine sich an ihren Eid hielten, und die Strafe zu vollstrecken, die auf Eidbruch stand – unverzüglich und ohne Ausnahme.
Sein Vater festigte den Griff um Judes Schulter. Auf seinem Gesicht lag ein angespannter, ernster Ausdruck. Jude wusste, was er dachte – dass Hectors Verurteilung unausweichlich war.
»Niemand hat auch nur den Hauch einer Ahnung, wo er ist«, sagte Jude leise. An dem Tag in Pallas Athos, als er in den Ruinen eines Mausoleums mit Hector gekämpft hatte, hatte er seinen Freund das letzte Mal gesehen. »Er könnte am anderen Ende der Welt sein.«
»Es wird die Entscheidung des Tribunals sein, welche Maßnahmen zu ergreifen sind«, entgegnete sein Vater. »Erzähle ihnen einfach alles, was du weißt.«
Jude nickte, ein nervöses Ziehen im Bauch. Alles, was sein Vater über die Ereignisse in Pallas Athos wusste, war, dass sie Jude auf die Spur des Letzten Propheten geführt hatten.
»Wenn die Anhörung zu Ende ist, werde ich für dich da sein. Und für den Propheten«, sagte sein Vater. »Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren.«
Anton. Jude fiel es immer noch schwer, sich ihn als den Propheten vorzustellen. Bei ihrer ersten Begegnung in Pallas Athos hatte er nichts weiter als einen Dieb und Spieler in ihm gesehen – der ihm das Leben gerettet hatte. Seit ihrer Rückkehr nach Kerameikos ging Jude ihm aus dem Weg. Anton hatte ihn so mühelos durchschaut, und Jude hatte Angst, dass ihm, wenn sie jetzt allein miteinander wären, ein einziger Blick genügen würde, um all die erbärmlichen Gedanken lesen zu können, die sich in Judes Kopf drängten. Das konnte er sich nicht leisten, nicht solange er die Anhörung vor dem Tribunal vor sich hatte.
Theron Weatherbourne nahm die Hand von der Schulter seines Sohnes und ließ ihn allein durch die Flügeltür treten, die in die Tribunalkammer führte.
In der Mitte des Raums befand sich ein großer Kreis aus blauen und grauen Fliesen, die den siebenzackigen Stern des Ordens bildeten. Ringsherum reihten sich in einem leicht erhöhten Halbrund Steinbänke aneinander, von denen Jude bei seinem Eintreten die Mitglieder des Tribunals entgegenblickten. Es setzte sich aus Paladinen und Kastellmeistern zusammen, die für diesen Anlass jedoch alle graue Umhänge trugen, die von einer Anstecknadel in Form der Waage von Tarseis dem Gerechten zusammengehalten wurden. Ihre Gesichter waren zur Wahrung der Geheimhaltung hinter Masken verborgen. Jeder konnte sich dahinter verbergen – Judes frühere Lehrer, andere Mündel des Ordens, die es ihm übel nahmen, dass er Hector immer bevorzugt hatte, ja selbst sein Vater, hätte Jude nicht noch vor wenigen Augenblicken mit ihm gesprochen.
Jude neigte respektvoll den Kopf, sobald er die Mitte des Kreises erreicht hatte. Links von ihm hatten Penrose und der Rest der Garde auf der Zeugenbank Platz genommen.
Der Magistrat, der dazu berufen worden war, die Befragung des Tribunals durchzuführen, trat nach vorn. Im Gegensatz zu den anderen trug er keine Maske. Jude glaubte, ihn wiederzuerkennen – kein Schwertkämpfer, sondern ein Kastellmeister, der für die Instandhaltung der Verteidigungsanlagen zuständig war.
»Hiermit eröffne ich die einundachtzigste Sitzung des Tribunals von Kerameikos«, sagte der Magistrat. »Das Tribunal möchte zunächst auf die ungewöhnlichen Umstände hinweisen, unter denen wir uns heute versammelt haben. Noch nie ist in einer unserer Verhandlungen ein Hüter der Botschaft befragt worden.«
»Ich bin aus freien Stücken hier und sichere dem Tribunal meine uneingeschränkte Mitarbeit zu«, sagte Jude.
Der Magistrat nickte zufrieden. »Das Ziel dieser Anhörung ist es, festzustellen, ob der Paladineid des Ordens des Letzten Lichts gebrochen wurde, welche Umstände zu dem vermeintlichen Bruch geführt haben und welche Schritte unternommen werden müssen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Wir werden mit allen sprechen, die darüber Aufschluss geben können. Das Tribunal ruft zunächst Jude Adlai Weatherbourne in den Zeugenstand.«
Jude nahm auf der Steinbank Platz, die auf einem Podest aus schwarzem Marmor stand.
»Marschall Weatherbourne, erzählt uns bitte von den Ereignissen, die der Abreise von Hector Navarro aus Pallas Athos vorausgingen.«
Jude holte Luft. Vielleicht konnte er sie davon überzeugen, dass Hector die Garde im Dienste des Ordens verlassen hatte. Vielleicht würde Hector dann eines Tages zurückkehren können. Er begann zu sprechen, berichtete, wie er und Hector zusammen zur Zitadelle von Pallos Athos gegangen waren. Wie sie dort auf die Blasse Hand gestoßen waren.
»Und woher wusstet Ihr, dass es sich um die Blasse Hand gehandelt hat?«, fragte der Magistrat.
Jude zögerte. Die Wahrheit würde gegen Hector sprechen, es so aussehen lassen, als hätte er aus reiner Rachsucht gehandelt. Schließlich hatte Jude ihm das selbst vorgeworfen.
»Er hat sie erkannt«, sagte er schließlich. »Er hatte schon einmal gesehen, wie sie getötet hatte. Wusste, wozu sie fähig war.«
Dieselbe Wut und Verletztheit, die an jenem Tag in Judes Brust gebrodelt hatten, schienen nun in seiner Kehle festzustecken. Er schluckte sie hinunter und behauptete, dass Hector am nächsten Morgen zur Zitadelle zurückgekehrt wäre und er sich entschlossen hätte, ihm zu folgen.
»Und als Ihr an diesem Morgen die Villa verlassen habt, was hattet Ihr da vor?«, fragte der Magistrat.
Mit dieser Frage hatte Jude nicht gerechnet. Er überlegte, was der Magistrat wohl aus seiner Antwort zu erfahren hoffte. »Ich wollte Hector finden. Ich dachte, ich könnte ihn davon überzeugen, mit mir zurückzukommen.«
Er hielt erneut inne. Dies war der heikelste Teil der Geschichte. Nicht nur für das Tribunal, sondern auch für ihn. Der Moment, in dem sie gekämpft hatten und Hector ihn verletzt in den Trümmern des zerstörten Mausoleums zurückgelassen hatte. Ihm wurde schon allein vom Erzählen übel.
»Und das ist Euch nicht gelungen?«, hakte der Magistrat prompt nach.
»Er … er hatte das Gefühl, seine Mission zu Ende führen zu müssen. Die Blasse Hand zu finden, von der er überzeugt war, dass sie einer der letzten Vorboten ist«, antwortete Jude ausweichend. Genau wie die Paladine konnte auch jedes Mitglied des Tribunals spüren, ob jemand die Wahrheit sagte oder nicht. Dafür reichte eine leichte Abweichung seines Pulsschlags, seines Geruchs, seines Atems. Er hatte nicht gelogen – er hatte lediglich nicht die ganze Wahrheit gesagt. »Falls er recht hatte, dann hätte er damit das Zeitalter der Dunkelheit vielleicht aufhalten können.«
»Ist dem so?«, sagte der Magistrat. »Marschall Weatherbourne, die Frage ist nicht, ob Hector falsch gehandelt hat. Wir sind nicht hier, um zu untersuchen, was er getan hat, sondern warum er es getan hat. Der Eidbruch nimmt seinen Anfang stets am selben Ort – im Herzen.«
»Nur Hector kann Euch sagen, was genau in seinem Herzen vor sich ging, als er sich dazu entschloss, den Orden zu verlassen.« Doch auch das war nur die halbe Wahrheit. Hectors hitzig ausgestoßene Worte hallten durch Judes Kopf – dass er der Garde niemals hätte beitreten dürfen.
»Ich würde ihn gern danach fragen … wenn er denn hier wäre«, entgegnete der Magistrat scharf.
Jude blickte auf seine zu Fäusten geballten Hände hinunter. Der Magistrat hatte recht. Ganz gleich, was Jude sagte, um ihn zu verteidigen, Hector war schlicht und einfach nicht hier. Und trotzdem verstrickte Jude sich in Halbwahrheiten, in der Hoffnung, und sei sie noch so klein, dass Hector eines Tages zurückkehren würde. Doch tief in seinem Herzen wusste er, dass es keine Rolle spielte, ob das Tribunal zu dem Schluss kommen würde, dass Hector ein Eidbrecher war. Er würde niemals zurückkehren.
»Nun gut«, sagte der Magistrat und klang nun wieder sanfter. »Ich danke Euch im Namen des Tribunals, dass Ihr heute hier seid.«
Jude stand benommen von der Bank auf und stieg von dem Podest.
»Als Nächstes ruft das Tribunal Moria Penrose auf«, sagte der Magistrat.
Penrose erhob sich von ihrem Platz und trat in den Kreis. Sie sah Jude nicht an, aber er hörte, wie sie den Atem anhielt, als ihre Wege sich kreuzten und sie auf das Marmorpodest zuging, um dort Platz zu nehmen.
»Paladin Penrose, könnt Ihr Marschall Weatherbournes Darstellung der Ereignisse, die zu Hector Navarros Weggang geführt haben, bestätigen?«, fragte der Magistrat.
»Ja.«
»Habt Ihr dem noch irgendwelche eigenen Beobachtungen hinzuzufügen?«
Jude sah zu Penrose. Es gab Dinge, die Jude außen vor gelassen hatte, zum Beispiel, wie verzweifelt Penrose versucht hatte, ihn davon abzuhalten, Hector zu folgen. Aber als sie dem Blick des Magistrats begegnete, schüttelte sie den Kopf. »Es war so, wie Jude gesagt hat.«
»Sehr gut.« Der Magistrat nickte wieder zufrieden. »Dann würde ich nun gern etwas in der Zeit zurückgehen, und zwar zu dem Tag, an dem Hector Navarro in den Orden zurückgekehrt ist. Könnt Ihr Euch daran erinnern, an jenem Tag mit jemandem über Navarros Rückkehr gesprochen zu haben?«
»Ich habe mit Marschall Weatherbourne darüber gesprochen«, antwortete Penrose. »Das heißt, mit Theron Weatherbourne.«
»Und wie hat er sich dazu geäußert?«
»Er hatte Bedenken hinsichtlich Hectors Rückkehr und seiner Vereidigung.«
Jude grub die Fingernägel in seine Handfläche. Er hatte von den Bedenken seines Vaters über Hectors Berufung in die Paladingarde gewusst, aber ihm war nicht klar gewesen, dass diese Bedenken sich auch darauf bezogen hatten, dass Hector überhaupt zurückgekehrt war.
»Habt Ihr diese Bedenken geteilt?«
Penrose schien ihre Worte vorsichtig abzuwägen. »Es geschieht nur selten, dass ein Ordensmitglied Kerameikos aus freien Stücken verlässt. Noch seltener entscheidet sich so jemand zurückzukehren. Wir haben uns alle gefragt, warum er das tat.«
»Was habt Ihr auf die Bedenken des ehemaligen Marschalls Weatherbourne erwidert?«, fragte der Magistrat.
»Dass ich mir fast sicher sei, dass Jude Navarro in seine Garde beruft.« Penrose zögerte. »Und dass ich das nicht wirklich gutheißen würde.«
Penroses Zögern ließ den Magistrat aufhorchen wie einen Jagdhund, der Blut gewittert hatte. »Ist das Euer exakter Wortlaut gewesen?«
»Nein«, sagte Penrose.
»Dann gebt diesen hier bitte wieder.«
Penrose warf Jude einen Blick zu. »Ich sagte, dass ich das für den größten Fehler halten würde, den Jude in seinem Leben machen könnte.«
Ihre Worte trafen Jude wie ein Schlag. Er hatte gewusst, dass Penrose nicht besonders glücklich über Hectors Rückkehr gewesen war, aber nicht, wie groß ihre Bedenken waren. Und noch mehr erschütterte ihn, dass sie so mit seinem Vater über ihn gesprochen hatte. Das grenzte an Ungehorsam ihrem künftigen Hüter gegenüber. Worüber sich Penrose im Klaren gewesen sein musste, und dass sie das Risiko dennoch eingegangen war, machte deutlich, wie sehr sie Hector misstraut hatte.
»Ihr hieltet es für einen Fehler, weil es so viele offene Fragen um Hector Navarro gab?«, hakte der Magistrat fast behutsam nach. »Weil Ihr dachtet, dass Navarro sich nicht an seinen Eid halten würde?«
Penrose senkte den Blick. Damit war es so gut wie entschieden. Jude hatte versucht, seine schützende Hand über Hector zu halten, doch das Misstrauen, das Penrose ihm entgegenbrachte, würde Hector zum Eidbrecher stempeln. Würde sein Todesurteil bedeuten.
Penrose holte tief Luft und schloss kurz die Augen. »Nein.«
In Judes Brust regte sich neue Hoffnung.
»Sondern?«, fragte der Magistrat.
»Weil ich befürchtet habe«, sagte Penrose mit einem kaum wahrnehmbaren Zittern in der Stimme, »dass Jude in Hector verliebt war. Und dass seine Gefühle für ihn sein Urteilsvermögen trüben würden, wenn er Hector täglich um sich hätte, sosehr ich auch wusste, dass Jude sich seinem Amt durch und durch verpflichtet fühlte.«
Sengende Hitze breitete sich in Judes Körper aus, dann wurde ihm eiskalt, als wäre er von Gottesfeuer verbrannt worden. Seine Lungen und seine Magengrube fühlten sich an wie mit Asche bedeckt. Das hier war der Moment, vor dem er sich gefürchtet hatte, seit er sechzehn gewesen war und zu spüren begonnen hatte, dass seine Hingabe an seine Bestimmung nicht so unerschütterlich war, wie er einmal geglaubt hatte. Der Moment, in dem seine ganzen Schwächen, sein Versagen, sein Nicht-würdig-Sein vor dem Rest des Ordens bloßgelegt wurden. Der Moment, in dem alle sehen konnten, dass in Judes Brust kein stählernes Herz schlug, sondern ein ungestümes, empfindsames Etwas.
»Und haben Jude Weatherbournes Gefühle sein Urteilsvermögen Eurer Einschätzung nach getrübt?«, fragte der Magistrat.
Penrose schaute in ihren Schoß hinunter und schwieg. Der Magistrat drängte sie nicht.
Schließlich sagte Penrose leise: »Ja.«
»Es ist so, wie ich gesagt habe.« In der Stimme des Magistrats lag ein fast mitleidiger Unterton. »Der Eidbruch nimmt seinen Anfang stets im Herzen. Paladin Penrose, würdet Ihr bitte den Eid der Paladingarde für uns aufsagen?«
Penrose schluckte, als würde sie mit den Tränen kämpfen, aber als sie sprach, war ihre Stimme stahlhart. »Ich gelobe, die Pflichten meines Amtes zu erfüllen, die Tugenden der Keuschheit, der Enthaltsamkeit und des Gehorsams hochzuhalten und mich selbst, meine Gabe und mein Leben ganz und gar dem Orden des Letzten Lichts zu widmen.«
»Hat Jude Weatherbourne sich an seinen Eid gehalten, als er Hector Navarro gefolgt ist und seine Gefühle für ihn über seine Eidespflicht als Hüter der Botschaft gestellt hat?«
Jude zog scharf die Luft ein. Auch ohne Penrose in die Augen zu schauen, kannte er ihre Antwort. Und er wusste, wie sehr es sie schmerzen würde, sie auszusprechen. Die Strafe für einen Paladin, der seinen Eid brach, war der Tod. Aber Jude wusste auch, dass ihm vollkommen klar gewesen war, welche Folgen es haben könnte, als er beschlossen hatte, Hector zu folgen.
»Nein«, sagte Penrose tonlos. »Ich glaube nicht, dass er das getan hat.«
»Und das war Eure größte Angst, nicht wahr?«, sagte der Magistrat. »Nicht dass Hector Navarro seinen Eid brechen würde – sondern Jude Weatherbourne.«
KAPITEL 3
BERU
An diesem Ort stank es überall nach Pisse.
Beru zog sich ihr blaues Tuch über die Nase, als sie sich einen Weg durch das Gedränge bahnte. Es half nur wenig gegen den üblen Geruch.
Die Luft war vom Gejohle der Menge erfüllt, die sich wie eine Horde Geier auf den Zuschauerrängen über den großen, blutdurchtränkten Sandgruben drängte, wo die Faustkämpfe ausgetragen wurden – nicht selten bis zum bitteren Ende. Manche der Kämpfer waren Gefangene, die von einem Nachbarort herbeigekarrt worden waren und denen, wenn sie eine gute Vorstellung boten, eine frühere Entlassung winkte. Manche waren verzweifelte Vagabunden, die ein Wüstenwind hereingeweht hatte und die auf der Suche nach einer Handvoll Münzen oder einem Abenteuer waren.
Das verstand man in diesem staubigen Nichts von einer Stadt unter Vergnügung. Die Leute strömten in Scharen hier zusammen, um sich die Kämpfe anzuschauen und Wetten darauf abzuschließen. Beru konnte nicht nachvollziehen, was so faszinierend daran war, dabei zuzusehen, wie jemandem das Gesicht zu Brei geschlagen wurde oder in einer Sandgrube Zähne aufgesammelt wurden, aber sie war auch nicht als Zuschauerin hier.
Sie hatte Medea vor über einer Woche verlassen. Hatte ihrer Schwester und dem einzigen Leben, das sie je gekannt hatte, den Rücken gekehrt. Sie hatte kein Ziel vor Augen gehabt, nur eine Stimme in ihrem Kopf, die Sühne deine Schuld flüsterte.
Diese Stimme hatte sie nach Osten geführt, an einen Außenposten entlang der Handelsstraße zwischen Tel Amot und Behesda. Eine Stadt, die so klein war, dass sie die Bezeichnung nicht verdiente, und aus einer einzigen Karawanserei bestand, einem Wasserloch und den Kampfgruben. Der Besitzer der Karawanserei und seine Frau Kala hatten Mitleid mit Beru gehabt und ihr angeboten, sie bei sich aufzunehmen, wenn sie ihnen im Gegenzug bei den verschiedenen Tätigkeiten, denen sie in der Stadt nachgingen, zur Hand gehen würde.
»Du hast die ersten Kämpfe verpasst«, sagte Kala, als Beru die am äußeren Rand der Sandgrube gelegene Krankenstation erreichte.
»Krankenstation« war eine freundliche Umschreibung für den schmalen Streifen staubige Erde, auf dem ein paar lange Bänke standen. Die Grubenkämpfe waren eine brutale und blutige Angelegenheit, und da es in der Stadt keine Heiler gab, verdingten sich ein paar der Einwohner als Sanitäter und verarzteten die Wunden der Kämpfer gegen eine Handvoll von ihrem Preisgeld. Beru hatte sich schon mit genügend Kämpfern unterhalten, um zu wissen, dass dies die einzige Möglichkeit war, hier Verletzungen behandeln zu lassen. Verloren sie, waren sie dem Besitzer der Kampfgruben noch nicht mal eine Mahlzeit wert.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, sagte Beru. Auf den Bänken lagen bereits ein paar Kämpfer, die ziemlich lädiert aussahen.
»Wo hast du gesteckt?«
Beru gab ihr die Antwort, die sie auf dem Weg hierher einstudiert hatte. »Ich habe die Ställe sauber gemacht und darüber die Zeit vergessen.«
Aber der wahre Grund für Berus Verspätung hatte nichts mit Stallausmisten zu tun, sondern mit den plötzlich auftretenden, heftigen Schmerzen, die sie seit einigen Tagen quälten. Sie wusste und fürchtete, was sie zu bedeuten hatten. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit ihr blieb, bevor ihr Leben zu schwinden begann, aber sie glaubte – hoffte –, dass es genug sein würde. Genug, um das zu tun, was die Stimme in ihrem Kopf verlangte.
Sühne deine Schuld.
Es war Hectors Stimme, das wusste sie mittlerweile. Sie konnte sich noch immer an ihren Klang erinnern, leise und rau, als er diese Worte in einer verlassenen Krypta in Pallas Athos zu ihr gesagt hatte. Er hatte von ihr gefordert, in aller Öffentlichkeit zu gestehen, dass ihre Schwester die Blasse Hand war. Aber Beru hatte sie nicht einfach so verraten können, ganz gleich, was Ephyra getan hatte.
Und jetzt verfolgten Hectors Worte sie. Sein Tod verfolgte sie. Es war sein Leben gewesen, das Ephyra genommen hatte, um sie zu heilen. Das letzte Leben, das sie jemals leben würde. Sie hatte sich selbst das Versprechen gegeben, dass es anders verlaufen würde. Sie würde es damit verbringen, Hectors Worten zu folgen.
Ihre Schuld zu sühnen.
Ich versuche es. Die Arbeit hier war ein Anfang. Zum ersten Mal in ihrem Leben heilte sie, statt Schaden zuzufügen. Aber es war so wenig angesichts dessen, was sie getan hatte. Sie wusste, was Hector sagen würde. Dass sie es nicht versuchte. Dass sie nichts tat. Dass sie einfach darauf wartete, zu sterben.
Das Dröhnen des Gongs riss Beru aus ihren Gedanken. Der nächste Kampf begann. Auf den ersten Gong folgte ein weiterer. Zwei bedeuteten, dass ein Kämpfer zwei Herausforderer bezwungen hatte. Die meisten Kämpfer würden an diesem Punkt aussteigen und ihr hart erkämpftes Preisgeld einstecken. Aber es gab ein paar, die sich dafür entschieden, weiterzukämpfen – denn der dritte Sieg war doppelt so viel wert wie die ersten beiden zusammen. Es kam selten vor, dass ein Kämpfer die dritte Runde gewann, aber sie war stets die spektakulärste.
Der Besitzer der Grube stieg mit großtuerischer Geste auf ein Podest und sprach durch eine kleine Metallscheibe, die er sich vor den Mund hielt.
»Unser nächster Herausforderer ist ein Kämpfer, den wir alle kennen und lieben!« Seine durch begnadete Konstrukteurskunst verstärkte Stimme hallte von den Zuschauerrängen wider. »Applaus für den Knochenbrecher!«
Die Menge brach in Jubel aus, als der Knochenbrecher in den Ring marschiert kam. Von seinem enormen Brustkorb tropfte Schweiß und Öl. Das Licht der tief stehenden Sonne spiegelte sich in seinem glatt rasierten Schädel, und die Narbe, von der eine seiner Gesichtshälften verunstaltet wurde, ließ sein Grinsen noch Furcht einflößender wirken. Beru hatte ihn schon kämpfen sehen und wusste, dass er seinen Spitznamen vollkommen zu Recht trug. Am besten fing sie schon mal an, die Schienen und Bandagen für die arme Seele vorzubereiten, die es mit ihm zu tun bekommen würde.
»Und unser neuester Kämpfer, der schon jetzt in dem Kampf um den Titel des Unbesiegbaren eintritt, nachdem er heute gleich seine ersten beiden Kämpfe gewonnen hat. Applaus für den Sandsturm!«
Der andere Kämpfer wurde deutlich zurückhaltender beklatscht, als er jetzt, mit dem Rücken zu Beru, auf der anderen Seite in den Ring trat.
Der Knochenbrecher spuckte aus. »Genug gespielt, Kleiner.«
Er stampfte so heftig mit einem Fuß auf, dass die ganze Grube unter der Wucht erzitterte. Die Menge quittierte es mit begeistertem Gebrüll.
Der andere Kämpfer ließ den Spott an sich abperlen und ging entspannt in Verteidigungshaltung, als sein Gegner auf ihn zusteuerte.
Knochenbrecher griff an. Sandsturm wich dem ersten Schlag geschickt aus. Und dem zweiten und dem dritten. Leichtfüßig tänzelte er in Reichweite des Knochenbrechers hin und her, nur um blitzschnell zurückzuweichen, sobald sein Gegner zuschlug, gerade so, als wollte er ihn verhöhnen. Doch Beru wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war – irgendwann würde der Knochenbrecher einen Schlag landen, und ein einziger Hieb konnte einen Mann von der Statur des Sandsturms ausknocken.
Knochenbrecher schwang die Faust. Diesmal wich Sandsturm nicht aus, sondern wehrte den Schlag mit einer Hand ab und hieb seinem Gegner die andere mit tödlicher Präzision in die Seite.
Der Riese ächzte laut und hustete. Blut rann ihm aus dem Mundwinkel.
Beru hörte, wie die Zuschauermenge kollektiv nach Luft schnappte. Der Knochenbrecher war seinen Kontrahenten normalerweise haushoch überlegen.
Knochenbrecher bleckte die Zähne und griff erneut an. Sandsturm sprang aus dem Stand über ihn hinweg und kam genau an der Stelle wieder in der Hocke auf, wo die Sandgrube an die behelfsmäßige Krankenstation grenzte.
Beru stockte der Atem, als sie zum ersten Mal das Gesicht des Kämpfers sah. Sie kannte diese dunklen Augen. Sie verfolgten sie in ihren Träumen. Und es war unmöglich, dass sie jetzt in ebendiese Augen sah.
Hector Navarro war tot.
Trotzdem stand er hier direkt vor ihr.
Sein Blick wanderte kurz zur jubelnden Menge hoch und blieb dann an dem von Beru hängen. Der zufriedene Ausdruck auf seinem Gesicht verwandelte sich in blankes Entsetzen.
Beru konnte die Augen nicht von ihm lösen. Ihre Blicke hielten einander fest. Nichts von dem Trubel um sie herum drang zu ihnen durch. Beru musste an das letzte Mal denken, als er sie so angesehen hatte, mit erhobenem Schwert, um ihrem Leben ein Ende zu machen.
Im nächsten Moment fuhr die Faust des Knochenbrechers auf Hector herab und schlug ihn nieder.
Ein heftiger Schmerz fuhr durch Beru hindurch. Sie schrie auf und sank zu Boden, als wäre sie selbst von dem Hieb getroffen worden.
»Alles in Ordnung?«, fragte Kala, die zu Beru geeilt war, um ihr aufzuhelfen. Einen Moment lang konnte Beru nicht sprechen.
»Brich ihm alle Knochen! Brich ihm alle Knochen!«, sangen die Zuschauer auf den Rängen.
»Mir geht es gut«, sagte Beru schwach, als sie erneut von einem scharfen Schmerz attackiert wurde, diesmal in die Seite. Keuchend hielt sie sich an Kala fest und schaute über die Schulter zur Kampfgrube.
Der Knochenbrecher stemmte Hector gerade wie eine Jagdtrophäe mit beiden Händen über den Kopf und schleuderte ihn grunzend in Richtung Grubenrand.
Hector vollführte mitten in der Luft eine Drehung, landete auf beiden Füßen, stieß sich sofort wieder vom Boden ab, direkt auf den Knochenbrecher zu. Noch im Flug schlang er die Beine um die breiten Schultern des Knochenbrechers und nutzte den Schwung, um den Koloss mit einem ohrenbetäubenden Krachen in den Sand zu rammen.
Totenstille breitete sich auf den Zuschauerrängen aus, als der schwergewichtige Kämpfer reglos liegen blieb. Dann brandete plötzlich so lauter Jubel auf, dass er alle anderen Geräusche übertönte.
Beru tastete nach der Bank hinter sich und ließ sich darauf fallen. Das Lärmen der Menge toste über sie hinweg, und sie nahm entfernt wahr, wie Kala alles dafür vorbereitete, den Knochenbrecher zu verarzten.
Hector Navarro lebte. Das war unmöglich. Spielte ihr Verstand ihr einen Streich? Hectors Gesicht verfolgte sie Nacht für Nacht in ihren Träumen – vielleicht verfolgte er sie nun schon tagsüber.
Sie wusste nicht, was sie fühlen sollte. Sie war so erschüttert gewesen, als ihr klar geworden war, dass Ephyra ihn getötet hatte. Es war der Moment gewesen, in dem sie gewusst hatte, dass sie nicht länger damit leben konnte, was sie war. Was aus ihnen beiden geworden war.
Und jetzt lebte Hector, als ob nie etwas geschehen wäre. Als ob es diesen grauenhaften Tag im Dorf der Toten nie gegeben hätte.
Und dann die Art, wie ihr Körper reagiert hatte, als der Knochenbrecher Hector niedergeschlagen hatte – der plötzliche Schmerz hatte sie völlig unvorbereitet getroffen.
»Beru, ich brauche dich dort drüben«, rief Kala und deutete ans andere Ende der Krankenstation. Der Knochenbrecher war bereits auf einer Bahre hereingetragen worden und Kala machte gerade eine Bestandsaufnahme seiner Verletzungen. »Halt still, Yandros.«
Benommen griff Beru nach einem Beutel mit Verbandszeug und Salben. Ihr wurde erst klar, worum Kala sie gebeten hatte, als sie sich dem hinteren Teil der Krankenstation näherte.
Hector Navarro saß dort auf einer der langen Bänke. Er hatte sein Hemd ausgezogen und presste die Finger auf einen blutigen Striemen auf seiner Stirn. Noch hatte er sie nicht gesehen. Noch konnte sie in der Menge untertauchen und sich später eine Entschuldigung für Kala überlegen.
Beru blieb stehen und musterte ihn. Ja, er war es wirklich. Dasselbe zerzauste dunkle Haar, dieselbe hochgewachsene, schlanke Statur. Sie betrachtete ihn selbstvergessen, bis er plötzlich den Kopf hob, sie entdeckte und erstarrte. Mit einem merkwürdigen Gefühl, wie losgelöst von ihrem Körper, ging sie auf ihn zu.
»Kann ich … kann ich mal sehen?« Sie deutete auf die Wunde an seiner Stirn.
Er sagte nichts, ließ nur langsam die Hand sinken, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
Beru kniete sich vor ihn, in ihrem Inneren ein Chaos aus Trauer und Verwirrung. Hector war tot. Wie konnte er hier vor ihr sitzen und – bis auf die Verletzungen, die er in dem Kampf davongetragen hatte – völlig unversehrt sein?
Sie brachte es nicht fertig, ihn zu fragen, wie es sein konnte, dass er am Leben war, wie überhaupt irgendetwas von dem, was hier passierte, möglich sein konnte. Stattdessen beugte sie sich zu ihm hinunter und legte ihm sanft den Daumen an die Schläfe. Sofort fuhr ihr ein stechender Schmerz in die eigene Schläfe, gefolgt von einem plötzlichen Schwindelanfall. Es fühlte sich an, als hätte sich der Boden unter ihr in nichts aufgelöst, als hätte sie ihren Körper verlassen. Entsetzen, Wut und Trauer breiteten sich in ihr aus wie schleichendes Gift.
Hector wich zurück. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, den sie schon einmal gesehen hatte – als ihm klar geworden war, dass sie eine Wiedergängerin war. Und da wusste sie, wessen Wut sie spürte.
»Was hast du mit mir gemacht?«
Sie konnte nicht sprechen. Dort, wo sie ihn mit der Hand berührt hatte, kribbelte ihre Haut.
»Sandsturm!«, dröhnte eine Stimme rechts von Beru.
Beru atmete erleichtert aus, als Hectors Aufmerksamkeit sich auf den Knochenbrecher richtete, der die Bankreihe entlangmarschiert kam.
»Ich verlange Revanche!«
Hector setzte eine Miene träger Sorglosigkeit auf. »Du willst dich noch mal besiegen lassen? Wenn du unbedingt darauf bestehst.«
»Niemand besiegt den Knochenbrecher. Ich werde es dir beweisen.«
»Muss das jetzt sofort sein?« Beru richtete sich auf.
»Das geht dich nichts an, Mädchen«, knurrte der Knochenbrecher und trat einen Schritt auf sie zu. »Halte dich gefälligst da raus, wenn du keinen Wert drauf legst, selbst in der Grube zu landen.«
Hector sprang so schnell von der Bank auf, dass Beru die Bewegung mit bloßem Auge kaum verfolgen konnte. »Du willst Revanche? Von mir aus. Aber zuerst binde ich mir einen Arm auf den Rücken, damit es auch ein fairer Kampf wird.«
Der Knochenbrecher begann vor Wut fast zu schäumen. »Wie wär’s, wenn ich dir den Arm einfach breche?«
»Großer Keric«, murmelte Beru und schob sich zwischen die beiden Kampfhähne. »Warum holt ihr nicht gleich euer Gemächt raus und schaut, wer von euch den Längeren hat?«
Der Knochenbrecher und Hector starrten sie schockiert an.
»Wieso bist du überhaupt so wütend auf ihn, Yandros? Deine Dienstherren halten dich wie einen Hund – immer hungrig und angriffsbereit, sobald sie dich brauchen«, sagte Beru. »Auf die solltest du wütend sein.«
»Wie hast du ihn gerade genannt?«, fragte Hector verblüfft.
»Yandros.« Beru sah ihn an. »So heißt du doch, oder?«, fügte sie an den Riesen gewandt hinzu. »Du bist nicht der Knochenbrecher. Du bist nicht ihr Kampfhund. Du bist ein Mensch, und ich wette, dass unter diesen ganzen … Muskeln ein gutes Herz schlägt. Vielleicht hast du bloß vergessen, wie man es benutzt, weil du schon so lange deine Fäuste benutzen musst.«
Yandros sah sie blinzelnd an. Hector tat es ihm gleich.
»Wir … wir bringen das später zu Ende«, sagte Yandros, aber aus seiner Stimme war alle Angriffslust verschwunden. Dann drehte er sich um und stapfte ohne ein weiteres Wort davon.
Beru sah wieder Hector an, der sie mit einem undeutbaren Ausdruck betrachtete.
»Ich habe vergessen, wie gut du darin bist«, sagte er.
»Worin?«, fragte sie.
»Darin, Menschen zu beschwichtigen, die dir etwas antun wollen.«
Beru kniete sich wieder hin, kramte in ihrem Beutel nach einem sauberen Tuch und tupfte, immer darauf bedacht, seine nackte Haut nicht zu berühren, die Schramme damit ab. Ihre Gesichter waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Sie konnte ihren eigenen, stoßweise gehenden Atem hören, und versuchte ihn zu beruhigen, damit ihre Hände zu zittern aufhörten.
»Du hast Angst«, sagte Hector einen Augenblick später.
»Bist du hierhergekommen, um nach mir zu suchen?«, fragte sie und hielt seinem Blick stand.
Er schüttelte den Kopf.
»Ich … wie kommt es, dass du hier bist?«, sagte sie.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Ich hatte gehofft, du könntest es mir sagen. Es gibt da eine Lücke in meinem Gedächtnis. Ich erinnere mich an Medea. Daran, dass deine Schwester dort aufgetaucht ist. Und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich allein in der Wüste aufgewacht bin. Eine Gefangenen-Karawane hat mich aufgelesen und hierhergebracht, um mich in den Sandgruben antreten zu lassen.«
»Du kannst dich nicht daran erinnern, was in Medea passiert ist?«, fragte Beru mit schwacher Stimme. Sie ließ den Blick über ihn wandern und stellte fest, dass der blasse Handabdruck auf seiner Kehle verschwunden war.
Was hatte das zu bedeuten?
»Nein«, sagte Hector. »Was ist passiert?«
Er hatte keine Ahnung, was Ephyra ihm angetan hatte. Was Beru getan hatte.
Sie verband seine Wunde und tat so, als würde die Tätigkeit ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Sie musste es ihm nicht sagen. Sie konnte von hier fortgehen und es ihn allein herausfinden lassen. Ihm den Rücken zukehren, wie sie und Ephyra es getan hatten, nachdem sie seine Familie getötet hatten.
Als sie sich davonmachen wollte, hielt er sie am Handgelenk fest, schloss die Finger um den schwarzen Handabdruck, der unter dem Stoffstreifen verborgen war. Sein Blick war dunkel und entschlossen, und sie spürte, wie ihr Puls unter seinem Daumen zu rasen begann. Mehr noch – sie konnte die Verzweiflung und Angst spüren, die unter seiner Wut lagen.
Sein Griff festigte sich. »Sag es mir.«
Beru schloss die Augen. Hinter ihren Lidern brannten unvergossene Tränen. »Sie hat dich umgebracht.« Ihr brach die Stimme. »Ephyra hat dich getötet, um mein Leben zu retten.«
»Das ist unmöglich«, stieß er hervor. Er ließ sie los und stand auf. »Sie kann mich nicht getötet haben. Ich lebe noch.«
Sie schüttelte den Kopf und richtete sich ebenfalls auf. »Ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Wie es sein kann, dass du hier bist.«
»Ist sie auch hier?«, fragte Hector.
»Ich habe mich in Medea von ihr getrennt. Ich konnte es nicht … kann es nicht ertragen, zu wissen, was sie dir angetan hat.«
Seine Miene verschloss sich. »Du gehst jetzt besser.«
»Hector«, sagte sie, aber er drehte sich von ihr weg.
Beru stockte der Atem, als sie Hectors Rücken sah. Fassungslos starrte sie auf eine Stelle über seiner Hüfte. Auf den schwarzen Handabdruck, der dort prangte.
Er sah fast genauso aus wie der auf ihrem Handgelenk.
KAPITEL 4
HASSAN
Hassans Kompassnadel zeigte noch immer in Richtung des Leuchtturms. Oder auf das, was davon übrig war.
Sein Blick wanderte zum Hafendamm hinüber, wo die geschwärzten Ruinen aufragten. Es fühlte sich an, als wäre die Stadt ohne den Leuchtturm nicht mehr wirklich seine Stadt.
Aber es gab noch viel schwerwiegendere Gründe, warum Nasira nicht mehr die Stadt war, die er liebte. Unten auf der Straße marschierte gerade ein kleiner Trupp Zeugen in schwarz-goldenen Kutten vorbei. Hassan zählte fünf davon. Sie zogen Ketten und Fackeln tragend – kein Gottesfeuer, sondern eine gewöhnliche gelbe Flamme – an den dunklen Häusern vorbei, die die Straße säumten. Es war ein ruhiges Wohnviertel, weit weg von der Geschäftigkeit der Ozmandith-Allee und dem Viertel der Konstrukteure und Alchemisten. Es hatte Gerüchte gegeben, dass die Zeugen in dieses Viertel kommen würden, und diese Gerüchte hatten sich bestätigt. Die Zeugen konnten nur aus einem Grund hier sein.
Er stupste Khepri an, die neben ihm in der Hocke auf dem Dach saß. Geräuschlos veränderte sie ihre Position und ließ die Hand zu dem Schwert an ihrer Hüfte wandern.
Hassan fasste sie am Arm. Warte, formte er mit den Lippen, was sie dank ihres begnadeten Sehvermögens trotz der Dunkelheit sehen konnte.
Sie beobachteten, wie sich die fünf Zeugen der Tür eines der im Dunkeln liegenden Häuser näherten. Dort angekommen, hielten die Zeugen inne, als würden sie auf etwas warten.
Einen Augenblick später traten am anderen Ende der Straße drei Herati-Soldaten aus den Schatten. Sie trugen die unverwechselbaren grün-goldenen Uniformen.
Hassan warf Khepri einen Blick zu. Ihre Augen spiegelten seine eigene Angst und Wut wider.
Der Zeuge an der Spitze des Trupps zog eine Metallstange mit einem gebogenen Ende hervor, und die anderen traten ein Stück zurück, als er das Schloss damit aufbrach. Die Tür schwang nach innen auf und im Haus ging ein Licht an.
»Jetzt«, raunte Khepri und machte sich zum Sprung bereit.
Aber Hassan hielt sie erneut fest. »Nein. Wir müssen herausfinden, wohin sie sie bringen.«
Eine aufgebrachte Frau erschien an der Tür.
»Wie könnt ihr es wagen, in mein Haus einzubrechen?«, rief sie mit wütend funkelndem Blick. »Wofür haltet ihr euch?«
»Wir sind die treuen Diener des Unbefleckten«, entgegnete der Zeuge mit der Metallstange. »Wir wissen, dass du einem Ketzer Unterschlupf gewährst.«
»Ketzer?«, wiederholte die Frau. »Verschwindet aus meinem Haus! Ihr habt kein Recht, hier zu sein.«
»Auf Befehl des Hierophanten fordern wir dich auf, uns den Ketzer auszuhändigen«, sagte der Zeuge ungerührt.
Die Frau musterte ihn finster. »Lieber würde ich nackt die Ozmandith-Allee hinunterlaufen, als mich euch und eurem Hierophanten zu unterwerfen.«
»Haltet sie zurück«, befahl der Zeuge den Herati-Soldaten. Als zwei von ihnen auf die Frau zugingen und sie an den Armen packen wollten, wich sie aus und stieß einen der beiden zurück, bevor sie ins Haus lief und aus Khepris und Hassans Blickfeld verschwand. Sie hörten Glas zerbrechen und einen lauten, dumpfen Schlag. Einen Moment später zerrten die Soldaten die Frau wieder aus dem Haus.
»Lasst mich los!« Sie warf den Kopf herum und begann zu schreien. »Hilfe! Hilfe!«
Hassan spürte, wie sich Khepris Muskeln unter seiner Hand anspannten. Er festigte seinen Griff um ihren Arm, was jedoch eher der Anstrengung geschuldet war, die es ihn kostete, sich still zu verhalten, statt nach unten zu springen und die Zeugen in ihre Schranken zu weisen.
Aber sie mussten herausfinden, wohin die anderen Begnadeten gebracht worden waren.
Die Zeugen stürmten das Haus. Hassan und Khepri blieb nichts anderes übrig, als mit weiß hervortretenden Fingerknöcheln und wütend pochendem Herzen abzuwarten, bis die Zeugen wieder herauskamen. Und als es so weit war, zerrten sie noch jemand anderen aus dem Haus, dessen Hände mit aus Gottesfeuer geschmiedeten Ketten gefesselt waren.
»Mutter?« Das junge Mädchen stand zwischen den Zeugen und blickte zu seiner Mutter auf, die nur hilflos dastehen konnte.
Sie war noch ein Kind. Ein Kind. Nicht älter als zwölf.
»Hassan«, flüsterte Khepri. Es war bloß sein Name, doch sie legte alles in dieses eine Wort, was sie nicht aussprach. Sie würden nicht zulassen, dass die Zeugen ein Kind mitnahmen, ganz gleich wie wichtig es für sie war, herauszufinden, wohin sie es bringen würden.
»Los«, raunte Hassan und Khepri sprang über den Rand des Daches. Hassan folgte ihr und machte dabei wesentlich mehr Lärm als sie.
»Was soll das?«
Hassan blieb wie angewurzelt stehen. Genau wie Khepri, die, eine Hand an ihrem Schwert, schon auf halbem Weg in Richtung der Zeugen gewesen war. Es war einer der Herati-Soldaten, der gesprochen hatte.
»Sie ist noch ein Kind«, sagte er. »Wir nehmen keine Kinder gefangen.«
Einer der Zeugen stürmte auf ihn zu. »Wir handeln im Auftrag des Unbefleckten höchstselbst. Glaubst du etwa, dass er sich irrt?«
Der Herati-Soldat zögerte. Dann straffte er die Schultern. »Mir ist egal, was der Hierophant euch aufgetragen hat. Wir trennen ein Kind nicht von seiner Mutter.«
»Die Begnadeten sind eine Abart der Natur. Wie alt sie sind, spielt keine Rolle«, zischte der Zeuge.
»Schau sie dir an! Sie ist doch noch viel zu jung, um schon irgendjemandem etwas getan zu haben.«
Der Widerstand des Soldaten überraschte Hassan. Offenbar hatten seit Lethias Machtergreifung nicht alle Herati-Soldaten begonnen, dem Hierophanten zu huldigen und die Begnadeten zu verdammen.
»Willst du damit sagen, du wüsstest es besser als der Hierophant?«
»Vielleicht will ich das tatsächlich.« Der Soldat trat auf den Zeugen zu. »Vielleicht will ich damit sagen, dass euer Anführer mit seiner schaurigen Maske nicht weiß, was das Beste für diese Stadt ist.«
Hassan griff Khepri erneut am Arm. Falls die Auseinandersetzung zwischen den Zeugen und den Soldaten eskalieren und in einem Kampf enden würde, könnten sie sich das zunutze machen.
Das Gesicht des Zeugen verzog sich zu einer wütenden Grimasse. »Schlimmer als eine Abart der Natur ist nur derjenige, der seine schützende Hand über sie hält. Entweder du fügst dich jetzt oder du trägst die Konsequenzen, die es für dich haben wird, wenn du dich dem Befehl des Hierophanten widersetzt.«
»Was ihr vorhabt, ist einfach nicht richtig.« Er schaute zu seinen beiden Kameraden, die noch immer die Mutter des Mädchens festhielten. Selbst aus der Entfernung konnte Hassan sehen, dass er von ihnen keine Hilfe zu erwarten hatte.
Hassan drückte Khepris Arm und nickte knapp.