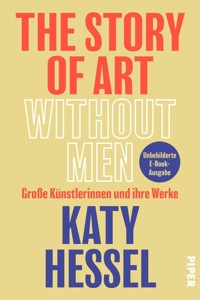
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein Buch das zeigt, wie sehr Frauen die Kunst prägen
Wie viele Künstlerinnen kennen Sie? Wer schreibt letztendlich Kunstgeschichte? Haben Frauen vor dem 20. Jahrhundert überhaupt als Künstlerinnen gearbeitet?
Bis in unsere Gegenwart hinein wirkt die Kunst, die über Jahrhunderte hinweg von Männern für Männer gemacht wurde – dieses Buch beweist, wie einseitig dieses Bild ist. Katy Hessel nimmt uns mit auf eine Reise durch die Epochen und zeigt, welch tiefgreifenden Einfluss Künstlerinnen über die Zeit hinweg hatten, welche Pionierarbeit sie häufig leisteten und wie sie verschiedene Stile, Techniken und Strömungen prägten. Entdecken Sie mit ihr viele Kunstformen, die oft übersehen oder abgetan werden, und zahlreiche aufregende Werke, die an der »Geschichte der Kunst« ebenfalls erheblichen Anteil hatten. So gibt die Autorin unbekannten, vergessenen oder bislang unsichtbaren Künstlerinnen aus aller Welt die Bühne, die sie verdienen. In diesem Buch entdecken Sie die schillernde Sofonisba Anguissola der Renaissance, die bedeutendste italienische Malerin des Barock Artemisia Gentileschi, das radikale Werk von Harriet Powers in den USA des 19. Jahrhunderts und viele weitere außergewöhnliche Frauen, die bis auf wenige Ausnahmen wie Frida Kahlo oder Paula Modersohn-Becker bislang wenig beachtet wurden. Von der Küste Cornwalls bis Manhattan, von Nigeria bis Japan – dies ist die eine zeitgemäße Geschichte der Kunst. Eine Geschichte, bei der Frauen im Mittelpunkt stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem Englischen von Marlene Fleißig, Astrid Gravert, Gabriele Würdinger und Dr. Maria Zettner
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Story of Art without Men bei Hutchinson Heinemann, einem Imprint von Penguin Random House UK
© Katy Hessel, 2022
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, nach einem Entwurf von Tom Etherington
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
»Ich werde euch zeigen, was eine Frau fertigbringt.«
Artemisia Gentileschi, 1649
Inhalt
Cover & Impressum
Einleitung
Teil eins: Wegbereiterinnen um 1500–1900
Kapitel eins – Wie Frauen sich in den Kanon malten
Kapitel zwei – Rückblick auf eine heroische Vergangenheit
Kapitel drei – Vom Realismus zum Spiritismus
Teil zwei: Das Moderne an der Kunst um 1870–1950
Kapitel vier – Krieg, Identität und die Pariser Avantgarde
Kapitel fünf – Nach dem Ersten Weltkrieg
Kapitel sechs – Die Moderne auf dem amerikanischen Kontinent
Kapitel sieben – Krieg und das Aufkommen neuer Methoden und künstlerischer Medien
Teil drei: Nachkriegsfrauen um 1945–1970
Kapitel acht – Die grosse Ära des Experimentalismus
Kapitel neun – Politischer Wandel und neue Abstraktionen
Kapitel zehn – Der Körper
Kapitel elf – Neue Traditionen weben
Teil vier: Inbesitznahme um 1970–2000
Kapitel zwölf – Das Zeitalter des Feminismus
Kapitel dreizehn – Die 1980er
Kapitel vierzehn – Die 1990er
Kapitel fünfzehn – Radikaler Wandel in Großbritannien
Teil fünf: Die Kunstgeschichte wird weitergeschrieben um 2000 bis heute
Kapitel sechzehn – Dekolonialisierung und eine neue Sicht auf alte Traditionen
Kapitel siebzehn – Figurative Kunst im 21. Jahrhundert
Kapitel achtzehn – Die 2020er
Glossar
Chronik
Anmerkungen und Bibliografie
Dank
Über die Autorin
Register
Einleitung
Beim Besuch einer Kunstmesse im Oktober 2015 machte ich eine ernüchternde Entdeckung: Keines von den vielen Werken dort stammte von einer Frau. Das gab mir zu denken. Konnte ich spontan 20 Malerinnen aufzählen? Zehn vor 1950? Irgendeine vor 1850? Nein. Hatte ich die Geschichte der Kunst im Grunde bis dahin immer aus einer männlichen Perspektive betrachtet? Ja.
Zu der Zeit war der Ausschluss von Frauen aus der offiziellen Kunstgeschichte ein großes Thema. Ich hatte gerade meinen Bachelor in Kunstgeschichte gemacht und mich mit Alice Neel (1900–1984) beschäftigt, einer großen amerikanischen Malerin psychologisch aufgeladener Porträts von Menschen aus allen sozialen Schichten. Doch Neel wurde vom Kunstestablishment erst mit über 70 als bedeutende Künstlerin anerkannt. Durch die Beschäftigung mit ihr fiel mir erst die gewaltige Unterrepräsentation von Frauen in der Kunstszene auf. Sie wurden nicht in Galerien angeboten, sie hingen nicht in Museen, fehlten in Ausstellungen und in der Literatur.
Wieso? Die mangelnde Anerkennung von Künstlerinnen wurde spätestens mit dem Erscheinen von Linda Nochlins wegweisendem Essay Why Have There Been No Great Women Artists? zu Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 1970ern zum Diskussionsgegenstand. Über 40 Jahre später schien sich nicht viel geändert zu haben.
Bei einer Auflistung der Künstler, die nach allgemeiner Einschätzung den Kanon der Kunstgeschichte »bestimmen«, fallen zumeist diese Namen: Giotto, Botticelli, Tizian, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rembrandt, David, Delacroix, Manet, Gauguin, Van Gogh, Kandinsky, Pollock, Freud, Hockney, Hirst.
Bestimmt sind sie Ihnen alle ein Begriff. Aber was sagen Ihnen diese Namen: Anguissola, Fontana, Sirani, Peeters, Gentileschi, Kauffmann, Powers, Lewis, Macdonald Mackintosh, Valadon, Höch, Asawa, Krasner, Mendieta, Pindell, Himid? Hätte ich mich nicht in den vergangenen sieben Jahren aktiv mit Künstlerinnen beschäftigt, würde ich wohl nur einen Bruchteil von ihnen kennen.
Sollte uns das wundern? Den Statistiken zufolge eher nicht. Eine Studie ermittelte 2019, dass in den Sammlungen von 18 bedeutenden US-Kunstmuseen 87 Prozent der Werke von Männern stammen und 85 Prozent von weißen Künstlern. Derzeit sind Künstlerinnen mit nur einem Prozent in der Londoner National Gallery vertreten. Dasselbe Museum widmete erst 2020 mit Artemisia Gentileschi erstmals einer historischen Künstlerin eine Einzelausstellung. 2023 wird dann auch die Royal Academy of Arts in London zum allerersten Mal in ihrem Hauptraum eine Einzelausstellung einer Frau (Marina Abramović) ausrichten. Nur eine Schwarze Frau hat bisher den Turner Prize gewonnen, Lubaina Himid im Jahr 2017, und erst 2022 wurden die USA und Großbritannien bei der Biennale in Venedig von farbigen Frauen vertreten (Simone Leigh, beziehungsweise Sonia Boyce). Eine Umfrage, die ich Anfang 2022 über den Kenntnisstand der britischen Öffentlichkeit zu Künstlerinnen durchführte, ergab, dass 30 Prozent nicht mehr als drei nennen konnten (83 Prozent der 18- bis 24-Jährigen kannten nicht mal drei), und mehr als die Hälfte gab an, in der Schule nichts über Künstlerinnen gelernt zu haben.
In der Nacht nach der Messe konnte ich nicht schlafen. Frustriert und wütend gab ich das Wort »Künstlerinnen« bei Instagram ein. Nichts erschien. Und so kam @thegreatwomenartists zustande (als Hommage an Nochlin). Ich machte es mir zur Aufgabe, mit täglichen Posts den Fokus auf Künstlerinnen zu richten, von jungen Hochschulabsolventinnen bis zu alten Meistern und quer durch alle Medien: Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Textilarbeiten. Mein Ziel war und ist, in einem verständlichen Stil und unabhängig von ihren Vorkenntnissen alle anzusprechen, die etwas über diese in den Hintergrund gedrängten Künstlerinnen erfahren möchten. So habe ich es auch, etwas ausführlicher, mit meinem Podcast gehalten, der 2019 an den Start ging. Ich möchte damit die Kunst vom Stigma des Elitismus befreien – Kunst ist für alle da, jeder kann an diesem Dialog teilhaben – und Künstlerinnen herausstellen, die in den Nachschlagewerken und Seminaren so oft fehlen. Es ist nicht so, dass ich glaube, Werke von Frauen seien von Natur aus »anders« als die von Männern – es geht eher darum, dass die Gesellschaft und ihre Meinungsmacher zu allen Zeiten einer Gruppe Priorität eingeräumt haben. Und ich fand, dass man das so nicht stehen lassen darf. Herausgekommen ist dieses Buch: The Story of Art without Men.
Es ist keine verbindliche Chronik – das wäre gar nicht möglich –, aber ich möchte den Kanon aufbrechen, der mir in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, so oft im Weg stand. Doch wird der Kanon der Kunstgeschichte auch weltweit zu Unrecht vom männlichen westlichen Narrativ beherrscht. Dem rücke ich zu Leibe. Der Titel meines Buches geht zurück auf die sogenannte Bibel der Kunstgeschichte, Ernst Gombrichs Die Geschichte der Kunst. Es ist ein wundervolles Werk mit einer entscheidenden Schwäche: Die erste Ausgabe von 1950 enthielt keine einzige Künstlerin, und selbst in der 16. Auflage kommt nur eine vor. Mit meinem Buch möchte ich einen neuen Kanon vorlegen, der das Bekannte ergänzt.
Kunstschaffende halten auf einzigartige Weise Augenblicke in der Geschichte fest. Ohne die Kunstwerke unterschiedlichster Menschen können wir Gesellschaft, Geschichte und Kultur nicht wirklich erfassen und einer Epoche keinen Sinn abgewinnen. Daher hoffe ich, dass noch weitere Bücher den Kanon fortschreiben werden.
Fortschritte sind erkennbar – dank der gemeinschaftlichen Bemühungen engagierter Künstlerinnen, Kunsthistoriker und Kuratorinnen unterschiedlichen Alters und Werdegangs rund um die Welt. Ihrer Arbeit schulde ich großen Dank, ohne sie hätte ich dieses Buch niemals schreiben können. Ich stütze mich hier auf die umfassende Forschung von (und meine Gespräche mit) maßgeblichen Kunsthistorikerinnen und Kuratoren, die sich um einen Wandel unseres Kunstverständnisses bemühen. Ihre Arbeiten sind in der Bibliografie am Ende dieses Buches aufgelistet. Durch sie erst wissen wir Genaueres aus dem Leben vieler Künstlerinnen. Es ist auch unbestreitbar, dass das zunehmende Interesse an Bildern von nicht männlichen Künstlern beziehungsweise an entsprechenden groß angelegten Ausstellungen denen zu verdanken ist, die heute Spitzenpositionen in Museen bekleiden. Zum ersten Mal überhaupt haben Frauen in der Tate, im Louvre und in der National Gallery of Art in Washington das Ruder übernommen, um nur einige zu nennen.
Dessen ungeachtet spiegelt das Ungleichgewicht in Galerien und Museen ein größeres systemisches Problem wider, weshalb sich noch vieles ändern muss. Das Gleiche gilt für den Geldwert, den wir geschlechtsspezifisch beimessen, wenn man etwa bedenkt, dass der Höchstpreis für ein Bild einer lebenden Künstlerin (Jenny Savilles Propped, 1992) nur 12 Prozent des Höchstpreises von über 90,3 Millionen US-Dollar für David Hockneys Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972, betrug. Mit diesem Buch möchte ich auch zeigen, dass der Preisunterschied nicht auf Qualität zurückzuführen ist, sondern auf den Wert, den wir Künstlerinnen und Künstlern zuweisen.
Im vergangenen Jahrzehnt wurde bereits eine ganze Reihe von kunsthistorischen »Korrekturen« vorgenommen. Von den zahlreichen Bildhauerinnen, Malerinnen und abstrakten wie surrealistischen Künstlerinnen gewidmeten Werkschauen wie Fantastische Frauen: Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo, We Wanted a Revolution: Black Radical Women 1965–1985 oder Radical Women: Latin American Art, 1960–1985 bis hin zu den ersten größeren Einzelausstellungen von Pauline Boty, Carmen Herrera, Hilma af Klint und anderen. Ich hoffe, da kommt noch mehr und meine nächste Kunstmesse wird erfreulicher ausfallen als die 2015.
Hier also meine Sicht der »Geschichte der Kunst« (ohne Männer). Da die Statistiken immer noch so schockierend ausfallen, müssen wir das Getöse um die Männer ausblenden, um die Bedeutung anderer Künstler für unsere Kulturgeschichten vernehmen zu können. Dieses Buch gliedert sich in fünf Teile, die jeweils den Fokus auf signifikante Umbrüche oder Momente überwiegend in der westlichen Kunstgeschichte richten. Damit Künstlerinnen nicht nur als Ehefrau, Muse, Modell oder Bekannte von gesehen werden, habe ich sie in den sozialen und politischen Kontext ihrer Zeit gestellt.
Auch wenn ich die Künstlerinnen (zur besseren Übersicht) etablierten Strömungen zuordne, ist mir sehr wohl bewusst, dass sie zuallererst Individuen mit unterschiedlichen Lebens- und Karriereverläufen waren und sind und auch Stilveränderungen herbeigeführt haben. In der Kunstgeschichte wurden solche Momente jedoch fast immer nur Männern zugeschrieben zulasten der Pionierarbeit von Frauen. Wenn ich das vielschichtige Werk vieler dieser Künstlerinnen auch nur oberflächlich gestreift habe, so hoffe ich doch, dass dieses Buch Ihnen einen Einblick in wenigstens einen Bruchteil der Arbeiten nicht männlicher Künstler vermittelt, die an der »Geschichte der Kunst« ebenfalls erheblichen Anteil haben.
Triumph der Frauen
Sich als Frau künstlerisch zu betätigen war zu keiner Zeit ein Zuckerschlecken. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden die führenden männlichen Künstler – die fünf Meter hohe Statuen in Angriff nahmen und ganze Kapellen mit Fresken ausstatteten – gern als »Virtuosen« bezeichnet, während Frauen, einfach nur aufgrund ihres Geschlechts, weder Anerkennung noch Gelegenheit zuteilwurde. Mit dem Wandel der Zeit ging hier leider kein Gesinnungswandel einher. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Frauen Aktstudien am lebenden Modell gestattet. Für Linda Nochlin war diese Benachteiligung so, »als würde man einem Medizinstudenten die Möglichkeit vorenthalten, den nackten menschlichen Körper zu sezieren oder auch nur zu untersuchen«. Selbst heute noch sucht man den Beitrag von Künstlerinnen in den meisten Chroniken und Museumsbeständen vergeblich. Es dauerte bis 1976, dass mit der Wanderausstellung Women Artists: 1550–1950 der feministischen Kunsthistorikerinnen Nochlin und Ann Sutherland Harris die Mitwirkung von Frauen an 400 Jahren Kunstgeschichte überhaupt anerkannt wurde. Diese Ausstellung gab erst den Anstoß zur – wiewohl immer noch spärlichen – wissenschaftlichen Erforschung der Künstlerinnen vor dem 20. Jahrhundert.
Bis dahin hatte man die Rolle der Frauen in der Kunstgeschichte bestenfalls als Kuriosität abgetan. Bei den Viktorianern galten sie mit ihren »kleineren«, »weniger kreativen« Gehirnen als untauglich für einen künstlerischen Beruf und wurden zumeist auf das (vom Establishment nicht als »schöne Kunst« angesehene) Kunsthandwerk beschränkt. Bei dieser Sichtweise konnten Künstlerinnen kaum darauf hoffen, ernst genommen zu werden, und noch weniger, ihre Werke zu verkaufen. Dem wirkten Kunsthändler nicht selten dadurch entgegen, dass sie die Signaturen der Frauen wegkratzten und durch die eines männlichen Kollegen ersetzten. (Kein Wunder, dass einige in ihren Stillleben Selbstporträts versteckten.)
Es wird Zeit für eine Korrektur. Denn trotz ihrer vielen persönlichen und professionellen Rückschläge und des Mangels an Fürsprechern unter den Kunsthistorikern trieben Künstlerinnen in ihrer jeweiligen Lebenszeit den Wandel voran. Sie sprengten Grenzen, unterwiesen nachfolgende Generationen und bereiteten, indem sie sich Geschlechterkonventionen widersetzten und radikale Themen anpackten, heutigen Künstlerinnen den Weg. Um diese Pionierinnen auch nur annähernd verstehen zu können, müssen wir uns den Kontext ansehen, in dem sie wirkten. Nur so können wir ihre Triumphe als Künstlerinnen im Angesicht ihrer eingeschränkten gesellschaftlichen und finanziellen Freiheiten, Ressourcen und Ausbildung nachvollziehen.
Eine humanistische Bildung war im Europa der Renaissance die Voraussetzung dafür, als Künstler ernst genommen zu werden, also das Studium der Literatur, Mathematik, Perspektive sowie, bezeichnenderweise, der menschlichen Anatomie (Zeichnen nach Kunstwerken und Modell, auch Akte). Entscheidend war auch der Besuch kultureller Zentren wie Rom, Florenz oder Venedig und antiker Stätten. Für Frauen war das alles jedoch tabu.
Der fehlende Zugang zu Bildung verschärfte noch einmal die bestehenden Klassenschranken, die für Frauen besonders gravierend waren. Während Jungen aus unteren Schichten zum Lernen in die Lehre gegeben werden konnten, handelte es sich bei den meisten Künstlerinnen um Töchter von Malern oder wohlhabenden, aufgeklärten Adligen. Alternativ konnten sie, aber nur mit entsprechender Bildung, in ein Kloster eintreten, wo Texte abgeschrieben und Manuskripte verziert wurden.
Eine Künstlerin brauchte also einen einflussreichen Mann (das konnte auch Gott sein), der ihre Interessen vertrat. Allerdings mochte ein Künstler-Vater (oder -Ehemann) ihr zwar Zugang zu einem Atelier verschaffen, wo sie die Werke männlicher Kollegen kopieren konnte, doch war sie in ihren Möglichkeiten immer noch extrem eingeschränkt. Und so blieb es lange Zeit.
Vom Besuch einer Kunstakademie waren Frauen auch im 19. Jahrhundert noch weitgehend ausgeschlossen. Erst zum Ende des Jahrhunderts stand ihnen eine staatlich geförderte künstlerische Ausbildung offen und durften sie ohne Begleitung durch die Straßen gehen oder Kirchen besuchen. Gerade Letzteres war unerlässlich für die Vorstellungskraft, wenn es um die populärsten Bildmotive der Zeit ging: gewaltige, vielfigurige historische und biblische Szenen mit besonderem Augenmerk auf der menschlichen Anatomie.
Wie konnten sich Frauen in früheren Zeiten dennoch behaupten? Im 16. und 17. Jahrhundert widmeten sie sich vorwiegend der Porträtkunst und dem Stillleben, Genres, die als seriös und ehrbar galten. Sie malten sich selbst, Schwestern oder Lehrer, häusliche Szenen sowie Gegenstände. Natürlich wurden diese Themen schon bald als belanglos und trivial abgestempelt. Doch soll es uns nicht um die Bewertungshierarchien der Vergangenheit gehen; wir wollen stattdessen lieber den Wert solcher Bilder preisen, denn Frauen haben sich zu wahren Meisterinnen dieser Genres entwickelt, die entsprechenden Märkte monopolisiert und sie sogar mit einer gezielt feministischen Note unterwandert.
In diesem Teil wollen wir die grandiosen Frauen aus Europa, Asien und Amerika im Laufe von vier Jahrhunderten ans Licht bringen, die in Medien von Malerei über Keramik und den Anfängen der Fotografie gewirkt haben, bis hin zu jenen, die so einzigartige und erfindungsreiche Methoden einführten, dass sie so ganz nebenbei das mitgeprägt haben, was wir heute als »moderne Kunst« kennen.
Die Renaissance
Bevor wir uns den radikalen Italienerinnen des späten 16. und des 17. Jahrhunderts zuwenden, möchte ich zwei Künstlerinnen aus der Zeit davor herausgreifen: Katharina von Vigri (1413–1463), die spätere heilige Katharina von Bologna, eine Schriftstellerin, Nonne und versierte Manuskriptillustratorin, sowie Properzia de’ Rossi (1490–1530), eine für ihr ungestümes Wesen bekannte Bildhauerin. De’ Rossi wurde für ihre akribischen, winzigen Arbeiten mit Holz, Marmor und Kirschsteinen gefeiert (siehe das Familienwappen der Grassi, 1510–1530). Sie erhielt Aufträge, wie sie keine Frau je zuvor ausgeführt hatte, so etwa ihr lebendiges Marmorrelief Joseph und die Frau des Potiphar, um 1525–1526, das sie für die Fassade der Basilica di San Petronio in Bologna schuf. Beide Frauen konnten sich als Künstlerinnen betätigen, da sie das Glück hatten, in Bologna zur Welt zu kommen, wo man Frauen gegenüber sehr fortschrittlich eingestellt war.
Zu der Zeit war Bologna eine Vorreiterin in Sachen Berufstätigkeit von Frauen. Als Heimat von Europas ältester Universität, die seit dem 13. Jahrhundert weibliche Studierende förderte, sah die Stadt ihre Künstlerinnen als wesentlich für ihre Entwicklung an. Von Gelehrten gelobt, von Biografen beschrieben und von der Bevölkerung verehrt, konnten die Frauen auch auf die Unterstützung von Gönnern aus allen Schichten zählen. (In Florenz und Neapel war die Auftragsvergabe dagegen ausgewählten Adelsfamilien vorbehalten.) Frauen wurden auch ermutigt, ihre Arbeiten zu signieren und sich mit Selbstporträts – nicht zuletzt der Nachwelt – bekannt zu machen. Kein Wunder also, dass Historiker zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert in der Stadt sage und schreibe 68 Künstlerinnen ermittelt haben.
Diese bemerkenswerten Ausnahmen bekräftigen, dass Frauen immer schon durchaus für die Kunst geeignet waren. Doch trotz der günstigen Voraussetzungen zu jener Zeit waren Künstlerinnen in der Realität eine absolute Seltenheit und dienten eher als »Symbole« denn als »Pionierinnen«. (Nach de’ Rossis Tod ist 200 Jahre lang keine Bildhauerin mehr in den Annalen der Stadt verzeichnet.) Und wir wissen nur sehr wenig über die, die während der Renaissance tätig waren. Das meiste ist uns durch männliche Gelehrte oder Rechtsurkunden überliefert und kaum von den Frauen selbst.
Der Beginn der Renaissance wird allgemein um die Mitte des 14. Jahrhunderts angesetzt, etwa ein, zwei Jahrhunderte bevor Künstlerinnen überhaupt erst verzeichnet sind. Dieses Kapitel setzt indes im Italien der 1550er-Jahre ein, als nach gängiger Auffassung der Glanz der Hochrenaissance schon erheblich verblasst war.
1550 veröffentlichte der Florentiner Kunsthistoriker Giorgio Vasari mit seinen Le Vite die ersten Künstlerbiografien (mit nur ganz wenigen Frauen). Auf ihn geht auch der Begriff »Renaissance« (»Wiedergeburt«) zurück. Er kennzeichnet eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte und eine neue Ära allgemeiner Gelehrsamkeit und der Hinwendung zur Natur. In Italien entdeckten bildende Künstler und Gelehrte die klassische Antike und ihre Literatur für sich. An Inspiration mangelte es nicht angesichts der antiken Ruinen, auf denen viele der italienischen Staaten im wahrsten Sinne des Wortes ruhten. Zu den antiken Einflüssen zählen die Linearperspektive, eine Technik, die mittels mathematischer Prinzipien eine Illusion von Raum und Tiefe schuf, Naturalismus im Sinne einer anatomischen Genauigkeit sowie weltliche Themen, die zur Förderung von Humanismus und Individualismus beitrugen.
Durch ihre Lage an den wichtigsten Handelsrouten und als Tore zum konsumfreudigen Westen waren die italienischen Staaten zu enormem Reichtum gelangt, der vielfach in die Förderung der Künste floss. Kunsthauptstädte waren Rom, Sitz der mächtigen katholischen Kirche, die zur Verbreitung der göttlichen Botschaft Kunstwerke in Auftrag gab, und Florenz, deren Bankendynastien mithilfe der Kunstförderung Bildung, Finanzkraft und Verbundenheit mit der Kirche demonstrierten. Mit wachsendem Wohlstand setzte unter den adligen Mäzenen ein regelrechter Wettstreit um die gefeiertsten Künstler der Zeit ein. Kunst in immer größerem Stil heizte Fortschritte in den Techniken an, und schnell wurden die Städte Magnete für internationale Besucher.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts bildete sich die nördliche Renaissance heraus, eine kulturelle Revolution außerhalb Italiens, die die Leitgedanken der Renaissance in Europa verbreitete und eine Flut von künstlerischen Auftragsarbeiten in den Niederlanden, England, Frankreich und Spanien auslöste. Künstler standen allerorten hoch im Kurs – aber es waren fast ausnahmslos Männer.
Unbeeindruckt von all jenen, die sie als das »passive Geschlecht« abqualifizierten, setzten sich die Frauen jedoch zur Wehr. Sie entwickelten innovative Maltechniken und lehrten jüngere Künstlerinnengenerationen, Männer zu meiden, die ihre Kreativität zu unterdrücken versuchten. Eine von diesen Frauen war Plautilla Nelli (1524–1588), eine Dominikanerin, die in ihrem Kloster eine rein weibliche Werkstatt einrichtete. Nelli, die erste bekannte Florentiner Renaissancekünstlerin, war eine von nur vier Frauen unter den Hunderten von Männern, die Vasari in seinen Le Vite verewigte.
Mit 14 ging Nelli ins Kloster, bildete sich autodidaktisch zur Miniaturmalerin aus und arbeitete sich rasch weiter vor zu großformatigen Altarbildern, eine absolute Seltenheit für eine Frau ihrer Zeit. Heute ist sie vor allem für ihr jüngst restauriertes Letztes Abendmahl, um 1560, bekannt, ein Juwel auf Leinwand und die erste bekannte Darstellung des Themas von einer Frau. Seit 2019 ist es – nach 450 Jahren erstmals öffentlich – im Refektorium von Santa Maria Novella in Florenz ausgestellt.
Als Frau hätte Nelli eigentlich keine großformatigen religiösen Gemälde in Angriff nehmen dürfen, tat es aber trotzdem. Ihre farbenfrohe sieben mal zwei Meter große Darstellung Jesu und seiner zwölf Apostel besticht durch ihre anatomische Genauigkeit und feinfühlige Interpretation, was sich etwa in den angespannten Sehnen an den Hälsen der Apostel und den liebevollen Gesten zwischen Jesus und Johannes ausdrückt. Die erkennbar auf Naturalismus bedachte Nelli zeichnet Johannes sehr feminin (mit weichen Zügen und geröteten Wangen), was zwar nicht unüblich war, aber vielleicht auch an mangelnden männlichen Modellen lag.
Woher aber hatte Nelli das Wissen und die Fertigkeiten, die ihr eine solche Arbeit ermöglichten? Wir wissen, dass sie peinlich genau die Bilder des Künstlers Fra Bartolommeo studierte und kopierte, und Vasari befand, »dass sie wunderbare Dinge vollbracht hätte, wenn sie den Männern gleich Gelegenheit gehabt hätte, zu studieren, sich dem Zeichnen zu widmen und lebende und natürliche Dinge abzubilden«.
Eine Malerin, die das Glück hatte, eine solide künstlerische Ausbildung zu erhalten, war Sofonisba Anguissola (1532–1625), Tochter eines hochrangigen, wiewohl finanziell angeschlagenen Adligen aus Cremona. Bestrebt, auch seinen Töchtern eine gute Bildung zuteilwerden zu lassen, schickte der Vater seine beiden Ältesten zu einem örtlichen Maler in die Lehre (vielleicht auch, weil erst sein siebtes Kind ein Junge war). So konnte es Anguissola an den gesellschaftlichen Normen vorbei zu ihren Lebzeiten zu großem Erfolg und Ansehen bringen. In Spanien bekleidete sie die prestigeträchtige Stellung einer Hofmalerin, wurde von Michelangelo bewundert und von Vasari gepriesen (der ihre Porträts für »so lebensecht« hielt, »dass ihnen nur die Sprache fehlt«).
Anguissolas stille, intime Selbstbildnisse bringen ihre souveräne Art und funkelnden Augen zur Geltung. Oft malte sie sich beim Musizieren oder bei der Arbeit an der Staffelei, Pinsel und Farben griffbereit neben sich. Anguissola war der Inbegriff dessen, was eine gebildete Frau im 16. Jahrhundert erreichen konnte. Ihr nachhaltiger Erfolg ermutigte adlige Familien in ganz Europa dazu, auch in ihren Töchtern professionellen Ehrgeiz zu wecken. Berühmt ist Anguissolas Darstellung ihrer Schwestern beim munteren Schachspiel, eins von mehreren Porträts von Frauen bei intellektuellen Betätigungen.
Obwohl überwiegend auf Porträts beschränkt, bewies Anguissola großes Geschick in der Komposition ihrer Bilder, von der bergigen grünen Landschaft hinter den lebhaften Figuren im Schachspiel von 1555 bis hin zur komplexen Madonna-mit-Kind-Szene im Selbstbildnis an der Staffelei, um 1556.
Für mich ist ihr bestes Porträt Bernardino Campi malt Sofonisba Anguissola von 1550. Dieses geistreiche Werk unterläuft wunderbar die Geschlechterkonventionen. Auf den ersten Blick sehen wir Campi (einen Lehrer Anguissolas), der uns über die Schulter anschaut, während er das Bild der jungen Künstlerin gestaltet. Aber bei näherem Hinsehen bestimmt nicht er ihr Erscheinungsbild, sondern sie das seine. Sie nimmt nicht nur fast zweimal so viel Raum ein wie ihr Lehrer und lässt ihn die Verzierungen auf ihrer Jacke malen (für gewöhnlich die Aufgabe eines Lehrlings), 1996 vorübergehend freigelegte Pentimenti offenbaren auch, dass ursprünglich ihr Handgelenk das seine umfasste – als würde sie seine Hand über die Leinwand lenken.
Anguissola war außerordentlich begabt und noch im hohen Alter gewitzt wie eh und je. Mit Anfang 90 wurde sie 1624 von dem sehr viel jüngeren Anthonis van Dyck gemalt. Von ihrem Verstand fasziniert, porträtierte van Dyck sie als aufgeweckt und asketisch zugleich, was sich noch in ihren durchdringenden, wiewohl fast blinden Augen spiegelt. Er erinnerte sich, dass sie ihm geraten hatte, »das Licht nicht zu sehr zu verstärken, damit die Schatten nicht die Altersfalten betonten«.
Zwar werden wir nie ermessen können, was sie unter den gleichen Bedingungen wie ihre männlichen Kollegen noch alles geleistet hätte, doch zeugen ihre Gemälde von großer Experimentierfreude und von den raffinierten Tricks, mit denen sie Grenzen unterwanderte, die ihrem Talent gesetzt wurden.
Anders als Anguissola begnügte sich die etwas jüngere Bologneserin Lavinia Fontana (1552–1614) nicht mit Porträts. Sie malte auch religiöse und mythologische Szenen, darunter großformatige Altarbilder. Fontana, die bei vielen als erste Malerin mit eigenem Atelier gilt, war die Tochter eines bekannten Bologneser Künstlers. In seinem Atelier lernte sie alle professionellen Tricks und kopierte zur Übung seine Bilder. Sie entwickelte einen vielfältigen, ausgeklügelten Stil und nahm auch Anleihen beim Manierismus: verlängerte Gliedmaßen, wirbelnder Faltenwurf und dramatische kurvenreiche Posen.
Als Porträtmalerin war Fontana bei der Bologneser Elite besonders beliebt wegen ihrer Detailtreue und der Fähigkeit, funkelnde Juwelen und üppige Muster wiederzugeben. (Mein Favorit ist das Porträt der Bianca degli Utili Maselli mit ihren sechs Kindern, um 1605, auf dem alle gleich gekleidet sind samt schimmernden Spitzenkrausen.)
Ihr Bestreben, als hochgebildete Künstlerin in die Geschichte einzugehen, setzte sie in einer ganzen Reihe von Selbstporträts um. Im Selbstbildnis im Atelier, 1579, finden wir sie im Begriff, antike Bronzen und Gipsabgüsse zu zeichnen, wobei ihre prächtige Robe auf ihre hochrangige Kundschaft verweist. Musizierend ist sie im Selbstbildnis am Spinett mit Dienerin, 1577, zu sehen, während im Hintergrund ihre Staffelei aufleuchtet. Der Liebesknoten auf dem Instrument verrät indes noch etwas mehr: Das Bild war als Geschenk für ihren zukünftigen Schwiegervater gedacht, zweifelsohne, um ihn von ihrem Talent zu überzeugen. Als weitere Demonstration ihrer Gelehrsamkeit verkündet eine Inschrift in Latein: »Lavinia, die unverheiratete Tochter des Prospero Fontana, malte dies, ihr Bildnis, nach dem Spiegel, 1577«.
Mit 25 heiratete sie einen ehemaligen Schüler ihres Vaters, der ihr nicht nur ihren Mädchennamen ließ, sondern auch ihre Kinder großzog. Mit ihrem erfolgreichen Atelierbetrieb (und unglaublichen 24 öffentlichen Aufträgen) im Rücken ging sie rasch zu größeren erzählenden Bildern über, und ihr Ruhm wuchs. 1604 war sie bereits nach Rom umgesiedelt, dem Mekka für ambitionierte Künstler, wo sie in die angesehene Accademia di San Luca aufgenommen und vom Papst gefördert wurde.
Fontana war eine der ersten Frauen, die weibliche Akte malten, wofür das schillernde und verführerische Venus und Mars, 1595, ein eindrucksvolles Beispiel ist.
Auch in Flandern waren Frauen als Malerinnen erfolgreich, wenn sie auch weit weniger bekannt sind als ihre italienischen Kolleginnen. Früher noch als Fontana unternahm Catharina van Hemessen (1528– um 1587) ebenfalls ihre ersten Schritte im Atelier ihres Vaters. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts malte sie zahllose kleinformatige Porträts, meist vor dunklem Hintergrund, mit schlichter Kleidung und ernsten Gesichtern. Van Hemessen schuf das wohl erste Selbstporträt eines Malers – in dem Fall einer Malerin – an der Staffelei. Die Inschrift auf ihrem Selbstbildnis lautet: »Ich, Catharina van Hemessen, habe mich selbst gemalt, 1548, im Alter von 20 Jahren«. Wie ihre italienischen Zeitgenossinnen wollte sie als berufstätige Frau im Gedächtnis bleiben.
Stillleben im 17. Jahrhundert
Mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Ausbreitung des Protestantismus in Nordeuropa verlagerte sich das Interesse der Mäzene von religiösen auf weltliche Themen. Stillleben kamen in Mode als Mittel, den eigenen Wohlstand zur Schau zu stellen, etwa aus aller Welt importierte Raritäten (Gewürze, Tabak, Vasen, Teppiche, Keramik) oder exotische kulinarische Genüsse, die nur einigen wenigen vorbehalten waren.
Stillleben galten auch als angemessenes Genre für Frauen aus der Oberschicht. Sie kamen damit den Männern nicht ins Gehege, die sich gern als Hüter der »intellektuelleren« Sujets (Religion, Mythologie) sahen, benötigten keine Kenntnisse der menschlichen Anatomie und hatten die Modelle im eigenen Heim. Bildern von Blumen und essbaren Gütern wohnte überdies eine moralische Bedeutung inne. Sie standen für vanitas, ein biblisches Wort, das die Betrachter an ihre eigene Sterblichkeit, die Vergänglichkeit des Lebens und die Wertlosigkeit materieller Dinge in den Augen Gottes erinnern sollte.
In der Renaissance war das Stillleben, dessen Ursprünge in der Antike liegen, schon populär, und zu Anfang des 17. Jahrhunderts galt es als ehrbare Kunstform. Auch hier wussten die Frauen wieder die vorgegebenen Grenzen des Genres auszuloten, indem sie ihre hohe fachliche Kompetenz demonstrierten und ihre Identität als Künstlerinnen geltend machten. Das zeigt sich besonders in den versteckten Selbstporträts in ihren Stillleben – vielleicht wollten sie damit auch sicherstellen, dass ihre Werke nicht den männlichen Kollegen zugeschrieben werden.
Früh dem Stillleben zugewandt hat sich die Flämin Clara Peeters (1594– um 1657), die 2016 als erste Frau mit einer großen Einzelausstellung im Prado geehrt wurde. Peeters entwickelte beim Stillleben einen ganz eigenen Stil. Oft malte sie einladend angerichtete auserlesene Weine, Früchte, Gemüse und Fische mit glänzenden Gefäßen und kraftvoll aufblühenden Blumen. Schaut man aber genauer hin, scheint sich etwas in den Kelchen zu spiegeln. Und dann enthüllen sich dem Betrachter winzige Selbstporträts der Malerin.
Mein persönlicher Favorit ist das Stillleben mit Blumen und vergoldeten Pokalen von 1612, das zwei kunstvolle vergoldete Kelche, eine Steinvase, Muscheln, eine einzelne Tulpe und eine Porzellanschale mit Ketten vor einem dunklen Hintergrund zeigt. Das Auge der Betrachterin richtet sich nicht etwa auf den Kelch in der Mitte, sondern folgt der eleganten Diagonale, die es zu dem ganz rechts führt – wo sich, eingearbeitet in den Kelch, unglaubliche zehn Selbstbildnisse offenbaren!
Peeters war nicht die einzige Malerin, die sich mit Stillleben und winzigen Reflexionen hervortat. In Mailand begann Fede Galizia (1578–1630) bereits als Kind mit detailreichen Kompositionen aus Kirschen, Äpfeln, Pfirsichen und Birnen vor dem ihr eigenen gedämpften Hintergrund. Von Galizia, die ihr Handwerk wohl von ihrem Vater, einem Miniaturmaler, lernte, stammt auch das nach Expertenmeinung »erste datierte Stillleben eines italienischen Malers« aus dem Jahr 1602. Die bereits im Jugendalter international bekannte Künstlerin hatte ebenso wie Peeters eine Vorliebe für versteckte Details. Bei genauer Betrachtung des ausdrucksstarken Bildnis des Paolo Morigia, 1592–1595, erkennt man in den Augengläsern in der linken Hand des Porträtierten die fein ausgeführte Reflexion eines Fensters.
Die Stillleben der italienischen Barockkünstlerin Giovanna Garzoni (1600–1670) sind ausgesprochen naturalistisch und lebendig: fein gezeichnete Artischocken mit schrumpeligen Blättern, Kirschen wie zum Reinbeißen, ledrige Zitronenschalen, naturgetreue Wespen. Die in der Komposition schlicht gehaltenen Darstellungen von Gegenständen und Früchten aus der ganzen Welt sind hier mit der Präzision naturwissenschaftlicher Zeichnungen ausgeführt. Klein, aber fein und von hohem Sammlerwert, waren Garzonis Bilder so begehrt, dass sie Kunsthistorikern zufolge jeden Preis dafür verlangen konnte.
Die aus einer gebildeten Familie aus der Region Marken stammende Garzoni war bewandert in Musik, Malerei und Kalligrafie. Anders als viele Künstlerinnen ihrer Zeit reiste sie kreuz und quer durch Italien, absolvierte ihre Ausbildung in Venedig und Rom und hatte später ihren Wohnsitz in Florenz, wo sie wohl auch mit Artemisia Gentileschi zusammentraf.
Zum Werk der auf kein einzelnes Medium beziehungsweise Genre beschränkten Künstlerin zählen ein Kalligrafiebuch mit einer Abfolge von mit Früchten verzierten Initialen, Gedichte und Briefe in ihrer erlesenen Handschrift sowie glanzvolle Porträtminiaturen.
Eine ihrer besten ist die des äthiopischen Prinzen Zaga Christ. Dieses mit äußerster Präzision gefertigte Kleinod von knapp sechs Zentimetern Größe gilt als erste Darstellung eines Schwarzen in der westeuropäischen Miniaturkunst. Der Prinz, der zur Hervorhebung seines königlichen Rangs europäische Hoftracht trägt, war nach der Ermordung seines Vaters, des Königs von Äthiopien, nach Europa geflohen (und soll in Rom eine Affäre mit einer Franziskanernonne gehabt haben!).
Beachtenswert ist an diesem Kunstwerk auch die Rückseite, die eine Freundschaft zwischen Garzoni und dem Prinzen nahelegt und den Namen der Malerin in amharischer Schrift trägt.
Barock
Der Barock markiert mit seinen oft brutalen, feurigen Motiven einen Wandel sowohl in der Umsetzung der Themen als auch in der Maltechnik. Hatten frühere Künstler sich zumeist an die genaue Wiedergabe der Form gehalten, machten sie sich im Barock das Üppige, Exzessive zu eigen. Heraus kamen Bilder voller theatralischem Schwung und lebhafter Lichtkontraste. Das Zentrum des mit dem 17. Jahrhundert einsetzenden Barock war Rom und sein größter Förderer die katholische Kirche. Sie wollte kühne und emotionale religiöse Szenen, die zum Lesen der biblischen Erzählungen animieren und die Menschen vom Protestantismus loseisen sollten.
Künstlerinnen waren immer noch eher selten, wenn auch nicht mehr die Kuriosa von einst, sie blieben weiterhin durch gesellschaftliche Restriktionen und mangelnde Ressourcen eingeschränkt und waren zumeist notgedrungen ihre eigenen Modelle. Doch während die Renaissancefrauen sich als begehrenswert und gebildet darstellten, wirken die aus dem Barock auf mich »präsenter« in ihren Werken – häufig malten sie sich selbst in der Rolle einer biblischen Heldin. Genau diese Präsenz ermöglicht uns heute einen leichteren Zugang zu ihnen.
Dunkler, mit sensationellen Lichteffekten durchdrungener Hintergrund, bluttriefende biblische und mythologische Themen, intensiver Realismus, triumphierende Frauen, eindrucksvolle psychologische Ausführung – das sind nur einige Elemente im erstaunlichen Werk der Römerin Artemisia Gentileschi (1593– um 1653), die schon zu Lebzeiten eine internationale Berühmtheit war. Sie wurde als erste Frau in die renommierte Florentiner Accademia delle Arti del Disegno aufgenommen, war in ganz Italien (und darüber hinaus) tätig und zählte Charles I. sowie die Medici zu ihren Gönnern. Doch begann diese Erfolgsgeschichte alles andere als rosig.
Als älteste Tochter einer Künstlerfamilie zog Gentileschi nach dem frühen Tod der Mutter ihre drei Brüder groß und malte nebenher im Atelier ihres Vaters Orazio Pigmente. Als Frau war es ihr verwehrt, alleine die Baudenkmäler und Kirchen der Stadt zu erkunden oder zusammen mit anderen das Modellzeichnen zu erlernen, daher studierte und kopierte sie sorgfältig die biblischen Szenen in den Gemälden ihres Vaters – Motive, die sie später meisterlich selbst in Angriff nahm.
Ermutigt von ihrem Vater, der ihr ihren klassischen Vornamen gegeben hatte, signierte und datierte sie ihr erstes großformatiges Bild, als sie gerade einmal 17 Jahre alt war. Susanna und die Ältesten, 1610, ist ein gewaltiges Werk von großer Dramatik, das ihre hervorragende Maltechnik ebenso offenbart wie ihr erzählerisches Talent. Gentileschi erzählt hier die Geschichte einer tugendhaften jungen Frau, die in ihrem Garten ein Bad nimmt, als zwei lüsterne Männer sie zu verführen versuchen. Der Betrachter verfolgt mit Unbehagen und Schmerz den spannungsgeladenen Moment, in dem Susanna ihren Körper vor den Eindringlingen abschirmt. In ihrem Bemühen, zu ihr zu gelangen, ziehen die Männer sie fast schon an den Haaren, während sie sich über die Holzverkleidung hängen, die sie eigentlich auf Abstand halten soll. Es war im Barock ein gängiges Motiv (auch wegen der halb nackten Susanna), doch Gentileschi stellt es aus Sicht der Frau dar und nicht der Männer. Es ist zwar nur Spekulation, aber dieses Werk könnte auch darauf anspielen, wie das Leben für eine Frau im Italien des 17. Jahrhunderts gewesen sein mag.
Im Jahr 1611 wurde Gentileschi, als sie im heimischen Atelier arbeitete, von einem Maler-Freund ihres Vaters, Agostino Tassi, vergewaltigt. Fast ein Jahr später brachte Orazio Tassi vor Gericht, hauptsächlich weil die Tat Schande über die Familie gebracht hatte. Von dem traumatischen sieben Monate dauernden Prozess ist ein 300-seitiges Protokoll überliefert. Daraus spricht die mutige, eloquente Stimme Artemisias zu uns: »Dann warf er mich auf den Bettrand, drückte mir eine Hand auf die Brust und schob ein Knie zwischen meine Schenkel, damit ich sie nicht schloss. Er hob meine Kleider an und drückte mir ein Taschentuch auf den Mund, um mein Schreien zu verhindern.«
Gentileschi wurde während des gesamten Prozesses mit einer »Sibille« traktiert (fest um die Finger gezurrte Stricke in der Funktion eines Lügendetektors – für einen Künstler die schlimmste Folter). Sie wurde außerdem gezwungen, ihre Unschuld zu beweisen, was sie mit den berühmten Worten »èvero, è vero, è vero« (»es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr«) tat. Trotz eines Schuldspruchs entging Tassi unter dem Schutz des Papstes der Strafe, was kaum verwundert.
Nach dem Ende des Prozesses wurde Gentileschi 1612 verheiratet und zog nach Florenz, wo sie einen kometenhaften Aufstieg erlebte. Gefragt waren nicht nur die Porträts, die sie selbst malte, sondern auch solche, die sie darstellten (oder ihre Hand). In dieser Zeit schuf sie ihre wohl besten Werke. Mit ihren großformatigen, psychologisch überaus intensiven Ganzfigurenkompositionen gab Gentileschi dem Motiv der heldenhaften Frauen neues Gewicht. Von Judith bis Susanna, von Lucretia bis Diana verarbeitete sie biblische und mythologische Stoffe auf eine Weise, wie Männer das nie gewagt hatten. Sie nahm sogar kleine Änderungen an den Geschichten vor, als wollte sie die Entschlossenheit der Frauen noch verstärken, so etwa in Judith tötet Holofernes, 1612. Das Bild, das sie mit 19 Jahren malte, nimmt Bezug auf eine Erzählung aus dem Alten Testament. Wenn wir es jedoch mit Caravaggios Version des Stoffes vergleichen, fällt unwillkürlich auf, dass in seiner Darstellung Judith passiv wirkt und Holofernes machtvoll. In krassem Gegensatz dazu stellt Gentileschi Judith und ihre Magd (die in der ursprünglichen Geschichte nur Wache hält) in den Mittelpunkt. Die beiden trennen Holofernes mit einem Schwert brutal den Kopf vom Hals, als würden sie ein Tier schlachten. Die gelassen wirkenden muskulösen Frauen werden von unten her aus einer einzelnen Lichtquelle beleuchtet, während sie den Oberkörper des Generals niederdrücken und an seinen Haaren zerren. Blut ergießt sich über die elfenbeinfarbenen Laken, und Holofernes, dessen Augen und Mund erst langsam aufgehen, tut seine letzten Atemzüge.
Mit diesem Werk stieg Gentileschi endgültig in die Liga der größten Künstler ihrer Zeit auf. Es diente nicht nur als Visitenkarte für potenzielle Florentiner Kunden wie die Medici, es bewies zudem, dass auch Frauen derartige Motive meistern konnten.
Durch diesen Triumph gestärkt, verewigte sich Gentileschi mit ihrem Selbstbildnis als heilige Katharina von Alexandrien, 1615–1617, in Gestalt einer Heiligen aus dem 4. Jahrhundert, die auf einem Rad aus Eisennägeln gefoltert und durch göttliche Macht erlöst worden war. Sie strahlt Stärke aus, indem sie mit der linken Hand das Rad umklammert, während die rechte eine Märtyrerpalme hält. Ihr ernster Blick nimmt uns beinahe gebieterisch gefangen.
Ein Großteil von Gentileschis Werk handelt von Frauen, die auf Rache aus sind, doch erscheinen sie nie als Opfer. Auch wenn es verlockend ist, ihr eigenes Leben in diese Bilder hineinzuinterpretieren, sollten wir sie in erster Linie als eigenständige Kunstwerke sehen. Auch wegen ihres starken Selbstwertgefühls ist Gentileschi zu einer Ikone der Frauenbewegung geworden. Aus ihren Briefen wissen wir, dass sie eine überzeugte Verfechterin einer gerechten Behandlung und Bezahlung von Frauen war. In einem Brief verlangt die sparsame Geschäftsfrau ein höheres Honorar für vielfigurige Kompositionen, in einem anderen versichert sie einem sizilianischen Sammler: »Ihr werdet den Geist eines Caesar im Herzen einer Frau vorfinden.«
Doch ist Gentileschi erst in den letzten vier Jahrzehnten wieder zu Ansehen gekommen. Als die Barockkunst um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus der Mode kam, geriet auch ihr Werk in Vergessenheit. So blieb es, bis feministische Kunsthistorikerinnen wie Nochlin und Sutherland Harris mit ihrer einflussreichen Ausstellung und Mary Garrard mit ihrer bahnbrechenden Monografie sie in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts wieder ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit rückten. Heute ist Gentileschi Thema von Büchern, Forschungsarbeiten, Theaterstücken und Filmen, und 2020 wurde ihr Ruhm durch eine große Ausstellung in der National Gallery in London mit einer riesigen Besucherzahl (trotz der herrschenden Coronapandemie) weiter angefacht.
Großformatige Arbeiten sind aus dem Barock auch von der Bologneser Malerin, Zeichnerin und Kupferstecherin Elisabetta Sirani (1638–1665) überliefert. Obwohl sie heute weniger bekannt ist als Gentileschi, hat sie doch ein bemerkenswertes Werk vorzuweisen. Auch sie stellte häufig heroische Frauengestalten in den Mittelpunkt ihrer Bilder. Doch lassen ihre zarteren Pinselstriche und gedämpfteren Farben die Darstellungen nicht so eklatant dramatisch erscheinen. Eine Ausnahme bildet da allerdings Timoklea tötet den Hauptmann Alexanders des Großen, 1659, auf dem anschaulich eine brutale Bluttat geschildert wird. Wie viele Malerinnen ihrer Zeit wuchs Sirani in einer Künstlerfamilie auf und lernte ihr Handwerk in der Werkstatt ihres Vaters. Als dieser aufgrund seiner Gicht nicht mehr arbeiten konnte, musste sie den Betrieb übernehmen und schon in jungen Jahren als Alleinverdienerin der Familie die Eltern sowie drei Geschwister ernähren.
Sirani war sehr produktiv und schuf mehr öffentliche Arbeiten und Altarbilder als ihre Vorgängerinnen. Besonders zeichnete sie sich durch ihre historischen Sujets aus, wie ihr bedeutendstes Werk, Portia verwundet sich am Oberschenkel, 1664, eindrucksvoll belegt.
Portia, die Frau des Brutus, wird hier dabei gezeigt, wie sie sich einen »Stiletto« (ein beim Sticken verwendetes Gerät) in den Oberschenkel sticht. Doch ist ihre Pose gelassen und würdevoll, geradezu ein Abbild der Kraft einer Frau, alle Widrigkeiten zu überwinden. Indem sie ihre Protagonistin in der Mode des 17. Jahrhunderts kleidet, scheint Sirani nicht einfach nur auf sich selbst zu verweisen, sondern auf die Entschlossenheit und Haltung der Bologneser Frauen im Allgemeinen.
Sirani, die ein offenes Atelier führte und sich beim Arbeiten gern zuschauen ließ (vielleicht um ihr Talent als Frau in der Kunst zu beweisen), sicherte sich Hunderte von Aufträgen und wurde von ihrem zeitgenössischen Biografen, dem Bologneser Kunsthistoriker Carlo Cesare Malvasia, als »Wunderkind der Kunst, Zierde des weiblichen Geschlechts, Juwel Italiens und Sonne Europas« gepriesen.
Doch im Alter von 27 Jahren starb sie ganz plötzlich. Eine Zeit lang glaubte man, sie sei vergiftet worden. Bologna war erschüttert. In der Basilika San Domenico wurde eine aufwendige Trauerfeier abgehalten samt »Ehrentempel«, einer lebensgroßen Skulptur der Künstlerin und Heerscharen von Trauernden. Ihr Vermächtnis, als Malerin wie als Vorbild für Frauen, wird noch heute in der Stadt geehrt, und dass so viele Frauen in den Jahren nach ihrem Tod die Malerei zu ihrem Beruf machten, wird ihr zugutegehalten.
Goldenes Zeitalter und botanische Kunst
Im 17. Jahrhundert wurden die Niederlande zu einer der reichsten Nationen der Welt. Die florierende Wirtschaft – gefördert durch koloniale Ausbeutung – führte in Verbindung mit raschen Fortschritten in Wissenschaft und Kunst nach der Unabhängigkeit von Spanien 1581 zum Aufstieg einer wohlhabenden Kaufmannsschicht, die durchaus Ambitionen in der Kunstförderung hatte. Da hier der Protestantismus den Ton angab, war der Geschmack allerdings ein anderer als im katholischen Italien. Und mit dem Aufkommen eines unabhängigen Kunstmarkts bedeutete eine größere Nachfrage mehr Chancen für Künstlerinnen und Künstler.
In einer der liberaleren Epochen der Kunstgeschichte war die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen nicht nur in religiöser Hinsicht relativ tolerant, sondern auch fortschrittlicher gegenüber Frauen. Ihre Bildung wurde gefördert, und sie durften in qualifizierten Berufen arbeiten. In dieser Zeit betätigten sich über 150 Künstlerinnen (gegenüber 3200 Künstlern) in einer Vielzahl von Medien.
Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts setzten auf psychologische Intensität und markante Lichteffekte und erteilten der ehrfurchtsvollen Prachtentfaltung früherer italienischer Bewegungen eine Absage. Sie bevorzugten kleinformatigere weltliche Konversationsstücke, die zum Teil mit groben, lockeren Pinselstrichen schwungvoll ausgeführt waren.
Eins der künstlerischen Zentren der Zeit war die Stadt Haarlem, aus der auch die Malerin Judith Leyster (1609–1660) stammte, damals eine der prominentesten Künstlerinnen. Sie war das achte Kind eines Brauereibesitzers und lebte als Jugendliche vorübergehend in Vreeland bei Utrecht. Dort kam sie wohl mit den Utrechter Caravaggisten in Berührung, die mit Chiaroscuro (Hell-Dunkel-Malerei) dramatische Effekte erzielten, denn auch sie verwendete später diese Technik.
Mitte der 1620er-Jahre war Leyster bereits ein Star der Malereiszene und wurde von einem zeitgenössischen Chronisten 1648 als »wahrer Leitstern in der Kunst« tituliert (was auch der wörtlichen Bedeutung ihres Namens entspricht und zu ihrer Signatur passte, der sie immer einen Stern beifügte). Mit 24 wurde sie das jüngste Mitglied (und eine von nur zwei Frauen) in der Haarlemer Malergilde und verkehrte mit den prominentesten Künstlern der Zeit. (Noch erhaltenen Rechtsdokumenten zufolge war sie einmal in einen Streit mit Frans Hals verstrickt, nachdem der eine ihrer Hilfskräfte abgeworben hatte.)
Leyster lässt ihre von überschäumender Energie erfüllten Figuren meist vor einem neutralen Hintergrund lebendig werden. Mit ihren ungezwungenen Posen, exzentrischen Kleidern und leicht geöffneten Lippen sehen sie aus, als wollten sie gleich lossingen. Am besten gefällt mir an ihrem Werk, wie gut sie die Aura der Umgebung einzufangen versteht, ob es nun um einen vergnügten, betrunkenen Mann geht, der sich im Nachmittagslicht sonnt (Der lustige Zecher, 1629), oder um einen Musikanten, der, von einer einzelnen Flamme beleuchtet, in intimerem Rahmen des Nachts leise auf seinem Instrument spielt (Die Serenade, 1629).
Auch Leysters Selbstbildnis von 1630 ist von Leichtigkeit und Frohsinn erfüllt. Lässig und selbstbewusst sitzt sie vor ihrer Staffelei, in der einen Hand einen feinen Pinsel, in der anderen benutzte Pinsel und eine Palette mit frischer Farbe – als hätten wir sie beim Malen unterbrochen. Aufwendig gekleidet mit Spitzenkragen und passenden Ärmelaufschlägen, macht es ihr sichtlich Freude, sich nicht nur in Aktion darzustellen, sondern auch anhand der kleineren Studie auf der Staffelei ihre künstlerische Bandbreite zu demonstrieren.
Trotz ihres frühen Erfolgs (mit 30 betrieb sie ein Atelier mit Hilfskräften und drei männlichen Schülern) ging es nach der Heirat mit einem Maler 1636 mit ihrer Karriere bergab. Sie zog fünf Kinder groß und managte das Atelier ihres Mannes, und ihre wenigen Gemeinschaftsarbeiten mit ihm wurden ihr kaum angerechnet.
Aufgrund von falschen Zuordnungen wurde ihr Talent erst nach über zwei Jahrhunderten durch einen faustdicken Skandal wiederentdeckt. 1893 stellte sich heraus, dass die Lustige Gesellschaft von 1630, die der Louvre als einen Frans Hals gekauft hatte, in Wahrheit mit den Initialen JL und einem Stern signiert war. Seitdem sind noch viele weitere Bilder aufgetaucht, die Leysters »Leitstern«-Status aufs Neue unterstreichen.
Bei dem wachsenden Interesse an Botanik und Gartenbau erfreute sich die Blumenmalerei vor allem in Holland und Flandern großer Beliebtheit. Die gehobenen Schichten bezogen inzwischen Waren aus aller Welt, und exotische Pflanzen wurden bald zu Sammlerstücken, die von Reichtum und guten Handelsbeziehungen zeugten.
Als Blumenmaler brillierten vor allem Frauen. Eine Reihe von Holländerinnen revolutionierte das Genre mit naturgetreuen Bildern, die einen Eindruck von der »Tulpenmanie« (der enormen Wertsteigerung von Tulpen) im 17. Jahrhundert vermitteln. Die Gartenarbeit war in den Niederlanden ohnehin schon ein überaus beliebter Zeitvertreib, wie die zahlreichen botanischen Gärten bezeugen, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Blumenmalerei dort ihr Zentrum hatte.
Die in Den Haag geborene Rachel Ruysch (1664–1750) versetzte Kunstfreunde ins Staunen mit ihren ausgefeilten Darstellungen von Flora und Fauna, die sie bis ins hohe Alter anfertigte. Ruysch war international berühmt und finanziell nicht minder erfolgreich als ihre männlichen Kollegen – für ein Bild von ihr wurden bis zu 750 Gulden gezahlt, fast zweimal so viel wie für einen Rembrandt zu dessen Lebzeiten. Gleichwohl ist sie zwar in wichtigen Museen, aber nur selten in Kunstbänden zu finden.
Für ihre bunten Mischungen von Blumen aus verschiedenen Jahreszeiten (Pfingstrosen, Mohnblumen, Apfelblüten oder Lilien) konnte Ruysch auf die Passion ihres Vaters, eines Anatomieprofessors und Botanikers, zurückgreifen. Er besaß eine große Naturaliensammlung mit exotischen Pflanzen, Schädeln, Mineralien, Insekten und sogar einbalsamierten Körperteilen und Föten. So konnte seine Tochter in ihren Werken Pflanzen aus aller Welt zusammenbringen, die sie aus eigener Anschauung kannte, und die idealisiertesten Sträuße aller Zeiten für die Nachwelt verewigen.
Ruyschs Sträuße platzen förmlich aus ihren verborgenen Vasen heraus und wuchern gleichzeitig scheinbar ins Bodenlose. Die von einer einzelnen Lichtquelle erhellten, meist voll erblühten Blumen sind in aller Deutlichkeit wiedergegeben, seien es die Fruchtblätter oder die gewundenen Stiele. Auf den Blättern ist jedes Äderchen, jedes Fältchen und Tröpfchen freigelegt, und in den Blüten huschen winzige Insekten umher, wie man im Stillleben mit Blumen auf einem Marmortisch, 1716, beobachten kann. Ruysch war in ihrer geradezu anatomischen Präzision wie besessen und presste für eine naturgetreue Optik zum Beispiel Schmetterlingsflügel in die noch feuchte Farbe. Nie zuvor hatte man bei gemalten Blumen eine so üppige Vielfalt und unverfälschte Subtilität erlebt.
Rachel Ruysch war nicht nur Mutter von zehn Kindern, sondern auch das erste weibliche Mitglied der Malergilde von Den Haag und Hofmalerin in Düsseldorf.
Während der Blütezeit des Stilllebens brachten einige Künstlerinnen auch die Naturwissenschaften entscheidend voran. Das gilt besonders für Maria Sibylla Merian (1647–1717), eine Entomologin, Botanikerin und Naturforscherin, die unter Künstlerinnen und Künstlern ebenso bekannt war wie unter Gärtnern und deren Insektenforschung noch heute Geltung besitzt.
Die in Deutschland geborene und ab 1691 in Amsterdam heimische Merian war eine Insektenliebhaberin. Heute gilt sie als eine der Begründerinnen der modernen Zoologie, vor allem aufgrund ihrer naturkundlichen Illustrationen, in denen sie die Metamorphosen von fast 200 Insektenarten dokumentierte. Merians große Stunde kam 1699, als sie mit ihrer Tochter an die Nordostspitze Südamerikas reiste und dort bis dahin in Europa unbekannte Pflanzen und Insekten erfasste.
Es war eine der ersten Fahrten, die ausschließlich der wissenschaftlichen Feldforschung dienten, und heraus kam ihr brillantes Meisterwerk Metamorphosis insectorum Surinamensium. Das 1705 auf Latein und Holländisch erschienene Buch enthielt auch 60 akribische Illustrationen von Merians Hand, ergänzt durch detaillierte wissenschaftliche Beschreibungen.
In ganz Europa war man tief beeindruckt von Merians Forschung, und Berühmtheiten vom Rang Goethes zogen ihr Werk zurate. Doch nach ihrem Tod blieb ihre Leistung bis ins 19. Jahrhundert hinein unbeachtet. Erst in den 1970er- und 1980er-Jahren wurde ihr in britischen und deutschen Publikationen wieder die ihr gebührende Anerkennung zuteil, und dank einer Neuveröffentlichung der Metamorphosis insectorum zum 300. Jahrestag ihres Todes 2017 ist ihr Name inzwischen wieder bekannt.
Sowohl Merian als auch Ruysch waren Meisterinnen ihres Fachs und führten die Blumenmalerei auf einem ausnehmend hohen wissenschaftlichen und künstlerischen Niveau aus. Doch beschränkten sich die Frauen in den Sieben Provinzen (und darüber hinaus) nicht auf die Botanik als Motiv, ja nicht einmal auf die Malerei.
Eine Künstlerin, die mit außergewöhnlicher Begabung komplexe Naturmotive in alternativen Medien umsetzte, war Joanna Koerten (1650–1715). Die aus Amsterdam stammende Koerten war Autodidaktin und auf Scherenschnitte spezialisiert. Die kunstvoll aus Papier geschnittenen Umrisse von Motiven vor einem kontrastierenden Hintergrund erforderten die gleiche – wenn nicht noch mehr – akribische Sorgfalt wie die Ölmalerei. Nicht selten im Miniaturformat schuf Koerten äußerst filigrane Szenen, so etwa die Jungfrau mit Kind und heiligem Johannes, um 1703. Dem aufmerksamen Betrachter des knapp sieben Zentimeter hohen Bildes offenbaren sich faszinierende Details: ausladende Zweige, die wie Feuerwerk hervorsprießen, Schriftbänder, die sich um einen Trompe-l’œil-Rahmen (dem also eine Augentäuschung zugrunde liegt) schlingen, Heiligenscheine um die Madonna und ihr Kind, zwischen den Bäumen und Blättern umherhuschende Tiere.
Im 18. Jahrhundert erwies sich die Papiercollage als ebenso beliebtes Medium wie der Scherenschnitt, vor allem in der gehobenen britischen Gesellschaft. Eine Pionierin dieser Technik war Mary Delany (1700–1788). Dank ihrer adligen Herkunft war sie in Musik, Kunst, Sprachen und Stickerei bewandert und schuf nahezu 1000 ungemein detaillierte florale Collagen. Aber das Erstaunliche ist: Sie begann mit ihren »Papiermosaiken«, wie sie selbst sie nannte, erst mit 72 Jahren, nachdem die Ähnlichkeit zwischen dem Blütenblatt einer Geranie und einem roten Stück Papier sie in höchste Verzückung versetzt hatte. Fortan arbeitete sie über viele Jahre fieberhaft an ihrem Collagen-Projekt Flora Delanica, bis gegen Ende ihres Lebens ihre Sehkraft nachließ.
Delanys originelle Arbeiten waren geradezu revolutionär und gehören zu den ersten Beispielen für Collagen in der westlichen Kunst. Für ihre radikale Technik besorgte sie sich haufenweise Papier in verschiedenen Farben, Gewichten und Arten, das sie ohne Vorstudien zurechtschnitt. Diese Ausschnitte klebte sie dann auf einen matt-dunklen Hintergrund, um so einen scharfen Kontrast zu den leuchtenden Farben der Blumen zu schaffen und die schillernden Details hervorzuheben. In der Strandlilie, 1778, mit ihren faserigen Blütenblättern und den in der allgemeinen Reglosigkeit umherwirbelnden Pollenkörnern lässt sich das gut erkennen.
Die für ihre wissenschaftliche Präzision gerühmte Flora Delanica ist so naturgetreu, als würde sie frei über den Nachthimmel wogen. So, wie ihre Zeitgenossinnen das Stillleben weiterentwickelten oder neuen Techniken den Weg bereiteten, war Mary Delany eine Pionierin in der künstlerischen Abbildung von Botanik. Oder wie sie selbst es ganz schlicht auf den Punkt brachte: »Ich habe eine neue Methode erfunden, Blumen nachzuahmen.«
Das 18. Jahrhundert
Das 18. Jahrhundert brachte nicht nur in künstlerischer und stilistischer Hinsicht viele Fortschritte, sondern auch für die Rolle der Frau. Aufzeichnungen zufolge betätigten sich in Europa fast 300 Künstlerinnen berufsmäßig als Miniatur- oder Porträtmalerinnen oder als Kupferstecherinnen, zum Teil mit großem Erfolg. Sie beherrschten ganze Märkte, brachten es zu beträchtlichen Honoraren und Aufträgen aus dem Königshaus, und ein paar Frauen beschritten mit ihren komplexen Historiengemälden und differenzierten Porträts komplett neue Wege. Im Eilverfahren gelangten sie an einige der renommiertesten Kunstakademien der Zeit, auch dank ihrer guten Beziehungen zu hochrangigen Mäzenen. Doch gingen ausgerechnet von ebenjenen Akademien (vor allem von der Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris und der Royal Academy of Arts in London) schwerwiegende Rückschläge für die Anerkennung von Künstlerinnen aus.
Zwar gab es schon seit der Renaissance Akademien, doch waren diese beiden eigens zu dem Zweck gegründet worden, Künstlern zu einer Grundausbildung in Theorie und Praxis, Kontakten zu Mäzenen durch Ausstellungen, Bewahrung ihres Vermächtnisses sowie – nicht zu unterschätzen – Geltung zu verhelfen. Wenig überraschend waren Frauen nicht unbedingt erwünscht.
Besagte Akademien unterschieden nicht nur beharrlich zwischen der ausschließlich geförderten »Hochkunst« und dem »trivialen« Kunsthandwerk, sie führten auch eine Hierarchie der Malereigattungen ein. Großformatige, vielfigurige Historiengemälde rangierten am oberen, Porträts und Stillleben am unteren Ende. Erwartungsgemäß kam das vor allem den Männern zugute, da Frauen trotz ihrer hohen Stellung an Akademien immer noch eine »ordentliche« Ausbildung verwehrt blieb (wofür der Akt nach lebendem Modell unabdingbar war). Damit waren sie schon im Nachteil, bevor sie überhaupt erst anspruchsvollere Arbeiten in Angriff nehmen konnten.
Und es wurde nicht besser. Nachdem sie von Anfang an nur wenige Frauen aufgenommen hatte, beschränkte die Académie Royale ab 1770 die Zahl der zugelassenen Künstlerinnen auf nur jeweils vier bei jeder Neuaufnahme. Die Londoner Royal Academy ging sogar noch weiter: Nach dem Tod zweier ihrer weiblichen Gründungsmitglieder zu Anfang des 19. Jahrhunderts ließ sie mehr als 100 Jahre keine Frauen mehr zu.
Im späten 18. Jahrhundert wirkte auch die Ansicht des populären Philosophen Jean-Jacques Rousseau, der Platz einer Frau sei am heimischen Herd, einer Förderung von Künstlerinnen entgegen, auch wenn einige das dazu nutzten, sich mit dem Sujet »Mutter und Kind« zu sozialen Fragen zu Wort zu melden. Eine kleine Zahl von Künstlerinnen umging die Hürden mit anderen Mitteln und erwies sich in einer Zeit einschneidenden gesellschaftlichen und politischen Wandels als wesentlich bei der Durchsetzung neuer Stile und Moden. Aber zunächst noch einmal zurück an den Anfang des Jahrhunderts, in eine Epoche der Überschwänglichkeit, in der eine Venezianerin die Richtung wies.
Rokoko und Klassizismus
Nach dem Ende der langen Regentschaft Ludwigs XIV., der einem verklärten Barockstil gefrönt hatte, zog der französische Hof unter dem neuen Kindkönig Ludwig XV. aus den pompösen Palästen von Versailles nach Paris um. Das erforderte einen Kunststil, der auch die neue urbane Aristokratie zufriedenstellte. Und so entfaltete sich der später unter dem Namen Rokoko bekannte Stil im Gegensatz zur bis dahin herrschenden glanzvollen, majestätischen Förmlichkeit in verschnörkelter Opulenz mit asymmetrischen geschwungenen Linien und Schneckenformen (»Rokoko« kommt vom französischen »rocaille« und bezieht sich auf die mit Muscheln überzogenen Grotten in Versailles). Das fand seinen Niederschlag in der Architektur ebenso wie im Kunstgewerbe. Die Malerei verlegte sich auf liebliche Alltagsszenen mit besonderer Betonung des Individuums. Verspielte Szenen vor duftigen Wolken oder sattgrüner Natur erstrahlten in zarten Pastelltönen.
Noch vor der eigentlichen Blütezeit der neuen Kunstrichtung bediente sich eine junge venezianische Malerin, Rosalba Carriera (1673–1757), eines Stils, der die Eleganz und Leichtigkeit des Rokoko vorwegnahm. Carriera wurde für ihre schillernden Pastellarbeiten gefeiert, die den Zeitgeschmack entscheidend beeinflussten und dem »Pastellporträt« den Weg bereiteten. Aus den Sammlungen des Hochadels war die »Königin des Pastells« bald nicht mehr wegzudenken, was sie zu ihren Lebzeiten zur erfolgreichsten Malerin Europas machte.
Die der Mittelschicht entstammende Künstlerin – ihre Mutter war Spitzenklöpplerin und ihr Vater Beamter – wuchs als älteste von drei Schwestern in Venedig auf. Nachdem sie in ihrer Jugend Spitzen entworfen hatte, verdiente sie sich zu Anfang des 18. Jahrhunderts ihren Lebensunterhalt mit Porträtminiaturen auf den Innendeckeln von Tabaksdosen. Um ihren schnell wachsenden internationalen Kundenstamm zufriedenzustellen, begann Carriera, mit Pastellkreiden zu experimentieren. Zu der Zeit war das sehr ungewöhnlich, da man damit eigentlich nur Zeichnungen oder Kopien anfertigte, doch Carrieras Schaffen erhob das Pastell in den Bereich der »Hochkunst«.
Für die Porträts der hochrangigen Adligen und reichen Kaufleute mit ihren silbrigen Locken und transparenten Halskrausen im Stil der Zeit eignete sich das Pastell hervorragend. Die (dem Make-up des 18. Jahrhunderts nicht unähnlichen) Kreiden, ein trockenes Medium, erzeugten glänzende Oberflächen, leuchtende Farbgebung und abgestufte Texturen, was perfekt das beim Adel so beliebte gepuderte Haar und die feinen Details der Spitzen wiedergab. Weil die Farbe nicht erst, wie bei Ölbildern, lange trocknen musste, konnte Carriera in kürzester Zeit große Mengen an Porträts fertigstellen (unterstützt von ihrer Schwester Giovanna, die die Hintergründe ausfüllte), und da sie auf Papier malte, ließen sich die Bilder auch leicht transportieren.
Auf Drängen eines gut vernetzten Sammlers reiste Carriera 1720 nach Paris, wo sie mit offenen Armen empfangen wurde (der gefeierte Maler Watteau war begeistert von ihr). Der Auftrag an sie, den damals zehnjährigen Ludwig XV. zu porträtieren, machte großen Eindruck auf die herrschende Klasse, die ihren unverwechselbaren Stil zu schätzen wusste (ihre kleineren, die Individualität herausstellenden Porträts passten perfekt ins Rokoko). Mit der Ehrenmitgliedschaft der Académie Royale im Rücken wurde Carriera auch in die Accademia Clementina in Bologna gewählt und unternahm in der Folge zahlreiche Reisen durch Europa.
Zurück in Venedig, brillierte sie auch nach 1721 noch in der Pastellmalerei, wie die Junge Dame mit Papagei, um 1730, eindrucksvoll belegt. Das umwerfende lichtdurchflutete Porträt fängt Eleganz und Charme der temperamentvollen Titelgestalt ebenso ein wie die kalte, glänzende Kompaktheit ihrer Perlen und die naturgetreuen Federn auf dem Papagei. Kein Wunder, dass der zeitgenössische Kunsthändler Pierre-Jean Mariette den Eindruck hatte, Carrieras Bilder »kommen aus dem Himmel«.
Carrieras letzte Lebensjahre waren überschattet von schweren Depressionen, ausgelöst durch den Tod ihrer Schwester Giovanna und das zunehmend nachlassende Sehvermögen. Mit dem Wandel des Zeitgeschmacks verblasste auch ihr Ruhm. Der aufkommende Klassizismus und die Abwertung des Rokoko als »feminin« taten ihr Übriges. Bis zur Französischen Revolution 1789 hatte diese Stilrichtung ausgedient. Für Jahrhunderte geriet Carriera in Vergessenheit.
Klare Linien, naturgetreue Farbpaletten, kompositorische Harmonie, heroische Sujets: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts breitete sich in Europa die Stilrichtung des Klassizismus aus, die alles ablehnte, was irgendwie an Rokoko erinnerte, und den Blick auf eine verklärte antike Vergangenheit richtete. Bedingt durch die gewaltigen Umbrüche in der französischen Politik und eine Wiederentdeckung römischer Ruinen, richteten Künstler den Fokus auf markante und triumphale historische, biblische und mythologische Themen.
Angelika Kauffmann (1741–1807) war ein Wunderkind, in Musik ebenso begabt wie in Sprachen und gefeiert für ihre fantastisch ausgeführten Porträts und Historiengemälde. Als Künstlerin voller Entschlossenheit sprengte sie Geschlechtergrenzen durch ihre Mitgliedschaft in renommierten Kunstakademien (in Rom, Bologna, Florenz), wurde von männlichen Kollegen geachtet (und umschwärmt) und galt zum Ende des 18. Jahrhunderts als eine der führenden Größen in der Welt der Malerei Europas. Wie ein Zeitgenosse es ausdrückte: »Die ganze Welt ist verrückt nach Angelika.«
Die in der Schweiz geborene Kauffmann erhielt ihre künstlerische Ausbildung durch ihren Vater, mit dem sie in ihrer Jugend in Europa unterwegs war, um Kontakte zu Mäzenen zu knüpfen und die Renaissancekunst zu studieren. Mit 13 besaß sie bereits einen mustergültigen Malstil, wie ihr technisch brillantes Selbstbildnis als Sängerin mit Notenblatt von 1753 beweist, das von ihrem künstlerischen Talent ebenso zeugt wie von ihrem musikalischen. Als Assistentin ihres Vaters bei seinen großformatigen Auftragsarbeiten reiste sie nach Rom, Neapel und Florenz, wo ihr künstlerisches Vokabular allmählich Formen annahm.
Als sie 1766 nach London kam (ein weiteres Zentrum des Klassizismus, dank der Vorliebe König Georgs III.), eröffnete die finanziell gewiefte Kauffmann am Golden Square ein Atelier, wo sie die gleichen Preise verlangte wie ihre männlichen Kollegen. Schnell fasste sie in England Fuß und war innerhalb von zwei Jahren schon Gründungsmitglied der Royal Academy of Arts (zusammen mit nur einer weiteren Frau, der englischen Malerin Mary Moser). Doch viel hatten die beiden Frauen davon nicht, denn sie waren vom regulären Unterricht, vom Aktzeichenraum und von wichtigen Besprechungen ausgeschlossen. Besonders grausam wurde mit ihnen beim offiziellen Porträt der 36 Gründungsmitglieder der Akademie verfahren, The Academicians of the Royal Academy, 1772. Statt sie – wie die selbstbewussten, ins Gespräch vertieften Männer um das Aktmodell herum – als Figuren darzustellen, hat der Maler des Bildes, Johann Zoffany, Kauffmann und Moser lediglich rechts oben in Form von kaum zu erkennenden Brustbildern verewigt.
Dennoch schuf Kauffmann weiter anspruchsvolle Gemälde, bevorzugt von eleganten, anatomisch genauen Gestalten, die sie mit nahezu transparenten Stoffen umhüllte und in ein dunstiges Licht tauchte. Beispielhaft für diesen Stil ist ihr Zeuxis wählt Modelle für sein Bildnis der Helena von Troja von 1778. Bei diesem populären Motiv geht es um den griechischen Maler Zeuxis aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., wie er versucht, die schöne Helena neu zu erschaffen, indem er sich Merkmale von fünf idealisierten Frauen »borgt«. Aber schauen Sie sich einmal die Figur genauer an, die ganz rechts mit Pinseln in der Hand vor einer großen Staffelei steht. Hier hat Kauffmann sich selbst ins Bild eingefügt, als Erinnerung, dass nicht etwa Zeuxis die Kontrolle hat, sondern sie.
Wie konnte Kauffmann so anspruchsvolle Kompositionen zustande bringen? Von der Royal Academy wurde sie damit beauftragt, die vier Elemente der Kunst – Erfindung, Farbe, Zeichnung und Komposition – allegorisch als Deckengemälde darzustellen. Auf dem Bild »Zeichnung« (Design) sitzt eine Malerin vor dem Torso vom Belvedere, der ihr als Ersatz für ein lebendes Modell dient. Kauffmann spielt hier darauf an, wie sie sich auch ohne Zugang zum Aktzeichenraum zu helfen wusste, und thematisiert damit sowohl das Können der Frauen als auch die Einschränkungen, die sie ertragen mussten.
Auch wenn Mosers und Kauffmanns gehobene Positionen den Anschein erwecken mochten, dass Frauen in neue Bereiche vordrangen, blieb jahrzehntelang alles beim Alten. Erst 1860 wurde wieder eine Frau in die Royal Academy aufgenommen (Laura Herford signierte ihre eingereichten Zeichnungen nur mit ihren Initialen), und bis in die 1890er-Jahre blieb Frauen die Aktstudie am lebenden Modell verwehrt. Zum ersten offiziellen weiblichen Akademiemitglied wurde 1936 Laura Knight gewählt, und bis heute (2022) waren lediglich 9,35 Prozent der Mitglieder Frauen. Wie die meisten derartigen Institutionen hat die Royal Academy noch viel aufzuarbeiten. Jetzt aber noch einmal zurück ins 18. Jahrhundert, diesmal nach Frankreich.
Die Französische Revolution
Im vorrevolutionären Frankreich erlebten einige Frauen einen kometenhaften Aufstieg. Sie brillierten in den Pariser Salons, wurden (trotz der Obergrenze von vier Frauen) Mitglied in der Académie Royale und konnten sich vor allem einer illustren Schar von royalen Kundinnen rühmen (die zweifelsohne ihre schmeichelhaften Porträts zu schätzen wussten). Favoritin von Königin Marie-Antoinette war Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842).
Die in Paris geborene Malerin lernte kurze Zeit bei ihrem Vater, einem Pastellmaler (er starb, als sie zwölf war), war aber vornehmlich Autodidaktin und sehr zielstrebig. Mit 15 war sie bereits die Haupternährerin der Familie und wurde in jungen Jahren mit einem Kunsthändler der oberen Gesellschaft verheiratet.





























