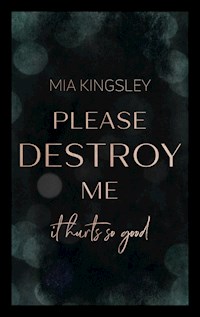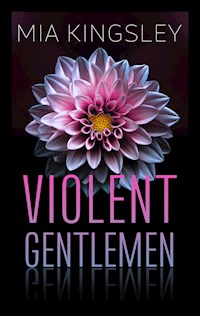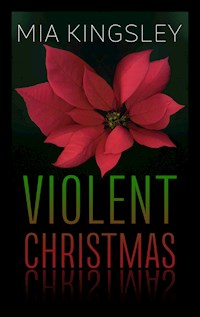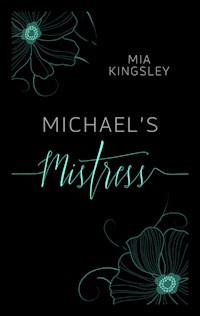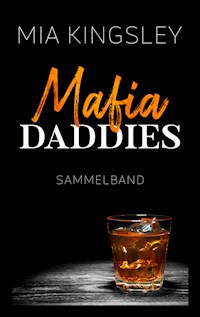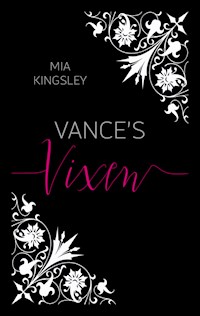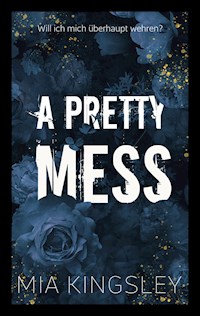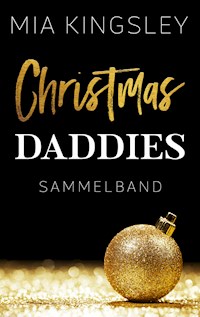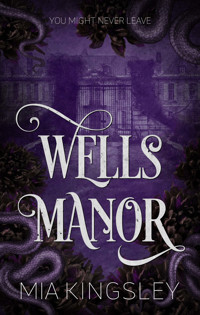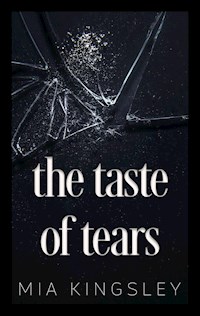
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich bin ich nicht zum Friedhof gefahren, um vier Männer zu töten und den größten Gangsterboss der Stadt zu verärgern – oder um eine Frau zu retten, die sich weigert, mit mir zu reden … Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen. "The Taste Of Tears" erschien zuerst im Frühjahr 2020 auf Wattpad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THE TASTE OF TEARS
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
INHALT
The Taste Of Tears
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
Copyright: Mia Kingsley, 2020, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
THE TASTE OF TEARS
Eigentlich bin ich nicht zum Friedhof gefahren, um vier Männer zu töten und den größten Gangsterboss der Stadt zu verärgern – oder um eine Frau zu retten, die sich weigert, mit mir zu reden …
Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
»The Taste Of Tears« erschien zuerst im Frühjahr 2020 auf Wattpad.
KAPITEL1
Es fiel mir schwer, gerade zu stehen. Deshalb war ich im ersten Anlauf auch nicht unbedingt treffsicher, als ich den Whiskey auf Alexanders Grab schüttete. »Auf dich, Bruderherz.« Ich beendete den Satz mit einem Hicksen und nahm selbst einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Nicht, dass ich mehr Alkohol gebraucht hätte. Das war bereits die zweite Flasche, und es wunderte mich ehrlich gesagt, dass ich überhaupt bei Bewusstsein war. Ich sollte mich langsam zusammenreißen, wenn ich die Pillen aus meiner Hosentasche noch schlucken wollte.
Es war eine gute Nacht zum Sterben. Allerdings war für mich jeder Tag eine gute Gelegenheit zum Sterben. Nur hatte ich endlich alle Aufgaben erledigt, die mich vom erlösenden Tod ferngehalten hatten. Jetzt war es so weit.
Wenigstens musste ich mich nicht um den morgigen Kater kümmern, weil ich ihn nicht mehr erleben würde.
Es hatte viel länger gedauert, den Tod meiner Familie zu rächen, als ich ursprünglich angenommen hatte.
Mit einem Seufzen wischte ich mir die Tränen aus den Augen. Dad würde mir sonst was erzählen, wenn er mich jetzt sehen könnte. Aber er war tot. Seit vier Jahren, genau wie meine Mom und mein älterer Bruder.
Ich setzte die Flasche an die Lippen und nahm einen großen Schluck, um endlich zu vergessen. Gleichzeitig schob ich die andere Hand in die Hosentasche, um das Oxycodon hervorzuholen. Nicht mehr als zwei Pillen pro Tag, hatte der Dealer gesagt. Ich plante, direkt alle sechs auf einmal zu nehmen.
Zuerst hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich zu erschießen. Aber dabei konnte zu viel schiefgehen, und ich wollte nicht den Rest meines Lebens ohne Unterkiefer, dafür aber mit Hirnschaden in einer Pflegeeinrichtung herumsitzen und mich noch mehr hassen, als ich es ohnehin schon tat.
Nein, es wurde Zeit, dieses Leben zu beenden. Es hatte sowieso nie zu mir gepasst, und jetzt, da ich meine Rache gehabt hatte, lohnte es sich nicht, am Leben zu bleiben. Ich hatte nichts mehr. Keine Familie, so gut wie keine Freunde, und auch sonst sah es eher finster aus, weil ich in den letzten Jahren für die falschen Leute auf der falschen Seite des Gesetzes gearbeitet hatte, um meine Rache ausführen zu können. Ich hatte ein fettes Bankkonto und kannte eine Menge zwielichtiger Gestalten – und das war es auch schon mit den Vorteilen. Der Rest war eher zum Heulen.
Obwohl ich wusste, dass ich langsam mit dem Trinken aufhören sollte, konnte ich nicht.
Das Mondlicht fiel durch den dichten Nebel, als ich den Kopf in den Nacken legte, um einen weiteren großen Schluck zu trinken. Es war wirklich die perfekte Nacht zum Sterben. Selbst in einem Hollywood-Film hätten sie den Friedhof nicht perfekter inszenieren können.
Der Wind schob den Nebel über den Friedhof, die Äste wogten im Wind, und immer wieder brachen die Wolken genug auf, damit ich die Namen meiner Familie auf den Grabsteinen lesen konnte, um die ich mich nicht genug gekümmert hatte.
Das letzte Mal war ich ein paar Wochen nach der Beerdigung hier gewesen. Danach hatte ich mich nicht mehr überwinden können.
Die anderen Gräber sahen viel hübscher aus, nicht, dass ich in der Dunkelheit und mit dem Nebel hätte viel erkennen können.
Morgen würde das Grab noch schlimmer aussehen, mit meiner abgerissenen Leiche darauf.
Ich wankte und musste zwei Schritte nach hinten machen, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen. Das Gras unter meinen Füßen raschelte, und ich betete, dass ich nicht gerade auf einem anderen Grab stand.
Meine Finger schlossen sich um die Tabletten und ich holte sie aus der Hosentasche. Ich zitterte, weil es eiskalt war und ich Idiot nur eine dünne Lederjacke über einem T-Shirt trug. Nicht, dass es eine Rolle spielte. Ich würde nie wieder eine Erkältung bekommen.
Gänsehaut kroch über meine Arme und meine Zähne begannen zu klappern. Hm, komisch. Ich hatte immer gedacht, so viel Alkohol würde gegen die Kälte immun machen. Doch ich spürte sie verdammt deutlich. Meine Finger waren taub und klamm, weshalb es nicht verwunderlich war, dass ich die Pillen fallen ließ.
»Shit«, fluchte ich und zog mein Handy hervor, um im Schein der Taschenlampenfunktion nach den Drogen zu suchen. Für alle Fälle steckte die Pistole in meinem Hosenbund, weil ich vorhin noch arbeiten gewesen war, aber die Pillen zu nehmen war mir lieber.
Die Flasche schlug gegen einen Zierstein, als ich sie abstellte, um den Boden abzutasten. Es fiel mir schwer, gleichzeitig meinen Blick zu fokussieren und das Handy zu halten. Vermutlich war es nicht überraschend, dass es mir kurz darauf aus der Hand fiel. Ich konnte das Display förmlich splittern hören. Egal. Ich würde es bald nicht mehr brauchen.
Fuck. Warum war ich so verdammt betrunken? Ich hätte wütend auf mich sein sollen, stattdessen kicherte ich wie ein Schulmädchen, während ich auf den Knien herumkroch und im nassen Gras nach den Pillen suchte.
Ich fand sie. Oder besser die Überreste. Weiße Klumpen halb aufgelöster Tabletten. Als ich die Faust ballte, quollen die Reste wie ranziges Sperma zwischen meinen Fingern hervor.
Genervt legte ich mich auf den Rücken und streckte mich aus, starrte nach oben in den Nebel. Das lief ja wirklich hervorragend.
Ich tastete nach der Flasche und stieß sie um. Hastig richtete ich mich auf und versuchte zu retten, was zu retten war. Jetzt würde ich mich doch erschießen müssen. Was für beschissene Aussichten.
Umständlich zog ich die Pistole hervor und kramte in meinem alkoholisierten Hirn nach der Antwort auf die Frage, ob ich heute jemanden erschossen hatte. Wie viele Patronen standen mir wohl zur Verfügung?
Probehalber presste ich die Mündung unter mein Kinn in das weiche Fleisch. Oder sollte ich mir den Lauf vielleicht lieber in den Mund stecken? So viele Dinge, die ich beachten musste. Warum hatte ich nicht einfach die Pillen geschluckt? Stattdessen wankte ich wie ein vierzehnjähriger Emo betrunken über den Friedhof, um mich von Leuten zu verabschieden, die längst von den Würmern gefressen worden waren.
Ich schüttelte den Kopf und sperrte den Mund auf, damit ich den Lauf hineinschieben konnte. Der beschissenste Blowjob der Welt, dachte ich, als sich meine Lippen um den kalten Lauf schlossen.
Moment, war die Pistole im Mund nicht immer genau die Art, wie Selbstmordversuche schiefgingen?
Verdammt. Ich rieb mir über die Stirn und sinnierte über meine Möglichkeiten. In meinem Stiefel steckte ein Messer – ich konnte mir genauso gut die Pulsadern aufschneiden und dramatisch verbluten.
Weil ich ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, zog ich das Messer hervor. In der einen Hand hielt ich das Messer, in der anderen die Pistole.
Ich war gerade im Begriff, mich zu entscheiden, als ich die Stimmen hörte.
KAPITEL2
Irritiert richtete ich mich weiter auf und blinzelte in die neblige Dunkelheit. Die Tatsache, dass der Friedhof sich um mich drehte, half nicht unbedingt dabei, etwas zu erkennen.
Mit einem Seufzen legte ich die beiden Waffen in meinen Schoß und klatschte mir mit den flachen Händen gegen die Wangen, um wieder klarer denken zu können. Es brachte nichts.
Mit einem Achselzucken tastete ich nach der Flasche und trank voller Wehmut den letzten Schluck, der zurückgeblieben war, nachdem ich Idiot den kostbaren Alkohol umgestoßen hatte.
Die Stimmen wehten zu mir herüber, und ich bildete mir ein, einen aggressiven Gesprächston zu vernehmen. Ich zog mein Handy hervor und drückte aufs Display, woraufhin es aufflammte. Die Risse machten es schwer, die Uhrzeit zu erkennen.
Hm. Wer stritt sich denn um drei Uhr morgens auf einem Friedhof? Nicht einmal in Ruhe umbringen konnte man sich hier.
Ich wollte aufstehen, um nachzusehen. Insgesamt brauchte ich drei Anläufe und schaffte es letztlich nur, weil ich mich an einem Grabstein festklammerte. Der Granit war kalt und hart unter meinen zittrigen Fingern.
Als ich endlich stand, bemerkte ich, dass ich die Pistole und das Messer vergessen hatte, weil ich … verdammt betrunken war. Mit einem mühseligen Schnaufen beugte ich mich vor und sammelte meine Habseligkeiten ein. Kaputtes Handy, leere Flasche Schnaps, Waffe mit fünf oder sechs Schüssen und ein Messer. Alles da.
Der Mond schien zwar hell vom Himmel, doch durch den Nebel war er nur ein verschwommener Fleck, kaum zu sehen. Ich setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und fragte mich, warum ich überhaupt nachschauen wollte. Es ging mich nichts an, was fremde Leute nachts auf dem Friedhof trieben, und an einer Unterhaltung war ich auch nicht interessiert.
Während ich durch die lange Reihe Gräber stolperte und dabei mehr als einmal vom Weg abkam und über Blumen trampelte, fiel es mir wieder ein: Richtig. Ich wollte die Eindringlinge verscheuchen, damit ich mich endlich umbringen konnte. Oder ich würde sie fragen, was sie für sinnvoller hielten — sollte ich mich erschießen oder mir lieber die Pulsadern aufschneiden?
Ich rülpste, und es schmeckte wie etwas, was bereits vor drei Tagen um gewesen war. Beinahe hätte ich mich übergeben. Im letzten Moment bezwang ich den Impuls und stolperte weiter.
Hätte ich diese verfickten Tabletten geschluckt, hätte ich dieses Problem jetzt nicht. Mein Bruder würde Tränen lachen, wenn er mich sehen könnte. Er war immer diszipliniert und organisiert gewesen und hätte sich niemals zu sehr betrunken, um sich umbringen zu können.
Ich wischte mir über die Nase und wunderte mich, ob ich jemals wieder aufhören würde, zu heulen. Wenn ich tot war vermutlich, aber dazu musste ich erst einmal sterben. Ein schwierigeres Unterfangen, als ich gedacht hatte.
Ich näherte mich den Eindringlingen, die der Nebel ebenso vor mir verbarg, wie ich vor ihnen verborgen war. Doch ich konnte sie deutlich hören.
Es klang verdächtig wie eine Schaufel, die immer wieder in den Boden gestoßen wurde. Irgendetwas sagte mir, dass es vermutlich nichts Gutes bedeutete, wenn Leute nachts zum Friedhof kamen und ihre eigene Schaufel mitbrachten, um jemanden zu begraben.
Nach einem weiteren Rülpser kam mir eine neue Idee. Vielleicht begruben sie gar keinen. Vielleicht waren sie Grabräuber.
Ich schwankte ziemlich stark und hielt mich an dem erstbesten Gegenstand fest, den ich zu fassen bekam. Weil der Friedhof sich wie ein Karussell immer schneller um mich drehte, lehnte ich sicherheitshalber auch die Stirn gegen meine neue Stütze.
Als ich es wagte, die Augen wieder zu öffnen, blickte ich direkt auf einen harten Nippel. Irritiert schaute ich hoch und stellte fest, dass ich mich an eine Engelsstatue klammerte.
Erschrocken trat ich einen Schritt zurück und verlor prompt das Gleichgewicht. Ich landete auf meinem Arsch, der Boden unter mir war glücklicherweise weich, weil ich auf ein relativ frisches Grab gefallen war. Mit einem Knurren rappelte ich mich wieder hoch. Das war echt nicht meine Nacht.
Die ganze Anstrengung brachte mich zum Schwitzen und ich wischte mir den Schweiß von der Stirn. Dabei war mir gerade kalt gewesen. Unfassbar.
Was hatte ich noch gleich machen wollen?
Ach ja, die Grabräuber befragen, auf welche Weise ich mich am besten umbringen sollte. Ich stolperte vorwärts und kam dem Ende des Weges näher. In der Mitte des Friedhofs stand eine Kapelle, an deren Vorderseite eine einsame Lampe brannte. Von hier wirkte das Licht wie ein winziges Glühwürmchen, aber es bot mir wenigstens einen Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung ich wanken musste, um zum Ausgang zu gelangen. Unterwegs würde ich den Grabräubern schon begegnen.
Ich hatte um die fünfzehn Schritte zurückgelegt, als ich eine Gruppe von schmalen Bäumen erreichte, deren dürre Äste sich langsam im Wind wogen. Der Hauch kroch unter mein Shirt, direkt an der offenen Lederjacke vorbei. Ich hätte beinahe gelacht. Mit fast vierzig zog ich mich immer noch an wie ein absoluter Vollidiot. Ich wusste nicht einmal, ob ich einen Schal besaß. Egal.
Ich stützte mich an den Bäumen ab und schaute mich um, als ich die Grabräuber entdeckte.
Sie hatten Lampen um das Grab herum aufgestellt, das sie gerade aushoben. Ich kniff die Augen zusammen, aber abgesehen von der Dunkelheit sah ich doppelt und dreifach, sodass ich mir nicht sicher war, ob dort ein Kerl im Schein der Lampe grub oder drei.
Die Hände um die dünnen Stämme geschlungen, schlängelte ich mich zwischen den Bäumen entlang, arbeitete mich langsam weiter vor. Ein neuer Rülpser stieg auf, doch dieses Mal war mein Selbsterhaltungstrieb groß genug, um ihn nach unten zu kämpfen. Ich wollte mich umbringen und nicht von anderen erschossen werden. Das war ein himmelweiter Unterschied.
Nein, das waren sogar vier Männer, die dort eifrig arbeiteten. Sie schienen ein Grab zu öffnen, das erst kürzlich geschlossen worden war. Meine Theorie, dass es sich bei den Männern um Grabräuber handelte, war also gar nicht so abwegig.
Das dachte ich zumindest, bis ich das laute Rascheln hörte. Zwischen den Männern auf dem Boden, im Schein der Lampen, sah ich einen ziemlich großen Wurm, der sich wand und kringelte.
Ich zwinkerte, rieb mir über die Augen und beugte mich vor, als würden zwanzig Zentimeter einen Unterschied machen. Komischer Wurm.
Eher wie … ein Mensch in einem Sack.
Für meine Begriffe war das keine Leiche. Ob die Männer wussten, dass sie dabei waren, ein Grab für einen lebendigen Menschen zu graben?
Es ging mich ja nichts an, aber … Prinzipien.
Ich und meine verschissenen Prinzipien.
Mit einem Seufzen zog ich meine Waffe aus dem Hosenbund. Meine Chancen waren unterirdisch, und ich hatte auch nicht die geringste Ahnung, warum ich mich überhaupt einmischen wollte. Ich musste den Lauf nur unter mein Kinn halten und das Problem, das sowieso nicht meins war, wäre nicht länger ein Problem.
Stattdessen schüttelte ich den Kopf, um wieder klar denken und normal sehen zu können. Vielleicht würde eine letzte gute Tat mein Konto wieder ausgleichen und mir den Selbstmord erleichtern. Was hatte ich schon zu verlieren?
KAPITEL3
Ich war nüchtern genug, um zu erkennen, dass es eine dumme Idee war, mich einzumischen. Gleichzeitig war ich zu betrunken, um mich darum zu scheren. Scheiß auf die Konsequenzen. Morgen wäre ich ohnehin tot.
Die vier Männer hatten sich eine gute Stelle gesucht, um ihre lebendige Fracht loszuwerden. Wenn ich richtig kombinierte, wollten sie den armen Kerl in dem Sack begraben, ohne ihn vorher zu töten. Sonst hätten sie es längst getan. Es gab schlicht keinen anderen Grund, sich freiwillig das Gewimmere anzuhören.
Einer der Männer versetzte dem Wurm einen Tritt, nachdem dieser versucht hatte, sich zur Seite zu rollen. »Du sollst verdammt noch mal liegen bleiben!«, fauchte er und holte bereits wieder aus, als sein Kumpel ihn stoppte.
Nicht etwa aus Mitleid dem Wurm gegenüber. Nein, es war purer Egoismus.
»Hey«, sagte er. »Wie wäre es, wenn du dich wie wir aufs Graben konzentrieren würdest? Es ist spät und ich will nach Hause.«
Der Dritte im Bunde rammte seinen Spaten in den Boden, holte eine Schachtel Zigaretten hervor und steckte sich eine an. »Ich weiß nicht. Wäre es nicht Verschwendung, wenn wir nicht das Beste aus der Situation machen und uns ein bisschen mit ihr vergnügen?«
Ihr? Moment mal. War das etwa kein Wurm, sondern eine Wurmin? Ich schüttelte den Kopf, um die Spinnweben aus meinem Gehirn zu vertreiben. Eine Frau, meinte ich selbstverständlich. Hatte der eine Kerl gerade wirklich nach einer Frau getreten, die sich hilflos auf dem Boden wand?
Ich hatte nicht gerade hohe moralische Ansprüche, aber so etwas machte man nun wirklich nicht. Mit zusammengekniffenen Augen schaute ich auf die Waffe in meiner Hand und wunderte mich, ob ich sie überhaupt richtig herum hielt. Wäre ich mal nicht ganz so betrunken gewesen.
»Halt die Klappe, Walt. Du kennst die Regeln. Was der Boss anordnet, wird gemacht.«
»Und?«, erwiderte Walt lässig. »Der Boss muss ja nicht erfahren, ob sie eine Stunde früher oder später unter der Erde gelandet ist.«