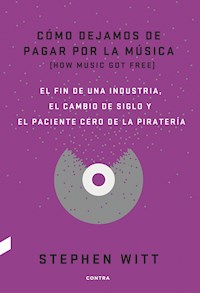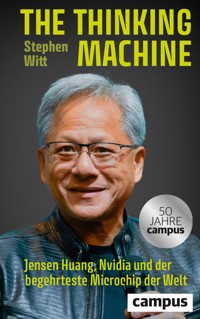
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie ein Hersteller von Videospielkomponenten das Silicon Valley schockierte, indem er den Markt für KI-Hardware eroberte und dabei den Computer neu erfand: Der renommierte Journalist Stephen Witt liefert einen faszinierenden Bericht vom Aufstieg des Technologieunternehmens Nvidia und seines charismatischen, kompromisslosen Gründers Jensen Huang. Er erhielt exklusiven Zugang zu ihm, seinen Freunden, Investoren und Mitarbeitenden. - Die einzigartige und fesselnd erzählte Geschichte eines entschlossenen Unternehmers - Die Geschichte einer Revolution in der Computertechnologie und der kleinen Gruppe von verwegenen Ingenieuren, die sie möglich machte - Die Geschichte der so fantastischen wie beängstigenden KI-Zukunft mit chipgesteuerten hyperrealistischen Avataren und autonomen Robotern »Ein fantastisches, aktuelles und informatives Buch. Stephen Witt ist ein mitreißender und kenntnisreicher Autor, seine Recherche und seine Erzählkunst sind beispielhaft.« Nick Hornby, The Sunday Times (zu »How Music Got Free«)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephen Witt
THE THINKING MACHINE
Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Wie ein Hersteller von Videospielkomponenten das Silicon Valley schockierte, indem er den Markt für KI-Hardware eroberte und dabei den Computer neu erfand: Der renommierte Journalist Stephen Witt liefert einen faszinierenden Bericht vom Aufstieg des Technologieunternehmens Nvidia und seines charismatischen, kompromisslosen Gründers Jensen Huang. Er erhielt exklusiven Zugang zu ihm, seinen Freunden, Investoren und Mitarbeitenden.- Die einzigartige und fesselnd erzählte Geschichte eines entschlossenen Unternehmers- Die Geschichte einer Revolution in der Computertechnologie und der kleinen Gruppe von verwegenen Ingenieuren, die sie möglich machte- Die Geschichte der so fantastischen wie beängstigenden KI-Zukunft mit chipgesteuerten hyperrealistischen Avataren und autonomen Robotern»Ein fantastisches, aktuelles und informatives Buch. Stephen Witt ist ein mitreißender und kenntnisreicher Autor, seine Recherche und seine Erzählkunst sind beispielhaft.« Nick Hornby, The Sunday Times (zu »How Music Got Free«)
Vita
Stephen Witt ist Journalist und Autor. Seine Artikel erscheinen in The New Yorker, Financial Times, New York Magazine, Wall Street Journal, Rolling Stone und GQ. Er lebt in Los Angeles, Kalifornien. Sein Buch How Music Got Free (2015) erzählt die Geschichte der digitalisierten Musik wie einen Roman und wurde in den Medien hochgelobt.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
INHALT
Impressum
INHALT
EINLEITUNG
TEIL I
Kapitel 1
Die Brücke
Kapitel 2
Integration in immer größerem Maßstab
Kapitel 3
Ein neuartiges Vorhaben
Kapitel 4
Dreißig Tage
Kapitel 5
Machen wir es parallel
Kapitel 6
Das neuronale Netz
Kapitel 7
Duelle auf Leben und Tod
Kapitel 8
Die Zwangsschleife
Kapitel 9
Beschleuniger der anderen Art
Kapitel 10
Resonanz
Kapitel 11
Das Netz von Alex
TEIL II
Kapitel 12
Eine einmalige Chance
Kapitel 13
Die Superintelligenz
Kapitel 14
Das gute Jahr
Kapitel 15
Der Transformer
Kapitel 16
Hyperskalierung
Kapitel 17
Geld
Kapitel 18
Raumschiffe
Kapitel 19
Energie
Kapitel 20
Die wichtigste Aktie der Welt
Kapitel 21
Jensen
Kapitel 22
Die Angst
Kapitel 23
Die denkende Maschine
DANKSAGUNGEN
Gewöhne dich auch an Dinge, an denen du verzweifelst.
Mark Aurel
EINLEITUNG
Diese Geschichte handelt davon, wie aus einem Nischenanbieter von Grafikkarten für Videospiele das wertvollste Unternehmen der Welt wurde. Sie handelt von einem unbeugsamen Unternehmer, der drei Jahrzehnte lang unermüdlich arbeitete, um eine radikale Vision der Datenverarbeitung zu verwirklichen, und dabei zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Sie handelt von einer Revolution in der Chipindustrie und von einer kleinen Gruppe von Ingenieuren, die dafür der Wall Street die Stirn bot. Und sie handelt von der Geburt einer faszinierenden und beängstigenden künstlichen Intelligenz, deren langfristige Auswirkungen auf die menschliche Spezies noch nicht abschätzbar sind.
Die Hauptfigur dieser Geschichte ist ein brillanter, temperamentvoller Mann, der die Menschen in seinem Umfeld mit hingebungsvoller Tatkraft antreibt. Jensen Huang steht seit zweiunddreißig Jahren an der Spitze von Nvidia. In keinem anderen im S&P 500 notierten Technologieunternehmen ist der Geschäftsführer ähnlich lange im Amt. Huang ist ein visionärer Erfinder, der mit den inneren Abläufen elektronischer Schaltkreise vertraut ist. Ausgehend von den Grundprinzipien beurteilt er, wozu Mikrochips heute in der Lage sind, und setzt mit unerschütterlicher Überzeugung auf das, was sie (seiner Meinung nach) in Zukunft werden leisten können. Nicht alle seine Wetten gehen auf, aber wenn er gewinnt, feiert er triumphale Erfolge: Der Entschluss, früher als alle anderen auf künstliche Intelligenz zu setzen, machte eines der besten Investments in der Geschichte des Silicon Valley möglich. Huangs Unternehmen ist heute mehr als 3 Billionen Dollar wert und steht auf einer Stufe mit Apple und Microsoft.
Trifft man ihn persönlich, ist Huang charmant, amüsant, selbstironisch und voller Widersprüche. Er geht mit trockenem Humor durchs Leben. Eines unserer Gespräche führten wir im Jahr 2023 in einer Filiale von Denny’s, seiner bevorzugten Restaurantkette. Dreißig Jahre früher hatte er in diesem Lokal den Geschäftsplan für Nvidia entworfen. Bei unserem Treffen plauderte er mit der Kellnerin und bestellte eine üppige Mahlzeit, unter anderem ein »Super Bird«-Sandwich und ein paniertes Beefsteak. »Ich war früher hier Tellerwäscher«, klärte er die Kellnerin auf. »Aber ich arbeitete hart, wirklich hart! Also wurde ich zum Hilfskellner befördert.«
Huang wurde in Taiwan geboren und kam im Alter von zehn Jahren in Vereinigten Staaten. Das Denny’s war die Schmiede seiner Assimilation – während er als Teenager dort arbeitete, aß er sich durch die Speisekarte. Und doch bewahrte er sich in all den Jahren die Perspektive eines Außenstehenden. »Du bleibst immer ein Einwanderer«, sagte er. »Ich bin immer noch Chinese.« Im Jahr 1993 gründete er im Alter von dreißig Jahren Nvidia (die korrekte Aussprache ist »Invidia«). Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen auf den gerade erst entstehenden Markt für hochwertige Grafikkarten für Videospiele. Nvidias Produkte waren beliebt: Die jungen Kunden bauten gerne ihre eigenen PCs zusammen und kauften manchmal durchsichtige Gehäuse, um ihren Freunden stolz ihre Nvidia-Hardware vorzuführen.
Ende der neunziger Jahre nahm Nvidia eine subtile Veränderung an der Schaltkreisarchitektur seiner Prozessoren vor, um die Videospiele aus der beliebten Quake-Reihe besser rendern zu können. Dabei gelang es dem Unternehmen, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen. Die wenig beachtete, aber radikale Neuerung bestand darin, dass Nvidia sich der so genannten »Parallelverarbeitung« zuwandte. Es war eine riskante Wette. »Bevor wir uns dazu entschieden haben, lag die Erfolgsquote der Parallelverarbeitung bei null Prozent«, erklärte Huang und zeigte mir zum Beweis eine Auflistung längst vergessener Unternehmen, die sich auf diesem Gebiet versucht hatten. »Bei null Komma null. Jeder, der versucht hatte, sie kommerziell zu nutzen, war gescheitert.« Huang ignorierte diese entmutigenden Präzedenzfälle und verfolgte mehr als ein Jahrzehnt lang unbeirrt seine unkonventionelle Vision, obwohl ihn die Börse dafür bestrafte. Er wusste, dass Videospieler nicht auf die Parallelverarbeitung angewiesen waren, und suchte deshalb nach einer anderen Kundengruppe, nach Kunden, die sehr große Rechenleistung brauchten: Meteorologen, Radiologen sowie Unternehmen, die unter den Meeren nach Öl suchten. In dieser Zeit sackte der Kurs der Nvidia-Aktie ab, und Huang musste Angriffe von Heuschreckenfonds abwehren, um seinen Job nicht zu verlieren.
Er hielt an seiner Wette fest und verlor jahrelang Geld. Dann kaufte im Jahr 2012 eine Gruppe eigenwilliger Forscher an der Universität Toronto, die gegen den Strom schwammen, zwei Grafikkarten von Nvidia, um eine ausgefallene Art von künstlicher Intelligenz anzulernen, die als »neuronales Netz« bezeichnet wurde. Zu jener Zeit hatten die neuronalen Netze, welche die Struktur biologischer Gehirne nachahmten, in der Forschung einen sehr schlechten Ruf, und die meisten Experten hielten sie für überflüssige Spielereien. Aber als Huang sah, wie schnell neuronale Netze mit seiner Parallelverarbeitungsplattform trainiert werden konnten, verwettete er sein ganzes Unternehmen auf die überraschende Symbiose. Jetzt musste er nur noch hoffen, dass sich zwei in Misskredit geratene Technologien, die sich nie hatten durchsetzen können, am Ende gemeinsam als nützlich erweisen würden.
Die riskante Wette ging auf, und der Börsenwert von Nvidia stieg um mehr als 1 000 Prozent. Vor zehn Jahren verkaufte das Unternehmen Grafikkarten für Videospiele zum Stückpreis von 200 Dollar. Heute verkauft es mehrere Millionen Dollar teure Ausrüstung für Superrechner, die ein ganzes Gebäude füllen können. In Zusammenarbeit mit KI-Pionieren wie OpenAI hat Nvidia die Maschinenlernapplikationen in den vergangenen zehn Jahren um mehr als das Tausendfache beschleunigt. Alle großen KI-Applikationen – unter anderen Midjourney, ChatGPT, Copilot – sind auf Nvidia-Maschinen entwickelt worden. Erst diese beispiellose Erhöhung der Rechenleistung hat den gegenwärtigen KI-Boom möglich gemacht.
Da sein Unternehmen quasi ein Monopol auf die Hardware hat, ist Huang vermutlich die mächtigste Person im KI-Sektor. Fest steht, dass er mehr Geld mit der künstlichen Intelligenz verdient hat als jeder andere. Vergleicht man ihn mit allen Männern, die an der Westküste reich wurden, so ähnelt Huang am ehesten dem ersten kalifornischen Millionär. Samuel Brannan lebte in San Francisco und wurde im Jahr 1849 als Anbieter von Ausrüstung für Goldschürfer berühmt. Nur verkauft Huang keine Schaufeln, sondern Prozessoren für das KI-Training, die 100 Milliarden Transistoren enthalten und 30 000 Dollar kosten. Mittlerweile muss man auf die Lieferung von Nvidias neuester Hardware mehr als ein Jahr warten, und in China werden die Chips des Unternehmens auf dem Schwarzmarkt für den doppelten Preis angeboten.
Huang denkt nicht wie ein Geschäftsmann, sondern wie ein Ingenieur. Er zerlegt schwierige Konzepte in einfache Prinzipien, die er anschließend auf wirksame Lösungen anwendet. »Ich tue, was ich kann, um nicht vom Markt verdrängt zu werden«, erklärte er mir bei unserem Frühstück bei Denny’s. »Ich tue alles, um nicht zu scheitern.« Huang ist überzeugt, dass die grundlegende Architektur der digitalen Datenverarbeitung, die sich seit ihrer Einführung durch IBM Anfang der sechziger Jahre kaum verändert hat, mit der KI neu erfunden wird: »Das Maschinenlernen ist kein Algorithmus. Es ist eine Methode. Es ist eine neue Methode der Softwareentwicklung.«
Diese neuartige Software besitzt unglaubliche Fähigkeiten. Sie kann sprechen wie ein Mensch, eine Seminararbeit schreiben, ein schwieriges mathematisches Problem lösen, eine medizinische Diagnose stellen und einen Podcast moderieren. Sie vertieft ihre Fähigkeiten parallel zur verfügbaren Rechenleistung und scheint nie an eine Grenze zu stoßen. Am Abend vor dem Treffen mit Huang hatte ich mir ein Video angesehen, in dem ein Roboter, der eine solche neuartige Software ausführte, seine Hände betrachtete, anscheinend verstand, wozu sie dienten, und sich daran machte, einen Haufen bunter Würfel zu sortieren. Das Video hatte mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt: Der Tag, an dem meine Spezies obsolet werden würde, schien nicht mehr fern.
Huang wickelte ein Würstchen in einen Pfannkuchen ein und wies derartige Sorgen als unbegründet zurück. »Ich weiß, wie es funktioniert, und kann Ihnen sagen, dass es ungefährlich ist«, sagte er. »Es funktioniert nicht anders als Mikrowellen.« Ich ließ nicht locker: Ein autonomer Roboter bringe zweifellos andere Risiken mit sich als ein Mikrowellenherd. Huang antwortete, er habe sich nie Sorgen über die Technologie gemacht, nicht ein einziges Mal. »Sie tut nichts anderes als Daten zu verarbeiten. Wir sollten uns über ganz andere Dinge Sorgen machen.«
Niemand kann wissen, wohin die Entwicklung führen wird. Viele Technologen befürchten mittlerweile, dass die Fähigkeiten der KI in Zukunft das Überleben der menschlichen Spezies direkt bedrohen wird. (Zu diesen »Untergangspropheten« zählen auch jene Wissenschaftler aus Toronto, die erstmals eine künstliche Intelligenz auf Huangs Plattform entwickelten.) Doch Huang hält den Pessimismus für unangebracht. In seinen Augen wird die KI ausschließlich dem menschlichen Fortschritt dienen, und er erklärt, dass sie eine neue industrielle Revolution auslöst. Er duldet in dieser Frage keinen Widerspruch, und seine starke Persönlichkeit kann einschüchternd wirken. (Einer seiner Manager drückt es so aus: »Mit Jensen zu kommunizieren ist so, als würde man einen Finger in die Steckdose stecken.«) Huangs Mitarbeiter verehren ihn, und ich habe den Verdacht, dass sie mit ihm aus dem Fenster eines Wolkenkratzers springen würden, wenn er auf der anderen Seite eine Geschäftschance sähe.
Im Mai 2023 unterzeichneten hunderte Wirtschaftsführer eine Erklärung, in der eine außer Kontrolle geratene KI als ebenso gefährlich eingestuft wurde wie ein Atomkrieg. Huang zählte nicht zu den Unterzeichnern. Wirtschaftswissenschaftler haben mit Blick auf die Tatsache, dass die Industrielle Revolution zu einem Rückgang der globalen Pferdepopulation führte, die Frage aufgeworfen, ob der Siegeszug der KI ähnliche Auswirkungen auf die menschliche Population haben könnte. Huangs Antwort: »Pferde haben begrenzte berufliche Optionen. Beispielsweise können Pferde nicht tippen.« Während er seine Mahlzeit beendete, äußerte ich die Befürchtung, dass ich irgendwann in naher Zukunft meine Notizen über ein Interview wie dieses in eine intelligente Maschine eingeben würde, um anschließend zuzusehen, wie sie daraus einen besser strukturierten und geschriebenen Text als ich machen werde. Diese Möglichkeit schloss Huang nicht aus, er versicherte aber, mir blieben noch ein paar Jahre, bevor ich die Überlegenheit einer Maschine würde anerkennen müssen: »Zuerst sind die Romanciers an der Reihe.« Mit diesen Worten gab er der Kellnerin ein Trinkgeld von 1 000 Dollar, erhob sich und ließ eine Vielzahl halbvoller Teller auf dem Tisch zurück.
Ich habe feststellen müssen, dass sich Huang jeder Kategorisierung entzieht und in mancher Hinsicht die schwierigste Person ist, über die ich je geschrieben habe. Er spricht sehr ungern über sich selbst, und einmal lief er einfach davon, als ich ihm eine Frage zu seiner Person stellte. Bevor ich den Auftrag erhielt, dieses Buch zu schreiben, hatte ich in The New Yorker ein Porträt von Huang veröffentlicht. Er sagte mir, er habe den Artikel nicht gelesen und auch nicht die Absicht, es jemals zu tun. Als ich ihm mitteilte, dass ich seine Biographie schreiben würde, sagte er: »Hoffentlich bin ich tot, wenn sie erscheint.«
Trotzdem vermittelte Huang mir Gespräche mit zahlreichen Personen, die ich für dieses Buch befragen konnte. Ich sprach mit fast zweihundert Personen, darunter Mitarbeiter Huangs sowie die beiden Männer, die gemeinsam mit ihm Nvidia gegründet hatten, Rivalen und mehrere seiner ältesten Freunde. Der geliebte und sogar ein wenig alberne Familienmensch, der sich in diesen Interviews herauskristallisiert hat, hat kaum Ähnlichkeit mit dem bekennend unbarmherzigen Manager, der Nvidia an die Spitze geführt hat, aber eben diese persönlichen Bindungen treiben Huang an: Er sprach offen mit mir über seine Selbstzweifel, über seine Angst davor, seine Angestellten im Stich zu lassen, über seine Sorge, den Namen seiner Familie zu entehren. Manche Manager sehen im Profit einen Beleg für die Qualität ihrer Arbeit, aber für Huang ist Geld nicht mehr als eine vorübergehende Absicherung gegen zukünftige Missgeschicke. Es hat etwas Rührendes, dass ein Mann mit einem Vermögen von 100 Milliarden Dollar so denkt.
Aber Huang wird nicht nur von Angst getrieben. Eine gleichermaßen starke Motivation geht von der verführerischen Macht seiner Technologie aus. Es war nicht sein Plan, ein Vorreiter der künstlichen Intelligenz zu werden – er dachte nicht einmal über diese Technologie nach, als er sich bereits der Parallelverarbeitung zugewandt hatte. Aber als die KI einmal aufgetaucht war, fasste Huang rasch den Entschluss, seine anspruchsvollen Vorhaben für die Maschinenintelligenz möglichst rasch so weit wie nur irgend möglich voranzutreiben. Selbst die zuversichtlichsten KI-Visionäre raten zu einem gewissen Maß an Vorsicht – OpenAI beispielsweise bezeichnet es als seine Mission, eine Katastrophe zu verhindern. Huang ist fast der Einzige, der überzeugt ist, dass die KI nur Gutes bewirken kann. Und diese Überzeugung motiviert ihn dazu, auch nach drei Jahrzehnten an der Spitze von Nvidia weiterhin an sieben Tagen pro Woche jeweils zwölf bis vierzehn Stunden zu arbeiten.
Natürlich würde Huang in jedem Fall hart arbeiten. Das liegt in seiner Natur. Wenn es ein Prinzip gibt, an dem sein Leben ausgerichtet ist, so ist es die Verstärkung: Er hat die einfachen Maximen von Fleiß, Mut und Beherrschung der Grundlagen wieder und wieder und immer wirksamer angewandt. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass viele der persönlichen Eigenschaften, denen Huang seine beeindruckende Karriere verdankt, bereits in dem Kind angelegt waren, das im Jahr 1973 ohne seine Eltern in den Vereinigten Staaten eintraf und in sich einem Umfeld wiederfand, das so ungeeignet für die kindliche Entwicklung war, dass es wie ein Wunder wirkt, dass der Junge diese Jahre überhaupt überlebte. Um Huang wirklich zu verstehen, müssen wir diese Geschichte nicht bei Denny’s oder in den gewaltigen Kathedralen der Technologie beginnen, die er später in Auftrag gab, sondern in einer kleinen Schule in einer der ärmsten Gegenden in den Vereinigten Staaten.
TEIL I
Kapitel 1Die Brücke
An einem Morgen im Winter 1973 machte sich der zehnjährige Jensen Huang wie jeden Tag auf den gefährlichen Weg zur Schule. In Taiwan geboren und in Thailand aufgewachsen, war der Junge erst kurz zuvor im ländlichen Kentucky eingetroffen. Sein Schulweg führte von einer Anhöhe hinab in eine Flussniederung, die sich zwischen bewaldeten Hügeln hindurchzog. Den Fluss überquerte Jensen auf einer an zwei Tauen aufgehängten, morschen Hängebrücke, in der viele Planken fehlten. Durch die Lücken sah man das eiskalte Wasser des in der Tiefe rauschenden Flusses.
Jensen Huang war ein aufgeweckter und strebsamer Junge. Er hatte ein Schuljahr übersprungen und war in der sechsten Klasse. Er war sehr klein für sein Alter und blieb jahrelang der Kleinste in seiner Klasse. Sein Englisch war fehlerhaft, und er war der einzige asiatische Schüler in der Schule. Die Eltern seiner Klassenkameraden in der Oneida Elementary School waren Tabakbauern und Bergleute in den Kohlegruben. Die Kinder waren fast alle weiß, und viele stammten aus armen Familien. Einige hatten zu Hause nicht einmal fließendes Wasser.
Huang war gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jeff mitten im Schuljahr in Kentucky eingetroffen. Die Eltern der beiden Jungen waren in Thailand zurückgeblieben. Die Brüder wohnten in einem Internat, dem Oneida Baptist Institute, aber da Jensen noch zu jung für das Internat war, wurde er in die Grundschule von Oneida geschickt. Am ersten Tag begleitete ihn der Schuldirektor in seine Klasse, legte den Arm um die Schultern des Jungen und sagte Jensens Mitschülern, sie sollten ihren neuen Kameraden, der aus einem anderen Teil der Welt komme, aber außergewöhnlich intelligent sei, gut aufnehmen.
Sie begannen sofort, Huang zu schikanieren. »Er war das perfekte Ziel«, erinnert sich sein Klassenkamerad Ben Bays.
Vor Huangs Ankunft war Bays selbst das bevorzugte Opfer gewesen. Wie der Neuankömmling war auch er klein, und wie Huang war er ein guter Schüler. Die Mobber zeigten ihre Wertschätzung für diese Eigenschaften, indem sie ihn regelmäßig in seinen Spind einschlossen, wo er manchmal stundenlang ausharren musste. Nachdem Huang den Platz von Bays eingenommen hatte, wurde die Schikane um eine rassistische Komponente erweitert. Viele von Huangs Klassenkameraden hatten Verwandte, die in Vietnam gekämpft hatten. »Chinesen wurden damals ›Chinks‹ genannt«, erzählte mir Huang fünfzig Jahre später in unserem ersten Gespräch, das in einem sterilen Konferenzzimmer stattfand. Ich sah keine Regung in seinem Gesicht, als er davon sprach. »Wir wurden immer so genannt.«
Die Mobber quälten Huang in der Schule, auf dem Schulweg, bei jeder Gelegenheit. Sie stießen ihn auf den Fluren und jagten ihn über den Spielplatz. Am liebsten lauerten sie ihm bei der Hängebrücke auf. Huang musste die Brücke allein überqueren, was auch unter günstigen Umständen gefährlich war. Manchmal sprangen die Angreifer aus Verstecken an beiden Ufern, wenn er gerade die Mitte erreicht hatte. Sie packten die Taue und brachten die Brücke zum Schaukeln, damit Huang in den Fluss stürzte. »Er wirkte völlig gleichmütig«, erinnert sich Bays. »Es sah sogar so aus, als hätte er Spaß daran.«
Bays und Huang schlossen rasch Freundschaft. Trotz der Sprachbarriere war Huang ein vorzüglicher Schüler und löste Bays als Klassenbesten ab. Er zeigte künstlerisches Talent und hatte eine makellose Handschrift, obwohl er nur in Großbuchstaben schrieb. Und er brachte Bays das Kämpfen bei. Alles, was die einheimischen Kinder über die chinesische Kultur wussten, hatten sie aus Bruce-Lee-Filmen. Huang konnte seinen Klassenkameraden anfangs weismachen, dass er Kampfkünste beherrschte. Es dauerte nicht lange, bis diese Behauptung auf dem Schulhof überprüft und widerlegt wurde, doch Huang machte seine mangelnde Kampftechnik durch Entschlossenheit wett. Wurde er herausgefordert, so setzte er sich stets zur Wehr, und manchmal rang er sogar größere Jungen zu Boden. Bays kann sich nicht entsinnen, dass Huang jemals am Boden blieb. (»Ich habe es anders in Erinnerung«, sagt Huang lachend.) Jedenfalls bewegte Huangs Vorbild Bays dazu, sich ebenfalls zu wehren, und nach einer Weile hörten die Schikanen auf.
Bays Familie lebte in tiefer Armut. Er hatte fünf Geschwister, sein Vater war Wanderprediger. Die Familie lebte am Ausgang eines abgeschiedenen, engen Tals, das in der Gegend »das Bergtal« genannt wurde, in einem baufälligen Haus mit Plumpsklo im Hinterhof. Nichts in seinem Leben hatte Bays darauf vorbereitet, einem Menschen wie Huang zu begegnen, und er konnte nur darüber rätseln, wie es dazu gekommen war, dass dieses ungewöhnlich begabte Kind ohne seine Eltern im Clay County in den Appalachen gelandet war, einer der ärmsten Regionen der Vereinigten Staaten.
Jensen Huang war als mittlerer von drei Brüdern im Februar 1963 in Taipeh zur Welt gekommen. Sein Vater war Chemieingenieur, seine Mutter Grundschullehrerin. Die Eltern stammten aus Tainan an der Südwestküste Taiwans. Sie waren mit dem südchinesischen Hokkien-Dialekt aufgewachsen, hatten aber den Großteil ihres Lebens unter Fremdherrschaft verbracht, denn bis 1945 war Taiwan eine japanische Kolonie. Im Jahr 1949 floh der chinesische General Chiang Kai-shek nach der Niederlage gegen die von Mao geführten Kommunisten mit seiner Armee nach Taiwan, wo bald darauf das Kriegsrecht verhängt wurde.
Als Huang fünf Jahre alt war, fand sein Vater Shing Tai Arbeit in einer Erdölraffinerie in Thailand und zog mit seiner Familie nach Bangkok um. Huang kann sich nur dunkel an seine Zeit in Südostasien erinnern. Er weiß noch, dass er einmal Brennflüssigkeit für Feuerzeuge in den Pool des elterlichen Hauses schüttete und in Brand setzte. Er erinnert sich an einen Affen, den ein Freund als Haustier hielt. Ende der sechziger Jahre reiste Huangs Vater Shing Tai im Rahmen einer Schulung beim Klimaanlagenhersteller Carrier nach New York. (Carrier veränderte das Büroleben durch die exakte Temperatursteuerung von Grund auf.) Shing Tai war fasziniert von der Stadt und kehrte mit dem Entschluss heim, mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten auszuwandern.
Um die Übersiedlung vorzubereiten, begann Jensens Mutter Chai Shiu, ihm und seinen Brüdern Englisch beizubringen. Sie selbst beherrschte die Sprache nicht, aber dadurch ließ sie sich nicht abhalten: Ausgehend von ihrer Erfahrung als Lehrerin ließ sie ihre Söhne jeden Abend zehn neue Worte auswendig lernen, die sie willkürlich aus dem Wörterbuch fischte. Am folgenden Tag übte sie diese Worte mit den Jungen. Nach etwa einem Jahr meldete sie ihre drei Söhne in einer internationalen Akademie an, und von da an erfolgte Jensens formale Schulbildung in Englisch, während er daheim weiter Taiwanesisch sprach.
Im Jahr 1973 eskalierten die innenpolitischen Konflikte in Thailand, was die Familie dazu bewegte, ihre Auswanderungspläne schneller voranzutreiben. Im Oktober jenes Jahres gingen in Bangkok eine halbe Million Menschen auf die Straße, um das Ende der Militärdiktatur zu fordern. Das Regime unterdrückte die Proteste gewaltsam, und Huang erinnert sich daran, dass er Panzer durch die Straßen rollen sah. Aus Furcht vor einer Ausweitung der Unruhen schickte sein Vater ihn und seinen älteren Bruder Jeff in die Vereinigten Staaten, wo sie in Tacoma im Bundesstaat Washington bei einem Onkel unterkamen. Die Eltern und der jüngste Bruder blieben zurück. Der Onkel gelangte zu der Überzeugung, die beiden Jungen gehörten in ein Internat, und machte sich auf die Suche nach einer Einrichtung, die bereit war, zwei taiwanesische Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren aufzunehmen, die alleine tausende Kilometer von ihren Eltern entfernt lebten. Er entschied sich für das Oneida Baptist Institute in Kentucky – möglicherweise verwechselte er es mit einer renommierten privaten Prep School.
Wie sich herausstellte, war das Oneida Baptist eine Besserungsanstalt für Minderjährige. Die Einrichtung war im Jahr 1899 von James Anderson Burns gegründet worden, einem Baptistenprediger, der in einem Dreihundertseelendorf eine langjährige blutige Fehde zwischen zwei Familien beenden wollte. (Burns war auf die Idee für die Schule gekommen, nachdem er einen Mordanschlag überlebt hatte: Die Angreifer hatten ihm den Schädel eingeschlagen und in ihn einen Graben geworfen.) Obwohl in der Schule auch einige ausländische Kinder untergebracht waren, war sie Ende der siebziger Jahre im Wesentlichen eine Institution, in der problematische Kinder eine letzte Chance bekamen.
Die beiden Brüder trafen auf einem Schulgelände ein, das mit Zigarettenkippen übersät war. »Alle Schüler rauchten«, erinnert sich Huang. »Und ich glaube, ich war der einzige Junge in der Schule, der kein Taschenmesser besaß. Man wies ihm ein Zimmer zu, das er sich mit einem Siebzehnjährigen teilte. Am ersten Abend zog der ältere Junge sein Hemd hoch, um dem Neuankömmling die zahlreichen Stichwunden zu zeigen, die er vor kurzem in einem Messerkampf davongetragen hatte. Huangs Zimmergenosse war Analphabet. Als Gegenleistung dafür, dass Huang ihm das Lesen beibrachte, zeigte er Huang, wie das Bankdrücken funktionierte. »Nach einer Weile machte ich jeden Abend vor dem Schlafengehen hundert Liegestütze.« An den täglichen Liegestützen hat Huang sein Leben lang festgehalten.
Die Huang-Brüder änderten ihre taiwanesischen Namen, um sich an das neue Umfeld anzupassen. Der Ältere, der eigentlich Jen-Chieh hieß, nannte sich von nun an »Jeff«, und aus Jen-Hsun wurde »Jensen«. (Ihr jüngerer Bruder Jen-Che verwandelte sich später in »Jim«.) Jeff und Jensen hielten den Kontakt zu ihren Eltern, indem sie diesen per Post Audiokassetten nach Thailand schickten: Um eine Botschaft aufzunehmen, überspielten sie immer die letzte Nachricht ihrer Eltern und schickten dieselbe Kassette wieder zurück. Jensen kann sich nur an wenige Gelegenheiten erinnern, bei denen er Heimweh hatte. Für ihn war das alles nur ein großes Abenteuer.
Im Sommer mussten die Schüler des OBI arbeiten, um ihre Unterhaltskosten zu verdienen. Jeff wurde auf eine Tabakplantage geschickt, während Jensen in der Schule zurückblieb, wo er die Toiletten im Wohnheim putzte. »Es war keine Strafe«, sagt er. »Es war einfach meine Arbeit.« Eine weitere Aufgabe bestand darin, mit einer Sense das Gestrüpp auf dem Schulgelände zu mähen. Bays erinnert sich, dass er einmal auf der Fahrt zur Kirche an einem Feld vorbeikam und seinen Freund Jensen sah: »Er lief in einem Baseballtrikot Runden über das Feld und mähte es ab.«
Am Ende des Jahres in der Oneida Elementary hatte Huang die Schule praktisch erobert. Er war der Klassenbeste, wofür er in einer Schulversammlung mit einem Silberdollar ausgezeichnet wurde. Er bot Kindern die Stirn, die ihn mit rassistischen Schimpfworten überhäuften – mindestens einmal wurde er auch von einem Lehrer beschimpft. Nach Schulschluss lief Huang an der Spitze seiner Klassenkameraden in die Hickory- und Eichenwälder. Den weichen, feuchten Boden der Appalachen unter den Füßen, folgte ihm die Meute der »Halbstarken« des Clay County.
Huang verbrachte den Sommer 1974 im Wohnheim. Er freute sich die ganze Woche auf den Sonntagsfilm von ABC, den er sich mit den anderen Kindern ansah, die am Wochenende nicht von ihrer Familie abgeholt wurden. Als der Herbst näher rückte, pflückte er Äpfel von einem Baum vor seinem Fenster. Für das siebte Schuljahr wechselte er in die Internatsschule, das Oneida Baptist Institute, während Bays weiter die öffentliche Schule besuchte. Von seinem kampferprobten Zimmergenossen im Internat beschützt, passte sich Huang problemlos an die neue Schule an. Im Jahr darauf fand sein Vater Arbeit in den Vereinigten Staaten, und die Brüder verließen Kentucky, um sich in Oregon mit ihrer Familie zu vereinen. Bays und Huang sollten sich erst 44 Jahre später wiedersehen.
Bays wurde Leiter eines Pflegeheims, Huang wurde einer der reichsten Männer der Welt. Der Werdegang seines Freundes überraschte Bays nicht. Er erzählte mir, er sei schon als Kind überzeugt gewesen, dass Huang zu Großem bestimmt war. Die beiden sahen sich im Jahr 2019 wieder, als Huang das Oneida Baptist Institute besuchte, dem er ein neues Gebäude gespendet hatte. »Er hatte mich nicht vergessen«, sagte Bays.
Für viele Kinder wären diese zwei Jahre in Kentucky eine traumatische Erfahrung gewesen. Im Alter von zehn Jahren war Huang von seinen Eltern in ein 13 000 Kilometer entferntes Land geschickt worden, dessen Sprache er kaum beherrschte. Er wurde schikaniert, ausgegrenzt, mit einem Messerstecher in ein Zimmer gesteckt und mit der Reinigung der Latrinen beauftragt. Was sagt es über ihn, dass er in dieser Umgebung aufblühte? »Damals gab es keine Schulpsychologen«, sagt Huang. »Damals musstest du dir einfach ein dickeres Fell zulegen und die Ärmel hochkrempeln.«
Möglicherweise hat die Zeit Huangs Erinnerungen an das Oneida Baptist Institute weichgezeichnet. Als er im Jahr 2019 das von ihm gespendete Schulgebäude einweihte, beschrieb er den Weg über die mittlerweile verschwundene Hängebrücke, die er jeden Tag auf dem Weg zur Schule überquert hatte, als schöne Erinnerung. Er ließ unerwähnt, dass seine Mitschüler die Brücke zum Schaukeln gebracht hatten, damit er in den Fluss hinabfiel. Als ich ihn nach der körperlichen Arbeit in der Schule fragte, erklärte er mir, diese Pflichten hätten ihn gelehrt, harte Arbeit zu akzeptieren: »Aber hätte man mich damals gefragt, hätte ich wohl eine andere Antwort gegeben.« Im Jahr 2020 wurde Huang vom OBI gebeten, per Telekonferenz eine Rede auf der Abschlussfeier jenes Jahrgangs zu halten. In seinem Vortrag sagte er, die Zeit in dieser Schule gehöre zu den besten Erfahrungen seines Lebens.
Ab 1976 besuchte Huang die Aloha High School in einem Vorort von Portland im Bundesstaat Oregon. Er trug jetzt Jeans und eine Velourslederjacke und hatte das Haar in der Form eines Motorradhelms frisiert. Seine schulischen Leistungen waren weiter herausragend, und sein Englisch wurde rasch besser. Aloha war ein angenehmer Ort, und er schloss sich dort rasch mit ein paar anderen Strebern zu einer verschworenen Clique zusammen: »Wir waren drei oder vier und alle in denselben AGs: Mathematikclub, Naturwissenschaftlicher Club, Computerclub. Die beliebten Jungs eben! Eine Freundin hatte ich nicht.«
Am meisten interessierte ihn der Computerclub. Im Jahr 1977 kaufte die Schule einen Apple II; dies war einer der ersten Personal Computer, die in Massenproduktion hergestellt wurden. Huang war begeistert von der Maschine, spielte darauf das primitive Spiel Super Star Trek und erschoss Klingonen in einem Textgitter. Außerdem nutzte er sie, um in Basic seine eigene Version von Snake zu programmieren.
Sein anderes außerschulisches Interesse galt dem Tischtennis. Im Oneida Baptist Institute war Huang der unangefochtene Herrscher an der Tischtennisplatte im Freizeitraum gewesen, aber er hatte den Sport nicht ernst genommen. In der High School begann er, an Turnieren teilzunehmen. Trainiert wurde er von Lou Bochenski, dem Inhaber des Paddle Palace, eines Tischtennisvereins, der in einem ehemaligen Tanzsaal untergebracht war. Bochenskis Tochter Judy hatte im Jahr 1971 dem amerikanischen Team angehört, das im Rahmen der »Ping-Pong-Diplomatie« Peking besuchte. Aber Huang war nicht mit der asiatischen Spielweise vertraut und hielt den Schläger mit dem westlichen Griff.
Einen ganzen Sommer lang tat er praktisch nichts anderes als zu trainieren. Bochenski war so beeindruckt, dass er einen Brief an Sports Illustrated schrieb, in dem er Huang als den »vielversprechendsten Nachwuchsspieler« bezeichnete, »den der Nordwesten je hervorgebracht hat«. Das war umso bemerkenswerter, als der Junge erst seit drei Monaten an Wettkämpfen teilnahm. Huangs beste Schlagtechnik war ein stark überschnittener Vorhandball, mit dem er viele höher eingeschätzte Spieler besiegte. Manchmal tauchte er unter die Tischplatte ab, um scheinbar unerreichbare Schmetterbälle mit diesem Bogenschlag zurückzubringen. Innerhalb eines Jahres schaffte er es in die nationale Rangliste und erreichte bei den Unter-16-Meisterschaften in Las Vegas das Finale im Doppel. »Ich habe nie jemanden gesehen, der so schnell Tischtennisspielen lernte wie er«, sagt Joe Romanosky, ein Freund aus dem Paddle Palace.
Huang war athletisch und hatte gute Reflexe, aber die Eigenschaft, die ihn aus der Masse heraushob, war seine außergewöhnliche Konzentrationsfähigkeit. Wenn er sich darauf fixierte, über sich hinauszuwachsen, rückte die Welt in den Hintergrund. Er arbeitete mehr als jeder andere, besaß eine extrem hohe Frustrationstoleranz, resignierte nie und stieß nie an eine Leistungsgrenze. Stattdessen sah er mit bescheidener Zufriedenheit, wie aus seiner geduldigen, hingebungsvollen Konzentration auf die Grundlagen sein Können entstand.
Huang verbrachte fast seine gesamte Freizeit im Paddle Palace. Wenn er nicht trainierte, arbeitete er dort und schrubbte bis in die Nacht hinein die Böden, um sich die Anmeldegebühren für die Turniere zu verdienen. Bochenski gab ihm einen Schlüssel, und manchmal schlief Huang nach der Arbeit im ehemaligen Tanzsaal, anstatt nach Hause zu gehen. Die Tischtennisplatten standen auf Dielenböden in einer opulenten Umgebung: An der Decke hingen Kronleuchter, an den Wänden standen gepolsterte Bänke. Es gibt ein Foto von Huang im Alter von etwa 15 Jahren an der Tischtennisplatte: Er trägt eine für die siebziger Jahre typische Turnhose und gestreifte, knielange Socken: ein kleiner Jugendlicher mit Topffrisur, der mit einem intensiven Ausdruck des Wetteifers den Ball fixiert. »Er war ein sehr aggressiver Spieler, immer im Angriff«, erinnert sich Romanosky.
Als der Schulabschluss näher rückte, fand Huang einen Job bei Denny’s. Die Restaurantkette war zu jener Zeit bekannt für bitteren Kaffee, mit Eipulver zubereitete Speisen, aufgewärmte Wurstpasteten und rund um die Uhr geöffnete Lokale. Huang liebte die Arbeit im Restaurant. Er fing als Tellerwäscher an und arbeitete sich zum Kellner hoch. »Ich habe festgestellt, dass mein Verstand unter widrigen Bedingungen am besten funktioniert. Wenn die Welt auseinanderfällt, habe ich das Gefühl, dass sich mein Puls tatsächlich verlangsamt«, sagt er. »Vielleicht ist Denny’s der Grund dafür. Als Kellner musst du die Stoßzeit verkraften. Jeder, der einmal den Hochbetrieb in einem Restaurant bewältigen musste, weiß, wovon ich spreche.«
Bei Denny’s absolvierte Huang einen Intensivkurs in amerikanischer Küche. Dort aß er zum ersten Mal einen Cheeseburger mit Speck, sein erstes Würstchen im Schlafrock, sein erstes paniertes Beefsteak. Er aß sich methodisch durch die Speisekarte. Seine Lieblingsspeise war der »Super Bird«, ein mit Truthahnbrust, Schinkenspeck, Tomaten und Käse gefülltes und gegrilltes Sauerteigsandwich. Für einen Einwanderer, der die Kultur seiner neuen Heimat verinnerlichen wollte, war die Begegnung mit der deftigen Küche eines Diners die amerikanischste aller Erfahrungen.
Huangs Schulnoten waren ausgezeichnet, so gut, dass er in die National Honor Society aufgenommen wurde. Sein Leistungswille war angeboren; Huang erklärt, seine Eltern seien keine typischen »Tigereltern« gewesen und hätten ihn nicht zu schulischen Höchstleistungen angetrieben. »Tatsächlich waren meine Brüder beide miserable Schüler«, sagt er, wobei er sich bemüht, sofort klarzustellen, dass sie beide sehr intelligent seien. Auf die Frage, warum er als mittlerer Sohn der einzige war, der die Motivation besaß, gute Noten nach Hause zu bringen, antwortet er schulterzuckend: »Darauf habe ich keine Antwort. Ich vermeide es, mich auf diese Art selbst zu analysieren.«
Als er die Schule abschloss, hatte Huang ein Schuljahr übersprungen, als Sportler an nationalen Meisterschaften teilgenommen und einen herausragenden Notendurchschnitt erzielt. Trotzdem verzichtete er darauf, sich bei den renommiertesten Colleges zu bewerben, sondern wählte stattdessen die nahegelegene Oregon State University. Er dachte nicht lange über diese Entscheidung nach, und seine Eltern drängten ihn nicht, sich woanders einzuschreiben. Sein Schulfreund Dean Verheiden hatte sich für die Oregon State entschieden, weil seine Eltern dort studiert hatten, und Huang schloss sich ihm an: »Ich folgte einfach meinem besten Freund.«
Andere erklären seine Entscheidung anders. Mit siebzehn hatte Huang bereits in drei Ländern gelebt und mindestens fünf verschiedene Schulen besucht. Zu jener Zeit wurden an der Oregon State University mehr als 70 Prozent der Studienbewerber angenommen, und sie stand nicht an der Spitze der Rangliste der besten öffentlichen Universitäten in Oregon. Aber sie war nur anderthalb Fahrstunden vom Wohnort der Familie entfernt. »Er wäre überall aufgenommen worden – Ivy League, Stanford, Ostküste, überall«, sagt ein langjähriger Freund von Huang. »Er entschied sich für die OSU, weil er in der Nähe seiner Familie bleiben wollte.«
Huang begann sein Studium im Jahr 1980. Zu jener Zeit bot die Oregon State kein Informatikstudium an, weshalb sich Huang für Elektrotechnik entschied. Die ersten Kenntnisse, die er auf diesem Gebiet erwarb, prägten den weiteren Verlauf seines Berufslebens. Er lernte, Schaltkreise zu entwerfen, und damit würde er sein ganzes Leben verbringen. Und er lernte seine zukünftige Frau kennen.
Lori Mills war eine ernste achtzehnjährige Studienanfängerin mit Brille und braunem Haar. Sie war freundlich und umgänglich, aber sie hatte ein ausgeprägtes Bedürfnis nach klaren Strukturen, weshalb sie sich einen genauen Lebensplan zurechtgelegt hatte: Studienabschluss mit zweiundzwanzig, verheiratet mit fünfundzwanzig, Kinder mit dreißig. In der ersten Unterrichtswoche wurde sie Huang als Laborpartnerin zugeteilt. »Es gab etwa 250 Studenten im Studiengang Elektrotechnik, unter denen vielleicht drei Mädchen waren«, erinnert sich Huang. »Sie war die Hübscheste.« Viele männliche Studienanfänger buhlten um die Aufmerksamkeit von Mills, und Huang hatte das Gefühl, im Nachteil zu sein. »Ich war der Jüngste im Kurs und sah aus wie zwölf.«
Angesichts seiner geringen Erfolgsaussichten beim herkömmlichen Flirten wählte Huang eine andere Methode: »Ich versuchte, sie zu beeindrucken – natürlich nicht mit meinem Aussehen, sondern damit, dass ich sehr gute Hausaufgaben abgab.« An jedem Wochenende rief er Mills an, um sie zu überreden, die Hausaufgaben gemeinsam mit ihm zu machen. Auf die Hausaufgaben verstand er sich so gut, dass er sie manchmal als seine »Superkraft« bezeichnete. Lori ließ sich überzeugen, und die beiden wurden Studienpartner.
Im Labor saßen Huang und Lori gemeinsam über einem rechteckigen Kunststoffgitter, das als Steckbrett bezeichnet wird, und schlossen Bauteile an, um Verstärker und Rechenmaschinen zu bauen. Die Arbeit erforderte Feingefühl und Sorgfalt und brachte die Laborpartner zwangsläufig einander näher. Die Elektrizität floss von einer Stromquelle durch verschiedene Komponenten und kehrte zur Quelle zurück. Einfache Stromkreise ließen Glühbirnen aufleuchten und trieben digitale Uhren an. In anspruchsvolleren Stromkreisen kam ein als »Transistor« bezeichnetes Bauteil zum Einsatz, das wie ein digitaler Schalter funktionierte. Indem man mehrere Transistoren miteinander kombinierte, konnte man ein »Logikgatter« erzeugen, und durch die Verbindung mehrerer Logikgatter war es möglich, rudimentäre Rechenschritte wie 1 + 0 oder 1 + 1 durchzuführen. Und indem man diese einfachen Additionsmaschinen aneinanderreihte, konnte man richtige Mathematik betreiben. Der letzte Schritt bestand stets darin, den Schaltkreis zu schließen, sodass der Strom fließen konnte. Nach sechs Monaten am Steckbrett schlug Huang Mills ein richtiges Date vor. Sie sagte ja, und von da an waren die beiden unzertrennlich.
Huang schloss sein Studium schnell und mit ausgezeichneten Noten ab. Sein Studium fiel mit der Siliziumrevolution der achtziger Jahre zusammen. Die Studenten arbeiteten mit Steckbrettern, aber das bevorzugte Medium für kommerzielle Schaltkreise war ein behandeltes Siliziumkristall, das als »Halbleiter« bezeichnet wurde. Die Ingenieure »druckten« mit gebündeltem, ultraviolettem Licht logische Schaltkreise auf Siliziumplatten und zerteilten sie in winzige Quadrate, die sie als »Mikrochips« bezeichneten. Da sich sämtliche elektrischen Komponenten auf einem Chip an einer festen Position befanden, wurden die Mikrochips manchmal auch als »integrierte Schaltkreise« bezeichnet.
Der Siegeszug des PCs in den achtziger Jahren erzeugte eine gewaltige Nachfrage nach Mikrochips. Die wachsende Beliebtheit digitaler Geräte trug ebenfalls zum Wachstum dieses Marktes bei. Mikrochips wurden in Autos, CD-Player, Spielzeug, Mikrowellenherde und alle erdenklichen nützlichen Gegenstände eingebaut. Nach einer Weile fanden sie auch Verwendung in Ladegeräten, Kühlschränken, Kreditkarten und elektrischen Zahnbürsten. Die Folge war, dass überall qualifizierte Designer von Schaltkreisen gebraucht wurden. (Ihre Kenntnisse sind nach wie vor begehrt.) Noch bevor er sein Studium beendet hatte, fand Huang Arbeit im Mekka der Mikrochipindustrie: im Silicon Valley.
Kapitel 2Integration in immer größerem Maßstab
Es war ein Morgen kurz vor Weihnachten 1984. Über der Autobahn, die sich unweit der Grenze zu Oregon durch eine karge kalifornische Landschaft zog, ging die Sonne auf. Die Bäume entlang der Straße warfen lange Schatten auf die Fahrbahn und auf die Motorhaube des schnittigen Autos, das in hohem Tempo über den Asphalt glitt. Der Toyota Supra, ein kantiger zweitüriger Sportwagen mit Sechs-Zylinder-Reihenmotor, wirkte mit eingeschalteten Scheinwerfern von vorne betrachtet wie ein freundlicher Android. Am Steuer saß Jensen Huang. Er schnitt eine Kurve und gab auf der leeren Geraden Gas.
Er hatte zweifellos das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Auf dem Beifahrersitz saß seine Verlobte Lori Mills. Jensen hatte ihr am Vorabend bei der rauschenden Weihnachtsfeier von Advanced Micro Devices einen Heiratsantrag gemacht. AMD war der Mikrochiphersteller, für den Huang seit seinem zwanzigsten Lebensjahr arbeitete. Damals hatte er zwar noch keine alkoholischen Getränke kaufen dürfen, jedoch ein Einstiegsgehalt von 28 700 Dollar bezogen. Der Betrag war so beeindruckend, dass sich Huang noch vierzig Jahre später daran erinnert. Da er sparsam lebte, hatte er nach einem Jahr genug Geld gespart, um sich sowohl den Sportwagen als auch einen Verlobungsring leisten zu können.
Die Weihnachtsfeier von AMD war die naheliegende Kulisse für einen Antrag. Es war eine der extravagantesten Partys im Silicon Valley, AMD hatte das Konferenzzentrum Moscone in San Francisco gemietet und verwöhnte seine Mitarbeiter mit kostenlosen Getränken und Auftritten bekannter Bands. In jenem Jahr spielte die Rockgruppe Chicago für die versammelten Ingenieure tanzbare Versionen von »Saturday in the Park« und »25 or 6 to 4«. Im Jahr 1984 war die Techszene in der Bay Area noch ein Randbereich der amerikanischen Volkswirtschaft: Als Huang bei AMD anfing, waren die wertvollsten amerikanischen Unternehmen noch klassische Industrieriesen wie DuPont und General Electric. Als Huangs Generation von Unternehmensgründern ihr Werk vollbracht hatte, waren diese Industriekonglomerate ausgeweidet worden, und an der Börse gaben die Techfirmen den Ton an.
Lori Mills hatte den Antrag natürlich angenommen. Selbst an damaligen Maßstaben gemessen, waren die beiden sehr jung für eine Verlobung. Jensen war erst 21 Jahre alt, und Lori, die ein Jahr älter war, hatte ihr Studium noch nicht abgeschlossen. Aber beide waren häuslich, und ihre Ehe sollte ihr Umfeld später neidisch machen. Nach dem Antrag schlug Jensen vor, Lori zum Haus ihrer Eltern zu fahren, damit sie ihren Eltern die gute Nachricht persönlich überbringen konnte. Er verstand sich gut mit der Familie Mills, vor allem mit Loris Vater, einem leutseligen amerikanischen Familienoberhaupt, der sowohl äußerlich als auch im Auftreten Ähnlichkeit mit dem Schauspieler James Stewart hatte. Die Mills-Eltern ihrerseits hatten einen Narren an Jensen gefressen und waren überzeugt, dass ihre Tochter trotz ihrer Jugend unmöglich eine bessere Wahl hätte treffen können. Freunde des Paars scherzten, Jensen stehe Loris Eltern näher als seinen eigenen.
Aber obwohl Huang zuverlässig und außergewöhnlich erwachsen war, kam er gelegentlich auf Ideen, die nur ein Einundzwanzigjähriger für vernünftig halten konnte – beispielsweise auf die, nach einer Weihnachtsfeier, bei der reichlich Alkohol geflossen war, mitten in der Nacht eine neunstündige Autofahrt über schneebedeckte Berge zu unternehmen. Als die Sonne aufging, war das Paar bereits seit mehr als fünf Stunden unterwegs. Sie reisten durch ein karges und dünn besiedeltes Gebiet, in dem einige Einwohner ihre Herkunft bis zu den ersten Glücksrittern zurückverfolgen konnten, die auf der Suche nach Gold in diese Hügel vorgestoßen waren. Im Reich der aufgegebenen Goldgruben geriet der Supra auf der unsichtbaren Eisschicht über dem Asphalt ins Rutschen. Die Reifen fanden keinen Halt und das Auto schlitterte über den Randstreifen von der Straße.
Im nächsten Augenblick überschlug sich der Wagen, kam mit einem furchtbaren Knirschen auf dem Boden auf und holperte durch das steinige Gelände, wobei es Stück für Stück seine schicke Karosserie verlor. Als der zerstörte Wagen schließlich zum Stillstand kam, waren die beiden Insassen im Inneren eingeklemmt. Lori, die ihren Verlobungsring trug, war fast unversehrt, doch Jensen blutete. Er hatte sich den Nacken verrenkt.
Die Sonne ging auf, aber es war der kälteste Moment des Tages. Als die Rettungskräfte schließlich eintrafen, mussten sie die Verlobten aus dem Wrack herausschneiden. Bei Jensen wurden mehrere Wunden genäht, und er musste monatelang eine Halskrause tragen. Viele Jahre später nach dem Unfall gefragt, bedauerte er vor allem den Verlust des Supra. »Es war ein unglaubliches Auto.«
Jensen erholte sich, und die Beziehung zu Lori wurde durch die belastende Erfahrung möglicherweise sogar noch gefestigt. Mills schloss ihr Studium ab, und Huang kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück. Bei AMD entwarf er Mikrochipdesigns auf Papier. Für jede Schicht des Chips verwendete er ein eigenes Blatt. Die Transistoren waren auf der untersten Ebene angesiedelt, und darüber lagen die verschiedenen Verbindungen. Wenn er mit einer Ebene fertig war, brachte er das Blatt in ein Büro, wo das Design auf eine durchsichtige Folie aus farbigem Zellophan übertragen wurde. Anhand dieser Zellophanfolien wurden als »Fotomasken« bezeichnete Schablonen angefertigt, die in die Fabrik geschickt wurden.
Aus unerfindlichen Gründen wurden die Fotomasken bei AMD ausschließlich von chinesischen Frauen angefertigt. Sie saßen an Arbeitsstationen und ordneten die farbigen Projektionsvorlagen zu präzisen Mustern an. Diese Frauen sprachen kaum Englisch, und Huang, der in Taiwan mit dem Hokkien-Dialekt aufgewachsen war, beherrschte das Mandarin-Chinesisch nicht. Die beiden Sprachen waren so unterschiedlich wie Deutsch und Englisch, aber durch die Gespräche mit dem Fotomaskenteam lernte Huang Mandarin, die am weitesten verbreitete Variante des Chinesischen. Er eignete es sich »rein phonetisch« an, »in regelmäßigen Gesprächen«. Die Frauen erinnerten ihn an seine Mutter.
Huang verbrachte zwei Jahre bei AMD und behielt diese Zeit in guter Erinnerung. Er kaufte im Rahmen eines Mitarbeiterinvestitionsprogramms ein paar Aktien von AMD, die er aufbewahrte, was ihn nach einigen Jahren belustigte. Im Jahr 1985 überredete ihn ein Kollege, von AMD zu einer innovativen Firma namens LSILogic zu wechseln, die für Chip-Architekten die ersten Werkzeuge für das Softwaredesign entwickelte. Mitte der achtziger Jahre platzierten die Ingenieure bereits hunderttausende Transistoren auf einem Chip, weshalb die Entwürfe auf Papier an ihre Grenzen stießen. Es war, als würde man einen Tennisplatz mit einem feinmaschigen Netz aus menschlichen Haaren bedecken.
Der von LSI entwickelte »Large Scale Integration«-Prozess für Chips mit hohem Integrationsgrad automatisierte das Design der Schaltungsblocks auf der unteren Ebene, womit sich die Ingenieure auf die übergeordnete Architektur konzentrieren konnten. Im Lauf der Zeit entwickelten sich diese automatisierten Designwerkzeuge zu einer unvorstellbar komplexen Integration, der »Very Large Scale Integration« (VLSI). Dieser Integrationsgrad ist noch heute der Punkt, an dem die meisten Ingenieure ansetzen. Mit VLSI entfernten sie sich so weit von den grundlegenden Ebenen, dass sie mitunter vergaßen, dass es dort unten einzelne Transistoren gab. Nach einigen Jahren konnten sich nur noch Huang und ein paar andere alte Hasen an den handwerklich gestalteten Mikrochip erinnern.
Lori Mills schloss ihr Studium im Jahr 1985 ab und fand Arbeit bei Silicon Graphics, einem Hersteller teurer Workstations für 3D-Grafik. SGI, wie das Unternehmen überall genannt wurde, war zu jener Zeit der andere Arbeitgeber im Silicon Valley, und Lori verdiente anfangs mehr als Jensen. Wie AMD hatte auch SGI seinen Sitz unweit der US 101, jener Autobahn, die das Stadtzentrum von San Jose mit der knapp 40 Kilometer entfernten Universität Stanford in Palo Alto verbindet. Auf dieser Autobahn kam man an Ausfahrten vorbei, die zu eigentlich wenig bemerkenswerten Vororten wie Cupertino, Santa Clara, Milipitas und Mountain View führten, jenen Orten, an denen Apple, Intel, Cisco und Silicon Graphics beheimatet waren. Dort war die Talentdichte hoch, und nirgendwo auf der Erde war jemals vergleichbarer Reichtum auf einer so kleinen Fläche angehäuft worden wie an diesem Ort. Huang schien untrennbar mit dem Silicon Valley verbunden und sollte den Rest seines Berufslebens im Umkreis von acht Kilometern verbringen.
Die Namen der Ortschaften mochten mittlerweile bekannt sein, aber ihre Architektur war im Wesentlichen uninteressant. Von dem Glanz Manhattans, der einst eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Huangs Vater ausgeübt hatte, war im Silicon Valley nichts zu sehen. Dort gab es keine Straßenschluchten und kein pausenlos pulsierendes städtisches Leben. Stattdessen fand man in dieser von Autobahnen durchzogenen Senke am Südende der San Francisco Bay Area eine langweilige Ansammlung moderner, von Parkplätzen umgebener kastenartiger Gebäude mittlerer Höhe, Einkaufsstraßen und Hotels für Geschäftsreisende. Hinter den getönten Glasscheiben waren einige der brillantesten Ingenieure am Werk, aber außerhalb dieser Mauern deutete nur der Autoverkehr auf menschliche Aktivität hin.
Das Innere der Gebäude war genauso langweilig wie ihr Äußeres. Typisch für das klimatisierte Büro der achtziger Jahre waren Röhrenbildschirme, eintönige Teppichböden, surrende fluoreszierende Lampen und Zwischendecken, die Kabel sowie Leitungen verbargen. Die Großraumbüros waren zumeist als »Action Office« ausgelegt, was bedeutete, dass die Arbeitsnischen flexibel angeordnet und von unterschiedlich hohen Trennwänden umgeben waren. Bei LSI Logic hatten sich die Designer für einen Nischenraster von geringer Höhe entschieden, das die Mitarbeiter als »die Grube« bezeichneten. Huang traf dort im Jahr 1985 ein. Er trug jetzt eine Brille mit großem Rahmen, eine geschmackvolle Armbanduhr und Button-Down-Hemden, hatte aber immer noch langes Haar. Für ihn war die Grube das Paradies. Er hätte an keinem anderen Ort in der Welt sein wollen.
Wie im Tischtennis tat sich Huang auch bei LSI rasch durch seinen unglaublichen Arbeitseifer hervor. Einer von Huangs Kollegen war Jens Horstmann, ein Elektroingenieur, der im Rahmen eines sechsmonatigen Förderprogramms aus Deutschland gekommen war und LSI nicht mehr verließ. Horstmann und Huang waren beide Einwanderer, sie waren etwa gleich alt, sie hatten dieselben Initialen. Und bald waren beide bereit, ihr persönliches Leben und ihre geistige Gesundheit zu opfern, um eine nicht enden wollende Abfolge schwieriger technischer Probleme zu lösen. »So etwas wie Wochenenden kannten wie nicht«, sagt Horstmann. »Wir kamen um sieben Uhr morgens ins Büro, und um neun Uhr abends riefen unsere Freundinnen an, um zu fragen, wann wir nach Hause kommen würden.«
Im Lauf der Zeit wurde der Deutsche Huangs engster Freund. Horstmann war charismatisch, extrovertiert und vergnügt, und in seinem persönlichen Leben war er ein wenig wagemutiger als Huang. Er hatte breiter gestreute Interessen und ein größeres soziales Umfeld, doch am Arbeitsplatz war Huang derjenige, der größere Risikobereitschaft bewies. Mit der für ihn charakteristischen Hingabe hatte er sich in einen Experten für eine Software namens SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) verwandelt. Er gab eine geordnete Liste von Schaltungskomponenten in eine Befehlszeile ein, und die Software spuckte im Textformat Stromspannungsdaten aus. Die primitive SPICE-Software galt allgemein als akademisches Unterrichtswerkzeug, aber Huang nutzte sie, um die Leistungsfähigkeit der Schaltkreise in einem Maße zu erhöhen, das niemand für möglich gehalten hatte. Wenn die Kunden von LSI neue Funktionen wollten, antworteten die meisten Ingenieure einfach: »Unmöglich.« Huang sagte: »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Huang saß stundenlang vor dem Simulator und versuchte, die Liste der Komponenten so anzuordnen, dass sie ermöglichten, was der Kunde brauchte. Es war eine mühsame Arbeit, die er ohne Unterstützung grafischer Benutzerschnittstellen oder auch nur von Farbbildschirmen machen musste. Seine Zielstrebigkeit war bewundernswert, aber Horstmann kannte viele solche Ingenieure, die sich jedoch leicht in technischen Problemen verloren. Was Huang von ihnen unterschied, war seine Fähigkeit, Sackgassen zu umgehen. »Andere Leute kommen vom Weg ab«, sagt Horstmann. »Sie verirren sich in diesen tiefen, tiefen Rattenlöchern. Er nicht. Er ist in der Lage zu erkennen, wann ein Problem ein bestimmtes Niveau der Komplexität erreicht hat, auf dem weitere Fortschritte schwierig werden, und dann schlägt er eine andere Richtung ein.«
Die anspruchsvollsten Kunden von LSI waren die Designer von Computergrafiken, die einen unstillbaren Appetit auf schnellere Chips hatten. Um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, begann Horstmann angespornt von Huang, Aufträge für anspruchsvolle Produkte anzunehmen, obwohl die beiden keine Ahnung hatten, ob LSI tatsächlich in der Lage sein würde, diese Produkte zu liefern. Ältere Kollegen rieten den beiden zu größerer Vorsicht. Wisst ihr, was ihr tut?, fragten sie. Wenn das in die Hose geht, könnte es das Ende eurer Karriere bedeuten. »Sie hatten recht«, sagt Horstmann. »Aber wir machten uns keine Gedanken darüber.«
Fast alles, was Horstmann und Huang den Kunden versprachen, wurde schließlich geliefert. Der Lohn für die Bewältigung dieser großen technischen Herausforderungen waren weitere, noch schwierigere technische Herausforderungen. Huang liebte die wachsende Schwierigkeit; er genoss es, an Hindernissen zu wachsen. »Er war in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und das Ergebnis drei zu erhalten«, sagt Horstmann. »Damit meine ich, dass wir nicht nur für unsere Kunden arbeiteten, sondern die Aufträge in Werkzeuge und die Werkzeuge in Methodologien umwandelten.« Die meisten Ingenieure waren dazu nicht in der Lage, erklärt Horstmann – ja die meisten von ihnen waren nicht einmal zu 1 + 1 = 2 imstande. »Man kann von Glück sagen, wenn man anderthalb schafft.«
In ihrem Freundeskreis waren Huang und Mills die Verantwortungsbewussten. Sie heirateten als Erste in ihrer Gruppe und kauften als Erste ein Haus. Im Jahr 1988 zogen sie in ein zweigeschossiges Reihenhaus in San Jose mit vier Schlafzimmern ein, das eine straßenseitige Garage und einen Garten hatte, in dem Jensen grillen konnte. Sie hatten beide stabile, gutbezahlte Jobs bei angesehenen Firmen und zahlten die höchsten möglichen Beiträge in ihre steuerbegünstigten Altersvorsorgepläne ein. Sie adoptierten einen Hund namens Sushi, den sie mit bedingungsloser Zuneigung überhäuften. Sushi erwiderte ihre Liebe und schmiss mit seinem begeisterten Schwanzwedeln ständig Gegenstände um.
Horstmann bewunderte die Beziehung seines Freundes und Jensens geordnetes Leben. Er bewunderte auch die talentierte Ingenieurin Lori. Horstmann erinnert sich, dass er einmal mit ihr über ein technisches Problem sprach, an dem er arbeitete: Der Mikrochip im Satelliten eines Kunden funktionierte aufgrund störender kosmischer Strahlung nicht richtig. Lori hatte mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt. Um es zu lösen, musste man sich nicht nur in der Elektrotechnik, sondern auch in der Teilchenphysik auskennen. »Es war faszinierend, wie tiefgründig und strukturiert ihr Denkprozess war«, sagt Horstmann.
Der Nachteil des strukturierten Vorgehens war, dass die Huangs ein wenig … eindimensional waren. Sie arbeiteten unablässig, verreisten selten und hatten außerhalb der Halbleiterindustrie kaum soziale Kontakte. Horstmann erinnert sich, dass er Huang einmal einem Freund vorstellte, der eine kleine Brauerei betrieb, was in den achtziger Jahren noch selten war. »Jensen reagierte mit ›Wie bist du nur auf diesen Kerl gekommen? Wie konnte das passieren?‹« Huang schien keinen einzigen Freund außerhalb der Techbranche zu haben.
Huang wurde bei LSI mehrfach befördert. Er begann auch, nach Feierabend in Stanford Kurse zu belegen, um einen Master in Elektrotechnik zu machen, aber er hatte derart viel Arbeit, dass er acht Jahre brauchte, um das Studium abzuschießen. Mittlerweile fuhr er ein zweckmäßiges Pendlerauto und bewegte sich jahrelang zwischen der Universität im Westen des Valley, seinem Haus im Osten und seinem Arbeitsplatz in der Mitte hin und her. Als er im Jahr 1992 endlich sein Diplom erhielt, war vieles von dem, was er gelernt hatte, schon wieder veraltet.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: