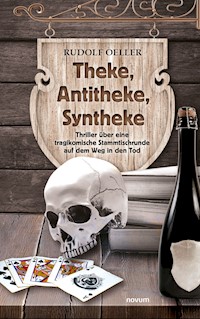
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum premium Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir waren eine großartige Bande von Stammtischbrüdern an der deutsch-österreichischen Grenze, auch zwei Stammtischschwestern waren dabei. Wir trafen uns jeden Freitag - eine verschworene Truppe, fast schon ein Dream Team. Drink Team trifft es allerdings besser. Voll Hoffnung starteten wir ins Coronajahr 2020, am Ende wurde es eine teils fröhliche, teils depressive Reise in den kollektiven Tod. Zunächst glaubten wir, es habe sich um Unfälle gehandelt, die wahren Hintergründe kamen erst an Weihnachten und auch nur zufällig ans Tageslicht. Wie es zu diesen Ereignissen kam? Das ist eine lange Geschichte, die ich am besten anhand meines Tagebuchs erzähle, beginnend mit dem ersten Stammtisch des verdammten Jahres, an dem wir alle trotz Ringe unter den Augen noch recht fröhlich feierten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Impressum 7
Widmung 8
Vorwort 9
Sonntag, 22. Dezember 15
Freitag, 3. Jänner 27
Freitag, 10. Jänner 35
Freitag, 17. Jänner 42
Freitag, 24. Jänner 48
Freitag, 31. Jänner 55
Freitag, 7. Februar 61
Freitag, 14. Februar 67
Freitag, 21. Februar 74
Freitag, 28. Februar 82
Freitag, 6. März 87
Freitag, 13. März 95
Freitag, 20. März 103
Freitag, 27. März 109
Freitag, 3. April 117
Samstag, 11. April (Karsamstag) 124
Freitag, 17. April 134
Freitag, 24. April 140
Freitag, 1. Mai 147
Freitag, 8. Mai 152
Freitag, 15. Mai 164
Freitag, 22. Mai 172
Freitag, 29. Mai 184
Freitag, 5. Juni 194
Freitag, 12. Juni 201
Freitag, 19. Juni 209
Freitag, 26. Juni 214
Freitag, 3. Juli 220
Freitag, 10. Juli 228
Freitag, 17. Juli 235
Freitag, 24. Juli 242
Freitag, 31. Juli 245
Freitag, 7. August 253
Freitag, 14. August 261
Freitag, 21. August 270
Freitag, 28. August 275
Freitag, 4. September 282
Freitag, 11. September 292
Freitag, 18. September 300
Freitag, 25. September 305
Freitag, 2. Oktober 310
Freitag, 9. Oktober 315
Freitag, 16. Oktober 319
Freitag, 23. Oktober 323
Freitag, 30. Oktober 328
Freitag, 6. November 335
Freitag, 13. November 341
Freitag, 20. November 346
Freitag, 27. November 351
Freitag, 4. Dezember 370
Freitag, 11. Dezember 373
Freitag, 18. Dezember 376
Donnerstag, 24. Dezember 386
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2021 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-025-0
ISBN e-book: 978-3-99130-026-7
Lektorat: Mag. Eva Zahnt
Umschlagfoto: Zdomiter, Leo Lintang, Valeriy Golubev, Phongphan Supphakankamjon, Atipat Chantarak | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Wolfram Öller
www.novumverlag.com
Widmung
Fürmeinen Kumpel Hans
undin Memoriam Emil
Vorwort
Wir waren eine großartige Bande von Stammtischbrüdern an der deutsch-österreichischen Grenze. Es waren auch zwei Stammtischschwestern dabei, Block Jane recte Jeanine und Dragoner recte Henriette.
Wir trafen uns jeden Freitag, selten auch an anderen Wochentagen, im Gasthaus zur Sauren Wiese. An jedem zweiten Freitag im Monat und gelegentlich auch, wenn wir Lust auf Hardrock-Musik hatten, fuhren wir auch in die Hopfenklause zum Rock-Pater Severin jenseits der Grenze oder in die Kneipe Zum Roten Affen in der Nähe unserer Sauren Wiese. Pasak und andere geile Säcke wechselten manchmal noch in den Nachtclub Stiff Bones, wo sie beim Pokern ihr letztes Geld verloren. Dieses Puff lag sinnvollerweise in der Nähe des Pfarrhofs und nur zehn Minuten zu Fuß von unserer Sauren Wiese entfernt. Unsere Lokale lagen auf österreichischem und deutschem Gebiet. Das war ok, denn wir fühlten uns als Europäer, zumal unsere Truppe ohnehin international war. Vor der Coronakrise wechselten wir mit unseren Fahrzeugen von einer Seite der Grenze zur anderen. Ich verließ mich selten auf die Fahrer, sondern fuhr lieber mit meiner Suzuki V-Strom oder meiner roten Harley. Als Deutschland, Österreich und andere europäische Länder im März 2020 das gesellschaftliche Leben auf null drehten und sogar unsere Lokale offiziell schließen mussten, haben wir Nieten uns zu einer Clique von Rebellen entwickelt. Wir brachten unsere Wirte dazu, für uns heimlich zu öffnen, denn wir ließen uns alles nehmen, nicht aber unseren Stammtisch und unsere Freiheit. Mit linken oder rechten Ideologien hatte das alles nichts zu tun. Unsere Wirte veranlassten während der kritischen Wochen sogar eine Verdunkelung wie im Krieg. Erstaunlicherweise ist keinem der verwegenen Grenzgänger bei unseren Fahrten über eine Forststraße etwas zugestoßen, aber das ist Vergangenheit.
Wir waren zehn. Mit unserem Wirt Blues sogar elf. Hie und da stießen auch der Pfarrer, den wir Kaiphas nannten, und unser Vereinspsychiater Psycho zu uns. Gelegentlich kamen auch einer der Gemeindeärzte und unser Orts-Sheriff Werner. Wenn weniger los war, gesellten sich noch die Wirte zu uns: Blues, der eigentlich Peter hieß, Wirt in der Sauren Wiese, Monk, der in Wahrheit Paul hieß, Wirt in der Hopfenklause, und Pavi, der mit bürgerlichem Namen Götz hieß, war Wirt im Roten Affen. Den Roten Affen nannten Hans und ich „Potex Rubens“, was so viel wie Roter Arsch bedeutet. Daraus leitete sich der Spitzname Pavi – von Pavian – ab. Pavi, ein Witzvogel bestenfalls mittlerer Intelligenzstufe und Meister der geschmacklosen und öden Witze, trägt es mit Humor.
Wir waren eine verschworene Truppe, fast schon ein Dream Team. Drink Team trifft es allerdings besser. Wir starteten voll Hoffnung ins Jahr 2020, am Ende wurde es eine teils fröhliche, teils depressive Reise in den kollektiven Tod.
Wer war mit dabei?
Ernesto vulgo Chewar seit Jahren Arbeiter mit angeblich bolivianischen Wurzeln in der Brauerei Pettingerbräu. Er war bis zu der Flucht des Staatspräsidenten Evo Morales ein Fan von ihm. Che träumte gelegentlich von einer gleichgeschlechtlichen Weltrevolution, wusste aber nicht, wie diese ablaufen sollte. Er liebte Jane auf seine Weise und sprach gerne über das Buch der Bücher, die Bibel. Er war ein liebenswerter südamerikanischer Schwuler mit theologischen Kenntnissen und tiefem christlichen Glauben. Nach seiner Einäscherung erfuhren wir über ihn etwas Unerwartetes.
Heinrich vulgo Charly. Charly ist den Schriftstellern Charles Bukowsky und Karl May entnommen. Er war angeblich pensionierter Briefträger und ehrenamtlicher Rettungsfahrer und Sanitäter. Den Briefträger hatte Charly erfunden. Er war nur als Student bei der Post gewesen. In Wahrheit hatte er mehrfach studiert, ohne ein Studium jemals zu beenden. Danach lebte er von Gelegenheitsjobs. Er erzählte uns gerne die wildesten Geschichten aus seinem Blaulichtleben. Charly hat nach eigenen Angaben in seinem ganzen Leben nur ein halbes Dutzend Bücher gelesen, die er immer wieder als seine Lieblingsbücher bezeichnete: „Der Mann mit der Ledertasche“ und „Faktotum“ von Charles Bukowsky und Bücher von Karl May. Erst später bekamen wir mit, dass er eine schillernde und vielseitig begabte Persönlichkeit war und viel mehr Bücher gelesen hatte, als er zugab. Wenn Charly zu viele Bockbiere getrunken hatte, mutierte er zum Sonderling, aber das war er auch ohne Bier. Wir nahmen ihn nicht immer ernst, was sich nach seinem Tod als Fehler herausstellen sollte.
Horst vulgo Pumpewar gebürtiger Berliner, Bodybuilder und selbsternannter Womanizer. Den Namen Pumpe bekam er, weil er gerne „Bölkstoff“ – wie er es nannte – abpumpte und im Fitnessstudio seine Muskeln aufpumpte. Wahrscheinlich nahm er Anabolika, aber darüber sprach er nie. Er war mit sechsundvierzig Jahren in Frührente gegangen, übte Gelegenheitsjobs aus, war belesen und sah wegen seiner Glatze, seiner langen Nackenhaare und seiner Nerd-Brille unverwechselbar komisch aus. Er hatte, so wie Hans und ich, ab und zu etwas zu lesen dabei, darunter auch Illustrierte und Fachzeitschriften über Modelleisenbahnen und Tauchen. Er erschien uns manchmal als Verschwörungssektierer, ein andermal als ernsthafter Gesprächspartner. Er war ein Träumer auf der ständigen Suche nach Anerkennung. Er war der ruhigste und am wenigsten nervige Typ von uns. Wir waren alle geschockt und traurig, als er uns für immer verließ.
Jeanine vulgo Janewar eine dunkelhaarige Schönheit mit einem eigenartigen bayrisch-österreichischen Misch-Akzent und Ansichten, die in Richtung Feminismus gingen. Wir nannten sie scherzhaft unsere jungfräuliche Nymphomanin, was sie nie dementierte. Sie fühlte sich zu uns Männern hingezogen, gleichzeitig wirkte sie blockiert. Sie ließ sich gerne vom schwulen Che, ihrem Arbeitskollegen in der Brauerei, bewundern. „Block Jane“, wie wir sie manchmal nannten, erschien uns etwas simpel gestrickt, aber das war nur vorgetäuscht, wie wir nach ihrem Ableben erkennen mussten. Sie hatte ein Herz aus Gold, trank gerne Weißwein und fuhr nach unseren Treffen viel zu schnell nach Hause. Beides sollte ihr zum Verhängnis werden. Ich weine nie bei Begräbnissen oder Hochzeiten. Als ich von ihrem Tod erfuhr, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten.
Konrad vulgo Knochenbrecherwar Physiotherapeut. Sein Name kam von seinen Behandlungsmethoden, die angeblich nur von Masochisten geschätzt wurden, aber das war lediglich ein running gag in unserer Runde. Er verabscheute seinen Spitznamen, fügte sich aber seinem Schicksal. Er fuhr einen roten Ford Mustang mit V8-Motor, den mein Freund Hans nach Konrads Tod erbte. Wir mochten den Knochenbrecher, obwohl er, so wie Pasak und Pumpe, ein Angeber mit Machogehabe war. Was soll ich zu seinem Tod sagen? Er war ein guter Physiotherapeut, der mich vor Jahren in kurzer Zeit von meiner „frozen shoulder“ heilte. Er war jedenfalls einer von uns. Sein Tod war ein herber Verlust.
Henriette vulgo Dragonerwar die Frau von Konrad. Sie war gebürtige Wienerin mit breitem Wiener Dialekt, holte Konrad meist um Mitternacht ab, blieb aber manchmal auch etwas länger. Sie beschwerte sich selten über unsere derben Witze, sie war mir also sympathisch. Gelegentlich war sie eine Nervensäge, mit der man aber laut lachen konnte, vor allem wenn sie zu viel Prosecco oder Cuba Libre intus hatte. Die in Wien übliche Bezeichnung Dragoner ist willensstarken Frauen vorbehalten – um es euphemistisch zu sagen. Als wir an ihrer Urne standen, wurde mir klar, dass die Welt für mich weniger bunt, weniger originell und weniger witzig sein würde.
Lothar vulgo Fat Lotwar wegen seines enormen Bierkonsums, seines gesegneten Appetits und seiner mangelnden Beweglichkeit übergewichtig. Sein Body-Mass-Index lag nie unter 36. Unter drei Litern Bier pro Abend ging bei ihm nichts, vor allem, wenn er am Pokertisch saß. Er täuschte Bildung durch vordergründigen Gebrauch von Anglizismen und manchmal auch lateinischen Sprüchen vor. Sein Spitzname war eine Folge des Lieblingsspruchs „A fat lot I care“ (ist mir scheißegal). Er versuchte ständig erfolglos, sein Gewicht zu reduzieren, indem er alle paar Wochen eine neue Wunderdiät ausprobierte. Sein Tod war grausam. Im Krematorium mussten sie über eine Stunde länger als üblich brennen, um seine sterblichen Überreste einzuäschern.
Pasakwar unter uns Stammtischmachos der lauteste und aufdringlichste. Seinen wahren Namen – genauer: seine vielen Namen – erfuhren wir erst nach seinem Tod. Er versuchte jahrelang vergeblich, Block Janes Beschützer zu sein. Er war der geilste Bock in der Runde und wusste alles besser. Er beleidigte gerne andere, weil er das für witzig hielt und nicht wusste, wo Satire begann oder Ironie aufhörte. Erst spät merkten wir, dass sein Benehmen nur Fassade war. Er hatte verdammt was drauf. Wir waren jedenfalls alle traurig, als er dran glauben musste und als Erster des grandiosen Drink Teams in die Grube fuhr. Das dunkle Geheimnis seines Lebens erfuhren wir erst nach seinem Tod.
Schließlich gab es in der Runde auch noch meinen Freund Hans und mich, die Zwei-Mann-Ibrahim-Loge. Über uns gibt es nicht viel zu erzählen, außer dass wir beide schon in Frührente leben, Musikliebhaber und Leseratten sind und bei jedem Treffen mindestens ein halbes Dutzend Bücher anschleppten, um uns zu unterhalten, manchmal auch, um die anderen zu nerven. Das hat uns eine Menge sensationelle Bezeichnungen beschert, wobei Klugscheißer noch neutral war. Hans hat eine merkwürdig aussehende Rauhaardackelmischung namens Shaasdougn (sprich: Schahsdak’n) und einen Honda-Roller. Ich fahre eine silbergraue Suzuki V-Strom namens Maus und eine dunkelrote Harley-Davidson Road King namens Harry.
Es gibt für mich keine melancholischere Zeit im Jahr als die Zeit der dunklen Tage rund um die Wintersonnenwende. Vor einem Jahr waren wir noch zehn. Jetzt sind wir, Hans und ich, nur noch der traurige Rest. Alle anderen, darunter einer unserer Wirte, haben sich für immer in eine hoffentlich bessere Welt verabschiedet. Zunächst hatten wir geglaubt, es habe sich in allen Fällen um Krankheiten oder Unfälle gehandelt, aber die wahren Hintergründe des Geschehens sind erst am Weihnachtsabend und auch nur durch Zufall ans Tageslicht gelangt.
Wie es zu diesen Ereignissen kam? Das ist eine lange Geschichte, die ich am besten anhand meines Tagebuchs und zahlreichen mit dem Mobiltelefon angefertigten Fotodokumenten im Corona-Jahr 2020 nacherzähle, beginnend mit Weihnachten 2019 und dem ersten Stammtisch dieses verdammten Jahres, an dem wir alle trotz dunkler Ringe unter den Augen noch recht fröhlich feierten.
Es folgten die Tage der Frühjahrs-Coronakrise, ein schöner und biergetränkter Sommer, die vielen Abschiede und das entsetzliche Ende im Dezember. Rückblickend muss ich gestehen, dass uns angesichts der Katastrophen, die wir erlebten, das Virus irgendwann egal war. Wir waren am Ende nur noch zu viert: Hans, unser Freund Psycho, der erst gegen Ende des Drink Teams zu uns stieß, meine Wenigkeit und Shaasdougn, der hässlichste, aber liebenswürdigste Hund in Mitteleuropa. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, begann zu Weihnachten und endete ein Jahr später wiederum zu Weihnachten.
Sonntag, 22. Dezember
im Gasthof zur Sauren Wiese,
4. Adventsonntag, Nachmittag
Ich stand allein an der Theke. Blues putzte wie immer Gläser. Wie feiert man Weihnachten, wenn man allein ist? Ich bestellte einen Weihnachtsbock, ließ meinen Blick in der Unendlichkeit verschwinden und kam ins Grübeln. Ich verbannte alle Gedanken an die Familie, auch an meine geschiedene Frau, und ließ nach einigen Minuten meine Luftschlösser ins Reich von Weihnachten abwandern. Ich musste dabei manchmal Selbstgespräche führen, denn Blues unterbrach mich alle paar Minuten mit „was war das eben?“
Ich ging zum Wurlitzer und drückte „Little Drummer Boy“ von Boney M. Das Lied erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der es sich nicht leisten kann, dem neugeborenen Jesus von Nazareth ein Geschenk zu machen und daher auf seiner Trommel spielt.
„Come they told me
Pa rum pum
A new born king to see
Pa rum pum
Our finest gifts we bring
Pa rum pum
To lay before the king
Pa rum pum …“
Ich gestehe, ich bin ein Weihnachtsromantiker. Das Herumstreunen auf Adventmärkten bereitet mir mehr Vergnügen als das Herumschlendern an einem Sandstrand in der Südsee.
Im Neuen Testament heißt es bei Lukas 2, 1: „In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Stadthalter von Syrien.“
Blues meinte, ich solle ihm nochmals die historischen Details rund um die Weihnachtsgeschichte erzählen. Nochmals ist gut. Ich muss das jedes Jahr zu Weihnachten tun. Ich kannte die Geschichte auswendig und begann zu dozieren.
Rom war nach den langen Bürgerkriegen und der Ermordung Caesars im Jahr 44 v. Chr. angeschlagen. Die nachfolgenden blutigen Machtkämpfe entschied der Großneffe Gaius Octavius für sich. Er war der Adoptivsohn und Erbe Caesars. Octavianus, wie er auch genannt wurde, befehligte mehrere Legionen. Mit einer Kombination aus militärischer Stärke und politischer List putschte er sich an die Macht. Unter dem Vorwand der Wiederherstellung der alten Republik betrieb er die Errichtung einer Monarchie. Das Volk und der Senat von Rom waren froh, endlich in Frieden leben zu können, daher ließen sie den neuen Herrscher gewähren, der damit eine Kaiserdynastie begründete. Seine Autorität festigte er nach außen durch Expansionskriege und nach innen durch eine Friedensphase, die später als „Pax Augusta“ in die Geschichte einging.
Ich stand schon vor dem Wurlitzer und wollte etwas einwerfen, als ich ein Weihnachtslied hörte. Wie sich herausstellte, probte der Männerchor des Nachbarortes im Veranstaltungssaal des Lokals für ihr Nachmittagskonzert am Heiligen Abend. Blues verschwand kurz und brachte mir das Programm. Wir hörten das polnische Weihnachtslied „Als die Welt verloren“ aus dem 19. Jahrhundert:
„Als die Welt verloren, Christus ward geboren …“
Ich dozierte weiter:
Zweiundvierzig Jahre vor der Zeitenwende (atheistische Version), das bedeutet 42 v. Chr. (old Christian school), nannte sich Caesars Adoptivsohn „Gaius Iulius Divi filius Caesar“. 27 v. Chr. erhielt er vom Senat den Ehrennamen Augustus (der Erhabene). Wegen seiner stetig anwachsenden Liste an Titeln wurde er verkürzt auch „Imperator Caesar Augustus“ genannt. Aus dem Namen Caesar entstanden später die Titel Kaiser und Zar.
Caesars und Augustus’ Eroberungskriege hatten Rom in eine Großmacht verwandelt. Niemand hatte damals die geringste Ahnung, wie viele Menschen in diesem Riesenreich lebten. Augustus wollte wissen, wie viele Untertanen er hatte und wie hoch die zu erwartenden Steuereinnahmen waren. Er ordnete folglich eine umfassende Zählung an. Da dies noch zu Lebzeiten von König Herodes stattfand, der 4 v. Chr. starb, liegt offenbar ein Fehler in der Zeitrechnung vor, aber das war mir immer egal.
Jetzt erklang „O Bethlehem, du kleine Stadt“, eine Melodie aus dem 16. Jahrhundert aus England. Es war wunderbar, und ein paar Sekunden vergaß ich meine Weihnachtsgeschichte:
„O Bethlehem, du kleine Stadt,
wie still liegst du hier,
du schläfst und goldne Sternlein
ziehn leise über dir.
Doch in den dunklen Gassen
Das ew’ge Licht heut scheint
Für alle die da traurig sind
Und die zuvor geweint.“
Blues kannte meinen Hang zur Weihnachtsromantik und wartete geduldig, bis ich weitermachte.
Publius Sulpicius Quirinius, ein Günstling des Imperators, war Statthalter in Syrien. Quirinius war loyal, klug und konsequent, somit der richtige Mann in der schwierigsten Provinz des Reiches. Hier lagerten starke römische Legionen zur Abschreckung in Richtung Osten. Vorgänger von Quirinius war Publius Quinctilius Varus, dessen Legionen im Jahr 9 n. Chr. im Teutoburger Wald von Germanenkriegern vernichtet worden waren.
Es ist fraglich, ob Quirinius der gesamten Bevölkerung befahl, in die Stadt ihrer Väter zur Zählung zu wandern. Für Josef und die schwangere Maria muss es ein beschwerlicher Weg von Galiläa im Norden nach Bethlehem im Süden gewesen sein, doch dieser historische Zweifel spielt heute keine Rolle mehr. Überhaupt ist heute vieles egal, was einmal war. Die Wanderung von Maria und Josef von Nazareth nach Süden war vermutlich später ins Evangelium eingefügt worden, um die Prophetenworte, wonach der Messias aus Bethlehem kommt, Wahrheit werden zu lassen.
Blues und ich blickten kurz auf, als „Tochter Zion, freue dich“ von Georg Friedrich Händel erklang. Ich achtete nicht auf den Text, sondern bestellte mir noch ein Glas Weihnachtsbock und grübelte weiter.
Blues sah auf die Krippe mit dem Weihnachtsstern und fragte mich, was ich von dem „Kometen“ über der Krippe halte. Ich begann, meine Gedanken jetzt lauter zu verkünden, denn einige Zechbrüder, die inzwischen eingetroffen waren, hörten zu.
Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten zu Beginn ihrer Aufzeichnungen von der Geburt Jesu. Matthäus erwähnt in seinem Evangelium mehrmals einen Stern. Sterndeuter haben den weiten Weg aus dem Osten auf sich genommen, um dem Stern des neugeborenen Königs der Juden zu folgen.
Astronomen haben sich seit Jahrhunderten den Kopf darüber zerbrochen, ob der Stern von Bethlehem nachweisbar existierte. Große Sterne sterben, indem sie mit gewaltiger Wucht explodieren. Eine solche Supernova wäre, wenn sie in unserer Milchstraße stattgefunden hätte, von den Himmelbeobachtern keinesfalls übersehen worden. Weder in den alten Schriften der Babylonier noch bei den Chinesen findet sich um die Zeitenwende ein Hinweis auf eine leuchtende Supernova.
Kometen erzeugen in Sonnennähe einen Dampfschweif, den man von der Erde aus erkennen kann. Kometen galten immer schon als Unheilsboten, andererseits aber auch als Ankündigung von Königen. Kometen sind nicht so selten, als dass sie als einzigartige Himmelserscheinung gelten könnten. Die Kometentheorie ist also nur teilweise plausibel.
Eine andere Überlegung ist wahrscheinlicher. Im Jahre 7 v. Chr. gab es eine sehr seltene Erscheinung am Himmel. Die beiden gut sichtbaren Planetengötter Jupiter und Saturn trafen sich gleich dreimal. Sie vollführten eine gemeinsame Schleife und kamen sich dabei so nahe, dass sie wie ein einziger großer heller Stern erschienen. Das war in den Monaten Mai, Oktober und Dezember im Jahre 7 v. Chr. Die dreifache Planetenkonjunktion fand zudem im Sternbild der Fische statt. Dieses Sternbild galt bei den Babyloniern als das Symbol für Israel. Für Sterndeuter war dies ein klares Zeichen.
Blues war beeindruckt.
Der Männerchor machte eine Pause. Einige der Sänger kamen an die Theke und bestellten Tee oder Glühwein. Bier wollte keiner, denn das sei schlecht für die Stimme, erklärte mir einer. Als sie gingen, tauchte ich wieder in Richtung Weihnachten ab und bestellte mir ein weiteres Glas Weihnachtsbock.
Ich erzählte weiter.
Unsere Jahreszählung geht auf den römischen Mönch Dionysius Exiguus zurück, welcher diese spät, nämlich erst im 6. Jahrhundert eingeführt hatte. Dionysius muss sich bei seinen Rückrechnungen geirrt haben, denn König Herodes, der Mörder von Bethlehem, starb höchstwahrscheinlich im Jahre 4 v. Chr., und der bei Lukas erwähnte Befehl des Kaiser Augustus, das Land in Steuerlisten zu erfassen, war zuletzt im Jahre 8 v. Chr. ergangen. Somit passen die historischen Eckdaten und das Treffen der Planeten Jupiter und Saturn überein.
Blues unterbrach mein Grübeln. Er fragte mich, wo Hans sei. Ich sagte, er werde mit seiner Shaasdougn schon noch kommen. Blues fragte mich, ob ich die Geschichte über die Fossilien, die ich vor einem Jahr schon vorgelesen hatte, nochmals lesen würde. Zufällig hatte ich das Buch über Weihnachtsbräuche in den Alpen in meiner Tasche. Als ich ihn fragte, was er hören will, meinte er nur: „Lies alles vor!“
Ich blätterte herum, erhob meinen obligaten Zeigefinger und dozierte:
Nicht nur die Saurier sind ausgestorben. Im Laufe der Jahrmillionen kamen und gingen Tier- und Pflanzenarten und hinterließen ihre Spuren in Form von Fossilien. Da man mit den merkwürdigen Fundstücken lange Zeit nichts anfangen konnte, fanden ihre Deutungen Eingang in die Welt der Sagen und Märchen. Ein Großteil der Fossilien wurde mangels natürlicher Interpretation mit Geistern und Dämonen in Verbindung gebracht.
In der Adventszeit ist oft von Raunächten die Rede. Mit rau sind Begriffe wie haarig oder pelzig gemeint. Rau ist auch eine alte Bezeichnung für Rauch. Die erste Deutung steht in Zusammenhang mit den dämonischen Gestalten, die der germanischen Sagenwelt nach in den Raunächten gesehen wurden. Die zweite Deutung entstammt dem uralten Brauch, diese Dämonen auszuräuchern.
Seit dem Mittelalter räuchert man mit geweihtem Rauch, vor allem in den weihnachtlichen Raunächten. In Österreich beginnen die Raunächte mit dem Thomastag, das ist der 21. Dezember, und sie enden in der Silvesternacht.
In den Raunächten ist nach alter Sage die „Wilde Jagd“ unterwegs, ihre Geister besitzen allerlei Tierfüße. Als angeblicher Beweis dient die Kuhtrittmuschel. Diese bis zu zwanzig Zentimeter große Muschel aus dem späten Erdaltertum, welche auf dem Dachstein-Plateau – und nicht nur dort – häufig gefunden wird, hat einen herzförmigen Querschnitt und erinnert an die Trittspuren von Rindern.
Ich erklärte Blues, dass der Dachstein, ein dreitausend Meter hoher Kalkriese, an der Grenze zwischen den Ländern Oberösterreich und Steiermark liegt. Dann las ich weiter.
Als eine weitere Form des Fußabdruckes von Alben, Druden und anderen Geistern galt der fünfzackige Drudenfuß. Die fünfteilige Symmetrie des Drudenfußes enthält nichts Magisches, sondern ist nur auf versteinerte Stachelhäuter, also Seeigel, Seesterne usw. zurückzuführen. Das Skelett dieser Tiere ist fünfstrahlig symmetrisch. Dies ist ungewöhnlich, daher hat man fossile Seeigel schon in der Bronzezeit als magische Grabbeigaben verwendet.
Eine seltene muschelähnliche Tiergruppe, die Brachiopoden, erinnert in ihrer Form an Vögel. Man nannte sie früher auch „Heilig-Geist-Steine“. Die sogenannten Ammoniten waren mit den heutigen Tintenfischen verwandt. Sie trugen schneckenähnliche Schalen und sind vor knapp siebzig Millionen Jahren gleichzeitig mit den Sauriern ausgestorben. Man hielt sie lange Zeit für versteinerte Schlangen. Da manche fossilen Überreste ungewöhnlich groß waren, wucherten in der Folge allerlei Drachengeschichten. So wurden Ammoniten, versteinerte Korallen sowie Knochen des Höhlenbären mit Drachen in Verbindung gebracht. Fossile Haizähne galten als Drachenzähne oder Drachenzungen.
Hans kam mit seinem Shaasdougn bei der Türe herein. Der Männerchor sang jetzt „Je angel gospodov“, ein slowenisches Weihnachtslied. Die Melodie ist wunderschön, da ich aber den Text nicht verstand, blätterte ich herum und gab nach dem Lied noch eine Geschichte zum Besten:
Im Lexikon liest man, dass ein Rentier bis zu zwei Meter lang und einen Meter dreißig hoch werden kann. Es gehört zur Familie der Hirsche. Im Gegensatz zu Reh oder Rothirsch tragen hier beide Geschlechter ein Geweih. Noch vor achttausend bis fünfzehntausend Jahren lebten Rentiere auch in Norddeutschland, wie man anhand von Knochen- und Geweihfunden nachweisen kann. Rentiere schließen sich zu gigantischen Herden zusammen und führen so weite Wanderungen zu neuen Futterplätzen durch. Der Lebensraum der Rentiere erstreckt sich heute über das nördliche Europa und Asien sowie das nördliche Nordamerika und Grönland. In Nordeuropa halten die Samen die Rentiere in Herden.
Auch tiefste Temperaturen fügen den Rentieren keinen Schaden zu. Die langen Außenhaare ihres Pelzes sind hohl wie Makkaroni – eine perfekte Wärmedämmung. Die Natur schenkte auch den Weibchen aller vierundzwanzig Rentier-Unterarten ein mächtiges Geweih, denn damit schaufeln sie ihr Futter aus dem Schnee: Moose, Flechten, Tundragras, manchmal auch einen Pilz. Sie ziehen schwere Schlitten, geben Fleisch und Milch, aus ihrem Fell entstehen Kleidung, Schuhe, Decken und Zelte, und das schon seit mehr als zweitausend Jahren.
Ein einziges der genügsamen Tiere wurde weltberühmt: „Rudolph, the rednosed reindeer“. Das angeblich rotnasige Tier zieht gemeinsam mit Artgenossen den Schlitten des Weihnachtsmannes. Rudolph und seine Rentier-Mannschaft wurden in der Fantasie des US-Dichters Clement Clark Moore geboren. Als dessen kleiner Sohn fragte: „Wie schafft es der Weihnachtsmann, in einer Nacht alle Kinder zu beschenken?“, ersann er den netten Rentier-Burschen mit der rotgefrorenen Nase, der dem Weihnachtsmann so fleißig hilft. Als Buch wurde Rudolph in den USA ein Bestseller, als Weihnachtslied ein Welterfolg. Unzählige Kinder in den angelsächsischen Ländern haben Rudolph, das rotnasige Rentier, ins Herz geschlossen.
Die Sache hat nur einen Haken. Während die Rentierbullen ihr Geweih nach der Brunft im Herbst verlieren, bleibt das Geweih der Kuh noch mehrere Wochen erhalten. So bekommt sie durch diese weise Einrichtung der Natur als trächtiges Weibchen Vorrang an den begehrten Futterplätzen. Wenn nun der Weihnachtsmann im Dezember mit seinen geweihtragenden Rentieren daherkommt, so kann es sich bei den Arbeitstieren nur um Weibchen handeln, denn die Männchen haben ihr Geweih längst abgeworfen. Rudolph ist daher in Wahrheit eine Rudolphine. Dies zeigt wohl, dass zur Weihnachtszeit auch bei den Rentieren die Frauen hart arbeiten.
Blues und Hans lachten.
Jetzt sangen die Männer im Nebenraum das schönste Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Das Lied ist zu schön, um es durch Gespräche zu stören. Wir waren still, bis die letzte Strophe verklungen war. Ich nutzte die Gelegenheit und las aus dem mitgebrachten Buch „Weihnachten und andere Krisen“ vor:
Der junge Hilfsgeistliche Joseph Mohr war bei Priestern und Bischöfen als aufsässiger Diener Gottes bekannt. Sein Vergehen bestand darin, ständig mit neuen Ideen daherzukommen, was als mangelnde Unterwürfigkeit gedeutet wurde. Als zu Weihnachten 1818 die Orgel in der kleinen Kirche von Oberndorf kaputt war, beschloss Mohr, dass etwas Neues versucht werden müsse. In einem alten Kirchenbuch fand er den etwas holprigen lateinischen Text „Alma nox, tacita nox, omnium silet vox, sola virginum nunc beatum …“ usw. Mohr dachte, dass es wohl für die Gläubigen besser sei, wenn sie in deutscher Sprache mitsingen könnten. Mohr übersetzte vom Lateinischen ins Deutsche und so entstand das berühmteste Weihnachtslied der Welt.
Mohr gab den Text seinem Freund Franz Xaver Gruber, der innerhalb weniger Stunden eine unsterbliche Melodie dazu komponierte. Die Gläubigen, die am Heiligen Abend die Christmette besuchten, staunten, als sie den Kirchenchor zusammen mit den beiden Solisten, dem Tenor Joseph Mohr und dem Bass Franz Gruber, hörten.
Mohr und Gruber zogen bald weg, aber die Oberndorfer vergaßen ihr Weihnachtslied nicht und sangen es jedes Jahr. Als der Zillertaler Orgelbauer Karl Mauracher 1825 die Orgel des kleinen Dorfes reparierte, hörte er zum ersten Mal „Stille Nacht“ und war beeindruckt. Mauracher schrieb das Lied ohne Angabe der Urheber ab, brachte Noten und Text ins Zillertal und übergab alles den singenden Geschwistern Amalie, Karoline, Anna und Josef Strasser. Diese machten das Lied bekannt, es galt von da an als Zillertaler Volkslied unbekannter Herkunft. 1833 erschien das Lied in gedruckter Form als „ächtes Tyroler Volkslied“.
Als sich die königliche Hofkapelle in Berlin 1854 unter anderen beim Stift St. Peter in Salzburg nach der Originalpartitur erkundigte, erfuhr Franz Grubers Sohn Felix von der Sache. Sogleich wurde der Ursprung des Liedes aufgeklärt. Die Berliner wandten sich direkt an Franz Gruber, der die Entstehungsgeschichte des Liedes aufschrieb.
Shaasdougn bekam von Blues ein Stück Wurst, was dieser genussvoll verdrückte. „Es ist nur einmal im Jahr Weihnachten.“
Wir hatten uns schon damit abgefunden, den Rest des Abends zu viert an der Bar zu verbringen, Blues, Hans, Shaasdougn und ich, als Pasak, Fat Lot, Charly und Block Jane mit lautem „Hallooo!“ bei der Tür hereinkamen.
Mir fiel im Moment nichts mehr ein. Ich hatte das Bedürfnis, ein richtiges Weihnachtslied zu hören, das meiner Stimmung entsprach: „Pasak, kannst du im Wurlitzer ein Weihnachtslied finden?“
„Ja“, meinte Blues“, „da ist noch ‚White Christmas‘ und ähnliches amerikanisches Zeug drin. Den ‚little Drummer Boy‘ hast du ja eben gedrückt.“
Pasak ging zum Wurlitzer. Kurz darauf ertönten die Stones: „Sympathy for the Devil“.
„And I was ’round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate.
Pleased to meet you
Hope you guess my name,
But what’s puzzling you
Is the nature of my game …“
In der Sauren Wiese gibt es ein Thekengästebuch. Niemand weiß, wer das vor vielen Jahren eingeführt hatte. Unser Wirt Blues meinte, es sei schon der sechste Band. Die ersten drei sind verschollen, sie lagern weiß Gott wo. Im Grunde stehen ohnehin nur Klosprüche drinnen wie etwa: „Such nicht nach Witzen an der Wand, den größten hältst du in der Hand.“
Ich wollte gerade einen ordinären Spruch und meinen Namen reinschreiben, als mir beim Herumblättern ein loser Zettel mit einem Gedicht auffiel:
Zehn kleine Zecherlein,
die tranken guten Wein.
Einer hatte Gift im Glas,
da waren’s nur noch neun.
Neun kleine Zecherlein,
die plantschten durch die Nacht.
Einer ist dabei ersoffen,
da waren’s nur noch acht.
Acht kleine Zecherlein,
die hat die Trauer aufgerieben;
Bei einer hat das Herz geflattert,
da waren’s nur noch sieben.
Sieben kleine Zecherlein,
die waren voll perplex.
Als einer fiel vom Kirchenturm,
da waren’s nur noch sechs.
Sechs kleine Zecherlein,
die hatten keine Trümpf.
Dead Man’s Hand war nicht genug,
da waren’s nur noch fünf.
Fünf kleine Zecherlein,
die tranken zu viel Bier.
Eine ist zu schnell gefahren,
da waren’s nur noch vier.
Vier kleine Zecherlein,
die gingen in die Brauerei.
Einer plumpste in den Kessel,
da waren’s nur noch drei.
Drei kleine Zecherlein,
die schossen gern mit Blei,
Einer fing ’ne Kugel ein,
da waren’s nur noch zwei.
Zwei kleine Zecherlein,
die fingen an zu weinen.
Einer legt sich auf die Schienen,
da gab es nur noch einen.
Ein kleines Zecherlein,
das litt gar große Not,
es starb am Grab der Freunde,
da waren alle tot.
Ich las es zweimal durch und fragte, wer das verfasst hatte. Es war mit Tuschefeder und in schöner Schrift geschrieben. Fast schon ein kalligraphisches Kunstwerk. Niemand hatte das Gedicht zuvor gelesen.
„Uns betrifft es ja nicht“, meinte Pasak, „wir leben ja alle noch.“
„Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne bei einer Pokerpartie mit Dead Man’s Hand sterben“, meinte Fat Lot grinsend, „und du, Jane, kommst gleich nach mir dran, weil du mit deiner Karre immer viel zu schnell unterwegs bist.“
Das Gedicht war mit „Teras“ unterschrieben. Ich kannte keinen Teras, auch der Wirt hatte keine Ahnung, wer das sein könnte. Charly, der neben mir stand, bemerkte meine gerunzelte Stirn und klärte mich auf: „Teras ist Griechisch und bedeutet so viel wie Ungeheuer. Schon mal was von einem Teratom gehört? Das ist eine besonders unheimliche Art von Krebs. Auch Terabyte kommt von Teras. Wörtlich übersetzt heißt das nichts anderes als ungeheuer viele Bytes“.
Wir mussten lachen und vergaßen die Sache schnell. Ich überlegte mir einen Spruch. Nach einigem Grübeln schrieb ich ins Gästebuch: „Ein Freund ist jemand, der mich mag, obwohl er mich kennt.“ Hans schrieb drunter: „Es ist ja nicht so, dass ich dich hasse, aber würdest du brennen und ich hätte Wasser, ich würde es trinken.“
Es war 2 Uhr, als wir alle aufbrachen. Blues begann, die Theke abzuwischen, dann löschte er die Lichter. Es hatte Minusgrade, und es schneite etwas.
Meine Harley-Davidson stand in der Garage. Road King Harry hielt Winterschlaf, genauso wie meine silbergraue Suzuki-Maus.
Freitag, 3. Jänner
im Gasthof zur Sauren Wiese
Wir trafen uns am 3. Jänner abends an der Theke in der Sauren Wiese. Die Theke hieß bei uns nur Theke. Die anderen hießen Antitheke, Syntheke oder hatten ordinäre Bezeichnungen. Alle von uns hatten noch von der letzten Silvesterfeier Ringe unter den Augen. Der einzige einigermaßen sportlich und frisch Aussehende war unser Wirt Blues.
Fat Lot klopfte gut gelaunt seine Sprüche, was Hans zu einem Kommentar veranlasste: „Charmant ist er schon“, und Pasak konterte: „Charme ist die Chance der Hässlichen und Dummen.“ Hans und ich gossen uns dunklen Weihnachtsbock ein.
Fat Lot erzählte von seinem Neujahrsvorsatz, seinen Wunderdiäten und schloss Wetten ab, wie viele Kilos er im nächsten Monat verlieren würde. Nachdem Blues unter allgemeinem Gelächter seine Brückenwaage zur Kontrolle zur Verfügung gestellt hatte, wechselte Fat Lot das Thema.
Fat Lot hatte Hans’ Kompliment überhört, redete fast ununterbrochen, und fragte mich gelegentlich etwas, was ich meist mit „Jawohl!“ beantwortete. Ich höre nicht zu, wenn jemand Unsinn redet, und das passiert eigentlich fast immer. Ich blätterte in einem der mitgebrachten Bücher und wurde wieder einmal von einem in der Runde, meinen Stammtischgeschwistern, „Hausautist“ genannt. Wenn die Weiber nicht da sind, haben Hans und ich Stammtischbrüder, aber wenn wenigstens eine anwesend ist, schalten wir um des Friedens willen auf „Geschwister“ um.
Die Stimmung war an diesem Abend etwas gedämpft, einige kämpften noch mit dem Jahreswechsel-Kater. Die Silvesterparty war wie meistens ein voller Erfolg gewesen. Da die meisten schon um 20 Uhr einen Zacken in der Krone hatten, lohnte sich kein Eintrag im Tagebuch.
Der Knochenbrecher schaute erkennbar frustriert in sein abgestandenes Bier, dann auf seine Uhr, wohl wissend, dass ihn der Dragoner in spätestens drei Stunden aus dem Lokal schleifen würde. Hans und ich versprachen ihm, seinen Dragoner in ein längeres Gespräch zu verwickeln, was bis zu einer Stunde Zeitaufschub bringen konnte.
Fat Lot jammerte, weil er seit Weihnachten zwei Kilo zugenommen hat. Hans versuchte ihn zu trösten und gab ihm einen Tipp: „Abnehmen ist ganz einfach. Man muss nur Appetit auf Dinge trainieren, die man nicht mag.“ Fat Lot meinte, das sei nicht so einfach, denn er fresse schließlich alles, wenn er Unterzuckerung spüre. Hans ließ nicht locker. „Schau dir einfach den Film ‚Das große Fressen‘ von Marko Ferreri an, und schon vergeht dir für einen Tag der Appetit.“
„Ja eh“, gab ihm Fat Lot Recht, „aber in dem Film vögeln sie so herrlich, und das macht wieder Appetit.“
Block Jane nippte an ihrem Irish Coffee. Ihren vermeintlich richtigen Namen Jeanine verwendeten wir schon lange nicht mehr. Da sie aber dafür bekannt war, mit ihrem Traumbusen und ihrer Wespentaille manchmal im Minirock und Netzstrümpfen zu erscheinen und dadurch anzügliche Sprüche provozierte, gleichzeitig aber jedes eindeutige Angebot – meist von Pasak – zurückwies, galt sie in der Runde als nymphomanische Jungfrau. Von der „blockierten Jeanine“ zur Block Jane war es nur ein Schritt.
Jane versuchte, Fat Lot aufzuheitern: „Schau mal, mein lieber Lothar, Gewicht zu reduzieren ist nur eine Sache des Willens. Du kannst das. Meine kaputte Kindheit kann ich dagegen nicht abschütteln. Als Kind hat mir meine Mutter immer eine Wurst umgehängt, damit wenigstens der Hund mit mir spielte.“ Fat Lot mochte es nicht, wenn jemand versuchte, ihn mit aufgesetzt dummen Sprüchen aufzuheitern.
Der schwule Ernesto, der von allen nur Che genannt wurde, tat ganz erstaunt und heuchelte Empathie, so als ob er die Kindheitsgeschichte zum ersten Mal gehört hätte. Che stammte nach eigenen Angaben aus Bolivien, machte aus seiner sexuellen Orientierung kein Geheimnis, arbeitete seit Jahren in der Brauerei Pettingerbräu und liebte Block Jane. Platonisch, versteht sich, aber innig. Da er nichts von ihr begehrte, liebte auch sie ihn. „Aber Jane“, sagte er, „du musst lernen, die alten Geschichten loszulassen. Im Übrigen wird Liebe überbewertet. Liebe ist in der Regel ein Wort mit drei Vokalen, zwei Konsonanten und zwei Idioten.“
Pasak hatte mitgehört. Niemand kannte seinen wahren Namen. Er hieß in der Runde nur Pasak. Er hatte einen tschechischen Akzent, zumindest klang das so. Er war der geborene Macho, versuchte ständig bei Block Jane zu landen, wurde aber regelmäßig abgewiesen. Er grinste Che ins Gesicht und sagte für alle hörbar: „Che ist einer von denen, die über ein Dutzend nackte Frauen hinwegsteigen, um zu einer Flasche Bockbier zu kommen.“ Block Jane kannte Pasaks Sprüche und fauchte zurück: „Lieber Bier im Blut als Stroh im Kopf, und wenn Kurt Cobain dich gekannt hätte, dann hätte er sich zweimal erschossen.“
Wir waren alle noch etwas verkatert, es war der Tag der blöden Sprüche. Wer wann was ernst oder humorvoll meinte, war letztlich egal.
Hans und ich blätterten derweil in unseren mitgebrachten Büchern. Die anderen hatten sich daran gewöhnt, manchmal stellten sie Fragen, und dann konnte es zu kleinen Vorträgen kommen. Wir waren für die anderen die Philosophen in der Runde.
Ich bestellte ein zweites Bier, und mein Kater war auf wunderbare Weise aufgewärmt. Es fühlte sich gut an. Das musste Fat Lot natürlich kommentieren: „Two beer or not two beer. That is the question.“ Charly staunte über Fats Literaturkenntnisse, betonte, dass dieses Zitat Charles Bukowsky auch schon verwendet hatte und bestellte ebenfalls ein Bier.
Charly hatte doch tatsächlich ein Buch von Charles Bukowsky mitgebracht. Es enthielt zwei Romane und einige Gedichte. Charly war wegen seiner Rückenprobleme ein vorzeitig pensionierter Briefträger. Zumindest behauptete er das. Trotzdem half er noch gelegentlich in unserer Rettungsstation aus. Da er immer noch eine Lizenz als Rettungssanitäter besaß, wurde er gelegentlich zum Beidienst eingeteilt, wenn es viel zu tun gab. Er kündigte aber an, mit Ende des Jahres endgültig Schluss machen zu wollen. Niemand fragte nach, warum er in seinem Beruf pensionierungswürdige Rückenprobleme hatte, nicht aber im Rettungsdienst. Nur der Knochenbrecher erinnerte ihn manchmal an die Sache, wenn er rief: „Es lebe der Sozialstaat!“ Was Charly beruflich tatsächlich machte, wusste niemand so richtig.
Normalerweise erzählte Charly uns von seinen interessantesten Rettungseinsätzen, aber jetzt blätterte er in seinem Bukowsky, wartete auf eine Pause und las dann laut aus dem Buch „Der Mann mit der Ledertasche“ vor:
„Aber ich sagte mir immer wieder, Herr Gott, als Briefträger braucht man nichts anderes als seine Briefe abzuliefern und mit der Hausfrau ins Bett zu steigen. Genau der richtige Job für mich.“
Pasak grinste und fragte, wie viele Briefe er pro gebumster Hausfrau zustellen musste, aber da startete Hans den Wurlitzer.
Kurz darauf ertönte „Dancing Queen“. Block Jane sang mit:
„You are the dancing queen
Young and sweet
Only seventeen
Dancing queen …“
Che beschäftigte trotz seines Katers eine Frage. Er wandte sich an mich. „Sag mal, wie ist das eigentlich mit den Monatsnamen? Zehn heißt auf Spanisch diez. Auf Italienisch heißt es dieci. Der Dezember hat also wahrscheinlich etwas mit der Zahl zehn zu tun.“ „Richtig“, bestätigte Hans, „denn zehn heißt auf Lateinisch decem. Dezember ist demnach der zehnte Monat.“ Che war verwirrt. „Warum wird dann der zwölfte Monat im Jahr lateinisch als zehnter Monat bezeichnet?“
Ich hob meinen rechten Zeigefinger, daher hat mich die Bande auch „Erklärbär“ genannt. Jetzt war ich wieder ganz der Vortragende, der in der Volkshochschule Vorträge über Philosophie und Geschichte hält. Ich fischte das Buch „Historische Tiefschläge“ aus meinem Stapel, blätterte herum, dann hatte ich die Stelle gefunden und begann zu dozieren.
Bei den alten Römern begann das Jahr nicht im Jänner, sondern im März. Die alten Monatsnamen verraten dies. Septem heißt sieben, decem bedeutet zehn. Der September war der siebte Monat im Jahr, der Dezember der zehnte. Julius Caesar und Augustus stifteten in ihrer Eitelkeit die Monatsnamen Juli und August und gaben ihnen jeweils einen einunddreißigsten Tag. Die beiden Tage entnahmen sie dem Februar, wodurch dieser nur noch achtundzwanzig Tage aufwies. Das ist ein merkwürdiges Erbe, welches die Zeiten überdauerte.
Che war begeistert. „Dann ist der kurze Februar also eine Folge der Eitelkeit zweier Cäsaren?“
„Genau“, sekundierte Hans. Ich fuhr fort und erklärte nun, ohne vorzulesen: „Die Römer wussten, dass ein Jahr nicht genau dreihundertfünfundsechzig Tage hat, sondern dreihundertfünfundsechzig und einen Vierteltag. Aus diesem Grunde hängten sie alle vier Jahre im Februar einen Schalttag an, wodurch der Kalender wieder ins Lot kam. Der Teufel steckt aber im Detail. Ein Jahr dauert, wie die Astronomen herausfanden, nicht dreihundertfünfundsechzig und einen Vierteltag, sondern etwas weniger. Im Zeitraum von einigen Jahrzehnten ist dies ohne Bedeutung, aber im Laufe der Jahrhunderte wurden wegen dieses kleinen Unterschieds zu viele Schalttage eingeschoben. Der Kalender wurde fehlerhaft.“
„Jaja, mit der Zeit ist das so eine Sache“, meinte Fat Lot und nahm einen tiefen Schluck, „Comes time, comes bicycle“, fügte er an.
Che war verwirrt. „Was?“
Hans beruhigte Che. Er meinte nur: „Kommt Zeit, kommt Rad.“
Ich fuhr mit erhobenem Zeigefinger fort:
„Im Jahr 325 hatten die Bischöfe am Konzil von Nizäa beschlossen, dass die Tag- und Nachtgleiche des Frühlings auf den 21. März fallen soll. Daraus folgten alle anderen beweglichen Festtage.“
Nur Che hatte noch zugehört. „Nach dem Silvesterkater und nach zwei Reparaturbieren seid ihr zwei“ – er meinte Hans und mich – „noch gut drauf.“ „Nicht übertreiben“, entgegnete Hans, und ich ergänzte: „Erzählen geht gerade noch.“
„Na“, meinte der Knochenbrecher, „seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht?“
„Scheiß-Rutsch“, maulte Pasak, „woher kommt denn der Quatsch? Ich habe mich ins neue Jahr mit Bier und Gin herübergeblödelt. Ist jemand von euch gerutscht? Ich nicht.“
Hans klärte Pasak auf, dass es sich beim Rutsch um einen Ausdruck aus dem Jiddischen handelt. Die Juden sind laut Hans ein erstaunliches Volk. „Obwohl sie innerhalb der gesamten Menschheit zahlenmäßig nur ein Spurenelement bilden, sind ungefähr 20 % der Nobelpreisträger Juden. Kein anderes Volk schafft auch nur näherungsweise so eine Zahl. Wohin man in den Wissenschaften und Künsten auch blickt, die Juden sind bei weitem überrepräsentiert.“
Alle hörten jetzt zu. Ich fuhr fort.
Ein machtvoller Einfluss des Judentums ist im Bereich der Philosophie zu erkennen und hier wiederum in einer Kunstform, die am Verschwinden ist, dem Witz. Amerikanische Juden haben das Wort aus Deutschland sogar in die USA mitgenommen. Der jüdische Witz ist geistvoll und hintergründig, mitunter auch doppelbödig. Da ein guter Witz fast immer auf Kosten von irgendjemandem geht, drängt die dumme political correctness die wunderbare Kultur des Witzes immer mehr ins Private zurück und bringt stattdessen den öffentlichen dummen Klamauk und das seichte Blödeln hervor.
Alle applaudierten. „Toller Vortrag“, meinte Pumpe. Es war uns nicht aufgefallen, dass Pumpe die ganze Zeit auf seinem Smartphone herumgewischt und bisher geschwiegen hatte. Pasak beschwerte sich. „Jetzt weiß ich immer noch nicht, was es mit dem blöden Rutsch auf sich hat.“
Jetzt war ich an der Reihe.
Zum Jahreswechsel wünschen wir uns einen guten Rutsch. Dieser Ausdruck kommt von jiddischen Rosch ha-schana, was Anfang des Jahres bedeutet. Das Wort soll an die Erschaffung der Welt erinnern. Die Juden wünschten sich damit einen guten Jahresanfang. Nichtjuden hörten das, verstanden nicht die Bedeutung und machten daraus unseren neudeutschen Rutsch.
Pasak hatte ausnahmsweise zugehört, bestellte sich noch ein Bockbier und murmelte: „Nach drei Starkbieren erkennt man die Tiefe des Lebens. Nüchtern nur die Abgründe.“
Block Jane hatte ihre Beine übereinandergeschlagen, sodass man ihren feuerroten Slip sehen konnte. Pasak bekam Stielaugen. Che schnappte sich irgendein Buch und blätterte herum. Der Knochenbrecher wurde immer stiller. Fat Lot bestellte sich beim Wirt noch einen Hamburger Spezial, Block Jane warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, aber Fat Lot meinte nur: „Ich bin gleich zu Hause, und zu Hause ist man dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss.“
Sein Neujahrsvorsatz hatte nur achtundvierzig Stunden gehalten.
Die Gespräche verflachten, Block Jane erzählte noch einen Witz:
„Lothar steht nackt vor dem Spiegel und meint: Drei Zentimeter länger, und ich wäre Prinz Karneval. Seine Mama antwortet: Und drei Zentimeter kürzer, und du wärst Kölner Jungfrau.“ Fat Lot lächelte säuerlich. Man sah, dass er versuchte, einen Rachewitz aus seinem Gedächtnis zu holen. Es war vergeblich.
Che spürte langsam seine Promille. „Gott ist nicht tot“, murmelte er lallend, „sondern er lebt in Frankreich, das behauptet sogar Pasak. Er wohnt dort in dieser Villa, die einmal einem Pancho gehört hat, aber der ist längst davongeritten.“ Niemand beachtete das Gefasel.
Um 1 Uhr rauschte der Dragoner herein. Der Knochenbrecher hatte schon vorgesorgt und den Mantel angezogen. Sie gingen beide und wünschten zuvor noch ein gutes Neues Jahr. Aus der Extrastunde für den Knochenbrecher wurde nichts. Charly winkte ihnen nach und blätterte in seinem Bukowsky.
Ich warf eine Münze in den alten Wurlitzer, der nach Jahrzehnten immer noch funktionierte. Einige Platten kratzten, aber das störte niemanden.
„The Wind cries Mary“ war einer meiner Lieblings-Hits.
Hans und ich sangen mit und wurden melancholisch:
„After all jacks are in their boxes
And the clowns have all gone to bed
You can hear happiness
staggering on down the street
Footprints dressed in red
And the wind whispers Mary.“
Und weil ich gerade in einer melancholischen Stimmung war, schickte ich einen alten Song hinterher. Es wurde still in der Runde, denn wir hörten alle andächtig „Nights in White Satin“ von den Moody Blues.
Als der Wurlitzer seinen letzten Ton von sich gab, lag Pasak schlafend auf der Bank, alle anderen waren gegangen.
Ich krallte mir das Thekenbuch und schrieb hinein: „Die Haare, die Zehen- und die Fingernägel sind die einzigen Stellen, an denen Frauen heutzutage noch rot werden.“ Ich wollte das Thekenbuch schon an Hans weitergeben, als mir ein eingeklebter Zettel mit einem merkwürdigen Text auffiel, der mit einer Schreibmaschine getippt war: „Honesta mors turpi vita potior.“ (Ein ehrlicher Tod ist besser als ein schändliches Leben.) Der Zettel war mit „Teras“ unterschrieben. Blues wusste nicht, von wem der Zettel stammte.
Hans und ich klappten unsere Bücher zu, sagten laut „Ibrahim“, tranken aus und verließen als Letzte die Theke.
Freitag, 10. Jänner
in der Hopfenklause
Wir saßen jenseits der Grenze in der Hopfenklause, die intern auch „Antitheke“ genannt wird. Da ich den Fahrkünsten anderer misstraue, fuhr ich mit meiner Suzuki-Maus über die Grenze. Hans folgte mir auf seinem roten Honda-Roller. Die Zeiten, als ich mich über seine fahrende „Klomuschel“ lustig machte, waren vorbei. Jeder Möchtegern-Rocker soll nach seiner Façon selig werden.
Alle waren da. Monk, der Hopfenklausenwirt, war an diesem Abend ausnahmsweise gut drauf. Sonst war er immer eher schweigsam. Charly hatte einen Ordner „Sanitätshilfe“ mit. Er wollte nochmal, „ein allerletztes Mal“, wie er sagte, eine Zweijahreslizenz für den Rettungssanitäter bekommen und musste noch büffeln.
Hans blätterte in einem mitgebrachten Buch über die verschiedenen Typen von Arschlöchern. Nach einiger Zeit schmunzelte er und zeigte mir das Inhaltsverzeichnis. „Alles klar“, meinte er, „wir beide und Charly sind Eigenbrötler, Block Jane ist ein Klammeraffe, du bist zusätzlich auch ein narzisstisches Arschloch, weil du auf jede Art von Kritik mimosenhaft reagierst, Pasak ist ein Riesenarschloch, der Knochenbrecher und sein Dragoner sind …“
„Halte dein blödes Maul!“, brüllte der Dragoner, der heute alles andere als gut drauf war, über die Theke, „ich kann ohne deine Psychoanalyse leben.“ Hans verstummte augenblicklich. Sie ist eine eigensinnige Tussi, dachte ich, sagte aber nichts. Dem Dragoner zu widersprechen war selten ratsam.
„Der Dragoner ist heute aber streng“, meldete sich Pasak zu Wort.
Block Jane warf ihm einen herben Blick zu: „Sie heißt immer noch Henriette. Es heißt die Henriette und nicht der Dragoner.“
Unser Wirt Adrian, den Hans und ich wegen seiner ansonsten schweigsamen und pingeligen Art „Monk“ nannten, grinste hinterhältig: „Man sagt ja auch die Conchita Wurst, obwohl er der Herr Tom Neuwirth ist. Also, lieber Herr Dra …, Frau Henriette, Genderismus ist genauso übrig wie dragonisch.“
Alle lachten, sogar der Dragoner.
Irgendwann kam die Sprache auf Männer und Frauen, und welches Geschlecht dem anderen überlegen wäre. Es flogen die üblichen Allgemeinplätze und Dummheiten durch den Raum, bis jemand die Bemerkung machte, dass eine Welt ohne Männer aus lauter frustrierten und übergewichtigen Frauen bestehen würde.
Für den Dragoner war das ein aufgelegter Elfmeter.
„Es gibt nichts Leichteres als einen Mann zu töten. Man muss nur Hundefutter in sein Essen mischen.“
Jetzt hörten sogar Pasak und die anderen zu. Der Knochenbrecher kannte den Witz schon, ich übrigens auch.
„Wenn du deinem Mann Hundefutter ins Essen gibst, dann bellt er nach einer Woche den Mond an, nach zwei Wochen pinkelt er im Garten im Knien an den Baum, und nach drei Wochen bricht er sich das Genick beim Versuch, an seinem Sack zu lecken.“
Dröhnendes Gelächter. Auch Pasak lachte. Ich blickte mich um, und suchte nach Pater Severin, aber der war zum Glück nicht da. Priester halten bekanntlich viel aus, aber das wollte ich Pater Severin doch nicht zumuten.
Der Dragoner blätterte in den herumliegenden Tageszeitungen und schimpfte lauthals über die Qualität der Medien. „Da schreibt doch einer vom anderen ab“, maulte sie, „und am Morgen können wir in der Zeitung lesen, was am Abend zuvor im Internet gestanden ist.“
Pumpe gab dem Dragoner recht. „Jaja, die Journalisten. Ich war auf dem höchsten Gebäude der Welt, aber die Journalisten haben nie darüber geschrieben.“
Hans fragte: „Was ist denn das höchste Gebäude, lieber Horst?“
Pumpe wissend und mit erhobenen Augenbrauen: „Das ist der CN-Tower in Toronto.“
Hans blätterte in seinem Buch „Wolkenkratzer, Könige der Klaustrophobie“ und meinte nur lapidar: „Falsch. Das ist diese lange Wüstennadel in Dubai.“
Pumpe gab sich nicht geschlagen: „Damals, als ich oben war, war es das höchste Gebäude der Welt, aber das haben die Journalisten ignoriert. Da wurde in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur das angeblich höchste Gebäude der Welt eröffnet. Das Doppel-Hochhaus heißt Petronas-Towers und ist mit vierhundertfünfundzwanzig Metern Höhe tatsächlich imposant. Laut Agenturberichten hat damals dieses Doppelding in Südostasien den Sears-Tower in Chicago um wenige Meter geschlagen.“
Pumpe lief zur Hochform auf, als er merkte, dass ihm ausnahmsweise die meisten zuhörten: „Die Meldung hatte nur einen Haken. Sie stimmte nicht. Der Sears-Tower und die Petronas-Towers zählten zu den höchsten Gebäuden mit Wohnungen und Geschäftsräumen. Das höchste Gebäude der Welt war aber nach wie vor der CN-Tower in Toronto, und der ist um mehr als hundert Meter höher als die Petronas-Towers. Der CN-Tower hat fünfhundertsechzig Meter Höhe. Alles klar?“
„Jaja, die Journalisten“, Hans seufzte, „ein weiterer oft auftretender Fehler ist die falsche Übersetzung des Zahlwortes Billion. Die englische Billion ist eine Zahl mit neun Nullen. Das entspricht im Deutschen der Milliarde. One Billion Dollar ist daher nicht eine Billion Dollar, sondern eine Milliarde Dollar. Im Deutschen hat die Billion nicht neun, sondern zwölf Nullen, und das ist immerhin das Tausendfache. Eine Milliarde Sekunden sind knapp zweiunddreißig Jahre, eine Billion Sekunden sind 31.710 Jahre. Die deutschsprachige Billion heißt im Englischen Trillion.“
Ich schnippte mit den Fingern und Monk schaltete den Verstärker ein. In der Hopfenklause gibt es keine Musikbox. Jeder kann sein Smartphone an die Anlage hängen und seine Musik den anderen aufzwingen. Ich hängte das Ding von Hans an, denn er hatte die größte Sammlung drauf.
Ich suchte nach AC/DC und drückte den Knopf. Aus den Boxen röhrte „Back in Black.“
Ich drehte die Lautstärke auf ein erträgliches Maß und erinnerte mich an eine alte Geschichte: „1994 stellte ein New Yorker Kaufmann am Times Square in Manhattan eine makabre Death-Clock auf. Es handelte sich um ein digitales Zählwerk, das die in den USA verkauften Schusswaffen und die damit getöteten Menschen zählte. Eine Nachrichtenagentur übersetzte diese Death-Clock nicht mit Todesuhr,sondern irrtümlich mit Todesglocke,was mehrere deutschsprachige Medien in Deutschland und Österreich übernahmen. Todesglocke hieße im Englischen bekanntlich Death-Bell. Zum Glück hatte der New Yorker Unternehmer seine Uhr nicht so genannt, denn möglicherweise wäre Death-Bell von einer Agentur mit Todeshund übersetzt worden.“
Brüllendes Gelächter, einige klopften sich auf die Schenkel.
Irgendwann klemmte Jane das Telefon von Hans ab und hängte ihr iPhone dran. Aus dem Lautsprecher tönte „Purple Rain“ von Prince.
Seit ein paar Jahren haben fast alle Gasthäuser und Spelunken im Dunstkreis unserer Gang auf meine Anregung hin Gäste- oder Thekenbücher eingeführt. Hans griff sich das Thekenbuch und notierte: „Der Bau von Luftschlössern kostet nichts, aber ihre Zerstörung ist sehr teuer.“
Daraufhin griff Charly, der nach dem dritten Bockbier schon leicht schwankte, nach dem Buch und schrieb hinein: „Das Elend hat viele Gesichter – wie gefällt dir meines?“
Ich hatte die arrogante Angewohnheit, hie und da lateinische Sprüche hinzuschreiben und die Übersetzung erst auf den letzten beiden Seiten des Buches zu hinterlassen: „Virtutem incolumen odimus.“ (Wir hassen vollkommene Tugend.)
Ich winkte Jane heran, machte ihr ein nichtssagendes Kompliment, was sie mit einer Handbewegung abtat, und ersuchte sie, auch etwas ins Thekenbuch zu schreiben. Sie kramte in ihrer Handtasche herum, holte ein kleines Molleskinebüchlein heraus, blätterte herum und schrieb dann: „Come to Lappland for your Honeymoon! The nights last twentyfour hours.“
Als ich sie fragte, ob das sowas wie ein Lyrikbuch von Mädchen aus ihrer Kindheit sei, lächelte sie nur, zwinkerte mir zu und verschwand wieder zu Che, um sich mit ihm zu unterhalten. Ich hasse es, wenn Frauen Signale aussenden und Männer raten lassen, was sie wohl bedeuten. Ich bin nicht geschaffen, um Frauen zu verstehen. Wahrscheinlich teile ich diese Eigenschaft mit fast allen Männern.
Monk raunte mir zu, dass der Dragoner eigentlich ganz nett sei, sogar an ihre ruppige Art könne man sich gewöhnen. An ihren Pferdearsch könne er sich aber nicht gewöhnen. Ich begann wie wild zu blättern und zeigte ihm das Vorwort aus dem Buch „Vom Pferd bis zur Raumfahrt waren es nur drei Schritte“:
Als Norio Ohga, der legendäre Chef des Elektronikkonzerns Sony, die CD entwickeln ließ, ergab sich die Frage nach der Größe. Ohga war ein Liebhaber klassischer europäischer Musik. Er verlangte, dass auf der Scheibe Beethovens 9. Sinfonie Platz haben müsse. Daraus ergab sich der Radius der CD von sechs Zentimetern. DVD und Blu-ray übernahmen später diese Größe.
Die Spurbreite der Eisenbahnen in den USA und in Kanada beträgt 4 Fuß und 8,5 Zoll. Eisenbahnen in England hatten früher diese Spurbreite, sie wurde in Amerika übernommen. Der Grund, warum die Engländer dieses Maß wählten, ist einfach. Sie kopierten die Spur der englischen Straßenbahnen. Die Spurbreite der englischen Straßenbahnen hat ihren Ursprung in den Werkbänken und Werkzeugen, mit denen auch Transportwagen, Karren, Kutschen und andere Transportmittel erzeugt wurden. Es gibt also einen direkten Zusammenhang von Kutschen- und Eisenbahnspuren.
Die Wagenspuren waren den Rillen der englischen Fernstraßen angepasst. Diese Vertiefungen stammen von den Straßen, die auf die Römer zurückgehen. Die Römer waren bekanntlich auch deshalb so erfolgreich, weil sie quer durch ihr großes Reich gut befestigte Straßen gebaut hatten. Die Räderfurchen der römischen Straßen stammten von römischen Streitwagen, deren Spur überall im römischen Reich annähernd gleich war. Die Spurbreite der römischen Wagen stammt – unbestätigten, aber glaubwürdigen Berichten zufolge – von zwei Pferdehintern, die nebeneinander die Breite der Räderspur ergaben.
Das amerikanische Space Shuttle hatte an den Seiten des Haupttanks zwei Hilfsraketen. Es handelte sich um Feststoffraketen, sogenannte „solid rocket boosters“. Diese beiden SRB produzierten den Hauptanteil des Startschubs des Space-Shuttles bis zu einer Höhe von ca. fünfundvierzigtausend Metern, wo sie abgeworfen wurden. Jeder SRB war 45,5 m lang und 3,7 m breit. Die Raketen wurden von der Firma „Thiokol Chemical Corporation“ in Utah hergestellt. Die Ingenieure mussten diese SRB so konzipieren, dass sie auf dem Bahntransport nach Florida in die Tunnels passten, deren Durchmesser natürlich mit der Schienenbreite zusammenhängt.
Die Behauptung, es führe ein gerader Weg von römischen Transportmitteln zu den Abmessungen des amerikanischen Space-Shuttles, erscheint etwas übertrieben, aber ein gewisser Zusammenhang von Raketengrößen und römischen Pferdehintern kann nicht bestritten werden. Die Welt tickt erstaunlich oft traditionell.
Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte mit den Spurbreiten, den Eisenbahnschienen und den Pferdeärschen stimmt, Monk und ich erhoben jedenfalls unser Glas auf alle Pferdeärsche der Welt.
Der Dragoner wurde im Laufe des Abends immer lustiger und blieb diesmal länger als sonst. Um 1 Uhr versuchte Monk, uns rauszuschmeißen, aber nach ein paar Fluchtbieren und hektischem Blättern in einigen Zeitschriften und Büchern wurde es am Ende 2 Uhr.
Die Erste, die mit Vollgas wegbrauste, war Jane. Sie hatte den völlig zugedröhnten Pasak auf den Beifahrersitz gepackt, um ihn zu Hause abzuliefern.
„Die wird sich mit ihrem Fahrstil eines Tages noch umbringen“, meinte Fat Lot, „und Pasak wird sich samt Diabetes noch zu Tode saufen“, ergänzte ich. Pasak arbeitete in einer Schule als Hilfsschulwart. Eine Putzfrau hatte uns schon vor einem Jahr verraten, dass er Diabetiker war. Fat Lot war übrigens auch schwerer Diabetiker, was alle anderen außer mir längst wussten.
Hans und ich bestiegen unsere motorisierten Böcke, der Rest der Gang bestieg den alten „Bulli“ von Che. Der gute Mensch fuhr einen uralten knatternden VW-Bus, aber das war uns egal, solange das Ding fuhr. Das Getriebe der Klapperkiste war zudem so abgenutzt, dass man ohne Kupplung schalten konnte. Das krachte bedenklich, aber die Kiste war nicht umzubringen.
Che hatte die Angewohnheit, alle seine Passagiere zu Hause abzuliefern, daher liebten ihn alle.
Freitag, 17. Jänner
im Roten Affen
Ich mag den Roten Affen vulgo Potex Rubens nicht, obwohl es die einzige Spelunke mit einem lateinischen Untertitel ist. Irgendwann nannte Hans dieses Loch „Syntheke“, was keiner verstand, aber letztlich ist es egal. Die Saure Wiese und die Hopfenklause sind mir jedenfalls lieber. Vor allem sind mir die Wirte Blues und Monk lieber als Götz, der Wirt im Potex, den alle nur „Pavi“ nennen. Er hat tatsächlich etwas von einem Affenarsch. Sein Gesicht ist ständig rot, er ist leicht beschränkt, ständig geil wie Pasak, und er erzählt mit Begeisterung schlechte Witze. Nichts gegen Witze, Gott bewahre, auch nichts gegen Witze aus der unteren Schublade, aber die sollten erst nach Mitternacht und nicht unter 1 Promille Ethanol im Blut erzählt werden.
Schon als wir hereinkamen, legte er los: „Der Weg von der Kabine zum Ring ist aber weit, beschwert sich der Boxer. Der Trainer tröstet ihn: Das macht nichts, zurück wirst du sowieso getragen.“
Ich klinkte mich mit einer Bauernregel ein und unterdrückte dabei meine schlechte Stimmung: „Liegt der Bauer unterm Tisch, war der Karpfen nicht mehr frisch.“ Es dauerte gezählte fünf Sekunden, bis Pavi kapiert hatte, dass das ein Witz war. Danach brüllte er vor Lachen und spendierte mir zum Einstieg ein Honigbier, seine neueste Errungenschaft auf der Bierkarte. Das Honigbier schmeckte komisch, aber immerhin war es Bier.
Auch Hans versuchte sein Glück: „Was ist Männerromantik? … Ein Fußballspiel bei Kerzenlicht.“ Mich erinnerte das nur an ein Zitat von Klaus Kinsky, der einmal meinte, wenn er Romantik wolle, dann zündet er ein Teelicht an – beim Kacken.
Pasak meinte, mein Witz sei etwas besser, aber einen Gin sei das schon wert. Ich bevorzuge Bier und Weißwein. Schnäpse weniger. Außerdem sind Pavis Schnäpse billiges Gesöff aus dem Diskonter. Gewinnspanne geschätzte 1.000 % oder mehr.
Pasak umkreiste wie immer Block Jane, was Che wie immer störte. Hans und ich packten unsere Bücher aus.
Nach einigen anzüglichen Bemerkungen von Pavi, Pasak und dem Knochenbrecher wurde Block Jane äffig. Sie kramte in ihrer Tasche und holte einen Zeitungsartikel vom letzten Wochenende heraus. Sie hielt ihn triumphierend in die Höhe und verkündete, dass jetzt alle Machos, also fast alle im Raum, zuhören sollten. Während ich darüber nachdachte, was sie mit den gedankenlos hingeworfenen Worten „fast alle“ meinte, legte sie los. Niemand wagte es, sie zu unterbrechen.
Manche Leute sind von der unstillbaren Begierde durchdrungen, ihrem Leben oder zumindest ihrer Gesundheit ein rasches und spannendes Ende zu bereiten. Die Supermänner des 20. Jahrhunderts hüpfen – natürlich mit Fallschirmen – von einer Klippe oder springen über dem Südpol aus einem Flugzeug. Andere wiederum stürmen mit Spezialgeräten einen Gebirgsbach hinunter oder springen mit Gummibändern an den Beinen von Brücken oder Staumauern. Diese Tapferkeit vor den feindlichen Naturgesetzen bedarf einer Begründung, und diese ist immer die gleiche. Man müsse eben diesen Kick, diesen unvergleichlichen Adrenalinschub haben. Andere philosophieren von Grenzerfahrungen und Ähnlichem, aber das Destillat der Supermanngesellschaft ist und bleibt das Hormon Adrenalin.
Das Adrenalin wird in den Nebennieren produziert. Diese sind kleine Drüsen, die auf der Niere aufsitzen. 1855 hatte man erstmals von diesen Drüsen gehört, als der britische Arzt Thomas Addison zeigte, dass eine Erkrankung der Nebennierenrinde zu schrecklichen Symptomen führt. Bis heute spricht man von der „Addison-Krankheit“. Zu den Kennzeichen zählen eine Störung des Mineral-, Wasser- und Säurehaushaltes, Kohlenhydrat-Störungen, niedriger Blutzucker und vieles mehr. Die Patienten fühlen sich müde und schwach, es treten Hautverfärbungen, Herzrhythmusstörungen und Muskelkrämpfe auf.
Der britische Physiologe Edward Albert Sharpey-Schafer entdeckte, dass eine in den Nebennieren gebildete Substanz den Blutdruck eines Versuchstieres erhöht, wenn man dieses Sekret injiziert. Diese Eigenschaft erschien so bemerkenswert, dass der amerikanische Pharmakologe John Jacob Abel die von Schafer untersuchte Substanz isolierte und wissenschaftlich genauer überprüfte. 1898 nannte Abel den von Sharpey-Schafer untersuchten Stoff „Epinephrin“. Erst einige Jahre später erhielt das Epinephrin die weitere Bezeichnung Adrenalin. Beide Namen bezeichnen im Wesentlichen das Gleiche und sind heute noch gebräuchlich.
Adrenalin wird durch einen stressbedingten Nervenimpuls ausgeschüttet. Es wirkt sofort auf den sogenannten Sympathicus, einem Teil des autonomen Nervensystems. Die Pulsfrequenz steigt, der Blutdruck steigt und damit auch das Herzminutenvolumen. Die Pupillen erweitern sich, die Bronchien dehnen sich aus, und der Energieumsatz steigt durch höheren Sauerstoffverbrauch. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts isolierte Adrenalin war das erste entdeckte Hormon. Heute ist es unentbehrlich für die modernen Supermänner.
Block Jane lächelte uns triumphierend an.
Pasak grinste schief: „Was ist schon das öde Adrenalin gegen mein Testosteron.“
Jetzt meldete sich Pumpe zu Wort. Für ihn war Testosteron eine Art Religion: „Wenn du, geliebte Jane, jetzt noch einen Artikel über Testosteron bei dir hast, spendiere ich dir ein Glas Rheinriesling und zwanzig Liter Benzin für deinen Boliden.“





























