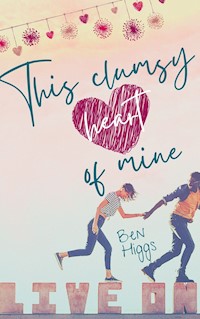
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Nicht alle Ritter erscheinen in strahlender Rüstung auf einem weißen Pferd und retten Jungfrauen in Nöten aus Türmen, vor feuerspeienden Drachen oder mörderischen Stiefmüttern und Hexen. Manche tragen einen Schlafanzug. Mit Dinos drauf. Oder auch gar nichts. Von drei dieser besonderen Ritter erzählen die Kurzgeschichten in "This clumsy heart of mine" - und von ihrer abenteuerlichen Reise zu Glück und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
This clumsy heart of mine
This clumsy heart of mineDer edle JackenspenderBelassen wir es dabeiCinderella und die DinosaurierBildquellenImpressumThis clumsy heart of mine
Hurt and Comfort Stories
von Ben Higgs
Der edle Jackenspender
Zwei Wochen mit dem Rucksack durch Schottland wandern und so viele Fotos schießen, dass die Speicherkarten heißlaufen, das war der Plan gewesen. Dann hatte Mitch einen Wettbewerb gewonnen und durfte für eine renommierte Reisezeitschrift nach Spanien fliegen, um dort Fotos für eine Sonderausgabe zu knipsen. Er fragte weder, ob ich auf eigene Kosten mitkommen wollte, noch entschuldigte Mitch sich dafür, dass unsere gemeinsame Reise ins Wasser fiel. Ich erfuhr nur durch einen Freund, dass Mitch bereits das Land verlassen hatte. Mir ist schon klar, dass wir nur Freunde sind und er mich weder um Erlaubnis bitten, noch darüber in Kenntnis setzen muss ... aber immerhin wohnen wir seit Studienbeginn zusammen in unserer Männer-wir-räumen-nur-auf-wenn-Frauenbesuch-angekündigt-ist-WG und sind, dachte ich zumindest, gute Freunde. Die Erkenntnis, dass es sich wohl doch mehr um eine Zweckgemeinschaft gehandelt hatte, zumindest für Mitch, traf mich hart. Zuerst wollte ich die Reise nach Schottland absagen. Ich war wütend auf Mitch, enttäuscht, weil ich auch ein Foto beim Wettbewerb eingereicht hatte, aber offensichtlich nicht einmal in die engere Auswahl gekommen war, und verspürte plötzlich eine tiefe Abneigung gegen die Schotten, obwohl die mir gar nichts getan hatten. Und doch saß ich fünf Tage später im Zug auf dem Weg nach Edinburgh. Schließlich hatte ich wochenlang Reiseführer gewälzt, mich durch Internetseiten geklickt und mit Dutzenden Pensionen und Hotels telefoniert, um eine Traumreise für jeden Fotografiebegeisterten zusammenzustellen. Wäre ich zu Hause geblieben, wäre die ganze Zeit und Arbeit für die Tonne gewesen, und das hätte mich noch viel mehr geärgert. Also fuhr ich wie geplant nach Schottland, mit nur zwei kleinen Änderungen: Erstens war Mitch nicht mit dabei und zweitens wollte ich nicht gleich von Edinburgh weiterfahren, sondern zwei Tage in der Stadt bleiben. Ich war fest entschlossen, jede Sehenswürdigkeit der Stadt mitzunehmen, die Royal Mile hinabzulaufen, mir das Edinburgh Castle anzusehen, dabei zu sein, wenn die «One o’clock gun» abgefeuert wurde, die Camera Obscura besuchen, mir das John Knox House ansehen, die Uhr am «The People’s Story Museum» bestaunen und gleich noch das Museum besuchen und durch die Princes Street Gardens flanieren. Außerdem hatte ich vor, abends so viele Kneipen wie nur möglich zu besuchen – und damit sofort nach meiner abendlichen Ankunft in Edinburgh zu beginnen. Nachdem mich ein Taxi vom Bahnhof zum Hotel gebracht hatte, lief ich los, um die Stadt zu erkunden. Etwa eine halbe Stunde später wurde mir bewusst, weshalb ich sonst immer mit Mitch reiste, auch wenn dieser oft andere Reisevorstellungen hatte als ich: Ich besitze keinerlei Orientierungssinn. Nicht den allerkleinsten Funken. Irgendwann entschied ich mich dafür, einer Gruppe Touristen zu folgen, in der Hoffnung, dass sie auf dem Weg in eine Kneipe waren. Ich hatte Glück und Pech zugleich: Sie schlenderten direkt zur Oxford Bar, genau der Bar, in der Ian Rankin als Student ein- und ausging und später zum zentralen Ort seiner Inspektor Rebus Romane machte. Früher war das kleine Pub kaum bekannt, doch heute ist es ein Publikumsmagnet. Da ich keine Lust hatte, weiter durch Edinburgh zu irren, quetschte ich mich an einen Tisch, bestellte das «Craft Beer des Tages» und trank einen kräftigen Schluck. Die Musik, die ausgelassene Stimmung und die Gemütlichkeit des Pubs - trotz der vielen Besucher - führten dazu, dass ich mich ein wenig entspannte. Ich blieb bis zum Schluss sitzen, mit nur zwei, drei anderen Besuchern. Um Mitternacht hatte der Wirt darauf hingewiesen, wir könnten nun die letzte Runde bestellen, um halb eins schließe er das Pub. Und um kurz nach halb eins standen wir dann tatsächlich auf der Straße, lachend, wankend und zitternd, weil uns die windige, kalte Nachtluft vollkommen unvorbereitet traf. Ich brauchte eine ganze Weile, um meinen Rucksack zu öffnen und meine Sweatshirtjacke herauszuholen, und doppelt so lange, die Jacke anzuziehen. Doch das störte mich nicht. Der Wirt hatte mir gesagt, gleich die Straße hinunter stünden Taxen, und mein alkoholisiertes Gehirn war fest davon überzeugt, besser mit Richtungen und Wegbeschreibungen zurechtkommen, als mein Gehirn es im nüchternen Zustand schaffte. In einiger Entfernung hörte ich die drei Männer kichern und lachen, mit denen ich das Pub verlassen hatte. Sie kamen wohl auch nicht allzu schnell vorwärts. «Brat mir einer ein Ei! Ricky, siehst du das? Ricky? Ricky!», hörte ich einen der Männer rufen. Seine Stimme klang ungläubig, aber amüsiert. Er lachte laut. «Haben wir nur getrunken oder auch was geraucht? Siehst du das aus? Bitte sag mir, dass du das auch siehst!» Noch mehr Gelächter. «Keine Ahnung, was du siehst, aber ich seh da ein Einhorn. Und eine Frau drauf. Eine Nackte auf einem Einhorn!»Na klar, dachte ich, eine nackte Frau reitet auf einem Einhorn durch Edinburgh. Ich kicherte – und verschluckte mich an meinem Kichern, als die nackte Frau auf dem Einhorn auf mich zugeritten kam. Direkt vor mir hielt sie an, glitt vom Einhorn und lächelte. «Sie haben nicht zufällig ein paar Anziehsachen, die Sie mir leihen können?» «Ich ... also ... äh ... ja.» Ich blinzelte irritiert, schlüpfte dann aber aus meiner Jacke und reichte sie ihr. Dann kramte ich in meinem Rucksack und zog meine dunkelgraue Leinenhose heraus, die ich stets für Notfälle einpackte - wenn ich mich beim Fotografieren in einen matschigen Untergrund kniete, mir beim Trinken ein Glas Saftschorle über die Jeans kippte oder die Nudeln mit Tomatensoße auf der Hose landeten. Für nackte Frauen auf Einhörner hatte ich meine Ersatzhose bis dahin noch nie gebraucht. «Vielen Dank», sagte sie, schenkte mir ein Lächeln und zog sich hastig die Kleidungsstücke über. Schnelle, harte Schritte knallten über das Kopfsteinpflaster. Ich warf einen kurzen Blick auf die Frau, die nun relativ unauffällig aussah, abgesehen davon, dass sie keine Schuhe trug, sah dann zu dem Pferd mit dem gigantischen Horn auf der Stirn, und fragte mich, was sie wohl mit dem Einhorn anstellen wollte. Sonnenbrille, Hut und falscher Bart? Die junge Frau stellte sich auf die Zehenspitzen, beugte sich vor und küsste mich auf die Wange. «Danke. Das war sehr ritterlich», sagte sie, nahm die Zügel wieder in die Hand und verschwand mit dem Einhorn zwischen zwei Häusern in einer schmalen Gasse – genau in dem Augenblick, in dem zwei Polizisten angerannt kamen. «Haben Sie sie gesehen? Die nackte Frau auf dem Einhorn?» Ich kicherte unwillkürlich. «Eine nackte Frau. Auf einem Einhorn», sagte ich, und musste noch mehr kichern. Die Polizisten seufzten, sahen sich um und teilten sich dann auf. Sie liefen in zwei verschiedene Gassen. In keiner davon war die Frau verschwunden, die nun in meinen Klamotten steckte. Ich wusste nicht genau warum, aber das freute mich. Noch immer kichernd, die Hände in den Hosentaschen, schlenderte ich die Straße entlang. Über die wartenden Taxen stolperte ich rein zufällig, aber das spielte keine Rolle. Keine zehn Minuten später war ich im Hotel, stieg die Stufen zu meinem Zimmer hinauf und presste die Lippen fest aufeinander, um nicht laut loszulachen. Eine nackte Frau. Auf einem Einhorn. Ja, doch. Nach Edinburgh zu kommen war eine gute Idee gewesen.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit Kopfschmerzen, schweren Augen und Schlagseite. Als ich versuchte, aus dem Bett zu steigen, gab mein linkes Knie spontan nach und ich legte mich kurzerhand der Länge nach auf den Teppichboden des Hotels. Zum Glück war ich nicht weiter gekommen, denn hätte mein Knie erst beim zweiten Schritt nachgegeben, wäre ich entweder gegen den schmalen Schreibtisch oder die altmodische Kleidertruhe geknallt. Doch so rappelte ich mich schwerfällig, aber unverletzt wieder auf, und schlurfte mit halb geschlossenen Augen in das kleine Badezimmer. Um vollends wach zu werden, hätte ich definitiv viel kälter duschen müssen, aber dazu konnte ich mich schlichtweg nicht überwinden. Aber es genügte, um in den Speisesaal hinunterzuschlurfen, festzustellen, dass ich fürs Frühstück zu spät und fürs Mittagessen zu früh dran war, und mich wieder hinauf auf mein Zimmer zu kämpfen. Ich stellte den Wecker so ein, dass ich noch einmal eineinhalb Stunden Schlaf bekam und das Mittagessen nicht verpasste, und legte mich dann wieder ins Bett, um meinem Kopf noch eine kurze Pause zu gönnen. Nach dem Mittagessen bewaffnete ich mich mit drei verschiedenen Stadtkarten, die ich an der Rezeption erhalten hatte, und stapfte hinaus in den Sonnenschein. Meinen ehrgeizigen Plan, jede nur erdenkliche Sehenswürdigkeit zu sehen, die Edinburgh zu bieten hatte, hatte ich bereits während des Mittagessens aufgegeben. Nun ja, nicht direkt aufgegeben, das klingt so negativ. Sagen wir: Ich habe dem Plan eine etwas realistischere Perspektive angedeihen lassen. In Ermangelung eines funktionierenden Orientierungssinns wollte ich schlicht aus dem Hotel marschieren, immer der Nase nach, und durch die Straßen und Gassen schlendern, bis es Abend wurde. Dann konnte ich einen letzten Abend in einem Pub verbringen, mich von einem Taxi zurück zum Hotel fahren lassen und am nächsten Tag in den Zug Richtung Highlands steigen. Ich fand, das klang recht vernünftig, und war guter Dinge. Wie sich herausstellte, brauchte ich die Karten überhaupt nicht. Alles, was ich benötigte, waren Touristengruppen, denen ich unauffällig folgen konnte. Und davon gab es nun wirklich genug. Ich wechselte immer wieder die Gruppe, der ich folgte, damit mich niemand verdächtigte. Mit meiner dunkelbraunen Haut und dem schwarzen Haar stach ich doch recht deutlich aus der der Menge anwesender Touristen und Einheimischer heraus und ich hatte keine Lust, einem schottischen Polizisten zu erklären, weshalb ich heimlich einer Gruppe Touristen hinterherlief. Deshalb achtete ich darauf, regelmäßig zu wechseln. Manchmal verlor ich meine Gruppe aber auch, weil ich wieder einmal zu lange zu viele Fotos schoss und niemand auf mich wartete. Als es zum erste Mal passierte, ärgerte ich mich einen Moment lang darüber, dass niemand auf mich Rücksicht nahm – bis mir bewusst wurde, dass ich ja gar nicht wirklich zu dieser Gruppe gehörte. In einem verwinkelten, kleinen Laden, in dem ich die ganze Zeit über damit rechnete, gleich auf ein Regal mit Zauberstäben zu stoßen, kaufte ich mir eine neue Sweatshirtjacke und eine Sommerhose. Die Hose sollte als Ersatzteil in meinen Rucksack wandern, daher waren mir Details daran egal. Die Jacke hingegen brauchte ich jeden Tag, daher suchte ich eine ganze Weile, bis ich eine fand, auf der sich keine Herzchen, Totenköpfe oder lustige Sprüche befanden. Ganz spruchfrei war sie leider nicht. Vorne stand in kleiner, geschwungener Schrift «Failte gu Alba» geschrieben, was so viel wie «Willkommen in Schottland» heißt. Ohne Text wäre sie mir lieber gewesen, aber es war okay. Zwischendurch knipste ich ein Selfie vor einer Touristenattraktion im strahlenden Sonnenschein, obwohl ich Selfies nicht ausstehen kann, und schickte das Bild als Lebenszeichen an meine Mom. Keine zehn Sekunden später bekam ich ihre Antwort: «Danke für deine Nachricht, Schatz. Pass gut auf dich auf. Geh abends nicht mehr alleine raus und halte dich von wilden Tieren fern! Mom.» Ich lächelte. Meine Mom hatte nach eigener Aussage zwei Jahrzehnte darum gekämpft, möglichst viel Distanz zwischen sich und die Natur zu bringen. Wann immer sie darüber berichtete, konnte man glauben, sie sei im tiefsten Dschungel zur Welt gekommen, von Wölfen großgezogen und von Forschern entdeckt und nach England mitgenommen worden. Tatsächlich stammt meine Mutter aus einem kleinen südenglischen Dorf, ist gut behütet auf einem Bauernhof aufgewachsen und musste sich nie mit Tieren herumschlagen, die gefährlicher gewesen wären als streunende Katzen, Mücken und dem heimtückischen Hahn der Nachbarn, der es auf lose Schuhbänder abgesehen hatte. Während der Bauernhof meiner Großeltern für mich als Kind stets Sehnsuchtsort war, konnte meine Mutter nicht nachvollziehen, weshalb jemand auch nur mit einem Fuß aus London hinaustreten wollte. Vor meinem ersten Ausflug in ein anderes Land – Mitch und ich wollten durch deutsche Nationalparks wandern und fotografieren - besorgte meine Mutter für mich einen Deutsch-Schnellkurs auf CD und schrieb eine Liste mit Notfallnummern, die ich in Deutschland brauchte, um einen Krankenwagen zu rufen, die Polizei zu kontaktieren oder die Bergwacht. In die Toskana durfte ich nur reisen, nachdem ich sämtliche Versicherungen abgeschlossen hatte, die zur Verfügung standen, damit ich im schlimmsten Fall aus der Wildnis errettet und nach Hause gebracht werden würde. Als ich mit Mitch nach Rumänien aufbrach, um mit dem Rucksack durch die Wälder zu wandern, sparte sich meine Mutter all diese Mühen und begann stattdessen damit, meine Beerdigung zu planen. Schottland war für sie weit weniger beängstigend als Rumänien, rangierte aber auf einer Stufe mit Deutschland: In beiden Ländern wollte ich in der Natur unterwegs sein und konnte mich nicht mit den Einheimischen verständigen. Meiner Mutter zufolge war es wahrscheinlicher, dass ich einen Deutschen traf, der verständliches Englisch sprach, als einen Schotten, der dazu in der Lage war. Wenn mein Stiefvater, gebürtiger Schotte, dann sanft, aber entschieden Einspruch erhob, winkte meine Mutter stets ab, er sei die allseits bekannte Ausnahme der Regel. Ob das tatsächlich der Wahrheit entsprach, konnte ich nicht beurteilen. In Edinburgh hatte ich weder im Hotel, noch in den Pubs oder im Taxi Verständigungsprobleme bewältigen müssen. Aber eine große Stadt wie diese war vermutlich nicht repräsentativ für den ganzen Rest des Landes. Um meine Mutter zu beruhigen, fotografierte ich für sie mit dem Handy noch ein paar gut mit Menschen gefüllte Straßen, Geschäfte und Hinweistafeln auf öffentliche Toiletten und schickte sie ihr zusammen mit dem Versprechen, gut auf mich aufzupassen. Dann suchte ich mir eine neue Touristengruppe und folgte ihr zu zwei Sehenswürdigkeiten, bevor ich mich abseilte und in einem netten Pub zu Abend aß. Ich trank weniger, aß mehr, lauschte den Leuten um mich herum und wurde zu einer Runde Dart eingeladen. Gegen halb zwei teilte uns der Wirt mit, dass es an der Zeit war, die Pfeile auf dem Tresen abzulegen und die Tür hinter uns zu schließen. Ich ließ mir die grobe Richtung geben, in der sich die nächsten Taxen befanden und stapfte in die kühle Sommernacht hinaus. Während ich, die Hände in den Hosentaschen, höchst zufrieden die Straße überquerte, drang ein bekanntes Geräusch an meine Ohren: Hufgetrappel. Ich zog die Augenbrauen hoch und sah mich um. Für einen kurzen Moment glaubte ich, es sei nur ein Hirngespinst und das letzte Bier doch eines zu viel gewesen, da ritt sie um die Ecke und wie selbstverständlich direkt auf mich zu. Die nackte Reiterin hielt neben mir, glitt elegant von ihrem Pferd und schenkte mir ein bezauberndes Lächeln. «Guten Abend der Herr. Ihr habt nicht zufällig erneut einige Kleidungsstücke, die Ihr zu entbehren vermögt, um einer Maid in Not zu helfen?», fragte sie, gut gelaunt und mit strahlenden, dunkelblauen Augen. Ich seufzte leise, schlüpfte aus meiner nagelneuen Sweatjacke, reichte sie ihr und kramte dann im Rucksack nach der neuen Hose. «Morgen früh reise ich ab – vielleicht sollte sich die Maid dann besser nicht mehr in eine solch missliche Lage manövrieren», sagte ich und hielt ihr die Hose entgegen, ohne zu genau hinzusehen. Ich bemühte mich sehr, meine Augen auf Kopfhöhe zu halten, auch wenn die Versuchung groß war, dem langen Haar die Schultern hinab bis über ihre Brüste zu folgen. Ich räusperte mich und sah stattdessen zu ihrem Pferd hinüber. «Heute gar nicht auf einem Einhorn unterwegs, Mylady?» Aus den Augenwinkeln erkannte ich, dass aus ihrem Lächeln ein Grinsen wurde. In ihren blauen Augen blitzte es frech. «Wie trefflich, dass ich morgen ebenfalls abreise. Und nein: leider nicht. Einhörner werden nur jeden zweiten Dienstag im Monat verliehen.» Sie schlüpfte ohne Hast, jedoch in schnellen, fließenden Bewegungen in die geliehene Kleidung. Dann deutete sie eine Verbeugung an und sagte: «Habt Dank, mein edler Retter.» Und bevor ich sie noch nach ihrem Namen fragen konnte, lief sie mit ihrem Pferd an den Zügeln davon. Ich seufzte erneut, drehte mich um und stapfte Richtung Taxi, während hinter mir die schnellen, schweren Schritte zweier Polizisten durch die Gassen hallten. Da ich keine Lust auf ein weiteres Gespräch mit schottischen Polizisten hatte, sah ich zu, dass ich mich vom Acker machte und stieg keine Minute später in ein Taxi ein. Zurück im Hotel lag ich nach einer raschen Dusche im Bett und starrte an die Decke. Jetzt war mir diese verrückte, faszinierende Frau zwei Mal begegnet und ich kannte nicht einmal ihren Namen ... und sie reiste aber, weiß Gott wohin, um dort nachts nackt durch die Gassen zu reiten, um ... ja, warum überhaupt? Reiner Nervenkitzel? Langeweile? Protest oder Rebellion? Ein überaus seltener und bisher vollkommen unerforschter Fall von spontan sich auflösender Bekleidung? Aller Grübelei zum Trotz schlief ich irgendwann ein und wurde wenige Stunden später von meinem Wecker aus dem Schlaf gerissen ...
Ein Taxi brachte mich zielsicher zum Bahnhof, das richtige Gleis befand sich erfreulicherweise in Sichtweite und die Waggonnummer, die ich auf meinem Ticket nachgelesen hatte, stand in großen Zahlen auf einem der ersten Waggons, weshalb ich ohne peinliche Zwischenfälle meinen Platz einnehmen und auf das Anfahren des Zuges warten konnte. Ich holte die Karte aus dem Rucksack, auf der ich die Strecke von Edinburgh nach Aviemore markiert hatte. Eine gemütliche Zugfahrt mit ScotRail quer durch die wunderschöne Landschaft. Mit aufgeregt klopfendem Herzen packte ich die Karte wieder ein und sah aus dem Fenster. Der Zug fuhr mit einem Ruck los und der Bahnhof zuckelte an mir vorbei. Wir tuckerten gemächlich durch Edinburgh und schon nach kurzer Zeit überquerten wir die Forth Bridge, und obwohl ich kein allzu großer Fan stählerner Architektur bin – diese Brücke war beeindruckend. Wir fuhren an der Küste entlang, durchquerten einige kleinere Küstenstädte wie Burntisland und Kinghorn und erreichten schnell Kirkcaldy. Hier machte der Zug einen Schlenker Richtung Landesmitte und steuerte in einem weiten Bogen auf Perth zu. Ich sah aus dem Fenster, die Augen groß vor Staunen und Faszination. Warum mich das Betrachten der langsam an mir vorbeiziehenden Landschaft derart mit Ruhe, Zufriedenheit und ein klein wenig aufgeregter Geborgenheit erfüllte, als wäre ich nach langer Reise auf dem Heimweg, nur noch wenige Stunden von meinem Zuhause getrennt, vermochte ich mir nicht zu erklären. Vielleicht hatte ich mich ja in die schottische Landschaft verliebt. Vielleicht schlummerte in mir das Herz eines Highlanders. Vielleicht war es aber auch nur eine verrückte Hormonausschüttung aufgrund eines eklatanten Schlafmangels. Mir war der Grund vollkommen gleich. Ich wollte schlicht jede einzelne Sekunde, jeden noch so kleinen Moment dieser Reise genießen und in mich aufnehmen. Also staunte ich weiter zum Fenster hinaus wie ein kleines Kind, das in der Adventszeit vor einem glitzernden, funkelnden Schaufenster voller Weihnachtsdekoration und Spielzeug steht.
Irgendwann musste ich eingeschlafen sein, denn als sich jemand laut neben mir räusperte und «Die Fahrkarte, bitte!», donnerte, riss er mich damit aus dem Schlaf. Ich blinzelte verwirrt, rieb mir die Augen und nickte dann. Noch etwas neben der Spur kramte ich in meinem Rucksack nach meinem Geldbeutel und holte das Ticket heraus. «Entschuldigen Sie bitte, ich bin eingeschlafen. Wann kommt denn der nächste Bahnhof?» Der Schaffner scannte mein Ticket ein und gab mir eine Antwort. Glaubte ich wenigstens. Sicher war ich nicht. Ich verstand kein Wort. Da er mich aber sehr freundlich anlächelte, lächelte ich schlicht zurück, nahm mein Ticket wieder entgegen und bedankte mich. Keine zwei Minuten später fuhren wir an einem kleinen Bahnhof ein und ich entschied, auszusteigen. Auf dieser Strecke fuhr tagsüber stündlich ein Zug in die Richtung Aviemore, ich konnte also getrost die Gegend erkunden und mich einfach anschließend in den nächsten Zug setzen. Oder den Übernächsten, falls es mir hier besonders gut gefiel. Ich stieg alleine auf den Bahnsteig, schulterte den Rucksack und wartete, bis der Zug weiterfuhr. Dann sah ich mich um. Vor mir stand eine kleine Bahnhofshalle mit Parkplatz. Beides wirkte verlassen. Auf dem Schild stand «Oldair». Ich kramte in meinem Gedächtnis und glaubte mich zu erinnern, dass das ein winziger Bahnhof nach Blair Atholl war. War da nicht dieser Wasserfall in der Nähe? Falls of ... hm. Irgendwas mit R. Oder U? Ich seufzte und drehte mich einmal um die eigene Achse. Das Ergebnis? Nichts. In alle anderen Richtungen erstreckte sich hügelige, grüne Landschaft. Hier und da waren vereinzelt Straßen oder Wege zu erahnen und manchmal ragte ein Baum in die Höhe. Das wars. Nicht gerade die Art hübscher Umgebung, mit der man Wettbewerbe gewann. Da hatte ich während der Fahrt definitiv beeindruckendere Umgebungen gesehen. Aber da der nächste Zug erst in etwa 55 Minuten eintreffen würde und ich nun schon einmal hier war, schlenderte ich los. Vielleicht stolperte ich ja zufällig über diese Wasserfälle, die wären ein paar Fotoaufnahmen wert. Die Sonne schien mir warm auf den Rücken, eine leichte, kühle Brise sorgte dafür, dass ich nicht ins Schwitzen kam, und der blaue Himmel mit den weichen, weißen Wattewolken sorgte dafür, dass meine Stimmung schnell wieder ins Lot kam. Orientierungs- und ziellos marschierte ich einen erdigen Pfad entlang, die Hände in den Hosentaschen und ein zufriedenes Grinsen auf dem Gesicht. Je weiter ich ging, desto waldiger wurde es: Bäume mehrten sich, standen dichter beieinander, rauschten leise im Wind. Neben dem Weg wuchs hellgrünes Moos, Findlinge lagen mal hier, mal da, und eine kleine, steinerne Brücke führte über einen gluckernden Bach. Die Luft roch schwer nach erdigem, feuchtem Boden, und meine Beine bewegten sich in lockerem Schritt fort, während ich die schlichte Schönheit um mich herum genoss. Und dann war ich da: nicht am Wasserfall, sondern an einer traumhaften Lichtung. Sie lag einfach so vor mir, kreisrund, mit hellgrünem Gras bewachsen, aus dem kleine, lilafarbene und blaue Blumen sprießten, Licht, das sanft durch Baumkronen fiel und Schatten auf den Boden zauberte und in der Mitte einige hellgraue, von Wind und Wetter rund geschliffene Steine, die kleine Türmchen und Mauern bildeten. Wie im Märchen, schoss es mir durch den Kopf. Ich holte meine Kamera heraus, stellte den Rucksack ins Gras und machte probeweise ein paar Bilder, beugte mich hierhin, streckte mich dorthin, legte mich ins Gras und umrundete auf diese Weise langsam, Stück für Stück, die Steinhaufen – bis ich die ideale Perspektive und den idealen Bildausschnitt fand. Mein Herz machte einen Hüpfer und schlug schneller vor lauter Freude und Aufregung, während ich mich in der Hocke näher und näher an den Steinhaufen heranpirschte, um das perfekte Bild zu knipsen. Meine Position war etwas schief und ich musste sämtliche Muskeln anspannend, um sowohl mich als auch die Kamera absolut gerade zu halten und das Bild nicht zu verwackeln. Ja. Ja, genau, das war perfekt. Und jetzt ganz stillhalten. Nicht mehr atmen. Das wird das beste Foto, das ich jemals ... «He! Weg da!» Erschrocken zuckte ich zusammen, verlor das fragile Gleichgewicht, fiel und drehte mich dabei, um die Kamera zu schützen, auf den Rücken, und riss die Arme hoch. Ich schlug der Länge nach im Gras auf und bekam für eine Sekunde keine Luft. Dann ein Biss. In einen linken Arm. Ich wollte schreien, bekam aber keinen Ton heraus, rollte mich panisch herum, atmete schnappend ein und wieder aus, hustete und stolperte von den Steinen weg. «Idiot!», schimpfte eine vertraute Frauenstimme direkt neben mir, zog mich energisch noch ein, zwei Meter weiter und drückte mich dann ins Gras. «Halt still.» Ich klammerte mich mit der rechten Hand an meine Kamera und hielt still, schon alleine, weil ich vor Schreck wie gelähmt war. «So blöd muss man erst einmal sein, dermaßen nah an den Kreuzotterhort heranzugehen.» Kreuzotterhort? Mir wurde schlecht. Dann war das also gerade tatsächlich eine Schlange gewesen. Ich war gebissen worden. Von einer giftigen Schlange. In Schottland. Klasse Aufschrift für meinen Grabstein. Meine Retterin ignorierte mich, öffnete ihren Rucksack, holte einen schwarzen Erste-Hilfe-Beutel heraus und besprühte meinen Arm nur wenige Sekunden später mit einer kühlen Flüssigkeit, die nach Krankenhaus roch. «Bist du gegen Tetanus geimpft?» Wie oft musste man Tetanus gleich wieder auffrischen? Zuletzt war ich vor drei Jahren geimpft worden, vor der Reise nach Rumänien. Ob das noch ausreichte? «Ich ... ich glaube schon», murmelte ich, war mir aber absolut nicht sicher. Verdammt. Mich hatte eine Schlange gebissen. Eine echte, richtige, giftige Schlange. Ich schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Wie giftig war so eine Kreuzotter? Würde mir der Arm anschwellen, zuerst blau und dann schwarz werden und musste dann amputiert werden? Mein Herz raste, mein Magen rumorte und mir war vor Angst speiübel. Oder war das eine Nebenwirkung des Gifts? «Grandpa? Ja, ich – nein, mir gehts gut. Ich hab hier einen Touristen am Kreuzotterhort. Ist gebissen worden. Kannst du uns abholen? Nein, im Arm. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Danke. Bis gleich.» Ich öffnete die Augen und sah, wie sie das Handy wieder in ihren Rucksack packte, zusammen mit dem Erste-Hilfe-Beutel. «Mein Grandpa kommt und holt uns ab. Bleib einfach liegen und halt still. Wir rufen Doc Willice an, der kann dann entscheiden, ob du ins Krankenhaus musst.» Sie schüttelte den Kopf mit den halblangen, strubbeligen, roten Haaren und seufzte. «Warum bist du so nah rangegangen?» Der Gedanke, abgeholt und zu einem Arzt gebracht zu werden, beruhigte mich ein wenig. Sie kannte sich anscheinend mit diesen Biestern aus, kannte auch die Gegend und den nächstgelegenen Arzt. Ich musste mich um nichts kümmern, konnte einfach nur im Gras liegen und auf Hilfe warten. Das konnte ich schaffen. Vermutlich. Also atmete ich tief durch und sagte: «Ich wusste nichts von den Schlangen. Ich wollte nur fotografieren.» Sie hob beide Augenbrauen an. «Für ein Selfie steckst du deinen Kopf fast in einen Steinhaufen voller Schlangennester?» «Schlangennester?» In meinem Hals bildete sich spontan ein Kloß enormen Ausmaßes und mir wurde schlagartig noch übler. Für einen Augenblick befürchtete ich, dass ich mich gleich übergeben musste. Wieder seufzte sie. «Wenn man gar keine Ahnung hat, sollte man nicht in der freien Natur herumlaufen», sagte sie tadelnd. «Zumindest nicht ohne Begleitung. Ich hatte dich für einen Städtetouristen gehalten, nicht für einen, der mit dem Rucksack durchs Grüne wandert.» «Das ist nicht mein erster Ausflug in die Wildnis. Ich war schon viel unterwegs», erwiderte ich energisch. Ich hatte das Gefühl, mich verteidigen zu müssen. Was sollte das denn? Ich war schließlich kein Amateur, der versuchte, den Mount Everest zu besteigen, nur um sagen zu können, dass ich da ganz oben war. Ich war verdammt nochmal nur in Schottland durch einen Wald spaziert. Dafür brauchte man nun wirklich keine spezielle Ausbildung oder Vorkenntnis. «Wildnis?» Sie lachte laut auf, prustete und schüttelte sich vor Lachen. Ihre roten Locken hüpften im Rhythmus ihres Gelächters. Das kränkte mich noch mehr. Ich presste die Lippen fest aufeinander, damit mir keine unüberlegte Erwiderung entwischte, und schloss wieder die Augen. «Ich bin jedenfalls kein Stubenhocker. Und hättest du nicht so gebrüllt, wäre ich auch gar nicht umgefallen und hätte die Schlange nicht erschreckt. Ich hatte alles im Griff, bis du gekommen bist.» «Ach so?» Sie verschränkte die Arme vor der Brust und wandte sich trotzig ab. «Na dann kann ich ja gehen. Mein Grandpa ist in ein paar Minuten hier, wenn du eh alles so wunderbar im Griff hast, kommst du bis dahin sicher gut alleine zurecht, und ich kann das machen, weshalb ich eigentlich hierhergekommen bin, nicht wahr?»





























