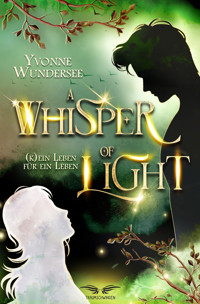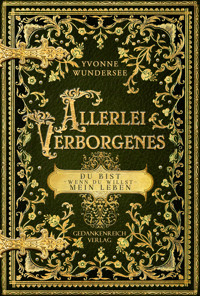Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Traumschwingen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Könntest du der Liebe eine Chance geben, wenn dein Tod unausweichlich wäre? Jeder kennt die Märchen über die bösen Dschinns, die Menschen dazu verführen drei Wünsche auszusprechen, denn dann sind sie frei und können Angst und Schrecken in der Welt verbreiten. Geschichten wie diese sind Schuld daran, dass Menschen das Dorf von Samira zerstören. Mit elf Jahren muss sie mitansehen, wie ihre Eltern brutal ermordet werden. Nur sie und ihre kleine Schwester überleben. Neun Jahre später will Samira das Versprechen, das sie ihrer sterbenden Mutter gab, einlösen. Ihr Plan: In der Duat, der Unterwelt, die Götter anflehen, ihr Volk vor den Menschen zu retten. Doch das schafft sie nicht allein. Und schon sehr bald muss sie sich die Frage stellen: ist sie wirklich bereit, einen so hohen Preis zu zahlen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Table of Contents
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Nachwort
Werbung
Impressum
Prolog
Samira
Ein lauter Schrei ließ mich im Bett hochfahren. Erschrocken starrte ich in die Dunkelheit. Schon zerriss ein weiteres Kreischen die Stille. »Sie kommen! Bringt euch in Sicherheit. Sie kommen!« Meine kleine Schwester fing an zu weinen. Meine Augen hatten sich an die spärlichen Lichtverhältnisse gewöhnt, also stand ich auf und hob ihren pummeligen Körper aus dem Bettchen. Sie steckte sich den Daumen in den Mund. Ihr Wimmern versiegte augenblicklich. Kija liebte es, wenn ich sie im Arm hielt.
Mein Vater stürzte in unser Schlafzimmer. »Wir müssen weg. Lasst alles hier!
Los!«
Ich stand einfach nur da und bewegte mich keinen Millimeter. Wo wollte er denn hin? Es war mitten in der Nacht. Mutter stürmte an uns vorbei und riss die Hintertür auf. Sie schob uns eilig hinaus.
Der Anblick, der sich mir bot, brannte sich in mein Gehirn, überlagerte alles und ließ mich leer und trotzdem überfüllt zurück.
Soldaten mit Speeren und Fackeln drangen von allen Seiten in unsere Siedlung ein. »Tod den Dschinns! Tod den Unheilsbringern!«, skandierten sie laut und warfen dabei Fackeln auf die mit Binsen gedeckten Hausdächer. Die Flammen fraßen sich sofort und unaufhaltsam in das trockene Material. Rauch stieg auf und hüllte alles in eine dichte Nebeldecke. Nur das gelb-orange Flackern der Flammen war noch verschwommen zu sehen.
Die Schreie kamen nun von allen Seiten. Aus ihnen sprach so viel Panik und Schmerz, dass sich mir die Nackenhaare aufstellten. Starben die Dschinda? Starben meine Freunde, mein Volk? Und wohin sollten wir uns in Sicherheit bringen? Die Soldaten waren überall. Schon hörte ich das Knacken und Knistern des Feuers auch aus unserem Haus. Mein Leben ging hinter mir in Flammen auf.
Mutter und Vater schauten sich verzweifelt um. Es gab keinen Ausweg aus dieser Hölle. Der alte Elas rannte brennend auf uns zu. Er stolperte und riss das große Wasserfass aus Ton mit einem lauten Poltern um. Das Wasser strömte in einem enormen Schwall heraus, löschte Elas´ Leib. Seine verbrannte Haut hing in Fetzen von seinem Rücken. Trotzdem rappelte er sich auf und rannte mit weit aufgerissenen Augen davon. Das Wasser zischte in den Flammen, die das Haus inzwischen vollständig verschlangen. Weißer Rauch stieg auf und verbarg uns für wenige Augenblicke vor allen Angreifern.
Mutter nahm mir Kija aus dem Arm. Sie küsste ihre zarte Wange.
»Rein da!«, zischte Vater und gab mir einen unsanften Stoß in Richtung des Fasses. Ich stolperte! Aber ihn schien es nicht zu interessieren, dass ich mir mein Knie aufschürfte. Es brannte furchtbar. Ich warf meinem Vater einen wütenden Blick zu. Der schob mich allerdings fast brutal in das Fass und drückte mir meine Schwester in die Arme. »Halt Kija ruhig und bleib da drin! Verstanden?« Ich nickte, obwohl ich nichts verstand.
Mutters Gesicht erschien noch einmal in der Öffnung. »Ich liebe euch!« Noch während sie sprach, schob mein Vater den Deckel auf das liegende Fass. Nur noch Dunkelheit und Schreie erfüllten meine Welt. Tränen liefen mir über die Wangen.
Kija schlief selig in meinen Armen. Ab und an durchdrang ihr zufriedenes Schmatzen die Kakophonie aus den Geräuschen der Vernichtung, die außerhalb noch sehr lange nicht verstummten. Irgendwann schlief ich erschöpft ein.
Die Ruhe weckte mich. Meine Schultern schmerzten, weil ich Kija noch immer fest an mich gedrückt hielt. Ich wagte es allerdings nicht, sie abzulegen. Angespannt lauschte ich, aber es herrschte absolute Stille. Wo waren Mutter und Vater? Warum hatten sie uns nicht hier herausgeholt, nachdem jetzt der ganze Spuk vorüber zu sein schien?
Ich wollte es dringend herausfinden. Der Deckel verschloss die Öffnung fest. Mit aller Kraft musste ich meine nackten Füße dagegenstemmen, bevor er sich mit einem Plopp löste. Mit lautem Scheppern polterte er auf den Boden. Ich hielt die Luft an. Hatte jemand diesen Lärm gehört? Würden die Männer mit den Speeren kommen und mich holen? Als nichts passierte, entspannte ich mich ein wenig, fasste neuen Mut. Ich legte Kija ab und krabbelte rückwärts ins Freie. Ich schirmte meine Augen mit meinen Händen vor der blendenden Morgensonne ab. Mit angehaltenem Atem schaute mich um. Doch der Anblick, der sich mir bot, war falsch. Was ich sah, war nicht mehr unser Dorf. Nur noch Ruß geschwärzte Ruinen ragten um mich herum auf. Dünne Rauchfäden stiegen in kleinen Wirbeln hinter den Mauerresten auf. Überall auf den Wegen lagen meine Nachbarn und schliefen. Sie hatten ja keine Häuser mehr.
Erst bei genauerem Hinsehen erkannte ich abgetrennte Gliedmaßen und Unmengen von Blut. Nein, das sprach nicht gerade für einen friedlichen Schlaf. So viele Augenpaare starrten mich blicklos an. Ich bekam keine Luft mehr, mein Herz schnürte sich zusammen. Es tat so weh. Schutzsuchend schlang ich die Arme um meine noch kindliche Brust und wiegte mich wie in Trance vor und zurück. Wie lange ich dort stand, wusste ich nicht. Erst Kijas Weinen, das bald zu einem zornigen Gebrüll anschwoll, brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Ich holte sie aus dem Fass. Dabei fiel mein Blick auf das Gesicht meines Vaters. Er lag neben unserem Haus. Der Kopf war fast vollständig von seinem Hals getrennt. Das Blut war vom Wüstensand aufgesaugt worden. Nur ein dunkler Fleck zeigte, dass hier Blut geflossen war – sehr viel Blut.
»Oh, Papa!«, keuchte ich.
»Samira, bist du das?« Als ich die Stimme meiner Mutter hörte, überflutete mich eine unbändige Freude. Sie hatte überlebt. Ich rannte um das Haus und fand sie angelehnt an unsere kleine Bank. Das Lächeln erstarb auf meinen Lippen, als ich ihre tiefe Bauchwunde sah. Mutter presste ihre Hände darauf, aber das Blut pulsierte unaufhörlich aus dem Schnitt. Ihre Haut war unnatürlich blass und die Lippen hatten jegliche Farbe verloren. Ihre Augen zuckten unkoordiniert hin und her.
Ich kniete mich neben sie und legte meine kleine Hand auf ihren Arm. »Ich bin da, Mama.«
»Samira. Meine große, starke Samira. Geh zu den Bergen. Bring dich in Sicherheit.«
»Ja, Mama und du kommst mit, oder?«
»Ich werde heute gemeinsam mit Vater sterben, mein Kind. Wer kümmert sich denn sonst um ihn? Er braucht mich doch.«
»Aber ich brauche dich auch, Mama. Kija braucht dich!« Tränen rannen aus meinen Augen und ließen meine Sicht verschwimmen.
»Nicht weinen, mein Kind. Unser Volk braucht dich. Geh zu den Göttern und bitte um Schutz für unser Volk. Sie werden dir zuhören, denn dein Herz ist so rein wie ein klarer Bergsee.« Ihr Atem rasselte laut und sie musste sich sehr anstrengen weiterzusprechen. »Vergiss nicht, dass ich dich liebe, du und Kija seid das Beste, was mir je passiert ist. Danke, dass ich deine Mutter sein durfte.« Sie hob ihre blutige Hand an meine Wange und strich federzart mit dem Daumen darüber. Ich spürte Feuchtigkeit. Meine Tränen, ihr Blut? Ich wusste es nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ein Lächeln umspielte ihre bleichen Lippen. Dann brach ihr Blick und ihr Arm fiel schlaff zu Boden.
Das war der Moment, in dem ich das Kind in mir verlor. Es war einfach weg, als habe jemand mit dem Finger geschnipst. Ich straffte die Schultern und sperrte die Trauer und jedes bisschen Verzweiflung in den hintersten Teil meiner Seele. Dort würde ich es erst wieder herausholen, wenn ich den Wunsch meiner Mutter erfüllt hatte. Ich würde in die Duat, das Totenreich, gehen und die Götter um Hilfe anflehen. Ich löste den kleinen Dolch von Mutters Hüfte und legte ihn mir selbst an. Beherzt zog ich ihn aus der Scheide und machte mich ans Werk. Auch meine Eltern hatten ein ewiges Leben in den Gefilden der Binsen verdient und dafür würde ich alles tun.
Anschließend durchsuchte ich die Überreste unseres Dorfes nach Vorräten, band mir die inzwischen wild kreischende Kija auf den Rücken und lief in die Wüste. Am Horizont konnte ich die Berge sehen. Sie waren mein Ziel. Dort würde ich lernen, zu kämpfen und dann meiner Bestimmung folgen, egal welchen Preis ich dafür zahlen musste.
Kapitel 1
Neun Jahre später ...
Samira
Ich lag bereits so lange hinter diesen Felsen auf der Lauer und beobachtete den Tempel. Wieder war er es, der den Unrat aus der Küche zu den Schweinen bringen musste. Die Holzstange, an der die zwei Eimer hingen, ließ ihn gebückt gehen. Schweiß tropfte von seiner Stirn. Er konnte ihn nicht abwischen, da er mit zusammengebissenen Zähnen versuchte, seine Last auszubalancieren. Fliegen umschwirrten seine Fracht. Ich konnte das Surren bis zu meinem Versteck hinauf hören. Der Wind brachte den Geruch von Verwesung mit sich. Ich hielt mir angeekelt die Nase zu.
Er hatte den Hof zur Hälfte überquert, als die anderen aus dem Schulgebäude kamen. Ihre Tuniken strahlten so weiß, dass sie mich blendeten. An den funkelnden Schmuckkragen erkannte jeder sofort ihre gehobene Stellung innerhalb des Tempels. Während er ein Arbeiter, ja fast ein Sklave war, fungierten sie als die Herren.
»Hey Kadir, du stinkst.«
»Ja, die Schweine werden sich freuen, wenn du kommst. Dann ist die Rotte wieder vollzählig.«
»Bestimmt legt er sich mit einer Sau in die Suhle. Vielleicht lässt die ihn ja dann mal ran.« Er versuchte, an ihnen vorbeizugehen, aber sie versperrten ihm den Weg. Es gab keine Möglichkeit, ihren bösen Scherzen auszuweichen. Trotzdem sah er einfach nur zu Boden, reagierte nicht auf die Worte, die mich schon längst zur Weißglut getrieben hätten. Aber anscheinend stachelte das den Mob nur noch mehr an. Sie begannen ihn zu stoßen. Der stinkende Brei schwappte aus den Eimern und lief an seinen Beinen herab. Die Insekten stürzten sich auf die neu gewonnene Futterstelle. Unzählige Plagegeister krabbelten über seine Haut. Wie hielt er das nur aus?
»Hast du dich schmutzig gemacht, Kadir? Wie ungeschickt, da du nur diese eine Tunika besitzt.« Die Jungen lachten schallend über diesen Kommentar.
»Sicherlich macht ihn dieser Geruch besonders schön für seine Sau.« Das Gelächter wollte nicht aufhören, aber Kadir stand weiterhin stoisch da und ließ alles über sich ergehen. Nur an seinen geschlossenen Augen erkannte ich, wie sehr die Worte ihn verletzten. So ging es nun seit einer Woche. So lange beobachtete ich den Tempel von Hamunaptra bereits. Jeden Tag musste Kadir sich diese oder noch schlimmere Demütigungen gefallen lassen. Kein einziges Mal setzte er sich zur Wehr. Nicht ein einziges wütendes Wort richtete er an seine Peiniger. Kadir schwieg, bis es ihnen zu langweilig wurde oder der Hohepriester sie zum Gebet rief. Warum tat er das? Ich hätte ihnen längst gezeigt, dass sie mit mir nicht so umspringen konnten.
»Was geht denn hier schon wieder vor sich? Hast du nichts zu tun?« Kadir drehte sich ruckartig um, als er die Stimme des Hohepriesters hinter sich hörte. Auch ich fuhr erschrocken zusammen. Dieser alte Priester konnte sich anschleichen wie kein zweiter.
Einer der Eimer stieß mit Schwung gegen eine Marmorstatue, die wohl Osiris und Isis in einer liebevollen Umarmung darstellen sollten. Als habe jemand die Zeit langsamer laufen lassen, kippte sie zu Boden und zerschellte auf den Pflastersteinen in viele kleine Teile. Der Hohepriester presste die Lippen fest aufeinander. Seine Nasenflügel bebten. Er holte aus und verpasste Kadir eine schallende Ohrfeige. »Du gottloser Bastard. Kein Wunder, dass deine Eltern dich auf unsere Schwelle legten. Du bist zu nichts zu gebrauchen und nun zerstörst du auch noch das Abbild unserer höchsten Götter.« Er wies mit dem Zeigefinger in Richtung Schweinestall. »Geh mir aus den Augen. Heute Nacht wirst du Osiris um Verzeihung anflehen, auch wenn ich mir sicher bin, dass selbst die Götter angewidert ihr Haupt abwenden, wenn sie deiner gewahr werden.«
Die Anwesenden lachten hinter vorgehaltenen Händen und folgten dem wütend ausschreitenden Hohepriester in den Tempel.
Ich sah den roten Handabdruck auf Kadirs Wange bis hierher. Der Schlag hatte gesessen. Trotzdem sagte der junge Mann nichts. Selbst die Eimer hielt er noch immer sicher auf seinen Schultern. Nur wenige Kleckse der grauen Pampe sprenkelten die weißen Wege, als er seinen Weg zu den Ställen fortsetzte.
Ich biss von meinem Streifen Trockenfleisch ab und sah ihm nachdenklich hinterher.
Die Sonne verschwand gerade hinter den Gräbern der Totenstadt, als ich mich aus meinem Versteck schlich. Heute würde ich alles auf eine Karte setzen. So leise wie möglich schlich ich an der hohen Mauer entlang.
Durch meine Beobachtungen kannte ich den kleinen Geheimgang, den die privilegierten Schüler hinter einer Rankpflanze versteckt hielten. Oft genug hatte ich gesehen, wie sie sich davonschlichen, um die Mädchen des benachbarten Dorfes mit ihren gesäuselten Lügen um den Verstand zu bringen. Es graute mir, als ich daran dachte, dass aus diesen gewissenlosen Menschen einmal die Führungselite des Landes werden sollte. Aber das war im Moment nicht mein Problem. Ich hatte ein anderes Ziel.
Der Vorhang aus trockenen Blättern raschelte leise, als ich ihn zur Seite schob und in den Tempelgarten schlüpfte. Der abnehmende Mond warf nur wenig Licht auf die ordentlich angelegten Beete. Ausschließlich das Weiß der Wege zog sich wie ein filigranes Labyrinth durch die Dunkelheit, ganz so, als würden die Götter mir den Weg weisen.
Hinter einem hohen Torbogen, der ins Innere des Tempels führte, flackerten hunderte Kerzen, einige ganz neu, andere fast bis zur Gänze heruntergebrannt. Sie säumten den runden Saal, an dessen Stirnseite eine riesige Statue des Totengottes Osiris wohlwollend in den Raum herabsah. Während der Körper des Gottes aus einem Stück riesigen Basaltgesteins geschlagen war, leuchtete sein Gesicht in Jadegrün. Eine Krone aus weißem Marmor, verziert mit goldenem Schmuck, bedeckte sein Haupt. In den schlanken Händen hielt er ein goldenes Was-Zepter und den Krummstab mit Geißel.
Auch zu seinen Füßen leuchteten die Kerzen. Ihr flackerndes Licht warf tanzende Schatten auf das Gesicht des Gottes, ließ ihn in der einen Sekunde lächeln und in der nächsten fast wütend dreinblicken. Ich erwartete fast, Osiris würde jeden Augenblick zum Leben erwachen.
Zu seinen Füßen lag Kadir ausgebreitet auf dem Bauch. Arme und Beine hielt er so weit wie möglich von sich gestreckt. Seine Augen waren geschlossen und der Rücken bewegte sich in gleichmäßigen Atemzügen auf und ab. War er etwa eingeschlafen? Ich hielt mir die Hand vor den Mund, um nicht lachen zu müssen. Das hier war das erste Zeichen von Widerstand, das ich an ihm sah, wenn auch ein unfreiwilliges.
Auf Zehenspitzen schlich ich mich neben ihn. Noch einmal fragte ich mich, ob ich ihm wirklich vertrauen sollte, ob ich das Leben oder auch das Sterben meines Volkes in die Hände dieses jungen Mannes legen konnte. Aber ich hatte keine andere Wahl. Also atmete ich tief durch und kniete mich neben ihn auf den kühlen Boden. Schnell schickte ich noch ein Stoßgebet zu Osiris und es schien mir, als würde die Statue mir aufmunternd zunicken.
Egal! Jetzt oder nie. Ich pikte meinen Finger in die Rippen des jungen Mannes. Er nuschelte etwas im Schlaf und drehte den Kopf zur anderen Seite. Ich lächelte. Noch nie hatte ich ihn so friedlich gesehen. Vorsichtig legte ich meine Hand auf seine Schulter und rüttelte leicht. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Wie von der Tarantel gestochen, sprang er auf die Knie.
»Ich hab nicht... Es sah nur so aus, als ob ich...«, stammelte er und schaute sich panisch um. Erst als sein Blick auf mir hängen blieb, wurde aus Panik Verwirrung. Er zog die Stirn kraus.
»Wer bist du denn und was machst du hier?«
»Nett, dass du fragst. Mein Name ist Samira und ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche.«
»Ja, genau. Ausgerechnet meine Hilfe suchst du, wo hier die Söhne der Berater und obersten Baumeister die Priesterschule besuchen. Sicherlich sitzen sie irgendwo im Schatten und können ihr Lachen kaum zurückhalten.« Kadir stand auf, ging in den Garten und setzte sich dort auf eine Bank. »Ihr könnt rauskommen. Sie ist wunderschön, aber ich falle nicht auf ihren Liebreiz herein.«
Mir wurde ganz heiß. Noch nie hatte mich jemand schön genannt. Trotzdem musste ich mich auf den Plan konzentrieren. Kadir war meine Chance, vielleicht sogar die Einzige.
»Hier ist niemand, außer mir.« Ich setzte mich neben ihn.
»Ich möchte dir einen Vorschlag unterbreiten.« Meine Hand legte sich wie von selbst auf seine. »Hör mir erst zu. Anschließend darfst du über mich urteilen.« Ich machte eine kurze Pause. Jetzt oder nie! »Ich bin eine Dschinda.« Kadir sog scharf die Luft ein.
Enttäuschung machte sich in mir breit. Ich entzog ihm meine Hand und presste die Lippen zu einem Strich zusammen. Hatte ich tatsächlich geglaubt, er würde mich nicht verurteilen, nur weil er ebenfalls schlecht behandelt wurde? Er war eben doch nur ein Mensch, bereit, sich allem zu beugen, was das Schicksal ihm auferlegte. Vielleicht sollte ich einfach gehen und mir einen anderen Weg suchen.
»Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen, aber jeder Mensch hat Angst vor den Dschinns. Es werden die grausamsten Geschichten über euch erzählt. Wie Naturgewalten sollt ihr Dörfer und Städte dem Erdboden gleichmachen, sobald ein dummer Mensch euch seine sehnlichsten Wünsche offenbart. Und wenn ich das richtig verstanden habe, entsprechen die Dschindas genau diesen Dschinns.«
Ich legte den Kopf schief und flüsterte: »Was interessieren dich die anderen Menschen? War je jemand gut zu dir? Hat es jemand verdient, dass du ihn schützt?«
Ein Schatten legte sich über seine Züge. Er schüttelte traurig den Kopf.
»Dann hast du nichts zu verlieren. Ich biete dir an, deine drei sehnlichsten Wünsche zu erfüllen, wenn du mich in die Duat begleitest, mir hilfst, die Tore zu passieren und die Gefahren dort zu überleben.« Kadir riss die Augen erschrocken auf, aber ich hob schnell die Hand. Bat ihn damit um noch ein wenig Redezeit. »Wir werden uns vor Osiris einen Eid schwören, dass du die drei Wünsche verlangen kannst, ohne dass dir eine Gefahr droht, wenn ich sie dir erfülle.«
Jetzt legte ich meine Hand wieder auf seine. »Überlege dir gut, ob das hier das Leben ist, das du bis ans Ende deiner Tage weiterführen möchtest. Ich kann das ändern.«
»Du willst in die Duat?«, entfuhr es ihm. »Wie soll ich dir denn dabei helfen?«
»Du bist ein Priester, oder nicht?« Kadir bewegte unschlüssig den Kopf hin und her.
»Zumindest kennst du alle Gebete, weißt, wie man die Götter anruft, und hast viel über die Duat gelesen.«
»Mhhh...«, war seine unbestimmte Antwort. Er schien mit sich zu ringen.
»Ich kann dir bis morgen Abend Zeit geben. Dann brauche ich allerdings deine Entscheidung.«
Wieder »Mhhh...«
Ich hob mit meinem Zeigefinger seinen Kopf an, sodass er mir in die Augen schauen musste. »Du bist meine einzige Chance, Kadir. Ich werde morgen Abend wieder hier sein und erwarte dann deine Antwort.«
In seinen braunen Augen spiegelte sich die Mondsichel. Sie schienen mir bis in die Seele zu schauen, zu erkunden, ob ich ihn hinters Licht führte oder ihm eine echte Chance aufzeigte diesem Leben zu entfliehen. Sein Mienenspiel wechselte zwischen Hoffnung und Unglaube.
Ich stand auf und huschte zum Geheimgang. Bevor ich hinter den Blättern verschwand, drehte ich mich noch einmal zu ihm um und lächelte.
Kapitel 2
Kadir
Wie ein Engel war sie mir erschienen und das auch noch in einem so peinlichen Moment. Hoffentlich hatte ich im Schlaf nicht auf den Tempelboden gesabbert.
Ich schaute zu Osiris auf. Hatte er mir diese Chance geschickt oder wollte sein Bruder Seth mich hinters Licht führen? Jedem Menschen wurde von klein auf mit auf den Weg gegeben, sich nicht von Seth in die Irre treiben zu lassen. Zu meinen frühesten Erinnerungen zählten die strengen Worte des Hohepriesters: »Der leichte Weg führt ins Verderben!« Immer wieder sagte er diesen Satz, um Krankheit und Verletzung nicht dafür herhalten zu lassen, dass ich meiner Arbeit nicht nachging.
Deshalb erschrak ich nicht, als ich in die Küche kam und die Überraschung sah, die mir mit großer Sicherheit Amir und Nebamun bereitet hatten. Ich nahm mir den Eimer aus der Ecke. Er war glücklicherweise noch ausreichend gefüllt. Ich tunkte die Bürste in den Sand und begann, den Küchenboden zu scheuern. Amir und Nebamun hatten sich diesmal einen Spaß daraus gemacht, die Fliesen dick mit dem Brei einzureiben, den ich gestern zu den Schweinen gebracht hatte. Natürlich würde man mir wieder die Schuld an dieser Sauerei geben. Es war einfacher, mich zu rügen, denn hinter mir stand kein reicher Vater, der dem Tempel Unsummen spendete.
Ich schrubbte mit aller Kraft, aber das Zeug klebte wie Kleister an den Steinen. Es würde eine Ewigkeit dauern, bis das helle Gelb der Bodenfliesen wieder sichtbar werden würde.
Wieder schweiften meine Gedanken zu dem Angebot des Mädchens ab. War eine Reise durch die Duat wirklich der leichtere Weg? - Nein, bestimmt nicht. Aber sie war eine Dschinda. Ein Wesen, das zerstören und vernichten konnte, sobald ihre Mächte entfesselt wurden. - Aber sie wollte auf Osiris schwören, dass mir kein Leid durch ihre Zauber widerfahren würde. Das Ganze Für und Wider machte mich ganz schwindelig.
Ein Schmerz ließ mich zusammenfahren. Ich schaute erschrocken auf und sah den alten Koch vor mir stehen. Seine Züge waren wutverzerrt. In der Hand hielt er den langen Rohrstock, mit dem ich schon so oft das Vergnügen gehabt hatte.
»Was hast du mit meiner Küche gemacht?«
Ich antwortete nicht. Denn ich konnte ihm sowieso keine richtige Antwort präsentieren. Amir und Nebamun beschuldigen? – Wie könnte ich es wagen, die tugendhaften Söhne der Senatoren zu bezichtigen? – Ich bekäme Schläge. Mich entschuldigen? – Welcher Dämon hatte mich geritten, eine solche Form des Vandalismus an den Tag zu legen? – Ich bekäme Schläge. Also blieb ich still und bürstete weiter den Küchenboden. Ich unterbrach meine Arbeit auch nicht, als der Stock mehrfach auf mich niedersauste. Die Narben auf meinem Körper hatten mich gegen den Schmerz abgehärtet.
Als der Koch die Lust verlor, weiter auf mich einzuschlagen und das Blut langsam auf meinem Rücken trocknete, dachte ich wieder an ihr Lächeln. Hatte mich jemals jemand so ehrlich angelächelt? Was konnte ich verlieren? Ich selbst war weniger wert als eine Ratte. Diese konnte nach ihrem Ableben noch auf einem Spieß gebraten werden und in Zeiten des Hungers über Leben und Tod entscheiden. Mich würde man nur im Wüstensand verscharren und vergessen.
Drei Wünsche – ich wusste genau, wie sie lauten würden, denn ich träumte schon so lange davon sie auszusprechen. Ein Lächeln legte sich über meine Lippen, als ich mir vorstellte, wie es sein würde. Meine Entscheidung war gefallen. Selbst wenn die Duat mich in den Tod führen sollte, konnte ich doch mit Hoffnung im Herzen sterben.
Die Stunden vergingen so langsam wie nie, obwohl dieser Tag genauso war, wie viele andere davor. Irgendwann war der Koch mit der Sauberkeit seiner Küche zufrieden und ich durfte die Tiere füttern. Das war die schönste Aufgabe des Tages. Auch wenn ich dafür verspottet wurde, die Tiere waren Freunde für mich. Selbst den wilden Eber konnte ich beruhigen. Inzwischen kam er genauso fröhlich zu mir wie seine Damen und holte sich seine täglichen Streicheleinheiten ab. Besonders gern mochte er es, wenn ich ihm das Kinn direkt unter den Hauern kratzte. Er zuckte dann mit seinem Hinterbein wie ein Hund und grunzte zufrieden. Seine Sauen liebten die Bürste und nicht selten schubsten und schoben sie, um als Erstes an der Reihe zu sein.
Anschließend kümmerte ich mich um die Schafe. Den alten Bock quälte die Hufrehe, eine übelriechende und extrem schmerzhafte Pilzinfektion. Jeden Tag badete ich daher seinen Fuß in Bittersalz und verband ihn dann. Inzwischen humpelte er schon bereitwillig zu mir herüber und ließ die Prozedur über sich ergehen. Natürlich nicht, ohne meine Taschen nach dem ein oder anderen frischen Kräutlein abzusuchen. Selbstverständlich war seine Suche auch jedes Mal erfolgreich.
Um die Tiere tat es mir wirklich leid. Niemand hier würde Zeit aufwenden, um sie glücklich zu machen. Sie waren Nutzvieh, standen in ihren Ställen, um geschlachtet oder geschoren zu werden. Mehr sah niemand in ihnen. Ich strich dem Eber noch einmal über seinen Rüssel. »Mach´s gut, mein Freund. Wünsch mir Glück.« Er grunzte, als wünsche er mir eine gute Reise und ich machte mich auf den Weg zurück zum Tempel.
Die Schule hatte bereits begonnen, sodass ich ohne Schikane in den kleinen Nebenraum kam, den mir der Priester zum Lernen zugewiesen hatte. Nur nachts, verhüllt von der Dunkelheit, durfte ich den Tempel betreten. Aber auch dann musste ich den Kopf gesenkt halten, damit ich die Götter mit meinem Anblick nicht verärgerte.
Müde lehnte ich mich zurück und folgte den Worten des Hohepriesters. Inzwischen konnte ich alle Gebete und Beschwörungen auswendig. Oft rezitierte ich sie gemeinsam mit ihm, fast im Duett, und verzog das Gesicht beim Sprechen zu einer strengen Grimasse, wie er sie immer zutage trug. Er konnte mich hier drin ja weder hören noch sehen.
Während die jungen Studenten nur wenige Jahre im Tempel verbrachten, lernte ich schon mein Leben lang. Das mussten inzwischen zwanzig oder einundzwanzig Jahre sein. Genau wusste ich es nicht. Ich kannte jedes Wort, das im großen Buch der Götter geschrieben stand, auch wenn ich es nie gelesen hatte. Sicherlich wussten die Priester nicht einmal, dass ich lesen und schreiben konnte. Sie hatten nie eine Notwendigkeit darin gesehen, es mir beizubringen, also tat ich es selbst. Lauschte heimlich dem Lesetraining der Studenten und versuchte mich dann selbst mit Hilfe eines ausgedienten Lehrbuchs daran. Schneller als ich es selbst für möglich gehalten hätte, schlich ich mich in die Bibliothek und las dort die Schriftrollen und Folianten. Eine ganz neue Welt eröffnete sich mir. Ich konnte fliehen, den Schmerz und die Einsamkeit hinter mir lassen. Reiste gedanklich in fremde Welten, bereiste ferne Länder.
Die Geschichte über einen bösen Dschinn war eine der Ersten, die ich gelesen hatte. Er wurde als blauer Unhold beschrieben, der aufgrund seiner Gräueltaten in eine Öllampe gebannt worden war. Samira glich diesen Beschreibungen überhaupt nicht. Sie war auf ihren eigenen zwei Beinen gegangen. Kein Rauch, der sie schweben ließ. Ich seufzte. Samira sah alles andere als furchterregend aus. Ihre grünen Augen strahlten so viel Stärke aus, dass ich fast fühlen konnte, wie sie auf mich übersprang. Mit ihrem sonnengebleichten, hüftlangen Haar, das ihr zartes Gesicht umrahmte, wirkte sie wie eine gute Fee, nicht wie ein furchtbares Monster. In ihrem Lächeln konnte ich mich verlieren. Wie sollte sie böse sein? In diesem Moment beschloss ich, nicht nur mit ihr zu gehen, sondern der Dschinda zu vertrauen.
Die Nacht breitete ihre dunkle Decke über die Wüste. Eine kühle Brise strich durch die Dünen und wirbelte Staub auf, den diesmal nicht ich beseitigen würde. Ich grinste schadenfroh bei dem Gedanken daran, wie sie alle nach mir rufen würden. Wer würde wohl den Besen schwingen, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stand?
Ich starrte aus dem winzigen vergitterten Fenster. Dieser Ausschnitt des Himmels zeigte, selbst das Wetter schien auf meiner Seite zu sein. Dicke Wolken verdeckten Mond und Sterne fast vollständig. Niemand würde mich mit Samira im Tempelgarten sehen können, wenn ich ihr sagte, dass ich mit ihr gehen würde.
Ich schlich aus dem winzigen Zimmer. Mein Blick ruhte ein letztes Mal auf dem, was bisher mein Reich gewesen war. Die harte Pritsche, die mein Bett darstellte, füllte den Raum vollständig aus. Auf einem Regalbrett über der Schlafstatt standen ein Becher und ein Teller. Sie und das fadenscheinige graue Gewand, das meine Blöße bedeckte, waren mein einziger Besitz. Ich zog langsam die Tür zu. Ab heute gehörte mir die ganze Welt.
Auf Zehenspitzen huschte ich die verlassenen Flure entlang. Mein erster Weg führte mich in die Küche. Wir brauchten Vorräte. Die Reise zum Tor der Unterwelt dauerte zu Fuß mindestens drei Sonnenzyklen. Dafür sollten wir gerüstet sein und der Tempel war gut ausgestattet. Ich nahm zwei Schläuche Wasser sowie etwas Brot, Käse und Datteln und stopfte alles in eine große Tasche, die für den Transport der Einkäufe auf dem Markt bestimmt war. Bei der Fülle, die diese Speisekammer zu bieten hatte, würde das Fehlen des Proviants kaum auffallen.
Ich warf mir die Riemen über die Schulter, verharrte aber einen kurzen Moment. Es gab noch jemanden, von dem ich mich verabschieden wollte. Ich ging in den Balsamierungsraum. Heute war die Nacht der Ruhe. Niemand befand sich in der Nähe, um den Geist unseres Herrschers nicht bei der Vorbereitung zum Übergang in eine neue Daseinsform zu stören. Hier roch es nach Weihrauch und getrockneten Kräutern. Der süßliche Geruch des Todes war schon vor einigen Tagen verschwunden. Eine dicke Schicht aus Binden verhinderte den weiteren Zerfall der Mumie, die hier vor mir lag. Niemand hätte wohl den verstorbenen Pharao als solchen erkannt, würden nicht unzählige Schmuckstücke aus den einzelnen Lagen hervorblitzen. Neben ihm stand sein verzierter Sarkophag. Sein gütiges Antlitz war mit Goldfarbe darauf gezeichnet. In fünf Tagen würde er darin seine Ruhestatt finden. Die komplette Priesterschaft des Tempels würde den verstorbenen Herrscher in seine Grabkammer transportieren und dort den letzten Akt des Mundöffnungsrituals durchführen. Damit konnte seine Reise durch die Duat beginnen. Gemeinsam mit dem Sonnengott Re würde er sich bei Sonnenuntergang in die königliche Barke begeben, um am nächsten Morgen selbst als Re, die Sonne, am Morgenhimmel aufzuerstehen.
Ich legte eine Hand auf die harzgetränkten Bandagen, die den Körper des Pharaos wie ein Kunstwerk umwickelten. Eine eigenartige Ruhe stellte sich in mir ein.
Ich beschwor den König stumm, uns in der Unterwelt zur Seite zu stehen, und wünschte ihm eine gute Reise.
Vorsichtig löste ich meine Finger von ihm und tat das Undenkbare. Meine Hände zitterten leicht, als ich nach dem Buch griff. Es war nicht irgendein Buch, das ich jetzt schnell in die Tasche zu den Lebensmitteln stopfte. Nein, ich war im Begriff das heilige Buch der Toten mit auf unsere Reise zu nehmen. Nirgends sonst standen so viele Geheimnisse der Unterwelt gelüftet. Nichts konnte uns besser den Weg weisen. Mit diesen Texten schaffte ich die besten Voraussetzungen, um der Erfüllung meiner Wünsche näher zu kommen.
Kapitel 3
Samira
Ich saß schon eine Stunde in dem winzigen Durchgang und starrte in den Tempelgarten. Was sollte ich tun, wenn er sich gegen mich entschied? Wie konnte ein anderer Weg aussehen, wenn selbst die Erfüllung seiner sehnlichsten Träume, die Angst vor der Unterwelt nicht überwinden konnte? Oder die Angst vor einer Dschinda?
Ich wollte mich schon wieder in die Berge zurückziehen und über einen anderen Weg nachgrübeln, als ich eine Bewegung in der Finsternis wahrnahm. War dort jemand? Da, Schritte knirschten im feinen Sand, den die Nacht herbeigeweht hatte. Ich packte den Griff meines Säbels fester, bereit ihn blitzschnell aus meinem Gürtel zu ziehen, sollte ein Feind sich nähern. In diesem Moment öffnete sich die Wolkendecke für einen winzigen Augenblick und ich erkannte Kadir. Er hatte eine Tasche geschultert und stand unschlüssig auf dem Weg. Sein Kopf ruckte unruhig hin und her. Alles in mir jubelte. Offensichtlich hatte er sich doch für das Abenteuer, für mich, entschieden. Warum sonst sollte er den halben Hausstand des Tempels auf seinem Rücken mit sich herumschleppen? Erleichtert stieß ich die Luft aus, kam aus meinem Versteck und ging ihm entgegen. Er legte seine Tasche hinter einem Gebüsch ab.
»Hallo.« Unsicher knetete er seine Hände.
»Ich freue mich, dass du mir helfen möchtest.«
Er nickte und sagte dann so leise, dass ich ihn kaum hören konnte: »Aber zuerst müssen wir in den Tempel.«
Ich runzelte die Stirn. Was sollte ich denn jetzt in diesem Tempel? Er bemerkte meine Verwirrung.
Ängstlich flüsterte er: »Du hast es versprochen. Wir schwören vor Osiris.«
Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Für mich wäre ein Schwur überall bindend gewesen, aber er war ein Priester und glaubte, dass die Götter die Gebete nur in den Tempeln hören konnten. Es war ein Risiko. Wir konnten entdeckt werden und dann würde die Reise enden, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Trotzdem war es wichtig, dass Kadir mir vertraute. Also stimmte ich zu und begleitete ihn.
Auch in dieser Nacht brannten die Kerzen. Sicherlich ließen sie sie nie erlöschen. Eine Art Ritual, dessen Grund mir nicht bekannt war.
Kadir nahm meine Hand. Er zog mich direkt vor die Statue des Osiris. Dort kniete er nieder und bedeutete mir, mich ihm gegenüber niederzulassen. Sein Blick traf meinen. »Osiris, Herr der Unterwelt, durch Betrug und Brudermord. Wenn jemand weiß, wie Verrat sich anfühlt, dann du. Deshalb bin ich mir sicher, dass dein Zorn unerbittlich über jeden kommen wird, der unter deinem Antlitz unwahr spricht.« Kadir legte eine Hand auf sein Herz. »Ich schwöre, diese Dschinda mit Namen Samira in die Duat zu begleiten. Ihr nach bestem Wissen und mit allen meinen Möglichkeiten zur Seite zu stehen, bis wir am Morgen mit dem Sonnengott Re auf die Erde zurückkehren.«
Kadir nickte mir auffordernd zu. Ich schaute zu dem Gott auf und schluckte. Ich kannte die Tragweite des Eides, den ich jetzt sprechen würde. »Osiris, Herr der Unterwelt, durch die Liebe deiner Schwestergemahlin Isis. Ich schwöre vor dir und dem Priester Kadir, dass ich ihn auf unserer Reise durch die Duat mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln schützen werde. Kein Leid soll ihm jemals durch mich widerfahren. Und ich schwöre, ihm zum Dank für seine Hilfe, drei Wünsche zu erfüllen, nachdem wir aus dem Totenreich zurück ins Leben aufsteigen.«
»So sei es. Bezeugt durch Osiris sind unsere Schwüre bindend.« Kadir hielt weiter meine Hand, als wir uns erhoben. Er strahlte wie ein neuer Mensch. Von dem unsicheren Jungen schien nichts mehr übrig zu sein. »Jetzt können wir aufbrechen.« Er zog mich hinter sich her, holte die Tasche aus ihrem Versteck und tauchte durch den Spalt auf die andere Seite der Mauer.
Kaum hatten wir uns aufgerichtet, wurden hinter uns Stimmen laut. »Meinst du, dass ich heute die Tochter des Schmieds rumbekomme? Sie soll endlich ihre Beine für mich öffnen. Ich habe langsam keine Lust mehr, mir ihre Liebesschwüre anzuhören. Die Kleine soll die Klappe halten und einen heißen Ritt auf meinen Lenden hinlegen.« Jemand lachte gehässig. »Danach kann sie zu Papi zurückrennen und ihm die Ohren vollheulen.«
»Ja, es macht Spaß, die Dummheit der Dorfschönheiten auszunutzen. Als wenn jemand in einer gehobenen Stellung ein solches Nichts zur Frau nehmen würde.« Wieder ein Lachen.
Sie waren bereits am Geheimgang. Bis zu den Bergen konnten wir es jetzt nicht mehr schaffen. Sie waren zu nah. Die Blätter raschelten bereits und zwei Schemen kamen in der Dunkelheit zum Vorschein. Kadir und ich pressten uns eng an die Mauer. Hätten sich die beiden nur einmal umgewendet, wäre es für sie unmöglich gewesen, uns zu übersehen. Hier gab es nichts als den hellen Wüstensand und diese weiße Steinwand. Ich hielt die Luft an. Das Herz schlug viel zu laut in meiner Brust. Kadir ließ meine Hand zu keiner Sekunde los, doch je weiter sich die beiden entfernten, desto lockerer wurde sein Griff. Das Letzte, was die kühle Nachtluft zu uns herüberwehte, waren die Worte. »Vielleicht hat ja der Schweinejunge eine Chance, unsere Reste zu bekommen. Er sollte uns dankbar sein, wir ebnen ihm schließlich den Weg.« Damit verschwanden sie hinter einem Hügel. Ich schaute vorsichtig zu Kadir hinüber. Beinahe hatte ich Angst davor zu sehen, dass diese furchtbaren Worte ihm seinen kurzen Anflug von Fröhlichkeit wieder genommen hatten. Aber Kadir überraschte mich. »Und jetzt erst recht!«, flüsterte er so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. Trotzdem musste ich breit grinsen. »Jetzt erst recht!«
Wir holten mein Gepäck vom Berghang und machten uns sofort auf den Weg. Der Eingang zur Unterwelt befand sich wenige Meilen nördlich von Sakkara. Diese ungenaue Wegbeschreibung war alles, was ich hatte. Der Rest bestand aus guten Augen und einem Quäntchen Glück. Wir mussten in der kurzen Zeitspanne, in der das Tor sich zeigte, so nah dran sein, dass wir es durchqueren konnten. Nur in den zehn Minuten, in denen das letzte Sonnenlicht die Erde erhellt, würde das Tor sichtbar werden. Als ob diese Aufgabe nicht schon schwer genug wäre, gab es laut den Überlieferungen auch noch Torwachen, mit denen nicht zu spaßen war. Sie wiesen jeden ab, der nichts in der Unterwelt zu suchen hatte. Zu dieser
›Nichtszusuchen‹-Gruppe gehörten wir beide ohne jeden Zweifel auch. Ich schaute zu Kadir, der einen entschlossenen Gesichtsausdruck aufgesetzt hatte. Neuer Mut durchströmte mich. Gemeinsam würden wir einen Weg finden. Da war ich mir ganz sicher.
Wir liefen bereits eine Stunde durch die nächtliche Wüste, als das dumpfe Dröhnen der Hörner hinter uns erklang.
»Was ist das?« Mein Blick ruckte erschrocken zu Kadir. Automatisch beschleunigte ich meine Schritte. Er zuckte nur mit den Schultern und klopfte auf seine Tasche. »Mich werden sie wohl nicht so schmerzlich vermissen, wie das hier.«
»Was ist das hier?« Mir wurde ganz mulmig. »Kadir, was hast du in dieser Tasche?« Ich sah bereits Heerscharen von berittenen Rachekriegern hinter uns herjagen.
Kadir erkannte wohl das Entsetzen in meiner Miene, als er mir eine Ecke des reich verzierten Einbandes zeigte. Er hob mir besänftigend die Handflächen entgegen. »Sie werden uns nicht folgen, solange das Mundöffnungsritual für den Pharao noch nicht vollständig vollzogen wurde. Alle müssen daran teilnehmen, außer dem Koch und mir natürlich.« Er grinste. »Du siehst, uns bleibt genügend Zeit, damit wir uns in der Duat in Sicherheit bringen können.«
Ich entspannte mich wieder und atmete tief durch. »Es ist schon sehr makaber, dass die Unterwelt uns mehr Sicherheit zu bieten scheint als die Welt, in die wir geboren wurden.«
Kadir rempelte mich spielerisch an. »Wir werden sehen, vielleicht richten wir uns da unten ja häuslich ein.«
Der Klang der Hörner verfolgte uns noch lang. Aber Kadir schien Recht zu behalten. Niemand folgte uns. Trotzdem schaute ich mich immer wieder um. Vorsicht konnte nicht schaden.
Wir liefen in der Nacht und ruhten tagsüber im Schatten, wenn die Hitze der Sonne uns zu ersticken drohte. Bei Dunkelheit waren die Gefahren der Wüste schlechter zu erkennen. Schlangen, giftige Skorpione und Sandwürmer krochen dann aus ihren Löchern und warteten nur auf unbedarfte Reisende. Trotzdem gab es keine Alternative. Nur im kühlenden Mondlicht kamen wir zügig voran und schonten unsere Kräfte.
Von den Händlerrouten am Nil musste ich mich selbst nachts fernhalten. Es war nicht sicher für eine Dschinda, sich unter Menschen zu begeben. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung. Wenn mich etwas als Dschinda verriet, würde ich gnadenlos getötet werden. Bilder versuchten, sich aus meinem Geist an die Oberfläche zu graben, aber ich drängte sie zurück. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit. Es gab keinen Grund, den Dämonen meiner Vergangenheit einen Platz einzuräumen. Ich musste stark sein und das Richtige tun. Vorsichtig warf ich einen Blick nach rechts. Quälten Kadir auch Erinnerungen? Jetzt, in diesem Moment, sah er glücklich aus. Er bemerkte wohl, dass ich ihn ansah, und lächelte offen. Auch mein Mund verzog sich zu einem Grinsen. Ich war froh, ihn an meiner Seite zu haben.
Kadir und ich sprachen nicht viel miteinander. Aber das Schweigen zwischen uns war nicht so, dass ich mich unwohl fühlte. Im Gegenteil, es fühlte sich an, als schweißte es uns mit jedem Schritt enger zusammen. Als wären wir blind aufeinander eingestimmt, wusste jeder, was seine Aufgaben waren. Es gab keinen Grund, diese Einheit durch Gespräche durcheinanderzubringen.
In der dritten Nacht unserer Reise kamen wir an eine Oase. Wie in den fantastischen Märchen, die meine Mutter mir immer vorgelesen hatte, rauschten junge Palmen im kühlen Nachtwind. Eine Quelle speiste ein Becken, das so klein war, dass ich es mit zwei bis drei kräftigen Schwimmstößen durchqueren hätte können. Das Wasser kam direkt aus den Felsen und plätscherte fröhlich über die Steine, bevor es sich in kleinen Wellen in den Teich ergoss. Das Licht des Mondes brachte die Wellen zum Funkeln, als wären sie aus Edelsteinen gemacht. Um die Quelle wuchs saftig grünes Gas. Es raschelte bei jedem unserer Schritte. Fast erwartete ich, einen weiblichen Wassergeist als Herrin dieses wunderschönen Fleckchens Erde vorzufinden. Aber so sehr ich auch nach ihr Ausschau hielt, ich konnte sie nicht entdecken. Wir waren allein. Nur ein paar Frösche und schillernde Libellen leisteten uns Gesellschaft.
»Sollen wir?«, fragte ich mit Vorfreude in meiner Stimme.
»Ich weiß nicht. Ich kann nicht schwimmen.«
»Dann werde ich mal nachschauen, wie tief das Wasser ist.« Behände entledigte ich mich meiner Tasche und zog mir die Tunika über den Kopf.
»Was tust du da?« Fast panisch hörte ich den Ausruf von Kadir hinter mir.
»Keine Angst, ich lasse meine Unterkleidung an. Du wirst nichts von mir zu Gesicht bekommen, das deine Tugend gefährden könnte.« Ich kicherte und hüpfte ins Wasser. Es war kühl, aber nicht kalt. Einfach eine Wohltat. Ich ließ mich nach vorn fallen. Mein Körper wurde augenblicklich vom Nass verschluckt. So lange wie möglich hielt ich die Luft an und genoss dieses schwerelose Gefühl. Erst Kadir holte mich zurück in die Realität. Mit einem lauten Klatschen brachte er das Wasser im Becken in Bewegung. Ich wurde herumgewirbelt, bevor starke Arme mich packten und an die Oberfläche hoben.
»Samira, ist alles in Ordnung?« Kadir hielt mich an sich gepresst und schleppte mich zurück ans Ufer.
»Was denkst du, dass du da tust?«
»Ich rette dich.«
»Ja, vielen Dank auch, aber das war nicht nötig. Ich bin eine ganz passable Schwimmerin und wie du gerade selbst bemerkst, ist das Wasser nicht sehr tief.« Ich grinste ihn frech an. »Aber wo du schon mal im Wasser bist, kannst du es doch jetzt einfach genießen, oder?«
Kadir blieb wie angewurzelt stehen und starrte zu mir herunter. Ich lag noch immer in seinen Armen und das schien ihm wohl gerade auch bewusst zu werden.
Kapitel 4
Kadir
Ich war wie vom Blitz getroffen. Gerade noch hatte ich alle meine Ängste über Bord geworfen. Todesmutig hatte ich mich in die Fluten gestürzt, um Samira zu retten. Und jetzt lag sie hier in meinen Armen und lächelte wieder dieses wunderschöne Lächeln, das mir den Atem stocken ließ. Dass ich ihre nackte Haut an meinen Händen spürte, machte es auch nicht gerade besser. Was hatte ich mir nur dabei gedacht?
Ich ließ sie los, als hätte ich mich an ihr verbrannt. Mit einem Platschen schloss sich die Wasseroberfläche über ihr und ich versuchte, mich zurück zum Ufer zu kämpfen.
Plötzlich packte etwas meine Knöchel und zog so fest daran, dass ich das Gleichgewicht verlor und wie ein gefällter Baum umfiel. Prustend kam ich an die Wasseroberfläche und wischte mir das Wasser aus den Augen. Samira hielt sich vor Lachen den Bauch. Dieses kleine Biest, diesen Hinterhalt sollte sie mir büßen. Mit zwei großen Schritten pflügte ich durchs Wasser, packte sie an der Hüfte und warf sie in die Mitte des Sees. Das Wasser spritzte hoch auf und Samira strampelte wild mit den Beinen, um ihr Gleichgewicht wieder zu finden. Sie kämpfte sich auf die Füße. Nun musste ich auch lachen. Ihre Haare hingen ihr wirr ins Gesicht. Wasserlinsen zauberten grüne Punkte hinein und um ihren Bauch hatte sich eine Seerose gewickelt. Die Arme vor der Brust verschränkt, sah sie aus, wie ein niedlicher Wasserneck.
Im nächsten Augenblick wurde ihre Miene ernst. Ihr Blick wanderte über meinen Oberkörper und ich ahnte, was sie sah. Hunderte dicke und dünnere Narben bedeckten meine Brust, meinen Bauch und was sie aus ihrer Position nicht sehen konnte, besonders meinen Rücken. Manche von ihnen waren erhabene dicke Wülste. Einige schnitten tiefe Gräben in meine Haut. Sie erzählten ihre eigene Geschichte über mein Leben im Tempel. Ich senkte den Blick. Ich schämte mich für den Anblick, den ich bot.
Ihre Bewegungen ließen Wellen über meinen Bauch schwappen. Ging sie, um den Anblick meiner Gestalt verdauen zu können?
Ich zuckte erschrocken zusammen, als ich ihre Hand an meiner Wange spürte. Wasser perlte von ihren Fingerspitzen und tropfte auf meine Schulter.
»Es tut mir leid«, flüsterte ich.
»Was sollte dir denn leidtun?« Wie konnte ihre Stimme trotz meines Anblicks noch so viel Wärme enthalten?
»Dass ich dir nicht vorher gesagt habe, mit was für einem Monster du die Reise antrittst.«
»Schäme dich nie dafür, Kadir. Diese Narben sind die Zeichen deiner Stärke. Schämen müssen sich die, die sie dir zugefügt haben. Sie sind die Monster.« Sie nahm mein Gesicht in beide Hände und wie schon im Tempel zwang sie mich, ihr in die Augen zu sehen. Ich fand in ihrem Blick so viel, aber nichts davon war Abscheu oder Ekel. Einmal glaubte ich, einen Hauch Traurigkeit zu sehen, aber mit einem Wimpernschlag war das aufrichtige Leuchten ihrer grünen Augen wieder da.
»Ich bin so froh, dich gewählt zu haben. Niemand hätte diese drei Wünsche mehr verdient als du.«
Mit diesen Worten stieg sie aus dem Wasser und ließ mich mit meinem flatternden Herzen und dem ungläubigen Kreischen meiner Gedanken allein. Ich blinzelte. Hatte ich mir diesen Moment nur eingebildet? Ich hatte bereits von ähnlichen Geisteskrankheiten gelesen.
»Kommst du auch raus aus dem Wasser? Du erkältest dich sonst noch.« Ich drehte mich um und sah Samira neben einer der Palmen stehen. Sie hatte sich ihre Tunika wieder übergeworfen und sammelte gerade abgestorbene Pflanzenteile und das wenige Holz, das es hier zu finden gab. Für ein kleines Feuer würde es reichen. Vielleicht konnte ich uns aus dem Trockenfleisch eine Suppe kochen.
Bei diesem banalen Gedanken wurde mir endlich klar, dass ich mir nichts eingebildet hatte. Weder Samira, noch diese Oase entsprangen meiner Fantasie, denn so etwas Schönes hätte ich mir niemals ausdenken können. Wir entschieden uns für eine kalte Mahlzeit, aber ich kochte uns einen wärmenden Tee.
Nach dem Essen zeigten sich bereits die ersten Zeichen der aufgehenden Sonne am Firmament. Jetzt konnten wir die Reise nicht fortsetzen, ohne bei dem beschwerlichen Fußmarsch unter der Wüstensonne gegrillt zu werden, also blieben wir.
Am Morgen rissen Stimmen uns aus dem Schlaf. In Windeseile bedeckten wir die vor Stunden verloschene Feuerstelle mit Sand und abgestorbenen Blättern. Schweigend rafften wir unsere Sachen zusammen und versteckten uns hinter dem Felsen, aus dem die Quelle noch immer vergnügt heraussprudelte. Keine Minute zu früh, denn schon kamen Kamele in unser Sichtfeld. Vier Reiter ließen die massigen Tiere knien und stiegen aus den Sätteln.
»Wie konntet ihr ihn entkommen lassen? Gerade jetzt?«, herrschte eine Frau jemanden an. Zu meinem Entsetzen erkannte ich den Hohepriester, dessen Kopf so tief gebeugt war, dass seine Krone aus Federn, Trockengräsern und Papyrus fast von seinem Kopf fiel.
»Es tut mir schrecklich leid. Wir wollten erst den Pharao für seine Reise vorbereiten und ihm dann sein weltliches Gepäck hinterherschicken. Er sollte lebendig mit in die Grabkammer eingemauert werden.«
»Warum nicht ein Messer in den Rücken und ab in die Wüste?«
»Bedenkt doch, wer er ist, Eure Hoheit.«
»Der Spross dessen, dem ich genauso das Leben nehmen ließ. Du kannst dir meiner Wut nicht vorstellen, als ich in deinem ach so tollen Tempel eintreffe, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und dann erfahren muss, dass das Bürschchen einfach so weggegangen ist.« Ihre Augen sprühten vor Zorn.
»Jetzt muss ich mich durch die Wüste plagen, um deinen Fehler wieder gutzumachen.« Sie schlug dem Priester ins Gesicht. Seine Krone landete vor einem der Kamele. Das Tier nutze die Gunst der Stunde und zerkaute die anscheinend sehr schmackhafte Kopfbedeckung mit einem zufriedenen Röhren.
Jeden anderen hätte der Oberste meines Tempels sicherlich für diese Schmach getötet, aber vor dieser Frau buckelte er weiter, wie ein geschlagener Esel.
»Vielleicht sollten wir ihn einfach gehen lassen. Wo soll er denn hin? Er hat weder Geld noch irgendwelche Fähigkeiten, die es ihm möglich machen, eine Anstellung zu finden.«
»Dann geht es ihm ja genau wie dir. Als ich dich von der Straße aufgesammelt habe, konntest du nichts, als deine Hand ausstrecken und um Almosen bitten. Nur für einen Zweck erhob ich dich in die sehr angenehme Position des Hohepriesters. Ich habe dir vertraut! Und wie dankst du es mir?« Sie bohrte ihm die mit Edelsteinen und Goldschmuck verzierten Finger in die Brust. »Du solltest nur dafür sorgen, dass der Junge stirbt oder zumindest diesen Tempel nicht lebend verlässt.«
»Glaubt mir, ich habe alles versucht, damit sein Körper von selbst den Lebensgeist aushaucht. Die Götter beschützen ihn.«
»Was ist das für eine Idiotie? Die Götter interessieren sich nur für sich selbst. Sonst hätten sie längst eingegriffen. Du kannst dir gewiss sein! Es ist ihnen egal, wer auf dem Thron sitzt.«
Samira tippte mir auf die Schulter. Ganz auf dieses Gespräch konzentriert, zuckte ich unter der leichten Berührung zusammen.
Mit dem Kopf wies Samira in Richtung einer nahe stehenden Felsformation. Ich verstand, dass sie Abstand zwischen sich und die Oase bringen wollte. Dieses Fleckchen Erde war seit der Ankunft dieser Personen nur noch mit Hass behaftet. Die Wirklichkeit hatte den Traum eingeholt. So leise wie möglich schlichen wir davon.