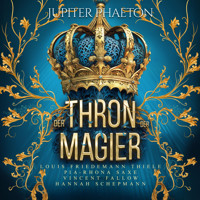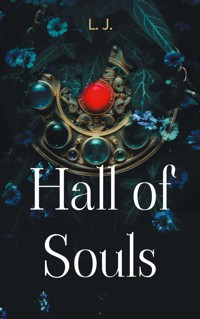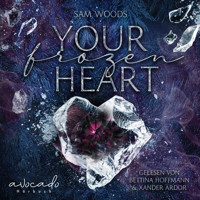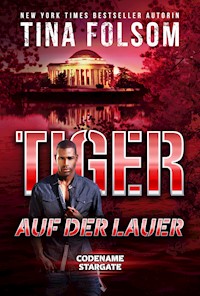7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Was Liebe verband, können Welten nicht trennen.
Die 16-jährige Anouk Parson lebt in dem alten Herrenhaus »Himmelshoch«, in dessen Kellergewölbe ein furchteinflößender Maelstrom seine Runden dreht. Sowohl ihr Vater als auch der eigensinnige Sander gehören dem Wächterzirkel an, der die Welt vor dem Ausbruch der Wasserfluten beschützt. Anouk ahnt nicht, dass Sander – den sie überall als ihren Bruder ausgibt – in Wirklichkeit ein viel größeres Geheimnis wahrt, das mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun hat. Als Sander sie eines Tages küsst, erfährt Anouk nicht nur von seiner heimlichen Liebe zu ihr, sondern auch von der gefährlich schönen Welt, die hinter dem Maelstrom liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Ähnliche
TANJA HEITMANN
TIAMAT
Liebe zwischen den Welten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. cbt ist der Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2013
© 2013 cbt Verlag, Münchenin der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagkonzeption: Dipl.-Des. Kathrin Schüler
Umschlagmotiv: Istockphoto/Vladimir Piskunov;
Shutterstock (Eliks, Anna Tyukhmeneva)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
MG · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-08752-4V003
www.cbt-jugendbuch.de
Für Rose, eine Dame von Welt
For my true love is a man
Who never existed at all
Vienna Teng
Prolog
Wer nicht wusste, worum es sich bei dem Bild handelte, sah nur blaue und dunkelgraue Kreise, die sich zu dem schwarzen Auge in der Mitte hin immer mehr verengten. Obwohl das Werk eindeutig von Kinderhand stammte, entwickelte es eine erstaunliche Sogwirkung. Daran änderte auch das blau schillernde Gitter nichts, das über dem kompletten Bild lag, als solle es den Betrachter schützen. Während das blaue Liniennetz trotz seiner Komplexität sorgfältig ausgearbeitet war, bestand der Strudel aus groben Strichen, als habe sich der kleine Künstler nicht länger als nötig mit dem verstörenden Motiv aufhalten wollen. Oben am Rand des Blattes prangte in unregelmäßigen Druckbuchstaben ein Name: Tiamat.
Filippa Margold ertappte sich dabei, das Bild schon viel zu lange anzustarren. Das von den Buntstiftstrichen wellig gewordene Papier schien zwischen ihren Fingern feucht zu werden. Als würde das dunkel kreisende Blau sie benetzen. Reine Einbildung, erkannte Filippa sofort. Schließlich war Tiamat tatsächlich hinter einem blauen Gitter gefangen. Mit einiger Anstrengung löste sie den Blick von der Zeichnung und betrachtete stattdessen das Mädchen, das vor ihr stand und aufgeregt von einem Bein aufs andere trat. Sie ist unleugbar die zehnjährige Ausgabe ihrer Mutter Madelin. Und damit meinte sie nicht nur das volle Lockenhaar des Mädchens, sondern auch diese bestimmte Erwartungshaltung, dass schon alles richtig sein würde, was es tat. Darin hatte sich auch Madelin schwer getäuscht – und ihre Tochter machte den gleichen Fehler, als sie die Wächterin im Esszimmer von Himmelshoch abgefangen und ihr das Kunstwerk gezeigt hatte.
»Und diese Zeichnung hast auch wirklich du angefertigt, Anouk?«, vergewisserte sich Filippa.
Anouk nickte so eifrig, dass ihre Locken wippten. »Ja, damit Sie wissen, wie Tiamat aussieht. Ich dachte, das hilft Ihnen vielleicht dabei, weil Sie nicht zu ihr können …«
Das Mädchen hielt abrupt inne, als Filippa die Zeichnung der Länge nach durchriss. »Mein liebes Kind, ich befürchte, du hast die Regeln nicht wirklich begriffen. Oder was ich noch sehr viel schlimmer fände: Du nimmst sie nicht ernst.«
»Doch, das tue ich.« Anouk kämpfte standhaft gegen die Tränen an, die ihr in den Augen standen. Mit einer solchen Zurechtweisung hatte sie zweifelsohne nicht gerechnet, sondern vielmehr mit einem Lob für ihre Bemühung. »Ich nehme die Regeln der Wächter ernst, aber warum darf man nicht versuchen, sie besser zu verstehen, oder auch mal nachfragen, wenn einem etwas unsinnig erscheint? Diese ganze Geheimniskrämerei …«
»… ist überlebenswichtig«, schloss Filippa den Satz für sie. Genauso stur wie Madelin. Eine Schande, dass sie so wenig vonseiten der Parsons mitbekommen hat. »Du bist zwar noch ein Kind, Anouk, aber du musst dennoch begriffen haben, wie heikel die Angelegenheit ist. Oder muss ich dich daran erinnern, dass dein Vater seine halbe Hand verloren hat, weil er sich nicht an unsere Regeln hielt?«
Endlich senkte das Kind den Kopf. »Nein.«
»So, wie ich das sehe, wird aus dir niemals eine Wächterin werden. Das ist eine Schande, nachdem so viele Generationen der Parsons dem Zirkel treu gedient haben. Es ist aber auch kein Weltuntergang, schließlich gibt es bereits einen würdigen Nachfolger für deinen Vater. Wenn du jedoch in Himmelshoch bleiben willst, solltest du aufhören, unsere Vorgehensweise infrage zu stellen. Ansonsten …«
Filippa ließ die Drohung unvollendet im Raum stehen, wohl wissend, dass dieses Mädchen sich schon allein ausmalen würde, welche Konsequenzen ein erneuter Regelverstoß nach sich ziehen würde. So schlau war sie zweifelsohne. Außerdem musste Filippa sich beeilen, denn sie hörte Schritte im Flur – und Jakob Parson würde es sicherlich nicht gutheißen, dass eine junge ehrgeizige Wächterin so mit seiner Tochter umsprang.
»Ich werde machen, was Sie sagen.« Anouks Stimme war nicht mehr als ein Flüstern. »Wenn ich dafür auf Himmelshoch bleiben darf, obwohl ich keine Wächterin werde.«
Es ist einfach, das Regelwerk des Wächterzirkels zusammenzufassen: Das Tor darf zu keiner Zeit unbewacht sein. Lass nichts und niemanden raus, lass nichts und niemanden rein.
Wer die Wächter jedoch sind und was sie tun, steht auf einem anderen Blatt.
Ich weiß einiges, aber bei Weitem nicht alles. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen will. Oder ob es noch eine Rolle spielt …
1. Ein ungebetener Besucher
Schon klar, ich hätte es kommen sehen müssen.
Normalerweise hätte ich ja auch gar nicht dort gestanden … Jedenfalls nicht eine Sekunde länger als nötig, wenn ich mich an die Absprache gehalten hätte, in einem solchen Fall sofort und ohne Zögern in den sicheren Raum zu flüchten.
Absprachen sind eine Sache, ein krakenartiges Etwas von den Ausmaßen eines Kleinwagens auf dem heimischen Dachboden eine ganz andere. Vor allem sobald dieses Etwas versucht, eine Form anzunehmen, mit der man sich leichter über die rissigen Deckenbalken bewegen kann. Die langen, sich grazil bewegenden Tentakel sahen schlicht zu faszinierend aus! Wie ein Designervorhang pendelten sie herab, während der Kopf des Kraken von unsichtbaren Mächten eingedrückt und gewrungen wurde, während er langsam seine Form veränderte. Als hätte das nicht ausgereicht, um einen zu bannen, verursachte das Geschöpf glitschige Geräusche von der Sorte, bei der man eine Gänsehaut bekommt und sich schütteln möchte.
Kurzum, es war einfach zu fesselnd, um mich aus dem Staub zu machen.
Dabei herrschte an Spannung eigentlich kein Mangel in meinem Leben.
Jetzt gerade noch weniger als zuvor, denn der Krake begnügte sich nicht damit, dekorativ zwischen den Deckenbalken hängen zu bleiben.
Warum auch, wenn es in seiner unmittelbaren Nähe einen Appetithappen wie mich gab?
Ein schlanker Arm schwebte auf mich zu, ganz gemächlich, als stände es gar nicht zur Debatte, dass ich die Flucht ergreifen könnte. Kein Wunder, schließlich stand ich stocksteif da, den Mund zu einem stummen O geformt und von dem verrückten Wunsch beseelt, die glänzende Oberfläche des Arms zu berühren, unter der bläuliche Schlieren trieben. Bestimmt fühlt es sich wie Wackelpudding an, dachte ich, dann übernahm endlich mein Restverstand die Führung. Mit einem lauten Knall ließ ich den Bücherkarton fallen, den ich eigentlich zwischen dem Gerümpel hatte verstauen wollen.
Die Spitze des Arms kringelte sich ein, dann schoss sie vor.
Ich schrie und wich wenig elegant aus, indem ich mich auf den Hintern plumpsen ließ.
Der Arm rollte sich ein, und als er sich erneut nach mir ausstreckte, bekam ich noch mit, dass ihm Dornen wuchsen. Dann konzentrierte ich mich darauf, dass meine Beine und Arme sich nicht verhedderten, während ich auf allen vieren den Rückzug antrat.
Gerade als ich die Luke zur Treppenstiege erreichte, erklang ein schlürfender Laut, der nichts Gutes verhieß. Der Krake hatte die Verfolgung über das Dachgebälk aufgenommen. Und er war verflixt schnell, trotz seines deformierten Kopfs und der spröden Unterlage. In meiner Panik stürzte ich mich kopfüber in die Luke, machte einen schrägen Überschlag und landete irgendwie auf den Füßen, wobei meine Waden schmerzhaft gegen die untersten Leiterstufen schlugen. Ich hob mir das Jammern für später auf und stolperte stattdessen den Flur entlang, die Arme weit ausgestreckt für den Fall, dass ich die Kurve bei diesem Tempo nicht bekam.
Und hohes Tempo war vonnöten, wie mir ein Blick über die Schulter bestätigte. Dunkelblaue, dornenbesetzte Tentakel mit pfeilspitzen Enden quollen durch die Dachbodenöffnung. Das Bedürfnis, sie zu berühren, war mir endgültig vergangen.
Ohne Rücksicht auf meine Fingernägel krallte ich mich in die altersschwache Stofftapete und flog um die Ecke.
Vor mir lag der Flur des Obergeschosses, der in einer geschwungenen, nach unten ins Foyer führenden Treppe endete.
Einsam und verlassen lag die Treppe da.
Das war ja mal wieder typisch.
Ich hielt inne, um meine Lungen mit Luft zu füllen, und dann brüllte ich das einzige Sinnvolle in meiner Situation: »Sander, wo zur Hölle steckst du? Beweg deinen Hintern ins Obergeschoss. Sofort!«
Auf das ›Sofort‹ ließ ich ein schrilles Kreischen folgen, weil mir just in diesem Moment auf die Schulter geklopft wurde. Von etwas, das pieksig und glibschig zugleich war. Ich verschwendete keine Zeit damit, mehr über den Klopfer in Erfahrung zu bringen, sondern sprintete los. Nur dass sich der Tentakel nicht abschütteln ließ, er grub seine Dornen wie eine Klette durch das Shirt in meine Haut. Instinktiv fasste ich zu, um ihn abzuwehren. Doch das war ein Fehler, denn die Dornen stachen auch auf der Oberseite heraus. Abgelenkt durch Schmerz und Ekel knallte ich mit der Hüfte gegen den asiatischen Hochzeitsschrank mit seinem Bambusrahmen und stürzte der Länge nach zu Boden.
Während ich noch fiel, hörte ich wildes Hundegebell und Schritte auf den ausgetretenen Holzstufen.
Endlich, dachte ich.
Dann holte der Krake den Arm, an dem ich hing, ein und schleifte mich über den Boden. Es gelang mir, mich an der Truhe festzuklammern, allerdings nur für wenige Sekunden, denn der Arm war zu stark und ich – außer Atem und zittrig durch den brennenden Schmerz – zu schwach. Lediglich ein paar Schritte von mir entfernt türmte sich ein ganzes Knäuel von Fangarmen auf, in dem ich gleich enden würde, umgeben von dem Geruch nach tiefen Wassern. Mein letzter Versuch, mich mit den Füßen bei einem der vorbeiziehenden Türrahmen einzuhaken, scheiterte. Ich brachte nicht einmal mehr die Kraft auf, zu schreien, als endlich ein Schemen auf vier Pfoten neben mir auftauchte und der Tentakel seine Spannkraft schlagartig verlor.
Unsere Bulldogge Lutz hatte zugeschlagen!
Entspannung war allerdings nicht angesagt, denn schon im nächsten Moment schlang sich etwas fest um meinen Fußknöchel.
Sehr fest.
Ich trat mit dem freien Bein blind zu und fand ein Ziel, das zu meiner Überraschung kein bisschen weich war. Ganz im Gegenteil.
»Shit. Anouk, was soll der Blödsinn, warum trittst du nach mir?«
Benommen drehte ich mich auf den Rücken und sah Sander an, der seine von meinem Absatz getroffene Brust rieb. »’Tschuldigung, das war Instinkt.«
»Instinkt? Du hast keine Instinkte, Mann, ansonsten würdest du jetzt wohl kaum flach auf dem Rücken liegen, sondern dich aufrappeln und wegrennen.«
Genervt zerrte Sander mich aus der Reichweite des Kraken, dessen Tentakel nach Lutz’ Angriff starr in der Luft verharrten. Ein Kraftpaket wie unsere englische Bulldogge war auch wirklich atemberaubend, vor allem wenn aus ihrem Maul ein Stück zuckender Tentakel herauslugte. Das war mal eine saubere Kriegserklärung! Und das, obwohl locker ein Dutzend Lutze in den Kraken gepasst hätten. Von solchen Nebensächlichkeiten ließ sich der Bully jedoch nicht beeindrucken, der dämliche Hund hatte schlicht kein Gespür für Gefahr. Seiner Meinung nach war er das mit Abstand gefährlichste Wesen vor Ort.
»Was bist du bloß für ein mieser Wächter?«, fuhr ich Sander an, der mich in Richtung Treppe manövrierte. »Dieses Monster wird Lutz fressen!«
»Blödsinn, denn im Gegensatz zu dir hat der Hund Instinkte.« Sander packte mich unter den Achseln, als ich in mich zusammenzusinken drohte. Ich war für solche Aktionen einfach nicht geschaffen. Unsanft hielt er mich in der Senkrechten, während der Krake seine Schockstarre überwand und mehrere Tentakel gleichzeitig auf Lutz abfeuerte, was dem Hund nicht mehr als ein Knurren entlockte, bevor er in den erstbesten Tentakel biss. »Und ein verdammt großes Ego hat er auch. Jetzt hau endlich ab, Anouk.«
»Gern, sobald du deine Pfoten von mir nimmst.«
Sander zog seine Hände so hastig zurück, als hätte ich mich in null Komma nix in einen stachligen Wabbelkraken verwandelt.
Ich sackte keuchend auf die Knie.
Ohne mich weiter zu beachten, machte Sander kehrt und brach im Vorbeilaufen einen der Bambusstäbe aus der Umrahmung des Hochzeitsschranks.
Unterdessen baute sich das Ungeheuer zu seiner vollen Größe auf, wobei sein Kopf nicht länger an eine eingedellte Tube voll blauem Gelee erinnerte, sondern den groben Umriss eines Mannes angenommen hatte, dessen Unterkörper anstelle von Beinen in unzähligen Tentakeln endete. Die Arme zeichneten sich bereits ab, waren aber noch mit den Seiten verwachsen. Als er jedoch den heranpreschenden Sander erblickte, spreizte er sie ab und öffnete seine Hände, in deren Innenflächen zwei Münder voller Zähne klafften.
Kurz vor dem Krakenmann blieb Sander stehen, hob den Bambusstab auf Brusthöhe, zielte und warf ihn mitten in die dunkelste Stelle des Leibes, die gleichmäßig pulsierte. Der Stab versank bis zur Hälfte mit einem schmatzenden Geräusch und für einen Moment fielen die reißzahnbewehrten Arme schlaff herab. Dann packten sie den Stab und zogen ihn heraus, während das Wesen auf seinen Tentakeln die Wand seitwärts hinaufzurutschen begann.
Der Anblick, wie Sanders Schulterblätter vor Schreck unter seinem Shirt zusammenzuckten, war eine Rarität, einfach, weil er äußerst selten überrascht war.
»Was hast du in Bio gemacht, Bleistifte auf der Nasenspitze balanciert? Kraken haben nicht bloß ein Herz und Schluss, da gibt es noch zwei weitere«, klärte ich ihn auf.
»Du bist ja immer noch da.« Sander warf mir einen giftigen Blick zu. »Willst du unbedingt noch einmal gerettet werden?«
Ich sparte mir eine Antwort und rutschte auf meinem Hinterteil die Treppenstufen runter, weil ich meinen Wackelbeinen nicht über den Weg traute. Ganz anders als die beiden Tentakelzähmer war ich keine Kämpfernatur, mir wurde allein bei der Vorstellung schummerig, mich mit jemandem körperlich zu messen. Was auch immer Sander anstellte, um an die zwei Kiemenherzen zu gelangen, davon wollte ich nach Möglichkeit kein Zeuge werden. Das Letzte, das ich noch mitbekam, war, wie der Krakenmann sich von der Flurdecke auf Sander fallen ließ und Lutz loskläffte, als gäbe es seine Lieblingspansensorte als Leckerli.
Irgendwann verstummte der Lärm aus Rappeln, Sanders Flüchen und Lutz’ laut kundgetaner Hundebegeisterung im Obergeschoss, und ich konnte aufhören, mein Nagelbett blutig zu knabbern. Das war ohnehin eine Angewohnheit, die ich mir dringend abgewöhnen musste – nicht nur weil Sander sich jedes Mal über meine Sorgen lustig machte, sondern weil ich mir selbst keine Sorgen machen wollte. Zumindest nicht um ihn, bei Lutz war das was anderes, den liebte ich schließlich heiß und innig. Sander hingegen wusste, was er tat. Nun gut, manchmal auch nicht, aber das hatte ihn bislang noch nie in Verlegenheit gebracht.
Trotzdem hatte ich meinen Zeigefingernagel fies eingerissen, als kurze Zeit später die Dusche im Badezimmer anging. Ich schloss daraus, dass an diesem Tag mit keinen weiteren Krakenattacken mehr zu rechnen war und ich den sicheren Raum im Untergeschoss wieder verlassen durfte. Ins Obergeschoss, wo mein Zimmer lag, mochte ich trotzdem noch nicht gehen, also verzog ich mich in die Küche. Dort kümmerte ich mich um meine zerstochene Hand und die geschwollene Schulter, deren Haut gerötet und mit lila Pünktchen übersät war. Zu meiner Erleichterung hatten die Dornen auf den Tentakeln kein Sekret oder Ähnliches in den Wunden hinterlassen, sodass schon bald nichts mehr von der Verletzung zu sehen sein würde. Allerdings war ich immer noch ordentlich aufgewühlt und meine Hände zitterten. Deshalb beschloss ich, ein Ablenkungsmanöver mit meinem Bedürfnis nach Süßem zu paaren: Ich backte Muffins.
Ich war gerade dabei, Schokoflocken in den Teig zu rühren, als Lutz an der Küchentür kratzte. Unsere weiße Bulldogge mit den rehfarbenen Flecken machte, im Gegensatz zu mir, nur einen leicht angeschlagenen Eindruck und ließ, ohne Gewinsel, ihre Blessuren untersuchen. Allerdings verschmähte Lutz den Klecks Muffinteig in seinem Napf, mit dem ich ihm was Gutes tun wollte. Stattdessen verkroch er sich in seinem Korb neben dem Ofen, von wo aus das tiefe Grummeln seines Bauchs verriet, dass gerade eifrig Tentakel verdaut wurden.
Allein bei der Vorstellung schüttelte es mich und – ›ping‹ – kündigten sich die ersten Herpesbläschen auf meiner Oberlippe an, die ich immer bekam, wenn ich mich ekelte. Bitte nicht! Verzweifelt bemühte ich mich, an Schokolade anstelle von fischigem Glibber zu denken, was sich als richtig schwierige Aufgabe herausstellte. Denn kaum waren meine Sinne auf fluffiges Gebäck eingestellt, blitzte der mutierte Krakenmann vor meinen Augen auf, dessen Zähne in den Handflächen sich auch liebend gern in etwas Leckerem vergraben hätten. Vorzugsweise in Mädchen mit Korkenzieherlocken. Dieses Erlebnis würde mich zweifelsohne noch eine Zeit lang verfolgen.
Sander fand den Weg in die Küche, als ich die Muffins gerade zum Auskühlen auf ein Gitter schob. Sein Gesicht war übersät mit feinen Schnitten und lila Punkten, an seinem Nasenflügel klebte ein Rest Blut, und beide Hände sahen aus, als hätte er sie in kochendes Wasser gesteckt. Nichts davon schien ihn zu kümmern, in dieser Hinsicht war er entweder ein großartiger Schauspieler oder bei ihm gab es dort, wo bei normalen Menschen das Schmerzzentrum saß, nur einen Sandsack, auf den man nach Herzenslust einprügeln konnte, ohne dass es ihm wehtat.
Die Augen zu Schlitzen verengt, musterte er mich, bis ihm auffiel, dass seine Brille nicht auf der Nase, sondern auf seinem Kopf saß, umgeben von verwuschelt schwarzem Haar.
Das war so typisch, dass ich es nicht einmal kommentierte. Die dunkel gerahmte Brille war überall im Haus anzutreffen, nur nie auf Sanders Nase, wo sie eigentlich hingehörte. Glücklicherweise waren seine anderen Sinnesorgane hervorragend ausgebildet, ansonsten wäre er vor lauter Blindheit gewiss schon längst einen bizarren Unfalltod gestorben. Das Einzige, was er zu hundert Prozent scharf sah, waren die Besucher von der anderen Seite des Tors. Was meiner Meinung nach kein Geschenk war.
Nachdem Sander die Brille zurechtgeschoben hatte, maß er mich erneut von Kopf bis Fuß, wobei sein Blick besonders lang an meiner malträtierten Schulter und dem mit Pflaster umwickelten Zeigefinger hängen blieb, dann ließ er sich auf seinen limonengrünen Stuhl fallen. Genau: sein Stuhl. Als ich den altertümlichen Küchentisch samt Stühlen abgeschliffen und bunt angemalt hatte, war mir gleich klar gewesen, dass Sander sich exakt das Exemplar mit der schrillsten Farbe aussuchen würde. So war es immer, obwohl er behauptete, sich nichts aus Farben zu machen. Aus Formen übrigens auch nicht, wie sein T-Shirt mit dem Testbild-Aufdruck zu den karierten Hosen bewies. Mir taten allein vom Hinsehen die Augen weh.
»Wow, und ich dachte, ich würde bereits alle geschmacklosen Kombis kennen, die dein Kleiderschrank hergibt.«
Sander zog eine Braue hoch. »Du willst über Klamotten reden? Wie wär’s damit: Zieh dir was mit Ärmeln an, ansonsten flippt Jakob aus, wenn er deine Wundmale sieht.«
»Papa wird heute den letzten Zug nehmen und nicht vor neun Uhr abends eintreffen. Bis dahin sind es noch vier Stunden. Außerdem bringt die Hitze mich um.« Der Backofen des alten Herrenhauses wurde mit Holz beheizt und verwandelte die Küche, selbst an kühlen Märztagen wie heute, problemlos in eine Sauna. Mehr als ein Trägershirt war da einfach nicht drin. »Wie sieht es oben aus?«, erkundigte ich mich.
»Umdekoriert. Diese angestaubte Kommode stand eh nur im Weg, jetzt brauchen wir sie für den Sperrmüll wenigstens nicht mehr extra zu zerlegen. Am übelsten hat es allerdings den Dachboden erwischt, auf den das Ding geflüchtet ist.«
»Hat es schon angefangen?«
»Noch nicht, es werden also weiterhin Wetten angenommen. In was wird sich der vollgerümpelte Dachboden, auf dem Mr Armfüßler sein gewaltsames Ende fand, im Lauf der nächsten Wochen verwandeln? In das größte Boudoir aller Zeiten, auf das selbst Ludwig XVI. neidisch gewesen wäre? Oder gar in ein Sternenzimmer?«
»Ein Sternenzimmer …« Das Wort zündete in mir. »Was genau meinst du damit?«
Natürlich war es albern nachzufragen, nicht nur, weil Sander mir vor lauter Coolness keine Antwort geben würde, sondern auch, weil es meine Vorfreude verriet, die ich ansonsten möglichst sorgfältig verbarg. Ich war nämlich die einzige Person in unserem Haushalt, die den Veränderungen durch die Besucher etwas abgewann. Für Sander waren sie lediglich ein Zeichen seines Versagens und für meinen Vater Jakob die reinste Verschwendung von Energie, die darüber hinaus das Risiko barg, dass jemand etwas von den Vorgängen in unserem Haus mitbekam. Schwer zu sagen, welche von beiden Vorstellungen Papa mehr auf den Magen schlug: Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden oder aufzufliegen.
Wie erwartet verzog Sander keine Miene, sondern lehnte sich über den Tisch, um sich einen Muffin zu schnappen.
Ohne zu fragen.
Warum auch? Schließlich war er der Held und ich bloß die Küchenmaid, die er zu allem Überfluss gerade erst vor dem bösen Ungeheuer gerettet hatte. Das wurmte mich mehr, als ich mir eingestand. Diese ganze Kampfkiste war nichts für mich und für gewöhnlich stand ich dazu, schließlich hatte ich dafür andere Dinge drauf. Aber dass Sander jetzt einen auf überlegen machte, weil er mir armem Lämmchen zu Hilfe geeilt war, wollte ich nun auch nicht so stehen lassen.
Sander, ein Held? Unterschreibe ich. Allerdings nur mit der Anmerkung, dass man auch über eine Daseinsberechtigung verfügt, wenn man außerstande ist, Meeresfrüchte mit Bambusstäben aufzuspießen.
Sander, cool? Ja, meinetwegen. Geschenkt.
Sander, mir generell überlegen? In hundert Jahren nicht!
Gerade als er in den Muffin biss, fragte ich deshalb voller Unschuld: »So hungrig? Wenn du ein paar Stücke vom Besucher übrig gelassen hättest, gäbe es heute gegrillten Tintenfisch zum Abendessen.«
Das war hinterhältig und gemein, aber ich freute mich trotzdem, als Sander bei dem Gedanken an Calamaris das Gesicht verzog. Dann schluckte er, als sei der Happen Schokogebäck ein Stein, und legte den Rest vom Muffin so weit weg wie möglich.
»Lass uns nicht mehr über Tentakel reden, einverstanden?«
»Kein Problem. Obwohl … Die müssen echt lecker gewesen sein, schließlich hat sich Lutz bis zum Anschlag damit vollgestopft.«
Sander hielt sich die Hand vor den Mund, während er mich wütend anfunkelte. Das konnte er gut, darin hatte er Übung.
»Eigentlich ist der Hund ja resistent, weil die Besucher nur leblose Materie verändern. Dieses Mal wäre es jedoch durchaus möglich, dass es zu viel des Guten war und Meister Sabbelschnute gegen alle Regeln mutiert«, plauderte ich unbekümmert weiter. Es war vermutlich kein schöner Zug von mir, aber ich genoss es, endlich einmal Oberwasser zu haben. Ansonsten war es nämlich stets Sander, der mich lässig vor die Wand laufen ließ. »Stell dir mal vor, dem alten Lutz wachsen plötzlich ein paar Engelsflügel. Wäre das nicht abgefahren?«
Beim Klang ihres Namens wälzte sich die Bulldogge schwerfällig auf den Rücken und gab ein pfeifendes Geräusch am unteren Ende von sich.
Sanders Grinsen war nicht mehr als eine Andeutung in den Mundwinkeln. »Dann könntest du ihn als einen weiteren Dekogegenstand in dein schickes Mädchenzimmer stellen.«
Wie aufs Stichwort war meine Überlegenheit dahin. »Wenigstens habe ich ein Zimmer und nicht wie du eine verwahrloste Höhle in den Katakomben, in direkter Nachbarschaft mit deinen fischigen Freunden, denen es in den ungünstigsten Momenten gelingt, durch das Tor zu kriechen. Oder in diesem Fall zu glitschen, und zwar so geschickt, dass du es trotz deines ach so hervorragenden Warnsystems nicht einmal mitbekommst, dass einer im Haus unterwegs ist.«
Aufgebracht knallte ich die benutzten Backutensilien ins steinerne Spülbecken, denn trotz meiner Bettelei hatte Papa es bis heute nicht geschafft, eine Spülmaschine anzuschaffen. Die Welt vor dem Untergang zu bewahren, war eben eine nervenaufreibende Angelegenheit, vor allem, wenn man noch einen offiziellen Job in einer Bank hatte. Inzwischen hatte Sander sich mit einem Geschirrtuch neben mich gestellt und begann abzutrocknen. Die Brille saß erneut schief in seinem Haar. Es kribbelte wie wild in meinen Fingern, aber ich widerstand dem Verlangen, sie ihm auf die Nasenspitze zu schieben.
»Auf die Gefahr hin, als Klugscheißer dazustehen: Ich würde nicht darauf setzen, dass es einer eh schon brüchigen Porzellanschüssel guttut, wenn man an ihr herumreibt, als sei sie Aladins Wunderlampe.«
Ichgrummeltenur,scheuerteabersicherheitshalbermit deutlich weniger Druck.
Wie ein Großteil unserer Haushaltsdinge war auch diese Schüssel ein Erbstück und hatte, wie alles von den Kronleuchtern in den Gesellschaftsräumen bis hin zum Silberbesteck, etliche Jahrzehnte auf dem Buckel, was sie in meinen Augen nur umso schöner machte. Der Rest unserer Einrichtung setzte sich zusammen aus ausgefallenen Stücken, die meine Mutter angeschafft hatte, und veränderten … Nun ja, sagen wir einmal veränderten Objekten, wie etwa die schwarze Stelle im Salonboden, in der wir so lange den Müll und die sich vorm Tor ansammelnden Salzmengen verschwinden ließen, bis sich herausstellte, dass die Dinge wieder auf dem Hinterhof des hiesigen Tante Emma Ladens herauskamen. Die Inhaberin, Frau Lorenz, verkaufte uns bis heute als Strafe nicht einmal ein lumpiges Ei. Aber wie sollten wir ihr bitte schön erklären, dass wir ihren Hinterhof keineswegs als wilde Müllkippe benutzt hatten? Das ging schlecht, ohne unser kleines Geheimnis zu lüften. Von solchen Unannehmlichkeiten einmal abgesehen, hatte unser Zuhause Charakter – und zwar in so mancher Hinsicht.
»Anouk …«, begann Sander, um sogleich wieder zu verstummen.
Trotzdem ahnte ich, worauf dieses gepresste »Anouk« hinauslaufen würde. »Fang gar nicht erst damit an«, knurrte ich.
»Du weißt genauso gut wie ich, dass an diesem Gespräch kein Weg vorbeiführt.«
»Unsinn, Papa muss überhaupt nicht erfahren, dass ich persönlich Bekanntschaft mit Besucher Tintenfisch gemacht habe.«
»Wie willst du es denn vor ihm verheimlichen?«
Das theatralische Augenrollen hatte ich mittlerweile richtig gut drauf, nur leider bekam Sander nichts davon mit, weil er zu sehr mit Abtrocknen beschäftigt war. Das Geschirr würde im Anschluss funkeln und glänzen, so, wie der sich ins Zeug legte. »Indem ich es Papa verschweige, du Genie.«
»Für dich mag das ja angehen, aber ich muss Jakob genau berichten, was passiert ist. Die Salzzeichen vorm Tor bieten nicht länger einen Schutzwall, und das Kraftfeld funktioniert auch nicht sonderlich verlässlich in der letzten Zeit, worauf du eben selbst so charmant hingewiesen hast. Ich habe viel zu spät mitbekommen, dass ein Besucher auf unsere Seite gewechselt ist, nämlich erst als du schon am Krakeelen warst. Insofern du deine Dienste nicht als neues Alarmsystem anbieten willst, wird mir gar nichts anderes übrig bleiben, als mit Jakob zu sprechen.«
S wie Sander, S wie stur, S wie scheißstur.
Ich stemmte die Hände in die Hüften. »Ein gewisser Ausschnitt des Geschehens würde vollauf ausreichen, nämlich genau ab dem Moment, in dem du den Krakenmann mit einem Bambusstab harpuniert hast. Die Vorgeschichte ist doch unwichtig, die kann man getrost unter den Tisch fallen lassen.«
»Super Vorschlag. Auf diese Weise findet Jakob zwar nicht heraus, wie es wieder einmal einem Besucher gelungen ist, unser Sicherheitssystem zu überlisten, aber das macht ja auch nichts.« Sanders Stimme war Ironie pur. »Jetzt mal im Ernst, dieser Glibberhaufen ist nicht nur durch das Tor gelangt, ohne dass Alarm ausgelöst wurde, sondern er hat es sogar unbemerkt bis unters Dach geschafft. Wenn du nicht zufällig deinem Ordnungswahn gefolgt wärst …«
Ich spritzte eine Ladung Spülwasser in Sanders Richtung.
Unbekümmert setzte er erneut an. »Wenn du nicht zufällig deiner Hausfrauenleidenschaft …«
»Entweder du hörst sofort auf damit oder ich tunke deinen Kopf in die Abwaschbrühe.« Ich war vielleicht keine Jeanne d’Arc, allzeit bereit, mich in die Schlacht gegen die Besucher zu werfen, aber von diesem Großmaul ließ ich mir nichts gefallen.
In Sanders grünen Augen war ein eindeutiges »Als ob es einem Mädel wie dir gelingen würde, mich baden zu schicken« zu lesen, aber er ließ es klugerweise dabei bewenden. Den Mund hielt er trotzdem nicht.
»Wenn du nicht zufällig in den Kraken gerannt wärst, wäre er uns vermutlich entwischt. Was das bedeuten würde, weißt du genauso gut wie ich: Es wäre der Anfang vom Ende. Jakob würde mich schlachten, bevor der Wächterzirkel ihn hinrichtet, weil er seit Jahren die Nebensächlichkeit vor ihnen verborgen hat, dass uns Besucher mit ihrer Anwesenheit beehren. Und das, obwohl er doch persönlich bewiesen hat, dass es unmöglich ist, die Barriere aus Salzzeichen zu durchqueren, und unser Tor deshalb auch kein ernsthaftes Risiko darstellt. Jedenfalls nicht so groß, dass der Wächterzirkel seine Lager in Himmelshoch aufschlägt. Deshalb müssen wir ganz genau analysieren, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass dieser Besucher unser Sicherheitsnetz ausgetrickst hat. Unsere alte Diskussion wird also zwangsläufig wiederaufgenommen, und du würdest uns allen einen Gefallen tun, wenn du dich dieses Mal nicht querstellen würdest. Das Internat, von dem Jakob sich Infomaterial hat schicken lassen, sah doch gar nicht übel aus.«
»Das hier ist mein Zuhause! Ich lasse mich auf keinen Fall abschieben. Dir mag so was ja schnurz sein, aber ich habe einen Freundeskreis, der mir wichtig ist. Da kann ich mich nicht einfach absetzen, nur weil du deinen Job vermasselt hast. Außerdem habe ich Ideen und Pläne, die mich an Marienfall binden.« Das war jetzt ein wenig hochgegriffen, darum schob ich rasch ein »Und ein Privatleben habe ich auch« hinterher.
»Anouks berühmtes Privatleben«, ächzte Sander. »Damit meinst du die Nachmittage, die du lesend in deinem Mädchenparadies verbringst, richtig?«
Ich hob drohend den Zeigefinger. »Du hast doch keine Ahnung, weil du unter Privatleben den Moment verstehst, in dem dudich mit Wodka randvoll auf irgendwelchen Partys ausschaltest.«
»Irre ich mich oder ist da eine Spur von Neid in deiner Stimme? Ach nee, du bist ja freiwillig Jakobs liebes Mädchen.«
»Genau, ich bin Papas Mädchen – auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall bleibe. Denn wenn ihr beide allein seid, verkommt ihr Männer doch innerhalb kürzester Zeit, vom armen Lutz mal ganz abgesehen. Wenn ich dich nicht unentwegt jagen würde, deinen Anteil der Hausarbeit zu erledigen, würdest du dich eines Tages wundern, warum dein Kleiderschrank keine frischen Klamotten mehr enthält und ein Müllberg dir den Weg zur Haustür versperrt. Papa hingegen würde vermutlich vor lauter Arbeit vergessen, dass er ein Mensch und keine im Dauereinsatz funktionierende Maschine ist. Auch wenn ihr beiden euch das nicht eingestehen wollt: Ihr braucht mich, weil ihr ohne mich gar nicht wüsstet, dass es abseits des Tors so was wie ein normales Leben gibt. Ich bin sozusagen die unentbehrliche Stellvertreterin der Außenwelt, dafür habe ich eigentlich einen Orden vom Wächterzirkel verdient, anstatt einer Fahrkarte nach Höhere-Töchter-Abschiebehausen.«
Leider war meine gesamte Überzeugungsarbeit für die Katz, bei Sander ging das zum einen Ohr rein und zum anderen umgehend hinaus. »Anouk, der Krake war dir wirklich verdammt dicht auf den Fersen. Wenn ich nur eine Sekunde später dazugekommen wäre …« Er brach ab, als sei mir mit Vernunft eh nicht beizukommen.
Womit er eindeutig recht hatte. Also versuchte ich ihn auf eine andere Weise zu überzeugen. »Kannst du dir das denn vorstellen: Ein Leben in diesem Haus ohne mich?«
Für einen winzigen Moment zögerte Sander, fast als würde ihm die Vorstellung zutiefst zuwider sein. Dann verhärtete sich sein Gesicht jedoch auch schon wieder. »In Himmelshoch ist es mittlerweile schlicht zu gefährlich für dich, sieh es ein.«
»Ich habe fast mein ganzes Leben in Himmelshoch verbracht, geschlagene elf von sechzehn Jahren und fünf Monaten, ohne dass mir jemals etwas Ernstzunehmendes zugestoßen ist.«
Sander berührte meine geschwollene Schulter – lediglich flüchtig, weil er wusste, wie sehr der Abdruck der Tentakel schmerzte, aber auch weil er es generell vermied, mir nah zu kommen. Trotz der leichten Berührung stöhnte ich vor Schmerzen auf.
»Es hätte noch viel schlimmer kommen können«, flüsterte er und jede Andeutung von Schalk war aus seinem schmalen Gesicht gewichen.
Schachmatt, gestand ich mir, aber nicht Sander gegenüber ein. Unter gar keinen Umständen würde ich zugeben, wie knapp ich tatsächlich entkommen war. Stattdessen drehte ich mich um und flüchtete auf mein Zimmer, wo ich mich aufs Bett warf. Falls Sander recht behielt und sich die Lage immer weiter verschlimmerte, dann würden sie mich fortschicken, dabei wollte ich um keinen Preis irgendwo anders sein. Dies war mein Zuhause, das einzige, das ich mir überhaupt vorstellen konnte. Ich war eine Parson, wir gehörten zu Marienfall wie der Salzgeruch des fernen Meeres und das flache Land. Auch wenn ich mich an die Orte, an denen wir bis zu meinen fünften Geburtstag gelebt hatten, kaum erinnerte, war ich mir trotzdem sicher, dass sie mir genauso unwichtig gewesen waren wie die Menschen, denen ich dort begegnet war. Nur hier fühlte ich mich heimisch, schlug Wurzeln, verflocht mich mit Freunden, Mitschülern und den Kleinstadtbewohnern von Marienfall.
Und was planten unterdessen die zwei Menschen, die mir am nächsten standen?
Meine Abschiebung.
2. Unter Himmelshoch
Ich musste eine ganze Weile geschlafen haben, denn als ich aufwachte, war ich kräftig durchgefroren in meinem Trägershirt. Ein Blick auf den Wecker verriet, dass es 21:23 Uhr war.
Papa war also bereits zu Hause.
Ich kam schlagartig auf die Beine, obwohl mir jeder Muskel in meinem Körper wehtat. Die Flucht vor dem Kraken hatte mir offenbar mehr abverlangt als gedacht. Während ich in ein Paar ausgetretener Vans schlüpfte, konnte ich mein Stöhnen nur notdürftig unterdrücken, dann öffnete ich im Dunkeln die Zimmertür und lauschte ins Treppenhaus. Aus dem Esszimmer war nur leises Klappern zu hören, als würde jemand den Tisch für ein spätes Abendessen eindecken. Demnach blieb mir noch Zeit für einen Abstecher ins Badezimmer, bevor ich mich in die Schlacht stürzte.
Im Spiegel sah mir ein Mädchen entgegen, das in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeit mit einer gewissen Anouk Parson aufwies, wie etwa die dunkelblonden Spirallocken, von denen Mutter Natur bei meiner Herstellung offenbar eine Extraportion übrig gehabt hatte, und die braunen Augen, dem einzigen an meinem Äußeren, für das mein Vater verantwortlich zeichnete, ansonsten schlug ich ganz nach meiner Mutter. So weit alles klar, nur dieser komische Mund … Vor allem die pralle Oberlippe war mir fremd. Das war nicht Anouk, die ich dort sah, das war Daisy Duck, und zwar schmollend. Der Ekel-Herpes hatte zugeschlagen.
»Oh nein«, entfuhr es mir, wobei ein unangenehmes Ziehen durch meine Lippe ging.
Hastig durchsuchte ich den Filzkorb, in dem ich meine Kosmetik aufbewahrte. Irgendwo muss zwischen dem ganzen Kram doch … Schließlich fand ich die Wundsalbe und verteilte sie großzügig auf meiner Oberlippe mit dem Ergebnis, dass sie richtig schön glänzte. Während ich mich entsetzt betrachtete, konnte ich Sanders dumme Sprüche bereits im Geiste hören: »Hey, das sieht so aus, als habe das Silikon nur für die obere Etage gereicht. Schick.« Die Chance, mich durch den Kakao zu ziehen, würde er unter keinen Umständen ungenutzt verstreichen lassen.
Normalerweise hätte ich mich mit meiner aufgeplusterten Lippe so lange unsichtbar gemacht, bis sie wieder halbwegs normal aussah. Aber heute war das unmöglich, denn ich musste mich in eigener Sache vertreten, ansonsten würden die beiden Herren mein Schicksal in meiner Abwesenheit besiegeln. Mir blieb also nichts anderes übrig, als noch eine Schicht Wundsalbe aufzutragen, meinen Lockenwust mit einem Haargummi zu bändigen und mir auf dem Weg nach unten einen Pulli überzuziehen, obwohl Papa zweifelsohne bereits über meine verletzte Schulter Bescheid wusste.
Der Clou in unserem Esszimmer war keineswegs der mächtige Eichentisch, der für locker ein Dutzend Gäste Platz bot. Auch nicht der Kristalllüster, der das Herz von so manchem Antiquitätenliebhaber zum Klopfen gebracht hätte – während die Stehlampe mit dem Fliegenpilzschirm, die meine Mutter auf irgendeinem Flohmarkt ersteigert hatte, wohl nur mich begeisterte. Nein, den absoluten Höhepunkt stellte das Panoramafenster dar, hinter dem keineswegs der zu erwartende Garten mit Hecken, Sträucher und Rabatten zu sehen war. Bei Tag ragte dort vielmehr die tibetische Hochebene auf mit dem Pamir, der auch das Dach der Welt genannt wurde, was ich für einen ausgesprochen passenden Namen für dieses imposante Hochgebirge hielt. Ich spreche übrigens von einem Blick auf das echte Gebirge und nicht etwa von einer besonders raffinierten Wandtapete, wie es sie auch mit Wasserfall-Motiven oder Einhörnern im Mondlicht gibt. Denn die Einhörner auf Wandtapeten bewegen sich nicht, während an unserem Pamir immer etwas los war – und seien es nur die vorbeiziehenden Wolken.
Das Gebirge im Panoramafenster war zu hundert Prozent real.
Das Geheimnis dieser fantastischen Aussicht lag im Scheibenglas, das wie ein Guckrohr nach Zentralasien funktionierte, nachdem es die Bekanntschaft mit einem monströsen Besucher gemacht hatte. Wo diese Ungeheuer nämlich entlangkamen, veränderte sich gelegentlich die Realität. In diesem Fall hatte Sander einen riesigen geleeartigen Klumpen im Esszimmer gestellt, der in seinem Bauch unzählige Eier getragen hatte. Über diesen Vorfall schwieg Sander sich nach Möglichkeit aus, weil es dem Monsterblob gelungen war, sich über ihn zu stülpen, ehe er ihn … den Weg aller Besucher von jenseits des Tors schickte. Ich hingegen diskutierte leidenschaftlich gern über diesen speziellen Besucher und vertrat dabei die Theorie, dass der Geleeberg Sander keineswegs zu ersticken beabsichtigte, sondern auf diese Weise lediglich seine Eier hatte befruchten wollen. Nur dass sich Sanders Kopf dafür leider als ungeeignet erwies.
Jedenfalls war das Panoramafenster nach dem Spektakel zuerst beschlagen gewesen, und seitdem sich der Nebel gelichtet hatte, lag dort die tibetische Hochebene.
Einen solchen Anblick steckte niemand locker weg, der nicht von klein auf mit veränderter Einrichtung aufgewachsen war. So wie ich. Ich war quasi die inoffizielle Chronistin für meeresartige Besucher mit Hang zu Mord und Totschlag plus der ihnen anhängigen Veränderungen – wobei ich Letzteres deutlich bevorzugte. Sander stand mehr aufs Entsorgen, während ich in meinem Hinterkopf Auftreten, Verhalten und Entsorgungsform notierte. Diese Dinge aufzuschreiben war leider verboten, obwohl es wirklich eine Schande war, vor allem da sich die Besucher in den letzten Wochen regelrecht die Klinke in die Hand gedrückt hatten. Meine mentale Sammlung umfasste bereits blutrünstige Meerfrauen, bei denen nicht einmal der Fischschwanz attraktiv ausgesehen hatte, mutierte Seeigel und eine hochgiftige Algensorte, die halb Himmelshoch überwuchert hatte, bis wir endlich herausfanden, dass sie kein Süßwasser vertrug. In einigen Räumen arbeiteten seitdem immer noch Heizlüfter gegen die Feuchtigkeit an.
Unsere Besucher waren nicht die einzigen, die regelmäßig aus anderen Welten vorbeikamen, um Unheil anzurichten. Soweit ich wusste, waren unsere jedoch die einzigen mit einem deutlichen Meeresbezug, während Besucher von anderen Toren beispielsweise zweidimensionale Reptilien waren oder Dämpfen ähnelten, die jedes Lebewesen, das sie einatmete, in den Wahnsinn trieben. Woher die Tore stammen? Gute Frage.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts, war etwas schiefgegangen – und zwar so richtig mächtig. Dass kurz darauf die Pest wütete und unzählige Menschenleben ausrottete, war gewiss kein Zufall – zumindest lenkte es von den verheerenden Folgen ab. Was da genau schiefgegangen war, wusste ich nicht, denn man musste dem Innersten Wächterzirkel angehören, um in das Mysterium, das die Katastrophe ausgelöst hat, eingeweiht zu werden. Nichtsdestotrotz hatte ich mir so viel zusammengereimt, dass der einflussreiche und außerdem geheimnisvolle Verband, aus dem sich später der Wächterzirkel rekrutierte, eine Dummheit – etwa ein Experiment oder Ritual – angestellt hatte, das nicht nach Plan verlief. Zumindest ist wohl kaum davon auszugehen, dass sie es darauf angesetzt hatten, der Realität Risse beizubringen.
Aber genau das geschah: Unsere Realität erlitt Risse wie eine gesprungene Glaskugel, deren Zentrum nahe Messina in Sizilien lag. Von dort fraßen sich immer feiner werdende Verästelungen fort, bis sie am Rand schließlich unregelmäßig ausliefen.
Unser Tor, wie der Wächterzirkel diese Risse nannte, lag am Rand dieses Musters und wurde somit erst entsprechend spät entdeckt. Im Jahr 1881 fanden es einige unglückliche Arbeiter beim Ausbau des Kellergewölbes des Herrenhauses Himmelshoch. Die Männer, die vor Angst nicht geflüchtet waren, brachte der Wächterzirkel zum Schweigen, denn die Geheimhaltung der Tore war ein essenzieller Bestandteil der Wacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zirkel solch einen großen Einfluss, dass sogar der damalige Besitzer von Himmelshoch, der größte Gutsherr von Marienfall, sich ihrem Willen beugte und ihnen sein Haus überließ. Die Wacht für Himmelshoch übernahm damals ein Zirkelmitglied namens Jori Parson, und für seine Zusage, dass er selbst, seine Söhne und deren Söhne das Tor zu ihrem Lebensmittelpunkt machen würden, bekam er das Herrenhaus als Lohn. Das bedeutete für die Familie Parson einerseits einen großartigen Familienwohnsitz, der andererseits trotz der harschen Geheimhaltungsmethoden des Zirkels wertlos geworden war. Der Teufel persönlich hause hinter den breiten Steinmauern, hieß es bis heute in Marienfall. Dabei schlief das dunkle Geheimnis unter seinen Grundfesten noch viele Jahrzehnte nach seiner Entdeckung.
Das ist allerdings nur eine grobe Zusammenfassung dessen, was ich über die Vergangenheit aufgeschnappt hatte oder mein Vater mir zu erzählen bereit gewesen war. Mir lag die Wacht nämlich nicht im Blut – im Gegensatz zu Sander, der schon ein Wächter war, bevor der Zirkel ihn aufgenommen hatte. Sander war dafür geboren, in der Nähe des Tors zu leben, und noch lieber machte er Jagd auf die Besucher. Einige Jahre nachdem das Tor unter Himmelshoch erwacht war, tauchten diese Wesen zum ersten Mal auf, und seitdem häufte sich ihr Erscheinen – nur um sogleich Sanders Bekanntschaft zu machen. Mich interessierten weder die Besucherabfertigung noch die Mysterien des Tors, die meinen Vater so in ihren Bann gezogen hatten, sodass in seinem Leben nur noch Platz für das Kellergewölbe und seine Arbeit in der Bank war. Aber ich mochte die Veränderungen, die Spuren, welche die Besucher im Herrenhaus hinterließen.
Übrigens war es Sander, der herausgefunden hatte, aus welcher Himmelsrichtung wir von unserem Esszimmer aus auf den Pamir blickten. Eigentlich lag ihm nichts an den Veränderungen, vermutlich weil man sich mit ihnen keinen Kampf um Leben und Tod liefern konnte, aber diese sensationelle Aussicht hatte ihn gepackt. Manchmal erwischte ich ihn, wie er vor dem Fenster stand und beobachtete, wie eine winzige Karawane sich einen Weg durch den kargen Landstrich suchte oder wie das Wetter innerhalb kürzester Zeit umschlug. In einem Moment waren Ebene und Gebirge noch weiß mit Schnee überpudert und im nächsten brach plötzlich die Sonne hervor und alles schimmerte in weichen Erdtönen. Der Pamir bewegte etwas in Sander, zog ihn an, stets aufs Neue. Vielleicht lag es an der atemberaubenden Schönheit des Gebirges, vielleicht aber auch daran, dass er – im Gegensatz zu mir – unter Fernweh litt. Eine Sehnsucht, der er nicht in absehbarer Zeit würde nachgeben können, auch wenn ihm unsere verschlafene Kleinstadt Marienfall noch so sehr zum Hals heraushing. Sander war auf eine Weise an das Tor gebunden, die noch mysteriöser war als das Tor selbst.
An diesem Abend lag tiefe Dunkelheit über dem Pamir, nur einige winzige Lichter verrieten einsame Jeeps, die auf unbefestigten Straßen unterwegs waren. Auch ansonsten herrschte Ruhe im Esszimmer. Über einem der mit dunkelrotem Samt bezogenen Stühle hing Jakobs Mantel, und auf dem Esstisch stand neben einem Stapel Schalen eine randvolle Plastiktüte, die dem Duft nach zu urteilen vom Asia-Imbiss am Bahnhof stammte.
Sander musste Dad abgefangen und direkt in den Keller gelotst haben, wo sie das Tor kontrollierten und dabei ungestört besprachen, wie sie mich am einfachsten loswerden könnten. Wie schön, dass sie endlich ein gemeinsames Thema entdeckten, wo sie ansonsten so wenig miteinander verband – einmal abgesehen von ihrer Furcht, ein überdimensionaler weißer Hai könnte eines Tages durchs Tor geschwappt kommen und uns alle verschlingen, bevor Sander eine Bombe basteln konnte, um ihn artgerecht in tausend Teile zu sprengen. Offenbar hatten die Männer meinen Lutz zu ihrem verschwörerischen Treffen mitgenommen, ansonsten würde der verfressene Köter bereits mitten auf dem Tisch stehen und Bratnudeln aus den zerfetzten Schachteln schlecken.
»Unfair«, murmelte ich.
Mein Stolz verlangte von mir, in den Keller zu stürmen und meine Beteiligung an dieser Entscheidung einzufordern, während mein innerer Hasenfuß ziemlich überzeugend darauf hinwies, dass es in der Nähe zum Tor alles andere als kuschelig-gemütlich war. Das galt besonders, seitdem das Tor zusehends außer Kontrolle geriet.
Ich riss mich zusammen und lief ins hintere Treppenhaus, in dem eine Holztür aus dicken Eichenbohlen in den Keller hinabführte. Wie das Herrenhaus selbst, stammte die Türklinke von anno 1836 und wurde von einem Teufelskopf mit aufgerissenem Maul geziert, dessen langer Hals im Lauf der Zeit von vielen Händen blank gescheuert worden war. Auch dieses Mal rang ich mich nicht dazu durch, die Klinke beziehungsweise den Teufelshals direkt anzufassen, sondern zog meinen Pulliärmel über meine Hand und benutzte ihn wie einen Topflappen. Obwohl die Tür schwer war, verursachten ihre Angeln nicht das leiseste Geräusch. Vermutlich ölte Sander sie regelmäßig, damit niemand hörte, wann er nachts, total dicht, zurück in sein Refugium schlich. Papa kam für solche Dinge nicht infrage, für solche Alltagsangelegenheiten war er schlichtweg zu genial – Essen vom Asia-Imbiss mitzubringen, war das höchste der Gefühle, wenn es darum ging, am Haushalt teilzunehmen.
Die Treppe war erstaunlich breit angelegt, obwohl sie lediglich in den Keller hinabführte. Wobei Keller eine Untertreibung war. Unter dem Herrenhaus gab es eine ganze Flut an Kammern, einige von ihnen sahen so aus, wie man sich einen ordentlichen Keller vorstellt, mit niedriger Decke und spartanischer Beleuchtung. Räume, in denen man Weinvorräte lagerte, den Rasenmäher unterbrachte oder Kisten vom Umzug verstaute, die niemals ausgepackt werden würden. In einer solchen Kammer hauste Sander – freiwillig, wie ich betonen möchte. Von allen zur Verfügung stehenden Zimmern hatte er sich für ein elendes Erdloch entschieden. Allein das war schon Grund genug, um den Keller verdächtig zu finden.
Ganz unvermittelt endete der offizielle Teil des Flurs mit seinem gefliesten Boden. Ab hier begann jener Teil, den ich in diesen Tagen noch mehr mied als ohnehin schon. Es handelte sich um einen roh aus dem Erdreich herausgehobenen Schacht, der von uralten Balken gestützt wurde. Hier hatte 1881 eigentlich das Kellergeschoss ausgeweitet werden sollen, doch so weit war es niemals gekommen.
Im Schacht klafften in unregelmäßigen Abständen Löcher in den Wänden und sogar im Boden, die aussahen wie zum stummen Schrei aufgerissene Schlünde. Hinter ihnen verbargen sich Höhlen, die an Luftblasen im Erdreich erinnerten. Sie zeigten, dass sich an diesem Ort Risse in der Realität aufgetan hatten, jedoch ohne ein Tor zu öffnen. Trotzdem ging von diesen Blasen ein seltsamer Geruch aus, nicht etwa erdig, wie zu erwarten gewesen wäre, sondern es roch nach See. Dabei war das Meer knapp fünfzig Kilometer von Marienfall entfernt, hier gab es nur flaches Land und gelegentlich mal eine verirrte Möwe – mehr nicht. Allerdings türmten sich in diesen Höhlen Berge von Salz, das sich dort im Laufe der letzten Monate angesammelt hatte und davon kündete, dass etwas Unheimliches beim Tor vor sich ging. Nicht einmal mein Vater hatte eine Ahnung, um was genau es sich handelte. Sander und mein Vater schafften die Salzfuhren Tag für Tag in die Höhlen, während sie sich im Stillen fragten, wann sie den Mengen nicht länger Herr werden würden.
Der Höhepunkt des Kellergewölbes verbarg sich am Ende des Schachts und war von der Kellertreppe her nicht einsehbar. Ab dieser Stelle legte man besser sein elektronisches Spielzeug wie Handy und MP3-Player ab, sofern man daran hing. Ansonsten lief man nämlich Gefahr, nur noch einen nutzlosen Haufen Schrott in der Hand zu halten.
Denn dort, hinter einer Eisentür, lag das Tor.
Das, Gott sei Dank, verschlossene Tor. Nur an seinen Rändern schien es im Laufe der Zeit ein winziges bisschen undicht geworden zu sein. Durch diese Bruchstellen rieselte das Salz und gelegentlich zwängte sich ein Besucher mit mörderischen Absichten hindurch.
Mit pochendem Herzen ging ich auf die Eisentür zu, die eher eine Sicherheitsschleuse war, die man im Notfall wasserdicht verschließen konnte.
Über ihr blinkte, aus Leuchtröhren zusammengesetzt, ein Name: Tiamat. Sander hatte dieses seltsame Kunstwerk, das er mithilfe eines Technikkastens gebaut hatte, vor einigen Jahren dort angebracht. Einer von seinen schrägen Witzen, nur lachte niemand über ihn, auch Sander nicht.
Tiamat.
Diesen Namen hatte ich in einem der Geschichtsbücher gefunden, die meine Mutter so geliebt hatte und die ich vor meinem Vater in Sicherheit gebracht hatte, bevor er sie ins Altpapier geben konnte. Tiamat war eine babylonische Göttin gewesen, die das Salzwasser und somit das Meer verkörperte. Außerdem hetzte sie gern Seeungeheuer auf ihre Feinde – der Krakenmann vom Dachboden wäre gewiss ihr Favorit gewesen. Obwohl mein Vater den Namen als Unsinn abtat, hatte er sich sogar unter den Wächtern eingebürgert. Denn es war bedeutend leichter, mit Schrecklichem und Geheimnisvollem fertig zu werden, wenn es einen Namen trug.
Heute jedoch half mir dieser Trick wenig. Ich stand noch immer vor der Eisentür, die vom unsteten Licht der Leuchtröhren angestrahlt wurde. Durch den Rost, mit dem sie überzogen war, sah sie uralt aus, oder als habe sie lange Zeit im Salzwasser gelegen. Dabei hatten Papa und Sander sie erst vor vier Monaten erneuert. Die Lackschicht war größtenteils abgeblättert, das Eisen darunter rissig und von Furchen übersät, als versuchte etwas von der anderen Seite sich langsam durch das Metall zu fressen. Der Rostgeruch kratzte in meiner Nase.
Dir läuft die Zeit davon, vermutlich haben die beiden Herren längst vereinbart, wer dich morgen früh zum Zug bringt. Du musst dich beeilen!
Trotzdem verharrte ich und inspizierte erst einmal den Boden, der mit Metallplatten bedeckt war. In meiner Angst bildete ich mir ein, dass sich Pfützen in ihren Unebenheiten abzeichneten, was natürlich Unsinn war. Ich kam jedoch nicht gegen meine Furcht an und glaubte lauter Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich in der Schleuse gerade eine gewaltige Flut aufbaute, die jeden Moment die Tür sprengen und alles mit sich reißen würde, das sich ihr in den Weg stellte. Die Salzzeichen, die das Tor verschlossen hielten, machten ihren verdammten Job nicht länger auf eine Weise, die mein Vertrauen verdiente. Der Krakenmann, der unbemerkt bis zum Dachboden vorgedrungen war, war nur ein weiterer Beweis in einer langen Kette von Schrecken. Und wenn ich das gestresste Gesicht meines Vaters richtig deutete, dann verschlechterte sich die Lage mit jedem Tag drastisch.
Vibrierten nicht die Nieten des Türrahmens verdächtig?
Sammelte sich nicht Wasser in den Fugen zwischen den Metallplatten?
Hatten die Sohlen meiner ausgetretenen Schuhe nicht soeben ein saugendes Geräusch verursacht?
Natürlich war das Unsinn, hinter der Eisentür befand sich die Schleuse, und erst dahinter erhob sich Tiamat, in deren Umfeld es so trocken war wie nirgendwo sonst auf der Welt. Denn rund um das Tor türmte sich Salz, jede Menge Salz. Salz, das durch die zunehmend zerbröckelnden Salzzeichen quoll.
Okay, Anouk, du schiebst jetzt deine Ängste meilenweit beiseite, feuerte ich mich an. Papa hat das Tor unter Kontrolle, so, wie er alles und jeden unter Kontrolle hat. Der Mann bändigt sogar Sander, was nun wirklich Beweis genug ist.
Trotzdem konnte ich ein »Brrrr« nicht unterdrücken, als ich die Metalltür aufzog und mir ein Schwall kalter Luft ins Gesicht wehte. Dahinter begann die Schleuse, eine Metallröhre, die tief hinab ins Erdreich führte. Im Gegensatz zu den beiden Männern des Hauses ging ich aufrecht hindurch – irgendeinen Vorteil musste es schließlich haben, bestenfalls durchschnittlich groß zu sein. Wobei durchschnittlich sich auf eher kleine Leute bezog.
Am Ende der Schleuse befand sich ein Kraftfeld, das einer Wand aus Nebel ähnelte. Diese harmlos aussehende Grenze unbeschadet zu durchschreiten, war nur der Familie Parson möglich, was witzigerweise auch unsere Bulldogge Lutz einschloss. Jeder andere, der durchging, musste mit einem mächtigen Stromschlag rechnen. Wobei es sich nicht um einen echten Stromschlag handelte, weil der Nebel nachweislich keinen Strom leitete. Das hatten die Wächter als Erstes herausgefunden bei ihren Versuchen, das Kraftfeld außer Betrieb zu setzen, weil es sie von Tiamat fernhielt. An dieser Aufgabe hatten sie sich jedoch trotz ihrer ganzen Technik und ihres Ehrgeizes die Zähne ausgebissen, genau wie sie nicht herausgefunden hatten, woher das Feld eigentlich stammte und woraus es gespeist wurde. Gegen Strom hätten sie sich schützen können, aber gegen diesen seltsamen Nebel kamen sie nicht an. Auch ihre Kameras nicht, die sie Papa auf die andere Seite hatten bringen lassen, um wenigstens ein Bild von dem Tor zu bekommen. Was Papa jedes Mal zurückgebracht hatte, war ein Haufen Elektroschrott gewesen, aber es gab keine einzige Aufnahme. Als ich noch jünger und dem Wächterzirkel gegenüber aufgeschlossener gewesen war, hatte ich meinem Unbehagen zum Trotz eine Zeichnung von Tiamat angefertigt. Anstelle von Dank hatte es eine Abmahnung darüber gesetzt, dass die Geheimhaltung des Tors an erster Stelle stand.
Als wäre ich so dumm gewesen, die Zeichnung an meiner Schule herumzuzeigen!
Schließlich stand man als Bewohnerin von Himmelshoch sowieso unter Generalverdacht, mit den bösen Mächten im Bunde zu stehen. Dass es eigentlich ganz schick ist, ein bisschen evil zu sein, darauf kam die Marienfaller Jugend nämlich erst, nachdem Sander das Partyalter erreicht hatte. Seitdem stand das alte Herrenhaus in dem Ruf, Durchgeknallte von der unterhaltsamen Sorte hervorzubringen. Sein größter Gag bestand darin, mithilfe seines Brillenbügels jedes Paar Handschellen zu knacken. Angeblich hatte er diese Kunst für sich entdeckt, als er nach einer lustigen Nacht an ein Bett gefesselt aufgewacht war. Nur dass das Bett nicht seins war und die Besitzer gerade im Wagen vorfuhren. Für gewöhnlich gab ich nichts auf Tratsch, aber diese Geschichte hatte ich sofort geglaubt. Niemand wusste besser als ich, dass für Sander das Leben erst richtig spannend war, wenn ihm jemand ans Leder wollte – ob das nun ein aus Reißzähnen bestehender Besucher oder ein rasender Familienvater war, der in sein kaputt gefeiertes Heim zurückkehrte und dem Kerl mit der Plüschhandschelle ums Handgelenk die alleinige Schuld für die Verwüstung gab.
Was das geheimnisvolle Kraftfeld anbelangte, an dem sich der Wächterzirkel die Zähne ausbiss, so war es aus unserer Sicht nicht im Geringsten geheimnisvoll. Es handelte sich schlicht um die erste Veränderung, die sich auf Himmelshoch breitgemacht hatte. Sie hatte sich kurz nach Tiamats Erwachen aufgetan, und wie die meisten Veränderungen war sie ein Sander-Fan: Auf eine magische Weise, die er weder Jakob noch mir plausibel erklären konnte, bekam er oftmals mit, wenn ein Besucher – allen Qualen zum Trotz – das Kraftfeld durchquerte. Ein wirklicher Vorteil, denn während mein Vater seine Schichten direkt vor Tiamat verbringen musste, konnte Sander faul in seinem Kellerloch herumlungern und Comics lesen.
Das eigentümliche Gefühl beim Durchschreiten des Nebels war mir zwar vertraut, dennoch überraschte mich meine Reaktion stets aufs Neue. Vermutlich, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass sich irgendetwas hier unten mit Worten wie »wohliger Schauer« und »Verzückung« in Verbindung bringen ließ. Der Nebel fühlte sich an, als bestände er aus unsichtbaren Händen, die einen abtasteten. Gehörte man zur Familie Parson, durfte man hindurch – gehörte man nicht dazu, bekam man einen ordentlichen Schlag verpasst. Leider dauerte der Zauber nicht länger als ein paar Herzschläge, dann war ich auch schon hindurch und musste den Preis zahlen. Den Anblick Tiamats.
Mitten im hohen Kellergewölbe drehte ein Maelstrom mit dem Durchmesser einer überdimensionalen Kinoleinwand bedächtig und doch mit erschreckender Gleichmäßigkeit seine Runden. Die Strömungen, die sein schwarzes Auge umkreisten, variierten in den Farben eines Gewitterhimmels. Als ich noch jünger war, hatte ich mir einzureden versucht, dass es sich tatsächlich um eine Leinwand handelte, die die gesamte unterirdische Halle ausfüllte. Dabei war dieses Gewölbe, tief unter Himmelshoch, so weiträumig, dass darin sogar der hochgewachsene Sander verloren aussah. Und auf dieser Fläche sah man direkt in einen monströsen Meeresstrudel, in dessen Zentrum ein dunkles Herz schlug, auf den Moment wartend, in dem die Barriere brach und er seine Wassermassen durch das Tor treiben konnte, um alles zu überfluten. Es ist nur eine Leinwand, eine Leinwand, auf der ein Horrorfilm läuft … Die Selbsttäuschung funktionierte leider nie, denn das Tor – und mit ihm der Maelstrom – war genauso real wie mein rasender Pulsschlag.
In unregelmäßigen Abständen fuhren bläuliche und goldene Blitze aus der Tiefe des Strudels hervor und warfen einen flackernden Schein gegen die Steinwände. Das war insofern ein Vorteil, da es in dem Gewölbe keine Elektrizität gab und nur einige Kerzen und Öllampen Licht spendeten. Sie beleuchteten den Schreibtisch meines Vaters, auf dem sich Stapel von Notizen neben aufgequollenen Büchern über Tiefseebewohner und Meeresströmungen türmten, eine zusammenklappbare Pritsche, die Sander als Folterinstrument bezeichnete, und eine verbeulte Schubkarre samt Schaufel. Am schönsten sahen die Salzberge im Kerzenlicht aus, obgleich sich darin auch schon ihr Vorteil erschöpfte. Die sanft glitzernden Erhebungen standen für ein ernsthaftes Problem, für das noch keine Lösung in Sicht war. Das Salz rieselte unaufhörlich durch die Barriere, die den Maelstrom zurückhielt: ein Netz aus lauter beweglichen, bläulich schimmernden Linien, an denen feinste Salzkristalle haften blieben. Wir nannten sie die Salzzeichen, weil sie sich zu komplexen Mustern zusammenschlossen, und mein Vater hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sie zu entschlüsseln. Das war auch dringend notwendig, denn immer mehr dieser Zeichen zerbrachen und durch die entstandenen Lücken drangen nicht nur Salzbäche, sondern auch die Besucher.
Als ich das Gewölbe betrat, knirschte Salz unter meinen Sohlen. Dieses leise Geräusch reichte aus, um Lutz, der stolz und aufrecht vor dem furchterregenden Maelstrom patrouillierte, auf meine Spur zu bringen. Eins seiner Schlappohren zuckte, dann machte er kehrt und stürzte auf mich zu. Der Aufprall einer rennenden Bulldogge ist nicht zu unterschätzen, also ging ich rasch in die Hocke und musste im nächsten Moment auch schon einen schlabberigen Hundekuss einstecken.
»Anouk, was machst du hier unten?«, begrüßte mich die strenge Stimme meines Vaters.
Ich presste mein Gesicht noch einmal fest in Lutz’ vertraut riechendes Fell, dann stand ich auf und erwiderte Jakobs eindringlichen Blick. Er trug noch den eleganten Anzug von der Arbeit und sein Haar lag nass in der Stirn. Offenbar hatte ihn auf dem Heimweg ein kräftiger Frühlingsregen überrascht, und Sander hatte ihm nicht die Zeit gelassen, sich das Haar trocken zu reiben, weil er es so verflucht eilig hatte mit seinem Verrat. Sah ganz danach aus, als ob er mich gar nicht schnell genug aus dem Haus bekommen konnte.
Aufgebracht stierte ich Sander an, der neben Jakob stand, und er besaß tatsächlich die Frechheit, meinen Blick zu erwidern.
»Anouk?« Mehr musste mein Vater nicht sagen, um unser Blickduell zu unterbrechen. Manchmal war mir seine Autorität unheimlich.
»Nun, ich bin in den Keller gekommen, weil … Im Esszimmer stand nur eine unangerührte Tüte mit Essen und deshalb bin ich …« Das war ein schlechter Einstieg, also richtete ich mich bewusst auf und setzte erneut an. »Es ist mein Leben, und über mein Leben entscheide ich, zumindest sollte ich mit sechzehn Jahren das Recht dazu haben.«
Die Augenbrauen meines Vaters fuhren in die Höhe und lösten seinen ansonsten stets eine Spur zu harten Ausdruck auf. »Es liegt mir fern, dir das Tiamat-Gewölbe zu verbieten. Du bist eine Parson, damit hast du jedes Recht, hier zu sein. Ich bin nur verblüfft, weil du es in der letzten Zeit, noch mehr als sonst, vermieden hast herzukommen.«
Das war nicht ganz die erwartete Reaktion.
Verwirrt sah ich nun doch zu Sander hinüber, der den Kopf schüttelte. Mit einer Geste deutete er an, wie er seinen Mund verschloss und den Schlüssel wegschmiss. Das sollte dann wohl bedeuten, dass er Papa nichts von meiner Begegnung der zudringlichen Art erzählt hatte. Klasse. Einmal davon abgesehen, dass ich nun wie ein Trottel dastand.
Prompt bekam ich die Rechnung für meinen wirren Auftritt serviert.
»Töchter in diesem Alter sind wahrlich kein Geschenk«, brummte Jakob, während er sich wieder einem faustgroßen Loch in den Salzzeichen zuwendete, um die sich ein verästeltes Muster aus weißen Kristallen gebildet hatte. Es sah aus, als wären die Zeichen mit Gewalt auseinandergedrängt worden. Bevor Jakob sich erneut in seine Arbeit vertiefte, gab er Sander ein Zeichen. »Bitte begleite Anouk nach oben. Es ist schon spät, fangt also ruhig schon mit dem Essen an. Ich muss mich erst einmal um die Auswertung kümmern und komme dann nach.«
Sander zögerte. »Das mit dem Essen bekommt Anouk bestimmt allein hin, ich würde lieber …«
Jakob hob die Hand. »Alexander, ich sagte bitte.«
Es war Sander anzusehen, was er von dieser ›Bitte‹, in Kombination mit seinem Vornamen, den er auf den Tod nicht ausstehen konnte, hielt. ›Alexander‹ war ein griechischer Name und bedeutete so viel wie ›Beschützer‹, was für seinen Geschmack dann doch zu viel Programm war. Er benutzte die Abkürzung Sander schon so lange, dass ich mich gar nicht daran erinnerte, gehört zu haben, wie ihn jemand außer meinem Vater mit seinem offiziellen Namen ansprach.
Darüber hinaus machte Sander ein langes Gesicht, weil er sich mit mir abgeben musste, während Jakob das Geheimnis der beschädigten Salzzeichen erforschte. Die Lippen zu einer schmalen Linie aufeinandergepresst, bedeutete er mir, durch das Kraftfeld zu treten, aber ich konnte mich nicht losreißen. Schwer zu sagen, ob es die Anziehungskraft des Maelstroms oder Papas konzentrierte Ausstrahlung war, die mich gebannt hielt.
Dann packte Sander mich an meiner heilen Schulter und führte mich ab, während mein Vater hinterm Schreibtisch inmitten der Salzhügel Platz nahm. In die rechte Hand nahm er einen Stift, während er mit der anderen umständlich ein Stück Papier zurechtrückte. An Jakobs linker Hand waren von seinen Fingern nur noch die ersten Glieder vorhanden, der Rest war mit einem sauberen Schnitt von den Salzzeichen amputiert worden, als er versucht hatte, durch sie hindurchzugreifen. Seitdem wussten wir, dass die Barriere aus dem filigranen Muster nicht nur den Maelstrom zurückhielt, sondern auch uns Menschen. Sämtliche Experimente, die mein Vater seitdem unternommen hatte, um sie zu überwinden, waren gescheitert. Außer für die Besucher stellten die Salzzeichen eine unüberwindbare Grenze dar.
Während ich mehr oder weniger freiwillig zur Schleuse ging, blickte Lutz unschlüssig drein, dann folgte er uns. Vermutlich war er zu der Überzeugung gelangt, dass sich heute Nacht kein fischiger Nachtisch mehr beim Tor blicken ließ, während wir höchstwahrscheinlich einen Abstecher in die Küche unternahmen.