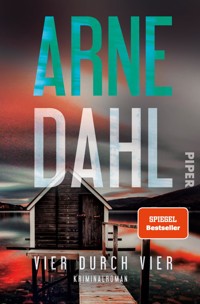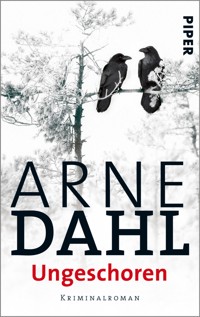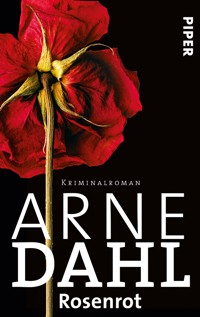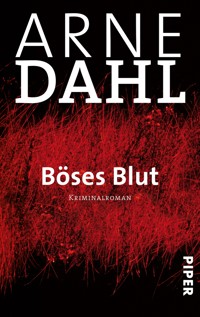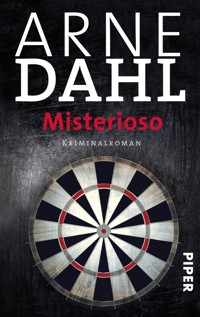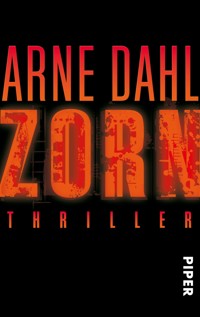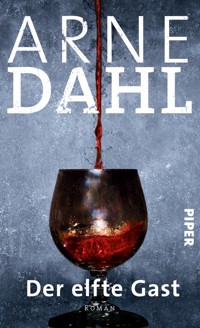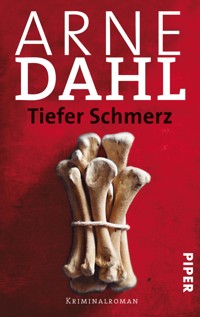
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein toter Nobelpreiskandidat und eine bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche in einem Stockholmer Freizeitpark – haben sie etwas miteinander zu tun? Fieberhaft suchen die Sonderermittler um Paul Hjelm und Kerstin Holm nach dem Verbindungsglied in einer bizarren Mordserie. Der Fall führt sie nicht nur durch halb Europa, sondern auch in die Vergangenheit, bis hin zu einem monströsen Verbrechen vor langer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt
ISBN 978-3-492-95191-3
November 2016 © 2001 Arne Dahl Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Europa Blues«, Bra Böcker AB, Malmö 2001. Vermittelt durch die Bengt Nordin Agency, Stockholm Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2005 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagfoto: Marc Sadlier / plainpicture / arcangel Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
1
Es war ein Abend Anfang Mai. Und es war vollkommen windstill.
Nicht der kleinste Windhauch kräuselte das Wasser von Saltsjön. Der Wimpel des Kastells draußen auf Kastellholmen hing schlaff herunter. Die gezackten Fassaden von Skeppsbron lagen wie eine Kulisse in der Ferne. Kein Zucken fuhr durch die Flaggen um Stadsgården, nicht eine Baumkrone regte sich oben an der Fjällgata, und das Grün von Mosebacke zeigte nicht die kleinste Bewegung. Das einzige, was das dunkle Wasser des Beckholmsunds von einem Spiegel unterschied, war der vorübertreibende regenbogenfarbene Schimmer von ausgelaufenem Öl.
Einen Augenblick lang war das Spiegelbild des jungen Mannes von einem fast perfekten konzentrischen Regenbogenkreis umgeben, wie im Fadenkreuz eines Zielfernrohrs, doch dann löste der Kreis sich auf und glitt langsam, in ständig wechselnden Formen hinunter nach Beckholmsbron. Der junge Mann schüttelte das Unbehagen ab, das ihn flüchtig gestreift hatte, und zog sich die erste Straße rein.
Dann lehnte er sich auf der Parkbank zurück, ließ die Arme über die Rückenlehne hängen und hob das Gesicht zu dem glasklaren Himmel auf, der sich spürbar verdunkelte. Er horchte in sich hinein: keine nennenswerte Wirkung. Nur die selbstsichere Ruhe, die für einen kurzen Augenblick erschüttert worden war. Mit einem herausfordernden Lächeln betrachtete er die Spielkarte, die offen auf der Parkbank neben ihm lag. Pikdame. Darauf lag die zweite Straße bereit.
Er rollte den Schein auseinander und leckte die Reste des weißen Pulvers ab. Dann hielt er ihn vor sich und betrachtete ihn. Tausend Kronen. Ein schwedischer Tausender. Alter Mann mit Bart. An dem alten Sack würde er sich in den nächsten Monaten satt sehen, soviel war klar. Er rollte den alten Sack wieder zusammen und hob vorsichtig die Pikdame hoch. Er fühlte sich doppelt mutig, doppelt stark. Sich nach nur ein paar Wochen in einer neuen Stadt in einem neuen Land auf eine öffentliche Parkbank zu setzen und Kokain zu schnupfen, das war schon mutig genug, aber es wurde doppelt mutig durch das Risiko, daß ein plötzlicher Windstoß sich mit dem ganzen Rausch auf und davon machte.
Doch es war ja vollkommen windstill.
Es waren inzwischen zwei Straßen nötig, damit der Rausch sich einstellte. Daß er bald drei brauchen würde, bald vier und bald fünf, daran verschwendete er keinen Gedanken, als er die Röhrenform des alten Sacks an die Köstlichkeiten der schwarzen Dame führte und sich das Paradies reinzog.
Es kam. Wenn auch nicht mit einem Schlag wie früher, diesem Baseballschläger mitten in die Fresse, sondern schleichend, ein unmittelbares, unersättliches Verlangen nach mehr.
Der Rausch nahm langsam aber sicher zu und ließ allmählich das Gesichtsfeld zur Seite abdriften, leicht geneigt, aber Windstöße brachte er nicht hervor. Die dunkler werdende Stadt lag noch immer in völliger Windstille da, fast wie auf einer Ansichtskarte. An den Fassaden gingen schon hier und da Lichter an, in der Ferne glitten lautlos die Lichtkegel der Autos dahin, und der ein wenig modrige Duft erstaunten Frühlings wurde plötzlich verstärkt zu einer Kloake, zum Kot von ein paar gigantischen Giraffen, die sich zu dem verzerrten Geräusch greller, hallender Kinderschreie wie aus dem Nichts über ihm erhoben. Das ihm, der Tiere haßte. Tiere jagten ihm Angst ein, seit seiner Kindheit hatte er Tiere gehaßt. Und dann diese monströsen, stinkenden, schreienden Giraffen, ein Alptraum. Eine kurze Ahnung von Panik durchfuhr ihn, bevor er erkannte, daß die Giraffen große Werftkräne waren, und hörte, daß die Kinderschreie vom nahe gelegenen Tivoli kamen, das gerade für die Saison eröffnet worden war. Und der Gestank von Giraffenkot verzog sich und war wieder ein Stück erstaunter Frühling.
Zeit verging. Viel Zeit. Fremde Zeit. Er war woanders. In einer anderen Zeit. Der Zeit des Rauschs. Einer unbekannten Urzeit.
In seinem Innern begann es zu grollen. Er stand auf und sah die Stadt an, als betrachtete er einen Feind. Stockholm, dachte er und hob die Hand. Du brutal schöne Miniatur einer Großstadt, dachte er und ballte die Hand zur Faust. So leicht zu erobern, dachte er und erhob die Faust gegen die Stadt, als sei er der erste, der dies tat.
Er wandte sich in dem unaufhaltsam zunehmenden Dämmerungsdunkel um. Sein Gesichtsfeld war noch immer ein wenig schief, die Geräusche und Gerüche waren noch leicht verzerrt. Kein Mensch in der Nähe. In der ganzen Zeit hatte er keinen einzigen Menschen gesehen. Dennoch hatte er das Gefühl, nicht allein zu sein. Ein vages Gefühl, wie eine Ahnung. Dinge, die knapp außerhalb seines Gesichtsfelds vorbeizugleiten schienen. Er schüttelte es von sich ab. Das waren keine Gefühle für einen Mann, der eine Stadt erobern wollte.
Er nahm die Pikdame von der Parkbank, leckte sie genüßlich sauber, steckte sie in die Innentasche, dem Herzen am nächsten, und klopfte sich an die Brust seines hellrosafarbenen leichten Sommerjacketts. Dann rollte er den Tausender auseinander, der während der unmeßbaren Zeit des Rauschs an seiner Hand geklebt hatte. Wieder schleckte er Reste von weißem Pulver auf und riß dann den Tausendkronenschein demonstrativ in lange Streifen, die er zu Boden fallen ließ. Sie rührten sich nicht vom Fleck. Es war vollkommen windstill.
Als er sich in Bewegung setzte, gab er ein Klappern von sich. Das tat er jetzt immer. Für ihn war Reichtum noch an der Dicke der Goldkette zu messen, die er um den Hals trug. Die Leute sollten seinen Erfolg hören.
Er war erstaunt, daß die Vattugränd, deren Namen auf dem Straßenschild er mühsam buchstabierte, vollständig menschenleer war. Gingen Schweden abends nicht auf die Straße? Jetzt erst spürte er, wie kalt es geworden war. Und fast pechschwarz. Und vollkommen still. Nicht ein einziger jubelnder Kinderschrei vom Tivoli.
Wie lange hatte er, in seinen Rausch versunken, dort unten am Wasser gesessen?
Etwas wuselte zu seinen Füßen. Einen Moment lang dachte er, es wären sich windende Schlangen. Tiere. Ein kurzer Schreck.
Dann sah er, was es war.
Streifen von einem Tausendkronenschein.
Er drehte sich um. Schaumkronen auf Saltsjön. Und der Wind zog eiskalt geradewegs durch ihn hindurch. Die Tausendkronenscheinschlangen wirbelten weiter, auf Djurgårdsstaden zu.
Da war ihm wieder so eigentümlich, als wäre er nicht allein. Nichts. Überhaupt nichts. Und dennoch dieses Gefühl. Eine eisige Gegenwart von etwas. Ein Eiswind durch die Seele. Und auch wieder gar nicht. Als befände es sich die ganze Zeit gerade an dem Punkt, den sein Blick nicht mehr erreichte.
Er kam hinaus auf die große Straße. Kein Mensch. Kein Fahrzeug. Er überquerte sie und drang in den Wald ein. Es kam ihm vor wie Wald. Bäume überall. Und die Gegenwart von etwas immer deutlicher. Ein Käuzchen rief.
Ein Käuzchen? dachte er. Tiere, dachte er.
Und da sah er aus dem Augenwinkel einen Schatten, der hinter einen Baum glitt. Und noch einen.
Er stand still. Das Käuzchen rief wieder. Minerva, dachte er. Die Mythologie der Alten, die ihm in seiner Schulzeit in den Armenvierteln von Athen eingetrichtert worden war.
Minerva, die Göttin der Weisheit, Athenas Name, als sie von den Römern gestohlen wurde.
Er blieb eine Weile stehen und versuchte, Athena zu gleichen. Weise zu sein.
Geschieht dies in der Wirklichkeit? Bilde ich mir diese beinah unmerklichen Bewegungen nicht ein? Und warum verspüre ich Angst? Habe ich nicht Auge in Auge mit völlig ausgerasteten Fixern gestanden und sie mit ein paar schnellen Bewegungen betäubt? Ich bin Herrscher über ein Imperium. Was fürchte ich?
Da nimmt der Schrecken Gestalt an. Irgendwie fühlt sich das besser an. Als der Ast dort hinter der Fichte knackt und das Geräusch selbst den zunehmenden Wind übertönt, weiß er, daß es sie gibt. In gewisser Weise ist das schön. Eine Bekräftigung. Er sieht sie nicht, aber er nimmt Tempo auf.
Es ist fast kohlrabenschwarz, und es kommt ihm vor, als liefe er durch einen Urwald. Die Zweige peitschen ihn. Und die dicke Goldkette klimpert und klimpert. Wie eine Kuhglocke.
Tiere, denkt er und stürzt über die Straße. Kein einziges Auto. Es ist, als hätte die Welt aufgehört zu existieren. Nur er und irgendwelche Wesen, die er nicht versteht.
Mehr Wald. Bäume überall. Der Wind, der durch ihn hindurchpfeift. Der Eiswind. Und die Schatten, die überall an den Rändern seines Gesichtsfelds gleiten. Urzeitwesen, denkt er, überquert einen kleinen Weg und läuft direkt in einen feinmaschigen Drahtzaun. Er wirft sich auf den Zaun. Der schwankt. Er klettert und klettert. Die Finger rutschen ab. Und kein Geräusch außer dem Wind. Doch, da: das Käuzchen. Gellend. Käuzchenschrei verzerrt. Ein furchtbarer Laut, der sich mit dem unablässigen Wind vereint.
Ein Urzeitschrei.
Seine Fingerspitzen sind aufgeschnitten und blutig von den nadelscharfen Maschen. Die Gegenwart von etwas ist jetzt überall. Das Spiel dunklerer Schatten durch das Dunkel.
Er fummelt die Pistole aus dem Schulterhalfter. Hängt mit der einen Hand am Zaun und schießt mit der anderen. Er schießt in alle Richtungen. Wahllos. Dumpfe Schüsse in den Urwald. Keine Erwiderung. Keine Reaktion. Das Gleiten um ihn her geht weiter. Unverändert. Unerschrocken. Unbezwinglich.
Er schiebt irgendwie die Pistole zurück ins Halfter, noch ein paar Schuß übrig, eine letzte Sicherheitsmaßnahme, und die Nähe der Schatten verleiht ihm übermenschliche Kräfte, jedenfalls ist er selbst der Meinung, als er sich hoch und nach außen hebt und den Stacheldraht packt, der über dem Zaun in einem nach außen weisenden Winkel verläuft.
Übermenschliche Kräfte, denkt er mit einem ironischen Lächeln, windet die Drahtstacheln aus den Händen und schwingt sich hinüber.
Jetzt aber, denkt er, als er hinunter ins Grüne auf der anderen Seite des Zauns springt. Gleitet darüber, ihr da.
Und sie tun es. Er spürt sofort ihre Nähe. Er erhebt sich aus dem Gebüsch, in dem er gelandet ist, und starrt geradewegs in ein paar schräge gelbliche Augen. Er schreit unvermittelt auf. Spitze Ohren richten sich über den Augen auf, und darunter wird eine Reihe nadelspitzer Zähne entblößt. Ein Tier, denkt er und wirft sich zur Seite. Direkt vor ein anderes, ebensolches Tier. Die gleichen schrägen gelblichen Augen, die eine ganz andere Welt sehen als er. Urzeitaugen. Und als er weiter durch das Waldgelände stürzt, ist es vor der Eiszeit.
Wölfe, schießt es ihm plötzlich durch den Kopf. Herr Gott, sind das nicht Wölfe?
Ist das hier eine Stadt? schreit es in seinem Innern. Wie zum Teufel kann das hier eine Großstadt in Europa sein?
Er klimpert. Sein Weg ist eine geräuschvolle Autobahn. Er packt die dicke Goldkette, reißt sie sich vom Hals und wirft sie in die Vegetation. Hinaus in die Natur.
Er erreicht eine Mauer, und mit seinen blutigen, pochenden Fingerspitzen, die den Schmerz durch den Körper pulsieren lassen, findet er sogleich Halt, und wie ein Bergsteiger klettert er die senkrechte Mauer hinauf, er hievt sich hinüber, über einen Zaun auf der Mauerkrone, und unter ihm ist die Natur wie in gleitende Schatten gehüllt, die Bäume scheinen sich zu bewegen, ein Wald, der sich nähert, die stillstehenden Wölfe scheinen mit ihrer gesammelten Urzeitgleichgültigkeit an dem Gleiten teilzuhaben. Und er bekommt die Pistole hoch, und er schießt auf die Tiere, auf die von gleitenden Schatten erfüllte Natur. Nichts verändert sich. Nur daß die Pistole klickt. Er wirft sie nach den Schatten. Sein Gesichtsfeld ist außer Funktion. Er weiß nicht, was sie getroffen hat.
Er ist oben auf einem Weg. Asphalt. Endlich Asphalt. Und er hetzt weiter eine Anhöhe hinauf, und von überallher starren Tiere ihn an, dunkel, gleichgültig, und Gestank und Geräusche füllen die pfeifende Luft, und er versucht einen Namen zu finden für diese gleitenden Schattenwesen, die ihn verfolgen und die nie, nie, nie aufzugeben scheinen.
Namen beruhigen.
Furien, denkt er, während er läuft. Gorgonen, Harpyien. Nein, falsch. Nein, wie heißen sie noch? Rachegöttinnen?
Und plötzlich versteht er, daß es tatsächlich Rachegöttinnen sind. Daß es tatsächlich Göttinnen der Rache sind, die Fliegen, die unbezwingbaren Urzeitgottheiten. Die weibliche Rache. Aber wie hießen sie noch? Mitten im Wahnsinn sucht er einen Namen.
Namen beruhigen.
Er läuft und läuft, doch es ist, als käme er nicht vom Fleck. Er läuft auf einem Rollband, er läuft in klebendem Asphalt. Und sie sind da, sie nehmen Gestalt an, sie gleiten weiter, aber werden zu Körpern. Er glaubt, daß er sie sieht. Er fällt. Wird gefällt.
Er fühlt, wie er hochgehoben wird. Es ist stockdunkel. Urzeitdunkel. Der eisige Wind heult. Sein Körper dreht sich. Oder dreht er sich nicht? Er weiß nicht. Plötzlich weiß er nichts mehr. Plötzlich ist alles zu einem namenlosen, unstrukturierten Chaos geworden. Alles, was er tut, ist, einen Namen zu suchen. Den Namen von mythischen Wesen. Er will wissen, wer sie sind, die ihn töten.
Und er sieht ein Gesicht. Vielleicht ist es ein Gesicht. Vielleicht sind es viele. Frauengesichter. Rachegöttinnen.
Und er dreht sich. Alles steht auf dem Kopf. Er sieht zwischen seinen Füßen den Mond hervorkommen. Er hört die Sterne in Lichtjahrgesang ausbrechen. Und er sieht das Dunkel sich verdunkeln.
Jetzt sieht er ein Gesicht. Es steht kopf. Es ist eine Frau, die alle Frauen ist, denen er je etwas angetan, die er vergewaltigt, mißhandelt, erniedrigt hat. Es ist eine Frau, die alle Frauen ist, die ein Tier wird, das eine Frau wird, die ein Tier wird. Ein goldiges kleines marderähnliches Gesicht, das zerbirst zu einem riesenhaften, mörderischen Rachen. Es verbeißt sich in sein Gesicht, und er fühlt, wie seine blutenden Fingerspitzen auf erdigem Boden tanzen und verspürt einen Schmerz, der jede Vorstellungskraft übersteigt, der den Angriff des Tieres, des Tieres, das sich gerade mit seiner Backe davonmacht, wie ein Streicheln erscheinen läßt. Und er versteht nichts, absolut nichts.
Außer daß er stirbt.
Daß er vor reinem Schmerz stirbt.
Und da, mit einem letzten Schub von Genugtuung, erinnert er sich an den Namen der Schattengestalten.
Das letzte, was er spürt, ist Erde, die in die blutenden Fingerspitzen gesogen wird.
Das beruhigt.
2
Der alte Fischer hatte viel gesehen. Tatsächlich glaubte er nur, alles gesehen zu haben. Als er jetzt gegen Abend seinen Stand mit Melonen zusammenpackte, der schon vor langer Zeit die Fischernetze abgelöst hatte, mußte er sich eingestehen, daß es doch noch Überraschungen gab. Und auch das überraschte ihn. Das Leben – und vor allem der Tourismus – hatte immer noch ein gewisses Maß an Wahnsinn zu bieten. Das war ein beruhigendes Gefühl. Das Leben war noch nicht ganz am Ende.
Schon vor vielen Jahren hatte der alte Fischer eingesehen, daß das Geld, welches ihm der Verkauf von Melonen an Touristen einbrachte, die Einkünfte aus seiner Fischerei bei weitem überstieg. Von der bedeutend geringeren Anstrengung ganz zu schweigen.
Er hatte nicht viel für Anstrengungen übrig. Was ein richtiger Fischer indessen haben sollte.
Der alte Fischer blickte aufs ligurische Meer, das vor ihm unter dem abendlichen Frühlingshimmel lag und sich wölbte, als würde es ebenso intensiv genießen wie der Betrachter. Der Blick des alten Fischers wanderte hinauf zu den bewaldeten Hügeln, die das kleine Dorf umgaben, und weiter hinauf zu der Mauer um die alte Stadt, die einst ein etruskischer Hafen gewesen war. Doch davon wußte der alte Fischer nichts. Er wußte nur, und er ließ die nach Pinien duftende Meeresluft Atemzug um Atemzug durch seine Zahnlücken pfeifen, daß Castiglione della Pescaia sein Zuhause war und daß er sich hier wohl fühlte.
Und daß er heute zum erstenmal seit langer, langer Zeit überrascht worden war.
Es hatte recht harmlos angefangen. Mit seinem leicht verdunkelten Blick hatte er mitten am Strand einen blau-weißen Sonnenschirm wahrgenommen, wo die übrigen Sonnenanbeter sich so schutzlos wie nur möglich der Frühjahrssonne darboten. Unter dem Sonnenschirm saßen drei Kinder unterschiedlichen Alters, alle kreideweiß, ihre Haut ebenso leuchtend weiß wie ihre Haare. Dann kam noch ein solches Kind und setzte sich, und schließlich eine ebensolche erwachsene Frau mit dem kleinsten ebensolchen Kind an der Hand. Sechs kreideweiße Menschen saßen jetzt aneinandergedrückt unter dem Sonnenschirm und teilten den kleinen kreisförmigen Schatten auf dem mäßig sonnenbeschienenen Strand.
Von dem seltsamen Anblick fasziniert, ließ der alte Fischer für einen Augenblick den Geschäftssinn ruhen und vernahm wie aus der Ferne:
»Cinque cocomori, per favore.«
Das Erstaunen über die merkwürdige Familie unter dem blau-weißen Sonnenschirm vermischte sich mit dem Erstaunen über die gigantische Bestellung – und steigerte sich noch einmal beim Anblick des gutmütig lächelnden Kunden.
Es war ein magerer, gänzlich kreideweißer Mann in einem ausgebeulten Leinenanzug und mit einem bizarren Sonnenhut mit knallgelbem Pikachu.
Der eigenartigen Aussprache zum Trotz war die Bestellung glasklar. Wiewohl absurd.
»Cinque?« stieß der alte Fischer hervor.
»Cinque«, nickte der Kreideweiße, nahm das Bestellte entgegen und taumelte wie ein betrunkener Jongleur mit fünf großen Wassermelonen in den Armen den Strand entlang. Sie sanken nacheinander vor dem Sonnenschirm in den Sand, wie gewaltige Samenkörner, die ein Riese ausstreute. Der kreideweiße Mann warf sich beinah in den Schatten, als habe er sich in einer radioaktiv verseuchten Zone befunden und endlich den Strahlenschutzbereich erreicht.
Der alte Fischer überlegte eine Weile, wie fünf Wassermelonen auf sieben Personen zu verteilen wären. Danach formulierte er die unausweichliche Frage: Warum reist man nach Italien, an die Küste der Toskana, in die Maremma, nach Castiglione della Pescaia, wenn man keine Sonne verträgt?
Arto Söderstedt hatte selbst keine richtig gute Antwort auf die Frage. ›Schönheit‹ war keine zufriedenstellende Antwort, wenn man eine so drastische Maßnahme ergriff, wie fünf Kinder für einen wichtigen Frühjahrsmonat und etwas länger aus der Schule zu nehmen. ›Frieden‹ klang auch nicht überzeugend, wenn zwei erwachsene Menschen sich von ihrer Arbeit im öffentlichen Dienst für Monate beurlauben ließen, besonders nicht, wenn man beim Finanzamt Steuererklärungen prüfte und diese gerade jetzt den Steuerkratzer überschwemmten. So verhielt es sich mit seiner Frau Anja.
Kein Wunder also, daß sich schlechtes Gewissen einstellte und gegen die ›Schönheit‹ ebenso aufbegehrte wie gegen den ›Frieden‹. Nur an seine eigene Situation reichte der Stachel des Gewissens nicht heran. Arto Söderstedt hatte nicht die geringste Spur von schlechtem Gewissen, weil er dem Polizeikorps vorübergehend den Rücken kehrte.
Die A-Gruppe – will sagen ›die Spezialeinheit beim Reichskriminalamt für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter‹ – hatte zwar im vergangenen Jahr vollauf zu tun gehabt, doch die großen, alles andere in den Schatten stellenden Fälle hatten durch Abwesenheit geglänzt, nachdem der als ›die Sickla-Schlacht‹ bezeichnete Fall sein denkwürdiges Ende erreicht hatte. Man war einer großen Katastrophe von internationalem Ausmaß extrem nahe gewesen. Aber das war jetzt fast ein Jahr her, und die Zeit hat ja die Tendenz, alle Wunden zu heilen.
Als ein Geldregen auf ihn niederging wie Manna vom Himmel, reagierte Arto Söderstedt jedenfalls, ohne zu zögern.
Außerdem fühlte er sich ausgebrannt. Alle waren heutzutage ausgebrannt, und wenn er meinte, eine Ausnahme zu sein, dann nur, weil er bisher gar nicht wußte, was es heißt, ausgebrannt zu sein.
Jetzt war auf jeden Fall er an der Reihe. Im Zeichen von ›Schönheit‹ und ›Frieden‹ erlaubte er sich, sein Ausgebranntsein zu kurieren – unabhängig davon, ob es existierte oder nicht. Und von ›Schönheit‹ und ›Frieden‹ gab es in der Toskana eine ganze Menge, dessen war er sich bereits nach wenigen Tagen sicher.
Die Familie mietete eine Villa inmitten der Weinberge des Chianti. Wenn villa auf Italienisch auch etwas ganz anderes bedeutete, so war es doch ein rustikales kleines Steinhaus an einem nach Pinien duftenden Abhang unweit des Dorfes Montefioralle in der Nähe der Stadt Greve. Unterhalb des Abhangs breiteten sich die Weinberge aus wie die Felder der Unendlichkeit, als wäre der Himmel geborsten und das Paradies in kleinen Stücken heruntergefallen, die sich zu einem überirdischen Flickenteppich zusammengesetzt hatten.
Arto Söderstedt genoß in vollen Zügen – zugleich fühlte er sich auf seltsame Weise unwürdig, als wäre Sankt Peter gerade in dem Moment eingenickt, in dem ein weißhäutiger Kriminalinspektor seinen mageren Leib schlangengleich durch das Tor des Paradieses wand. Ganz und gar unverdient. Er fand sich allabendlich auf der Terrasse sitzend wieder, mit einem Glas Vin Santo den Einbruch der Nacht erwartend, oder während ein richtig majestätischer Brunello di Montalcino die Geschmacksknospen umspülte. Zielbewußt unkritisch schluckte er den ganzen Toskana-Mythos, und es ging ihm ausgezeichnet dabei. Von seinem Besuch in Siena, dieser magischen Stadt, würde er niemals auch nur eine Minute vergessen. Trotz der Kinder, die im stilreinen Kanon im Herzen der Kathedrale ein Sirenengeheul anstimmten. Orgelpfeifen, war alles, was er dachte, während er die fünf Geschöpfe betrachtete, die der Größe nach aufgereiht standen und ein Sturmgeheul, Wutgeheul, Dromedargeheul ertönen ließen, bis ein Aufseher die ganze Bande einfach hinauswarf. Ohne eine Spur von schlechtem Gewissen leugnete Söderstedt die Vaterschaft. Der Aufseher beäugte mißtrauisch seine gleichermaßen weiße, nur eine Spur größere Gestalt. Im Hause Gottes in einer solchen Sache zu lügen … In völlig ungestörter Ruhe wandelte er daraufhin eine halbe Stunde lang durch den Dom und genoß Donatello, Michelangelo, Pinturicchio, Bernini und Pisano in tiefen Zügen. Als er herauskam, saßen die Kinder ganz friedlich auf der Treppe der Piazza del Duomo und schleckten italienisches Eis. Nicht einmal Anja, die ein noch größeres Schleckermaul war als die Kinder, wirkte sonderlich empört über die geleugnete Vaterschaft.
Er hatte sogar das Handy abgeschaltet.
Als er jetzt unter dem blau-weißen Sonnenschirm saß und sich zu erinnern versuchte, wie er die Verteilung von fünf Wassermelonen auf sieben Personen unterschiedlicher Größe hatte vornehmen wollen, stellte sich der Gedanke an Onkel Pertti ein. Ein Gedanke, der ihm Dankbarkeit eingab – und ein schlechtes Gewissen.
Er hatte fast vergessen, daß der Alte noch lebte. Und jetzt lebte er nicht mehr.
Onkel Pertti war eigentlich der Onkel seiner Mutter, und in seiner Jugend war Onkel Pertti eine stets gegenwärtige Legende gewesen. Der Held des Winterkriegs. Der Arzt, der einer von den Großen in Mannerheims Armee wurde.
Arto Söderstedt hatte selbst keine Geschwister – wahrscheinlich war das der Grund dafür, daß er mit seiner ebenso geschwisterlosen Frau fünf Kinder in die Welt gesetzt hatte – und seine finnlandschwedische Familie war minimal. Seine geschwisterlosen Eltern waren seit langem tot, und andere Verwandte gab es nicht. Folglich gab es keinen anderen Erben.
Arto Söderstedt fuchtelte mit dem Messer und dachte: fünf geteilt durch sieben, hmm, 0,714 Wassermelone pro Person, vorausgesetzt, daß alle gleich viel bekommen sollen, wenn man aber nach Körpergewicht ginge …
Er hielt inne und betrachtete seine beschattete Großfamilie, die ihrerseits, immer grämlicher, das passive Messer betrachtete. Waren dies wirklich würdige Erben des großen Winterkriegshelden Pertti Lindrot, des Siegers bei Suomussalmi, eines der Architekten der berühmten Motti-Taktik, die die Truppen der an Straßen gebundenen Roten Armee aufrieb, indem sie sie durch den Wald in kleinere Einheiten aufsplitterte, die eine nach der anderen umzingelt und niedergekämpft wurden?
»Schneide sie doch einfach in Stücke«, sagte seine zweitälteste Tochter Linda ungeduldig.
Arto Söderstedt warf ihr einen gekränkten Blick zu. So schlampig führte er seine Aufträge wahrlich nicht aus. Nein. Arto wog fünfundsechzig Kilo, Anja ungefähr genausoviel, Mikaela vierzig, Linda fünfunddreißig, Peter genausoviel, Stefan fünfundzwanzig und die kleine Lina zwanzig. Zusammen zweihundertfünfundachtzig Kilo. Davon müßten also dreiundzwanzig Prozent, fünfundsechzig geteilt durch zweihundertfünfundachtzig, an jedes Elternteil gehen. Dreiundzwanzig Prozent von fünf Melonen sind …
»Schneide sie einfach in Stücke«, echote die kleine Lina.
… sind eins Komma fünfzehn Melonen. Mehr als eine Melone für jedes Elternteil. Hatte er sich die Verteilung ernsthaft so vorgestellt?
Das Messer blieb passiv. Die Familie nicht. Dann gäbe es nur null Komma fünfunddreißig Melonen für die kleine Lina, und das kam ihm nicht gerecht vor.
Gerecht.
War es gerecht, daß er, der sich auf das abenteuerlichste in Schulden gestürzt hatte, um ein großes Familienauto anzuschaffen, von heute auf morgen dieses Auto nicht nur ganz bezahlen konnte, sondern noch so viel übrig hatte, daß er umgehend, ohne die Familie zu informieren, ins Internet ging und für zwei Monate ein Haus in der Toskana mietete?
Nein, nicht besonders gerecht.
Aber was war schon gerecht im Leben?
Bestimmt nicht null Komma fünfunddreißig Melonen für die Kleinste, dachte er mit plötzlicher Entschiedenheit und schnitt die Melone in Stücke, die er ganz und gar gerecht unter den Familienmitgliedern aufteilte.
Fast eine Million. Wer hätte ahnen können, daß der alte Onkel Pertti, dessen Existenz er vergessen hatte, auf solchen Ersparnissen saß? Mit dem Geld kamen die Erinnerungen, und Arto Söderstedt erinnerte sich eigentlich nur an einen stinkenden Mund und halb verfaulte Zähne. An einen Helden, mit dem es abwärts gegangen war, dessen Heldenglorie aber noch immer glasklar strahlte. Er hatte sozusagen recht damit, daß es mit ihm abwärts ging, so verstand er das hochtrabende Gerede seiner Eltern. Er hatte stets den Eindruck gehabt, daß sie es waren, seine Eltern, die den letzten verbliebenen Familienangehörigen versorgten. Und dann zeigte es sich. Daß er auf einer Million saß. Finnmark.
Nichts ist genau das, was es zu sein scheint.
Nach seiner Rekonstruktion mußte Onkel Perttis Lebenslauf ungefähr folgendermaßen ausgesehen haben: Junger enthusiastischer Landarzt wird nach dem ziemlich abrupten Angriff der Sowjetunion in den finnischen Winterkrieg hineingezogen. Er beweist großes Talent für den Guerillakrieg in winterlichen Wäldern und wird mehrfach befördert. Nach einigen entscheidenden Schlachten wird er zum Helden und verschwindet beim Sieg der Russen in den Wäldern wie ein klassischer Guerillero. Bei Kriegsende taucht er wieder auf, mehr oder weniger gebrochen. Trinkt immer mehr, kann sich auf verschiedenen Arztstellen in immer versteckteren Provinznestern nicht halten, kehrt schließlich nach Vasa zurück und wird ein Original, das bis ins hohe Alter von neunzig Jahren sein trauriges Leben führt. End of story.
Glaubte Arto Söderstedt.
Bis das Erbe kam.
Das jetzt, unter anderem in Form einer ansehnlichen Menge von Wassermelonenstücken, verbraucht wurde, in einem Schatten, der immer gigantischer wurde. Die toskanische Frühlingssonne berührte zu diesem Zeitpunkt den deutlich gebogenen Horizont des ligurischen Meeres. Bald würde sie tief genug stehen, daß die kreideweiße Familie sich hinauswagen könnte, um zu baden.
Wenn alle anderen – fröstelnd – den Strand verlassen hätten.
Arto Söderstedt sah den alten Fischer seinen Stand mit Melonen zusammenpacken, einen verwunderten Blick auf die beschattete Familie werfen, den Kopf schütteln und davonziehen, um in seiner Stamm-Osteria ein Glas Wein zu trinken. Dort würde er von der sonnenscheuen Familie erzählen und Geld auf den Tisch legen, das einst einem ganz anderen Original an einem ganz anderen Ort Europas gehört hatte.
Arto Söderstedt ließ sich für einen kurzen Augenblick von den Bewegungen des Geldes, den Wanderungen des Geldes, dem Ursprung des Geldes faszinieren.
Dann zog er den verknitterten Anzug aus und lief als erster vor einer Reihe von Kindern ans Wasser und tauchte den großen Zeh hinein, dessen Eiseskälte ihn an die finnischen Binnenseen seiner Kindheit erinnerte.
Am Strand saß Onkel Pertti, trank Koskenkorva aus der Flasche und lachte heiser über seine Feigheit.
Er lief hinein. Die Kinder heulten wie die Sirenen.
Im Rucksack oben unter dem blau-weißen Sonnenschirm lag das noch immer abgeschaltete Mobiltelefon.
3
Das Mädchen mit dem Glück im Unglück saß auf dem Krankenhausbett und sah verwundert aus. Vermutlich hatte sie seit dem vorausgegangenen Abend nicht aufgehört, verwundert auszusehen. Es war eine anhaltende Verwunderung.
Paul Hjelm fand ihre Verwunderung ganz und gar verständlich. Wenn man zehn Jahre alt ist und an der Hand seines Papas durch den Frühlingsabend spaziert, erwartet man kaum, angeschossen zu werden.
Doch genau das war passiert.
Sie hatte ein wenig gefroren, es war plötzlich Wind aufgekommen, der durch ihre dünne Daunenjacke drang und ihre bloßen Beine mit Gänsehaut bedeckte. Eine Hand hatte sie in Papas Hand geschoben, in der anderen hielt sie einen Ballon in Form eines lachenden gelben Clowns. Sie war ein bißchen gehüpft, hauptsächlich, um sich warm zu halten, aber auch, weil sie froh war über die Wundertüte, die sie aus dem Fischteich geangelt hatte und die jetzt in dem Plastikbeutel lag, den Papa trug. Sie fror ein bißchen, aber sonst war alles prima.
Da wurde sie von einer Kugel getroffen.
Von irgendwoher kam eine Kugel und schlug in ihren rechten Oberarm. Da blieb sie. Zum Glück.
Sie hatte Glück im Unglück.
»Das wird bald wieder gut, Lisa«, sagte Paul Hjelm und legte seine Hand auf ihre. »Es ist nur eine Fleischwunde.«
Lisas Papa saß mit verweintem Gesicht und übernächtigt auf dem Besuchsstuhl und schnarchte. Paul Hjelm tippte ihm vorsichtig an die Schulter. Er fuhr mit einem schniefenden Laut hoch und starrte verständnislos auf den Polizeibeamten auf der Bettkante. Dann sah er seine Tochter mit dem bandagierten Arm, und das Schreckliche fiel ihm wieder ein.
»Entschuldigen Sie, Herr Altbratt«, sagte Hjelm verbindlich. »Ich muß nur absolut sicher sein, daß Sie wirklich keine Spur eines Täters gesehen haben. Keine Bewegung zwischen den Bäumen? Nichts?«
Herr Altbratt schüttelte den Kopf und starrte auf seine Hände. »Es war kein einziger Mensch in der Nähe«, sagte er leise. »Es war kein Laut zu hören. Plötzlich schrie Lisa auf, und ihr Arm blutete. Erst als der Arzt es mir sagte, begriff ich, daß eine Kugel sie getroffen hatte. Eine Schußwunde! In was für einer Welt leben wir bloß?«
»Sie gingen also auf Sirishovsvägen in Richtung Djurgårdsvägen? Wo waren Sie genau?«
»Spielt das denn eine Rolle?«
Paul Hjelms Handy klingelte. Das war jetzt nicht so ganz passend. Er hoffte, daß keine Respiratoren oder Herz-Lungen-Maschinen den Geist aufgaben, wenn er antwortete. Er sah die Schlagzeilen vor sich: ›Das Handymassaker! Exklusiver Sonderbericht! Bekannter Kriminalbeamter ermordet vier Schwerkranke mit Handy.‹
»Hjelm«, meldete er sich lakonisch, denn wie meldet man sich anders am Telefon, wenn man nicht schwer gestört ist? Oder möglicherweise ein Anrufbeantworter …
Es war einen Augenblick still. Papa Altbratt sah ihn an, als wäre er dabei, einem vom Aussterben bedrohten Adler die Federn auszureißen. Lisa Altbratt sah weiter verwundert aus.
»Skansen?« stieß der Adlerschänder aus. Das war alles. Dann stand er auf, streichelte Lisa übers Haar und streckte dem Vater die Hand hin. »Ich muß fort, leider. Ich melde mich noch einmal.«
Auf der Treppe der Kinderaufnahme des Karolinska schien ihm eine Vormittagssonne ins Gesicht, die nicht wärmte. Astrid Lindgrens Kinderkrankenhaus.
Er klopfte sich an sämtliche Taschen, während er zum Parkplatz ging. Die Autoschlüssel waren verschwunden. Andererseits hatten sie es so an sich, verschwunden zu sein, also führte er das Klopfritual ein zweites Mal durch, und simsalabim! schon schwebten sie aus der Tasche des viel zu dünnen Jacketts herauf. Same procedure as last year.
Es war einer dieser frischen Frühlingsmorgen, mit denen die erste Woche im Mai um sich zu werfen pflegt. Solche Tage, die durchs Fenster so einladend aussehen, sich dann aber als heimtückisch maskierte Wintertage erweisen. Da er immer zu dünn angezogen war, hatte er jetzt praktisch nichts an. Die jämmerlichen Kleidungsfetzen boten nicht den geringsten Widerstand gegen die Eiswinde. Er versuchte, sie dichter um den Körper zu ziehen, aber da war nichts, was er dichter zusammenziehen konnte.
Es war neun Uhr am Vormittag, und die Autoschlangen um Haga Södra und Norrtull standen vollkommen still. Im letzten Jahr hatte der Autoverkehr drastisch zugenommen. Auf einmal war es überaus attraktiv, in Staus festzusitzen. Billige Psychotherapie vermutlich, eine Serie von Käfigen, in denen Urschreie ausgestoßen werden konnten. Andererseits waren die Alternativen kürzlich privatisierte Pendelzüge, die nie fuhren, oder gleichfalls privatisierte U-Bahnen, die stundenlang in finsteren Tunneln feststeckten, oder das Fahrrad auf sadistisch angelegten Radwegen, die niemand zu benutzen wagte, weil sie für äußerst häßliche Unfallverletzungen gemacht zu sein schienen.
Okay, er war ein Meckerpott.
Selbst hatte er wirklich keinen Grund zu klagen. Die rote U-Bahnlinie war von Dummheiten einigermaßen verschont geblieben. Seine tägliche lange U-Bahnfahrt zwischen Norsborg und Stockholm widmete er wie bisher intensivem, weltabgewandtem Hören von Jazz. Nach einem Ausflug in die Welt der Oper, einem leicht zerrütteten Kommissar Morse nicht unähnlich, war er zum Jazz zurückgekehrt. Er konnte sich nicht richtig von den Bebop-Jahren um 1960 losreißen. Gerade jetzt war es Miles Davis. Kind of Blue. Fabelhafte Meisterwerke ganz einfach, jedes einzelne Stück auf der Platte. Fünf Klassiker: ›So What‹, ›Freddie Freeloader‹, ›Blue in Green‹, ›All Blues‹ und ›Flamenco Sketches‹ – alle während des goldenen Jahres 1959 im Studio improvisiert. Die Musiker kamen ins Studio, ohne die Musik vorher gesehen zu haben. Miles kam mit einem Stapel Notenblätter, und sämtliche fünf Stücke sollen beim allerersten Versuch gesessen haben. Irgendwie so, als wäre dies eine Musik, die entstand, während sie vorgeführt wurde, die sich unmittelbar setzte. Eine neue Art von Blues, unendlich erdnah, unendlich sophisticated. Jede Sekunde ein Genuß.
Doch während der Arbeit gab es einen Dienstwagen. Er drückte den auf wunderbare Weise herbeigezauberten Schlüssel ins Zündschloß des beigefarbenen alten Audis, blickte über den Verkehr hin und seufzte schwer.
Es würde wahrscheinlich schneller gehen, nach Djurgården zu schwimmen.
Denn dorthin war er unterwegs. Der Kollege und Tandempartner Jorge Chavez hatte diesen versteckt hoffnungsvollen Unterton in der Stimme, nach dem Paul Hjelm sich schon lange sehnte. »Ich glaube, du solltest herkommen, Paul. Nach Skansen.«
Daß er gerade von einem anderen Fall kam, der mit der Umgebung von Skansen verknüpft war, machte die Sache zusätzlich interessant.
Er blieb bereits auf dem Gelände des Karolinska in Autoschlangen stecken und beschloß, keine Urschreie auszustoßen. Es war die Mühe nicht wert. Statt dessen ließ er die CD mit Kind of Blue in den CD-Spieler des Autoradios gleiten und lächelte, als die ersten Töne sich wie Honig über seine Trommelfelle legten. Während er sich sanftmütig aus dem riesigen Krankenhausgelände hinauskämpfte, verfiel er darauf, eigentümliche Nachnamen in eine Rangfolge zu sortieren. War nicht Altbratt ein Spitzenkandidat? Früher war er auf Größen wie Kungskranz und Riddarsson, Äppelblohm und Markander gestoßen, aber hatten die gegen Altbratt wirklich eine Chance?
Anton Altbratt war der wohlhabende Besitzer eines Pelzgeschäfts auf Östermalm, wohnhaft in Djurgårdsstaden, in zweiter Ehe lebend, deren Frucht die zehnjährige Lisa war. Er hatte natürlich ein paar erwachsene Kinder aus erster Ehe, und die neue Ehefrau, Lisas Mutter, war nicht zu erreichen gewesen. Sie befand sich auf Geschäftsreise an unbekanntem Ort. Hjelm bekam den Eindruck eines verwickelten erotischen Arrangements, beschloß jedoch, nicht nachzufragen.
Was konnte hinter dem Schuß auf die arme kleine Lisa stecken? Es war zu hoffen, daß es Papa Anton war, auf den es der Schütze abgesehen hatte. In dem Fall wäre es etwas einfacher, sich rationale Motive vorzustellen – die junge Ehefrau, die auf die Oberklasse zugeschnittene Geschäftstätigkeit, vielleicht sogar ein Angriff militanter Tierschützer auf einen Pelzhändler. Obwohl die Lautlosigkeit auf einen Schalldämpfer und damit auf eine Form von professioneller Kriminalität schließen ließ – also eher die Ehefrau, die aus finanziellen oder sexuellen Gründen den Gatten aus dem Weg räumen wollte, oder lichtscheue Geschäftsverbindungen, vielleicht illegaler Pelzhandel. Oder etwas in der Art. Dann war es nicht so bedrohlich. Ein geplanter, aber mißglückter einmaliger Angriff. War dagegen Lisa das auserwählte Opfer, sah es schlechter aus. Dann verflüchtigten sich die meisten rationalen Motive, und ein Wahnsinniger vom Typ Laser-Mann wirkte wahrscheinlicher. Allerdings mit Kindern als Spezialität.
Den Gedanken wollte Paul Hjelm lieber nicht zu Ende denken.
Natürlich gab es noch eine dritte Möglichkeit: daß weder der Vater noch die Tochter als Opfer ausersehen waren, sondern daß die Kugel aus schierem Zufall den Weg in Lisas Arm gefunden hatte. Für den Fall lag es nahe, von einer Abrechnung in der Unterwelt auszugehen, und die hatte sich irgendwo zwischen den Bäumen von Djurgården abgespielt.
Es gab also einiges, was man tun konnte. Die Aktivitäten der Ehefrau am gestrigen Abend überprüfen, herausfinden, wie die Ehe eigentlich aussah, nachprüfen, wer von dem Kinderfest oben in Rosendal wußte, die Führung der Geschäfte auf Unregelmäßigkeiten abklopfen, eventuelle Drohungen militanter Tierschützer oder ähnlicher Gruppen überprüfen, das Waldgelände, aus dem der Schuß mit großer Wahrscheinlichkeit abgefeuert wurde, durchsuchen. Und so weiter.
Sowie abwarten und sehen, ob es reiner Zufall war, daß zwei Verbrechen so nah beieinander begangen worden waren – je nach dem, was Jorge nun oben in Skansen zu bieten hatte.
Zeit Zeit Zeit. Er saß wirklich fest. Die Motortemperatur des Audis stieg wie gewöhnlich bei der geringsten Andeutung eines Staus drastisch an. Es war ein Wagen ohne die geringste Geduld. Da der Fahrer sich weigerte, aufzubegehren, mußte es statt dessen der Wagen tun. Als ob jedes in der Schlange stehende Fahrzeug per definitionem gezwungen wäre zu explodieren. Paul Hjelm stellte Gebläse und Heizung auf Maximum und dankte seinem Schöpfer, daß in Stockholm eher winterliche Kälte als sommerliche Hitze herrschte. Mit einem Auge auf der Anzeige der Motortemperatur ließ er seinen Gedanken freien Lauf – in der Begleitung von Miles Davis’ und John Coltranes und Bill Evans’ und Cannonball Adderleys und Wynton Kellys und Paul Chambers und Jimmy Cobbs unübertroffenen Improvisationen.
Ein Bild seines Lebens kam ihm plötzlich in den Sinn.
Ein eiskalt kontrollierendes Auge auf einen Motor, der kurz davor ist, zu explodieren. Gedankenbahnen in Form waghalsiger Improvisationen. Während sich der Wagen gleichzeitig äußerst langsam vorwärts bewegt.
Doch, genau so war es. Obwohl irgend etwas fehlte, um das Bild komplett zu machen.
Gerade als ›So What‹ in ›Freddie Freeloader‹ überging und ein geläufigerer Zwölftaktblues sich in die als Auto verkleidete Sauna ergoß, offenbarte sich auf dem rechten Fahrstreifen bei Roslagstull eine Lücke. Er schoß hinein, gab Gas, daß die Reifen quietschten, schaffte es noch bei dem neuen, europäisch vollgelben Ampellicht über die Kreuzung und sah plötzlich die gesamte Birger Jarlsgata leer vor sich liegen.
Doch, dachte er, jetzt stimmt es, jetzt ist das Bild komplett.
›Freddie Freeloader‹, dachte er und trat das Gaspedal durch bis zum Anschlag.
Es ging bemerkenswert glatt bis zum Stureplan, wo er in ein beinah obligatorisches Gerangel mit rücksichtslosen Fahrern von Reklamefirmen geriet, die auf ihrem Recht bestanden, auch wenn sie noch so sehr im Unrecht waren. Paul Hjelm war es egal. Laß sie doch, dachte er und lallte die Schlußsequenz des langen Solos der Zirkelkomposition ›Blue in Green‹ mit. Und auch im Wirrwarr unten am Nybroplan behielt er kühlen Kopf. Gerade als er bei offenem Seitenfenster eine Lieblingsphrase aus ›All Blues‹ grölte, sah er Ingmar Bergman mit Stock und allem ins ›Dramaten‹ tapern. Nicht ohne eine gewisse Verblüffung wandte der Alte sich um, und für einen Moment begegneten sich ihre Blicke. Es war sagenhaft.
Strandvägen war schlimmer. Es sah ungeheuer dicht aus.
Nein, dachte er. Jetzt war das Bild komplett. Eine schnelle, kurze Strecke freie Fahrt, und dann wieder das langsame, zähe, ruckhafte Vorwärtskommen. Schleppend.
Es lockerte sich ein wenig, und über Djurgårdsbron ging es richtig gut. Da hatte das Bild sich bereits in Luft aufgelöst. Gerade als er heillos vorschriftswidrig vor dem Eingang von Skansen parkte, verklangen die spanisch beeinflußten letzten Harmonien von ›Flamenco Sketches‹. Da rede noch einer von Präzision. Der Weg von Astrid Lindgren via Ingmar Bergman nach Skansen – wie eine Reise ins Herz Schwedens – war genauso lang wie Kind of Blue mit Miles Davis. Soviel dazu. Auf die Sekunde drei Viertel Stunden.
Es war also Viertel vor zehn, als Paul Hjelm durch die Tore von Skansen einzog, versehen mit einer kleinen Karte und dem Hinweis, sich zu den ›wilden Tieren‹ in der Nordostecke des großen Freilichtmuseums zu begeben. Während er auf der langen, überdachten Rolltreppe, die den Berg hinaufführte, nach oben glitt, überlegte er, welche Tiere nicht wild waren. War zum Beispiel der Mensch ein wildes Tier? Oben angekommen, trat er in ein ganz anderes Wetter hinaus als das, das er unten zurückgelassen hatte. Alle Winterwinde waren wie fortgeblasen, statt dessen wanderte er im denkbar höchsten Hochsommer durch die artifizielle Stadt des neunzehnten Jahrhunderts. Aprilwetter, hätte er fast gesagt, aber es war ja tatsächlich schon Mai. Donnerstag, der vierte Mai im Jahr des Herrn zwanzighundert. Oder zweitausend. Während die Sonne von den faluroten Wänden zurückgeworfen wurde, dachte er über die Konjunkturschwankungen in der Bezeichnung des Jahres 2000 nach. Zunächst war es selbstverständlich gewesen, vom ›Jahr zweitausend‹ zu sprechen, dann – nach der massiven Propagandakampagne einer unbekannten Sprachreinigungsinstanz – wurde es ebenso selbstverständlich, ›das Jahr zwanzighundert‹ zu sagen, auch wenn dies häufig mit einer gewissen Selbstüberwindung geschah. Und obwohl die offizielle Zwanzighundert-Version festlag, hörte man inzwischen oft, daß das eher dubiose Zweitausend benutzt wurde, hinter vorgehaltener Hand, als gehörte man dadurch zu einer unterirdischen Widerstandsbewegung. Widerstand aus dem Volk. Er selbst verfolgte eine Sowohl-als-auch-Linie. Sie erweckte allgemein Abneigung und orientierte sich am Verstakt. ›Zwanzighundert‹ waren zwei aufeinanderfolgende Trochäen, nach dem Schema – ∪ – ∪, während ›zweitausend‹ das rhythmisch unreine – – ∪ war, also zwei einleitende betonte Silben, denen eine unbetonte folgte. Da es weder für das erste noch für das zweite irgendwelche akzeptablen Argumente gab, ließ er den sprachrhythmischen Zusammenhang ausschlaggebend sein. Der Kampf zwischen den beiden Bezeichnungsvarianten war in Paul Hjelms Augen ein ganz und gar nacktes Zeitbild: der Wille zur Macht in seiner reinsten Form. Man wollte recht haben, man wollte gewinnen, und weder die nahezu nichtexistente Bedeutung der Frage noch der Mangel an Argumenten spielte irgendeine Rolle. Und die Widersacher waren sich in genau dem Punkt einig: Das Unentschiedene war der schlimmste Feind. Paul Hjelm war durch und durch überzeugt davon, daß seine eigene Position die eigentliche Widerstandsbewegung vertrat.
Daran also dachte der Kriminalinspektor in diesem Jahr des Herrn, in dem Schweden von Amnesty wegen gravierend zunehmender Polizeigewalt angeprangert wurde: Polizisten, hieß es, drehten regelmäßig die Gummiknüppel um, so daß sie mit der harten Seite schlugen, und Kosovo-Albaner wurden mit fünftausend edelschwedischen Kronen in der Tasche in ihre verwüsteten Heimatdörfer zurückgeschickt.
Einen kurzen Augenblick war ihm so, als hätte irgend jemand sich sein gesamtes Denkmuster angeeignet.
Er fragte sich, wohin all die guten alten sexuellen Phantasien verschwunden waren, die einem, neuesten Forschungen zufolge, mindestens fünfzehnmal am Tag kommen sollten.
Und eine letzte Frage fuhr ihm noch durch den Sinn, bevor er die Raubtiere witterte: Wer zum Teufel war dieser exemplarische Mensch, der fünfzehn sexuelle Phantasien am Tag schaffte? Dann nahm die Witterung überhand, und Paul Hjelm spürte eine echte Erwartung: wie ein Kind, wenn der Auftritt des Weihnachtsmanns unmittelbar bevorsteht, in dem Augenblick, in dem Papa sich mit einer Miene eindeutig vorgetäuschter Ausdruckslosigkeit auf die Toilette schleicht. Und der Weihnachtsmann hieß etwas so Komisches wie Jorge Chavez und war etwas so Hölzernes wie Kriminalinspektor beim Reichskriminalamt.
Genau wie er selbst.
Danach verschwand die Witterung ebenso plötzlich, wie sie gekommen war. Paul Hjelm war nämlich dabei, sich zu verirren. Später sollte er jede Kenntnis besagten Vorkommnisses leugnen, aber Tatsache war, daß er sich in Skansen verirrte. Seine Kinder gingen auf die Zwanzig zu, und es war eine gehörig lange Zeit her, seit sie sich nicht mehr von dem billigen Skansentrick täuschen ließen, zu dem man greift, wenn einem alle anderen Ideen ausgegangen sind. Inzwischen waren die Wildtiergehege in dem großen Freilichtmuseum umgebaut worden, und er fand sich unversehens im Gespräch mit einem unendlich träge wiederkäuenden Elchbullen, der wie ausgestopft und aufgezogen wirkte. Jemand anderes, um ein Gespräch zu führen, war nämlich nicht zu sehen. Es ging auf zehn Uhr zu, und vermutlich war Skansen ganz einfach geschlossen. Es war kein einziger Mensch in der Nähe, und der dusselige Elch hatte wenig zu sagen.
Vor allem schien er in totaler Unkenntnis darüber zu sein, wo sich die mörderischen Marder aufhalten konnten.
Schließlich landete Hjelm am Bärenfelsen, für ihn unbekanntes Territorium. Alles war mächtig aufgerüstet, und er verließ die labyrinthischen Konstruktionen mit dem Gefühl, einem ausgeworfenen Garnknäuel gefolgt zu sein. Er kam bei den Pferden und Luchsen und Wildschweinen und Wölfen vorbei, und plötzlich war er da.
Bei den Vielfraßen.
Dort waren um so mehr Menschen in Aktion. Er erkannte sogleich die weißgekleideten Kriminaltechniker, die wie Bergsteiger im Anfängerkurs die kleinen Hügel im Inneren des Territoriums der Vielfraße auf und ab rutschten. Er erkannte das rot-weiße Plastikband, das kreuz und quer vor dem Schutzzaun ausgespannt war und ›Polizei‹ schrie. Er erkannte ein ziemlich moosbewachsenes Gesicht um die Achtzig, das dem Chefobduzenten Sigvard Qvarfordt gehörte. Er erkannte ein stramm germanisches Gesicht, das zum Chefkriminaltechniker Brynolf Svenhagen gehörte. Und er erkannte ein überaus energisches dunkelhäutiges Gesicht, das einem engen Kollegen gehörte – der außerdem der Schwiegersohn des Chefkriminaltechnikers Svenhagen war. Sein Name war Jorge Chavez.
Chavez erblickte Hjelm, sein Gesicht hellte sich auf, er näherte sich dem tiefen Graben, der den inneren Teil des Vielfraßgeheges vom äußeren trennte, breitete die Arme aus und rief, als habe er es eingeübt (was vermutlich der Fall war): »Wirf ab deine menschliche Hülle, o Krone der Schöpfung, und tritt ein in unsere animalische Orgie.«
Paul Hjelm seufzte und sagte: »Wie denn, verdammt?«
Jorge Chavez hob verwundert die Augenbrauen und blickte sich um. Schließlich wandte er sich an Brynolf Svenhagen, der vor allem hin und her zu wandern schien und stramm aussah. Als sei das eine Lebensaufgabe.
»Hast du die Laufplanke geklaut, Brunte?«
Brynolf Svenhagen betrachtete seinen Schwiegersohn mit tief empfundener Abneigung und sagte, wenig aufschlußreich: »Ich heiße nicht Brunte.«
Woraufhin er weiter wanderte und stramm aussah.
Chavez kratzte sich den Kopf. »Wahrscheinlich haben die Pornopolizisten sie beiseite gebracht«, sagte er. »Gleich lassen sie auch noch die Vielfraße rein.«
Paul Hjelm kletterte auf den schlanken Holzzaun, balancierte einen Augenblick und tat anschließend einen gewagten Sprung ins Nichts. Wie eine Ballerina schwebte er über dem wassergefüllten tiefen Graben und landete geschmeidig auf dem Trockenen neben seinem Kollegen. Es war sehr überraschend.
»Grazil«, sagte Chavez anerkennend.
»Danke«, sagte Hjelm, selbst noch tief verwundert darüber, daß er nicht rücklings in den Vielfraßgraben gestürzt, von Vielfraßkot überhäuft worden war und sich ein paar Nackenwirbel gebrochen hatte.
Er sah sich um. Das Territorium der Vielfraße war recht weitläufig, ein welliges Gelände, das sich hinauf zu einer verhältnismäßig hohen Hügelkuppe erstreckte. Hier und da waren Löcher im Boden zu sehen, wahrscheinlich Baue, und große Teile des grasbewachsenen Terrains waren von klitzekleinen Stoffstückchen bedeckt, fast wie Federn verschiedener Farben und verschiedenen Materials. Die Kriminaltechniker taten alles, was in ihrer Macht stand, um zu verhindern, daß der mäßige Morgenwind sämtliche Fasern davontrug.
Paul zeigte auf die Fasern. Jorge nickte, nahm ihn am Arm und führte ihn in Richtung der hinteren Ecke des Vielfraßgeheges, wo der Graben nur eine senkrecht abfallende Betonwand von drei Metern Tiefe hinunter zu dem eher erdigen als grasbewachsenen Boden war. »Fangen wir von vorn an«, sagte er.
Die Fasern hatten hier, zumindest teilweise, etwas zusammenhängendere Formen, vor allem ein hellrosafarbenes Hosenbein.
Aus dem Hosenbein schauten etwa zehn Zentimeter eines abgenagten Knochenpaars heraus.
Wahrscheinlich ein Schienbein und ein Wadenbein.
»Das ist das größte Stück, das übriggeblieben ist«, sagte Chavez bedächtig und ging in die Hocke. Hjelm tat es ihm nach und wartete auf die Fortsetzung. Sie kam.
»Gulo gulo heißen sie. Lateinisch für Vielfraß. Süße kleine Viecher. Sehen wie goldige Bärenjunge aus. Familie der Marder. Die nächsten Verwandten sind Dachs, Baummarder, Iltis, Wiesel, Otter und Nerz. Sie sind von der Ausrottung bedroht, und es gibt in Schweden nur noch rund hundert. Hoch oben im Gebirge. Sie werden einen Meter lang und ernähren sich in der Regel von Erdmäusen und Lemmingen. Doch manchmal wechseln sie das Beutetier …«
Hjelm stand auf und streckte den Rücken. »Okay«, sagte er tastend. »Jemand war betrunken, ist ins Skansen geklettert und zu den Raubtieren hier hineingefallen. Es kann nicht das erste Mal gewesen sein.«
»Hätte ich dich dann hergerufen?« sagte Chavez und sah ihn scharf an. »Dies sind ungewöhnlich präzisionsangepaßte Mörderbestien. Kennst du deinen Ellroy nicht? Bei der geringsten Provokation reißen sie einen Menschen in Stücke, besonders wenn sie in Gruppen zusammenarbeiten. Ihre Schnauzen sind Bolzenschneider. Sie brechen umstandslos Knochen und zermalmen sie. Im Grunde haben wir Glück, daß überhaupt noch was übrig ist.«
Mit Hilfe eines Bleistifts hob Chavez vorsichtig den Stoff des gekappten Hosenbeins an. Etwas weiter oben im Verborgenen saß noch Fleisch an den Knochen und hielt sie zusammen. Da saß auch ein Knoten, an einem Stück Tau.
»Aha«, sagte Hjelm und ging wieder in die Hocke.
»Das kann man wohl sagen«, übernahm Chavez und fügte hinzu: »M.«
»O«, sagte Hjelm.
»R«, sagte Chavez.
»D«, sagte Hjelm.
»Ohne Zweifel«, sagte Chavez. »Und es wäre schön, wenn wir einen Kopf finden könnten. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Variante des Themas«, fuhr er fort und hielt den alten Gerichtsmediziner Qvarfordt auf. »Gibt es etwas Neues, guter Mann?« fragte er galant.
»Nix«, entgegnete der trotz Pensionierung unermüdliche Sigvard Qvarfordt und schob mit einer routinierten Kaubewegung das zu locker sitzende Gebiß an seinen Platz. »Kein Kopf, keine Finger. Schwer zu identifizieren. Für einen DNA-Befund sollte es reichen, doch wie ihr wißt, ist das System nicht besonders gut ausgebaut. Aber es ist ein Mann. Erwachsenes Individuum männlichen Geschlechts, also. Der Gerinnungsgrad des Bluts läßt auf gestern abend bis in die Nacht schließen. Und es wäre ja auch erstaunlich, wenn er länger gelegen hätte. Kindereltern und ähnliche Elemente hätten sicher Anstoß daran genommen, wenn unser Freund am hellichten Tag konsumiert worden wäre. Sonst habe ich nichts zu bieten.«
In diesem Moment heulte ein Kriminaltechniker oben auf dem Hügel auf und wedelte mit etwas, das er aus einem der Löcher herausgeholt hatte. Es sah aus wie eine Vielfraßkackwurst. Paul Hjelm ließ sich das Wort ein paarmal im Mund herumgehen. Hatte er dieses Wort in seinem bisherigen Leben schon benutzt? Die Wahrscheinlichkeit war gleich Null.
»Vermutlich ein Vielfraßpimmel«, flüsterte Chavez in Bühnenlautstärke.
»Hoffentlich war der Vielfraß nicht mehr in der Höhle«, flüsterte Hjelm deutlich vernehmbar zurück.
Während der Techniker den Hügel herunterrutschte, dachte Hjelm einen kurzen Moment über verschiedene Assoziationsbahnen und ihre Bedeutung nach. Der Techniker trat zu seinem Chef, der dastand und stramm aussah. Brynolf Svenhagen nahm den Gegenstand in Empfang, drehte und wendete ihn eine Weile und begann dann, in Richtung des Trios zu gehen. Er hielt dem alten Qvarfordt den Gegenstand hin, der durch eine zentimeterdicke Brille darauf starrte und dann nickte. »Ausgezeichnet«, war alles, was er sagte.
Widerwillig wandte sich dann der stramme Svenhagen an seinen Schwiegersohn und dessen mindestens ebenso verabscheuungswürdigen Kollegen. Er hielt den Gegenstand in die Luft.
Es war ein Finger.
»Ausgezeichnet«, sagte Chavez, ohne die geringste Neigung erkennen zu lassen, ihn genau betrachten zu wollen. »Fingerabdrücke«, fügte er überflüssigerweise noch hinzu.
Svenhagen machte auf dem Absatz kehrt. Chavez griff den flatternden weißen Ärmel und zog ihn an sich. Es wirkte wie ein Vorgeschmack der Fußball-Europameisterschaft.
»Leck mich doch«, sagte Svenhagen verbissen.
»Können wir eine erste Übersicht bekommen, Brunte? Wenn das nicht zuviel verlangt ist?«
Brynolf Svenhagen nickte schwer.
»Wir sind Polizisten«, sagte Hjelm, um Hilfestellung zu geben.
Svenhagen ließ eine weitere Mißfallensäußerung hören und überwand sich. Er führte die beiden Kriminalinspektoren zum Rand des Vielfraßgeheges, unmittelbar neben dem drei Meter tief abstürzenden Graben vor den Zuschauerplätzen. Dort ging der Gras- und Steinuntergrund in schwarze Erde über, und genau hier war der Bestand an bunten Fasern besonders groß. Dort waren auch die einzigen Blutspuren zu sehen, ein dunklerer Fleck, der fast ganz von dem erdigen Untergrund aufgesogen worden war. »Paßt auf, wohin ihr hier tretet«, sagte Svenhagen.
»Wie viele Vielfraße waren es?« fragte Hjelm.
»Vier«, erwiderte Svenhagen.
»Vier bestialische Ungeheuer, die sich einen Menschen einverleiben, und fast nirgendwo eine Blutspur – ist das nicht sonderbar?«
Svenhagen hielt inne und richtete einen eisblauen Begreifst-du-gar-nichts-Blick auf Hjelm. »Es hat während der Nacht geregnet«, sagte er und beugte sich nieder. »Glücklicherweise ist dies hier erhalten geblieben«, sagte er und zeigte auf den Boden.
Unmittelbar unter Brynolf Svenhagens Zeigefinger konnte Hjelm eine Reihe von Vertiefungen im Sand erkennen. Mit einer gewissen Mühe konnte er Buchstaben ausmachen. Fünf Stück.
Er buchstabierte »Epivu?«
»Allem Anschein nach«, bekräftigte Svenhagen. »Aber frag mich nicht, was es bedeutet.«
»Hat er es geschrieben?«
»Das wissen wir nicht. Die Größe der Buchstaben paßt zu einem menschlichen Finger, soviel können wir sagen. Außerdem läßt die Menge der Fasern darauf schließen, daß dies der Ort der eigentlichen … Nahrungsaufnahme sein könnte. In dem Fall könnte man sich vorstellen, daß das Opfer, an Händen und Füßen gefesselt, eine letzte Mitteilung schrieb. Wir haben Proben entnommen, um zu untersuchen, ob die Erde Blutspuren oder Hautreste enthält. Und vielleicht kann auch dieser Finger zur Lösung des Rätsels beitragen.«
»Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wie er hier gelandet ist?«
»Nein«, sagte Svenhagen. »Natürlich massenweise Fingerabdrücke am Zaun, aber sonst nichts. Wir müssen uns alles vornehmen.«
»Wenn wir davon ausgehen, daß er derjenige war, der ›Epivu‹ geschrieben hat, dann kann er nicht ohne Kopf hier gelandet sein. Wie kann ein Kopf verschwinden?«
»Es gibt verschiedene Möglichkeiten«, sagte Svenhagen und betrachtete Hjelm. Vielleicht war dieser Mann doch nicht der Vollidiot, für den er ihn bisher gehalten hatte. Aber Brynolf Svenhagen war keiner, der es gern sah, wenn seine Vorurteile über den Haufen geworfen wurden. Das machte ihn womöglich noch bissiger. Er fuhr grimmig fort: »Die Vielfraße können ihn ganz einfach aufgefressen haben. Es ist tatsächlich nicht ganz unwahrscheinlich, daß sie sich den gesamten Schädel einverleibt haben, mit Kranium, Zähnen und Gehirnrinde und dem ganzen Kram. Aber es kann ja auch sein, daß es gar nicht er war, der diese Buchstaben geschrieben hat. Ihr müßt das mit den Tierpflegern klären, das ist euer Job. Vielleicht heißt einer der Vielfraße Epivu, was weiß ich?«
Hjelm ließ nicht locker. Er blickte sich in dem unwegsamen Gelände um. »Der Schädel kann sich also sehr wohl noch hier irgendwo befinden? Da hilft wohl nur weitersuchen. Außerdem vermute ich, daß ihr euch in der nächsten Zeit durch jede Menge Vielfraßkacke hindurchwühlen müßt. Vielleicht ist es nicht nur ein Mensch, vielleicht sind es zwei oder mehr oder eine ganze Fußballmannschaft, die von den bösartigen Vielfraßen verschlungen worden sind.«
Bei der Erwähnung des Durchwühlens von Vielfraßkacke sah Hjelm ein leichtes Zucken zwischen Brynolf Svenhagens Augen. So weit hatte der hyperorganisierte Chefkriminaltechniker offenbar nicht gedacht. Es war Hjelm eine kleine Genugtuung. Diese wunderlichen kleinen Machtkämpfe, an denen das soziale Leben so reich ist …
Warum können Menschen nicht miteinander umgehen, ohne sich in Kindsköpfe zu verwandeln?
Svenhagen zog ab.
Hjelm sah Chavez an. »Was ist das hier?« fragte er gerade heraus.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Chavez. »Aber richtig normal ist es nicht.«
»Nein«, sagte Paul Hjelm. »Richtig normal ist es nicht.«
Sie gingen nach Bredablick und machten Frühstückspause. Sie saßen ganz oben im Aussichtsturm, kauten dröge Käsestullen, starrten über das von der Frühlingssonne beschienene Skansen und sahen die Menschenströme von Minute zu Minute anschwellen. Stockholms gesammeltes Pensionärskorps schien sich mit tödlichen Brotstücken in den Händen eingefunden zu haben, die, binnen kurzem in monströse Klumpen verwandelt, mehr Seevögel das Leben kosteten als die gesamte Wilderei im Lande.
Obwohl es nicht genau das war, woran Paul Hjelm und Jorge Chavez dachten. Sie dachten an einen Mord.
Wenn es denn ein Mord war.
»Die Unterwelt«, sagte Chavez und versuchte vergebens, von der Käsestulle abzubeißen. Er wünschte, er hätte Bolzenschneider statt Kiefer.
»Ellroy?« sagte Hjelm und starrte ziellos auf die großartige Stockholmaussicht. »Was für ein Ellroy?«
»Auf die eine oder andere Weise die Unterwelt«, verdeutlichte Chavez.
»Auf die eine oder andere Weise: ja. Aber nicht auf jede Weise. Keine einfache Abrechnung im Drogenmilieu. Keine gewöhnliche Hinrichtung. Da macht man so etwas nicht. Dies hier ist etwas Besonderes. Es enthält eine Mitteilung.«
»Epivu?«
Hjelm schüttelte den Kopf und blieb stumm.
Chavez dachte laut weiter: »Wahrscheinlich wurde er gefesselt und zu den Vielfraßen hineingeworfen. Dort gelandet, konnte er noch das Wort ›Epivu‹ schreiben. Warum tut er das? Warum versucht er nicht statt dessen zu fliehen? Selbst ein so mittelmäßiger Sportler wie Paul Hjelm hat ohne bleibenden Schaden den Sprung über den Graben geschafft.«
»Die rechte Leiste«, sagte Hjelm und nahm einen Schluck des sonderbar zähflüssigen Kaffees. »Die Schmerzen in der rechten Leiste. Strahlen aus bis hinunter ins Knie.«
»Das hört sich nach Krebs an«, sagte Chavez. »Leistenkrebs, die gefährlichste Sorte. Den jüngsten Forschungsergebnissen zufolge in siebenundneunzig Prozent aller Fälle tödlich.«
»Zu seiner Verteidigung kann man sagen, daß es leichter ist, hineinzuspringen als heraus.«
»Wenn man zu bestialischen Raubtieren hineingeworfen wird, setzt man sich nicht als erstes hin und schreibt etwas mit dem Finger auf den Boden. Man versucht rauszukommen.«
»Andererseits ist es nicht gerade wahrscheinlich, daß die Mörder einen nur zu den Raubtieren hineinwerfen und dann direkt abhauen. Wahrscheinlich bleiben sie stehen und gucken. Wahrscheinlich richten sie Waffen auf einen. Wahrscheinlich hindern sie einen daran zu fliehen. Wahrscheinlich stehen sie da und genießen die Show. Gladiatorenspiele.«
»Klingt das nicht übermäßig kompliziert?« sagte Chavez. »Jemand soll hingerichtet werden. Man fesselt den Betreffenden, hebt ihn hinüber in das bereits geschlossene Skansen, trägt ihn durch den Tierpark, wo sich jederzeit noch verspätete Tierpfleger offenbaren können, nur um ihn zu den Vielfraßen zu werfen. Das tut man nicht, wenn man nicht einen ganz speziellen Grund hat, ihn genau den Vielfraßen vorzuwerfen.«
»Und da sind wir wieder bei Ellroy«, sagte Hjelm. »Wer ist dieser Ellroy eigentlich?«
»Oder«, stieß Chavez hervor und setzte mit einem Knall die Tasse auf die Untertasse, so daß letztere sich in zwei elegante Halbkreise teilte, »oder man jagt ihn und landet ganz zufällig in Skansen.«
»Und dann«, sagte Hjelm und nickte, »ist es nicht unwahrscheinlich, daß es irgendwo unterwegs zu einem Schußwechsel gekommen ist, und ein Querschläger dieses Schußwechsels kann sehr wohl im Arm eines zehnjährigen Mädchens eingeschlagen sein.«
Chavez betrachtete ihn mit einer gewissen Verwunderung. Hjelm hielt die Kunstpause lange genug durch, daß der Kollege anfing, sich zu winden.
Naja, es war kindisch …
»Um zweiundzwanzig Uhr vierzehn gestern abend wurde die zehnjährige Lisa Altbratt von einer Neunmillimeterpistolenkugel in den Arm getroffen, als sie den Sirishovsväg hinunterging.«
»Und wo liegt der Sirishovsväg?« fragte Chavez.
»Es ist eine Querstraße vom Djurgårdsväg, die von Rosendal herunterkommt.«
»Die Skansen-Karte«, sagte Chavez. Hjelm zog die ziemlich zerfledderte Karte aus der Innentasche seines Leinenjacketts. Chavez strich sie mit der Hand glatt und betrachtete sie.
»Hier geht der Sirishovsväg«, sagte Hjelm und zeigte drauf.
»Wo befand sich Lisa Alstedt, als sie angeschossen wurde?«
»Altbratt«, sagte Hjelm. »Hier ungefähr.«
Er zeigte auf einen Punkt kurz vor der Einmündung von Sirishovsvägen in den Djurgårdsväg, nicht weit von Oakhill und der Italienischen Botschaft. Und direkt daneben verlief der Zaun von Skansen.
»Hmmm«, sagte Chavez, der die Unart hatte, sich wie Sherlock Holmes anzuhören, wenn er dachte. »Lisa Altbrunn hier, Kreuz, der Vielfraßmann hier, Kreuz.«
»Altbratt«, sagte Hjelm und folgte mit den Augen Chavez’ Bleistift.
Chavez fuhr fort: »Die Kugel?«
»Rechter Arm auf dem Weg hinunter zum Djurgårdsväg.«
»Also von irgendwo innerhalb des Skansen-Zauns. Hier. Kommt man hier rüber? Was ist dahinter?«
»Was steht da? Wölfe?«
»Genau: da. Ja, Wölfe. Hier.«
Hjelm folgte dem Bleistift, der sich von der Skansen-Karte zum Fenster von Bredablick und zu dem realen Skansen bewegte. Hjelm erkannte das Labyrinth des Bärenfelsens, und sein Blick ging weiter, vorbei an Pferden und Luchsen und Wildschweinen und Büffeln, weiter am Gehege der Vielfraße vorbei, wo die rot-weißen Plastikbänder im Morgenwind vibrierten, bis er das weitläufige Wolfsgehege erreichte. Der Zaun war zwar hoch, schien aber nicht unüberwindbar zu sein. Obwohl an seiner oberen Kante schräg nach außen abgewinkelt Stacheldraht verlief.
Paul Hjelm nickte. Ein fast schadenfrohes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ich glaube, daß Brunte seinen Untersuchungsbereich um eine Spur ausweiten muß. Willst du es ihm sagen?«
»Mit dem größten Vergnügen«, sagte Jorge Chavez und grinste.
4
Professor emeritus. Er hatte sich an den Titel nie richtig gewöhnt, obwohl er ihn seit Jahren trug. Er war inzwischen ein sehr alter Mann.
Obwohl er erst in den letzten Tagen angefangen hatte sich alt zu fühlen. Seit alles zurückzukehren begann.
Es war schwer, den Finger darauf zu legen. Es war eigentlich nichts Besonderes geschehen.
Dennoch war er davon überzeugt, daß er bald sterben würde.
Er hatte früher nicht soviel an den Tod gedacht. Der Tod war Teil all dessen gewesen, was verdrängt werden mußte. Und das war ihm gelungen. Es war ihm besser gelungen als erwartet. Es war ihm gelungen, einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen und neu anzufangen. Als wäre das Leben ein leeres Blatt Papier, das darauf wartete, vollgeschrieben zu werden. Anscheinend war es jetzt voll, anscheinend hatte es deshalb angefangen, auf die Rückseite durchzulecken. Und auf der Rückseite war all das Alte, all das, was auszuradieren ihm während eines halben Jahrhunderts nicht gelungen war. Er schrieb nicht mehr – er las. Und das war sehr viel schlimmer.
Es begann wie die Gegenwart von etwas, mehr nicht. Eine vage, diffuse Gegenwart von etwas, das sich plötzlich in seinem ruhigen, festgefügten Leben breitmachte. Auf eine gewisse Art und Weise war er dankbar; nicht alle durften eine Weile mit dem Tod an ihrer Seite wandern, bevor es zu Ende ging, nicht alle bekamen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was das Leben ihnen geboten hatte. Andererseits wäre es besser, Knall auf Fall zu sterben, ohne Reue, ohne Nachdenken, ohne Gewissensqualen. Einfach mausetot auf der Straße umzufallen und wie eine zerschlagene Weinflasche weggefegt zu werden.
The End, wie es einst am Schluß amerikanischer Filme zu lesen war. Damit man Bescheid wußte.
Doch nein: aus irgendeiner unergründlichen Ursache war ihm diese Frist geschenkt worden. Er verstand nicht, warum.
Oder eher: Je länger sie währte, desto besser verstand er.
Es war ein Morgen wie jeder andere. Keine größeren Krämpfe, nur der bösartige Ischias im Bein und die schlechte Verdauung. Überhaupt keine äußeren Veränderungen.
Bis auf diese plötzliche Gegenwart von etwas.
Ja. Die stille Gegenwart des Todes.
Äußerlich lief das Leben weiter wie bisher, wie es eben aussah für einen einst so aktiven Mann von über achtzig Jahren. Also schleppend. Er traf die Kinder wie gewöhnlich, er kam zu ihren immer angenehmen Sonntagsessen, er feierte den Sabbat, Pessach, Sukkot, Chanukka und Yom Kippur wie gewöhnlich mit ihnen zusammen. Es war gerade die scheinbare Normalität, die es so schrecklich machte. Denn schrecklich war es doch? Es war doch schrecklich zu sterben. Doch richtig sicher war er nicht.
Das bedrückendste war, daß es keine rationale Erklärung gab.
Ende der Leseprobe