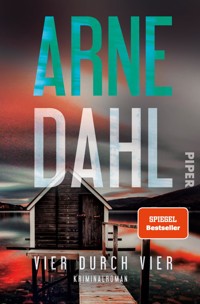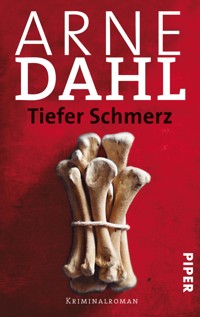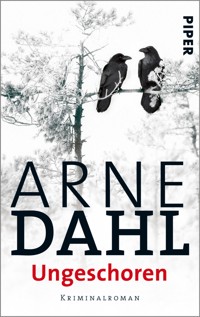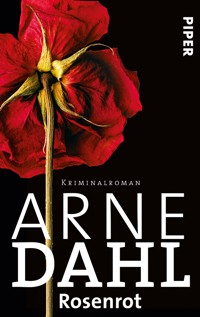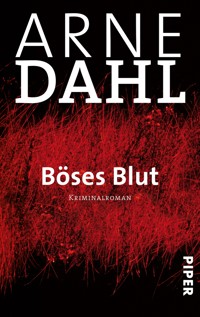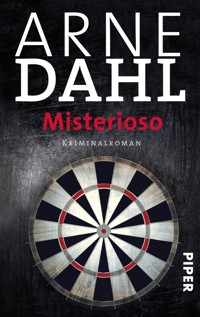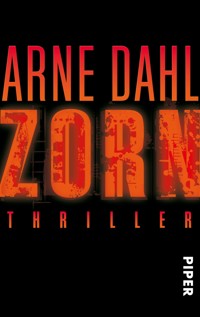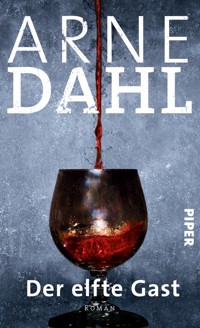
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jahre sind vergangen seit der Auflösung der A-Gruppe. Jahre, in denen Gunnar Nyberg sein Leben als Schriftsteller genossen hat, ohne mit dem Übel der Welt konfrontiert zu sein. Nur seine Ex-Kollegen hat er vermisst: Paul Hjelm, Kerstin Holm, Arto Söderstedt und all die anderen. Das hat ihm dieser Brief gezeigt, der sie zu einem letzten Treffen zusammenruft. Doch was will der unbekannte Absender von ihnen? Auch der Treffpunkt wirft Fragen auf: ein verlassenes Herrenhaus, eine festlich gedeckte Tafel und eine Speisefolge wie im 18. Jahrhundert. Hinter all dem steckt ein ausgeklügelter Plan – und den kennt nur der mysteriöse elfte Gast … »Der elfte Gast« ist ein kriminalistisches Puzzlespiel und ein schaurig-schönes Lesevergnügen – ein spannender Nachtrag zu einer der international erfolgreichsten Krimi-Serien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel » Elva «
im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag
erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96738-9
© Arne Dahl 2008
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: Cornelia Niere, München
Covermotiv: Wojciech Zwolinski / Trevillion Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa
Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten
Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag
nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Andere aber waren grausameren Sinnes – obgleich sie vermutlich sicherer gingen – und erklärten, kein Mittel gegen die Seuche sei so wirksam und zuverlässig wie die Flucht.
Giovanni Boccaccio, Das Dekameron
Hugo stellte sich alles in einem anderen Licht dar. Unter seinen eigenen und den Gemälden seiner Verwandten hatte er oft im Stillen gedacht, wie viel vortrefflicher das »Märchenwerk im Jagdschloss« wäre, wenn es, statt verstreuter Erzählungen ohne inneren Zusammenhang, ein einziges Ganzes bildete, dessen Teile zwar jedes für sich genommen selbständig waren, aber dennoch aus ihrer Beziehung zueinander lebten.
C. J. L. Almqvist, Das Jagdschloss
Verehrte ehemalige Mitglieder der A-Gruppe!
Viel Wasser ist ins Meer geflossen, seit wir vor mehr als einem Jahr beschlossen, uns wiederzusehen. Und auch wenn wir uns in alle Winde verstreut haben, bezweifle ich, dass einer von uns unsere Abmachung vergessen hat. Die Zeit ist reif, ja mehr als reif, und keiner von uns wird jünger. Lasst also den Tag in Nacht übergehen, während die Erzählungen uns mit jener Magie einhüllen, die stets vorübergehend ist, die aber immer auch zurückerobert werden kann, der Stoff, aus dem die Träume sind. Lasst uns bei einem Treffen zusammenkommen, das an vergangene ruhmreiche Tage erinnert, Tage, die vielleicht auf diese Art und Weise wieder lebendig werden können, mit doppelter Kraft.
Alle Vorbereitungen sind getroffen, Ihr braucht Euch um nichts zu kümmern. Begebt Euch nur zu der auf der Rückseite des Briefs genannten Adresse. Dort findet Ihr auch das Datum der Veranstaltung sowie eine vollständige Wegbeschreibung. Der öffentliche Nahverkehr in der Gegend ist äußerst rudimentär, aber auch aus Gründen der Umweltverträglichkeit empfehlen sich Fahrgemeinschaften. Die mit Informationen gespickte Rückseite dieses Briefs enthält auch Angaben darüber, was von Euch erwartet wird, damit der Abend für jeden Einzelnen von uns zu einem Genuss wird. Zu einem Genuss, wie nur die Sondereinheit der Reichskriminalpolizei für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter ihn möglich machen kann. Wenn es sie noch gäbe. Es wird ein phantastisches Vergnügen sein, sich wiederzusehen.
Mit großen Erwartungen
1
Elf Minuten vor Mitternacht stürmten sie herein und zerschlugen seinen Traum. Er hatte keine Ahnung, warum sein Blick in einem so kritischen Augenblick auf die wertvolle Tischuhr fiel, die auf demselben schlanken Vollmaster von Philadelphia nach Hause gefrachtet worden war wie er selbst. Vielleicht hing es mit dem Schicksal zusammen, denn er war sich sicher, dass in der Sekunde, bevor er Tempo aufnahm, die kleine goldene Tischuhr stehen blieb. Das leuchtende Pendel glitt langsam auf einer Seite herunter und stand still.
Während er aufsprang, und zwar schneller, als irgendeiner der vorrückenden Hofregimentssoldaten hatte ahnen können, glitt sein Blick über das markige Gesicht des Alten auf der anderen Seite des Tisches. Es war wie in Stein gemeißelt. Als hätten die harten Jahre im Feld zusammen mit den harten Jahren in der Politik eine Maske aus reinstem Granit geschaffen.
Bevor einer der Soldaten auch nur auf den Gedanken gekommen war, seine unförmige Muskete zu heben oder seinen unhandlichen Degen zu ziehen, war er schon aus der nächstgelegenen Tür. Er schlug sie zu, stürzte durch die neu eingerichtete Bibliothek, in der sich noch auf keinem Buch das kleinste Staubkorn hatte ansammeln können, und sprang durch das Fenster, das er vor einigen Stunden nur angelehnt hatte, hinaus.
Er hatte sich für einen kurzen Moment aus dem von glückseligem Stimmengewirr erfüllten Festsaal zurückgezogen, war in die Bibliothek gegangen, hatte ein paar Zeilen in seinem Lieblingsbuch gelesen – »Alle in der Gesellschaft, Herren wie Damen, waren mit dem Vorschlag einverstanden, Geschichten zu erzählen« – und hatte das Fenster einen Spaltbreit geöffnet. Er hatte es traurigen Herzens getan. Denn er war nicht gern misstrauisch. Doch ein langes und hartes Leben hatte ihn gelehrt, auch in der Wirklichkeit zu Hause zu sein, und da war Misstrauen nichts weniger als eine Tugend. Wäre es auch nur um einen Bruchteil geringer gewesen, würde er jetzt nicht mehr leben.
Sein Blick war tief in die Flammen des Kaminfeuers versunken gewesen, er hatte traurig den Kopf geschüttelt und einen Moment so verharrt, bevor er wieder sein weltgewandtes Lächeln aufsetzte und erneut zum perfekten Gastgeber wurde und in den Trubel des Festsaals zurückkehrte.
Das war Vergangenheit. Jetzt landete er auf dem Boden unterhalb des Fensters und versank bis zu den Knöcheln im Schlamm. Es regnete in Strömen, und zum ersten Mal in seinem Leben freute er sich darüber, er, der Schlamm immer gehasst hatte. Doch jetzt war die Situation eine ganz andere. Der Regen würde es viel schwerer machen, ihn zu finden. Er lief an der Hauswand entlang und warf einen hastigen Blick durch das Fenster in den Festsaal. Er war menschenleer. Die Kandelaber verbreiteten in dem verlassenen Saal noch immer einen nahezu magischen Schein, die Tische waren überhäuft von Speiseresten, schmutzigem Geschirr und Gläsern. Erst als die Türen des Festsaals aufgestoßen wurden und die Soldaten hereinstürmten, lief er weiter.
Er ging nur bis zu dem dichten Tannenwäldchen, das er stehen gelassen hatte, als der großartige französische Garten angelegt worden war. Als hätte er damals tatsächlich in die Zukunft sehen können. Er duckte sich. Die Tannennadeln stachen ihn, der Regen rann unter sein maßgeschneidertes Seidenhemd. Nichts von alldem störte ihn, denn von hier aus hatte er eine perfekte Sicht auf den Festsaal.
Dort irrten die Soldaten eine Weile umher. Dann verteilten sie sich über das ihn umgebende Gelände. Rechts und links sah er, wie Fackeln angezündet wurden. Noch war es keine geordnete Jagd. Nicht einmal, als er die markante Stimme des Alten in ihrem wohlbekannten Dialekt Befehle brüllen hörte, fühlte er sich ernstlich bedroht. Alles, was er brauchte, war ein klein wenig Zeit.
Einen Augenblick Unsichtbarkeit.
Dieser kam unerwartet rasch. Der Festsaal leerte sich, auch in seiner unmittelbaren Umgebung waren die Soldaten nicht mehr zu hören, die Fackeln schienen sich entfernt zu haben. Er nahm die Leiter, kletterte hinauf und sprang durchs nächste offene Fenster in den Festsaal – auch dieses Fenster hatte er angelehnt, er liebte und hasste sein Misstrauen gleichermaßen. Drinnen zog er die Schuhe aus, die stets so zuverlässigen Lederschuhe, angefertigt von keinem Geringeren als Adam Slythe in Philadelphia. Diese Handlung erinnerte ihn vage an das Vergangene. Dann lief er lautlos und, so hoffte er, ohne Spuren zu hinterlassen durch den Festsaal und erreichte den Punkt. Er stellte sich auf die Zehenspitzen.
Die Tür glitt auf, wie sie sollte, und glitt ebenso wieder hinter ihm zu. Ein kleines architektonisches Wunder. Aber auch kostspieliger als jede andere Tür, dachte er. Der Ausdruck »das Gewicht in Gold wert« kam ihm in den Sinn, und er musste lächeln. Ein ganz klein wenig.
Zunächst schien es stockdunkel zu sein. Es wäre schlecht, wenn es das wirklich wäre. Das durfte es einfach nicht sein. Er wartete und hörte seinen eigenen pfeifenden Atem. Es war ein entsetzliches Warten.
Es blieb pechschwarz um ihn her.
Lange. Lange.
Doch dann hatten sich die Augen an das Dunkel gewöhnt, und er erkannte das kleine Bienenwachslicht in seiner Vertiefung ein paar Meter weiter vorn im Gang. Er zog die Schuhe an. Auf zittrigen Beinen ging er hin und nahm die Kerze. Er nahm sie ganz vorsichtig auf und hielt die gekrümmte Hand um die Flamme, als hinge sein Leben davon ab, dass sie weiterbrannte.
Und so war es auch.
Obwohl Leben und Leben … Eben das, was denn nun davon noch übrig war.
Der Auftrag.
Sehr, sehr langsam bewegte er sich die wenigen Meter zurück zur Tür. An der feuchten Steinwand hing die erste Fackel. Er sah deutlich, wie seine linke Hand zitterte, als er die Fackel an die kleine Flamme der Wachskerze hielt.
Als die Fackel mit klarer Flamme brannte, blies er die Kerze aus und strich dankbar mit der Hand darüber. Dann hielt er inne. Aus dem Festsaal drang das charakteristische Stiefeltrampeln der Soldaten des Hofregiments. Er betete zu einer höheren Macht – an die er kaum glaubte –, dass er keine Spuren hinterlassen hatte. Dass sie die Tür nicht entdeckten. Dass sie nicht – und er beugte sich so abrupt über die Flamme der Fackel, dass seine Perücke beinahe Feuer gefangen hätte –, dass sie nicht ein mystisches Licht hinter der Wand flackern sähen.
Er machte sich auf den Weg. Eine Treppe führte nach unten. Einen kurzen Moment lang durchströmte ihn das Gefühl, ins Inferno hinabzusteigen.
Am Fuß der Treppe verlief der Gang weiter geradeaus. Er hatte das Gefühl, als käme er dem Mittelpunkt der Erde immer näher. Zwar gehörte er zu den wenigen, die glaubten, der Mittelpunkt der Erde wäre heiß, heiß von kochender Lava, doch hier wurde es nur immer kälter. Als wäre die Hölle aus Eis.
Die Hölle, an die er nicht glaubte.
Der Gang, der immer schmaler wurde, teilte sich endlich in vier Gänge, die in verschiedene Richtungen führten. Er zögerte nicht. So weit zurück reichte sein Erinnerungsvermögen auf jeden Fall. Er sah die Zeichnung vor sich, wählte den richtigen Gang und sah nach einer Weile an einer gewissen Stelle, wie ein kalter Wind die Flamme der Fackel flackern ließ. Eine Kerze wäre auf der Stelle erloschen, doch die Fackel hielt dem Wind stand.
Der Gang wurde enger und niedriger. Er konnte nicht mehr aufrecht gehen, sondern musste sich immer tiefer ducken. Schließlich war es am einfachsten zu kriechen. Er folgte einem Gang, der nur notdürftig aus dem Urgestein herausgehauen zu sein schien. Die Knie seiner Hose aus feinem Tuch, das von dem großen Loutard in Paris gewebt war, wurden blutig und waren bald durchgescheuert. Die Fackel versengte ihm mal das Gesicht, mal das Hinterteil, je nachdem, ob er sie behutsam vor sich herschob oder hinter sich herzog.
Dann endete der Gang an einer nackten Felswand. Es gab keinen Weg mehr, bis auf den trostlosen Weg zurück.
Er schloss die Augen und hoffte, dass alles mit der Zeichnung übereinstimmte. Dass dem Meister, der das erste architektonische Wunder vollbracht hatte, auch das zweite gelungen und dass es ebenso zuverlässig war. Er hob die Hände zur Decke.
Nichts geschah.
Er fühlte förmlich, wie ihm der Schweiß aus den Handflächen trat. Noch einmal vollführte er das Manöver, entschieden, exakter.
Und der Stein glitt zur Seite.
Er gab einen tiefen Seufzer von sich und dankte dem Gott, an den er trotz allem eigentlich nicht glaubte. Oder eher, er glaubte schon an einen Gott, doch an einen, der bereits im Anbeginn der Zeit sein Werk aufgegeben und die Menschheit allein hier zurückgelassen hatte.
Völlig allein.
Auf der anderen Seite des Steins weitete sich der Gang, und er konnte sich wieder aufrichten. Vor ihm lag ein Gewölbe. Er blickte sich darin um. Erkannte den Raum vage von der Zeichnung. Der Schemel geradeaus, der große, reich ornamentierte Eichenschrank zur Linken, das Relikt einer Epoche, die an grenzenlose Ausschmückung geglaubt hatte. Und dann rechts das dritte architektonische Wunder.
Unmittelbar zu seiner Linken, als er den Raum betrat, steckte eine weitere Fackel in einer Befestigung an der Wand. Er zündete sie an und schob seine treue Fackel in eine Fassung auf der rechten Seite der Tür, durch die er gekommen war.
Als er zu dem Schemel an der gegenüberliegenden Wand trat, sah er, dass er einen doppelten Schatten warf. Gerade jetzt schien dies ungewöhnlich gut zu passen, da sein altes und sein neues Ich im Begriff waren, sich zu vereinen. Aber noch waren es zwei Schatten.
Er sank auf den Schemel nieder und atmete, so ruhig er es vermochte, bis sein Atem einigermaßen normal ging.
In einer Vertiefung der robusten Steinwand zur Rechten stand ein Tintenfass neben einem Papier und einer Schreibfeder. Er strich über das Papier und fühlte seine grobe Struktur. Es kam aus der neuen Papierfabrik der Provinz. Das Gefühl, Papier zu berühren, ließ ihn immer ein wenig andächtig werden. Papier war ihm heiliger als Gott. Und das war wohl einer der Gründe dafür, dass er nicht weiterleben durfte.
Einer von allzu vielen Gründen.
Er tunkte die Feder in das Tintenfass und ließ die Tinte langsam auf den Boden tropfen. Sie sah aus wie Blut.
Es war Blut. Die Tinte zirkulierte in seinem zweiten, parallelen Blutkreislauf.
Und dann schrieb er. Einen kurzen Brief in zierlicher Handschrift.
Er faltete den Brief zusammen, während er aufstand. Dann zog er eine kleine Kiste unter dem Schemel hervor, in deren Schloss ein Schlüssel steckte. Er legte sie auf den Schemel und öffnete sie. Sie war mit Ruß gefüllt.
Er lachte auf. Manchmal hatte man sonderbare Ideen.
Und dann drückte er den Brief mit der Feder in den Ruß, steckte die Feder ins Tintenfass und schlug die kleine Kiste zu, drehte den Schlüssel um und trug ihn hinüber zu dem großen Eichenschrank auf der linken Seite. Anschließend ging er nach rechts.
Zu dem dritten architektonischen Wunder.
Er trat durch eine Türöffnung und blickte sich um. Ein weiterer, kleinerer Raum. Eher wie eine Zelle. Die Zelle hatte er stets gemieden. Er sah eine Pritsche und einen Stuhl. Außerdem vier große Kisten auf dem Boden.
Und er sah, dass alles gut war.
Gut unter den gegebenen Umständen.
Er öffnete die linke äußere Kiste. Darin standen zahlreiche Krüge mit Wasser. In der Kiste daneben befand sich Essen in Form von allerlei geräuchertem und getrocknetem Fleisch. Er öffnete die nächste Kiste, und sie war voller Fackeln. Die letzte Kiste ganz rechts ließ er geschlossen.
Er nahm eine der Fackeln und ging hinaus in den größeren Raum. Dort hielt er sie an seine alte treue Fackel, die an der Wand steckte, und kehrte, die brennende Fackel hoch erhoben, in die Zelle zurück. Er befestigte sie an der Wand und holte tief Luft.
Dann zog er an einem Hebel unmittelbar neben der Türöffnung. Eine massive Tür schlug vor ihm zu. Auf der Innenseite hatte sie keinen Handgriff, und er stand mit dem Hebel in der Hand da. Er hatte sich gelöst, als er ihn betätigt hatte. Er lächelte, ließ den Hebel fallen und öffnete die letzte Kiste.
Darin waren Tintenfässer und Schreibfedern im Überfluss. Und stapelweise Papier, lose Bögen, die an das Papier erinnerten, auf dem er gerade den Brief geschrieben hatte. Außerdem waren Bücher in der Kiste, gewaltige Mengen von Büchern.
Er nahm eines davon in die Hand und schlug es auf. Es bestand aus völlig leeren Seiten. Er lächelte wieder.
Er legte das leere Buch zur Seite und nahm einen der losen Bögen. Dann setzte er sich auf den Stuhl und begann zu schreiben.
Er schrieb eine Weile. Kurze Zeilen. Und während er schrieb, dachte er: So ist es gekommen. Die Einsamkeit des Schreibens. Und ich, der versucht hat, ihr zu entgehen. Das Erzählen soll nicht einsam sein.
Die Dinge fielen ihm unmittelbar ein. Die Worte kamen wie von allein. Als wären es nicht seine eigenen.
Schließlich war er fertig. Er betrachtete sein Werk. Es sah nicht nach besonders viel aus.
Dann faltete er das Papier zu einem kleinen Brief zusammen, faltete es öfter als gewöhnlich. Er holte einen kleinen Beutel aus feinstem gegerbtem Seehundleder aus der Tasche, betrachtete ihn und lächelte. Darin hatten die armseligen Silbermünzen gelegen, die einmal seine Familie gerettet hatten. Er streichelte den Lederbeutel und steckte den Brief hinein. Dann ging er hinüber zur einen Ecke der kleinen Zelle, zu einem langen Holzstock. Er näherte sich dem kleinen Loch in der Decke, hielt den Finger daran und spürte einen leichten kühlen Windhauch. Er kletterte auf eine der Kisten und hielt die Nase an das Loch. Er roch den Duft der frischen Luft.
Die Luft des Lebens.
Das war das Letzte, was er davon wahrnehmen sollte.
Er fand, dass sie nach Schlamm roch.
Schließlich drückte er den kleinen Lederbeutel in das Loch, nahm den langen Stock und schob den Beutel hinaus in die Außenwelt. Er spürte, wie das Säckchen auf der anderen Seite herausfiel.
Er betrachtete seine Schuhe, seine phantastischen, kostbaren Lederschuhe, angefertigt von Adam Slythe in Philadelphia. Und er sah, wie lehmig sie waren.
Der Lehm. Er kam zurück. Er siegte.
Dann kehrte er zu dem Stuhl zurück, in Gedanken noch immer bei den lehmverschmierten Luxusschuhen. Er dachte an seinen eigenen Hochmut, seine Selbstverliebtheit, seine Eingebildetheit und seine Selbstzufriedenheit. An all das, was ihn hierhin geführt hatte, trotz aller guten Vorsätze, trotz der Tatsache, dass der Mensch eigentlich das Einzige war, woran er glaubte. Aber letztlich war alles von Eitelkeit gelenkt. Wie bei allen anderen.
Erneut legte er das erste leere Buch auf seine Knie, öffnete es und ließ im bleichen Schein der Fackel die Feder sich der allerersten Seite nähern.
Bevor er zu schreiben begann, dachte er erneut:
Die Eitelkeit.
2
Die Eitelkeit.
Er stand auf der Felsenkuppe, die nicht nur einer der höchstgelegenen Punkte in der Innenstadt von Stockholm war, sondern auch diesen verrückten Namen trug. DieEitelkeit. Von hier aus blickte er über die Stadt. Er verspürte keine Lust, die Faust gegen sie zu ballen und sie herauszufordern, auch wenn das wohl der eigentliche Grund dafür war, dass er hergekommen war. Doch nachdem er erst den Felsen bestiegen hatte, der bis zum Jahr 1956 Danviksberget geheißen hatte, stand ihm nicht mehr der Sinn danach. Nicht nur, dass er zu alt und vielleicht auch zu sehr mit dem Leben in all seinen eigentümlichen Aspekten versöhnt war – da war noch etwas anderes. Er war der Vogelperspektive ganz einfach überdrüssig. Es reichte jetzt. Zumindest für die kommenden vierundzwanzig Stunden.
Er war Lehrer. Die Perspektive von oben war sein Spezialgebiet. Manchmal fragte er sich, wie er dazu gekommen war. Aber immer seltener. Das Leben hielt eine Reihe von Achterbahnfahrten bereit, das war eigentlich die einzige Weisheit, mit der er aufwarten konnte. Das Einzige, was vollkommen sicher, was felsenfest klar war: dass nichts wirklich sicher war.
Die Eitelkeit, dachte er.
Nein, alle Eitelkeit war jetzt verschwunden. Nichts davon war geblieben. Das Leben als Läuterungsprozess. Schade, dass man genau zum falschen Zeitpunkt stirbt.
Denn natürlich hatte es in seinem früheren Leben eine ganze Menge Eitelkeiten gegeben. Nicht zuletzt in seinem Berufsleben. Er hatte immer der Beste sein wollen, auch wenn er es gut kaschiert hatte. Und immer hatte er der Smarteste von allen sein wollen.
Jetzt spielte das keine große Rolle mehr. Er war Lehrer. Er unterrichtete. Er lehrte Menschen, die selten die geschliffensten Messer in der Schublade waren, den Schnitt richtig anzusetzen. Er schabte die Unebenheiten weg. Er schliff das polizeiliche Rohmaterial zurecht und brachte auch die verstecktesten Erzadern zum Vorschein. Auf gewisse Art und Weise war er es, der die Basis für das Polizeikorps der Zukunft schaffte.
Immerhin etwas.
Jetzt, da es die A-Gruppe nicht mehr gab.
Inzwischen war er Kommissar. Mehrere der ehemaligen Mitglieder der Sondereinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter bei der Reichskriminalpolizei waren Kommissare geworden. Als hätte eine ganze Reisegruppe von Kommissaren in Quarantäne gesessen und nur darauf gewartet, rauskommen zu dürfen.
Dekontaminiert.
Er war auf jeden Fall der Einzige, dem es gelungen war, nach der Auflösung der A-Gruppe gleich zwei Titel einzuheimsen. Er war nicht nur Kommissar (was genau genommen aber nur ein Titel ohne praktische Konsequenzen war), sondern jetzt auch Dozent.
Wenn es irgendwo Eitelkeit gab, dachte er, als er von Fåfängan über die Stadt schaute, dann vor seinem Pult. Es hatte eine Zeit gegeben, da war er der Meinung gewesen, dass in der Polizeihochschule eine ungute Mischung aus künstlichen Machoattitüden und überspanntem Idealismus vorherrschte. Dann kam er dahinter, dass es sich ganz einfach um die Jugend handelte.
Aber so alt war er doch verdammt noch mal auch nicht. Wieso ließ ihn dann der Gedanke nicht mehr los? Wahrscheinlich aufgrund des kuriosen Schicksals seines langjährigen Partners.
Eitelkeit, dachte er und strich sich über sein kreideweißes Haar. Eitelkeit, Eitelkeit. Und dann die Stadt dort unten. Der Jahrmarkt der Eitelkeiten. Vanity Fair. Eine immer härtere Welt. Immer oberflächlicher, immer konkurrenzbetonter. Immer rauere zwischenmenschliche Beziehungen.
Die Pest war in die Stadt gekommen.
Zehn Jahre lang hatte Arto Söderstedt gewartet, und jetzt war sie da. Jetzt, da er keine aktive Rolle in der Gesellschaft mehr zu spielen hatte. Jetzt, wo sich seine Einflussmöglichkeit darauf beschränkte, unreflektierten Seelen, die sich für nichts anderes begeistern konnten als ihre eigenen körperlichen Hüllen, den faschistoiden Lack abzuschleifen.
Die Eitelkeit.
Er übertrieb natürlich. Die meisten seiner Studenten waren gewöhnliche Menschen ohne große Laster, dafür aber mit einem leichten Anstrich von Idealismus, der beinahe schwerer abzuschleifen war als der faschistoide Anstrich der anderen Seite. Vielleicht fiel es ihm auch deshalb so schwer, weil es ihm auch bei sich selbst nicht richtig gelungen war, ihn abzuschleifen.
Arto Söderstedt lächelte leicht in dem feuchtkalten Wind und zog seinen Mantel enger um den Körper. Er wünschte, er hätte ein Halstuch mitgenommen. Und dass sie einen anderen Tag gewählt hätten.
Es war Totensonntag, der letzte Sonntag im November. Der letzte Sonntag des Kirchenjahres und der Sonntag vor dem ersten Advent. Traditionellerweise handelten an diesem Sonntag Lesungen und Predigten vom Jüngsten Gericht.
Die Apokalypse.
Die Pest.
Nein, dachte er dann und ließ den Blick an diesem trotz allem ungewöhnlich klaren Spätherbstmorgen über den Saltsjön zum Djurgården schweifen. Nein, jetzt keine eschatologischen Untergangsvisionen. Das war nicht seine Tonart. Obendrein hatte er nicht einmal mehr einen Partner, der Anstoß daran nehmen konnte, dass er mit Wörtern wie »Eschatologie« um sich warf.
Auch im grausamsten Monat war die Stadt schön. Es hatte zwar ein paarmal geschneit, aber davon war jetzt keine Spur mehr zu sehen. Es schien, als hätte sich das Klima verändert. Zu einem eher gesamteuropäischen Klima.
Und so war es wohl. Das Klima lief Amok.
Fast eineinhalb Jahre waren seit dem letzten großen Fall der A-Gruppe vergangen. Und Arto Söderstedt erinnerte sich an jede Naturkatastrophe seitdem.
Er wünschte, er hätte ein etwas schlechteres Gedächtnis.
Der vergangene Herbst hatte mit einer Überschwemmung in Indien und Pakistan begonnen, die dreihundert Menschen getötet hatte, und einer anderen in Äthiopien, bei der an die neunhundert ertrunken waren. Dann war ein Taifun mit Namen Xangsane über die Philippinen und Vietnam hinweggefegt und hatte ein paar Hundert Menschen getötet. Kurz danach, im Oktober des vergangenen Jahres, hatten Stürme in Nordkorea siebentausend Menschen obdachlos gemacht, während der amerikanische Mittelwesten von Stürmen und Tornados verwüstet wurde. Der November begann mit einer großen Überschwemmung im Südosten der Türkei, der dreißig Menschen zum Opfer fielen, und über Saroma in Japan, das eigentlich nie von Wirbelstürmen heimgesucht worden war, brach ein tödlicher Tornado herein und zerstörte die Stadt. Während Stürme das Innere Nordamerikas überzogen, tobte über den Philippinen der Taifun Durian und führte zu einer massiven Schlammflut, die vom Vulkan Mayon herabstürzte und fünfhundert Menschen in den Tod riss. Das Jahr endete damit, dass orkanartige Winde in der Javasee eine Fähre mit sechshundert Menschen an Bord zum Kentern brachten, von denen vierhundert noch immer verschollen sind.
Das Gedächtnis, dachte Arto Söderstedt, die Hände vors Gesicht geschlagen. Das Gedächtnis, die Eitelkeit. Was tue ich da eigentlich?
Doch das Gedächtnis war unerbittlich. Allein das letzte halbe Jahr war bis zum Rand von solchen Ereignissen angefüllt.
Schwere Monsunregen im Juni lösten Schlammlawinen aus, die sechzig Menschen in Bangladesch unter sich begruben, und heftige Regenfälle in Südchina führten zu Überschwemmungen, bei denen mindestens ebenso viele umkamen. Schwere Stürme in Karatschi in Pakistan forderten mehr als zweihundert Menschenleben, und große Teile der Ostküste Australiens wurden überschwemmt. Den Höhepunkt bildeten im Juli gigantische Überschwemmungen im indischen Westbengalen, als sechshundertsechzig Menschen umkamen und mehr als eine Million obdachlos wurden. Zwei Tage später wurde Buenos Aires vom ersten Schneefall seit neunzig Jahren überrascht. Juni und Juli wurden jedoch vom August noch übertroffen. In Nordkorea rissen Regenfluten nicht nur Hunderte von Menschen, sondern auch die letzten Nahrungsreserven mit sich fort und führten zu einer akuten Hungersnot. Kurz danach zog der Orkan Dean über das Karibische Meer und brannte sich im Gedächtnis der Mexikaner als der drittstärkste Orkan seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Wenige Tage später wurde Griechenland von über zweihundert Feuersbrünsten verwüstet, die nicht nur zweihundert Menschen töteten, sondern auch die Landschaft der Antike in Asche legten, und als wäre der Sudan nicht schon genügend von irrsinniger Gewalt heimgesucht, wurden dort die letzten Trinkwasserreserven von einer Überschwemmung vernichtet. Danach präsentierte der Oktober eine erstaunliche Serie von Waldbränden in Kalifornien, in deren Verlauf eine halbe Million Menschen evakuiert werden mussten. Ende Oktober fegte der Tropensturm Noel über die Karibik, tötete etwa hundert Menschen und machte hunderttausend obdachlos. Und dann kam der Monat des Totensonntags, der grausamste von allen, November. Nach fünf Tage anhaltenden Wolkenbrüchen in der Provinz Tabasco in Mexiko mussten dreihunderttausend Menschen ihre Häuser verlassen. Viertausend Schulen wurden von den Wassermassen fortgerissen. Eine Woche später wütete der Sturm im Schwarzen Meer. Elf Schiffe sanken, zwanzig Seeleute ertranken, und dreihundert Tonnen Öl ergossen sich in das ohnehin schon biologisch tote Binnenmeer. Und zuletzt tötete der Zyklon Sidr rund viertausend Menschen im südlichen Bangladesch. Während einer einzigen Nacht wurden mehr als eine Million Menschen heimatlos.
Arto Söderstedt atmete schwer aus und nahm die Hände vom Gesicht. Es dauerte einige Sekunden, bis die Stadt wieder Gestalt annahm vor seinen Augen, und ein paar weitere, bis sein überhitztes Gehirn den Eindruck des Anblicks einordnete.
Warum ausgerechnet er?
Warum musste ausgerechnet er sich an all das erinnern? All diese Klimakatastrophen? Als ob die kontinuierlichen Nachrichten über die schmelzenden Eisberge der Arktis und die abtauenden Alpengletscher, die wachsenden Wüsten der Sahara und den verschwindenden Regenwald im Amazonasgebiet nicht genügen würden. Kürzlich hatte er über den Pastoruri-Gletscher in Peru gelesen, der in fünfundzwanzig Jahren vierzig Prozent seiner Eismasse verloren hatte. Und auch die Eisdecke der Anden schmolz mit rasender Geschwindigkeit.
Eine neue Krankheit grassierte in der westlichen Welt: die »Klimaangst«. Das war natürlich nicht gut – nicht direkt produktiv –, doch solange sie nicht ganz von der zweiten Krankheit überflügelt wurde, die sich in den zehn Jahren der Existenz der A-Gruppe so stark verbreitet hatte, ja epidemisch geworden war, meinte Söderstedt trotz allem, dass die Lage noch unter Kontrolle war.
Diese Krankheit hieß »Empathiemangel«.
Wenn man jedoch unter dem Begriff Klimaangst auch eine gewisse Sorge um das mentale Klima der gegenwärtigen Gesellschaft verstand – den reaktionären Rückgriff auf traditionelle Geschlechterrollen, den zunehmenden Konsum von Gewaltpornografie, die Anorexiewelle, Selbstjustiz und Selbstgeißelung, die zunehmende Fixierung auf die reine Oberfläche –, dann bestand eine augenscheinliche Gefahr von Depression.
Und Depression war nicht wirklich Arto Söderstedts Ding.
Nein, er fühlte sich keineswegs deprimiert. Nur auf quälende Weise klarsichtig. Wozu die A-Gruppe in dem Jahrzehnt ihrer Aktivität ebenfalls tendiert hatte. Wie viele ihrer Vorahnungen und Voraussagen waren eigentlich eingetroffen?
Wenn er eines nicht werden wollte, dann war es altersverdrießlich. Deshalb erlaubte er es sich im Moment, Naturkatastrophen nur in ihrer reinen Naturform zu betrachten. Denn er mochte diese Stadt ja, die sich zu seinen Füßen ausbreitete. Es war seine Stadt. Endlich war er zu Hause. Sogar die Bewohner mochte er, obwohl sie ein wenig eitel waren.
Dennoch erschien es ihm keineswegs falsch, Stockholm und die Zivilisation für eine Weile zu verlassen. Für eine kurze Zeit der Pest zu entfliehen und sich alten Freundschaften und neuen Erzählungen hinzugeben.
Für die andere Art von Klimaangst waren Leute wie Paul Hjelm zuständig.
Söderstedt blickte sich auf dem Fåfängan um. Er war allein dort. Der klare Totensonntagmorgen war nun wolkenverhangen, wodurch die Stadt mit jeder Sekunde konturloser wurde. Er war dankbar dafür, rechtzeitig gekommen zu sein. Spätere Morgenwanderer würden nichts mehr von der verführerischen Schönheit der Stadt zu sehen bekommen.
Arto Söderstedt machte sich auf den Abstieg von der Felsenkuppe. Feuchtigkeit schwebte in der Luft wie ein Sprühregen, der vergessen hat, dass das Gesetz der Schwerkraft ihm vorschreibt, zu Boden zu fallen. Wieder zog er den Mantel fester um seinen Körper – den Lehrermantel, den frisch erstandenen Dozentenrock, in dem er sich noch nicht ganz wohlfühlte – und erreichte sein Auto.
Bevor er in seinen alten rostigen Minibus der Marke Toyota Hiace stieg, hob er kurz die Hand gegen die nebelverhangene Stadt, ballte sie zur Faust und drohte ihr.
Aber er meinte es nicht ganz ernst.
Als der Motor wie ein betagter halb toter See-Elefant losröhrte, spürte Arto Söderstedt nur noch eines.
Eine starke und unwiderstehliche Erwartung.
3
Gewalt, Gewalt, Gewalt. Sie trat auf die Straße, die nach Süden hin zum Medborgarplatsen und nach Norden zum Slussen abfiel, und betrachtete die Hinterlassenschaften der letzten Nacht. Offenbar war es auf dem Götgatsbacken hoch hergegangen, obwohl es die Nacht zum Totensonntag gewesen war. Sie selbst hatte, aus erklärlichen Gründen, nicht viel davon mitbekommen.
Er war es gewesen, der sie darauf hingewiesen hatte, dass heute Totensonntag war. Oder eher: dass überhaupt ein Tag mit diesem Namen existierte.
Er, der jetzt die wenigen Meter bis zur Kreuzung an der Högbergsgatan neben ihr ging. Er mit dem speziellen Beruf.
Klar hätte sie etwas hören müssen. Die Wohnung lag im zweiten Stock, und alle Fenster gingen auf die Götgatan hinaus. Aber sie war anderweitig beschäftigt gewesen. Sie beide waren anderweitig beschäftigt gewesen.
Sie beobachtete, wie seine ziemlich abgewetzten Sneakers geschmeidig einer unverhältnismäßig großen Lache von Erbrochenem auswichen – es musste sich um ein Gruppenkotzen gehandelt haben –, um anschließend etwas weniger tänzelnd mitten in die nächste Pfütze zu tappen. Ihr scharfer Blick wusste sofort, worum es sich handelte. Er war inzwischen ihr wichtigstes Arbeitswerkzeug. Nicht das Gehirn, das die langsame komplizierte Ermittlungsarbeit leistete, und auch nicht das enge, intime, wunderbare Zusammenspiel mit einem Partner, der zu ihr passte wie eine Hand in den Handschuh. Nein, der scharfe Blick.
Blut.
Auch davon zu viel. Viel zu viel. Niemand, der so viel Blut verloren hatte, konnte überlebt haben. Jemand musste heute Nacht nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt gestorben sein. Und sie hatte nichts gehört.
Gehörte das nun dazu? Waren Todesfälle bei Schlägereien unter Betrunkenen mittlerweile Alltag? Und wurden wir immer geschickter darin, die Gewalt zu übersehen? Ekel erfüllte sie. Dies hier war ihr Alltag. Hiermit verbrachte sie jeden Tag ihres Lebens. Konnte sie nicht zumindest am Sonntag verschont bleiben? Wenigstens an diesem verfluchten Totensonntag?
»Igitt«, sagte er und machte einen Schritt zur Seite. »Öl?«
In diesem Moment krampfte sich etwas in Lena Lindbergs Innerem zusammen, und sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Aber vor Glück, denn ihre innere Stimme sagte: Dieser Mann ist kein Teil dieser Welt. Ich habe Kontakte mit einer Welt voller Gewalt und Blut und Trunkenheit und einem immer gleichen unnötigen Leiden. Dieser Mann kann meine Rettung sein. Mein Atemloch. Meine Lebensquelle.
»Ja«, sagte sie. »Öl.«
Und dann gingen sie ein paar Schritte weiter zum Medborgarplatsen und zur Högbergsgatan hinunter. Ihr Blick wanderte an seinem Körper aufwärts. Als er bei den Augen ankam, erkannte sie es wieder. Dieses Aufblitzen, das sie gestern Abend gesehen und das zu all dem geführt hatte, was danach geschehen war.
Es war selten, dass sie denselben Blick am Tag danach wiedersah. In der Regel war er dann erloschen. Es gab immer noch etwas Besseres. Irgendwo anders.
Lena Lindberg war in die Internetdatingfalle geraten. Nie zuvor hatte sie so viel Bestätigung erfahren wie während des letzten Jahres. Die Männer meldeten sich in Scharen. Aber jedes Mal, wenn sie sich sagte, dass sie immer noch den Richtigen suchte, Mr Right, klang es hohler. Fast jeder Mann, den sie über das Internet kennenlernte, war Mr Right. Und am nächsten Morgen Mr Wrong.
Der Ausgangspunkt war einfach. Sie war einsam und wollte es nicht mehr sein.
Sie kam zwar gut allein zurecht, schließlich war sie daran gewöhnt. Aber das Leben war schwarz-weiß. Die Erlebnisse waren gedämpft wie durch einen Filter. Als bekäme jede Erfahrung ihre richtigen Farben, ihre richtigen Töne, ihre Nuancen und Düfte erst, wenn es jemanden gab, mit dem sie sie teilen konnte.
Die Kneipe war nichts mehr für sie. Sie brachte es nicht mehr fertig, die einsame Frau am Tresen zu sein, die von lüsternen Männern ohne Hemmungen belagert wurde. Sie wollte nicht mehr Schlampe genannt werden. Nicht ein einziges Mal mehr im Leben. Also beschloss sie, die Auswahl selbst zu treffen.
So geriet sie in diese Spirale der Internetbekanntschaften. Keiner der Männer war ihr genug. Es gab immer irgendwo einen besseren. Und wer sagte eigentlich, dass Frauen in Paarbeziehungen leben mussten?
Natürlich war das Gras auf der anderen Seite immer grüner, doch sie suchte nicht einmal das. Sie suchte das rote Gras. Und es wurde immer deutlicher, dass das nur in ihrer Phantasie existierte. Da fand es sich dafür aber im Überfluss. Lena Lindberg war süchtig. Ihre Sucht hieß Onlinedating. Es war die neue Krankheit der Gegenwart, die Pest von heute.
Sie hoffte, dass ihr diese Sekunde des Erstarrens, das sie auf den letzten Metern vor der Kreuzung von Högbergsgatan und Götgatan überfallen hatte, nicht anzumerken gewesen war. Es war das erste Mal, dass sie sich ihre Sucht eingestand – ein Eingeständnis, das einem nur gelingen kann, wenn sich eine Alternative bietet.
Und damit kehrte das Gefühl von vorhin zurück, dass sich etwas in ihr zusammenkrampfte und ihr die Tränen in die Augen stiegen. Er wandte sich ihr nämlich zu und hielt inne. Sein Blick war von Zärtlichkeit erfüllt. Als ob er nicht nur sähe, aufnähme und reagierte. Sondern als ob er verstünde.
Als ob er sagen würde: Wir sind nur Menschen. Es ist in Ordnung.
Aber die eigentliche, hohe Schwelle zu ihrem Herzen überschritt er, indem er schwieg. Als er sah, verstand und nichts sagte. Da wurde es ernst.
Und in dem Moment erblickte sie den Wagen oben auf der Högbergsgatan. Sie schob den Mann vor sich her, aber er blieb an der Ampel stehen, bis sie von Grün auf Rot sprang.
»Hau jetzt ab«, sagte sie und merkte, dass sie lächelte. »Damit du nicht überfahren wirst.«
Er lächelte auch. »Damit er mich nicht sieht?«
»Damit er das nicht sieht«, antwortete Lena Lindberg und zeigte auf sein Beffchen.
Er lächelte ein wenig breiter, drehte sich um, lief zwischen den hupenden Autos hindurch und verschwand im stärker werdenden Regen. Ehe er ganz außer Sicht war, hörte sie seine Stimme, die auf eine seltsam ruhige Weise rief: »Ich habe gesehen, dass es Blut war, Lena. Ich arbeite auch damit.«
Und in den kurzen Sekunden, die der Wagen brauchte, um die abfallende Straße hinunter zu ihr zu gelangen, kam der gestrige Abend mit voller Kraft zu ihr zurück. Die schmerzhafte Ernüchterung nach dem beiläufigen sinnlosen Sex mit einem weiteren mittelmäßigen Netzcharmeur mit völlig verzerrtem Selbstbild am Freitagabend hatte sie in die Samstagshysterie hinausgetrieben. Sie war sicher zwanzig Kilometer durch die Stadt gewandert, immer hektischer, immer gehetzter auf der Flucht vor sich selbst und der Gegenwartspest, die sie am eigenen Leibe spürte. Und als wandelndes Klischee hatte sie vor, ihre verzweifelte Wanderung in der Kirche zu beenden. In der mächtigen, aber dennoch anonymen Engelbrektskirche, dieser Felsenkirche, die wie ein versöhnlicher Riese über Östermalm hinblickte.
Doch als sie dort anlangte, wurde die Kirche gerade geschlossen. Das brachte das Fass zum Überlaufen. So endete ihre Wanderung. Sie sank auf die Mauer am Kirchhügel, und alles entwich aus ihr. Alle Kraft. Ja, alles Leben, so kam es ihr vor. Und sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, bis irgendeine Form von Vernunft in ihren ausgelaugten Geist zurückkehrte. Es konnte ebenso gut fünf Minuten nach drei Uhr am Tag wie in der Nacht sein, als er den zur Kirche führenden Weg entlangkam, gleichsam ein paar Zentimeter über dem Boden schwebend in seinem an Zorro erinnernden Talar. Er legte eine große und beruhigende Hand auf ihre Schulter, sah sie an, als würde er alles verstehen, sah in jeden Winkel ihrer leidenden Seele und sagte, dass alles in Ordnung sei.
Wir sind einfach nur Menschen.
Es war so unglaublich lächerlich. Wie ein Kitschfilm, über den man sich die ganze Zeit beschwert, bei dem man aber trotzdem ständig weinen muss.
Sie gingen Kaffee trinken. Und das eine ergab das andere, wie man so sagt. Dies hier war etwas anderes, redete sie sich ein. Dieser Mann war etwas ganz anderes als die, die ihr für gewöhnlich begegneten. Und gleichzeitig kämpfte sie mit ihren inneren Dämonen, nicht zuletzt mit einer moderneren Variante von Groucho Marx: »Ich kann mir nicht vorstellen, einem Club beizutreten, der mich als Mitglied haben möchte.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem zu schlafen, der mit mir schlafen möchte.« Denn das wollte er. Das wurde immer deutlicher. Und sie wollte es auch. Es war trotz allem ihre besterprobte Art, Wertschätzung zu zeigen. Die Frage war, ob es auch ihre einzig mögliche war.
Vielleicht trotz allem nicht. Denn jetzt fuhr das Auto an den Bürgersteig heran, und die Tür zum Beifahrersitz wurde aufgestoßen.
Es war eineinhalb Jahre her, dass sie mit diesem Wagen gefahren war, und damals waren die Umstände recht dramatisch gewesen. Außerdem war es fast ein Jahr her, seit sie den kreideweißen Mann hinter dem Steuer zuletzt gesehen hatte, der jetzt sagte: »Ein Pastor?«
Lena Lindberg lächelte und sprang geschmeidig in den Wagen, begleitet vom obligatorischen Frusthupen dahinter wartender Autos. Sie schaute Arto Söderstedt an, während er trotz der roten Ampel Gas gab und fortfuhr: »Das wird bestimmt lustig.«
»Warten wir’s ab«, sagte Lena Lindberg. »Es ist eine Weile her. Wir haben uns alle verändert.«
»Durch die Zeit außerhalb der A-Gruppe.« Arto Söderstedt nickte.
»Oh, Herr Professor.«
»Dozent, wenn ich bitten darf.«
Sie sahen einander eine Weile an. Söderstedts weißes Gesicht wurde für eine kurze Sekunde ernst. Dann sagte er: »Und du bist zur Gewalt zurückgekehrt, soviel ich gehört habe.«
»Mit Uniform und allem«, entgegnete Lena Lindberg und schnitt eine unfreiwillige Grimasse.
Nach einem Moment des Schweigens sagte sie: »Er ist kein Pastor.«
»Es sah wahrlich danach aus«, meinte Söderstedt.
»Das ist nur ein Rollenspiel«, sagte Lena Lindberg.
4
Die beiden Gesichter auf der anderen Seite des Frühstückstischs faszinierten sie. Nicht nur, weil sie sie liebte, nicht nur, weil ihre Wangen erstaunlicherweise rot leuchteten. Es war etwas anderes, aber sie konnte den Finger nicht genau darauf legen.
Sicher war, dass sie jung und vital waren und hoffentlich ein langes Leben vor sich hatten. Sicher war auch, dass diese armen Schweine gezwungen waren, die Reste des wahnsinnigen 20. Jahrhunderts zusammenzukehren, und versuchen mussten, sich in den Ruinen einzurichten. Und dazu kam der Sirenengesang der Gene, die ihren Fortbestand in einer unsicheren Zeit einforderten. Aber nicht nur das.
Sie merkte, dass sie lächelte, während sie die beiden betrachtete, die, jeder auf seine Weise, deswegen eine gewisse Irritation erkennen ließen.
»So, und wann kommt ihr zurück von eurem Abenteuer?«, fragte die Ältere mit einem solchen Grad von Ironie in der Stimme, dass sie den Faden verlor.
»Vielleicht erst morgen, wie gesagt.«
»Aber wann? Muss ich am Abend hier sein?«
»Kannst du das denn nicht?«, fragte der Jüngere. »Es macht doch Spaß.«
»Ich finde auch, dass es Spaß macht«, entgegnete die Ältere und streichelte dem Jüngeren übers Haar. »Aber ich habe auch noch ein anderes Leben.«
Damit wandten sich beider Blicke wieder ihr zu, fragend, und sie versuchte sich daran zu erinnern, wie die Frage gelautet hatte. Das Einzige, was sie erfüllte, war die Faszination. Die unbestimmbare Faszination beim Betrachten dieser beiden jungen Gesichter.
Schließlich fand sie den Faden wieder, dachte über den Wortlaut der Einladung nach und antwortete: »Wir dürften morgen Nachmittag wieder zurück sein.«
»Wieso dürften? Habt ihr echt null Durchblick?«
»Wenig«, gestand Kerstin Holm.
*
Zu seiner grenzenlosen Verblüffung bekam er einen Parkplatz in der Nähe. Allerdings nicht in der Heleneborgsgatan, wo er spät am gestrigen Abend aus schierer Frustration in der zweiten Reihe geparkt hatte, sondern an der kleinen Kurve in der Varvsgatan gegenüber von Långholmen.
Erst als er um die Ecke bog und die Bucht mit dem Riddarfjärden vor ihm lag, über der ein stärker werdender Novemberregen hing, wurde ihm klar, wo er sich befand. Sein Blick hatte sich wie von selbst und ganz ohne sein Zutun hinauf zu dem Balkon im ersten Stock bewegt. Dort lagen inzwischen Spielsachen herum, ein paar hingeworfene Springseile und ein vom Regen aufgeweichtes Kuscheltier neben einem kleinen Tretauto, das auf dem engen Balkon kaum wenden konnte. Nicht das geringste Anzeichen ließ vermuten, dass hier einmal Schwedens Topspion gewohnt hatte, ein höchst anonymer Mann mit Namen Tore Michaelis. Und noch weniger konnte man ahnen, dass der Mann, der gerade seinen Blick vom Balkon abwandte und sich im Schaufenster eines Tante-Emma-Ladens selbst erblickte, sein Nachfolger war.
Der Meisterspion Paul Hjelm.
Und er fand nicht einmal besonders schlecht, was er da in der Scheibe sah. Auf jeden Fall noch nicht. Er war immer noch zu frisch in der Agentenbranche, um sich allmählich vor seinem Spiegelbild zu ekeln.
Mittlerweile war er ein gutes Jahr im Dienst der Säpo, der Sicherheitspolizei. Es war keineswegs ein ruhiges Jahr gewesen, unter internationalen sicherheitspolizeilichen Aspekten betrachtet, aber für ihn selbst war es einigermaßen entspannt gewesen. Eine Einarbeitungsphase. Nur wenige Auslandsreisen. Ein wenig introvertiertes Spionagenetzwerken. Die Planung zukünftiger Aufgaben für diese Stelle. Und die Gewöhnung an die Einsamkeit.
Das war das Paradox seines Lebens. In seinem Berufsleben gewöhnte er sich an die Einsamkeit, in seinem privaten Leben gewöhnte er sie sich gerade ab.
Nach all den Jahren hatte Paul seine Kerstin bekommen. Das altvertraute Komikerpaar Jalm & Halm war wieder vereint. Oder eher wiedergeboren.
Er musste lächeln, wenn er daran dachte. An die Liebe. Er hatte sie tatsächlich nie aufgegeben, war trotz seiner zunehmend verwahrlosten Junggeselleneinzimmerwohnung in der Slipgatan im alten Messer-Söder jenseits der Långholmsgatan nie bitter geworden, hatte nie Magenbeschwerden gehabt oder zu viel getrunken. Er hatte nicht einmal angefangen, Opern zu hören. Und irgendwie hatte Kerstin sich stets in Reichweite befunden, in seinen Gedanken, in seiner Seele. Ihre Leben waren nur immer sozusagen asynchron verlaufen.
Aber jetzt nicht mehr.
All die Jahre, in denen sie zusammengearbeitet hatten. In denen sie einander zuweilen so nahegekommen waren, dass zwischen ihren Hirnen praktisch keine Grenze verlaufen war. Es war vorgekommen, dass sie jeweils die Gedanken des anderen gedacht hatten.
Wie bemerkenswert einfach es gewesen war, wieder darauf zurückzukommen, jetzt nicht mehr beruflich – wenngleich dies natürlich auch vorkam, aller Schweigepflicht und aufgezwungenen Geheimnistuerei zum Trotz –, sondern in höchstem Maße privat. Wenn es früher keine Grenze zwischen ihren Hirnen und Gedanken gegeben hatte, so war jetzt auch die Grenze zwischen ihren Körpern und Seelen durchlässig geworden. Es schien fast, als gäbe es so etwas wie Glück. Tatsächlich.
Natürlich gerieten sie manchmal aneinander, doch nie ernstlich, nie mit bedrohlichen Konsequenzen. Es war beinahe ein wenig verdächtig, dass ein Jahr so schmerzfrei vergehen konnte, so, na ja, glückselig. Nicht einmal der Zustand der Welt vermochte seine im Grunde positive Lebenseinstellung zu erschüttern.
Kerstin, du weiche, scharf geschliffene, intelligente, schöne, gerechte, betörende Frau. Die du das Leben gezeichnet hast, ohne dich von ihm zeichnen zu lassen.
Und in ebendiesem Augenblick spürte er, dass sie an ihn dachte. Seine Sinne wurden auf einmal doppelt so klar.
*
Und plötzlich sah sie es vollkommen deutlich. Als hätte sich ihre Sehschärfe abrupt verdoppelt, und mit einem Lächeln erkannte sie, warum. Auf einmal sah sie, was an den beiden Gestalten auf der anderen Seite des Frühstückstischs so faszinierend war. Sie waren Paul und Kerstin. Doch mit vertauschten Rollen. Paul als Frau und Kerstin als Mann.
Oder genau genommen: Anders Holm war jetzt dreizehn Jahre alt und Tova Hjelm zweiundzwanzig. Und beide hätten ebenso gut tot sein können.
Anders war vor sieben Jahren nur um Haaresbreite dem Tod entronnen, aufgrund des Ränkespiels seines Vaters, dessen Name nie wieder genannt werden sollte, und Tova hatte erst im vergangenen Jahr am Rand des Grabes balanciert, als die Anorexie sie eisern im Griff hatte – und sie außerdem einem richtig grässlichen Serienmörder über den Weg lief.
Kerstin Holm betrachtete Tova über den ziemlich schmuddeligen Küchentisch hinweg. Niemand würde ahnen können, dass sie vor einem Jahr nur vierunddreißig Kilo gewogen hatte. Ihre Ähnlichkeit mit Paul war entzückend, und sie sah kerngesund aus. Eine Zweiundzwanzigjährige von strahlender Schönheit, die gerade für die Schauspielausbildung an der Theaterhochschule angenommen worden war. Doch Kerstin wusste, dass der Schein trog. Was sie vor sich sah, war eine junge Frau, die die ganze Zeit mit ihrer inneren Selbstzerstörung zu kämpfen hatte und nur vorübergehend siegreich aus diesem Kampf hervorging. Denn die Anorexie lässt sich nicht besiegen, sie ruht nur. Sie ist die ganze Zeit da, wie eine Drohung, ein festes Verhaltensmuster, ein eingebautes Kontrollbedürfnis.
Paul hatte Tova gestern Abend spät in ihrer Studentenwohnung am Lappkärrsberget in Frescati abgeholt. Im Laufe des Jahres, das sie jetzt zusammengelebt hatten, war Pauls Tochter zu einem perfekten – und extrem geschätzten – Babysitter für Kerstins Sohn geworden. Der meinte zwar, eigentlich keinen Babysitter mehr nötig zu haben, er war immerhin ein Teenager, er kam zurecht. Aber für Tova war Anders immer bereit, eine Ausnahme zu machen.
Dann hatten sie die halbe Nacht beisammengesessen und geredet, und die Erwachsenen hatten ein bisschen zu viel Wein getrunken. Sie hatten Paul ein paar Geschichten aus den verschlossenen Korridoren der Säpo abgeluchst, Tova hatte freimütig Anekdoten aus den heiligen Hallen der Theaterhochschule zum Besten gegeben, und sogar Kerstin steuerte einige Sätze über ihr neues Leben als Bürokratin bei.
Nun ja, vielleicht war sie nicht direkt eine Bürokratin. Aber auf jeden Fall eine ranghohe Beamtin in dem sogenannten Operativen Rat bei der Reichskriminalpolizei. Der Operative Rat war das erst kürzlich ins Leben gerufene Organ, das die polizeilichen Kraftanstrengungen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen koordinierte. So lautete auf jeden Fall die offizielle Beschreibung. Und Gott sei Dank war die Reichskrim dem Chaos entgangen, das sich im Lauf des Herbstes in der übrigen schwedischen Polizei breitgemacht hatte und das – Kerstin Holms Einschätzung zufolge – jederzeit explosionsartig zu einer massiven Unzufriedenheit mit dem ziemlich juristischen und nichtpolizeilichen Reichspolizeichef führen konnte. Denn der Operative Rat funktionierte recht gut. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Einsetzung sogenannter Aktionsgruppen. Eine nationale Aktionsgruppe wurde für einen zeitlich begrenzten Einsatz gegen einen bestimmten Verbrechenstyp gebildet – mit anderen Worten war sie also der betrüblicherweise aufgelösten Sondereinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter, gelegentlich als A-Gruppe bezeichnet, nicht ganz unähnlich. Waldemar Mörner, der nominelle Chef der A-Gruppe, hatte deren operative Chefin Kerstin Holm mit hinübergenommen in den Operativen Rat, wo sie für zeitlich begrenzte Einsatzgruppen verantwortlich war. Seit sie dort war, hatten Einsätze unter anderem gegen Cannabishandel, Überfälle auf Werttransporte und einhundert Schwerkriminelle stattgefunden. Letztere bildeten die Hunderterliste, was bedeutete, dass hundert Schwerkriminelle im ganzen Land von der Polizei auf Schritt und Tritt beschattet wurden.
In den letzten sieben Jahren hatten die Fälle von sogenannter »unzulässiger Beeinflussung« um fünfzig Prozent zugenommen. Die Urteile gegen Kriminelle, die mit Gewaltandrohung Politiker, Gewerbetreibende, Zeugen und Juristen zu beeinflussen versucht hatten, waren drastisch gestiegen – und dabei wurden nur rechtskräftige Verurteilungen berücksichtigt. Die Dunkelziffer der Anzahl von Drohungen, Einschüchterungen und Misshandlungen von Zeugen und Angestellten im Rechtswesen, aber auch von Bestechung und Schutz von Kriminellen, war allem Anschein nach enorm.
Mit anderen Worten, Kerstin Holm ging es ziemlich gut. Die Erfahrungen aus der A-Gruppe waren unschätzbar, weil die Gruppe eine neue und zukunftstaugliche Einheit gewesen war, in der es keine Hierarchien gab, wo Denkfreiheit herrschte und die Entscheidungswege kurz waren. Die zeitlich befristet zusammengestellten Einsatzgruppen waren in hohem Maß nach dem Muster der A-Gruppe geformt.
Dennoch vermisste sie diese. Ihr fehlten nicht nur die praktische Polizeiarbeit, die Ermittlungen, die Wahrheitssuche, sondern vor allem die Menschen, das gemeinsame kollektive Denken, die langen Besprechungen in der nunmehr zum Lagerraum umgewandelten Kampfleitzentrale.
Es würde ganz einfach unglaublich schön sein, sie alle wieder zu treffen. Die verschwendeten Ressourcen.
Als Tova Hjelm zwischen ihrem Vater und ihrer, ja, Stiefmutter eingeklemmt Schauspieleranekdoten zum Besten gegeben hatte, während der gestrige Abend in die Nacht und die wiederum fast in den grauenden Morgen übergegangen war, schien ihr kaum bewusst gewesen zu sein, dass sie zwischen zwei der höchsten Polizeibeamten des Landes saß. Weder Paul Hjelm noch Kerstin Holm waren als Angeber bekannt. Vermutlich waren sie deshalb so weit gekommen. Nur durch Verdienste, nicht durch Gelaber.
Paul. Ja, Paul, Paul, Paul. Sie hätte nie geglaubt, dass sie fähig war, so zu lieben. Nicht bei ihrer Vergangenheit. Nicht so einfach, unverstellt und stark. Nach ein paar Jahren in Armani-Anzügen bei der Abteilung für interne Ermittlungen hatte er seinen etwas saloppen Stil wieder aufgenommen. Auf diesem am wenigsten offiziellen und vielleicht allerwichtigsten Posten bei der Säpo durfte Paul er selbst sein, zumindest, was das Äußere anging. Und Kerstin Holm gefiel das. Paul Hjelm hatte sich bemerkenswert gut gehalten, als hätte er sein Leben so lange konserviert, bis es in ihrer Beziehung aufblühen konnte. Und vielleicht hatte sie das Gleiche getan.
All die Jahre, in denen sie wie die Katze um den heißen Brei geschlichen waren, als ihre Leben kontinuierlich asynchron verlaufen waren: Vergeudete Jahre? Nein, kaum. Vielmehr Jahre auf emotionaler Sparflamme, als hätten sie beide eingesehen, dass sie eines Tages eine ansehnliche Menge emotionalen Kapitals brauchen würden.
Sie blickte auf die Uhr, bekam einen Schrecken und begann hektisch alles durchzugehen, was Tova in den nächsten gut vierundzwanzig Stunden bedenken musste.
»Du, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, oder?«, sagte Tova mit einem nachsichtigen Lächeln.
»Frag Anders, dann wirst du hören, ob ich eine überbeschützende Mutter bin«, gab Kerstin lachend zurück.
»Helikoptermutter«, sagte Anders. Tova und Kerstin lachten. Kerstin Holm drückte ihre beiden Lieben. Die Tatsache, dass Anders seiner Mutter inzwischen über den Kopf gewachsen war, machte ihr schwer zu schaffen. Instinktiv wollte sie sich immer noch zu ihm hinunterbeugen.
Sie öffnete die Tür und winkte Tova und Anders zum Abschied.
Die beiden waren schon wieder in ein Gespräch vertieft.
*
Paul Hjelm stand vor dem Haus, das schon sein Zuhause war. Er blickte durch den Torbogen in den Hinterhof, wo in einem Ladenlokal die Redaktion einer Zeitschrift und ein Fotostudio untergebracht waren. Dieses Haus war unerwartet schnell viel mehr ein Zuhause geworden, als es die Einzimmerwohnung in der Slipgatan je gewesen war. Die wurde jetzt von den nicht immer glückseligen Nebeln der Vergangenheit verschluckt. Als er schließlich mit Kerstin und Anders hier einzog, verspürte er nicht die geringste Sentimentalität für die alte heruntergekommene Junggesellenbude. Sie gehörte der Vergangenheit an, jedoch auf eine ganz andere Art und Weise als das Reihenhaus in Norsborg. Dort waren immerhin seine Kinder aufgewachsen. Es begleitete ihn, wie ein Gruß aus einem anderen Leben.
Aber jetzt zählte dies hier. Die Heleneborgsgatan. Er liebte die Gegend um die Högalidskirche. Er war sich nicht ganz sicher, ob ein Spion leicht bohemehafte Künstler- und Musikerviertel lieben sollte, doch er tat es auf jeden Fall. Vermutlich war er kein echter Spion.
Er dachte an den merkwürdigen Zufall, dass sein Vorgänger auch in dieser Ecke gewohnt hatte. Sein Vorgänger, der in der gleichen Position, die Paul jetzt innehatte, mindestens zehn Menschen getötet hatte. Er selbst war noch nicht annähernd so weit, aber er hatte in der A-Gruppe getötet und begann allmählich zu ahnen, dass er seiner Aufgabe nicht mit dem gleichen selbstaufopfernden Pflichteifer nachkam wie Tore Michaelis.
Im vergangenen Jahr war er natürlich ein paarmal im Ausland gewesen, hatte wegen des überraschenden Kernwaffenversuchs Nordkoreas und der besorgniserregenden Erklärung des iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, sein Land sei in der Lage, Atomwaffen herzustellen, an internationalen Konferenzen der Nachrichtendienste in London und Athen teilgenommen. Seine erste alleinige Auslandsreise hatte ihn nach Budapest geführt, wo die Proteste gegen Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány aus dem Ruder zu laufen drohten. Dessen Stimme war zuvor auf Band festgehalten worden, als er zugab, bezüglich der Staatsfinanzen gelogen zu haben, um die Wahl zu gewinnen. Aber es war dennoch ein Jahr gewesen, in dem keine großen umwälzenden Ereignisse die Welt erschütterten. Und was im April geschehen war, um sich nur wenige Wochen später zu wiederholen, war höchstens auf subtile, indirekte Weise von größerer politischer Bedeutung. Wenn auch nicht weniger furchtbar.
Kaum zufällig traf es zwei der waffenfreundlichsten Länder. Im Waffenparadies USA war man zwar daran gewöhnt, doch die Wahnsinnstat des Todesschützen Cho Seung-Hui an der Virginia Tech war dennoch rekordverdächtig. Zweiunddreißig Menschen starben durch die einhundertfünfundsiebzig Schüsse des waffenverrückten jungen Mannes, und der hinterließ so verwirrte, so von richtungslosem Hass erfüllte Äußerungen, dass es ein Rätsel war, wie er die Schule hatte besuchen können, ohne dass jemand eingriff. Es war nicht nur ein Versagen der amerikanischen Waffengesetze – die es dem aktenkundig geisteskranken jungen Mann erlaubten, mit seiner Kreditkarte Waffen zu kaufen –, sondern auch des ganzen psychiatrischen Systems, ja der gesamten Öffentlichkeit.
Ende der Leseprobe