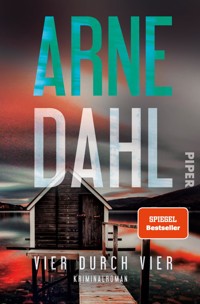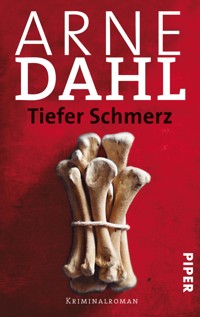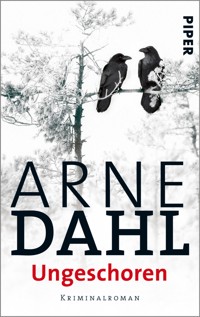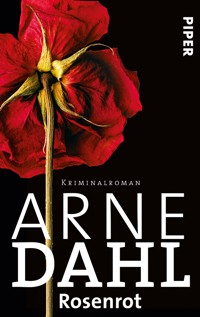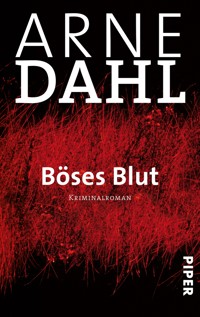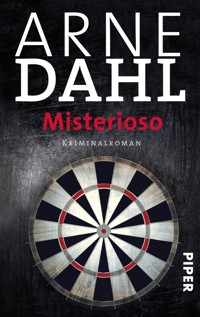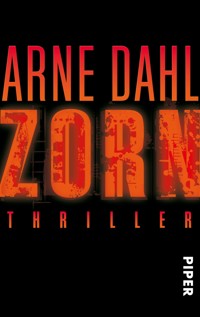
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein renommierter plastischer Chirurg wird erhängt in seinem Haus gefunden. In einer Stockholmer Kneipe stirbt ein albanischer Waffenhändler zusammen mit vier anderen im Kugelhagel eines kühl agierenden Killers. Und auf der ehemaligen italienischen Gefangeneninsel Capraia findet ein hochrangiger Politiker den Tod. Die international ermittelnde Opcop-Gruppe soll das schier Unmögliche möglich machen und die Zusammenhänge zwischen diesen Morden aufdecken - sie stößt auf zwei parallele Serienmörder. Einer von ihnen hat es auch auf die Mitglieder des Teams abgesehen … »Zorn« erzählt von jahrzehntelanger Rache, von Schuld und dem Wert der Menschlichkeit. Mit dem zweiten Fall aus seinem Thriller-Quartett um die Opcop-Gruppe stößt Arne Dahl in neue Dimensionen vor und erntet international höchstes Lob.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Hela havet stormar« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Die Zitate aus »Der Graf von Monte Christo« von Alexandre Dumas stammen aus der deutschen Übersetzung von F. W. Bruckbräu und liegen im Deutschen Taschenbuch Verlag, München 2010, vor.
Übersetzung aus dem Schwedischen von Antje Rieck-Blankenburg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95517-1
© Arne Dahl 2012
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH 2013
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
1 – Flaute
Insel I
Livorno, 8. Mai
Ein Schleier. Alles dahinter ist nur schemenhaft zu erkennen. Dann, ganz sacht, eine Bewegung. Wie sich der Schleier gleichsam prüfend lüftet. Sich wie in Zeitlupe aufbauscht. Dann öffnet er sich. Und gibt die Sicht frei.
Auf das, was er gesehen hat. Was er gespürt hat. Die ganze Zeit über.
Dabei dürfte sich die Tüllgardine gar nicht bewegen. Denn nachdem sich der sanft wiegende Schleier geöffnet hat, ist eine vollkommen glatte Wasseroberfläche zu sehen. Windstille.
Flaute.
So hat sich die Welt für Deda dargestellt, als er in der Frühjahrskälte von der Hand des Kapitäns an Deck des alten Lastkahns gehoben wurde. Beinahe friedlich. Als bestünde neue Hoffnung für die Menschheit.
Aber so dachte Deda natürlich nicht. Dafür war er noch viel zu jung. Er war zehn Jahre alt, und der Fluss lag spiegelglatt vor ihm. Es sah beinahe so aus, als läge noch immer eine hauchdünne Eisschicht auf der Wasseroberfläche, die der alte Kahn mit der Schärfe eines Rasiermessers durchschnitt. Erstaunlich lautlos.
Auf beiden Seiten des Flusses erstreckte sich die karge, trostlose Landschaft, eine Landschaft, die er in den vergangenen Wochen durch so viele Fenster gesehen hatte. Zuerst durch Zugfenster, dann durch Barackenfenster und schließlich durch die Bullaugen eines Schiffes. Wenn man diesen Kahn überhaupt als Schiff bezeichnen konnte.
Der Kapitän warf Deda erneut einen besorgten Blick zu. Eine Woche zuvor hatte er auf seinem alten Kahn noch Holz transportiert. Jetzt war die Fracht eine andere. Und sein Leben war ein anderes geworden.
Es sind vier Kähne, die jahrzehntelang widerspenstiges Holz durch die kärgste aller Landschaften transportiert haben. Dedas Kahn ist der erste in der Reihe. Derjenige, der die blanke schwarze Wasseroberfläche mit unerwartet scharfen Schnitten zerteilt.
Es ist so lange her und dennoch so gegenwärtig. Es war im Mai, und eigentlich hätte es gar nicht so kalt sein dürfen. In der Großstadt, in der Deda aufwuchs, war es fast schon Sommer. Bäume und Sträucher blühten, als sie ihn in der Stadt aufgriffen, die bis dahin seine Welt gewesen war. Er begreift immer noch nicht, warum. Weil er Waise ist? Weil Großmutter ihn nicht jeden Tag in die Schule schickte? Weil er seinen neuen Pass vergessen hatte? Er weiß es nicht, er begreift nichts. Außer, dass der Kapitän freundlich ist. Er tätschelt Deda den Kopf, doch sein Gesichtsausdruck bleibt sorgenvoll.
Der Tag vergeht erstaunlich langsam. Die Natur scheint innezuhalten und mitten in ihrem sonst so dauerhaften Streben nach Veränderung ins Stocken geraten zu sein. Als wisse sie, was geschehen wird. Als reagiere sie instinktiv auf das naturwidrige Geschehen.
Sie sind inzwischen seit mehr als zwei Wochen unterwegs. Den Großteil der Strecke haben sie mit dem Zug zurückgelegt. Sie sind viele, so viel weiß Deda, Tausende, und sie bekommen nur wenig Brot und Wasser am Tag. Der kollektive Hunger wird immer lähmender, immer bedrohlicher. Aber jetzt sind sie bald da. Das hat der Kapitän gesagt.
Deda vertraut dem Kapitän.
Vorhin hatten sie tatsächlich für eine Weile angehalten. Legten an einem Pier an, der zu einer Stadt zu gehören schien. Zu dem Zeitpunkt war Deda noch unter Deck. Der Gestank, das Wimmern, die Schreie. Die unvermittelt ausbrechenden Schlägereien um die wenigen Bullaugen. Die brutale Bande mit dem Glatzköpfigen, die Deda aus seinem Viertel zu Hause kannte. Von der er sich immer ferngehalten hat. Damals wie heute.
Die vom Rauchen kratzige Stimme des Glatzkopfs: »Verdammt, sie fahren wieder!«
Die daraufhin einsetzende Bewegung der fast fünftausend Gefangenen, die einander zu schieben und zu pressen beginnen. Gegen die Wände, hinunter auf die Bodenplanken. Deda hat gehört, wie Menschen starben. Er hörte die Geräusche des Todes. Und bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte das Geräusch auch seinen Körper erfasst und bohrte sich tief in seinen Kopf. Er wurde an der Wand nach oben gepresst und spürte, wie sämtlicher beharrliche Widerstand, der ihn seit mehr als zwei Wochen in dieser Hölle am Leben gehalten hatte, mit einem Mal aus ihm wich.
Plötzlich war es angenehm zu sterben.
Was dann geschah, nahm er nur schemenhaft am Rand der Ohnmacht wahr. Die Luke über seinem Kopf wurde geöffnet. Eine große, raue Hand langte nach unten. Und plötzlich stand er heftig schlotternd oben an Deck, doch die klare kalte Luft, die in seine Lungen strömte, ließ ihn wieder Kraft schöpfen.
»Befehl«, brummte die Kapitänsstimme. »Mir erteilt kein Idiot einen Befehl.«
Deda gelingt es zum ersten Mal, dem Blick des Kapitäns zu begegnen. Er sieht sehr besorgt aus.
»Jetzt ist es nicht mehr weit«, erklärt der Kapitän, »aber ich bin mir nicht sicher, ob es dort, wo ihr hinsollt, so viel besser sein wird.«
Es ist nicht viel mehr als eine kleine Unebenheit, ein winzig kleiner grauer Fleck, der sich auf der makellosen schwarzen Oberfläche des Flusses abzeichnet, weit in der Ferne am äußersten Rand des Blickfelds. Anfänglich scheint er nicht zu wachsen. Er scheint ebenso innezuhalten wie die übrige Natur.
Dann löst sich die Illusion auf, und die Natur gerät wieder in Bewegung. Der graue Fleck wird größer und größer. Schließlich entpuppt er sich als Insel.
Sie sind angekommen.
Die Gefangenen werden von den Kähnen gelassen. Auf der Insel stinkt es nach Sumpf und Moder.
Deda ist noch so klein. Eigentlich kennt er sich nicht aus mit Sumpf und Moder. Aber sein Organismus reagiert instinktiv. Der modrige Geruch sucht sich einen Weg in sein Innerstes.
Hinzu kommt die Kälte. Er begreift zwar nicht, wie es mitten im Mai schneien kann, aber er riecht, dass Schnee in der Luft liegt.
Die Insel ist klein und unbewohnt. Sie besteht lediglich aus sumpfigem Gelände und vereinzelten Pappelhainen. Dedas alte Stiefel sinken in den feuchten Boden ein, der bei den kalten Temperaturen langsam zu gefrieren beginnt. Er steht einfach da, wartet ab und versucht sich unsichtbar zu machen. Allerdings bewegt er die Füße, ihm ist kalt. Er tritt auf der Stelle, an einem Ort, den Gott vergessen hat.
Um ihn herum herrscht Chaos. Die Gefangenen werden gezählt. Gefangene aus vier großen Lastkähnen, ein grummelndes Gedrängel, ein drängelndes Gegrummel. Die Hälfte kann kaum gehen und stolpert taumelnd auf dem sumpfigen Boden umher. Die Toten werden herausgetragen, woraufhin sich der Leichengestank mit dem Sumpfgeruch mischt.
Die Aufseher, in ebenso erbärmlichem Zustand wie die Gefangenen und nur durch ihre Gewehre zu erkennen, tragen Jutesäcke an Land. Plötzlich greifen die Gefangenen sie an. Die Säcke reißen. Aus ihnen rinnt etwas Weißes. Es ist Mehl, das herausstaubt und wie vergebliche SOS-Rauchsignale in die Luft steigt, bis die Feuchtigkeit wie Vorboten des Schneesturms, den Deda heraufziehen spürt, kleine weiße Klümpchen zu Boden fallen lässt. Die Aufseher schießen auf die angreifenden Gefangenen. Das Mehl vermischt sich mit Blut. Ein rötlich-weißes Klümpchen landet vor Deda auf dem feuchten Boden. Ein Blutfleck, denkt er. Er will ihn auflecken. Denn in seinem Körper wütet der Hunger. Aber er lässt es bleiben.
Der Uniformierte, der am Pier zugestiegen ist, pfeift die Jutesackträger zurück. Obwohl er sich bemüht, herrisch und streng auszusehen, steht ihm die Angst ins Gesicht geschrieben. Deda erkennt die Angst wieder. Er weiß, wie sie die Blicke der Menschen verändert. Er hat gelernt, wozu Angst die Menschen treiben kann.
Jetzt schreit der Uniformierte den Kapitän an. Dedas Kapitän. Dann legen die Kähne ab. Umrunden die Insel. Deda sieht die Kähne auf der anderen Seite des Flusses wieder anlegen. Sie laden etwas ab. Deda glaubt, beinahe die Miene des Kapitäns vor sich zu sehen, als man ihn zwingt, Mehl direkt auf den Boden zu entladen. Der Mehlberg zeichnet sich ab wie ein Berggipfel. Ein schneebedeckter Berggipfel. Das ist alles, ein riesiger Mehlberg. Deda sieht keinen anderen Proviant. Weder Brot noch Wasser und auch keinen getrockneten Fisch, obwohl man es ihnen versprochen hat. Da sind auch keine Gerätschaften, um darin zu kochen oder daraus zu essen und zu trinken.
Was macht man mit nichts als Mehl? Essen?
Während sich die Kähne flussabwärts entfernen, werden Wachen um den Mehlberg herum aufgestellt. Kurz vor dem Einsetzen der Dämmerung beginnt es zu schneien. Aber es ist kein leichter Schneefall, sondern ein Schneesturm. Über Nacht verwandelt sich der Mehlberg tatsächlich in einen schneebedeckten Berggipfel.
Die Gefangenen versuchen, Feuer zu entfachen, um sich zu wärmen, aber das feuchte Pappelholz brennt miserabel. Nur einige wenige Holzhaufen entflammen, und Deda weicht dem Gedränge um die Feuerstellen aus. Er will nicht schon wieder gestoßen und getreten werden. Stattdessen zieht er seine Kleidung fester um sich und dankt Großmutter und Gott – ja, Gott auch ein wenig, Gott, an den er nicht glaubt –, dass Großmutter ihn immer gezwungen hat, sich zu warm anzuziehen. »Man weiß nie, was im Leben auf einen zukommt«, hat sie stets gesagt.
Großmutter. Er fragt sich, was sie nun denkt, was sie tut. Was sie glaubt, dass passiert ist.
Ob sie noch Tränen übrig hat.
Die Nacht wird hart, sehr hart. Deda setzt sich inmitten einer ruhigen Gruppe, die sich etwas abseits, oben am Waldrand, versammelt hat. Sie hocken eng beieinander, und er versucht bei dem Schneesturm so viel wie möglich von der Wärme der anderen abzubekommen. Wahrscheinlich gibt er ebenfalls ein wenig ab, aber er merkt es nicht.
Neben ihm sitzt eine blonde Frau in einem auffälligen hellgrünen, bodenlangen Kleid, als hätte man sie während der Pause in der Oper aufgegriffen. Seine Mutter wäre jetzt in ihrem Alter, wenn sie den Mut gehabt hätte weiterzuleben. Sie heißt Faina, und sie unterhalten sich leise, bevor er an ihre Schulter gelehnt einschläft. Als die Dämmerung einsetzt, hat er dennoch nicht das Gefühl, geschlafen zu haben.
Fainas Oberkörper ist erschreckend kalt. Ihr hellgrünes Kleid ist fast vollständig mit Schnee bedeckt. Erschrocken schreit er auf, er hat bereits genügend Tote gesehen. Aber sie bewegt sich, sie wimmert. In dem Moment sieht er es.
Fainas bloße Füße sind über Nacht am Boden festgefroren.
Ein paar Leute helfen ihr loszukommen. Sie graben, scharren und befreien sie. Jemand holt von irgendwoher eine Decke, die um ihre Schultern gelegt wird. Deda wärmt ihre Füße an seinem Bauch. Sie blickt ihn durch einen Tränenschleier hindurch an.
Als Faina ihre Füße wieder unter seiner Jacke hervorzieht, sind sie blau. Sie kann nicht gehen. Deda verspricht, ihr zu helfen. Er sammelt Schnee und formt daraus einen Schneeball, an dem sie lutschen kann.
Inzwischen hat sich vor dem Mehlberg eine lange unruhige Schlange gebildet. Fünftausend Menschen stehen da und warten ungeduldig. Ihnen gegenüber stehen fünfzig Aufseher, neben vier Zelten für den Arzt, die Gesundheitsoffiziere und die am schwersten Erkrankten, sowie eine kleine Führungsgruppe Uniformierter, deren Gesichter alle von großer Angst gezeichnet sind, die jeden Moment in Hass umschlagen kann.
Die Leute nehmen das Mehl, so gut sie können, in Empfang. Einige haben Mützen bei sich, andere tragen es auf ihren bloßen Handflächen. Es rinnt ihnen zwischen den Fingern hindurch.
Der Befehl, sich in einer Schlange anzustellen, ist nutzlos. Chaos entsteht. Die Aufseher schießen wieder. Immer mehr Menschen sterben. Es geht bereits das Gerücht um, dass irgendwo im Wald ein Leichenhaufen versteckt ist.
Deda sitzt neben Faina und blickt auf seine alte Mütze. Sie betrachten das Mehl. Faina schüttelt bloß den Kopf. Sie schauen einander an. Sie könnte in der Tat seine Mutter sein.
In ihren Blicken liegt ein Versprechen. Sie werden einander nicht im Stich lassen.
Einander nicht verlassen.
»Man kann es mit Wasser mischen«, sagt Faina schließlich.
»Es gibt aber kein Wasser«, entgegnet Deda.
»Wir befinden uns doch mitten in einem Fluss«, anwortet Faina und lächelt matt.
Ihr Lächeln ist einzigartig. Zum ersten Mal in seinem Leben begreift Deda, was eine Mutter ist. Er begreift es wirklich.
Rundherum gibt es Wasser. Sie sitzen immer noch ganz in der Nähe von dem Ort, wo die Kähne sie abgesetzt haben. Aber unten am Ufer herrscht dichtes Gedränge. Deda möchte nicht dorthin, er will nie wieder eingeklemmt werden wie auf dem Kahn. Vorsichtig trägt er seine Mütze in Richtung des Mehlberges zurück. Auf dieser Seite gibt es ebenfalls eine Uferlinie. Vielleicht sind dort mittlerweile weniger Menschen.
Die Aufseher stehen mit ihren Gewehren um den Mehlberg herum aufgereiht. Sie sind ihm unheimlich. Obdachlose mit Gewehren. Deda schüttelt sich und beschließt, einen Umweg durch den dichten Pappelhain zu machen.
Und landet in der Hölle.
Zuerst begreift er nicht, was er sieht. Zwischen einigen Stämmen liegt etwas. Es dauert eine Weile, bis sich seine Sinneseindrücke zusammenfügen und sich die herumliegenden Gliedmaßen zu Menschen formen.
Das ist der Leichenberg. Deda erinnert sich an das Gerücht, dass die Aufseher die Leichen irgendwo zusammengetragen haben sollen. Zumindest solange sie es noch schafften, die Toten einzusammeln. Inzwischen bleiben sie einfach dort liegen, wo sie umfallen.
Deda hält inne. Nicht nur, weil er starr vor Schreck ist. Er empfindet noch etwas anderes. Vielleicht ist es Ehrfurcht angesichts des versammelten verlorenen Lebens, das diese Toten bedeuten.
Auf der schmelzenden Schneedecke zeichnen sich seltsame Spuren ab. Blutrote Streifen. Er kann nicht länger hinschauen. Muss sich abwenden.
Deda läuft weiter in Richtung Wasser. Es muss hinter dem unerwartet dichten Wäldchen liegen. Er lugt zwischen den Zweigen hindurch. Das Wasser ist pechschwarz. Hier sind ebenfalls Menschen, allerdings nicht so viele wie auf der anderen Seite. Einige von ihnen haben Treibholz gesammelt und binden die jämmerlichen Stöcke mit Rindenstreifen zu einem Floß zusammen. Aber wohin wollen sie fliehen? Geradewegs in die Wildnis?
Aber es sind nicht die Floßbauer, die Dedas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es sind die Menschen, die am Ufer sitzen oder kauern. Neben vielen liegen dreckig verschmierte Mützen und Hüte, ihr Erbrochenes hat einen ähnlichen Farbton. Und Deda begreift. Er begreift nur allzu gut.
Wenn man das Flusswasser nicht trinken und auch nicht abkochen kann, weil man kein anständiges Feuer in Gang bekommt und es keine geeigneten Kochgefäße gibt – wie sollen sie dann überleben? Ohne Wasser?
Er ist so durstig.
Jetzt ist er unten am Wasser angelangt. Er betrachtet das schwarze Flusswasser. Und lässt langsam das Mehl in die Fluten rieseln. Beobachtet, wie sich unter Wasser eine wogende Wolke ausbreitet, die sich langsam auflöst und immer unsichtbarer mit dem Strom davontreibt. Eine letzte Hoffnung, die sich verflüchtigt.
Er muss Schnee sammeln. Aber worin? In seiner Mütze?
Der Schnee schmilzt rasch. Auf dem Boden verwandelt er sich bereits in braune Schmiere.
Deda muss zurück zu Faina. Schnee für sie sammeln. Sie retten. Die Mutter heraufbeschwören, die er nie gehabt hat.
Auf dem Weg zurück durch das Wäldchen hört er einen unbekannten Laut. Eigentlich dürfte es inzwischen nicht mehr so viele unbekannte Geräusche geben – in den vergangenen Wochen hat er nahezu alles gehört, was man hören kann. Aber dies hier hat er noch nie zuvor gehört.
Es ist unmöglich zu beschreiben.
Als Deda ein paar Zweige zur Seite schiebt, steht er plötzlich direkt vor einem Mann. Merkwürdigerweise ist es nicht der wie wahnsinnig stierende Blick, vor dem er zusammenfährt. Denn normalerweise hätte der ihn zu Tode erschreckt. Doch er ist nichts gegen das andere – das, was von seinem immer noch kauenden Mund herunterrinnt.
Dieses Blut, das dem Mann übers Kinn und den Hals hinunterläuft.
Der Mann weicht ihm aus und rennt an ihm vorbei, tiefer in den Pappelhain hinein. Da erblickt Deda den zweiten Leichenhaufen. Und die Bewegungen um ihn herum. Menschen, die darin herumwühlen. Menschen, besudelt vom Blut anderer. Menschen, die aufgehört haben, Menschen zu sein.
Deda wird von eiskalter Angst erfasst. Und von einer Befürchtung.
Er rennt los. Rennt, wie er noch nie zuvor gerannt ist. Es ist nicht weit bis zum anderen Ufer – der Weg war so kurz –, aber der Rückweg dauert unendlich lange. Jeder Atemzug schmerzt, und seine mageren Beine tragen ihn kaum mehr. Der Mangel an Nahrung und Flüssigkeit holt ihn ein, und die Welt um ihn herum wird träge und diffus. Nur seine Befürchtung, die ist real.
Der Himmel betrachtet ihn mit seinem grauen Auge.
Noch weit entfernt sieht er nun die Decke, die fürsorgliche Menschen Faina heute Morgen um die Schultern gelegt haben. Zwar sieht er ihr hübsches hellgrünes langes Kleid nicht, doch als er etwas näher kommt, meint er, ihre blau gefrorenen Füße unter der Decke hervorlugen zu sehen.
Ja, denkt er, und an dieses »Ja« wird er sich im Augenblick seines Todes erinnern.
Ja, Faina ist unversehrt.
Schließlich hat er den Waldrand fast erreicht. Er sieht die Füße. Es sind tatsächlich ihre Füße. Er verschließt die Augen vor dem Grau des Himmels. Dankt den höheren Mächten. Er wird sie nicht wieder verlassen.
Nie wieder.
Aber mit der Decke stimmt irgendetwas nicht. Hat Faina sich darin eingewickelt? Wahrscheinlich. Ihr war schließlich kalt. Aber er kann ihren Kopf nicht sehen. Ihre blonden Haare.
Jetzt ist er am Waldrand angekommen. Die Decke erscheint ihm immer seltsamer. Sie ist so platt. Und keine Spur von dem hellgrünen Kleid. Aber die Füße sind jedenfalls da. Die blau gefrorenen Füße ragen unter der Decke hervor.
Mit letzter Kraft stürzt er zu ihr und hebt die Decke an. Das kühle beobachtende Himmelsauge ist grauer als je zuvor.
Faina ist weg. Lediglich ihre Füße liegen da. Sie baden in Blut.
Er kann es nicht begreifen, fällt auf die Knie und starrt vor sich hin. Dann hebt er Fainas linken Fuß an. Er ist blau. In dem Moment wird es ihm klar. Es wird ihm mit einer Macht bewusst, die stärker ist als alles, was er je erlebt hat. Sie ist unerbittlich.
Sie haben ihr die Füße abgehackt, weil sie sie nicht essen wollten. Sie hätten ja giftig sein können.
Und sonst ist nichts mehr da.
Nichts.
Die Tüllgardine beweist Barmherzigkeit. Ihr Tanz hält inne. Der halb durchsichtige Schleier legt sich wieder über die Szene. Die Windbö flaut ab. Das, was bei geöffnetem Schleier geschah, liegt nun wieder gnädig im Dunkeln, ist jedoch nicht vergessen. Aber das Herz schlägt noch heftig. Es wird sich nie daran gewöhnen. Es wird sich nie wieder beruhigen.
Bis es stehen bleibt.
Die Hand, die die Tüllgardine jetzt erneut zur Seite schiebt, hat aufgehört zu zittern. Dort draußen ist das Meer noch immer spiegelglatt. Der Wind hält sich von der Küste der Toskana fern.
Der Schmerz, den die Erinnerung wachruft, ist dabei, sich zu verwandeln. Er formt sich, fokussiert sich zu einem Plan. Während der Blick weiterhin auf den halb durchsichtigen Schleier gerichtet ist, geht der unkontrollierbare Schmerz in einen kontrollierbaren Genuss über.
Fünf Tage akkurate Planung.
Bis es so weit ist.
Bekenntnis und Wahrheit
Den Haag, 9. Mai
Entgegen allen Prognosen hatte es in Den Haag angefangen zu regnen. Der Frühling war zwar bereits fortgeschritten, doch es wollte einfach nicht wärmer werden. Der Abend hingegen wich unweigerlich der Nacht. Vor dem Kneipenfenster prügelte der Regen auf den Asphalt. In den nachtschwarzen Pfützen spiegelte sich zitternd das Licht der Straßenlaternen.
Die von Narben gezeichneten Kämpen Paul Hjelm und Arto Söderstedt saßen im Café Rootz an der Kreuzung Raamstraat – Grote Marktstraat. Das gesamte Abendessen über hatten sie vorwiegend geschwiegen, und inzwischen waren sie beim Calvados angelangt.
»Der Selbstmörder«, sagte Hjelm nach einer Weile.
Söderstedt schüttelte langsam den Kopf.
»Es ist Sonntagabend«, entgegnete er und nippte am Calvados. »Da bringst du mich jetzt nicht hin.«
»Ich weiß«, antwortete Hjelm.
Und dann schwiegen sie wieder eine Weile.
»Nein«, sagte Söderstedt schließlich. »Du bringst mich da nicht hin, egal wie ausdauernd du auch schweigst.«
»Ich weiß«, entgegnete Hjelm.
Wieder verstrich Zeit.
»Egal wie ausdauernd du auch als Chef schweigst«, fügte Söderstedt hinzu.
»Deine Familie ist also wieder zu Hause in Schweden?«, fragte Hjelm.
»Linda ist gerade aus Australien zurückgekommen«, antwortete Söderstedt. »Sie muss inzwischen die älteste Tagträumerin der Welt sein. Ich wäre gerne übers Wochenende mit ihnen nach Hause gefahren. Aber da war ja ...«
Paul Hjelm schwieg erneut.
Arto Söderstedt richtete seinen hellblauesten Blick auf ihn und fragte: »Du erinnerst dich an meine zweitälteste Tochter?«
»Linda«, sagte Hjelm. »Ich weiß. Geht es ihr gut?«
»Ja, obwohl sie immer noch ohne Plan und Ziel durch die Weltgeschichte reist«, antwortete Söderstedt. »Unverschämt gut.«
»Genau wie der Vater«, entgegnete Hjelm. Dann schwieg er wieder.
Söderstedt nippte erneut am Calvados und ließ das goldene Elixier sich sacht in seiner Mundhöhle ausbreiten und dachte an absolut gar nichts. Dadurch erzeugte er ein Vakuum, das normalerweise die geheimen Gedanken seiner Gesprächspartner wirkungsvoll ansog.
»Ich reise ziemlich selten durch die Weltgeschichte«, sagte Söderstedt verdrießlich. »Als ich diesen Job hier antrat, hatte ich eigentlich angenommen, etwas öfter unterwegs zu sein.«
»Und jetzt besteht die Möglichkeit dazu«, entgegnete Hjelm knapp.
Sie schwiegen erneut.
»Er hat sich nicht das Leben genommen«, meinte Söderstedt schließlich.
Hjelm lächelte nicht einmal triumphierend, als er sagte: »Aber alles deutet darauf hin. Betagter Professor. Eine fast ein halbes Jahrhundert währende Ehe, die in die Brüche ging. Unglücklich nach der Scheidung. Die Sache ist nur deshalb auf unserem Tisch gelandet, weil das Tätigkeitsfeld des Professors hochsensibel ist und sein Tod daher automatisch diverse nationale und internationale Alarmsysteme aktiviert.«
»Und das zu Recht«, behauptete Söderstedt. »Dort ist es zu sauber, und das weißt du auch, Paul. Kein Staubkorn. Da ist gezielt gereinigt worden. Es handelt sich um einen vorgetäuschten Selbstmord, falls es so etwas überhaupt gibt. Er hat sich nicht das Leben genommen. Es ist ein klassischer fingierter Selbstmord. Falls er nun überhaupt tot ist.«
»Die erhängte Leiche war ja wohl ein deutliches Zeichen ...«, entgegnete Hjelm.
»Okay, möglicherweise«, pflichtete Söderstedt ihm bei, »aber kein Zeichen für einen Selbstmord. Ich garantiere dir, dass er vorgetäuscht ist.«
»Aber es gibt nichts, was darauf hindeutet«, beharrte Hjelm. »Das ist doch der typische Niedergang eines erfolgreichen Mannes. Scheidung, Alkohol, Workaholic-Symptome, Einsamkeit, all das, wovon so viele von uns bedroht sind.«
»Von uns?«, fragte Söderstedt.
»Von uns weißen heterosexuellen Männern mittleren Alters«, erklärte Hjelm.
»Seit wann sind diese stereotypen Allgemeinplätze eigentlich wieder salonfähig?«, brummte Söderstedt. »Warum lässt du mich nicht einfach meinen Calvados genießen?«
»Weil wir so alt nun auch wieder nicht sind«, antwortete Paul Hjelm und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Nun komm schon, Arto. Im Grunde stoßen wir doch in diesem verdammten Job jeden Tag auf etwas Neues und Überraschendes. Und auch wenn es sich selten um positive Überraschungen handelt, sind Überraschungen etwas Gutes. Man lernt aus Überraschungen. Man lernt unentwegt.«
»Du bist doch ein unverbesserlicher Optimist, Paul. Höchstwahrscheinlich, weil du ein Spätzünder bist, immerhin hattest du deine Teenagerzeit ja erst in der A-Gruppe. Mehr als dreißig Jahre haben deine Fähigkeiten brachgelegen, und dann bist du plötzlich aufgeblüht. Alle Möglichkeiten dieser Welt haben sich dir eröffnet. Während ich an der Universität Uppsala akademische Abhandlungen über theoretischen Marxismus verfasst habe, warst du ein desillusionierter, träger Kriminalpolizist in Alby. Und dann hast du mich möglicherweise überholt. Aber wohlgemerkt nur möglicherweise.«
»Worüber?«
»Wie bitte?«
»Du hast Abhandlungen über theoretischen Marxismus geschrieben?«
»Ja, den üblichen Aufsatz ›Marxismus im Alltag‹«, gab Söderstedt zu und stellte enttäuscht fest, dass sein Calvadosglas leer war. «Wir müssen noch einen bestellen«, meinte er und winkte der Bedienung.
»Denk daran, dass morgen Montag ist«, sagte Hjelm.
»Soll ich das so verstehen, dass du keinen mehr möchtest?«
»Nein.«
»Gut.«
Es wurden zwei volle Gläser gebracht. Nach einer Weile genussvollen Schweigens sagte Arto Söderstedt etwas nachdenklicher: »Ich hatte die eine Seite gesehen. Eine Welt, in der Kapitalismus und Kriminalität ganz einfach ein und dasselbe sind. In der es nur darum geht, sich an Macht zu berauschen, an dem Gefühl, stärker zu sein als andere, andere dominieren zu können. In der Mangel an Empathie nicht nur Voraussetzung für den Erfolg ist, sondern absolut bewundert wird. Wer am wenigsten Mitgefühl zeigt, gewinnt. Ich habe für diesen Typus Mensch gearbeitet und war das Sprachrohr solcher Leute: der junge Staranwalt, dem es immer gelang, ihr Handeln logisch und in der jeweiligen Situation notwendig erscheinen zu lassen.«
»Ich erinnere mich«, nickte Paul Hjelm. »In Finnland. Das ist eine ganze Weile her ...«
»Ja, aber es ist unauslöschlich in mein Gedächtnis gebrannt. Irgendwann begann das alles – diese Welt um mich herum und nicht zuletzt ich selbst –, nach Verwesung zu stinken. Und dennoch ist es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Seither habe ich nämlich eine ziemlich ausgeprägte Sensibilität für Menschen mit ebendiesem Mangel an Mitgefühl entwickelt. Denn Empathiemangel kommt ja nicht nur in der Wirtschaft vor – auch wenn er dort am wirkungsvollsten ist –, sondern genauso im Krankenhaus, in Schulen, sozialen Einrichtungen und in der Entwicklungshilfe, in der Kirche und natürlich bei der Polizei. Überall dort, wo die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, eine Funktion erfüllt.«
»Auch unter Marxisten?«, fragte Paul Hjelm lächelnd.
»Nicht zuletzt dort«, antwortete Arto Söderstedt. »Als diese Welt der Reichen und Mächtigen für mich anfing, nach Verwesung zu stinken, wollte ich mein Leben neu ausrichten. Ich hielt es plötzlich für dringend notwendig, dass man diesen Menschen Einhalt gebot und das politische System nicht weiter diese Empathietoten belohnte und das öffentliche Leben steuern ließ. Daher landete ich am linken politischen Rand und schrieb sogar einige radikale politische Artikel für linksgerichtete Zeitschriften.«
»Und dann wurdest du Polizist«, merkte Hjelm an.
»Ja, ja, das war vielleicht nicht der einfallsreichste Schachzug in meinem Leben. Aber nach all den Erlebnissen war mein innerer Detektor hochsensibel, und mir fiel auf, dass unter den Linken eine selektive Blindheit existierte, die manche ohne Vorwarnung befiel. Sie äußerte sich in diffusem Antihumanismus und einer überbordenden Wut. Man wollte sich prügeln, Steine werfen, morden, Völkermord begehen. Mir wurde klar, dass die simple Losung ›links gut, rechts schlecht‹ falsch war. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass es in allen Gruppierungen sowohl wahre Humanisten wie auch Empathiegestörte gibt. Man muss lernen, das Individuum zu sehen, und man muss seinen inneren Detektor aktivieren.«
Paul Hjelm nickte kurz und betrachtete Arto Söderstedt, der nun ziemlich erschöpft wirkte. Es war offenbar lange her, seit er zuletzt eine derart feurige Verteidigungsrede gehalten hatte.
»Alle Achtung«, sagte Hjelm schließlich. »Aber das Ganze hat keinen Deut mit Professor Udo Massicotte zu tun.«
»Alles hat damit zu tun«, entgegnete Söderstedt. »Wirklich alles.«
»Inwiefern?«
»Es genügt zu registrieren, wie es bei ihm zu Hause aussah.«
»Ich kann die Zeichen, die du siehst, offenbar nicht erkennen«, wandte Paul Hjelm ein.
»Aber du siehst andere?«
»Ich stelle lediglich fest, dass ein Wissenschaftler, zumal ein Arzt vom Kaliber Massicottes, hätte wissen müssen, dass Erhängen mit einem kurzen Strick zu den qualvollsten Todesarten gehört, die wir kennen. Bei einem Fall aus großer Höhe bricht man sich sofort das Genick oder wird zumindest bewusstlos, bevor man erstickt. Bei geringer Höhe hängt man bei vollem Bewusstsein, bis man erstickt. Ganz langsam.«
»Obwohl Selbstmord ja eine Selbstbestrafung ist«, warf Arto Söderstedt ein. »Also, wenn man es ernst meint. Wenn es kein Hilferuf ist. Und es sich um echte Selbstverachtung handelt, nach dem Motto: ›Dein Tod wird jetzt ebenso qualvoll sein, wie es dein Leben gewesen ist, du Feigling‹.«
»Gab es denn wirklich Zeichen für eine derartige Selbstverachtung?«
»Es fanden sich jedenfalls keine Zeichen, die auf das Gegenteil hingedeutet hätten.«
»Und wie funktioniert es, wenn wir auf diese Art und Weise die Rollen tauschen?«
»Wir können uns in die Position des anderen hineinversetzen.«
Sie betrachteten einander eine Weile lang, als hätten sie tatsächlich die Rollen getauscht. Es war ein eigentümlicher Augenblick.
»Ich habe allerdings nicht die Rolle getauscht«, erklärte Arto Söderstedt schließlich und leerte sein Glas. »Mein Misstrauen bezüglich der Selbstmordtheorie hat nichts mit dem Charakter des verehrten Professors zu tun, sondern mit seinem Haus und seinem Arbeitsplatz.«
»Und wenn ich der Selbstmordtheorie misstraue, dann aufgrund des kurzen Stricks«, meinte Paul Hjelm, fügte sich in sein Schicksal und leerte ebenfalls das kleine Calvadosglas. Allerdings sein eigenes.
»Tust du das denn?«
»Professor Udo Massicotte war für ein geheimes EU-Projekt tätig, bei dem es um die Wiedererkennung von Terroristen nach einer chiroplastischen Operation geht. Ein hoch qualifizierter Arzt mit Zugang zu einem Regenbogenspektrum an tödlichen Drogen. Da muss es schon gute Gründe geben, dass so ein Mann sich mit einem kurzen Strick erhängt.«
»Die Sache wird also zu einem Opcop-Fall?«
»Ich denke schon«, antwortete Hjelm. »Aber uns wird nicht viel Zeit bleiben, um Beweise zu finden. Hilf mir einen Schritt weiter. Sein Haus, sein Arbeitsplatz?«
Arto Söderstedt seufzte tief und winkte die Bedienung heran. Dann antwortete er: »An beiden Orten herrscht eine ganz gewöhnliche Kombination aus Ordnung und Unordnung. Als wäre Massicotte einfach von seinem Stuhl aufgestanden, hätte seinen Rücken durchgestreckt, einen Schluck Kaffee getrunken und sich dann aus geringer Höhe erhängt. Die Alltäglichkeit der Szene erscheint mir nicht logisch. Er hat etwas Extremes vor. Auch wenn er keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, hätte er den Ort doch wenigstens auf außergewöhnliche Art verlassen müssen. Ihn entweder in Unordnung bringen oder aufräumen müssen. Zeichen der Verbitterung zeigen müssen. Aber die Räume sind von einer Normalität, die kein Zufall sein kann. Es ist eine Normalität, die geradezu nach Täuschung riecht.«
Paul Hjelm unterschrieb die Rechnung und holte etwas Trinkgeld aus seiner Jackentasche. Dann sagte er: »Tja, das klingt nach einem schlagenden Beweis.«
Arto Söderstedt kramte ebenfalls ein wenig Trinkgeld hervor, das er klimpernd auf die Tischplatte fallen ließ, während er aufstand. »Obwohl es darum im Grunde eigentlich überhaupt nicht geht«, erklärte er und ging in Richtung Tür.
Hjelm winkte der Bedienung kurz zu und folgte ihm.
»Nicht?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Söderstedt und öffnete seinem Chef galant die Tür.
»Ich habe eigentlich keine Lust, mich heute Abend mit dir zu streiten«, sagte Paul Hjelm und trat hinaus in den Regen. »Um was geht es dann?«
»Um den Raum im Keller«, antwortete Arto Söderstedt.
Erster Bericht
Bezeichnung:Bericht CJH-28347-B452
Auftragsnummer:A-100318
Ziel:Aktualisierung, Einholen von Einschätzungen
Datum im laufendem Jahr:21. März
Level:The Utmost Degree of Secrecy
Entsprechend dem oben genannten Auftrag werden vom heutigen Datum an kontinuierlich Berichte über das zu observierende Objekt, im Folgenden als »W« bezeichnet, herausgegeben.
Über die Zeit vor der Auslieferung ist keine Berichterstattung angefordert worden. Der erste Bericht befasst sich aus diesem Grund mit der Zeit, unmittelbar nachdem W die Anlage verlassen hat. Dies geschah in einem Alter, das in unserem Quellenmaterial als »vorbewusst« bezeichnet wird.
W wurde von der vielsprachigen Diplomatenfamilie Berner-Marenzi adoptiert, die sich, entsprechend den Intentionen des Auftraggebers, in ständiger Bewegung rund um den Erdball befand. Demzufolge entwickelte der junge W nie eine eindeutige Muttersprache, sondern wurde bereits in den ersten Stadien des Spracherwerbs in gleichem Umfang mit dem großväterlichen Spanisch und dem großmütterlichen Deutsch seiner Mutter Maria sowie dem großväterlichen Italienisch und dem großmütterlichen Russisch seines Vaters Luigi konfrontiert. Die Tatsache, dass die Familie im Austausch mit ihrer Umwelt Englisch sprach, bedeutet für W, dass er keine Muttersprache, aber bis zu fünf Sprachen beherrscht.
Es hat einige Zeit in Anspruch genommen, Quellenmaterial über Ws erste Jahre ausfindig zu machen. Es besteht aus den fünf Tagebüchern von Maria Berner-Marenzi aus den Jahren 1977 bis 1994, die abwechselnd in Spanisch und Deutsch verfasst sind.
W ist vier Jahre alt, als er er zum ersten Mal im Tagebuch seiner Adoptivmutter erwähnt wird. Er ist das jüngste von drei Kindern, die alle adoptiert wurden, da Maria Berner-Marenzi unter einem Gendefekt litt, der Unfruchtbarkeit zur Folge hatte und vermutlich auch in späteren Jahren zu ihrem Tod geführt hätte.
Die Familie verlässt Manila auf den Philippinen, wo Luigi Berner-Marenzi italienischer Generalkonsul gewesen ist, und verbringt ein Jahr in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Anschließend wird Maria spanische Botschafterin in Bukarest, Rumänien, dem Land mit dem damals wohl korruptesten sozialistischen Regime der Welt. Bald darauf wird W dort eingeschult. Noch bevor er schreiben lernt, wird Rumänisch die sechste Sprache, die er spricht.
Das erste schriftliche Dokument von ihm ist allerdings auf Englisch, da er eine internationale Schule für Diplomatenkinder im Lipscani-Viertel in Bukarest besucht. Maria hat seinen Aufsatz in ihr Tagebuch übertragen. Er erzählt von einem Badeausflug mit den Eltern und seinen Schwestern Una und Vera.
»Im Sommer waren wir am Gardasee und haben gebadet. Es war kalt. Una ist zuerst reingegangen. Es war steinig. Sie fiel ins Wasser. Papa musste reinspringen und sie wieder herausziehen. Ich habe eine andere Stelle zum Baden gefunden. Im Wasser war es schön.«
Der kurze Aufsatz wurde ohne weitere Kommentare mit Gut benotet. Ein Auszug aus der Beurteilung des ersten Schulhalbjahres durch die Englischlehrerin ist es wert, wörtlich zitiert zu werden: »W trotzt regelmäßig seinen ›Hummeln im Hintern‹, wodurch es ihm ohne Probleme gelingt, seine Hausaufgaben zu erledigen. Dass die Gruppenarbeit weniger gut funktioniert, hat mit Ws offensichtlichen Führungseigenschaften zu tun.«
Die nächste bedeutendere Erwähnung handelt von einem Segelwettbewerb im Schwarzen Meer. W ist inzwischen neun Jahre alt und hat gelernt, eine gut fünfzig Kilo leichte Einmannjolle zu beherrschen. Er konkurriert bei der rumänischen Juniorenmeisterschaft in der Hafenstadt Mangalia mit deutlich älteren Gegnern. Die Ceaus¸escu-treue Lokalpresse berichtet, dass er den zweiten Platz erzielte. Drei Tage später wird das Ergebnis revidiert. Eine Meldung informiert nüchtern darüber, dass der Sieger aufgrund antikommunistischer Propaganda disqualifiziert worden sei. Als Sieger stehe nun W fest.
Der ursprüngliche Gewinner hieß Costin Florescu und war zu diesem Zeitpunkt vierzehn Jahre alt. In einem Gespräch mit unserem lokalen Repräsentanten erklärt Florescu, dass am Tag nach dem Wettbewerb ein fremder junger Mann in der Schule seiner Heimatstadt Constant¸a mit einem hellblauen Zettel in der Hand gesehen worden sei. Als er selbst einen Tag später aus Mangalia zurückkehrte, spielte sich Folgendes ab: »Als ich in die Schule kam, standen sie dort, eine ganze Delegation mit dem Rektor an der Spitze. Sie zeigten ohne ein Wort auf meinen Spind. Mit zitternden Händen holte ich die Schlüssel hervor und schloss ihn auf. Darin lag ein Zettel mit der Aufforderung, das kommunistische System zu stürzen. Ein hellblauer Zettel.«
Als die Familie kurz nach diesem Vorfall nach Paris umzieht, da Luigi Berner-Marenzi zum italienischen Kulturattaché in Frankreich ernannt wird, bedeutet dies für den jungen W und seine Schwestern, eine weitere Sprache erlernen zu müssen. Dies scheint dem Elfjährigen jedoch nicht schwerzufallen, wie ein anderer, französischer, Schulaufsatz belegt, den er an der International School of Paris im 16. Arrondissement geschrieben hat. Bereits mit vierzehn Jahren konnte W daher an die École Massillon wechseln, eine der katholischen Eliteschulen der Stadt.
Seine positive Entwicklung belegt außerdem ein Tagebucheintrag der Mutter: »W machte einen ziemlich fröhlichen Eindruck, als er heute nach Hause kam. Mein Kleiner ist wirklich groß geworden. Und er hatte diesen spitzbübischen Blick, der keiner Mutter entgeht. Während des außergewöhnlich guten Abendessens von Anaïs, bei dem mein Kleiner seine Foie gras wirklich zu genießen schien, blühte er dann regelrecht auf und erzählte: ›Ich kann jetzt richtig gut Französisch, Mutter.‹ Mir wurde ganz warm ums Herz. Ich frage mich, wie viel Wissen in diesem kleinen Körper stecken muss. Seine beiden Schwestern tun sich viel schwerer, eine siebte Sprache zu erlernen. Luigi sagt, das liege daran, dass W der Jüngste ist. Aber ich weiß, dass dies nicht die einzige Erklärung ist.«
An dieser Stelle muss berichtet werden, dass es in der Diplomatenwohnung im 16. Arrondissement eine Haushälterin namens Anaïs gab und dass sie die Hauptrolle in einer Episode spielt, mit der wir diesen einleitenden Bericht abschließen. Zwei Zeugenaussagen vermitteln in diesem Fall zwei unterschiedliche psychologische Profile von W. Die erste Darstellung entstammt wiederum dem Tagebuch der Mutter – die Familie lebt nun seit gut einem Jahr in Paris, und W steht kurz vor seinem dreizehnten Geburtstag:
»Heute waren wir gezwungen, Anaïs zu entlassen. Das war ein harter Schlag für uns. Dieses, wie wir bislang angenommen hatten, wunderbare Geschöpf aus der Provence hat über ein Jahr lang unsere Abendessen in Festessen verwandelt, von den Mahlzeiten am Wochenende ganz zu schweigen. Doch diese Woche hat sie meinen Kleinen derart verleumdet, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich war gezwungen, rasch zu reagieren, da die falschen Klagelieder von Anaïs ansonsten möglicherweise bis an Luigis Ohren gedrungen wären. Sie musste auf der Stelle gehen, allerdings nicht ohne eine großzügig bemessene Abfindung.«
Der Pariser Polizei liegt im Gegenzug eine Zeugenaussage von Anaïs Criton vor, aus der hier ein Passus zitiert werden soll:
»Ich habe in der Tat ein Röhrchen mit der Aufschrift ›Protobiamid‹ in seinem Zimmer gefunden. Nein, leider ist es nicht mehr dort, obwohl ich es zurückgelegt habe. Seine Mutter durfte nicht erfahren, dass ich in den Schubladen des jungen W gewühlt habe. Doch beim zweiten Mal war es noch viel schlimmer. Ich weiß, dass er erst zwölf Jahre alt ist, Herr Kommissar, aber es handelt sich bei ihm nicht um einen gewöhnlichen Zwölfjährigen. Sie hätten nur seinen Blick sehen müssen. Ja, ja, ich weiß, dass der Blick eines Zwölfjährigen keinerlei Beweis darstellt, aber warum sollte er sonst dieses Protobiamid zu Hause haben? Das ist ein Stoff, der in Verbindung mit Eiweißstoffen stark reagiert, so viel habe ich begriffen, nachdem ich mit einem Freund gesprochen habe, der Chemiker ist, aber mehr weiß ich nicht. Außer, wie entsetzlich es juckte. Ich habe mich völlig zerkratzt. Ja, dort unten. Es ist mir unangenehm, das zu sagen, aber mein Unterleib war danach ganz blutig. Ja, ich weiß natürlich, dass Sperma hauptsächlich Eiweißstoffe enthält, aber dürfte ich Ihnen meine Theorie unterbreiten? Und es ist weitaus mehr als nur eine Theorie, Herr Kommissar, das garantiere ich Ihnen. Natürlich, ich weiß, dass dies kein formeller Beweis ist, aber ich weiß auch, dass das Protobiamid irgendwie in meinen Slip gelangt ist und es furchtbar wehtat, Herr Kommissar, wirklich grauenhaft. Meine Theorie? Ja, aber Herr Kommissar, es ist doch wohl offensichtlich, dass W mich bestraft hat, weil ich mich mit Männern getroffen habe. Er hat eine Schicht Protobiamid auf meinen Slip aufgetragen, und als ich Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte, kam die Reaktion. Muss ich noch mehr sagen?«
Weiter sind wir in unseren Nachforschungen über W aktuell noch nicht gekommen. Da uns noch kein Hinweis auf seinen momentanen Aufenthaltsort vorliegt, sind wir gezwungen, W hier an der Schwelle zur Pubertät zurückzulassen. Nun warten wir die Reaktion des Auftraggebers ab. Sollen wir unsere Recherchearbeit fortsetzen? Wir gehen davon aus, dass noch eine Menge Material über die Zeit bis zu seinem Verschwinden gefunden werden kann. Unsere Empfehlung lautet, die Nachforschungen weiterzubetreiben, bis sich eindeutige Spuren auftun. Dies dürfte nicht mehr allzu lange dauern.
Besprechung
Den Haag, 10. Mai
Jutta Beyer fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nach dem starken Regen vom Vorabend herrschte strahlender Sonnenschein. Für derart launenhaftes Aprilwetter war es zwar bereits ein wenig zu spät im Jahr, andererseits galt dies auch für die Erde an sich. Dieses Gefühl hatte Jutta Beyer schon seit Längerem. Und es hatte sich während des vergangenen Jahres einerseits verstärkt, war andererseits aber auch ein wenig in den Hintergrund getreten.
Verstärkt hatte es sich, weil sie in den letzten Monaten einen tieferen Einblick in die europäische Kriminalität gewonnen hatte. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit liebte sie ihre Arbeit. Daher empfand sie eine gewisse Zuversicht.
Doch als sie mit ihrem zuverlässigen Kalkhoff aus Cloppenburg auf das Europolgelände einbog, geschah genau das, was so oft um diese morgendliche Uhrzeit passierte. Sie traf auf einen Kollegen, der gerade sein Fahrrad abschloss.
»Nein, Marek«, sagte sie, noch bevor sie von ihrem Fahrrad abgestiegen war.
»Ich hab ja gar nicht gefragt«, entgegnete Marek Kowalewski lächelnd. »Aber guten Morgen, Jutta.«
»Es gibt immer Ärger, wenn wir die Räder mit deiner Kette zusammenschließen«, erklärte Jutta Beyer und schloß ihr Fahrrad separat ab. In dem Moment fuhr ein antiker Minibus der Marke Toyota Picnic brummend an dem Fahrradparkplatz vorbei. Marek und Jutta winkten dem Fahrer mit dem bleichen Gesicht zu, der zurückwinkte und in einer Rußwolke um die Hausecke verschwand.
»Arto sah blasser aus als sonst«, stellte Kowalewski fest, während sie auf die Eingangstüren des alten Europolgebäudes zuschlenderten. »Es wird Zeit, dass die Sonne endlich wieder ein paar Tage scheint.«
»Auch dann sitzen wir noch in diesem alten Kasten, weil sie das neue Gebäude ja nicht rechtzeitig fertigbekommen haben«, sagte Beyer. »Wir platzen hier langsam aus allen Nähten.«
»So ist es halt bei der EU«, entgegnete Kowalewski. »Massenweise gute Vorsätze, aber extrem langsame Umsetzung. Während es bei den Polen richtig gut läuft.«
»Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte«, bemerkte Beyer.
Schweigend passierten sie das Sicherheitspersonal und gingen die Treppen hinauf.
»Schönes Wochenende gehabt?«, fragte Kowalewski schließlich.
»Eigentlich wie immer«, antwortete Beyer. »Ich bin nach Antwerpen geradelt.«
»Nach Belgien? Aber bis dahin sind es doch bestimmt hundertfünfzig Kilometer.«
»Hundertdreißig«, korrigierte ihn Beyer. »Ein robustes Kalkhoff ist ziemlich schnell, im Gegensatz zu einer polnischen Klapperkiste.«
»Genau betrachtet, ist meine Klapperkiste, glaube ich, holländisch. Ich war übrigens übers Wochenende zu Hause in Warschau. Meine Mutter ist krank.«
»Oh. Ernsthaft?«
»Ja, ihre Hypochondrie war diesmal richtig schlimm. Drei Krebsarten gleichzeitig. Ich habe den Arztbericht zerrissen im Müll gefunden. Daraufhin habe ich ihn wieder zusammengeklebt und konnte mich mit den Worten ›Gesundheitszustand wie eine gut trainierte Fünfunddreißigjährige‹ zufriedengeben.«
Jutta Beyer spürte, wie es ihr wieder einmal misslang, Distanz zu Marek Kowalewski zu halten. Sie lachte laut auf, während sie ihren Code an der Tür zur offenen Bürolandschaft der Opcop-Gruppe eingaben. Dort drinnen standen Miriam Hershey und Laima Balodis gerade von ihren auf mysteriöse Weise zusammengewachsenen Schreibtischen auf.
»Besprechung«, sagte Balodis und wies vage mit der Hand in eine Richtung.
»Kathedrale?«, fragte Beyer.
»Nein«, antwortete Hershey. »Whiteboard.«
Kowalewski betrachtete die einsilbigen Damen und ertappte sich dabei, über Gewohnheiten zu sinnieren. Wie schnell sich doch Spitznamen und gewisse Ausdrücke einschliffen. Die »Kathedrale« war ein großer Saal für Zusammenkünfte mit einer Kassettendecke und Bildschirmen von allen siebenundzwanzig Mitgliedsstaaten der EU. Das »Whiteboard« hingegen war eine eher informelle Besprechungsecke am Rand der Bürolandschaft mit einem Touchscreen, der das althergebrachte Whiteboard ersetzte.
Am Schreibtisch daneben saß Paul Hjelm, der Chef der Opcop-Gruppe, tief versunken in einen Stapel Unterlagen. Neben ihm war der stellvertretende Chef, der zierlich gebaute Grieche Angelos Sifakis, damit beschäftigt, den Computer hochzufahren. Der Bildschirm des Whiteboards flimmerte merkwürdig, während Sifakis mindestens ebenso merkwürdig das Gesicht verzog und dann in Richtung Festplatte hinter dem Schreibtisch abtauchte.
Zwei Personen hatten bereits ihre Plätze eingenommen, als sich Kowalewski, Beyer, Hershey und Balodis auf ihre Stühle setzten. Es waren die Französin Corine Bouhaddi und der Spanier Felipe Navarro. Arto Söderstedt kam als Letzter in die Ecke der Bürolandschaft geschlendert, nachdem er sich gerade aus der Umarmung einer groß gewachsenen blonden Frau gelöst hatte. Marek Kowalewski betrachtete sie respektvoll. Sie war eine der nationalen Repräsentanten, die immer ein wenig am Rand der Kerngruppe standen. Er versuchte sich an ihren Namen zu erinnern. Sie war doch Schwedin, oder? Mit einem sehr ausgefallenen Namen. Schließlich kam er drauf: Svenhagen.
Sara Svenhagen.
Eine der knapp ein Dutzend nationalen Repräsentanten war also anwesend.
Angelos Sifakis tauchte hinter dem Schreibtisch wieder auf, betrachtete den Bildschirm, der inzwischen nicht mehr flimmerte, und sagte in seiner zurückhaltenden Art: »Also dann, Meeting der Kerngruppe.«
Paul Hjelm blickte von seinen Unterlagen auf und nickte Sifakis zu, der ein Foto von einem älteren Mann mit traurigen Augen anklickte, das auf dem elektronischen Whiteboard im Großformat erschien.
Hjelm räusperte sich und sagte: »Das hier ist Professor Udo Massicotte, Arzt für plastische Chirurgie von Weltklasse. Mit ihm werden wir uns in dieser Woche befassen, denn er hat sich am vergangenen Samstag erhängt. Er war sechsundsechzig Jahre alt und in einem mit Alarmanlagen gesicherten Bereich tätig, er hat nämlich für ein geheimes EU-Projekt gearbeitet, das sich mit der Identifikation von Terroristen nach chiroplastischen Operationen befasst. Man gewährt uns für diesen Fall für ein paar Tage Einblick in das Projekt, wenn wir innerhalb dieses Zeitfensters nichts finden, wird es geschlossen. Aus diesem Grund befassen wir uns in erster Linie intensiv mit seiner Person anstatt mit unmittelbaren Verdachtsmomenten. Finden wir binnen ein paar Tagen nichts, lassen wir die Sache fallen. Man hat uns die Abstimmung mit der NATO zugesichert, aber wenn die Amerikaner erst einmal involviert sind, wollen sie wahrscheinlich ihre eigenen Ermittlungen durchziehen.«
»Also bestehen eventuell Verbindungen zum Terrorismus?«, fragte Miriam Hershey, die eine Vergangenheit beim MI5 in England hatte.
»Möglicherweise«, bestätigte Hjelm.
»Und womit hat er sich genau befasst?«, fragte Kowalewski.
»Das Ganze ist zwar auf unserem Tisch gelandet, weil es sich um ein EU-Projekt handelt, aber wir haben noch zu wenig Informationen. Das Projekt wird in Straßburg durchgeführt, ursprünglich waren fünf Forscher und Sicherheitsexperten mit unterschiedlicher Fachrichtung involviert. Wir haben gerade grünes Licht dafür erhalten, dass zwei von euch hinfahren und mit den vier verbleibenden Personen sprechen. Das Projekt wurde von Udo Massicotte geleitet, die restlichen Namen stehen hier.«
Sifakis tippte etwas in seinen Computer, bis vier Namen offensichtlich unterschiedlicher Nationalitäten erschienen.
»Ist denn das Problem mit chiroplastisch operierten Terroristen gravierend?«, fragte Jutta Beyer.
»Ich habe etwas darüber gelesen«, merkte Laima Balodis an. »Die Sicherheitsdienste haben generell Schwierigkeiten damit, vor allem arabische Terroristen zu identifizieren, und offenbar nutzen das immer mehr von ihnen aus und lassen sich chiroplastisch operieren.«
»Weitere Infos zur Ausrichtung des Projekts erhaltet ihr dann von Hershey und Balodis aus Straßburg«, sagte Hjelm.
»Der Flug geht in genau einer Stunde von Schiphol«, erklärte Sifakis. »Das Taxi wartet draußen, Tickets, Hotelreservierung und weitere Informationen werden an eure Handys geschickt. Off you go.«
Hershey und Balodis schauten einander an und seufzten.
»Billigflug, vermute ich mal?«, fragte Hershey.
»Kauft euch Slips am Flughafen«, riet Kowalewski.
»Ab mit euch«, rief Hjelm.
Woraufhin sich Hershey und Balodis in Bewegung setzten, durch die Bürolandschaft joggten und zur Tür hinaus verschwanden.
»Das war aber nicht gerade die feine Art«, merkte Arto Söderstedt an. »Ihr hättet es ihnen ja auch schon heute Morgen mitteilen können.«
»Es hat sich erst, drei Minuten bevor ihr kamt, entschieden«, entgegnete Hjelm.
»Aber ging es nicht um einen Selbstmord?«, fragte Jutta Beyer.
»Wir glauben nicht daran«, antwortete Hjelm. »Es gibt gewisse Anzeichen.«
»Anzeichen?«
»Arto?«, meinte Paul Hjelm leicht gehässig.
Arto Söderstedt bedachte ihn mit einem eindringlichen Blick und sagte dann: »Es ist besser, wenn ihr euch das Ganze vorbehaltlos anschaut.«
»Das vorhandene Material findet ihr auf euren Computern«, erklärte Sifakis. »Schaut es durch und lasst uns wissen, was ihr dazu denkt.«
Paul Hjelm betrachtete seine Truppe, während die Mitglieder sich zu mehr oder weniger festen Paaren formierten. Dies waren also die Übriggebliebenen der ursprünglichen Opcop-Gruppe, die sich im vergangenen Jahr bereits in der Testphase auf so tragische Weise dezimiert und noch immer keine Nachfolger erhalten hatte. Vielleicht war das Sondierungsverfahren schon im Gange, vielleicht auch nicht. Er wurde allerdings den Verdacht nicht los, dass irgendein wie auch immer gearteter Machthaber ihn bestrafte. Vielleicht hieß dieser Machthaber auch schlicht und einfach Gewissen.
Schlechtes Gewissen.
Sowohl Hershey und Balodis als auch Beyer und Söderstedt hatten sich zusammengefunden. Navarro und Kowalewski waren genau wie Sifakis Computerbullen und hatten keine Probleme damit, allein zu arbeiten beziehungsweise spontane Allianzen miteinander zu bilden. Diejenige, die allerdings leicht ins Abseits geriet, war Bouhaddi. Sie benötigte einen Partner. Wenn schon nicht für die anderen, so musste er wenigstens ihr zuliebe so bald wie möglich einen Ersatz für die schmerzlich Vermissten Fabio Tebaldi und Lavinia Potorac finden.
Er kehrte in sein Chefzimmer zurück und schaltete das Radio ein, um vor seinem Anruf bei der NATO ein wenig musikalische Erbauung zu finden. Beethovens einfache, aber majestätische Klänge der Europahymne Ode an die Freude waren fast verklungen, als er endlich das Radio ausschaltete und nach dem Telefonhörer griff.
Draußen in der Bürolandschaft blätterte Jutta Beyer mit versierten Mausbewegungen die Dateien auf ihrem Computer durch und sagte: »Tja, hier findet sich ja nicht gerade viel ...«
»Die Fotos«, entgegnete Arto Söderstedt, »die Protokolle. Sag mir, was du siehst.«
Dann verfiel er in eine Art vermeintlichen Halbschlaf, den Beyer nur allzu gut von ihm kannte. Er wartete auf ihre Reaktion.
Sie arbeitete sich durch die Fotos, sowohl von Massicottes Villa außerhalb von Charleroi in Wallonien als auch von seinem Arbeitszimmer in den provisorischen Büroräumen in einem Gebäude des Europäischen Gerichtshofs in Straßburg. Er hatte sich in seiner Villa erhängt, genauer gesagt in einem Ankleidezimmer hinter dem Schlafzimmer. Beyer scannte mit ihrem Blick die Bilder ab und suchte fieberhaft nach irgendwelchen Hinweisen. Während sie sich schließlich dem schriftlichen Ermittlungsmaterial der belgischen Polizei widmete, ging Söderstedts Halbschlaf in einen Winterschlaf über. Man sah deutlich, wie seine Körpertemperatur um mindestens zehn Grad sank.
Corine Bouhaddi musterte ihn von der Seite und schüttelte den Kopf. Dann fragte sie: »Ist sein Alkoholismus eigentlich näher dokumentiert?«
»Wie bitte?«, rief Marek Kowalewski neben ihr aus.
»Ich sehe zwar, dass in den Dokumenten der belgischen Polizei etwas darüber steht, aber ich finde keine Quellenangabe. Außer einem Klatschweib, das seine Nachbarin war.«
»Gut«, meinte Kowalewski. »Ich notiere es mir. Aber die Scheidung ist hinreichend dokumentiert. Und wurde vor einem halben Jahr vollzogen.«
»Verzeihung«, sagte eine Stimme vom Schreibtisch nebenan. »Im Obduktionsprotokoll ist von einer Schrumpfleber die Rede.«
Bouhaddi und Kowalewski drehten sich um und blickten in Navarros unbewegtes Gesicht. Bis dieser verdeutlichte: »Leberzirrhose. Apropos Alkoholismus.«
»Danke«, sagte Bouhaddi. »Gut, dann ist das also bestätigt.«
»Vor zwei Jahren stand ein Artikel über das aufstrebende Ehepaar Massicotte in der Nouvelle Gazette«, informierte Kowalewski, mit dem Gesicht unmittelbar am Bildschirm klebend.
»Bist du etwa kurzsichtig?«, fragte Bouhaddi.
»Ich warte darauf, dass die Altersweitsichtigkeit es wieder ausgleicht«, entgegnete Kowalewski. »So wie die Zeit auch meine Lungen innerhalb eines halben Jahres nach Queens wieder geheilt hat. In der Zeitung steht unter anderem: ›Wir wissen beide, dass wir zusammen alt werden und sterben wollen.‹ Ein gutes Jahr danach, er ist siebenundsechzig, sie vierundsechzig, kommt die Scheidung. Sie hat ihn verlassen. Er hat gesoffen, bis er sich schließlich erhängt hat. Schwierig, da etwas anderes zu sehen.«
»Das Saufen war vielleicht eher die Ursache als der Grund«, meinte Bouhaddi.
»Nicht ganz von der Hand zu weisen«, bestätigte Kowalewski. »Vielleicht war es sowohl die Ursache als auch der Grund und die Situation deshalb nicht länger zu ertragen.«
»Fast zwei Promille im Blut bei Eintritt des Todes«, las Navarro neben ihnen vor. »Eins Komma acht.«
»Im Großen und Ganzen deutet alles in ein und dieselbe Richtung«, erklärte Bouhaddi. »Scheidung, Alkohol, Workaholic-Symptome, Einsamkeit und so weiter.«
»Das erscheint mir allerdings etwas zu konstruiert«, rief Jutta Beyer aus.
Söderstedts Körpertemperatur stieg allein während der minimalen Bewegung, deren es bedurfte, um sich leicht vorzubeugen, markant. Er forderte sie auf: »Führ das näher aus.«
»Es scheint geradezu so, als wäre Massicotte von seinem Schreibtisch aufgestanden und hätte gedacht: ›Man müsste sich mal das Leben nehmen. Das würde einem vielleicht wieder den nötigen Kick geben.‹ Keinerlei Gefühlsregung.«
»Hm«, meinte Söderstedt, »klingt fast nach Sherlock Holmes.«
»Liege ich falsch?«, fragte Jutta Beyer.
»Keine Ahnung«, antwortete Arto Söderstedt und begab sich wieder in seinen Dämmerzustand. »Rede nur weiter.«
Beyer warf ihm einen enttäuschten Blick zu und wandte sich wieder dem Material zu.
»Mit einem kurzen Strick?«, fragte Corine Bouhaddi.
Kowalewski schaute auf. »Kurz?«
»Ja«, antwortete Bouhaddi. »Dabei ist das Ankleidezimmer ein ziemlich hoher Raum. Und der Hocker war auch relativ hoch, eher eine Trittleiter. Man hätte ohne Probleme einen langen Strick benutzen können, um das Leiden zu verringern.«
»Verlangst du jetzt nicht zu viel Rationalität von einem Selbstmörder?«
»Alles andere deutet schließlich auf Rationalität hin«, entgegnete Bouhaddi und zuckte mit den Achseln.
»Jetzt sehe ich es«, rief Jutta Beyer so leise aus, wie sie es vermochte. Denn etwas leise zu äußern war und blieb für sie eine Kunst.
Söderstedts Gelenke tauten erneut auf, diesmal allerdings etwas langsamer.
»Was siehst du?«
»Das Zimmer im Keller«, antwortete Beyer.
»Das musst du näher erklären«, forderte Söderstedt sie auf, während er seinen Nacken dehnte, als hätte er einen langen Winterschlaf gehalten.
»Professor Udo Massicottes Villa war groß«, begann Beyer. »Sie war groß und ziemlich verwahrlost, wenn ich das erste Protokoll richtig gelesen habe. Er selbst war ebenfalls ziemlich heruntergekommen, wenn ich das zweite recht verstehe. Leberzirrhose et cetera. Geschieden, seelisch am Ende. Und die Villa sah dementsprechend aus. Er hatte zwar eine Putzfrau – sie war schließlich diejenige, die ihn gefunden hat –, aber sie hat offenbar keinen besonders guten Job gemacht. Es war überall staubig. Außer in einem Raum. Ein Raum im Keller war sehr sauber.«
»Danke«, sagte Arto Söderstedt und stand auf. »Außerdem hast doch bestimmt du, Jutta, eine Ahnung davon, wie weit es nach Charleroi ist. Übrigens ein absolut unangemessener Wohnort für einen der weltweit führenden Ärzte für plastische Chirurgie. Charleroi ist allgemein bekannt als die hässlichste Stadt der Welt. Es werden sogar spezielle Reisen dorthin angeboten, für Leute, die in Hässlichkeit schwelgen wollen.«
»Gut zweihundert Kilometer«, antwortete Jutta Beyer.
»Das schaffen wir in zwei Stunden, oder?«
»Nicht mit deiner Schrottkarre.«
»Mein Toyota Picnic sehnt sich schon nach einem Facelifting in der hässlichsten Stadt der Welt«, behauptete Söderstedt galant, während er sich das Jackett überzog und auf die Tür zuging.
»Müssen wir nicht erst den Chef fragen?«, wandte Jutta Beyer ein.
Arto Söderstedt erstarrte. Beyer holte ihn ein und warf ihm einen erstaunten Blick zu. Er beugte sich zu ihr vor und sagte mit Nachdruck: »Wenn du, Jutta Beyer, mich jemals den Chef fragen siehst, dann versprich mir, mich direkt ins Jenseits zu befördern.«
Insel II
Ligurisches Meer, 10. Mai
Heute scheint alles genau das Gegenteil von damals zu sein. Die Sonne, die Wellen. Das aufspritzende Meerwasser. Alles wirkt belebend. Auch die Delfine. Diese kitschigen Symbole der Lebensfreude. Sie folgen dem Schiff.
Wenn man jetzt die Hand ausstreckte, würde man sie berühren können. Ihre kalte glatte Haut. Man bildet sich ein zu wissen, wie sie sich anfühlen, aber bevor man sie nicht tatsächlich berührt hat, weiß man es nicht.
Die ausgestreckte Hand. Geradewegs über die Reling gehalten. Sie scheint kurz zu verharren, dann kommt der Sprung. Die Präzision dieser gewaltigen spulenförmigen Körper. Wie ihre Haut die Fingerspitzen nur flüchtig berührt, und dann sind sie schon wieder verschwunden. Als lebten sie in einer völlig anderen Zeit, in der in einer einzigen Sekunde eine intensive Berührung möglich wäre.
Doch das Gefühl danach ist ein völlig anderes. Die Kälte an den Fingerspitzen. Als hätte man eine ganz andere Haut berührt. Eine blauere als die des Delfins. Fußhaut. Kalte Fußhaut.
Das eigenartige Begräbnis.
Der vererbte Schmerz der Erinnerung, der durch den Kopf schneidet, als sich die Insel aus der mittelmeerblauen Wasseroberfläche erhebt. Als würde sie sich wegen einer plötzlichen Windbö kräuseln.
Die Kräuselung hält an. Immerhin ist sie es, die die so gegensätzlichen Zustände vereint. Die Brise.
Es ist die Brise, die Deda weckt, nachdem er die beiden Löcher gegraben hat. Die ihm buchstäblich wieder Leben einhaucht. Er ist so unendlich müde.
Die ganze Nacht über hat er sich versteckt, alle Sinne angestrengt. In dieser Nacht gab es niemanden, an den er seinen Kopf hätte lehnen können. Keine Mutter-die-sie-hätte-sein-müssen. Keine Faina.
Es macht auch keinen Sinn, sich an jemanden anzulehnen. Sie sterben ja doch.
Er ist aus dem Pappelhain getaumelt, als die Morgendämmerung einsetzte und die Leute sich zu bewegen begannen. Diejenigen, die es noch konnten. Dort fühlte er sich etwas sicherer.
Keiner, der ihn fressen würde.
Deda erwacht davon, dass die Brise seine Haut streichelt. Er starrt geradewegs hinunter in die beiden Löcher wie in ausdruckslose Augen. Er ist eingeschlafen, während er sie gegraben hat, während er mit seinen bloßen Händen Löcher bis tief hinunter in den tiefgefrorenen sumpfigen Boden gescharrt hat. Er ist über die Löcher gebeugt eingeschlafen.
Mit einer Hand auf der Haut.
Auf der kalten Haut der Füße.
Würdevoll senkt er Fainas blaue Füße in die beiden Gräber hinab. Wo sich der Rest von ihr befindet, daran mag er gar nicht denken. Das liegt jenseits seines Vorstellungsvermögens, obwohl sich dieses innerhalb der vergangenen Wochen brutal erweitert hat. Auf diese unwiederbringliche Art und Weise ausgedehnt hat. Unwiederbringlich, weshalb nichts jemals wieder so werden kann, wie es einmal war.
Dennoch muss er daran denken. So, wie man immer genau an das denken muss, woran man nicht denken möchte. Vor seinem inneren Auge sieht er Fleischbrocken, einen Schädel, abgenagte Skelettteile.
Als er sich übergeben muss, kommt nichts, was er erbrechen könnte.
Deda würgt eine Weile. Sein Körper wird von Krämpfen geschüttelt, während er die tiefgefrorenen Sumpfklumpen in die Löcher hinunterschaufelt und danach den Boden glatt klopft. Dann spricht er ein Gebet. Er weiß zwar nicht, zu wem, doch das Gebet handelt davon, zum zweiten Mal eine Mutter zu verlieren.
Er steht auf. Er ist zehn Jahre alt und versucht sich einen Überblick über all das zu verschaffen, was er nicht versteht. Kann man das Unbegreifliche verstehen?
Deda beobachtet all die Menschen, die an der Schwelle des Todes entlangstolpern und dieses ewige Wimmern von sich geben, dem man weder Tag noch Nacht für wenigstens eine Minute entfliehen kann. Er beobachtet sie und fragt sich, was sie eigentlich hier machen. Warum hat man sie hergebracht? Wessen Leben profitiert davon, dass Tausende Großstädter auf einer vom Wind gepeinigten Hölleninsel in einem pechschwarzen Fluss umhertorkeln, den Gott vergessen hat? Wieso sollte das auch nur für einen einzigen Menschen gut sein?
In diesem Augenblick trifft er eine Entscheidung. Er beschließt, dass er, falls er überleben sollte, falls er entgegen allen Erwartungen diese verdammte Kannibaleninsel lebend verlassen sollte, dieser großen Frage nach dem Warum nachgehen wird.
Also, Überblick verschaffen. Die Landzunge diesseits des Waldrandes. Der groteske Mehlberg, der auf der anderen Seite der Insel aufragt. Die wenigen Uniformierten, die so verängstigt wirken. Die Gesundheitsoffiziere mit ihren spärlichen Krankenzelten. Die Kette der Aufseher um sie herum, bewaffnete Obdachlose mit mörderischen Blicken, die man in den dunklen Spelunken der Kleinstädte aufgegriffen hat. Absolut unzuverlässig. Dann der Waldrand. Dahinter befinden sich die Leichenhaufen. Und dort sind sie – die Menschenfresser.
Keiner, dem er sich anschließen könnte. Absolut keiner. Diejenigen, die nicht bedrohlich wirken, sind mögliche Opfer. Dedas einzige Hoffnung besteht darin, dass er noch zu klein ist. Dass an seinen Knochen nicht viel dran ist.
Dank Großmutter ist Deda wärmer angezogen als die meisten anderen. Aber das stellt wiederum schon ein Risiko dar. Er meint, immer wieder schiefe Blicke auf seine wärmende Jacke zu spüren. Selbst auf seine warmen Stiefel, die sowieso keinem passen würden.
Doch rationale Argumente haben auf der Insel nichts verloren. Seine Schuhe sehen warm aus. Punktum.
Begleitet von dem ewigen Wimmern, driftet er zwischen den Gruppen hin und her. Findet keinen Ort, wo er kurz ausruhen könnte. Merkt, dass es am besten ist, in Bewegung zu bleiben.Dennoch traut er sich nicht, die Landzunge zu verlassen und in den Wald zu gehen. Oder auch nur am Ufer entlangzulaufen. Denn dort halten sich die Verzweifelten auf. Diejenigen, die daran glauben, fliehen zu können. Diejenigen, die im eiskalten Wasser herumwaten und Strandgut und angeschwemmte Hölzer sammeln, um Flöße zu bauen. Keiner beachtet sie weiter. Deda traut ihnen nicht, denn ihre Blicke sind bereits vom Tode gezeichnet.
Doch das ist noch gar nichts gegen den Wald und die Menschen dort drinnen. Manchmal kommen sie an den Waldrand und sehen sich um. Sie wirken, als wären sie keine Menschen mehr. In ihren Augen liegt der Blick eines wilden Tieres. Eine Furcht einflößende animalische Intensität. Deda kann sie nicht deuten, aber er erkennt sie. Er hat seine eigene Regel, um ihnen auszuweichen: Sich keinem zuwenden, keinem trauen, keinem vertrauen. Allein sein. Schnell sein.
Es ist schwer, schnell zu sein, wenn man ausgehungert ist. Der Hunger nagt immer stärker an ihm. Inzwischen hat es aufgehört zu schneien, weshalb es nun nicht einmal mehr Wasser gibt.
Während er unten über die Landzunge am Ufer entlangwandert, fragt er sich erneut, warum sie hier sind. Auf dieser Insel kann doch nicht ernsthaft Endstation für sie sein. Diejenigen, die sie hierher geschafft haben, wissen doch, dass hier niemand leben kann. Hier gibt es nichts, absolut nichts. Außer dem Tod.
Dann hätten sie die Gefangenen auch gleich erschießen können.
Das Ganze erscheint ihm wie ein Versehen. Ein übles Versehen. Als hätte irgendjemand irgendeine Idee gehabt, die nicht mit der Realität vereinbar ist. In dem Fall muss der Fehler doch auch wieder behoben werden. Man wird sie wieder abholen. Also ist der Aufenthalt hier zeitlich begrenzt, und es gibt einen Schlusspunkt. Irgendwer ist sicher schon auf dem Weg hierher. Man muss also nur bis zu seinem Eintreffen durchhalten.
Der Gedanke verleiht ihm neue Kraft. Man wird sie abholen. Es gibt Krankenzelte – was auch immer sich in ihnen befinden mag –, es gibt Offiziere, Aufseher, es gibt einen Mehlberg. Die Sache ist schiefgegangen, aber es war nicht geplant, dass sie hier sterben.
Diese Hölle dauert nicht unendlich lange.
Also gilt es zu überleben. Das ist alles. So lange zu überleben, bis sie kommen und ihn abholen.
Es ist die glasklare Logik des Zehnjährigen, die ihn weitertreibt und dazu bringt, am Ufer entlangzuwandern, auch wenn er sich dadurch von der Menge entfernt, in der er sich etwas sicherer gefühlt hat.