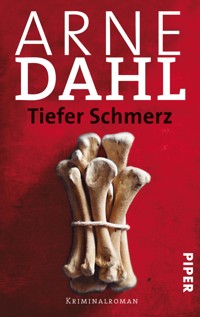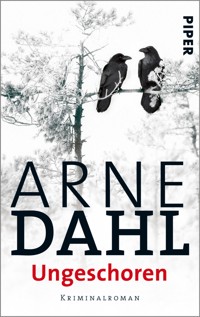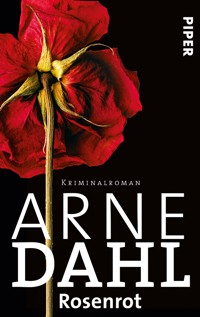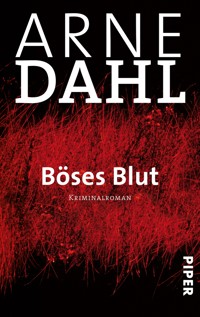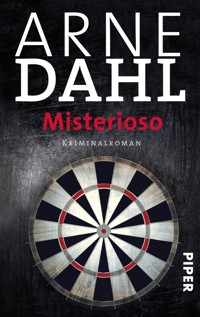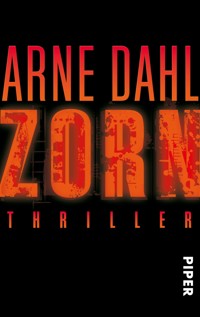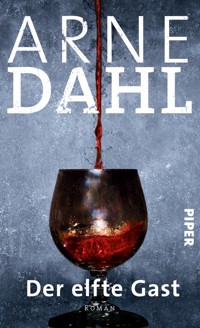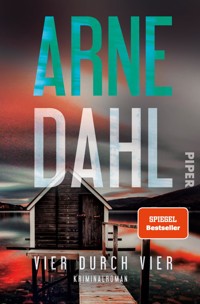
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit – der ins Herz des Ermittlerduos Berger & Blom führt Sam Berger wagt, wovor jeder andere Ermittler zurückschreckt: Er jagt die Russenmafia. 74 Stunden bleiben ihm, bis der ehemaligen Zwangsprostituierten Nadja der Kopf abgeschlagen werden soll. Da taucht Bergers Kollegin Molly Blom wieder auf, die in der Zwischenzeit die gemeinsame Tochter Myrina zur Welt gebracht hat. Fieberhaft graben sich Berger & Blom in den Fall um Nadja hinein – bis sie eine ungeheuerliche Entdeckung machen. Denn Molly Blom weiß mehr, als ihr lieb ist … »Arne Dahl schreibt die raffiniertesten und spannendsten Krimis, die Skandinavien zu bieten hat.« – Ian Rankin Als Arne Dahl 2016 mit dem Ermittlerduo Berger & Blom auf die Bestsellerlisten stürmte, war Kritikern sofort klar: Dem Titan des Schwedenkrimis gelingt hier ein Coup. Sie sollten recht behalten, denn der Autor hat den Erfolg seiner gefeierten Bestsellerromane um das A-Team und die Opcop-Gruppe mit Berger & Blom sogar noch übertreffen. »Vier durch vier« ist ein weiterer Meilenstein für das Nordic-Noir-Genre. »Spannend, blutig und raffiniert, so wie man es vom Schweden Arne Dahl kennt.« – B.Z. am Sonntag Dieser actionreiche, psychologisch meisterhaft zugespitzte Krimi wird Sie packen und in die Abgründe der menschlichen Seele führen. Folgen Sie Berger & Blom in ihrem vierten Fall – oder nehmen Sie sich gleich die ganze Krimireihe vor. Finden Sie heraus, warum Arne Dahl auf Deutsch bereits mehr als 2,5 Millionen Bücher verkauft hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Vier durch vier« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gern vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem Schwedischen von Wibke Kuhn
© Arne Dahl 2020
Published by agreement with Salomonsson Agency
Titel der schwedischen Originalausgabe: »Friheten«,
Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Evelina Kremsdorf / arcangel
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
III
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
I
1
Sam Berger war allein. Es war Nacht.
Die in den Ziegeln gespeicherte Sommerwärme brannte ihm auf dem Rücken, als er um die Ecke spähte. Hinter der Hecke sah er in einiger Ferne das Nachbarhaus. Es lag ein bisschen abgeschieden, auf einem Hügel, hinter einem kleinen Gehölz, dunkler noch als die Nacht selbst.
Es war die hellste Zeit des Jahres. Die Nacht war nicht länger als ein paar Stunden. Aber gerade die brauchte er. Er brauchte die Dunkelheit. Denn in der Dunkelheit lag die Wahrheit.
Sam Berger holte tief Luft und rannte los. Geduckt zwängte er sich durch das Loch, das er in der Hecke entdeckt hatte, und lief den Hügel hinauf. Als er sich dem Hain näherte, zog er seine Pistole aus dem Schulterhalfter.
Diese Juninacht war eigentümlich still, und jedes Geräusch, das er hörte, kam von ihm. In der Einsamkeit umgab ihn weiter nichts als der unverwechselbare Duft einer Sommernacht.
Er schlich vorsichtig durch das kleine Wäldchen, hielt Ausschau nach Überwachungskameras, konnte aber nichts entdecken. Da war nichts zu sehen. Die Nacht verhüllte alles. Doch die Taschenlampe konnte er noch nicht herausholen. Noch nicht.
Wider Erwarten gelang es ihm, sich lautlos bis zum Haus vorzuarbeiten. Was für eine Farbe es hatte, war nicht zu erkennen, im Grunde nicht mal, ob es aus Holz oder Stein gebaut war.
Er blieb kurz stehen, spürte die kühle Pistole an der Brust, die Wärme der Hauswand in seinem Rücken. Wartete, bis sein Atem wieder normal ging. Wenn hier denn überhaupt noch die Rede von normal sein konnte.
Dann spähte er um die Ecke. Konnte undeutlich eine Kellertreppe erkennen, die vor einer Tür im Souterrain zu enden schien. Jetzt holte er seine Taschenlampe heraus, stellte sie auf die niedrigste Helligkeitsstufe und richtete den Lichtkegel ins Hausinnere, auf den Boden, um ihn so klein wie möglich zu halten – für den Fall, dass über ihm jemand saß und durch die dunklen Fensterscheiben spähte.
Berger glitt die Kellertreppe hinunter, bewegte sich vollkommen lautlos. Er schlich sich weiter, Stufe für Stufe, leise, ganz leise. Noch leiser schob er den Dietrich ins Schloss. Ruckelte suchend, bis er einen Widerstand spürte und der Dietrich griff, und drückte dann vorsichtig die Klinke herunter. Zog lautlos die Tür auf.
Es war, als würde die schwarze Türöffnung ausatmen, wie ein Schwefelhauch von unten, aus unbekannten Höllenschlünden. Danach roch der Atem fast schon antiseptisch, klinisch. Er machte einen Schritt ins Haus, blieb stehen, geduckt, die Waffe erhoben, die Taschenlampe erhoben.
Trotzdem dauerte es eine gute Weile, bevor er das Geringste sehen konnte. Wenn ihm jemand aufgelauert hätte, wäre er jetzt tot gewesen.
Es fühlte sich an wie sein Mantra – die Verblüffung, immer noch am Leben zu sein.
Zu guter Letzt nahm der Raum, in dem er stand, doch erkennbare Konturen an. Er erstreckte sich über das gesamte Kellergeschoss des Hauses. Ein Hobbyraum, der zu einem Pflegezimmer umgebaut worden war. In der Ecke ein Bett mit einer Art Beatmungsgerät, ein elektrischer Rollstuhl, ein Rollator mit dazugehörigem Infusionsständer.
Der Raum war leer. Nächtlich leer.
In der Dunkelheit lag die Wahrheit.
Irgendwo in der Dunkelheit.
Er schob die Pistole wieder ins Schulterhalfter, drehte die Taschenlampe heller, leuchtete suchend um sich herum. Die Finsternis umschloss ihn. Der Lichtschein schien kaum bis zum Boden zu reichen. Als würde er auf halbem Wege zum Erliegen kommen, auf Widerstand treffen und quasi in der Luft hängen bleiben.
Berger bewegte sich mit der Langsamkeit eines Faultiers. Er schob sich am Rollator vorbei, der Beutel mit der Nährlösung schaukelte in dem leichten Windzug, den er verursachte; er ging vorbei am Rollstuhl, stand jetzt beim Bett neben dem stillen Beatmungsgerät, wie mitten in der Bewegung erstarrt. Es war, als wäre diese ganze schwarze Luft ansteckend, bakteriengesättigt. Als befände er sich in einem mittelalterlichen Pesthaus.
Die Zeit verging. Er suchte irgendetwas, irgendeinen Fehler, etwas, das hier nicht in Ordnung war. Ein Geräusch brachte ihn schließlich darauf. Einer seiner vorsichtigen Schritte klang anders, direkt neben dem Bett. Er machte ein paarmal auf derselben Stelle einen Schritt vor und zurück. Da war er wieder, der hohle Klang.
Berger bückte sich. Wie erwartet, lief ein dünner Strich über den Linoleumboden, ein kleiner Spalt, der bis unters Bett reichte. Vorsichtig schob er das Krankenbett beiseite und legte so das Viereck frei.
Es war äußerst geschickt gemacht. Der Spalt im Boden war nur wenige Millimeter breit, und daneben lag ein größerer Teppich. Der wohl normalerweise über die Falltür gezogen wurde. Denn es war garantiert eine Falltür.
Und wann wurde der Teppich nicht über die Falltür gezogen?
Wenn noch jemand dort unten war.
Vergeblich versuchte Berger, den Schauder zu unterdrücken, der ihm über den Rücken lief. Als er neben der Falltür in die Hocke ging und nach dem Griff suchte, befiel ihn das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu. Nicht noch so ein Scheißkellerloch in seinem Leben.
Der Griff war sehr geschickt in den Linoleumbelag eingearbeitet. Er bekam ihn mit der Linken zu fassen, nahm die Pistole in die Rechte und die Taschenlampe zwischen die Zähne. Dann zog er die Falltür langsam und behutsam nach oben. Er sah die massive Isolierung, die auf der unteren Seite der Tür über die Holzbretter herausragte. Richtete den Strahl eine Treppe hinunter, welche in einem Gang endete. Doch auch dort unten war kein Lebenszeichen zu vernehmen.
Erdiger Grabgeruch stieg aus dem Keller unter dem Keller.
Berger seufzte tief, blickte zur Decke. Und empfand sein Leben plötzlich als etwas Wertvolles, etwas, was er wirklich gerne behalten wollte. Fast wie etwas, das er zärtlich in der Hand halten und befühlen konnte. Dann begann er mit der Taschenlampe in der einen und der Pistole in der anderen Hand hinunterzuklettern. Jeden seiner Schritte tat er mit äußerster Wachsamkeit. Bis er schließlich am Ende der Treppe angelangt war. Der Raum glich einem Erdkeller.
Er war eng, hatte eine niedrige Decke. Für einen Moment dachte Berger, er stünde wieder in einem der Củ-Chi-Tunnel vor Saigon, durch die er in seiner jugendlichen Verwirrung gekrochen war. Und Panik bekommen hatte. Seine Kameraden hatten ihn hinausschleppen müssen. Dabei waren sie doch bloß Touristen gewesen.
Genau wie die Gänge in Vietnam wurde auch dieser hier immer enger und enger. Er war kaum ein paar Meter vorangekommen, da hatte sich die Decke schon drastisch abgesenkt, und die Wände rückten immer näher an ihn heran. Am Ende kam er nicht mal mehr geduckt weiter. Er musste auf die Knie gehen und sich auf allen vieren durch den Gang kämpfen.
Diese Panik aus seiner Jugend hatte ihn wirklich schon lange nicht mehr erfasst. Auch jetzt spürte er sie nicht, aber er spürte ihre intime Nähe. Spürte, dass sie nicht weit war und ihm auflauerte. Seine Finger kratzten durch die Erdschichten, seine Knie wurden aufgeschürft. So angestrengt er auch nach vorne spähte, er konnte das Ende des Tunnels nicht erkennen. Ob er wohl einfach in einem Trichter ohne andere Ausgänge endete?
Berger musste innehalten. Die Augen schließen. Sich konzentrieren. Nicht in den Củ-Chi-Zustand verfallen. Er war jetzt ein erwachsener Mann. Ein Mann mit gewissen Erfahrungen.
Er schlug die Augen wieder auf. Nahm die Taschenlampe, die er aus der Hand gelegt hatte, kroch weiter.
Denn jetzt konnte er nur noch kriechen. Sein Rücken fühlte sich an, als hätte ihm die Tunneldecke bereits die Haut aufgerissen. Der Sauerstoff schien zu Ende zu gehen, das Atmen fiel ihm schwerer und schwerer. Um ihn herum war kein Platz mehr, und es kam Berger vor, als wäre er genauso breit, genauso hoch wie der Tunnel. Es kam ihm vor, als wäre er nicht mehr allein in diesem engen Gang: Die Panik kroch neben ihm, ganz dicht neben ihm. Er brauchte nur den Kopf zu wenden und sie einzuatmen.
Gerade als sein Inneres die Panik inhalieren wollte, geschah etwas. Ganz unvermutet erweiterte sich der Gang in sämtliche Richtungen, und auf einmal hatte er wieder Platz für alle Gliedmaßen. Kam gleich viel schneller voran.
Doch nachdem er etwas schneller weitergekrochen war, hielt Sam Berger genau deswegen inne. Wie dafür gemacht. Er atmete aus und lauschte, was da wohl vor ihm liegen mochte. Dort war eine Tür am Ende des Ganges. Eine Tür, die eine fast normale Höhe hatte. Alle Instinkte drängten ihn, darauf zuzugehen. Alle außer einem.
Seinem Polizisteninstinkt.
Der ihn niemals verlassen würde, auch wenn sie ihn zehnmal absägten und ausstießen. Und dieser Instinkt sagte ihm, dass hier etwas nicht stimmte.
Er lauschte nach unten, nach vorne, nach rechts, nach links. Er lauschte nach unten.
Er lauschte nach unten, zum Boden.
Doch da war kein Boden mehr.
Vielmehr war da ein Graben. Ein Loch. Und zwar fünf Zentimeter von seiner linken Hand entfernt. Wäre er auch nur zehn Zentimeter weitergekrochen, wäre er direkt hineingefallen.
Der Graben war einen knappen Meter breit. Er hätte keine Chance gehabt zu bremsen.
Dann entdeckte Berger, dass da im Boden mindestens fünf parallele Klingen steckten, die rasiermesserscharf vor ihm aufblitzten. Sie erstreckten sich von der einen zur anderen Seite der Kluft. Wenn Sam Berger seinen restlichen Instinkten gefolgt und Richtung Tür gerannt wäre, wäre er völlig verstümmelt worden. Da hätte es Körperteile von Körperteilen getrennt.
Weißglühende Wut baute sich in ihm auf. Es gelang ihm, sie in Schach zu halten, während er mit der größten Vorsicht über den tödlichen Graben kletterte.
Als er ihn überwunden hatte, konnte er fast aufrecht stehen. Er hatte die Taschenlampe bereits in den Mund gesteckt und den Dietrich gezückt, als er sah, dass die Tür sich nach innen öffnete. Da schob er den Dietrich wieder in die Tasche.
Ganz offensichtlich hatte niemand damit gerechnet, dass eventuelle Eindringlinge überhaupt so weit kommen würden, denn die Tür selbst war ziemlich marode. Und sie flog nicht auf, sie zerbarst förmlich, als Bergers weißglühende Wut sich ihren Weg nach draußen bahnte.
Der Mann an der Rudermaschine saß mit dem Rücken zu ihm und zog mit voller Kraft. Die Kopfhörer auf seinen Ohren waren zweifellos völlig schalldicht. Berger trat an ihn heran, riss ihm die Kopfhörer herunter und hob ihn mit einer Hand von der Rudermaschine. Sein Gesicht ganz nah vor der Nase des Mannes, starrte er in die reinste Form von Entsetzen.
Berger brüllte ihm direkt entgegen: »Verdammt noch mal, wie weit ist ein Mensch eigentlich bereit zu gehen für so einen Scheißversicherungsbetrug?«
Er gestattete sich, den Mann niederzuschlagen, der ihn um ein Haar zerstückelt hätte. Während der Typ schlaff über seiner Rudermaschine zusammensackte, wurde Sam Berger von seiner Panik eingeholt. Mit zitternder Hand holte er seine alten Handschellen heraus und fesselte den Mann an die im Boden verschraubte Rudermaschine.
Dann schaute er sich um in dem, was aussah wie das unterirdische Fitnessstudio eines Mannes, der vortäuschte, gelähmt zu sein. Es gab keinen anderen Weg hinaus.
Die Klaustrophobie blockierte Bergers Atmung. Der Củ-Chi-Zustand überwältigte ihn. Er brauchte sofort Luft. Stürzte durch die zerschmetterte Tür hinaus, und es gelang ihm das Kunststück, über den tödlichen Graben zu hechten. Dann zwang er sich mit einer Energie, die der schieren Panik entsprang, durch die engsten Passagen, erreichte die Treppe, ohne ein einziges Mal zu atmen, rannte hoch, kam im falschen Krankenzimmer heraus, raste sofort die Kellertreppe hinauf und nahm einen der tiefsten Atemzüge seines Lebens.
Das süße Lächeln der Sommernacht schaute zaghaft aus dem Dunkel. Berger setzte sich auf einen Stein und spürte die Nacht höhnisch grinsen.
Aber so sollte es nicht bleiben.
Einen Augenblick lang hatte er zwei Familien gehabt, eine alte und eine neue. Alles, was er sich gewünscht hatte, war in greifbarer Nähe gewesen. Doch schon ein halbes Jahr später schwebte er in einem luftleeren Raum, leerer denn je zuvor.
Als Sicherheitsberater. Im Klartext: Privatdetektiv.
Er dachte an seine Zwillinge. The still point of the turning world. Zwölf Jahre waren sie jetzt alt. Er würde sie zurückbekommen. Sie waren wieder da. Die kalte Stimme seiner Ex hallte durch die Sommernacht. Ist mir scheißegal, ob du jetzt Unternehmer bist, du bleibst doch Bulle mit Leib und Seele, und das wird uns noch alle umbringen. Der Wegzug der Familie aus Stockholm, das Sorgerecht, auf das er schon vor Jahren verzichtet hatte. Die seltenen, angespannten Besuche. Vielleicht würde es besser werden. Doch er bezweifelte es. Bald würden sie in die Pubertät kommen.
Und diese verdammte Firma schluckte all seine Zeit. Von der Kohle ganz zu schweigen. Unglaublich, wie viel es kostete, so eine Firma zu gründen. Und nun bekam er keine anderen Aufträge als diese verfluchten Versicherungsbetrüger.
Er starrte zum zaghaft leuchtenden Himmelsgewölbe empor. So blieb er eine ganze Weile sitzen. Dann zog er ein zusammengefaltetes Foto aus der Innentasche seiner Jacke.
Es zeigte eine Frau, eine blonde Frau, mit starkem, aber traurigem, fast entschuldigendem Blick. Sie stand auf einem Flugplatz, und es sah so aus, als würde das Flugzeug hinter ihr gleich das riesige Fenster durchbrechen. Es sah so aus, als würde sie sprechen. Sie schaute direkt in die Kamera.
Berger betrachtete es so lange, dass die Szene wieder zum Leben erwachte. Die Frau auf dem Foto begann, sich zu bewegen. Das Flugzeug in ihrem Rücken rollte näher heran. Und als sie sprach, hörte er Molly Bloms Stimme: Ich kann nicht, Sam. Ich kann wirklich nicht. Ich brauche Ruhe. Nachdenken. Stille.
Dann war tatsächlich alles still. Furchterregend still. Bis der überirdisch schöne Gesang einer Nachtigall durch die Sommernacht drang. Vielleicht gab es ja doch noch ein wenig Gesang auf dieser Welt.
2
Vitenka rückt seine rote Seidenkrawatte zurecht, dreht die Manschettenknöpfe richtig herum und dehnt den Nacken, dass die Wirbel vernehmlich knacken. Der Mann auf der anderen Seite des Schreibtischs redet und redet, auf seine leicht gehetzte Art, als würde ihm jemand ein Schwert an die Gurgel halten, doch Vitenka hört nichts. Er hat längst aufgehört zuzuhören.
Stattdessen gleitet sein Blick über die Bucht. Auf der anderen Seite meint er, wie immer den japanischen Außenpool auf den Klippen zu sehen, aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht – so weit kann nicht mal er schauen. Ein weiteres großes Kreuzfahrtschiff gleitet vorbei; ausnahmsweise erkennt er es nicht.
Es kommt vor, dass er sich wünscht, irgendetwas zu fühlen.
Egal was.
»Wunderbar, Eldner«, sagte Vitenka jetzt und hebt die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Aber kannst du mir nicht einfach eine kurze Zusammenfassung geben?«
Eldner hält inne und senkt kurz den Blick, um seine Suada gedanklich zusammenzustreichen, scheint erfolgreich zu sein und sagt: »Die Trennung wird finanziell nur marginale Effekte haben.«
Vitenka nickt langsam. Versteht. Raushaben wollen sie ihn. Männer wie Alvar Eldner haben ihm damals die Türen der Weltgewandtheit geöffnet. Feingliedrige Herren in maßgeschneiderten Hemden auf höchst vorübergehendem Besuch. Er hat es trotz allem weit gebracht.
Und er braucht Männer wie Eldner. Juristen, die ihm die Welt, in der er sich jetzt bewegt, nach Bedarf drehen und wenden, sie ihm zurechtlegen. Rückgratlose Männer, die ihm am Ende herzlich egal sind.
»Also gut«, sagt er mit einer Bewegung, bei der Eldner automatisch aufsteht. Trotzdem bekommt der Anwalt noch über die Lippen: »Eine Sache ist da jetzt aber noch aufgetaucht.«
Vitenka weiß, dass Eldner so etwas nicht sagen würde, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Er macht eine Geste, die Eldner nicht nur auffordert, sich wieder zu setzen, sondern auch, sich zu räuspern und zu sagen: »Ich glaube, wir könnten eine neue Spur haben.«
»Eine neue Spur«, wiederholt Vitenka neutral und schaut über die Bucht, wo das Kreuzfahrtschiff gerade aus ihrem Blickfeld verschwindet.
»Es sind mittlerweile ein paar Monate vergangen«, fährt Eldner fort. »Aber Boris hatte ja leider keine neuen Informationen für uns. Diese Geschichte ist ganz einfach nicht der Grund gewesen, warum er sich vor vierzehn Jahren nach Kamtschatka abgesetzt hat.«
»Ich weiß«, sagt Vitenka kalt. »Das hat er mir ja alles persönlich erzählt. Wenn auch ziemlich … abgehackt …«
»Vierzehn Jahre lang war es nicht mehr als ein Gerücht.« Eldner lässt sich nicht beirren. »Zwanzig Millionen verschwundene Euro. In immer noch gültigen Scheinen.«
»Die Fakten sind mir bekannt. Komm zur Sache, Eldner.«
»Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt doch noch einen neuen Zusammenhang gefunden haben. Eine direkte Verbindung zu Stepanka.«
Vitenka merkt, wie er zusammenzuckt. Er darf nicht zusammenzucken. Leute wie Vitenka zucken nicht zusammen. Also blickt er jäh auf und fragt: »Eine direkte Verbindung?«
»Wir hoffen es«, nickt Eldner. »Falls sich das Gerücht wirklich bestätigen sollte, dass Ihr Vorgänger Stepanka das Geld versteckt hat.«
»Aber der ist ja von uns gegangen, wie wir alle wissen«, entgegnet Vitenka, der seine Fassung inzwischen wiedergewonnen hat.
Alvar Eldner blättert in seinen Papieren. Als ob er noch nicht genau wüsste, was er sagen soll.
»Sag es einfach«, drängt Vitenka.
Eldner runzelt die Stirn und erklärt: »Stepanka ist von uns gegangen, das stimmt schon. Aber jetzt sind doch gewisse Unregelmäßigkeiten ans Licht gekommen, was diesen Todesfall vor vierzehn Jahren angeht.«
Ausnahmsweise ist die Bucht jetzt einmal leer. Nicht ein Schiff bricht die stille Oberfläche, nicht eine Welle. Vitenka schaut von seinem hohen Aussichtspunkt aufs Wasser hinunter. Genau so muss es ausgesehen haben zur Zeit der Landnahme, als die starken und autarken Wikinger auf dieser gottverlassenen Insel ankamen und sich des Landes bemächtigten.
Genau wie wir, denkt Vitenka, als die Mauer fiel. Niemand konnte uns zurückhalten. Wir suchten die Freiheit, die richtige, grenzenlose Freiheit. Für uns gab es keine Grenzen. Keine politische und keine polizeiliche Macht konnte uns etwas anhaben. Wir sind die Wikinger der Gegenwart.
Die Zeit der Landnahme.
»Unregelmäßigkeiten?«, fragt Vitenka schließlich.
Eldner nickt.
»Drei Männer aus Stepankas persönlicher Leibwache sind vor vierzehn Jahren verschwunden, ungefähr zur selben Zeit, als das Geld verschwand. Es liegt nahe, dass das irgendwas mit der Sache zu tun hat. Ein vierter sitzt … da unten. Er heißt Adrian Fokin.«
»Ah«, sagt Vitenka. »Dann möchtest du jetzt sicher gerne gehen, Eldner?«
Vitenkas Blick folgt Eldner, bis der sich endlich verkrümelt hat. Er kann bloß Verachtung empfinden für die Gierschlünde, die immer nur den Rahm an der Oberfläche abschöpfen wollen und so tun, als wüssten sie nicht, was in der Tiefe liegt. Wahrscheinlich, damit sie noch mit sich selbst leben können, damit sie sich einreden können, sie seien noch Teil des Lichts, sie machten ja nur ihren Job und zahlten ihre Steuern, um in Ruhe und Frieden das eigene Oberklassendasein zu genießen.
Er steht auf und schaut noch einmal über die Bucht. Das scharfe Spätsommerlicht scheint von überall zu kommen, durch sämtliche Panoramafenster der eleganten einstöckigen Villa. Das Licht strömt über ihn, als er ans Bücherregal tritt. Er kann nicht anders, jedes Mal, wenn er die Buchrücken in der richtigen Reihenfolge eindrückt, muss er auflachen. Seine eigene kleine Satire auf den kulturellen Firnis der Bourgeoisie.
Das Bücherregal gleitet geschmeidig zur Seite und gibt den Blick auf eine Stahltür frei. Vitenka schaut in die Linse des Irisscanners und gibt den langen Code ein. Die Aufzugtüren gleiten auf.
Er steigt ein, wird nach unten gefahren, ganz tief nach unten. Jedes Mal spürt er den Druck auf den Ohren.
Dann gleiten die Stahltüren wieder auf. Zwei schwer bewaffnete Wachen nicken ihm im Dunkeln zu und öffnen mit großen Schlüsseln die nächste Stahltür für ihn.
Man kann den nackten Mann kaum sehen, der dort in der hinteren Ecke des Raumes hängt. Die blanken Füße erreichen mit Müh und Not den Boden, und seine Hände sind an zwei Turnringen oder etwas in der Art festgebunden, die von der Decke hängen. Seine Augen sind fast genauso groß wie der Knebel, den man ihm in den Mund gestopft hat.
Vitenka zieht einen Stuhl heran und setzt sich an den Schreibtisch, der vor dem Mann steht. Er sagt: »Du weißt, worum es hier geht, Adrian. Vor vierzehn Jahren ist eine komplette Lieferung verschwunden, zwanzig Millionen Euro. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, wohin das Geld verschwunden ist.«
Der Mann starrt ihn an. Schweiß tropft ihm vom Gesicht. Er zuckt und zappelt so viel, wie es eben geht. Viel ist das nicht.
Vitenka nimmt bedächtig seinen roten Schlips ab, faltet ihn sehr exakt in der Mitte zusammen und legt ihn ganz glatt auf den Tisch. Dann zieht er eine Schublade auf und nimmt ein großes Schwert mit breiter Klinge heraus. Es sieht aus wie ein Wikingerschwert.
Er platziert das Schwert neben dem präzise zusammengelegten Schlips. Sie sind genau gleich lang.
»Ich werde dir ein Privileg einräumen, Adrian. Willst du wissen, was für ein Privileg das sein wird?«
Der Mann starrt ihn mit wild aufgerissenen Augen an. Dann nickt er. Eine Spur von Hoffnung flackert in seinem Blick auf.
Vitenka lächelt.
»Du darfst dir selbst aussuchen, in welcher Reihenfolge du deine Gliedmaßen verlierst, Adrian. Ist das nicht nett von mir?«
Als Vitenka aufsteht und das Schwert ergreift, geht sein Pulsschlag nicht einen Schlag schneller als sonst.
3
Ihr Navi fand die Adresse nicht wirklich, und sie wollte ungern mit dem Dienstauto in der wachsamen Reihenhaussiedlung umherirren.
Hier passte ein Nachbar für den anderen auf.
Am Ende blieb sie einfach stehen, suchte sich einen abgelegenen Parkplatz, ohne größeres Aufsehen zu erregen. Die Augustdämmerung senkte sich herab, als sie den Wagen abstellte, und hüllte das ausgeschaltete Blaulicht in die versöhnliche Dunkelheit. Ganz zu schweigen von dem auffälligen Schriftzug »Polizei« auf Seitentüren und Kühlerhaube.
Sie hatte sich entscheiden müssen: entweder mit dem Pendelzug nach Hause, um ihr eigenes Auto zu holen, oder einen Streifenwagen ausleihen. Der Umweg hätte sie eine gute Stunde gekostet. Und ihre Tochter erwartete sie.
Entgegen aller Wahrscheinlichkeit stellte sich das Navi auf ihrem Handy als besser heraus als das GPS im Polizeiauto. Es führte sie in den Wald. Nachdem sie eine Weile durch die zunehmende Dämmerung gelaufen war, öffnete sich vor ihr eine Lichtung. Sie ging über in eine Wiese, die aussah wie frisch gemäht. Dünne Plastikröhren, die in regelmäßigen Abständen aus dem Boden ragten, verrieten, dass hier ein kurviger Kiesweg angelegt werden sollte.
Sooft Kriminalkommissarin Desiré Rosenkvist auch auf ihr Handy schaute, nun wurde sie doch unsicher, ob sie richtig gegangen war. Was da unten im Wäldchen am Ufer lag, erinnerte sie beunruhigend an eine Baustelle.
Sie war tatsächlich noch nie im Bootshaus gewesen.
Es war die Hütte ihres ehemaligen Chefs, Sam Berger. Sowohl vor als auch nach seinem unrühmlichen Ausscheiden aus dem schwedischen Polizeikorps war dies hier das Zentrum für die verborgenen Teile seiner Erinnerung gewesen. Vielleicht sogar das Zentrum seiner Seele.
Wenn sie denn hier richtig war.
Denn das, worauf sie jetzt zuwanderte, konnte man eigentlich kaum als Bootshaus bezeichnen. Bootshäuser waren doch normalerweise als Wetterschutz für Boote im Wasser gedacht, mit einer Einfahrt an der Giebelseite. Hier gab es keine Einfahrt an der Wasserseite, auch kein Boot, sondern nur eine lange Terrasse auf Pfeilern, die sich über das Wasser erstreckte wie eine Landungsbrücke. Die Plane, die den Großteil des Gebäudes verdeckte, strahlte ein eigentümliches Licht ab.
Sie näherte sich dem Ufer. Die Dunkelheit senkte sich herab. Die Seeluft war jetzt deutlicher zu riechen. Aber ein richtiges Bootshaus war dieses Bootshaus nicht.
Die kleine Treppe zum Eingang sah neu aus. Unter der Abdeckplane zeichnete sich ein Metallschild mit eingraviertem Text ab. Die Frau, die sich in erster Linie immer noch wie Kriminalkommissarin Desiré Rosenkvist fühlte, senkte den Kopf zum Schild und versuchte, den Text durch die Plastikfolie hindurch zu entziffern. Hieß es da wirklich »Bootshaus Security AB«? Sie widerstand der Versuchung, die Plane wegzureißen, und klopfte stattdessen an die Tür.
Niemand öffnete. Kein Lebenszeichen von drinnen, keinerlei Reaktion. Sie klopfte erneut. Das bebende Licht bebte weiter. Nichts. Sie klopfte lauter, schlug jetzt kräftig mit der Faust an die Tür. Da glitt sie auf.
Baustaub. Der unverkennbare Geruch eines Neubaus. Nach frisch gesägtem Holz. Aber mehr nicht. Abgesehen von etwas, das an kleine, durch die Luft zuckende Glühwürmchen erinnerte. Sehr klein. Vielleicht Staubkörner.
Sie sah eine winzige Küche, eine Kochnische direkt vor ihr. Dann machte sie einen Schritt nach rechts, in einen größeren Raum. Zwei parallele Türen, ganz hinten rechts neben der Tür. Ein offenbar neu gekauftes Sofa, das immer noch straff in Plastikfolie gewickelt war, ein dazu passender Sessel, ein Wohnzimmertisch. Ein vollgeschriebenes Whiteboard. Sie ging um die Ecke, nach links, sah die Meeresbucht wie ein Panorama durch die gläserne Schiebetür. Es war, als könnte man die ganze Bucht überblicken.
Aber mehr war da nicht. Keine Menschenseele.
Vorsichtig ging sie zur Schiebetür. Auf den Ausblick zu. Da hörte sie ein Geräusch unmittelbar links neben sich. Von der Wand her. Dort bewegte sich etwas. Ein leicht schleifendes Geräusch, dann ein dumpfer Ton.
Sie erstarrte zu Eis.
Als sie sich vom ersten Schreck erholt hatte, sah sie, dass dort eine Tür war, eine Tür ohne Klinke. Sie konnte lediglich ein Stück Wand ausmachen, eingerahmt von einem schmalen, rechteckigen Spalt. Als sie die Tür so weit aufbekommen hatte, dass sie die Finger ihrer Linken hineinzwängen konnte, tastete ihre Rechte nach der Dienstwaffe. Dann zog sie die Tür blitzschnell auf.
Es war eine kleine Toilette, nicht mehr als ein paar Quadratmeter groß, noch nicht ganz fertig gebaut. Und es stand außer Zweifel, dass der Kopf ganz schön tief in der Toilettenschüssel steckte. Sie machte einen Satz nach vorn, packte ihn bei den Haaren und riss den Kopf hoch. Er fühlte sich bleischwer an. Das Wasser rann an ihm herab. Er hustete.
Der Körper sank neben der Toilettenschüssel langsam zu Boden. Bevor sie seinen Blick auffangen konnte, sagte eine halb ertrunkene Stimme: »Hier gibt’s keine Dusche.«
Sie starrte auf den nassen, zerstrubbelten Hinterkopf und erwiderte instinktiv: »Da draußen ist ein ganzes Meer.«
Der Mann neben der Toilette drehte sich unglaublich langsam zu ihr um. Schaute ihr in die Augen und sagte: »Das ist eine Meeresbucht, um genau zu sein.«
Als Kriminalkommissarin Desiré Rosenkvist diesen Blick sah, verwandelte sie sich in Deer. Was überhaupt nicht absehbar gewesen war. Es war über ein halbes Jahr her, dass sie unter dramatischen Umständen auseinandergegangen waren. Seitdem hatte keiner von beiden versucht, den anderen zu kontaktieren. Und trotzdem hatte sie geahnt, dass ihre Verwandlung in Deer kurz bevorstand.
Oder hatte sie es befürchtet? Nein, geahnt. Vielleicht gehofft. Irgendwie gelang es Sam Berger immer, sie in die etwas entspanntere Person zu verwandeln, die auf den Namen Deer hörte.
»Es sieht schlimmer aus, als es ist«, sagte er und versuchte, sich vom Toilettenboden hochzustemmen. Doch er rutschte mit der Hand weg, sodass er mit den Zähnen des Oberkiefers direkt auf der Porzellankante der Toilettenschüssel landete.
*
Die Wärme des Sommers hing noch in der Luft, es war Mitte August und windstill. Die Dämmerung war fast schon in Nacht übergegangen. Sie saßen auf dem Steg, der sich ins Wasser erstreckte. Auf dem Tisch zwischen ihnen standen zwei kleine Gläser.
Berger hielt sich ein blutgeflecktes Handtuch an den Mund. Er nahm es nur kurz weg, um einen Schluck Laphroaig zu trinken und irgendetwas Unverständliches zu murmeln.
Keiner der beiden schien zu wissen, wie sie anfangen sollten. Ihre Blicke glitten über das stille, pechschwarze Wasser. Auf der anderen Seite der Bucht leuchtete die goldgelbe Fassade eines kleinen Schlosses auf. Dort verlief eine Perlenschnur aus Lichtern, ein sich dahinschlängelnder Lichterpfad, der vom spiegelglatten nächtlichen Meer reflektiert wurde. Schließlich sagte Deer: »Sieht es wirklich schlimmer aus, als es ist?«
Berger zuckte mit den Schultern.
»Jedenfalls habe ich Aufträge«, sagte er, nahm einen Schluck und verzog das Gesicht.
Deer nickte.
»Ich hab das Whiteboard gesehen. Wahrscheinlich Versicherungsbetrug, oder?«
»Nicht nur«, sagte Berger.
»Nicht?«
»Nein.«
»Was noch?«
»Private Ermittlungen.«
So eindringlich Deer ihn auch anschaute, mehr kam da nicht. Sie seufzte, schaute weg und suchte nach Worten, um die achtmonatige Leerstelle zu füllen. Am Ende sagte sie: »Ich hatte keine Ahnung, was aus dir geworden ist, bis ich Anfang des Sommers deinen Namen in einem Gerichtsurteil gelesen habe.«
Berger verzog das Gesicht noch ein bisschen mehr und drückte sich das Handtuch an den Mund.
Als die Antwort ausblieb, fuhr Deer fort: »Es ging um einen Fall von Körperverletzung in einem Haus in Spånga. Du hattest einen Behinderten zusammengeschlagen.«
Berger lachte auf.
»Emil Sundh war nicht behindert. Das war ja der Witz an der ganzen Geschichte.«
»Ich habe gesehen, dass man dich freigesprochen hat.«
»Während er im Knast sitzt«, ergänzte Berger. »Versicherungsbetrug kann ein richtiges Verbrechen sein, Deer.«
»Aber er sitzt nicht deswegen im Knast, oder?«
»Es lag wohl hauptsächlich daran, dass er versucht hat, mich zu zerstückeln«, erklärte Berger.
Deer schauderte. Dann fragte sie: »Wie geht’s dir eigentlich, Sam?«
»Wie geht’s dir denn?«, fragte Berger rasch zurück.
Deer lächelte schwach. Es dauerte eine Weile, bis sie antwortete: »Immer besser.«
Berger musterte sie zum ersten Mal richtig.
»War’s schlimm?«, wollte er wissen.
»Eigentlich nicht«, sagte Deer. »Meiner Familie geht es ja gut. Johnny arbeitet, Lykke spielt immer besser Fußball. Wenn sie nicht auf eines der üblichen Hindernisse stößt, kann sie wohl richtig gut werden.«
»Und du?«
»Besser. Jeden Tag ein Stückchen besser.«
Berger hielt inne, musterte sie, wartete ab und nahm noch einen Schluck Laphroaig.
»Ich habe einen Menschen getötet«, fuhr Deer schließlich fort. »Ich hatte Albträume, Schlaflosigkeit, Panikattacken.«
Berger schüttelte langsam den Kopf. »Das wusste ich alles gar nicht.«
»Ich hab tolle Hilfe bekommen«, sagte Deer und nippte an ihrem Whisky.
Berger tat es ihr nach und schwieg.
»Deswegen frag ich noch mal«, insistierte sie schließlich. »Wie geht es dir?«
Berger wandte den Kopf ab und schaute übers Wasser. Sah nichts. Sagte nichts.
Die Stille musste sich erst mal setzen. Er nahm noch einen Schluck Whisky. Betrachtete das Handtuch – offenbar blutete er immer noch am Mund. Dann hatte er es auf einmal satt, legte es zur Seite und trank noch etwas. Spülte den Mund damit aus. Es brannte wohltuend am Zahnfleisch.
Doch er schwieg weiterhin.
Deer wurde es langsam müde. »Sam. Du lagst mit dem Kopf in der Kloschüssel. Und ich hab’s gesehen.«
»Du warst unbestreitbar hier …«
»Nein, nicht das«, sagte Deer. »Ich hab die untere Ecke gesehen.«
Berger schaute sie an. Was Deer in seinem Blick las, war etwas Grenzenloses. Ein Vakuum? Eine schlummernde Urkraft? Unendliche Traurigkeit? Sie wusste es nicht.
»Die untere rechte Ecke deines Whiteboards«, erklärte sie. »Ist das etwa nicht deine private Ermittlung?«
»Das geht bloß mich etwas an«, murmelte Berger.
»Das geht deine Freunde etwas an. Auch die, die du seit acht Monaten ignorierst.«
»Nein. Das ist einzig und allein meine Angelegenheit.«
»Die Zwillinge und Molly?«, fragte Deer.
Berger lachte bitter. Erneut schoss das Blut aus seinem lädierten Mund.
»Reicht, um ein Flusspferd zu versenken, oder?«, sagte er, leerte sein Glas und schenkte sich gleich wieder nach.
»Das Flusspferd, das sich zu baden geweigert hat«, entgegnete Deer.
Sie stießen an. Tranken.
»Du kannst nicht alkoholisiert so einen Scheißstreifenwagen fahren«, sagte Berger.
»Wenn es eines auf der Welt gibt, was ich sehr wohl alkoholisiert fahren kann, dann ist es ein Streifenwagen«, erwiderte Deer und nahm noch einen Schluck.
Berger lachte erneut, und sie fing seinen Blick auf.
»Trotzdem schön, dass du dir Sorgen um mich machst«, sagte sie.
Berger verstummte, es klang ja doch nicht nach Gelächter. Er seufzte tief. Und sagte: »Du weißt, dass ich mir Sorgen um dich mache. Du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem ich hundertprozentig vertraue.«
»Aber was ich hier sehe, das ist doch alles bloß Mist. Was treibst du hier eigentlich, Sam?«
»Alle sind weg. Verstehst du nicht, Deer? Alle sind weg.«
Wieder schwiegen sie. Eine geraume Weile.
Deer musterte Berger. Beugte sich vor und fasste ihn am Arm.
»Du musst mir erklären, was du meinst, Sam. Ich verstehe es nicht.«
Sein Kopf sank nach vorn. Sie sah, wie er in sich zusammensank, wie die Lebenskraft aus ihm wich. Und sie verstand. Sie verstand nicht so wirklich, was sie da gerade verstand, aber sie verstand es mit absoluter Klarheit.
»Deine Zwillinge haben doch bei dir gewohnt«, sagte sie, »Marcus und Oscar.«
»Für elf Tage …«
»Was ist passiert?«
»Freja hat einen Job bekommen, für den sie wegziehen musste«, erklärte er. »Sie hat beschlossen, dass sie die harten Bandagen auspackt. Ich hatte schon vor mehreren Jahren auf das Sorgerecht verzichtet. Wenn ich Glück habe, darf ich sie jedes zweite Wochenende sehen.«
»Und? Hättest du das gerne anders, Sam?«
Berger hob die Hand in einer resignierten Geste.
»Vielleicht später«, sagte er. »Erst muss ich das hier in Ordnung bringen.«
»Die Bootshaus Security AB? Oder …?«
»Mein Leben eher …«
»Dann ist es also Molly«, sagte Deer und hielt seinen Blick.
»Was?«, rief Berger.
»Dann ist Molly also deine private Ermittlung.«
Berger schüttelte langsam den Kopf. »Nein, Deer. Auf das Eis lass ich mich nicht locken. Sorry.«
»Vor acht Monaten war Molly Blom schwanger mit einem Kind, das wahrscheinlich von dir ist. Was zur Hölle ist passiert?«
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Auf das Eis geh ich jetzt nicht.«
Deer betrachtete Berger. Dann sagte sie: »Du brauchst Hilfe. So wie ich Hilfe gebraucht habe.«
Erneutes Schweigen. Ein kurzes Rascheln im Espenlaub. Als wollte jemand aus einer anderen Zeit zu ihnen.
Berger verzog das Gesicht. »Alles war da. Die Zwillinge, Molly, das ungeborene Kind. Für einen Moment waren sie alle da. Wie in einem Traum. Dann bin ich aufgewacht.«
Deer nickte.
»Und jetzt ist nichts mehr da«, sagte sie.
»Doch«, antwortete Berger. »Eine Bande von Versicherungsbetrügern.«
»Darf ich nur mal kurz fragen, ob du einsiehst, dass du Hilfe brauchst?«
Er wandte den Blick zu ihr. Ganz rein und klar wirkte er.
»Ich komme mit Abstraktionen nicht so gut klar«, sagte er. »Inwiefern Hilfe?«
»Das ist keine Abstraktion«, insistierte Deer und zog eine Visitenkarte aus der Tasche. »Ich meine das ganz konkret. Sie heißt Rita Ohlén. Sie hat mir aus dem Sumpf geholfen. Und ich glaube, sie wäre auch für dich die Richtige, Sam. So ein No-bullshit-Typ. Ruf sie an, sondier das Terrain, mehr verlange ich gar nicht. Aber so kannst du nicht weitermachen.«
Berger nahm die Visitenkarte, las sie, legte sie am Rand des Tisches ab und nickte.
»Ich verspreche gar nichts«, sagte er.
Der Mond kroch hinter den Wolken hervor und erleuchtete die kleine Bucht. Jetzt kräuselte sich die Wasseroberfläche leicht, und die kleinen Wellen liefen auf das Bootshaus zu. Als sie bei der Landungsbrücke ankamen, fiel die Visitenkarte vom Tisch. Berger streckte geistesgegenwärtig die Hand aus und fing sie in der Luft.
»Schön«, sagte Deer spontan.
»Ich glaube, der Herbst ist da«, gab Berger zurück und steckte die Visitenkarte ein.
Ihre Blicke begegneten sich. Jetzt war es an Deer, ihnen nachzuschenken.
»Okay«, sagte sie und hob ihr Glas. »Es sieht vielleicht schlimmer aus, als es ist. Aber sprich mal mit Rita. Es lohnt sich.«
»Willst du jetzt wirklich noch mehr trinken?«, fragte Berger.
4
Er schaute aus dem Fenster. Die kurze Ploggatan erstreckte sich dort unten im Morgenlicht. Ploggatan, Södermalm, Stockholm, Schweden. Er war wie ein Landei zu Besuch in der Großstadt. Aber auch zu Besuch in seiner Vergangenheit. In dem, was einmal sein Leben gewesen war.
Die Wohnung fühlte sich seltsam fremd an, als hätte er nie dort gewohnt. Als hätte dort nie jemand gewohnt, den er kannte.
Der Traum, aus dem er aufgewacht war.
Sam Berger ging durch die unaufgeräumte Wohnung. Es sah aus, als hätte er sie von einer Sekunde auf die andere verlassen, ohne sich auch nur ein Mal umzublicken. Er sah sein vergangenes Leben von außen, betrachtete es mit dem neugierigen, aber objektiven Blick des Anthropologen.
Es gab nichts zu sehen. Überhaupt nichts.
Den ganzen Sommer hatte er, während die Renovierung nur schleppend voranging, in einem Schlafsack im Bootshaus geschlafen. Hauptsächlich draußen auf dem Steg. Wo er heute Nacht schlafen würde – und überhaupt in Zukunft –, würde sich noch entscheiden müssen.
An diesem Tag, über den er noch nichts wusste.
Er stand am Küchentisch und sortierte die Post. Es kam immer weniger. Weswegen es eigentlich nicht viel zu sortieren gab. Er schob einfach die Fensterkuverts von dem großen Stapel auf den Stapel mit den Werbesendungen. Allein die Bewegung fühlte sich unfassbar trostlos an.
Dann kam endlich ein bisschen richtige Post. Von der Handelskammer. Eine Firma namens »Bootshaus Security AB« war registriert worden.
Berger betrachtete den formellen, automatisierten Brief und versuchte zu verstehen, was er fühlte. Das war nicht ganz einfach. Vielleicht weil er überhaupt nichts fühlte.
Obwohl es da einen Weg gab, etwas zu fühlen, wirklich zu fühlen, und der bestand darin, dass er ins Zimmer der Zwillinge ging. Er trat an ihr Stockbett, zog die beiden Überdecken ganz glatt. Ließ das Gefühl durch sich hindurchströmen. Schluckte die Trauer, die irgendwie doch nicht so sehr Trauer war wie vorher.
Sie waren jetzt ja doch wieder in seinem Leben.
Sam Berger begab sich auf eine lange Morgenwanderung durch Stockholm, die ihn von der Dunkelheit fernhalten sollte. Es lag zweifellos schon Herbst in der Luft, wenn auch nur eine unbestimmte Spur. Kein Windhauch, eher eine abwartende Stille, mit jähen Anflügen von Kälte, die ihm folgten, als er in nördlicher Richtung über Södermalm spazierte, quer durch Gamla Stan, in die Stadt, und dann stand er am Ende vor einem Tor in einer Querstraße, mitten in einem anonymen Teil der Stadt. Vielleicht war es dieser unscharf umrissene Stadtteil, den man Norrmalm nannte.
Er betätigte jedenfalls die Klingel neben einem kleinen Metallschild, das diskret darauf hinwies, dass dieses Haus »Norrmalms Therapiezentrum AB« beherbergte. Die Tür summte, Berger trat ein. Er nahm die Treppen nach oben, merkte verblüfft, dass seine Lungen ein pfeifendes Geräusch machten, wartete, bis es aufhörte, dann klingelte er an der Tür. Die summte ebenfalls.
Dann stand Berger an einer Rezeption in einem leeren, hellen, sauberen Wartezimmer, zeigte seinen Ausweis vor, bekam die Zimmernummer genannt und wanderte durch verblüffend lange Flure, die ein Bild vom Therapiebedarf der Großstadt vermittelten.
Er klopfte, und eine dumpfe Frauenstimme sagte: »Herein.«
Und so trat er ein, betrachtete die Frau, die auf einem Sofa saß und etwas in ein großes Buch notierte. Sie mochte Mitte fünfzig sein, hatte kurze graublonde Haare, eine Brille auf der Stirn und trug ein Outfit mit Jeans, das trotzdem einen strengen Eindruck machte. Aber was Berger in erster Linie gefangen nahm, war der Blick, den sie jetzt hob, ein freundlicher, aber alles durchdringender Blick.
Sie stand auf und ging auf ihn zu. Sie begrüßten sich.
»Ich bin Rita Ohlén.«
»Sam Berger«, sagte er. »Schön, dass ich so schnell einen Termin bei Ihnen kriegen konnte.«
»Es klang, als wäre es ein bisschen akut«, sagte Rita Ohlén und setzte sich, wobei sie auf einen Sessel auf der anderen Seite eines kleinen Glastisches deutete. Berger nahm ebenfalls Platz. Sein Blick blieb an den Papiertaschentüchern mitten auf dem Tisch hängen, die man aus einer praktischen Box herausziehen konnte.
»Ich bin Psychotherapeutin und Psychologin hier im Therapiezentrum Norrmalm«, fuhr Rita Ohlén fort, »und verfüge über langjährige Erfahrung im Umgang mit ausgebrannten Polizisten. Und ich ahne, dass man Sie wohl am ehesten als ausgebrannten Polizisten bezeichnen kann. Was machen Sie jetzt für einen Job?«
»Ich arbeite in der Securitybranche«, sagte Berger.
Sie hielt seinen Blick fest, schien noch mehr von ihm zu erwarten. Doch er schwieg. Sie nickte und schrieb etwas in ihr Notizbuch.
»Also gut«, sagte sie mit ermunterndem Lächeln. »Ich will vorher betonen, dass ich gerne mit etwas unorthodoxen Methoden arbeite. Zum Beispiel müssen meine Patienten Texte für mich schreiben und sich filmen lassen, um sich später Filme von sich selbst anzuschauen, wie sie mir antworten. Klingt das zu unorthodox für Sie?«
»Ich hab ja keine Ahnung, wie die orthodoxe Variante aussieht«, antwortete Berger und zuckte mit den Schultern.
Rita Ohlén lächelte. »Das nehme ich mal als Ja. Warum sind Sie hier, Sam?«
Berger merkte, dass auch er lächeln musste. Ganz von selbst. Er fragte sich, wie dieses Lächeln wohl aussah.
»Tja«, setzte er an. »Wenn ich wüsste, wo ich anfangen soll …«
»Sagen Sie es einfach mit einem Wort, ohne groß nachzudenken. Ein einziges Wort.«
»Verlust«, hörte Berger sich selbst sagen.
Rita Ohlén nickte kurz. Dann erklärte sie: »Es ist egal, wo Sie anfangen, Sam. Wir kommen schon da hin, wo wir hinwollen.«
Und er begann. Er begann nicht einfach nur, er ließ alle Hemmungen fallen, und es war nicht mehr er, der da sprach, es war etwas in ihm, was einfach nur rauswollte. Hier und da kam ein aufmunterndes Nicken oder ein interessierter Blick von ihr, manchmal ein Stichwort, das ihn wieder auf die Spur zurückbrachte, und dazu machte sie sich sporadisch Notizen. Ein paarmal funkelten ihre Augen auf, als hätte sie den Deckel zu einem klaftertiefen Brunnen gefunden. Die Zeit verflog in Windeseile. Sie schien nicht mehr messbar zu sein.
Sie holte ihn erst wieder irgendwie ein, als Rita Ohlén mit fragendem Tonfall wiederholte: »The still point of the turning world?«
Berger nickte, nahm sich ein Taschentuch, knüllte es zusammen, bis es ganz klein war, und sagte dann: »So habe ich immer an Marcus und Oscar gedacht. Wenn die Wirklichkeit ins Rotieren kam, habe ich ihr Foto genommen, und schon war wieder alles ruhig.«
»Aber das funktioniert jetzt nicht mehr?«
»Sie sind zu einer Fata Morgana geworden. Sie waren da, und alles war in Ordnung. Sie waren ein paar Tage da, und dann sind sie wieder verschwunden.«
»Sie sehen sie doch jedes zweite Wochenende, oder?«, fragte Rita Ohlén.
»In einer anderen Stadt«, sagte Berger.
»Aber sie könnten doch sicher auch nach Stockholm kommen, nicht?«
»Das läuft nie so besonders gut …«
»Vielleicht ist es Ihnen ja lieber, dass sie eine Fata Morgana bleiben?«
Das sagte sie so ruhig und still, dass er im ersten Moment gar nicht begriff, was sie da redete. Er hielt inne und erstarrte.
»Warum sollte mir das lieber sein?«, fragte er.
»Es ist leicht, es sich in seinem Elend gemütlich zu machen. Es sich in seinem Leiden wohnlich einzurichten. Trost in der Ungerechtigkeit zu finden. Sonst müssten Sie die Dinge ja in Angriff nehmen. Handeln, statt Ihre Umwelt zu verfluchen. Aktiv zur Erziehung der Zwillinge beitragen. Es ist einfacher, sie auf Distanz zu haben, denn das gestattet Ihnen nicht nur Selbstmitleid, es macht es unvermeidlich.«
Berger schwieg. Er schaute auf seine Hände. Seine passiven Hände. Das Taschentuch nur mehr ein winziger Ball.
»Aber an der Situation mit Ihren Söhnen ist ja seit Wochen, im Grunde seit Monaten nichts akuter geworden«, sagte Ohlén. »Warum wurde es gestern plötzlich so akut?«
»Wer hat das denn behauptet?«
»Zum einen wollten Sie so schnell wie möglich einen Termin, als Sie gestern Morgen anriefen. Zum andern war da die Geschichte mit der Toilettenschüssel, die ja von Ihrer dicken Lippe beglaubigt wird. Haben Sie versucht, sich zu ertränken?«
»Das hätte ich nicht erzählen sollen«, murmelte Berger.
»Es war gut, dass Sie das erzählt haben«, sagte Rita Ohlén. »Also: Warum gestern?«
»Ich habe keine Dusche …«
»Es wird nur anstrengend, wenn Sie jetzt weiter Vorwände bringen. Warum gestern? Der Zeitpunkt steht in keinem direkten Zusammenhang zu Ihrem Verlust der Zwillinge. Das muss bedeuten, dass es hier um Ihren anderen Verlust geht. Den Sie irgendwie nicht ansprechen können.«
Jetzt war Berger still. Mucksmäuschenstill.
»Denn da gibt es sehr wohl einen Zeitfaktor, stimmt’s?«, fuhr Rita Ohlén etwas schärfer fort. »Sie haben bis jetzt noch nicht viel über Molly Blom gesagt. Da müssen wir jetzt wohl hin, Sam.«
Er wurde noch stiller.
»Verstehe«, sagte die Psychologin und nickte. »Darf ich es mal versuchen?«
Schweigen. Sie ging noch einen Schritt weiter.
»Eine Schwangerschaft bedeutet immer, dass eine Stoppuhr tickt, oder? Wie ist das passiert, als Molly verschwand, Sam?«
»Ich kann nicht …«
»Sie sind hergekommen, um zu können.«
»Eher nicht.«
»Lassen Sie mich trotzdem weitersprechen«, sagte Rita Ohlén. »Sie haben versucht herauszufinden, wohin Molly gegangen ist, richtig? Sind Sie sicher, dass Sie nicht wissen, wo sie jetzt ist?«
»Ich glaube, das reicht für heute«, entfuhr es Berger.
»Ich sage hier, wann es reicht, Sam. Jetzt sind wir einer wichtigen Sache auf der Spur. Sie haben viel investiert, um sie zu finden, Sie haben Ihr ganzes professionelles Können eingesetzt, um Molly Blom zu finden. Gut, Sie haben sich ein paar Brotjobs organisiert, indem Sie schäbige Versicherungsbetrüger aufgestöbert haben, und dabei sind Sie auch auf irgendetwas gestoßen, was unmittelbare Todesangst bei Ihnen ausgelöst hat …«
»Sind Sie schon mal um Haaresbreite zerstückelt worden?«, unterbrach Berger sie mit einer unterschwelligen Wut.
Rita Ohlén ignorierte seinen Einwurf mit beispielhafter Präzision und fuhr fort: »Aber Ihre ganze Aufmerksamkeit haben Sie darauf gerichtet, Molly Blom zu finden, Ihre Ex-Freundin, die jetzt – eventuell – mit einem Kind von Ihnen schwanger ist. Aber es ist Ihnen nicht gelungen. Sie sind nicht einen Schritt weitergekommen. Wie ist das möglich, Sam? Wenn ich Ihre Erzählung richtig verstanden habe, haben Sie im letzten Jahr eine Reihe extrem komplexer Fälle gelöst – aber Ihre eigene Freundin können Sie nicht finden. Warum?«
»Sie war bei der Säpo, sie wurde als Undercover-Agentin eingesetzt. Wenn irgendjemand weiß, wie man verschwindet, dann sie«, sagte Berger.
»Das war also freiwillig?«
»Zumindest zu Anfang war es das. Und ich habe versucht, sie zu finden.«
»Und Sie wissen nicht, ob sie in der Zeit immer noch schwanger war?«
»Jetzt werden Sie aber brutal, Rita. Nein, das weiß ich nicht.«
»Aber Sie wissen, dass Sie ›zu Anfang‹ freiwillig verschwunden ist. Woher wissen Sie das? Haben Sie miteinander gesprochen?«
»Nein, die Chance hatte ich nie. Aber ich glaube, ich schaffe das hier nicht. Vielleicht nächstes Mal. Wunder geschehen nur in Träumen – und Molly wird nie zurückkommen.«
»Sie haben nicht miteinander gesprochen, aber sie hat Sie informiert. Ich glaube kaum, dass sie der Typ ist, der per SMS Schluss macht, oder? Hat sie einen Film geschickt? Einen Abschiedsfilm?«
»Ja …«
Rita Ohlén schrieb noch ein paar Worte in ihr allwissendes Notizbuch. Dann schob sie die Brille auf die Stirn und schaute ihn an.
»Haben Sie den Film dabei, auf Ihrem Handy?«
»Ich habe ihn seit acht Monaten nicht mehr angeschaut, und ich habe nicht vor, ihn jetzt anzuschauen. Das geht mir hier alles zu schnell.«
»Können Sie den Film trotzdem beschreiben?«
Schweigen. Schließlich ein zögerliches Nicken.
»Sie steht vor dem Panoramafenster eines Flughafens«, begann Berger langsam. »Ich konnte das Flugzeug hinter ihr identifizieren. Sie steht da auf dem Flughafen Brüssel. Ich habe auch den Zeitpunkt ziemlich exakt ermitteln können. Wenn sie von dort geflogen ist, hat sie auf jeden Fall nie einen Pass mit ihrem echten Namen benutzt. Was entweder bedeutet, dass sie überhaupt nicht geflogen, sondern geblieben ist. Oder dass sie eine falsche Identität benutzt hat. Seitdem nicht eine Spur in der ganzen weiten Welt. Was ja doch wieder die Variante mit der falschen Identität stützt. Da ich keine finanziellen Fingerabdrücke finden kann, muss es wohl auch falsche Kreditkarten geben. Oder ganz einfach Bargeld.«
»Und was hat Molly in dem Film gesagt?«
Berger schloss die Augen und rieb sich kräftig über die Lider.
»Nicht viel«, antwortete er.
Rita Ohlén beugte sich vor und lächelte. Dann meinte sie: »Okay, ich versteh schon.«
»Was verstehen Sie?«
»Dass Sie es auswendig können. Was hat sie gesagt?«
Berger seufzte tief und beugte sich ebenfalls vor, sodass sein Kopf dem von Rita Ohlén bedrohlich nahe kam. Er sah ihr in die Augen und sagte: »Ich weiß, dass du unsere Zukunft geplant hast, Sam. Ich weiß, dass du willst, dass wir Sicherheitsberater werden in diesem blöden Bootshaus, das für mich nur wie Erbrochenes aus der Vergangenheit ist. Ich kann es nicht, Sam. Ich kann es wirklich nicht. Ich brauche Ruhe. Zeit zum Nachdenken. Stille. Danach schauen wir weiter, ob wir uns wiedersehen, alle zusammen. Lass du es auch erst mal ruhig angehen. Das ist für dich auch wichtig, vergiss das nicht.«
»Alle zusammen«, wiederholte Rita Ohlén.
Berger schnaubte.
»Ich ahne, dass ebendieses ›alle zusammen‹ das Einzige ist, was mich davon abgehalten hat, mich totzusaufen.«
Die Psychologin lehnte sich wieder zurück und notierte etwas. Dann sagte sie: »Und ? Wie interpretieren Sie das?«
»Genauso wie Sie«, erwiderte Berger. »›Alle zusammen‹ könnte zwar auch bedeuten ›du, ich und Desiré Rosenkvist‹, das alte Team, aber verdammt, ich weiß, es bedeutet einfach ›du, ich und unser Kind‹. Zumindest muss ich das glauben.«
Rita Ohlén nickte. Sie lächelte schwach, machte sich noch einmal eine Notiz.
»Das können nur Sie wissen«, sagte sie. »Haben Sie viel an das Kind gedacht?«
»Es ist ihr Körper«, sagte Berger.
»Das beantwortet meine Frage nicht«, sagte Rita Ohlén.
Berger kam es vor, als würde er in sich zusammenschrumpfen. Dann sagte er: »Ich habe viel an das Kind gedacht, ja.«
5
Es ist Nacht. Windstille. Die Szenerie wirkt wie ein Standbild.
Die Straße verläuft schnurgerade zwischen Reihen aus dicht an dicht stehenden Häusern. Hier und da beleuchtet eine Laterne einzelne geparkte Autos rechts und links am Straßenrand. Es könnte jede beliebige Jahreszeit sein. Nur Nacht. Nacht in einem Vorort.
Durch den einen oder anderen Schlitz – durch Rollläden, Jalousien, Vorhänge – dringt ein schwacher Lichtschein, Licht aus dem Reich der Schlaflosen und derer, die Angst vor der Dunkelheit haben.
Nichts regt sich. Absolute Stille. Alles ruht.
Alles außer Nadja. Sie ruht nicht. Sie begegnet ihrem eigenen Blick im Rückspiegel.
Begegnet allem, was in diesem Blick liegt …
Ohne den Blick abzuwenden, wandert ihre Hand zum Beifahrersitz des Vans. Das paradoxe Gefühl von Sicherheit, als ihre Finger über das Metall gleiten, blitzt kurz in ihren braunen Augen auf. Sie entspannen sich unter der hochgerollten schwarzen Mütze.
Dann betastet Nadja ihre Kette, die Achtelnoten, und sieht ihr ganzes Leben an sich vorbeiziehen. Sieht ihre Kindheit: arm, aber voller Lebensfreude, den dichten, geheimnisvollen Wald, Großmutters gute Blini, die wunderschönen Stunden am Klavier, sieht den kleinen Singvogel wie von außen. Sie sieht die Fortsetzung: die Fabrik, die Monotonie, die Lebensmüdigkeit, die Lebensgefahr. Sie sieht den Traum, das Paradies, das plötzlich in Reichweite war. Sie sieht die Reise hierher.
Sie sieht die Hölle hier. Aber diese Bilder wagt sie sich lieber nicht genauer ins Gedächtnis zu rufen. Nicht so richtig.
Nicht diese ganzen Jahre. Das alles ist zu tief vergraben.
Sie ist hier, um sich diese Jahre zurückzuholen. Die verlorenen Jahre.
Alles steht und fällt mit diesem Augenblick, auf dieser Straße. Diesem Augenblick, auf den Nadja jetzt wartet.
Die Zeit verstreicht.
Da huscht ein Hund unter einer Straßenlaterne vorbei, rechts neben ihrem Van. Nadja bleibt vollkommen still sitzen, macht sich unsichtbar, spürt das Metall an ihren Fingerspitzen. Als sie ins Licht tritt, wird auch die Hundebesitzerin sichtbar, eine Frau mit kurzen blonden Haaren, Lederjacke, Jeans, Spuren eines Tattoos an einem Handgelenk, das aufblitzt, weil der Rottweiler an der Leine zieht, dann aber wieder locker lässt und stehen bleibt, um am Vorderreifen des Vans zu schnüffeln.
Nadja umklammert das Metall, ganz fest jetzt, als wollte sie die Pistole gleich heben, den Schalldämpfer an die Beifahrertür drücken.
Mit einem Mal zerrt die Frau an der Leine. Ebenfalls ganz fest. Das Tattoo wird im Licht deutlich sichtbar. Das Herz. Mit dem Namen »Sam« darin, und von einem Pfeil durchschossen. Ein einzelner Blutstropfen. Herzblut.
Nadja hebt die Pistole, richtet sie auf die Frau. Aus wenigen Metern Entfernung. Das jetzt könnte der Augenblick ihres Todes sein.
Doch dann geht der Rottweiler weiter und zieht sein Frauchen hinter sich her.
Nadja sinkt in sich zusammen. Die Stille kehrt zurück.
Sie fühlt sich so klein, so unbedeutend. In den Jahren nach der Hölle, nach der Freiheit, die sie in Wahrheit nie erreicht hat, kam die totale Selbstkontrolle, das Geordnete, immer alles schön am richtigen Platz, damit das Leben in überschaubaren Bahnen verlief. Kein Rausch mehr in ihrem Leben, obwohl sie doch für den betäubenden Rausch gelebt hatte – kein einziger Rausch mehr, bis in alle Ewigkeit. Bis auf diesen einen.
Bald. Bald ist es so weit.
Bald wird sie ihren Kopf ins Maul des Löwen stecken.
Sie schaut auf ihre Hände hinab. Sie zittern nicht, beben aber leicht. Als würde das Leben selbst vom Himmel herunterstrahlen und in sie hinein. Sie spürt, wie ihr Herz das Leben durch ihre Adern pumpt, nicht Tod, nicht Gleichgültigkeit, nicht Leiden, nicht Ordnung.
In dem Moment nimmt sie eine Bewegung im linken Außenspiegel wahr. Sie sieht einen Mann auf der anderen Straßenseite auftauchen. Er bewegt sich in ihre Richtung, taucht immer kurz in den Lücken zwischen den geparkten Autos auf. Die Arme um den Körper geschlungen, als würde er frieren. Aber sie erkennt ihn am wetterfesten Trainingsanzug und dem weinroten Käppi.
Jetzt ist er fast auf ihrer Höhe. Sie hält den Atem an.
Er ist es.
Jetzt.
Entweder oder. Himmel oder Hölle.
Als er noch zwei Straßenlaternen von ihr entfernt ist, hebt sie erneut die Pistole. Er macht ein paar letzte Schritte. Jetzt muss alles sitzen. Jede noch so kleine Bewegung.
In dem Moment, in dem Nadja die Autotür aufstößt, sieht sie ganz deutlich das kleine Mädchen am Klavier. Als sie über die Straße rennt, hört sie die engelsgleiche Stimme des Mädchens zum abweisenden Nachthimmel emporsteigen.
Es ist nicht mehr weit bis zur anderen Straßenseite. Sie hebt die Pistole, schaut dem Mann in die Augen und zielt.
Blitzschnell duckt er sich hinter ein geparktes Auto, einen großen Jeep. Sie war zu langsam.
Angst steigt in ihr auf. Es gibt zwei Wege um das Auto herum. Fifty-fifty. Nadja nimmt den Uhrzeigersinn. Geht in die Hocke.
Ganz langsam.
Es fühlt sich an, als würde sich der dumpfe Himmel über sie herabsenken. Da singt niemand mehr. Es ist, als hätte auf der ganzen Welt noch nie jemand gesungen. Alles ist ganz still.
Der Mann schnellt, ebenfalls im Uhrzeigersinn, um den Jeep herum. Er packt sie von hinten. Versucht, ihr die Pistole zu entwinden. Der Schalldämpfer ist auf den niedrigen Himmel gerichtet.
Als wäre er auf Gott gerichtet.
Dann bekommt der Mann die Pistole zu fassen und entreißt sie ihr. Entreißt ihr alles, was sie ihm in ihrer Wehrlosigkeit preisgibt. Die Freiheit, die Nadja bisher nur dem Namen nach kannte, sollte endlich Wirklichkeit werden. Stattdessen ist sie gescheitert.
Schrecklich, dass sie sich jetzt so fühlen muss. Nadja hält die Luft an, als der Mann ihr den Arm auf den Rücken dreht und sie vor sich her über die Straße schubst. Sie stolpert, vornübergebeugt. Für immer gebeugt.
Er reißt die Hecktüren ihres weißen Vans auf. Nadja sieht, wie er ein paar Kabelbinder aus der Tasche seiner Windjacke zieht. Als er sie an ihren Handgelenk festzurrt, wird ihr klar, dass sie einem langsamen Tod entgegensieht.
Dann stößt er sie in den Laderaum. Dumpf schlägt sie auf dem Boden auf, ihr Mund weit geöffnet wie zu einem Schrei aus dem tiefsten Abgrund der Angst.
Aber er bleibt völlig stumm. Kein Laut dringt aus ihrem Mund. Über ihre Schulter, durch die Fenster, beobachtet Nadja, wie der Mann zum Beifahrersitz des Autos geht. Er hält inne. Sieht etwas, was sich mehrere Meter über dem Boden zu befinden scheint. Er hebt sein weinrotes Käppi leicht an. Zielt.
Nicht.
Zielt nicht. Schießt einfach nur.
Schräg nach oben.
Ganz kurz regnen Glassplitter von einer Kamera herunter, die an einer Straßenlaterne montiert war. Dann fährt der Mann davon.
Niemand singt im Laderaum des Vans.
Niemand wird jemals wieder singen.
Der Singvogel ist verstummt.
6
Sam Berger saß auf dem Steg vorm Bootshaus. Obwohl er nur einen einzigen Whisky getrunken hatte, breitete sich eine ganz spezielle Ruhe in seinem Körper aus. Doch die hatte nicht im Geringsten mit dem Whisky zu tun. Sie hatte mit einem Blick zu tun. Intelligent, einfühlsam, lebendig. Diese Brille, die geheimnisvollerweise auf der Stirn sitzen blieb, kurz unter einem blonden, von Grau durchzogenen Haaransatz. Und dann dieser Blick. Als ob sie ihn wirklich verstehen würde. Lesen, interpretieren, akzeptieren, verstehen. Es war kein mütterlicher Blick, ganz im Gegenteil, eher der alles erfassende Blick einer älteren, klügeren Frau mit mehr Lebenserfahrung.
Er hatte gesagt: »Ich habe viel an das Kind gedacht, ja.« Dann hatte er nicht weitersprechen können.
Die Dinge waren ihm völlig entglitten. Wirklich völlig. Aus dem kleinen Taschentuchball wurden mehrere, noch fester zusammengeknüllte. Aber trockene.
Rita Ohlén hatte abgewartet, großes Mitgefühl gezeigt, ein wenig in ihrem Terminkalender geblättert und dann gesagt: »Tatsächlich hätte ich morgen Nachmittag noch eine Lücke.«
Jetzt war der Abend nach dieser Lücke. Berger ließ den Blick über die spiegelglatte Fläche des Edsviken gleiten. Seine Schönheit war überwältigend.
Er hatte nicht vorgehabt, hierher zurückzukommen. Das Bootshaus sollte sein Arbeitsplatz sein, und er hätte eigentlich wieder in die Ploggatan auf Södermalm ziehen und dann ins Büro gehen sollen wie ein ganz normaler Mensch. Den Job hinter sich lassen.
Das war nicht passiert. Er begriff, dass er erst am Anfang einer langen Entwicklung stand, bei der die Psychologin Rita Ohlén eine große und wichtige Rolle spielen würde. Das Bootshaus war immer noch sein Zuhause. Hier würde er bleiben, bis er wieder in der Lage war, Leben und Job zu trennen.
Der Job, der sein Leben war. Der Job, den er kaum hatte. Was wiederum ziemlich viel über sein Leben aussagte.
Berger seufzte tief – aber ohne dass die Ruhe ihm abhandengekommen wäre – und streckte den Arm nach seinem Laptop aus. Er klappte ihn auf, sah eine offene Mail und starrte auf den Anhang. Eine Filmdatei.
Rita Ohlén hatte ihm von Anfang an klargemacht, dass sie mit »unorthodoxen Methoden« arbeitete, und schon heute Nachmittag hatte sie ihn gefilmt. Als er am Bootshaus ankam, wartete der Film bereits in seinem Postfach.
Er hatte ihn nicht angeschaut. Hatte stattdessen versucht zu verstehen, wer er war. In Wirklichkeit. In seinem eigenen Leben, im Leben anderer, in der Geschichte, in der Ewigkeit. Egal, welche Perspektive er wählte, es kam nie viel dabei heraus. Ein marginales Dasein. Eine Randfigur. Sogar in seinem eigenen Leben.
Irgendwie hatten die beiden Sitzungen mit Rita Ohlén dazu beigetragen, dass er sein Leben nun aus dieser Perspektive betrachtete. Und das hatte ihm die Ruhe gegeben, die er jetzt auf dem Bootssteg immer noch genoss. Auch beim Anblick des ungesehenen Videos.
Sam Berger musste die Hauptperson in seinem eigenen Leben werden. Es lohnte nicht, sich zu schonen. Also beugte er sich vor und klickte zweimal auf den Film.
Irgendwie landete er am Ende der Aufzeichnung. Er sah sich selbst auf dem Sessel in Rita Ohléns Büro sitzen. Sie war nicht im Bild. Und der Ton war ausgestellt. Alles, was er sah, waren mindestens fünfzehn kleine Papierkügelchen auf dem Tisch vor einem immer unbekannteren Mann, dessen Mund sich für ein paar Sekunden lautlos bewegte, bevor sich sein Gesicht verzog und er sich über seine Knie beugte.
Er drückte auf Pause. Das Seltsame war, dass ihm in diesem Augenblick nur zwei Dinge durch den Kopf gingen: Erstens freute er sich darüber, dass das, was in seinem Haar grau geworden war, wieder den alten Braunton angenommen hatte, zweitens stellte er befriedigt fest, dass da nicht eine Spur von Glatze zu entdecken war.
Dann überlegte er, was Rita Ohlén wohl zu diesen beiden Gedanken gesagt hätte. Der Schauer eines paradox behaglichen Unbehagens überkam ihn, und er spulte zurück zum Anfang des Films, wo sich Sam Berger in den Sessel setzte und dünn lächelte. Vor ihm lagen noch keine Papierkügelchen auf dem Tisch, nur eine Box Papiertaschentücher.
Er schaltete jetzt doch den Ton ein und hörte Rita Ohléns sanfte Stimme fragen: »Haben Sie rund um Ihr Bootshaus Überwachungskameras angebracht, Sam?«
Er sah, wie ihm die Kinnlade herunterklappte.
»Wovon reden Sie da?«, fragte er schließlich.