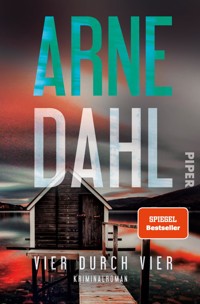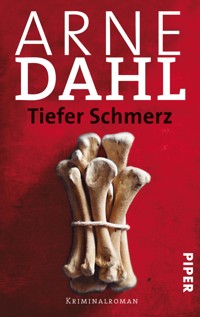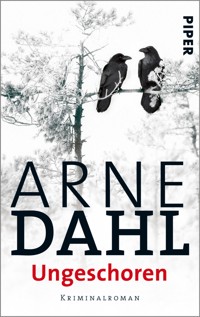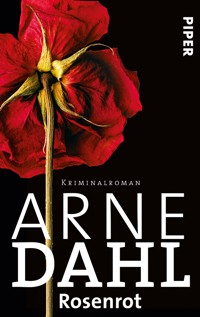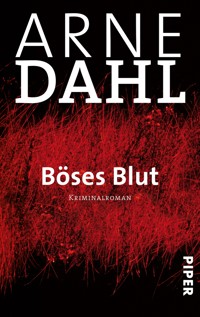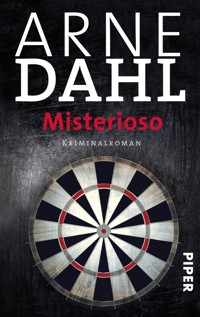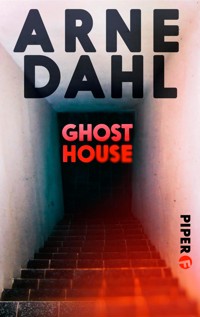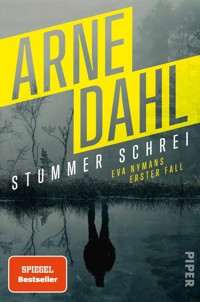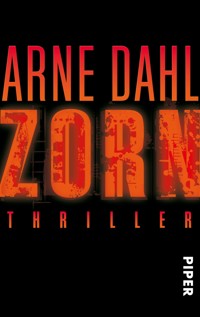8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Rachefeldzug gegen den Chefermittler oder die Verschwörung eines unsichtbaren Gegners? Erschüttert betrachtet Paul Hjelm die verzweifelte Videobotschaft zweier seiner Ermittler. Zeitgleich detoniert in der Wohnung seiner Kollegin Donatella Bruni eine heimtückische Paketbombe - ein tragischer Zufall? Nein, Paul Hjelm ist überzeugt davon, dass die Verbrechen ganz gezielt ausgeführt werden: Jemand muss ihn und seine geheime Opcop-Gruppe enttarnt haben. Wer aber könnte ein Motiv besitzen, sie zerschlagen zu wollen? Hjelm lässt in verdeckten Zweierteams rund um den Globus ermitteln und spürt ein schwedisches Biotech-Labor auf, das an der Manipulation des menschlichen Körpers Milliarden verdienen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Kerstin Schöps
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Sista paret ut« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
ISBN 978-3-492-96908-6
Oktober 2016
© Arne Dahl 2014
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
1 – Das erste aktivierte Paar
Raubtier I
Tuamotu-Inseln, 2. Mai
Ein Fleck auf der Sonne. Damit fing alles an.
Damit begann auch die Zeitrechnung. Genau in diesem Augenblick.
Davor war lange keine Zeit vorhanden gewesen. Sie befand sich an einem Ort, an dem die Zeit nicht mehr existierte. Sie hätte die Fältchen in ihren Augenwinkeln zählen können, wenn es einen Spiegel gegeben hätte, dessen Oberfläche sich nicht ständig bewegte. Aber das Meer lag niemals ganz still da, und das Einzige, was auf der Insel verboten war, waren Spiegel.
Obwohl, richtig verboten waren sie nicht. Eher unerwünscht. Und alles, was unerwünscht war, wurde entfernt. Das war das Einzige, was sie für ihn tun konnte. Das war sie ihm schuldig.
Es war auch ein Ort, an dem man sich schnell auf die Nerven gehen konnte. Das war am Anfang auch häufig der Fall gewesen, aber jetzt nicht mehr. Nicht, seit sie ganz allein auf der Insel waren. Seitdem war er ihr Leben und sie seines.
Und da die Entsalzungsanlage jetzt funktionierte, waren sie Selbstversorger. Teiki kam immer seltener mit seinem Auslegerboot und hatte noch seltener Grundnahrungsmittel dabei. Am Anfang war viel los gewesen auf der Insel, die gesamte Energie galt der Errichtung der Gebäude und Konstruktionen, und Teiki hatte Solarzellen, Elektronik, Kabel, Sonnensegel, Baumaterial, Werkzeug, Taucherausrüstungen, Eimer mit Sonnenschutz, Angelutensilien – und Fleisch geliefert.
Fleisch hatte sie am meisten vermisst. In kürzester Zeit hatten sie zwar eine kleine Hühnerfarm aufgebaut, aber Schwein, Rind und Kalb blieben Mangelware, ihre Nahrung bestand zu fünfundneunzig Prozent aus Fisch.
Fleisch war genau genommen das Einzige, was Teiki nach wie vor lieferte. Fleisch und Wein. Industriestaatenüberfluss. Teiki kam ungefähr jede zweite Woche, vielleicht sogar noch seltener, sie wusste es nicht genau, Zeit existierte ja nicht. Das Fleisch hielt sich in der kleinen Tiefkühltruhe ein paar Wochen; sie war nach wie vor darüber erstaunt, dass man Wärme in Kälte umwandeln konnte. Oder was auch immer passierte, wenn die Solarzellen die Kühltruhe betrieben.
Die Solarzellen waren hinter einem Tarnnetz verborgen, das zwischen den Kokospalmen und ihrem kleinen Stück Land gespannt worden war. Auf dem kargen und sandigen Boden wuchs nicht viel, aber was erst einmal Wurzeln geschlagen hatte, wurde nicht nur sehr groß, sondern gedieh auch das ganze Jahr über. Es gab Bananen, Apfelsinen, Yamswurzeln, Wasserwurzeln und Brotfruchtbäume. Ihr war es sogar gelungen, eine Tomatenstaude zu ziehen. Italienische Flaschentomaten. Sie pflegte sie mit großem Aufwand. Sie ersetzten das Kind, das sie niemals bekommen würde. Pomodori.
Ansonsten gab es nur Fisch. Fisch, Fisch und nochmals Fisch. Fische, deren Namen sie in keiner der Sprachen kannte, die sie beherrschte. Fische in allen Farben des Regenbogens. Fische, die aussahen, als wären sie Albträumen entstiegen.
Während sie ihren Blick über das Fischerboot schweifen ließ – das zwar primitiv, aber dennoch robust und funktionell war, trotz seines selbst gezimmerten Rumpfs –, stieg in ihr der Gedanke auf, dass heute ein Fleischtag war. Heute Abend musste es unbedingt Fleisch geben. Irgendetwas würde doch noch in der Tiefkühltruhe zu finden sein.
Wie viel Zeit war seit Teikis letztem Besuch vergangen? Wein hatten sie schon eine ganze Weile nicht mehr, das einzige Rauschmittel, das ihnen noch zur Verfügung stand, war dieser ekelhafte Palmwein, den Teiki mit großer Beharrlichkeit den Palmen abpresste. Nein, sie brauchte heute richtigen Wein. Europäischen. Am liebsten italienischen. Barolo. Und dazu Fleisch. Kalb. Vitello.
Teiki, wo bleibst du?
Der Wein wurde in Pappkartons transportiert, das Fleisch in Plastik eingeschweißt, und dann bekamen sie noch diese Eimer geliefert. Die Eimer mit den Ködern. Sie hatte einmal zugesehen, als er einen der Eimer geöffnet hatte. Um zu fischen, benötigte man natürlich auch Unmengen von Ködern, aber mussten die in Blut baden? Es plätscherte in den Eimern, ein dunkles Plätschern, und der Inhalt erinnerte an die blutgetränkten Eingeweide von Säugetieren.
Die Köder sahen eher aus, als könnte man damit größere Raubtiere fangen als nur Fische. Aber es funktionierte, denn jedes Mal, wenn er mit dem primitiven Boot zurückkehrte, hatte er etwas gefangen. Viel zu viel Fisch. Er behauptete zwar, dass er sich mit Fischen auskennen würde, die genießbaren von den ungenießbaren unterscheiden könne, die geschmackvollen von den giftigen. Und doch dachte sie immer, wenn sie am Strand hockte und die Fische ausnahm und filetierte, unweigerlich an den Mondfisch. Sie dachte an den Fugu, sie dachte an ein Nervengift, das tausendfach stärker war als Cyanid, sie dachte an Tetrodotoxin.
Aber die Speisen schmeckten immer köstlich, und wenn er ab und zu mit einem Thunfisch zurückkam, dann erkannte auch sie, dass die unappetitlichen Köder doch ihren Zweck erfüllten. Aber ihr war es ein Rätsel, wie er den Kontakt mit den Haien vermied.
Denn es war ein Haigewässer. Jeden Morgen machte er sich auf den Weg mit dem schmalen selbst gebauten Boot aus instabilem Palmenholz und hatte einen Eimer mit blutigen Eingeweiden dabei. Und doch wurde er kein einziges Mal von Haien angegriffen. Was am Anfang ein Mysterium gewesen war, war im Lauf der Zeit Alltag geworden. Ein Alltag im Stillstand. Ein Alltag ohne Zeit.
Ein Leben ohne Zeit.
Bis heute.
Sie saß unten am Strand in einem Sonnenstuhl aus Treibholz und spielte mit ihren Zehen im Wasser. Sie trug einen Bikini, war sorgfältig mit Sonnenschutzmittel eingecremt und blickte in den Himmel hinauf, an dem die unendliche Sonne hing. Keine einzige Wolke war zu sehen. Dies hier war das Paradies. Aber die Sonne hatte einen Fleck.
Und damit begann alles.
Sie bemerkte den Sonnenfleck und musste an eine Sonnenfinsternis denken. Gab es nicht ganz unterschiedliche Varianten einer Sonnenfinsternis? Auch kleinere?
Einen Sonnenfleck?
Plötzlich stand er hinter ihr. Sie hatte die beherrschte, aber unmissverständliche Tonlage seiner Stimme schon lange nicht mehr gehört. Darum horchte sie augenblicklich auf, als er sagte: »Raubtier. Jetzt.«
Sie warf ihm einen schnellen Blick zu. Er stand reglos da und sah in den Himmel. Es dauerte eine Sekunde, bis das Codewort zu ihr durchgedrungen war. Aber als er sie anlächelte und bestätigend nickte, stürzte sie sich augenblicklich in das türkisfarbene Meer.
Raubtier, das Wort wanderte durch ihren Kopf, während sie immer tiefer tauchte. Sie wusste nach wie vor nicht, was damit gemeint war.
Sie erreichte das Korallenriff, ein blaugrünes Universum aus sonderbaren fingerartigen Strukturen, die von farbenfrohen Fischschwärmen durchzogen waren, deren zuckende Bewegungen ganz eigenen physikalischen Regeln folgten.
Sie fand ihren Weg durch das Korallenriff. Zumindest glaubte sie das. Sie orientierte sich an den äußeren Kanten der Kalkformationen, verdeckt von den bunten Fischschwärmen. Irgendwo musste sie sein, die Grotte, sie musste hier ganz in der Nähe liegen. Ihr ging langsam die Luft aus.
Nein, das stimmte ja gar nicht. Die Grotte befand sich noch tiefer unten. Sie versuchte, sich zu orientieren. Sie wusste, dass der Sauerstoff in den Lungen meist viel länger reichte, als man dachte. Es war alles eine Frage der Einstellung. Also riss sie sich zusammen. Mahnte sich zur Ruhe. Sie wedelte einen Schwarm kleiner, fröhlicher blaugelber Fische beiseite und tauchte tiefer.
Schließlich entdeckte sie eine bekannte Korallenstruktur. Und nur wenige Meter links davon musste der Grotteneingang sein. Sie glitt an einer großen Koralle vorbei und sah tatsächlich nur unweit davon den dunklen Schatten des Eingangs. Es handelte sich um jene Art von Hohlraum, die sie bei einem normalen Tauchgang wie die Pest gemieden hätte. Aber das hier war kein normaler Tauchgang.
Ein schwaches Licht fiel auf die beiden Sauerstoffflaschen, die mit einem Metallband an der Korallenformation befestigt waren. Die zwei Tauchermasken und Mundstücke schwebten schwerfällig im Wasser wie schwarze Seeanemonen.
Hastig zog sie sich eine Maske über das Gesicht, legte den Kopf in den Nacken, lockerte den unteren Rand der Taucherbrille und blies Luft durch die Nase. Maskenleerung, dachte sie. Danach drückte sie die Maske fest aufs Gesicht, drehte das Luftventil auf und nahm einen ersten Atemzug.
Das fühlte sich göttlich an, das Leben wurde förmlich in sie hineingesogen. Sie löste die Taschenlampe, die mit starken Magneten auf der Rückseite der Flasche befestigt war, und leuchtete die Grotte ab. Nach und nach normalisierte sich ihre Atmung.
Raubtier, dachte sie erneut. Das war das Codewort für den sofortigen Aufbruch. Was hatte er entdeckt?
In diesem Augenblick wurde das Korallenriff vollkommen unerwartet von den Detonationen erschüttert. Zweimal in schneller Abfolge. Das zuvor klare türkisfarbene Wasser war jetzt bräunlich. Die Bodensedimente wurden aufgewirbelt und hatten das Wasser so eingetrübt, dass sie kaum mehr den Eingang der Grotte ausmachen konnte. Sie war umringt von kleinen Fischen, die von Panik gepackt um sie herumschossen.
Sie rührte sich nicht von der Stelle, sondern versuchte sich in eiskalter Gelassenheit. Sie wartete ab, bis der Lichtkegel der Taschenlampe wieder weiter als einen halben Meter reichte. Langsam sanken die Sedimente zurück auf den Meeresboden, die türkisfarbene Klarheit kehrte zurück. Auch der Eingang der Grotte wurde wieder sichtbar. Alle Fische hatten den Weg heraus gefunden, und sie konnte wieder ohne Schwierigkeiten den Luftdruckmesser ablesen. Sie würde noch für mehrere Stunden Luft haben.
Sie verharrte noch eine Weile dort. Dann erst löste sie die Sauerstoffflasche aus ihrer Befestigung und schnallte sie sich um. Sie nahm auch die zweite Flasche und Tauchermaske.
Raubtier, das Wort tauchte wieder in ihrem Kopf auf, und ein eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken. Ein eiskalter Schauer der Angst.
Dann machte sie sich auf den Weg.
*
Raubtier, schoss es ihm durch den Kopf, während er unverwandt in den Himmel starrte. Das Codewort für den sofortigen Aufbruch. Aber nicht nur das.
Er blickte aufs Wasser. Von ihr waren nur noch ein paar Luftblasen an der Oberfläche zu sehen. Es müsste gut gehen.
Dieser Teil sollte zumindest gut gehen.
Und dann gab es natürlich noch seinen Auftrag hier.
Erneut hob er den Kopf und sah zur Sonne hoch. Der Fleck war größer geworden. Er schärfte sein Bewusstsein, formte es zu einer Pfeilspitze der Entschlossenheit. Bereitschaft. Geistesgegenwart. Aber nicht nur das allein. Er rechnete. Er zählte die Sekunden.
Es konnte sich nur um das eine handeln. Das Raubtier. Die Drohne MQ-1 Predator.
Immerhin war es nicht der Sensenmann, der MQ-9 Reaper. Denn sonst würden sie unter Garantie sterben.
Als der Fleck auf der Sonne sichtbar geworden war, hatte er gewusst, dass es das Raubtier war und sie wenigstens eine geringe Chance hatten. Diese Drohne war ein älteres Modell der Remotely Piloted Aircraft, RPA. Sie war mit dem Höllenfeuer ausgerüstet, zwei lasergesteuerten Luft-Boden-Raketen, den AGM-114 Hellfires.
Er wartete. Der Fleck war längst kein Fleck mehr, er nahm Form an. Die Form eines Flugzeugs. Er wartete, bis er sicher war, dass der Pilot in der Bodenstation auf der anderen Seite des Globus ihn gesehen hatte. Das unbemannte Flugzeug zitterte in der Luft, als würde es sich ab jetzt voll und ganz auf ihn konzentrieren.
Dann rannte er los.
Er war zwar barfuß, aber er rannte so schnell, dass der glühend heiße, korallenweiße Sand ihn nicht verbrannte. Er lief zwischen den verlassenen Bungalows hindurch in Richtung Hühnerstall. Jetzt befand er sich auf freiem Feld. Er war sichtbar. Ein Blick über die Schulter sagte ihm, dass die Drohne deutlich größer geworden war. Näherte sie sich nicht viel zu schnell?
Er ließ den Hühnerstall und die Entsalzungsanlage hinter sich und näherte sich den Palmen und dem kleinen Acker mit den Solarzellen. Aber kurz davor bog er ab und stürmte auf ein Gebüsch zu. Ein zweiter Blick verriet ihm, dass die Drohne ebenfalls den Kurs gewechselt hatte. Und dass sie sehr nah war.
Er erreichte das Gebüsch. Hinter ein paar hochgewachsenen Pandanusbäumen kauerten Gestalten. Er warf sich hinter die buschigen Pflanzen und griff gleichzeitig nach einem Seil, das in dem sandigen Boden verborgen war. Auf dem Bauch liegend, hob er den Kopf und sah in den Himmel. Das Raubtier war gefährlich nahe. Die Drohne korrigierte ein letztes Mal ihre Flugrichtung. Die Raketen saßen am Rumpf der Maschine.
Zwei Sekunden, sagte er sich. Das digitale Signal von der Bodenstation zur Drohne hat eine Verzögerung von zwei Sekunden.
Er zerrte an dem Seil, stemmte die schwere Luke im Sandboden hoch und sprang in die Öffnung. Die Luke schlug über seinem Kopf zu, und er konnte gerade noch die Handflächen auf seine Ohren pressen. Denn unmittelbar danach waren zwei ohrenbetäubende Detonationen zu hören, die sein unterirdisches Versteck erschütterten. An den Rändern der Panzerluke rieselte feiner Sand zu Boden.
Auf allen vieren kroch er zum Kommandostand vor, packte den Joystick und fing die Drohne in dem Moment mit der Kamera ein, als diese einige Hundert Meter von der Insel entfernt abdrehte. Er arretierte den Sucher und ignorierte den Blutstropfen, der auf die Tastatur fiel und den Buchstaben »S« traf. Das Raubtier hatte gewendet und kam wieder zurück. Er hörte, wie die Drohne über seinen Standort flog, und sah sie in niedriger Flughöhe an der Kamera vorbeischweben, die im Wipfel der höchsten Kokospalme angebracht war. Als das Flugzeug ein drittes Mal herankam, flog es deutlich langsamer als zuvor, als würde es alles genau in Augenschein nehmen. Dann drehte es ein paar Kreise über der Insel.
Erst danach verschwand das Raubtier. Offensichtlich zufriedengestellt.
Bald war die Drohne wieder nichts weiter als ein Fleck auf der Sonne.
Sie hatte das Höllenfeuer gelegt.
Er spulte die Aufnahmen zurück. Eine der fest installierten Kameras war auf die Pandanusbäume gerichtet. Nichts rührte sich. Hinter ein paar hochgewachsenen Bäumen konnte er zwei kauernde Gestalten ausmachen. Er wechselte zu einer anderen Kamera. Diese war oben auf dem Hühnerstall montiert. Sie filmte ebenfalls die Pandanusbaumgruppe, nur von hinten. In dieser Einstellung war zu erkennen, dass die beiden Gestalten nur Puppen waren.
Kauernde, lebensechte Schaufensterpuppen.
Zeitgleich mit seinem Erscheinen in der Kameraaufzeichnung wurde auch die Drohne im oberen linken Bildrand sichtbar. Während er sich dabei beobachtete, wie er sich hinter das Gebüsch warf und exakt zwei Sekunden wartete, während die Drohne immer näher kam, wurden ihm zwei Dinge klar. Zum einen stellte er fest, dass die Puppen überzeugend echt und lebendig aussahen. Zum anderen hatte er registriert, dass noch alles vorhanden war. In ihm. Er war geistesgegenwärtig genug gewesen, ebendiese zwei Sekunden zu warten, um bestätigt zu bekommen, dass die Raketen justiert wurden. Das deutete darauf hin, dass seine Fähigkeiten mitnichten so eingerostet waren, wie er es gehofft hatte. Es war paradox. Um durchzukommen, benötigte er diese unversehrte Geistesgegenwart. Aber um wirklich zu überleben, musste er sie eliminieren.
Als die Sequenz kam, in der er nach dem Seil griff und sich dann in die Luke warf, hielt er den Film an und tauschte ihn aus. Den neuen Film spulte er vor, bis das mitlaufende Datum von vorgestern auf gestern gesprungen war. Zum frühen Morgen des gestrigen Tages. Er wusste zwar noch gut, dass er die beiden Hohlkörper gefüllt hatte, aber dennoch wollte er es zur Sicherheit noch einmal überprüfen. Die Sonne hatte gerade den Horizont erklommen, als er im Bild auftauchte. Er trug einen weißen Eimer in der Hand und näherte sich den Pandanusgewächsen. Dann packte er den Hals der einen kauernden Puppe und schraubte ihr den Kopf ab. Nachdem er den Deckel des Eimers entfernt hatte, goss er die mit Bröckchen durchsetzte rote Flüssigkeit in den offenen Hals der Puppe. Danach brachte er den Kopf wieder an, richtete die langhaarige Perücke und wiederholte die Prozedur mit der zweiten, kurzhaarigen Puppe.
Ihm gefiel es nicht, dass er ihr nicht die Wahrheit gesagt hatte. Aber wem nützte es, wenn sie sich Sorgen machte? Sie ging davon aus, dass die Figuren sein Hobby wären und in den Eimern Fischköder.
Erneut tauschte er den Film aus und ließ die aktuellsten Aufnahmen weiterlaufen. Er sah, wie er das Seil packte, die Luke aufriss und sich in den Schutzraum fallen ließ. Zwei Raketen schlugen praktisch direkt dort ein, wo er zwei Sekunden zuvor auf dem Boden gelegen hatte. Das Höllenfeuer.
Die Raketen hatten die Puppen getroffen. Zwei Volltreffer. Die Drohne schoss an der Kamera vorbei und verschwand aus dem Bild.
Er spulte zurück und ließ die Sequenz noch einmal in Zeitlupe laufen. Erst jetzt konnte er den Weg der Raketen verfolgen, bis diese die Brustkörbe der Puppen durchschlugen. Die Puppen wurden in ihre Einzelteile zerlegt. Zwei rote Wolken stoben mit geradezu unheimlicher Lautlosigkeit aus dem Gebüsch und legten sich als rote, eiförmige Flächen auf den korallenweißen Sand. Vereinzelt erkannte er Teile von Eingeweiden in all dem Roten.
Das Raubtier drehte eine Kurve und kehrte zurück. Sondierte die Oberfläche. Befand das Ergebnis für gut. Befand, dass die beiden Zielobjekte perfekt von den Raketen getroffen worden waren. Dann kehrte es, nach erfüllter Mission, zur Bodenstation zurück.
Er schloss die Augen und dachte kurz nach. Die Drohne war die einzige Möglichkeit für sie gewesen, ihm auf die Spur zu kommen – aus genau dieser Richtung. Darauf hatte er sich minutiös vorbereitet. Dass sie den MQ-1 Predator eingesetzt hatten statt den weitaus moderneren MQ-9 Reaper, sprach dafür, dass ihre Ressourcen dann doch begrenzt waren. Dann war wohl doch nicht das Militär hinter ihnen her, und daher war es durchaus möglich, dass sie doch nicht satellitenüberwacht wurden. Und ihre Verfolger würden eine Weile brauchen, um die Aufnahmen der Drohne zu sichten und zu analysieren.
Auf den ersten Blick würde der Film ihn zeigen, wie er ins Gebüsch hechtete, um sich zu verstecken. Dort wartete bereits die zweite Person, die unsinnigerweise hinter einem Pandanusbaum kauerte. Und es würde aussehen, als wären sie beide ausgelöscht worden.
Aber es würde einen zweiten Blick auf die Aufnahmen geben. Je früher sie sich auf den Weg machten, desto besser.
Er sah sich im Inneren des Schutzraumes um. Hier befanden sich all die Dinge, die ihm Teiki heimlich bei Nacht gebracht hatte. Waffen. Computer. Alarmsysteme. Nichts davon würden sie benötigen. Nichts davon würde sie verraten können. Zumindest nicht in dem Zustand, in dem die anderen die Sachen vorfinden würden.
Alles, was er wirklich benötigte, befand sich im Cyberspace. Das Einzige, was er mitnahm, waren zwei Paar Schwimmflossen, ein größeres und ein kleineres, sowie eine Rettungsfolie. Er beugte sich über die Tatstatur und sah den Blutfleck auf dem »S«, der sich bereits über seine Nachbarn, das »W« und das »X«, ausgebreitet hatte. Er berührte seine Ohren. Aus beiden tropfte Blut. Er war sich nicht sicher, wie geschädigt sein Gehör war. Und er wusste auch nicht, ob das Blut nicht die Haie anlocken würde. Er zerriss ein Stück Stoff, stopfte es sich in beide Ohrmuscheln und beugte sich erneut über die Tastatur. Auf dem Monitor klickte er eine Digitaluhr an und stellte 10:00 ein. Dann startete er das Zählwerk. 09:59 und los.
Er wickelte sich in die Rettungsfolie ein, sodass sie ihn vollkommen bedeckte, drückte die Panzerluke auf, verschloss sie wieder hinter sich und schlich auf der anderen Seite der Bucht hinunter zum Strand. Die ersten Meter lief er über geronnenes, verbranntes Blut, dann hatte er das Wasser erreicht. Er zog die Schwimmflossen an und ließ die Folie erst los, als er abtauchte. Ein paar Minuten lang dümpelte sie auf der Wasseroberfläche, dann versank auch sie und verschwand.
Er tauchte hinunter zu den großen roten Korallen. Als er sie in der Grotte warten sah, spürte er, wie sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Er streckte ihr die Schwimmflossen hin, nahm die Tauchermaske und leerte sie, bevor endlich die Luft aus der Sauerstoffflasche seine brennenden Lungen erlöste. Sie blickten sich an. Er nickte und zeigte ihr die Richtung, weg von der Insel.
Sie schwammen und schwammen immer weiter. Nur weg. Dann warf er einen Blick auf die Uhr und gab ihr ein Zeichen. Er zeigte zur Wasseroberfläche, und sie stiegen auf.
Oben lagen sie auf dem Rücken und ließen sich treiben, ihre Blicke waren auf die Insel gerichtet. Ihre Insel.
Die in Flammen aufging. Die Bungalows, der Hühnerstall, ihr Acker, die Entsalzungsanlage, die Kokospalmen.
Ihre pomodori.
Alles stand in Flammen, es war ein besonderer, fast klarer Feuerschein. Und beinahe lautlos.
Sie sah ihn an und fragte: »Wer war das?«
Er schüttelte den Kopf.
»Keine Ahnung. Unbekannt.«
»Wir könnten ihn X nennen«, schlug sie vor.
Er lachte trocken und sah ihr hinterher, als sie wieder abtauchte.
»X«, wiederholte er.
So einfach.
X.
Dann folgte er ihr.
Sie waren das erste aktivierte Paar.
Gustaf Horn
Stockholm, 20. Juli
Man könnte meinen, dass die beiden Landspitzen der zwei größten Inseln von Stockholm sprachhistorisch miteinander verbunden wären. Zumal der äußere westliche Teil von Södermalm seit dem Mittelalter »Horn« genannt wurde. Der Name bezieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die spitze Form dieser westlichen Landzunge. Und als dort Mitte des 17. Jahrhunderts eine Zollstelle errichtet wurde, hieß sie selbstverständlich Hornstull. Die Namensgebung von Hornsberg auf Kungsholmen hingegen ging auf Gustaf Horn zurück, einen der bedeutendsten schwedischen Feldherren im Dreißigjährigen Krieg. Zeitgleich mit der Zollstelle Hornstull entstand auch Hornsberg auf Kungsholmen, eine Art Schloss, aber wohl eher ein Malmgård, die innerstädtische Variante der Herrenhäuser des 17. Jahrhunderts.
In der Zeit der Großmächte im 17. Jahrhundert dämmerte bald auch dem kleinen Land Schweden, dass es zu internationaler Bedeutung aufgestiegen war. Und besagter Gustaf Horn war nicht nur der Held der Schlacht bei Breitenfeld gewesen, die den Dreißigjährigen Krieg zugunsten der Protestanten entschieden hatte, sondern war auch in Lützen zugegen, als der damalige König Gustaf II. Adolf auf dem Schlachtfeld im Nebel umkam. Nach dem Tod des Königs wurde Horn zum Oberbefehlshaber ernannt, wurde aber kurz darauf in der Schlacht bei Nördlingen gefangen genommen und saß dann acht Jahre in Bayern in Kriegsgefangenschaft. Als er nach Schweden zurückkehrte, hatte sein Schwiegervater, Axel Oxenstierna, sein Land fast ein Jahrzehnt lang mit eiserner Hand regiert. Während Gustaf Horn einen Feldzug im Krieg gegen Dänemark anführte – den man später »Horns Krieg« nannte –, wurde die Thronfolgerin endlich mündig. Das neue Staatsoberhaupt war tatsächlich eine Frau, und Königin Kristina bezog bei ihrem Amtsantritt gleich Position und verteilte staatliches Land an ihre Günstlinge. Gustaf Horn bekam ein großzügiges Stück Land im Westen von Kungsholmen. Dort ließ er sich einen eleganten Hof mit einem erlesenen Garten nach dem Vorbild des Riddarhuset errichten, das damals das Versammlungshaus des Adels in der Altstadt von Stockholm gewesen war. Das Anwesen wurde später nach seinem Besitzer Hornsberg genannt.
Ein Problem stellte lediglich dar, dass Gustaf Horn viele solcher Anwesen besaß und bereits kurz nach der Fertigstellung von Hornsberg starb. Das Gebäude verfiel, und die Gartenanlage wurde anderweitig genutzt. Carl von Linné studierte ihren Artenreichtum, und Carl Michael Bellman schrieb mehrere Lieder über Hornsberg, aber das Anwesen verrottete. Eine Textilfabrik wurde darauf errichtet, die später zu einer Zuckerraffinerie umfunktioniert wurde, und Ende des 19. Jahrhunderts wurden die verbleibenden Gebäude abgerissen. Nicht etwa, um Licht und Luft zu schaffen, vielmehr um der Großen Brauerei genügend Platz zu bieten. Bier war zum Hauptgetränk der Stadtbevölkerung geworden und wurde in beeindruckenden Mengen gebraut. Bei der Produktion entstanden Nebenerzeugnisse und Abfallprodukte, Vitamin B und Enzyme. Das war der Anfang der Veränderung von Hornsberg hin zu einem Standort für die Biotechnologie.
Die Biotechnologie ist im Großen und Ganzen das Einzige, was erhalten blieb, als vor einigen Jahrzehnten dieses verfallene Industriegebiet rundum erneuert wurde. Heute ist Hornsberg ein herausgeputztes Stadtviertel für den jungen urbanen Mittelstand. Und in seinem Zentrum befinden sich mehrere biotechnologische Unternehmen.
Eines davon ist die Bionovia AB. Und dort saß in den wegen der Sommerferien praktisch menschenleeren Büroräumen, mit Aussicht auf den Ulvsundasjön, ein junger Mann ganz allein in einem Computerraum mit zwanzig PCs und Monitoren. Dieser junge Mann, der sich von anderen jungen Männern in nichts unterschied, hieß Gustaf Horn.
Aus Mangel an Arbeit hatte er im Internet eine Seite über seinen Namensvetter aus dem 17. Jahrhundert aufgerufen. Aber soweit er das bisher ermitteln konnte, bestand keinerlei Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihm und dem Feldherrn. Als er sich um den Sommerjob beworben hatte, war er davon ausgegangen, dass er andauernd mit seinem Namen aufgezogen werden würde. Das Sonderbare war jedoch, dass niemand eine Bemerkung machte. Keiner seiner temporären Kollegen schien auch nur das Geringste über Gustaf Horn oder die Zeit der Großmächte zu wissen. Aber das störte ihn nicht weiter. Allerdings hätte er ganz gerne mit irgendjemandem gequatscht, doch nicht einmal der Abteilungsleiter hatte sich für etwas anderes interessiert als seinen Golfurlaub auf Ibiza. Gustaf Horn hatte gar nicht gewusst, dass es auf Ibiza Golfplätze gab. Für ihn war Ibiza vielmehr die Insel mit den weltweit meisten Geschlechtskrankheiten pro Kopf. Obwohl sich Golf und Geschlechtskrankheiten vielleicht gar nicht widersprachen.
Aber Geschlechtskrankheiten waren in Gustaf Horns momentanem Leben nicht relevant. Er war zweiundzwanzig, hatte das erste Jahr seines Studiums zum Systemanalytiker an der Universität beendet, hatte Semesterferien und war Single. Der Sommerjob in der IT-Abteilung von Bionovia hatte sich wie ein Traumjob angehört, und in gewisser Hinsicht war er das auch. In seinem Lebenslauf würde er sich sehr gut machen. Aber der Posten war leider unendlich langweilig. Gustaf Horn hatte keine direkten Kollegen, saß allein in diesem Raum, und seine einzige Aufgabe bestand darin, »den Datenverkehr zu überwachen«. Die Instruktionen, wie das vonstattengehen sollte, waren allerdings alles andere als ausführlich gewesen. Dafür war er quasi allein verantwortlich.
Die Bionovia AB war ein relativ junges Unternehmen im biotechnologischen Bereich, und ihr Sitz hatte sich in Lichtgeschwindigkeit von Räumen in einer Bürogemeinschaft zu einer eigenen Firmenzentrale in einem glänzenden Neubau am Hornsbergs strand gemausert. Die Firma war spezialisiert auf die Interaktion der verschiedenen Moleküle und Systeme in einer Zelle, sowohl in der Nanopartikel-Molekularforschung als auch in der Proteinforschung. Hier wurden unter anderem auf Plasmabasis hergestellte Proteinarzneimittel hergestellt. Das war Gustaf Horns Wissensstand, aber immer wenn er sich das in Erinnerung rief, klang es in seinen Ohren, als würde er es auswendig aufsagen. Eigentlich hatte er keine Ahnung, was das alles bedeutete. Er war ein echter Computernerd und stolz darauf.
Es war Hochsommer. Er vermied den Blick auf das glitzernde Wasser, wo die Hausboote am anderen Ufer neben dem Strandrestaurant Pampas dümpelten. Aber mittlerweile langweilten ihn die Geschichten über die bewegte Vergangenheit von Hornsberg, seinen Namensvetter aus dem 17. Jahrhundert und Bellmans Gedichte. Er hatte versucht, im Tagebuch von Gustaf Horns Tochter Agneta zu lesen. Es galt als das wichtigste Zeugnis schwedischer autobiografischer Texte des 17. Jahrhunderts und hatte den umwerfenden Titel Die Beschreibung meiner bejammernswerten und äußerst abscheulichen Wanderjahre sowie aller meiner großen Unglücke und großen Herzenssorgen und Abscheulichkeiten, die mir derweil unzählige Male begegnet sind, von meiner frühsten Kindheit an, und wie Gott mir stets geholfen hat, mit viel Geduld alle diese Abscheulichkeiten zu überstehen. Aber nach einer Weile hatte ihn auch das gelangweilt. Und Computerspiele konnte er hier nicht öffnen, dafür hätte er sich einloggen müssen.
Er starrte auf den Monitor. Zog die Maus an der verschlüsselten Liste nach oben und nach unten. Den Datenverkehr der vergangenen Woche hatte er bereits überprüft, und besonders viel Neues war seitdem ganz offensichtlich nicht geschehen. Es war Ende Juli, und da herrschte Flaute in der Biotechnologiebranche. In Ermangelung einer besseren Idee begann er, sich durch das vergangene halbe Jahr der Aufzeichnungen zu scrollen. Auch das war im höchsten Maße langweilig. Er würde diese Tätigkeit sofort gegen jede erdenkliche Geschlechtskrankheit tauschen. Natürlich nur unter der Bedingung, sich mit dieser Krankheit auch auf eine angemessene Weise angesteckt zu haben.
Diese Listen bestanden hauptsächlich aus Posten. Jeder einzelne bezeichnete eine Cyberaktivität zwischen Bionovia und der Außenwelt. Die Reihen von Buchstaben und Ziffern verrieten, bis zu welchem Sicherheitsniveau der anfragende Computer vorgedrungen war, was wiederum – in Echtzeit oder im Nachhinein – mit verschiedenen Listen abgeglichen wurde, die aus zertifizierten und identifizierten Codes bestanden. Je höher das Sicherheitsniveau war, desto kürzer und umfangreicher wurde die Liste der Zugangsberechtigten. Um in das höchste Niveau zu kommen – das »Niveau acht« genannt wurde und in dem Bionovia seine vertraulichsten Unternehmensgeheimnisse versteckte –, war es erforderlich, einen lückenlos dokumentierten Suchpfad vorzulegen. Bereits auf Niveau fünf wurde schon bei der geringsten Unstimmigkeit der Alarm ausgelöst, dabei handelte es sich da meistens nur um einfache Formen von trojanischen Pferden und falsch benutzte Eingabemasken. Aber auch auf Niveau sechs und sieben kam es zu vereinzelten Versuchen, sich etwa über Tastaturspione Zugang zu verschaffen. Laut dem Abteilungsleiter – dem Ibiza-Golfer, an dessen Namen er sich nicht erinnern konnte – war der schwerwiegendste Angriff vonseiten einer neuen Sorte von Spyware gekommen, die vor etwa einem halben Jahr auf Niveau acht herumgeschnüffelt habe. Allerdings war damals jeder erdenkliche Alarm im Haus losgegangen und der Eindringling schnell identifiziert worden: ein vierzehnjähriger russischer Hacker, der mittlerweile in einer Jugendstrafanstalt saß.
Gustaf Horn konzentrierte sich jetzt auf Niveau acht. Die Listen waren mehrfach kontrolliert und bereits archiviert worden. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass andere als die sehr beschränkte Anzahl von Befugten dort eingedrungen waren. Er blätterte durch die Reihen von bereits kontrollierten Ziffern und Buchstaben, überprüfte jedes noch so kleine Zeichen, und ganz plötzlich hatte er das Gefühl, als hätte jemand in ihm einen Schalter umgelegt.
Gustaf Horn hatte sich zeit seines bewussten Lebens mit Computern beschäftigt. Er gehörte zu jener Gruppe von jungen Männern, die sich in ihrer Kindheit und Jugend nur äußerst selten im Freien aufhielten. Statt die sozialen Codes zu erlernen, war er ein Experte in Computercodes geworden. Und sein Umgang mit diesen Codes war mindestens so subtil und nuanciert wie das Vermögen anderer Menschen im sozialen Umgang miteinander. Von außen betrachtet ging es nur um digitale Logik, Einsen und Nullen – und doch war das Entdecken eines Musters für ihn jedes Mal wie ein Mysterium.
Und was er jetzt vor sich sah, war ein solches Muster. Aber es würde zweifellos sehr schwer werden, diesen Umstand zu erklären. Und das ließ ihn zögern. Er wollte niemanden anrufen, er hatte eine ganze Liste von Argumenten, die dagegensprachen. Aber er war gezwungen, es zu tun. Dieses Muster verlangte, dass er sich über seine Sozialphobie hinwegsetzte.
Gustaf Horn öffnete das Skype-Fenster auf seinem Rechner und holte einmal tief Luft. Dann rief er an.
Verschwommene Bewegungen tauchten auf dem Monitor auf, und es dauerte einen Augenblick, ehe er begriff, was sein Chef in der Hand hielt. Es war ein Vierer-Eisen. Die Sonne schien auf den hellgrünen, kurz geschnittenen Rasen, und der Abteilungsleiter schob sich die Sonnenbrille auf die Stirn und starrte überrascht auf sein Handy.
»Horn?«, sagte er mit einer Skepsis in der Stimme, die Gustaf Horn unter normalen Umständen den Boden unter den Füßen weggerissen hätte. Ihn vernichtet hätte. Aber diese Umstände waren alles andere als normal.
Mit erstaunlicher Leichtigkeit entgegnete Gustaf Horn: »Herr Jägerskiöld. Können wir ungestört reden?«
Die Augen in dem sonnenverbrannten Gesicht blinzelten ein paarmal angestrengt, bevor im Hintergrund ein paar Sätze auf Englisch gewechselt wurden und das Bild gewaltig zu tanzen begann. Nach einer Weile wurde es schattig, wahrscheinlich hatte er sich unter eine Palme gestellt.
»In Ihrem eigenen Interesse sollte es sich um etwas Wichtiges handeln, Horn«, zischte der Mann mit der verbrannten Lederhaut.
»Ich bin mir ganz sicher, dass Bionovia in den letzten sechs Monaten mindestens drei Hackerangriffen ausgesetzt war«, sagte Gustaf Horn.
Jägerskiöld setzte sich offenbar.
»Niveau?«, fragte er, allerdings klang es nicht wie eine Frage.
»Ich hätte mich nicht gemeldet, wenn es sich nicht um Niveau acht handeln würde.«
»Und wenn Sie ›ganz sicher‹ sagen, dann meinen Sie also ...?«
»Ganz sicher.«
Jägerskiöld drehte sein Handy, und Horn hatte fünf Sekunden lang nur die Wurzeln der Palme vor Augen, die sich wurmgleich umeinanderwanden. Dann kam sein Chef zurück in den Bildausschnitt und fragte: »In den letzten sechs Monaten, sagen Sie? Sie müssen entschuldigen, wenn ich so skeptisch klinge, aber wie sollen die unser Sicherheitssystem überwunden haben?«
»Die haben sich sehr clever getarnt«, antwortete Gustaf Horn. »Der Eindringling hat die Identität vorheriger Besucher angenommen. Erst wenn man die Pfade zurückverfolgt, entstehen Diskrepanzen, und die ergeben ein Muster.«
»Aber Sie haben keine Anzeichen von Spyware gefunden?«
»Nein, damit kommt das Programm allein zurecht. Es scheint sich um sporadische Angriffe zu handeln. Eindringen in den Sicherheitsbereich, kopieren, ausloggen. Und es hat nie länger als eine halbe Stunde gedauert. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen.«
Jägerskiöld nickte. Er nickte eine ganze Weile, bis er sagte: »Wenn wir unseren Geschäftsführer in seinem Urlaub auf Ornö stören sollen, dann müssen Sie mir garantieren, dass Sie sich nicht geirrt haben. Garantieren!«
»Ich verstehe«, erwiderte Gustaf Horn und begriff, um was es hier ging.
Sein oder Nichtsein. Weiterzuarbeiten oder nie wieder im ganzen Leben in dieser Branche einen Job zu finden.
»Und?«
»Ich garantiere es.«
»Bleiben Sie dran.«
Gustaf Horn wartete, die abrupte Stille löste eine erneute Unsicherheit in ihm aus. Hat er ein bisschen überreagiert? Hätte er nicht zur Sicherheit noch einmal alles überprüfen sollen? Das Bild auf dem Monitor zitterte und zuckte, und dann tauchte ein zweites Gesicht auf.
Gustaf war Hannes Grönlund, dem Geschäftsführer von Bionovia, bisher nicht persönlich begegnet. Es überraschte ihn, dass der Mann so jung aussah. Er trug einen Hipsterbart und ein T-Shirt, dessen Aufdruck verkündete: My shirt is more ironic than yours. Er saß an Deck eines Bootes, hatte einen blauen Drink in der Hand, und im Hintergrund erkannte Gustaf einen gigantischen schwarzen Außenbordmotor mit mindestens dreihundertfünfzig PS.
»Nein, Peder«, sagte er gerade und nippte an seinem Drink. »Das hatten wir so nicht vereinbart.«
»Höhere Gewalt«, entgegnete Jägerskiöld von dem Videofenster direkt daneben.
Hannes Grönlund stellte seinen Drink beiseite, wedelte ungehalten mit der Hand und verschwand dann aus dem Bild. Nur der klarblaue Himmel war zu sehen. Dann kehrte sein Gesicht zurück, und er sagte: »Leg los.«
»Es gab in den letzten sechs Monaten mindestens drei unentdeckte Zugriffe auf Niveau acht.«
»Sagt wer?«
»Die Sommeraushilfe«, antwortete Peder Jägerskiöld.
»Eine Sommeraushilfe in der IT-Abteilung?«
»Ja. Er ist dem Gespräch zugeschaltet.«
Gustaf Horn spürte, wie sich der Blick des Mannes auf dem oberen rechten Videofenster in ihn bohrte.
»Gustaf Horn mein Name«, stellte er sich vor.
»Und was haben Sie entdeckt?«, fragte Hannes Grönlund knapp.
»Ein Eindringen, wie schon gesagt, aber sehr clever getarnt.«
»Gibt es Anzeichen, von wo?«
»Nein, ich habe so etwas noch nie gesehen. Mir ist nur das Muster aufgefallen. Drei verschiedene Rechner mit Zugangsberechtigung hatten sich eingeloggt – ganz gewöhnliche längere Benutzereinheiten –, aber denen folgten jeweils drei kurze. Und offensichtlich von dem jeweiligen Rechner. Und einer davon ist – ja – Ihrer.«
»Ihrer? Unserer?«
»Ihrer.«
»Meiner?«
»Am 4. März hat sich Hannes Grönlund auf Niveau acht eingeloggt, für zwei Stunden und vierzehn Minuten. Vier Minuten später hat sich derselbe Rechner erneut eingeloggt, dieses Mal nur für zweiundzwanzig Minuten. Als hätten Sie einfach nur eine Kleinigkeit vergessen und würden Ihre Unterlagen vervollständigen. Und dasselbe Muster – auch mit vierminütigem Abstand – wiederholt sich noch an zwei weiteren Stellen.«
»Wie bitte?«, fragte Hannes Grönlund. »Da greift sich jemand die Identität und die Zugangsdaten von demjenigen ab, der gerade eingeloggt war?«
»Ganz genau«, bestätigte Gustaf Horn. »Allerdings scheint das stattzufinden, während derjenige eingeloggt ist. Dann wartet er, bis der Nutzer sich wieder ausloggt, nimmt seine Identität und loggt sich wieder ein. Vier Minuten später.«
»Was zum Teufel ist da los!«, schrie Grönlund auf. »Peder!«
Im linken Videofenster räusperte sich der Sicherheitschef Peder Jägerskiöld. Er hatte nach wie vor seinen Golfschläger in der Hand, diesen aber umgedreht und sein Kinn auf den Schlagkopf gestützt.
»Muster«, wiederholte er nach einer Weile. »Unglaublich gute Arbeit von Gustaf Horn, aber, Hannes, wir müssen jetzt über andere Muster sprechen.«
»Vollkommen richtig«, sagte Hannes Grönlund, »sehr gut beobachtet, Gustaf. Wir werden uns in Kürze darüber unterhalten. Aber Sie dürfen diesen Zwischenfall unter keinen Umständen einem Dritten gegenüber erwähnen. Ich hoffe, das verstehen Sie?«
»Das verstehe ich«, antwortete Gustaf Horn.
»Sehr gut. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen, wie wir damit weiter verfahren. Kannst du Gustafs Fenster schließen, Peder?«
»Selbstverständlich«, sagte Jägerskiöld.
Die Inhalte der Videofenster verschwanden vom Monitor. Eigentlich hätte auch die Tonspur verstummen müssen.
Aber das tat sie nicht. Jägerskiöld musste es versäumt haben, sie abzuschalten. Zu Beginn der darauffolgenden Unterhaltung erwog Gustaf kurz, ob er selbst den Ton ausstellen sollte. Aus Gründen der Diskretion. Aber er tat es nicht. Er hörte zu.
»Und so etwas kann also eine Sommeraushilfe bemerken, Peder?«
»Das ist einerseits sehr unglücklich«, erwiderte Jägerskiöld. »Aber andererseits auch wieder nicht.«
»Und inwiefern, bitte?«
»Na, diese Information ist doch quasi tabu. Wenn dieser Jüngling jemals wieder einen Job in der IT-Branche haben will, dann muss er die Klappe halten. Das hat er kapiert.«
»Wie sind die reingekommen?«
»Keine Ahnung. Ich werde mich sofort darum kümmern.«
»Nach dieser Golfrunde?«
»Natürlich nicht. Ich werde mir umgehend eine sichere Verbindung besorgen.«
»Ich wette, es sind die Chinesen«, sagte Grönlund.
»Vermutlich. Der fünfzigste Versuch, oder? Könnte es das Projekt Myo sein?«
»Das liegt auf Niveau acht. Natürlich besteht das Risiko. Aber du hast gesagt, du könntest es schützen.«
»Verdammt«, brüllte Jägerskiöld. »Ihr hättet es auch besser sichern müssen. Aufteilen. Das habe ich ja versucht, euch zu erklären.«
»Du bist nicht wirklich in der Position, mir Vorwürfe zu machen, Peder. Es ist immerhin dein Sicherheitssystem, das hier versagt hat. Aber es ist mein Projekt, das wahrscheinlich gestohlen wurde. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was wir in dieses Projekt Myo investiert haben?«
»Mir ist durchaus bewusst, was da passiert ist.«
»Und wie sieht dein nächster Schritt aus?«
Der Sicherheitschef Jägerskiöld seufzte laut und entgegnete dann: »Tja, wenn es wirklich die Chinesen sind, weiß ich nicht, ob meine Kontakte weit genug reichen.«
»Du kannst doch nicht im Ernst vorschlagen, dass wir uns an die wenden sollen ...«
»Nein, nein, nein, verdammt. So schlimm ist es nicht. Aber ...«
»Aber?«
»Aber unsere Auftragnehmer können uns diesen Teil der Welt nicht vorbehaltlos garantieren.«
»Warum bezahlen wir sie dann?«
»Weil sie die Besten sind. Aber die Chinesen ...«
»Polizei?«
»Nein, ich kümmere mich darum. Wir müssten schnell herausbekommen können, ob es ... ja, ob es das Militär ist.«
»Zwei Tage, Peder. Nicht mehr. Dann gehe ich zur Polizei.«
»Ich habe verstanden«, sagte Peder Jägerskiöld.
Dann verschwanden auch die beiden leeren Videofenster vom Bildschirm in Hornsberg. Gustaf Horn starrte auf den blanken Monitor. Lange saß er so da, bis er den Blick hob und über den Ulvsundasjön gleiten ließ. Und plötzlich befand er sich im Schloss von Hornsberg. Die Königin hatte ihm das Land geschenkt, und er hatte den renommierten Architekten Jean de la Vallée gewonnen, um eine Kopie des Riddarhuset im Westen von Kungsholmen zu errichten. Er saß im obersten Stock seines Schlosses und blickte über die glitzernden Wogen. Für einen sehr kurzen Augenblick war er der Herrscher von Stockholm.
Hornsberg ist mein, dachte Gustaf Horn.
Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Rechner zu.
Los Indignados
Madrid, 23. Juli
Es hätte ihn nicht weiter überraschen sollen. Er hatte alles darüber gelesen, es seit Mitte Mai aufmerksam verfolgt. Aber dann war sein Universum tief erschüttert worden. Seine Welt war von einer Liga verschluckt worden, die alle Bettler in ganz Europa kontrollierte. Danach hatten mehrere Rippen daran glauben müssen, als er einer fliegenden Glaskugel hinterhersprang, in der ein Höllenzeug schwappte, und schließlich war sein blinder Sohn auf ihm herumgehüpft und hatte ihm den Rest gegeben.
Lange Rede, kurzer Sinn, Felipe Navarro war krankgeschrieben und verbrachte diese Zeit in seiner Heimatstadt Madrid. Die Dämmerung brach herein – auf der Puerta del Sol, dem großen Marktplatz in der Mitte von Madrid, Spaniens Nabel –, und die Demonstrationszüge drängten aus allen Teilen des Landes in die Stadt.
Es hätte ihn nicht weiter überraschen sollen, aber die Kraft, die Entschlossenheit und die Energie waren überwältigend. Und trotzdem galten seine Gedanken einer anderen Sache. Am Tag zuvor hatte eine dunkle und kranke Version dieser Kraft, Entschlossenheit und Energie ein zuvor verschontes Land im Norden Europas heimgesucht. Ein ideologisch vollkommen gestörter Norweger hatte in und außerhalb von Oslo eine bislang unbekannte Anzahl von Menschen ausgelöscht, hauptsächlich Jugendliche. Und diese dunkle Energie hatte die gesamte mediale Aufmerksamkeit von der hellen Energie abgezogen.
Und die helle Energie war hier. Hier in Spanien.
Die Leute in diesem Land hatten die Nase voll. Die Arbeitslosigkeit war die höchste in ganz Europa, die Finanzkrise hatte das Land härter getroffen als andere, und ununterbrochen wurden neue phantasievolle Korruptionsfälle in den höchsten politischen Ebenen aufgedeckt. Die Liste ließ sich beliebig ergänzen, und Felipe Navarro musste – aus der Distanz – mitansehen, wie sein Land verfiel.
Doch jetzt war diese Distanz aufgehoben. Er hatte Den Haag verlassen und war zum ersten Mal seit Jahren wieder in seine Heimatstadt geflogen. Was ihm dort entgegenschlug, war der Schmerz. Er war auf der Straße zu spüren. Schmerz darüber, nach Jahrzehnten der Diktatur keine richtige Ordnung in der politischen Landschaft geschaffen zu haben. Darüber, dass die empfindliche, noch junge Demokratie in die Hände von Leuten geraten war, die sich nur bereichern wollten.
Dieser Schmerz war am Ende explodiert. Inspiriert vom Arabischen Frühling, entstand in Spanien die digitale Plattform ¡Democracia Real YA! in den verschiedenen sozialen Netzwerken. Ihre Parole lautete »Echte Demokratie JETZT!«, und mittels Twitter und Facebook hatte die Organisation in fünfzig spanischen Städten zur Demonstration am 15. Mai aufgerufen. So wurde die Bewegung Movimiento 15-M geboren. Die Bewegung 15. Mai.
Allein in Madrid nahmen daran über fünfzigtausend Demonstranten teil, und auf der Puerta del Sol beschlossen »die Empörten« – Los Indignados –, bis zur nächsten Wahl in einer Woche den Platz zu besetzen. Im ganzen Land herrschte Aufbruchstimmung, und die Demonstrationen fanden in Dutzenden Städten statt.
Mit der Zeit entschieden sich die Menschen, ein Protestkunstwerk zu schaffen, einen Demonstrationszug von Menschen aus sechzehn Städten, ähnlich einem achtarmigen Tintenfisch, der an ein und demselben Tag aus allen Ecken des Landes gleichzeitig auf der Puerta del Sol eintreffen sollte. Dieses Datum war der 23. Juli.
Heute.
Und gerade als Felipe und Felipa Navarro zusammen mit Félix im Kinderwagen an der Puerta del Sol saßen und in dem magischen Licht kurz vor der Abenddämmerung einen Kaffee tranken – in diesem Augenblick kamen sie an. Langsam, aber beständig erreichte der Sternmarsch sein Zentrum, das Zentrum, von dem aus alle Wege ins Land führten.
Die Puerta del Sol.
Nach dem einmonatigen Zug sahen die Wanderer des »Volksmarsches der Empörten« ziemlich erschöpft aus. Und dennoch ging von ihnen eine Kraft aus wie von Siegern eines Marathonlaufs. Der Körper war am Ende, aber die Seele unüberwindbar.
Als sich die Familie Navarro in das Café gesetzt hatte, war der Platz fast menschenleer gewesen. Plötzlich aber strömten die Leute von überall her, und während die Dämmerung hereinbrach, wurden gigantische Banderolen in den Himmel gehoben, und die Menschen versammelten sich unter den Worten »Bienvenida la dignidad«.
Willkommen, Würde.
Felipe und Felipa Navarrro sahen sich an. Sie saßen auf diesem Platz und hatten beide gleichzeitig das Gefühl, in Madrid angekommen zu sein. In Spanien. Zu Hause.
Ihr Sohn Félix war zum ersten Mal hier, doch es war auch sein Heimatland. Aber seitdem hatte sich sein Verhalten verändert. Félix war von Geburt an blind, knapp ein Jahr alt und hatte außer seine Eltern bisher noch niemanden Spanisch sprechen hören. Und jetzt war alles anders. Plötzlich war seine Welt erfüllt von diesen vertrauten Geräuschen. Plötzlich hörte er überall seine Muttersprache – die er selbst noch gar nicht beherrschte. Es war sehr interessant, ihn dabei zu beobachten.
Obwohl das natürlich nicht das richtige Wort war. Es war vielmehr herzzerreißend, ergreifend und tief berührend.
Felipe Navarro sah zu, wie sein blinder Sohn nach Hause kam.
Es war unmöglich, sich zu unterhalten. Denn jetzt war alles Sprache. Die Sprechchöre, die am Anfang noch vereinzelt und schwach zu hören gewesen waren, wurden immer lauter und einheitlicher. Es ging um Menschenwürde und Demokratie, um Gemeinschaft und die Chance, eine gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Und das alles auf Spanisch. Felipe beobachtete seinen Sohn, er versuchte zu begreifen, was Félix hörte. Wie er diese plötzliche Flut seiner Muttersprache wahrnahm. Sein Mund war geöffnet, als würde er die Sprache durch sich hindurchfließen lassen, ohne dass sie in seinem Körper auf Widerstand träfe. Aber allmählich überstieg der Geräuschpegel die Schmerzgrenze. Zumindest für einen blinden Einjährigen.
Felipa Navarro gab ihrem Mann ein Zeichen. Er sah es zwar, aber die Stimme, die ihre Geste unterstreichen sollte, konnte er nicht hören. Aber dennoch verstand er sie. Es galt, den Ort so schnell wie möglich zu verlassen, bevor es für Félix zu viel wurde. Aber ihre Geste hatte noch eine zweite Bedeutung. Offenbar wollte sie, dass er blieb. Dass sie ihren Sohn nach Hause zu der Großmutter bringen würde, wo sie unter zunehmend klaustrophobischen Umständen die Nächte verbrachten, und er auf dem Platz blieb.
Felipa stand auf, packte den Kinderwagen und verschwand. Er sah den beiden hinterher, wie sie in eine Seitenstraße einbogen und versuchten, die Menschenmassen hinter sich zu lassen. Sie waren in Sicherheit.
Auch Felipe Navarro konnte nicht auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Ihr Cafébesuch war durch den Aufmarsch der Demonstranten beendet worden. Sofort wurde sein Stuhl von der Menge davongetragen bis in die Mitte des Platzes, auf dem das Denkmal mit dem Madrider Stadtwappen stand, der Bär am Erdbeerbaum. Auch Felipe wurde in diese Richtung geschoben. Ihn zog es magisch in das Zentrum des Sternmarsches. Dort fand eine Art Besprechung stand, die Arme des Tintenfisches konferierten nach ihrer einmonatigen Wanderung, und die Erfahrungen aus sechzehn spanischen Städten wurden ausgetauscht. Navarro beobachtete es, er hörte Schlagwörter wie »El libro del pueblo« und begriff, dass die Teilnehmer vorhatten, ein »Buch des Volkes« zusammenzustellen. Aber der Großteil der Menschenmenge interessierte sich dafür nicht besonders, weder für das Buch des Volkes noch für das Zentrum des Tintenfisches. Sie wollten zusammensitzen, ausruhen und vielleicht ein bisschen Schlaf finden. Navarro war in einem Strom von Menschen gefangen, der ihn förmlich vom Platz trug, bis er im Osten die große Hauptstraße Paseo del Prado erreichte, wo provisorische Lager für die Tausenden und Abertausenden von Demonstranten errichtet worden waren. Ihm wurde ein Platz auf einem Feldbett angeboten, den er höflich dankend ablehnte. Eines der Lager befand sich in der Nähe des Nationalmuseums Prado. Dort hockte er sich hin und kam endlich ein bisschen zur Ruhe. Als er seinen Blick über die unendlichen Reihen von Feldbetten und Schlafunterlagen gleiten ließ, auf die Jung wie Alt erschöpft niedersanken, wurde ihm erst bewusst, dass ihn die Menschenmasse fast einen Kilometer weit geschoben hatte. Da bekam er zum ersten Mal ein Gefühl für die Macht des Volkes. Die Kraft der Massen.
Und in dem Augenblick sah er den Mann, der nicht ins Bild passte.
Natürlich waren die Demonstranten eine heterogene Gruppe, sie entstammten jenen Teilen der Bevölkerung Spaniens, die am härtesten von der Finanzkrise getroffen worden waren. Unter ihnen waren Universitätsprofessoren und Gymnasiasten, Ärzte und einfache Arbeiter, Ingenieure und Krankenschwestern. Aber dieser Mann, der sich da von Schlafplatz zu Schlafplatz schlich, gehörte vom Typ her nicht dazu. Gerade hatte er sich neben einen jungen rothaarigen Mann gehockt und unterhielt sich mit ihm. Es sah sogar so aus, als würden sie etwas austauschen, und danach machte sich der Mann im Anzug Notizen auf einem kleinen Block.
Felipes erster Eindruck war, dass es sich bei dem Mann um einen Polizisten in Zivil handelte. Das war bei Demonstrationen auch nicht weiter ungewöhnlich. Sie wurden zwar nicht verdeckt eingesetzt, um Organisationen zu infiltrieren, sondern es ging vielmehr darum, eine möglicherweise kritische Situation im Vorfeld zu erkennen und einschätzen zu können. Aber irgendetwas stimmte da nicht. Felipe hatte sich aufgerichtet und wollte sich dem Kollegen nähern und ihn ansprechen, doch im letzten Augenblick zögerte er. Mit dem Mann stimmte etwas nicht.
Aber dieser zuvor geduckt herumschleichende Mann, dessen Gesicht wegen der zunehmenden Dämmerung kaum zu erkennen war, war auch keiner dieser Kleinkriminellen, die solche Menschenansammlungen dazu nutzten, ihre Finger in Taschen und Jacken wandern zu lassen. Doch er war auch definitiv kein Demonstrant und schon gar kein Polizist. Kein echter.
Er stand noch immer im regen Austausch mit dem Rothaarigen. Etwas hatte den Besitzer gewechselt, es waren Notizen gemacht worden.
Eigentlich sollte Felipe Navarro sich umsehen und die Stadt seiner Jugend in sich aufnehmen, sein Madrid, und diese Stimmung genießen, die er schon so lange nicht mehr erlebt hatte. Diese plötzliche, urgewaltige Flut an Optimismus, diese Bewegungsabläufe potenzieller Veränderungen.
Aber im Moment reagierte nicht der Landsmann in ihm auf die Situation, sondern der Polizist. Und der Polizist beobachtete den Mann in der Hocke und konnte ihn nicht einordnen. Der Polizist sollte im besten Fall die rationale Hälfte von Felipe Navarro einnehmen, der Optimist die andere, irrationale Hälfte. Aber es war Instinkt. Der Mann hatte sich erhoben und lief die Straße hinunter, und bevor Navarro seine Entscheidung reflektieren konnte, hatte er die Verfolgung bereits aufgenommen.
Sein Anzug war viel zu fein für einen Zivilpolizisten, und auch die Schuhe waren zu teuer. Der Mann erinnerte Navarro an einen Leibwächter, so wie er sich durch die Menschenmenge auf dem Paseo del Prado zwängte. An einen amerikanischen Bodyguard, einen Agenten vom Secret Service, der Staatsmänner bewacht und immer eine Sonnenbrille trägt. Dieser trug zwar keine Sonnenbrille, und er bewachte gerade niemanden, so wie er sich fortbewegte. Und dennoch, er hatte im Lager eindeutig ein bestimmtes Ziel verfolgt.
Felipe Navarro ging den Paseo del Prado hinunter hinter ihm her und bog dann in eine sehr schmale Straße ein, die anmutete, als wäre sie eine breite, baumbestandene Allee. Während Felipe den Gutgekleideten nicht aus den Augen ließ, schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, was wohl passieren würde, wenn die Laubbäume auf der Calle de las Huertas weiterwachsen würden. Die Häuser würden erdrückt werden.
Die Verfolgung war einfach. Der Mann ragte gut zehn Zentimeter aus der Menge heraus. Der fast kahle Kopf bewegte sich wie eine losgerissene Boje in dem Menschenmeer. Je weiter sie sich vom Paseo del Prado entfernten, desto weniger Menschen waren auf den Straßen unterwegs. Es wurde immer leichter, sich fortzubewegen, aber auch leichter, entdeckt zu werden. Navarro war zwar überhaupt nicht wie ein Polizist angezogen – kein Polizist mit einem Mindestmaß an Selbstachtung würde Shorts mit so überdimensioniertem Blumenmuster tragen –, aber er wusste sehr gut, dass sein Verhalten diesen Eindruck vermitteln konnte.
Die Straße wurde breiter, bis sie sich zu einem kleinen Platz öffnete, einem kleinen Stadtviertelmarktplatz. Der Mann überquerte die Plaza Ángel und ging dann eine große breite Straße hinauf bis zur riesigen Plaza Mayor, die merkwürdig menschenleer war. Aber sie war gesäumt von Restaurants, die Tische waren voll besetzt mit Menschen, die über ¡Democracia Real YA!, Movimiento 15-M und Los Indignados diskutierten.
Der Gutgekleidete überquerte die Plaza Mayor in einer sauberen Diagonale. Als er hinter der nächsten Häuserecke und in den Gassen der Altstadt verschwand, rannte Felipe los. Er wusste nach wie vor nicht, was für ein Ziel er hatte. Eigentlich war er nicht der Typ Mensch, der seiner Intuition folgte, auf sein Bauchgefühl hörte. Daher redete er sich ein, dass seinem Verhalten rationale Einschätzungen zugrunde lagen, keine eindeutigen, aber dennoch rationale. Als der Mann jedoch hinter einer weiteren Ecke verschwand, spürte Navarro das Adrenalin in seinem Körper. Und gleichzeitig tauchte in ihm die Frage auf, wie das funktionierte. Warum wurde plötzlich Adrenalin in den Körper gespült und führte dazu, dass er sich auf einmal ganz anders verhielt?
Als der Gutgekleidete eine Karte aus der Jackentasche zog, eine Schlüsselkarte, und sie durch ein Lesegerät an einer vollkommen unauffälligen Tür zog, jagte die nächste Dosis Adrenalin durch Felipes Blut. Der Mann beugte sich vor und starrte scheinbar die Wand an. Danach verschwand er in dem Gebäude.
Es war ein sehr altes Gebäude in einem der ältesten Viertel der Stadt auf dem Hochplateau, die Anfang des 17. Jahrhunderts zu ihrer größten Überraschung zum Zentrum der einflussreichsten Kolonialmacht der Welt geworden war. Felipe Navarro schlich näher heran, und je geringer die Entfernung zu der Eingangstür wurde, desto deutlicher erkannte er, dass dieses Haus einer Festung glich.
Vielleicht nicht buchstäblich einer Festung, aber einem sehr gut bewachten Gebäude. Über der Tür entdeckte er ein paar Löcher im Mauerwerk, die dort nicht hingehörten, und als er an dem Haus vorbeischlenderte – so unauffällig wie möglich –, begriff er, warum sich der Mann vorgebeugt hatte. Auf den ersten Blick hatte es so gewirkt, als habe ein extrem Kurzsichtiger versucht, das Schild über der Klingel zu entziffern. Aber das war nicht der Grund. Navarro kannte das Gerät nicht, aber er wusste, was es war. Und es war nicht das Einzige, was sein betont unbeschwerter Blick erfasste. Er konnte auch einen Firmennamen lesen. Polemos Seguridad S. A. Dann setzte er seinen Weg fort. Die Kameraaufzeichnungen von dem Mann mit den Blumenshorts würden niemals einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Denn das verbarg sich in den Löchern an der Hauswand: Überwachungskameras. Und das Gerät, vor das der Mann sein Gesicht gehalten hatte, war entweder ein Irislesegerät oder ein Netzhautlesegerät.
Auf seinem Rückweg zur Plaza Mayor gingen Felipe folgende Fragen durch den Kopf: Warum mischte sich ein Mann im Maßanzug, der bei einer professionell bewachten Sicherheitsfirma namens Polemos Seguridad S. A. arbeitete, unter die Demonstranten, die einen einmonatigen Protestmarsch aus unterschiedlichen spanischen Städten hinter sich hatten?
Felipe Navarro blieb abrupt stehen, lehnte sich gegen eine der Mauern aus dem Mittelalter und versuchte, sich an das Geschehen zu erinnern. Er sah die vielen Feldbetten vor sich und einen rothaarigen jungen Mann. Dann stürmte er los.
Er rannte durch die kleinen Gassen, über die Plaza Ángel und durch eine weitaus stärker bevölkerte Calle de las Huertas. Das provisorische Lager aus Feldbetten war noch voller als zuvor. Erneut schob Navarro sich durch die Menschenmenge, es war nicht einfach, sich zurechtzufinden, aber er hatte den Prado als Orientierungspunkt. Nachdem er eine Weile zwischen den Betten umhergeirrt war, hatte er entdeckt, was er suchte. Auf der Pritsche, neben der der Gutgekleidete gehockt hatte, lag eine Gestalt mit einem Kapuzenpulli. Felipe ging ebenfalls in die Hocke. Die Gestalt auf dem Feldbett drehte sich zu ihm um, und er sah in das überraschte Gesicht einer alten Frau. Erschrocken sprang er auf, entschuldigte sich und setzte seinen Weg zwischen den wahllos aufgestellten Betten fort. Erst als einer der Demonstranten ihm »Scheißbulle« hinterherrief, blieb Felipe Navarro endlich stehen.
Er wusste nach wie vor nicht, welches Ziel er verfolgte.
Aber er wusste, dass es wichtig war.
Cimitero del Verano
Rom, 24. Juli
Es gab nichts beizusetzen. Der Inhalt des Sarges, der würdevoll durch das majestätische Portal des Cimitero del Verano transportiert wurde, bestand kaum aus Überresten. Es waren nur vereinzelte Zellen, mühsam zusammengekratzte DNA-Ketten.
Rom steuerte einen besonders heißen Sommertag bei, seine Fassaden leuchteten. Ein paar unermüdliche Tauben gurrten apathisch, und der Leichenwagen wurde von Sonnenreflexen überzogen, als er durch das mächtige Mittelportal fuhr.
Paul Hjelm saß in seinem Wagen, folgte mit den anderen Fahrzeugen der Prozession und schwitzte. Sein Blick wanderte auf den Rücksitz, auf dem mehrere Leute saßen. Sie sahen alle sehr mitgenommen aus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!