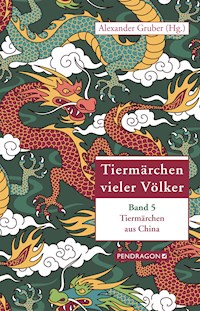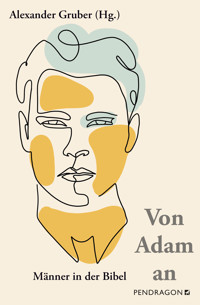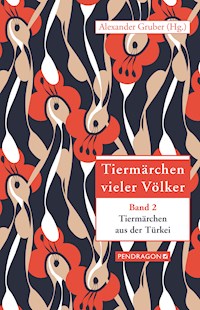Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Tiere in den hier versammelten vietnamesischen Märchen, dem 6. Band unserer Reihe »Tiermärchen vieler Völker«, lösen keinen großen Schrecken aus. Warum? Hier gehören sie ins Ganze der Welt. Sie treten ein für einen Menschen, der sie als Lebewesen gleichen Rechts behandelt hat. Sie tun es, auch wenn sich so oft zeigt, dass die Menschen die weitaus Schlimmeren sein können. Die vietnamesischen Volkserzählungen sind oft witzig und knüpfen gern an bekannte Lieder, Sprüche oder Kinderspiele an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Gruber (Hg.) · Tiermärchen vieler Völker
Tiermärchen vieler Völker
Band 6:
Tiermärchen aus Vietnam
Herausgegeben, neu erzählt und mit einem Vor- und Nachwort versehen von Alexander Gruber
H. B. gewidmet, der auch vom Krankenbett aus geholfen hat.
Inhalt
Vorwort
Der Rabe und der Pfau
Specht und Eule
Der Krebs aus Gold
Katze bleibt Katze
Der Bauer wird zum Star
Der Freund der Fliegen
Neun Büffel und ein kluger Knabe
Wenn der Gong einmal ertönt
Der Fischer, des Fischers Frau und der Mönch
Eine Brautwahl
Der Herr Zaunkönig und das Fräulein Amsel
Eine Freite mit Star
Was die Amsel sang
Ein Pferd, schnell wie der Wind, aber nicht …
Wildenten kaufen
Biene und Maus gehn voraus
Ein König über Völker
Holzwürmer, Termiten und andere Schädlinge
Der Wildbüffel redet, der Hausbüffel antwortet
Der Knecht und die Perle des Raben
Die Gans der Tochter des Kaisers von China
Vom Ursprung der Familie Yang
Vom Schlangenmann und seiner Frau
Ein guter Tausch
Hühnerklein
Die Pferdebraut
Der Knabe mit dem Eisen
Wohin die Raben im siebten Monat verschwinden
Da Tràng, die Krabbe
Das goldene Tier
Vom Fischer und der Schlange
Der Student und die Schildkröte
Der Elefant und die Heuschrecken
Nachwort
Editorische Notiz
Vorwort
Vietnam –
das ist für viele von uns aus dem Westen die blaue Bucht von Ha Long mit ihren tausend steilen bewaldeten Felseninseln zwischen denen die Fischer- und Touristenboote kreuzen: eine schimmernde Idylle, die wir, wenn nicht von Ferienreisen, doch aus Film und Fernsehen kennen: James Bond war hier – u. a.
Vietnam –
das ist in der Hauptstadt Hanoi der kühle monumentale geradlinige Bau aus Beton, verkleidet mit Platten aus glattem grauem Granit, Grabmal des Führers eines von ihm realisierten Ein-Parteien-Staates und Kriegsherrn: Ho Chi Minh, vor dem täglich Busladungen von Schülern und Studenten in langen Schlangen vorrücken, die den daneben liegenden hübschen Garten mit dem kleinen Holzhaus, in dem ›Onkel Ho‹ wohnte, nicht beachten.
Vietnam –
das ist die alte, unter der Sonne brütende Kaiserstadt Hué mit ihren gepflegten Grabanlagen, massiven Mauern, leeren Palästen und seerosenbedeckten, still fließenden Kanälen, 1858 von den Franzosen militärisch angegriffen und eingenommen.
Vietnam –
das ist der lange, weit geschwungene Sandstrand von Da Nang mit den kleinen Kriegsschiffen, den hohen Zäunen, den Militärbauten, dem Flugplatz und der steilen, staubigen Straße hinauf ins Hochland Annam. Lange lagen amerikanische Flugzeugträger in der Bucht, und schickten von da aus ihre tödliche Fracht der Bomben und des nicht zu löschenden Napalm übers Land.
Vietnam –
das ist die wimmelnde Ameisen-Stadt Saigon (amtlich: Ho-Chi-Minh-Stadt, aber wen kümmert’s?) – ein Gewusel von kleinen Autos, unzähligen Mopeds, Fußgängern, Bussen, Ochsenkarren, das weit ins ebene, fruchtbare, bebaute Land hinausgreift, in das wasserreiche, dschungelverschlungene Delta des Mekong, des sechs Länder verbindenden, fünftgrößten Stroms der Welt, wo heute Reisende auf überwachsenen engsten Wasserstraßen in schmalen Kanus die Wege des Vietcong gegen Dollars nachfahren.
Vietnam –
das ist ein gewaltsam in den Schrecken und das Chaos der Moderne gerissene Land. Seine Bevölkerung ist mit 95 ½ Millionen Einwohnern größer als die Deutschlands, seine Fläche jedoch um 26 500 km2 kleiner, als fehlte der BRD das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Seine stärkste Ressource sind seine Menschen: eher zierlich und klein, nie flamboyant, jedoch oft zäh und hartnäckig bis zum äußersten. Ihre Märchen – kaum eines kommt ohne Tiere aus! – sind unerwartet, sind anders: sehnig, schmal, gern pointiert, oft ein Sprichwort, ein Scherzwort oder ein Kinderspiel erinnernd oder daran anschließend, nicht gefühlig und nichts verklärend. Sie stammen zur Hauptsache aus einer früheren Welt der Bauern, der einfachen Handwerker, Hausierer, Fischer, Wald- und Landarbeiter, aus einer vorkolonialen Zeit, in der nicht alles Land in Einzelbesitz aufgeteilt war und strenge Lebensregeln galten. Die vietnamesischen Märchen lassen auch heute die Härte des Daseins durchscheinen. Der vorliegende Band bietet eine signifikante Auswahl.
Der Rabe und der Pfau
Der Rabe und der Pfau, die waren gute Freunde, hauptsächlich deshalb, weil sie beide so hässlich waren. Eines Tages saßen sie beisammen, da sagte der Rabe: »Die Vögel, alle die hier im Wald und auf den Bergen leben, sind so schön, ja, einer ist schöner als der andre. Sieh dir nur den Phönix an! Ach, er hat ein so kostbares, herrliches, wunderbares Gefieder! Nicht umsonst heißt es: ›Eine einzige Feder des Vogels Phönix wiegt eine ganze Schar Zaunkönige auf !‹ Oder nimm den Kranich: Wie schlank er ist! Wie erhaben er schreitet! Er ist ein würdiger Diener des Himmelskaisers. Und wenn nach tausend Jahren die Federn seines Hauptes silbern und weiß geworden sind, und wenn er so alt geworden ist wie eine Schildkröte, strahlt er noch immer jugendlich und schön. – Und wir? Wir sind beide hässlich! Kein Vogel auf der weiten Welt ist so hässlich wie wir!« – »Ach«, sagte der Pfau, »wir müssen uns damit abfinden, wir können es nicht ändern. Oder?!« – »Was? Was hast du da gesagt?«, fragte der Rabe. – »Ich? Dass wir’s nicht ändern können!« – »Krah! Lass es uns wenigstens versuchen!«, sagte der Rabe aufgeregt. – »Und wie?« – »Wie macht man schön aus hässlich? Mit Farbe!« – »Ja, mit Farbe!« Und, oh, alle Farben besorgte sich der Rabe und malte dem Pfau die schönen schillernden Augen auf die Federn. Wie der strahlte, wie der sich spreizte in der neuen Schönheit! Er war jetzt schöner als alle anderen Vögel! Er war der schönste von allen!
»Jetzt ich! Jetzt ich!«, drängte der Rabe und drückte dem Pfau den Pinsel in die Klaue. Aber noch als der überlegte, ob er mit Rot oder mit Blau die Verschönerung beginnen sollte, flog ein Schwarm Vögel aufgeregt zwitschernd über ihnen hin. »Wohin? Wohin?«, fragte der Rabe, der immer wissbegierig war, »Was gibt’s, wohin ihr fliegt?« – »Nach Süd! Nach Süd!«, zwitscherten die Vögel, »Da gibt es viele Felder voller Reis! Da gibt es Hühner, frisch geschlüpfte Küken! Manches Aas! Kiwitt! Komm mit!« – Oh, wie der Rabe da ungeduldig hin- und her hüpfte! »Mach doch! Beeil dich! Wie lang soll ich hier hocken, bis du ein Bisschen Farbe auf mich kriegst?! Nimm nicht den Pinsel! Nimm den Topf und kipp ihn aus! Ich brauch auch was zu fressen! Da, die Gelegenheit ist günstig! Im Süden!« Und ganz erschrocken nahm der Pfau den Kübel Farbe, der am nächsten stand, und goss ihn überm Raben aus. Der sprang empor und flog davon nach Süden.
Da ging’s ihm gut! Wie herrlich gab es da zu fressen! Und als er von allem, was er gerne fraß, genug gefressen hatte, machte er sich auf den Heimweg. Unterwegs, sich ausruhend an einem Wasserlauf, traf er auf einen Reiher, der ihn erstaunt ansah und dann in lautes Gelächter ausbrach. »Was gibt’s zu lachen? Krah!«, fragte der Rabe und sah an sich hinunter. Da sah er: Er war schwarz! Schwarz bis zu den Beinen und den Krallen! Tiefschwarz! Er hüpfte ans Wasser, legte den Kopf schief und sah sich darin gespiegelt: Schwarz! Tiefschwarz! Oh, wie er sich schämte! Flügelschlagend flog er auf und davon! Seither singt man das Liedchen:
Der Rabe weiß, wie schwarz er ist,
er ist ein schwarzer Vogel!
Die bunten Vögel meidet er,
doch nach den weißen hackt er mehr.
Und wenn er einen Reiher sieht,
krächzt er: »Krah, krah, ich schäme mich,
ich schäme mich so sehr!«
Specht und Eule
Vielleicht haben sie im selben Baum gelebt, ein Specht und eine Eule? Jedenfalls waren sie gute Freunde, sehr gute Freunde sogar! Wenn die Eule abends ausging, vertraute sie dem Specht ihr Haus an, und der passte mit seinem langen scharfen Schnabel darauf auf als wär er ein Schießhund. Hatte der Specht Besorgungen zu machen, ging’s umgekehrt. Und es ging gut, jahrein, jahraus, sehr gut sogar! Bis, ja, bis eines Tages sich der Specht auf eine längere Reise machen musste, sein Haus der Obhut der Eule übergab, und die Eule sich gründlich darin umsah. Oh, was fand sie da! Wie war das möglich?! Das Haus war voll der schönsten Schätze und vollgestopft mit Vorräten! Sie musste das haben, alles haben! Und sie schaffte alles fort!
Als der Specht nach seiner Reise zurückkam, fand er das Haus leer vor, ausgeraubt! Entsetzt ging er zur Eule hinüber, aber sie war nicht da. Er suchte sie baumauf, baumab und konnte sie nicht finden. War ihr etwas passiert? War sie von den Räubern entführt? Oder gar erschlagen? Wo er auch suchte, er fand sie nicht und keine Spur von seinen Schätzen. Ratlos war er da und tief betrübt, bis einer der geschwätzigen Sperlinge, die ja überall herumfliegen, sich in alles einmischen und tschilpend jeden Klatsch verbreiten, ihm kundtat, dass die Eule viele Male mit vollem Schnabel und vollen Klauen von seinem Hause weggeflogen sei. »Was?! Waswaswas?!«, rief da der Specht, »O Halunke! Halunke von Eule! Nie und nimmer hätt’ ich das gedacht!« Aber es half alles nichts! Die Eule blieb verschwunden. Doch seither herrscht bittere Feindschaft zwischen den beiden Vögeln und ihren Sippen. Erblickt ein Specht eine Eule, stürzt er sich, gefolgt von seinen Genossen, auf sie und mit dem Schrei: »Du Halunke!«, umringen sie sie und verlangen alles zurück, was die Eule seinerzeit gestohlen hat. Da flieht jede Eule vor der Übermacht und sucht das Weite. Nur nachts fliegt sie noch aus. Deshalb singen die Kinder bis heute das Liedchen:
Ihr Spechte, hört, gebt Acht! Gebt Acht!
’s ist noch nicht Nacht! ’s ist noch nicht Nacht,
doch da sitzt eine Eule!
Los, auf sie mit Geheule!
Weg will sie, aber kann’s nicht wagen!
Sitzt im Kreis, muss es ertragen!
Der Krebs aus Gold
Also: es war einmal ein reicher Mann, der viel, sehr viel besaß, aber am liebsten hatte er seine Katze, eine schöne samtweiche, schmiegsame und sehr anhängliche Katze. Aber er erfreute sich auch an Krebsen. Die konnte er freilich nicht als Haustier halten, und deshalb ließ er einen Goldschmied kommen und gab ihm den Auftrag, einen goldenen Krebs für ihn anzufertigen. Der Meister tat’s mit großer Sorgfalt und als er fertig war, brachte er ihn dem reichen Mann. Der fand das Werk meisterlich gelungen, so wie er sich’s gedacht: der Krebs aus Gold sah aus, als lebte er, und der Goldschmied wurde fürstlich entlohnt.
Der Reiche trug den Krebs nun bei sich, wo er ging, stand oder saß, betrachtete ihn, fuhr mit dem Finger sacht über seine goldene Oberfläche und freute sich tagtäglich an dem Werk. Einmal musste er, eines Geschäftes wegen, außer Haus gehen und vergaß, den Krebs mitzunehmen. Er kam zurück, der Krebs fiel ihm ein, aber der war nicht da. Überall suchte er jetzt den Krebs aus Gold, vergeblich! Er konnte ihn nicht finden; auch die Dienerschaft nicht. Da rief er die Katze und sagte: »Katze, du warst doch hier, als ich weg war; du müsstest doch wissen, wo der Krebs aus Gold ist. Such ihn! Findest du ihn nicht, dann muss ich denken, dass du ihn genommen hast. Dann werd ich dich bestrafen.« – »Eh! Wie kann ich wissen, wo der Krebs aus Gold ist?«, sagte die Katze, »Ich weiß nur, dass es eine Maus im Haus gibt, die alles benagt und fortträgt, alles maust. Ich spüre sie auf und frage sie, was sie darüber weiß.« – »Tu das, Katze! Und tu es rasch!«
Auf samtnen, seidenweichen Sohlen schlich nun die Katze durch das Haus, und als sie die Maus aufgespürt hatte, sagte sie: »Der Herr vermisst seinen Krebs aus Gold. Wenn du ihn genommen und weggeschleppt hast, bring ihn sofort zurück. Ich beiße dich sonst tot!« Die Maus zitterte vor Angst, sagte aber: »Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht genommen! Aber ich weiß genau, dass gestern, als der Herr außer Haus war, der Goldschmied hergeschlichen kam und ihn gestohlen hat. Lass uns uns zusammentun und den goldenen Krebs zurückholen!« – »Ein guter Vorschlag, komm!«, sagte die Katze. Sie wusste: das Haus des Goldschmieds stand am anderen Ufer des Flusses, sie würden also hinüberschwimmen müssen. Das war ihr widerwärtig – und aber auch wie! –, aber sie überwand ihre Abneigung und erlaubte der Maus, dass sie sich zwischen ihren Ohren festklammerte.
Das Haus des Goldschmieds war gut und fest gebaut, aber die Maus fand ohne langes Suchen doch ein Loch, durch das sie schlüpfen konnte, während die Katze draußen wartete. Überall lief nun die Maus herum, konnte den Krebs aus Gold aber nirgends entdecken, fand schließlich einen alten Koffer, nagte ein Loch hinein, und da, versteckt unter anderen Sachen, fand sie den Krebs aus Gold. Mühselig zog und zerrte sie ihn heraus und hinaus aus dem Haus, wo die Katze ihn packte und ins Maul nahm. Beide liefen so schnell sie konnten zurück zum Fluss. Als sie aber hinüberschwammen, verlor ihn die Katze aus dem Maul, und er versank. »Auwei!«, sagte die Katze am anderen Ufer, »Jetzt liegt der Krebs auf dem Flussbett; er ist mir aus dem Maul gerutscht. Und tauchen können wir beide nicht! Was machen wir jetzt?« – »Wir? Du! Ich hab ihn aufgespürt und aus dem Haus geschleppt, und du hast ihn verloren. Jetzt ist es deine Sache, sieh du zu!«, sagte die Maus empört. Da sah die Katze einen Fisch, der aus den Wellen sprang, paschte ihn und hielt ihn fest. »Du!«, schrie sie im höchsten Katzendiskant, »Du hast den goldenen Krebs! Ich habe ihn gerade verloren, und du hast ihn! Gib ihn sofort zurück, sonst fress ich dich auf der Stelle!« – »Tu mir nichts!«, sagte der Fisch in seiner Not, sonst sind Fische nämlich stumm, »Tu mir nichts! Ja, du hast Recht, er sank an mir vorbei, und da hab ich ihn geschnappt, weil ich dachte, das sei ein Leckerbissen, aber er war viel zu hart, und ich hab ihn ausgespuckt. Jetzt liegt er bestimmt unten im Flussbett.« – »Ja, dann hol ihn herauf, oder ich fress dich auf der Stelle!«, schrie die Katze. Und tatsächlich – der Fisch tat wie geheißen, tauchte hinunter und brachte den Krebs herauf. Die Katze dankte ihm nicht einmal. Sie legte sich das Schmuckstück auf den Kopf und machte sich mit der Maus auf den Weg, zu der sie sagte: »Ich trag ihn jetzt auf dem Kopf statt im Maul, dass ich ihn nicht wieder verliere. Rutscht er mir ’runter, merk ich es sofort. Gut, nicht?« Aber während sie noch so sprach, flog oben ein Rabe vorüber. Der sah da etwas Glänzendes, das wollte er haben. Vielleicht war es ja auch was zum Fressen? Und stürzte sich jäh hinunter, erhaschte den Krebs im Flug und flog nach oben in einen Feigenbaum.
Die Katze war mehr als verblüfft, sie war außer sich. »Was denn?! Was denn?!«, sagte sie zur Maus. »Das ist doch nicht möglich! Erst geht der Krebs im Wasser unter, und der Fisch muss uns helfen, dass wir ihn wiederkriegen. Dann holt ihn der Rabe dort oben auf den Baum. Und wen sollen wir jetzt dazu kriegen, dass er da hinauffliegt und dem Raben den goldenen Krebs wieder abnimmt?« – »Ach«, sagte die Maus, »Raben sind Vögel und zum Fliegen geboren, wir aber nicht! Und ich habe keinen, der fliegen kann, in der Verwandtschaft.« – »Ja, das weiß ich doch!«, sagte die Katze, »Lass mich nachdenken!« Dann dachte sie nach und sagte plötzlich: »Erinnerst du dich an die Geschichte, in der ein Mann sich totstellte, weil er einen Raben fangen wollte? So mach ich es auch! Ich will doch sehen, ob ich den Krebs aus Gold nicht wiederkriege, das wär ja gelacht!« Und sie sprang zum Fluss und soff so viel Wasser, dass sie ganz aufgebläht wurde. Dann schlich sie zurück, legte sich unter dem Baum auf den Rücken und streckte alle Viere von sich.