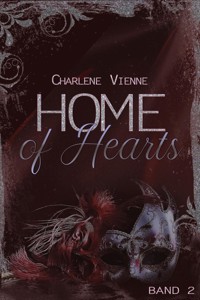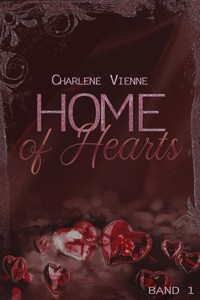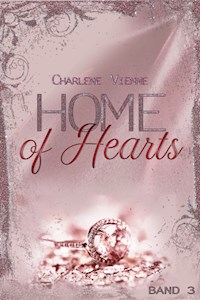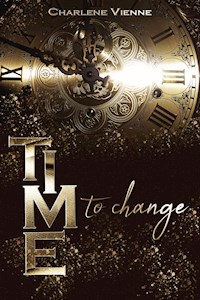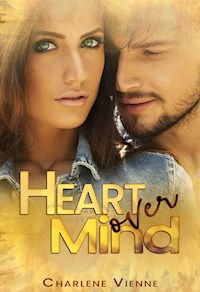3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Denises Entscheidung hat Tommaso jede Kraft geraubt, noch länger gegen sein grausames Schicksal anzukämpfen. In dem Glauben, die Frau, die er über alles liebt, hassen zu müssen, versucht er verzweifelt, seine frühere Stärke zurückzugewinnen. Denise kämpft ihrerseits um seine Liebe und ihr verloren gegangenes Glück! Nur Salvatore glaubt sich am Ziel, während seine Feinde im Hintergrund die Fäden für seine endgültige Vernichtung spinnen; und schon bald wird auch Tommaso vor die ultimative Wahl gestellt. Welche Opfer ist er bereit, zu bringen, um als Sieger aus dieser Schlacht hervorzugehen? Wer wird den Krieg gewinnen? Oder werden am Ende alle verlieren? Der finale Band der Time to-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Time to come home – Time to-Reihe Band 3
© 2020/ Charlene Vienne
www.facebook.com/Charlene.Vienne.Autorin/
Alle Rechte vorbehalten!
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.
Umschlaggestaltung
Charlene Vienne; Bilder: pixabay
Bildmaterial Buchlayout
pixabay
Lektorat/ Korrektorat
Elke Preininger
Erschienen im Selbstverlag:
Karin Pils
Lichtensterngasse 3-21/5/9
1120 Wien
Dieser Roman wurde unter Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst, lektoriert und korrigiert. Es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Orte, Events, Markennamen und Organisationen werden in einem fiktiven Zusammenhang verwendet. Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Markennamen und Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Das Buch enthält explizit beschriebene Sexszenen und ist daher für Leser unter 18 Jahren nicht geeignet.
Für alle, die bereit sind, jedes Opfer zu bringen,
um am Ende zuhause anzukommen!
Kurzbeschreibung
Denises Entscheidung hat Tommaso jede Kraft geraubt, noch länger gegen sein grausames Schicksal anzukämpfen. In dem Glauben, die Frau, die er über alles liebt, hassen zu müssen, versucht er verzweifelt, seine frühere Stärke zurückzugewinnen. Denise kämpft ihrerseits um seine Liebe und ihr verloren gegangenes Glück! Nur Salvatore glaubt sich am Ziel, während seine Feinde im Hintergrund die Fäden für seine endgültige Vernichtung spinnen; und schon bald wird auch Tommaso vor die ultimative Wahl gestellt. Welche Opfer ist er bereit, zu bringen, um als Sieger aus dieser Schlacht hervorzugehen? Wer wird den Krieg gewinnen?
Oder werden am Ende alle verlieren?
Der finale Band der Time to-Trilogie
Kapitel 1
Monique Harley, 1. Juli 2000, Acapulco
Die kleinen Arme, die sich um meinen Hals winden, bringen mir endlich Ruhe. Mein Herzschlag normalisiert sich, auch wenn es ein wenig dauert, weil die Freude, meine Jungs wiederzuhaben, einfach zu groß ist.
Ich sehe den Mann, den ich liebe, und die Frau, die uns zu all dem gezwungen hat, ein Stück weiter entfernt stehen. Sie sprechen miteinander. Er ist aufgeregt, ich erkenne es an seinen Gesten.
Ein wenig später kommt er zu mir. Ich lasse meine Söhne dennoch nicht los, zumindest ihre kleinen Hände bleiben in den meinen. »Können wir gehen?«, frage ich, obwohl ich nur zu gut weiß, dass es keinen Platz gibt, an dem wir sicher sein werden.
»Sie bietet uns Schutz, wenn ich ab sofort für sie arbeite.«
Seine Erklärung lässt mich schnauben. »Schutz«, murmle ich, sehe demonstrativ auf unsere Kinder, die hier als Geiseln festgehalten worden sind, um uns zu erpressen … – hier cutte ich meine Gedanken, möchte nicht daran denken, dass mein Geliebter und Vertrauter jemanden getötet hat, der mir so viel wert war. Bis – ja –, bis er die nächsten Worte ausspricht.
»Er lebt!«
Die Erleichterung, dich mich daraufhin erfüllt, spiegelt sich in seinen Augen wider. In diesem Moment bin ich fast froh, dass es Tommaso getroffen hat, und nicht Denise. Somit sind alle am Leben! Wäre der Plan unserer neuen Gönnerin aufgegangen, hätten zumindest die Babys mit Sicherheit nicht überlebt.
»Salvatore hat ihn gerettet, was bedeutet, dass er jetzt bei ihm ist. Und sie werden sich rächen wollen.«
»Aber wir haben es nur getan …«, beginne ich eifrig, als stünde ich tatsächlich vor Gericht, als mich eine Stimme aufschreckt.
»Jungs, warum geht ihr nicht eine Runde schwimmen?« Sie ist nähergetreten, und zu meinem Entsetzen reagieren meine Söhne sofort auf ihre Frage, lassen mich los und laufen in Richtung hinterer Garten. Meine verwaisten Hände fühlen sich an, als wären sie aus Eis.
»Ihr seid diejenigen, deren Gesichter, deren Namen er kennt.« Sie nimmt auf einem der Stühle Platz, ihre Beine sind übereinandergeschlagen. Das linke, das oben liegt, wippt. »Ihr habt keine Beweise, dass ich irgendetwas damit zu tun habe. Also wäre es taktisch unklug, den sicheren Schoß meiner Familie zu verlassen.«
Buzz setzt sich ebenfalls. »Und was verlangst du? Sollen wir einen neuen Anschlag auf sie planen?«
»Nein. Jetzt, im Nachhinein betrachtet, war es ganz gut, wie es gekommen ist. Es ist besser, zu warten, bis die Kinder auf der Welt sind.«
»NEIN!«, schreie ich unbeherrscht auf.
Ihre Augen ziehen sich zusammen. »Keine Angst, meine Liebe. Ich werde ihnen nichts tun. Ich dachte eher, wir können uns ihrer annehmen. Es wird sie umbringen, nicht zu wissen, wo sie sind. Oder ob sie überhaupt noch leben.«
Ich starre sie an, bin völlig überfordert und perplex über die Härte, mit der sie spricht. Jede ihrer Gesten, jedes Wort aus ihrem Mund, jeder Blick spiegeln den Hass wider, der sie beherrscht.
»Tommaso Salvatore Cosolino und die Schlampe, die er geheiratet hat, haben meinen Sohn getötet – dafür nehme ich ihnen jetzt, was sie am meisten lieben!«
Kapitel 2
Kaltes Schweigen war besser als die Hitze der Wut, oder die beißende Schärfe der Trauer, ganz abgesehen von der vernichtenden Leere seines Verlustes. Zuhause – normalerweise ein Wort, das Behaglichkeit, Zufriedenheit und Liebe symbolisiert. Für ihn hingegen bedeutete es die ultimative Niederlage. Zumindest was sein neues, schwer erkämpftes und doch schlussendlich zum Scheitern verurteiltes Leben betraf. Er war geflohen, hatte gelebt, geliebt, und jetzt war es vorbei. Das Schicksal hatte ihn eingesogen und die Überreste des Mannes ausgespuckt, der er hätte sein wollen, der er tief in seinem Herzen war, dem die Vorsehung aber einfach keine Chance gab.
Tommaso Salvatore Cosolino lag, gefangen in der Bewegungslosigkeit seines völlig erschöpften Körpers, in einem steril sauberen Bett. In einem Zimmer, dessen Anblick für ihn so gewöhnlich war, dass das Entsetzen darüber, wieder hier zu sein, selbst seinen Gedanken die Kraft raubten, zu bestehen. Seine Augen bewegten sich träge hin und her. Kein Irrtum möglich. Das war eines der privaten Krankenzimmer seines Vaters. Er erkannte es an den extravaganten Bildern an der Wand, so deplatziert, wie ein Zimmerschmuck nur sein konnte. Stylische, silbern schimmernde Jalousien an den Fenstern statt farbenfroher Vorhänge. Aber das untrüglichste Zeichen war wohl das kleine, surrende Auge in der rechten Ecke der Zimmerdecke. Es summte leise – wahrscheinlich zoomte die Kamera näher, weil sie bemerkt hatten, dass er wach war.
Er hörte Schritte vor der Tür. Zögernde Schritte. Das Nachhallen des Trittgeräusches zeugte davon, dass es sich um Frauenschuhe handelte, die gerade vor seinem Zimmer angehalten hatten. Sein erledigtes Hirn brauchte ein paar Sekunden, um die Geräusche dem zuzuordnen, was er eigentlich schon wusste. Genauso lange, wie die Person vor der Tür benötigte, um den Mut zu finden, die Klinke nach unten zu drücken.
Ein Schopf rotbrauner Locken erschien in der sich öffnenden Tür, dann das Gesicht einer Frau – seiner Frau. Eine eigentümliche Wehmut erfasste ihn, die aber immer noch besser war als die unbändige Wut, die er bis jetzt bei jedem Gedanken an sie verspürt hatte.
»Du bist wach«, sagte Denise mit einem zärtlichen Lächeln. Es war ihr anzusehen, wie müde und erschöpft sie war. Die letzten Wochen waren sicher nicht leicht für sie gewesen. Die Angst um ihn, die Trauer um … Er kappte seine Überlegungen. Doch da war kein Mitleid in ihm, das er ihr hätte schenken können. Er war leer. Er war tot.
Stattdessen starrte er sie an, außerstande, einen klaren Gedanken fassen zu können. Für einen Moment wünschte er sich das gnadenvolle Vakuum einer Amnesie herbei. Was wäre es für ein trostvoller Segen, nicht zu wissen, dass sie ihn verraten hatte. Wenn er sie immer noch lieben könnte. Wenn er nicht die verdammte Lektion hätte lernen müssen, die sein Vater so oft versucht hatte, ihn zu lehren. Nämlich, dass Liebe in ihrem Business nichts zu suchen hatte, weil eine rationale Entscheidung eben nicht möglich war, sobald das Herz mitspielte.
Denise straffte sich, darum bemüht, ihre Unsicherheit zu verbergen, während sie langsam eintrat, die Tür hinter sich schloss und schließlich auf ihn zukam. »Wie fühlst du dich?«, flüsterte sie mit einer so eingeschüchterten Stimme, dass sich sein Magen zusammenzog.
Deshalb, und auch, weil es ihm gleichzeitig die Kehle zuschnürte, antwortete er nicht, saugte jedoch ihren Anblick in sich auf. Trotz allem sah sie wunderschön aus in ihrem weitgeschnittenen Kleid aus hellgelbem Stoff. Um den Hals trug sie eine weiße, grobgliedrige Kette, und an ihren Füßen saßen passende, bis über die Knöchel geschnürte Sandalen. Ihr Gesicht war kaum geschminkt, aber dennoch rosig und strahlend, wie es eben schwangeren Frauen zu eigen war.
»Tom?« Sie nahm auf dem Stuhl neben seinem Bett Platz. Ihre Hand zuckte auf ihn zu und zog sich wieder zurück. Schließlich wagte sie es aber doch und griff nach der seinen. »Sag doch bitte etwas.«
Angestrengt schluckte er, bevor er über seine Lippen leckte. »Wo ist Sue?«, stellte er die einzige Frage, die ihn interessierte, und somit jene Frage, die Denise am meisten fürchtete. Das Rosa ihrer Wangen wich, und ihre Wimpern sanken nach unten.
Erst wartete er reglos, dann entzog er ihr seine Hand, worauf sie ihm wieder in die Augen sah. »Tom«, begann sie, stoppte jedoch, als ein verächtliches Lächeln seine Lippen kräuselte.
»Sie ist tot!«
Nun unterbrach sie den Augenkontakt und schluchzte auf.
»Du musst nichts sagen. Mein Vater hat es bereits für dich getan«, berichtete er emotionslos, danach drehte er sich seitlich von ihr weg.
»Es tut mir so leid.« Er hörte und spürte ihre Trauer, aber im Chaos seiner Psyche war da keine Energie, um sie zu bedauern. Da war nur Hass, und weil er sie gleichzeitig immer noch liebte, fraß sich die Verzweiflung ein weiteres Stück tiefer in sein Herz. »Geh, bitte.« Seine Bitte war kraftlos und doch endgültig.
Ein schmerzhaftes Ziehen in Denises Brust ließ ihren Atem stocken. »Bitte, Tom. Du weißt, dass ich sie geliebt habe.«
»Tommaso«, korrigierte jemand hinter ihnen, und während Toms Gesichtszüge weiter starr blieben, entgleisten Denise die ihren. Fast widerstrebend sah sie über die Schulter zurück, wo Salvatore stand – aufrecht und mit versteinerter Miene. »Mein Sohn heißt Tommaso Salvatore Cosolino. Du hast ihn anders kennengelernt, trotzdem möchte ich, dass du ihn ab sofort nur mehr mit seinem richtigen Namen ansprichst.«
»Ciao, padre«, grüßte nun auch Tommaso. Gleichzeitig rollte er sich zurück auf den Rücken. Dass er dabei so gelassen und ruhig klang, ließ Denise herumfahren, um ihn ungläubig anzustarren.
Salvatore belächelte ihre Irritation milde. Danach schenkte er seinem Sohn ein halbherziges Lächeln. »Wie fühlst du dich, mio figlio?«
»Gut«, erwiderte Tommaso.
Salvatore kam näher, sein Blick streifte seine Schwiegertochter. »Denise, würdest du uns bitte allein lassen?«
Unglaube und Fassungslosigkeit spiegelten sich abwechselnd auf ihrem Gesicht. Ihr Kehlkopf hüpfte auf und ab. »Ich möchte gerne mit Tom … mit Tommaso sprechen, bitte.« Ihre unterwürfigen, flehenden Augen schienen Salvatore zu gefallen. Zur Belohnung erntete sie ebenfalls ein kurzes Lächeln. Trotzdem lehnte er ihre Bitte ab. »Später, mia cara.«
»Tom … Tommaso, ich bitte dich.« Beschwörend fixierte sie nun wieder das blasse Gesicht ihres Mannes, doch der wandte sich nur gleichgültig ab. »Ich möchte meine Ruhe haben.« Er hörte ihr ersticktes Aufatmen und fügte ein »Bitte« hinzu.
»Wie du willst.« Mit einer Hand auf ihrem Bauch richtete sie sich auf – irgendwie war der Kontakt zu ihren ungeborenen Kindern das Einzige, das sie im Moment davon abhielt, den Verstand zu verlieren. »Ich warte einfach vor der Tür«, wisperte sie kraftlos.
»Musst du nicht.« Das bedeutete ihren endgültigen Rausschmiss, so viel war klar, und sie bemühte sich redlich, ihre Tränen zurückzuhalten. »Gut. Dann sehen wir uns einfach morgen.« Bevor er ihr auch das verbieten konnte, stürzte sie aus der Tür. Danach herrschte für ein paar Sekunden eisiges Schweigen.
Es war Salvatore, der schließlich das Wort erhob. »Du bist also sauer«, stellte er lässig fest.
Tommaso antwortete nicht, drückte nur seinen Kopf tiefer in das Kissen.
Ein paar leise Geräusche waren zu hören. Das Rascheln von Stoff, dann ein zartes Knarren – Tommaso nahm an, dass sein Vater es sich auf dem Stuhl vor seinem Bett bequem gemacht hatte.
»Also, mein Sohn. Du bist wieder zuhause. Und endlich, nach Wochen des Bangens, steht fest, dass du leben wirst.«
Erneut war ein eisiges Schweigen die einzige Antwort.
»Denise hat getan, was sie tun musste, um dein Leben zu retten. Sie liebt dich über alles. Das wirst du ihr doch nicht zum Vorwurf machen, oder?« Salvatore klang geschäftsmäßig und glatt. Nicht so, als würde er gerade die Tatsache besprechen, ein Leben ausgelöscht zu haben. Ein Leben, das Tom wertvoller gewesen war als sein eigenes.
Als sein Sohn weiter schwieg, stieß Salvatore ein Seufzen aus. »Es ist nicht sehr männlich, wie ein kleines Mädchen zu schmollen, mein Junge. Du bist ein Cosolino, also benimm dich auch so.«
Tommaso befeuchtete seine staubtrockenen Lippen, dann sprach er, allerdings so leise, dass sein Vater sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen. »Wird mein Arm wieder, oder bleibt er taub?«
»Der Doc sagt, du wirst dich vollständig erholen, auch wenn deine linke Hand nie wieder perfekt funktionieren wird. Die Feinmotorik wird eingeschränkt sein, aber zum Glück bist du ja Rechtshänder.«
Mit einem resignierten Seufzer rollte sich Tommaso auf den Rücken, obgleich er es nicht schaffte, seinem Vater ins Gesicht zu sehen.
Ein kleines Lächeln hob Salvatores Lippen. »Du hättest mich früher eingreifen lassen sollen.«
»Ich habe dich gar nicht um Hilfe gebeten«, stellte Tommaso säuerlich klar.
»Nein. Zum Glück war deine Frau klug genug, es zu tun.« Ein selbstgerechtes Grinsen löste das sanfte Lächeln ab, und Toms Miene erstarrte zu Stein. »Das werde ich ihr nie verzeihen«, sprach er nüchtern aus.
Salvatore lachte trocken. »Mach dich nicht lächerlich. Ich konnte dir sogar verzeihen, dass du meinen Tod wolltest.«
Nun legte sich ein dunkler Schleier über Tommasos Miene. »Hast du das?«
»Natürlich. Sonst hätte ich wohl kaum dein Leben gerettet.« Erneut knarrte der Stuhl, als Salvatore sein Gewicht verlagerte.
»Ich dachte, vielleicht hast du es getan, um deine Rache voll auskosten zu können. Mich fern von dir sterben zu lassen, und das nicht einmal durch deine – wenn auch indirekte – Hand, ist wohl kaum der Stil des Capo, oder?« Trotz des Inhalts der Worte klang Tom nicht im Entferntesten zynisch oder ärgerlich. Es war mehr eine nüchterne Feststellung.
»Ich hatte meine Rache. Du weißt, dass es oft sinnvoller ist, jemanden mit dem Verlust eines wichtigen Menschen zu treffen, als mit dem Tod selbst.«
»Also genügt es dir, dass du Sue getötet hast? Das Wissen, dass du damit mein Leben zerstört hast, das ist genug?« Nun musterte Tommaso seinen Vater doch intensiv – die Antwort auf diese Frage schien elementarer als alles andere, zumindest für diesen Moment.
»Ja.« Mehr als dieses emotionslos ausgesprochene Wort war nicht notwendig, und Tommaso nickte verstehend. Salvatore hatte seinen Sohn wieder, und er war, wie er ihn haben wollte. Leer und doch voller Zorn – genauso, wie er schon einmal von ihm aufgebaut worden war, damals, als er seine Familie das erste Mal verloren hatte, auch wenn der Verlust nicht annähernd so vernichtend wie dieses Mal gewesen war.
»Und du hast dafür gesorgt, dass der Mensch, der mir am nächsten stand, dir dabei geholfen hat«, vervollständigte Tom das Unfassbare, und sein Vater nickte erneut, ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht.
»Und genau deshalb kann ich euch beiden nicht verzeihen«, brachte Tom heiser hervor.
»Okay. Kein Problem. Mit mir musst du leider leben, ob es dir gefällt, oder nicht. Aber das andere.« Salvatore zuckte mit den Achseln. »Wir warten einfach, bis die Kinder auf der Welt sind, dann ist Denise weg.«
Tommasos Genick knackte, als er nun ruckartig den Kopf drehte, um die Augen seines Vaters zu taxieren. »Das würdest du nicht tun«, flüsterte er eindringlich, doch Salvatores kühle Miene eröffnete ihm, dass er zu so ziemlich allem bereit war.
»Ach. Würde ich nicht?«, gab er eiskalt zurück, und in diesem Moment erkannte Tommaso, was Denise blühen würde, wenn er es nicht schaffte, die Liebe zu ihr über den Hass siegen zu lassen – sie würde sterben und damit ein weiteres Mal er.
Für eine Sekunde war er versucht, Salvatore mitzuteilen, dass er bereits tot war, wenngleich sein Körper noch hier lag. Dass er nur vorgab, das Leben anzunehmen, das dieser verhasste Mann ihm geschenkt hatte, für den kleinen Preis – seine Schwester. Doch dann wurde ihm klar, was es heißen würde, Denise zu verlieren, und er konnte nur hilflos den Kopf schütteln.
Salvatore nickte, so als wüsste er genau, welche Gedanken seinen Sohn gerade quälten. »Hör mir jetzt gut zu, Tommaso.« Er lehnte sich mit den Unterarmen auf seine Oberschenkel und drückte die gespreizten Finger seiner rechten Hand gegen seine Lippen. »Ich hatte eigentlich vor, jeden – wirklich jeden, der an meiner Niederlage beteiligt war, zu töten.« Er machte eine eindrucksvolle Pause, dann sprach er betont deutlich weiter: »Auch dich.« Wieder kehrte Schweigen ein. Offensichtlich wartete er eine etwaige Reaktion von Tommaso ab. Als diese jedoch nicht erfolgte, nicht einmal in Form eines kurzen Zuckens in seinem Gesicht, räusperte er sich und fuhr fort. »Aber ich konnte es nicht, ob du es mir nun glaubst, oder nicht. Du bist alles, was mir an Familie geblieben ist, und ich liebe dich. Daher wirst du leben, und Denise auch, wenn du es willst. Was dich betrifft – du wirst alles tun, damit du gesund wirst. Und dann wirst du in dein altes Leben zurückkehren. Du wirst deine Aufgaben in der Firma wieder übernehmen. Und du wirst mein Sohn sein, und zwar nicht nur zum Schein.« Das letzte Wort hatte er betont.
Tommasos Kopf ging hin und her. Aber nur einmal, danach hielt er inne, und Salvatore lächelte zufrieden. »Du wirst dich entscheiden, und zwar in den nächsten Stunden, ob du dein restliches Leben mit Denise verbringen willst, oder nicht. Und diese Entscheidung wird endgültig sein, egal wie sie ausfällt. Du kennst meine Meinung dazu. Wenn man sich bindet, dann für immer. Aber, wie auch immer du dich entscheidest – die Kinder bleiben auf jeden Fall hier, im Notfall eben bei mir.«
Tommaso setzte an, zu antworten, doch die erhobene Hand seines Vaters stoppte ihn, noch bevor ein Ton über seine Lippen gekommen war. »Sag jetzt nichts. Überleg es dir gut.« Salvatore nickte energisch, so als hätte er ihm zugestimmt, und stand gleich darauf auf. »Ich werde morgen Mittag wiederkommen. Da kannst du mir deine Entscheidung mitteilen.« Kaum ausgesprochen, verließ er, ohne eine Erwiderung abzuwarten, das Zimmer.
Die nächsten Stunden verbrachte Tommaso damit, abzuwiegen, was ihn härter treffen würde. Der endgültige Verlust seiner Liebe, die als Einigkeit seiner Zuneigung, erst zu Sue, dann zu Denise, das Licht seines Daseins gewesen war. Oder die Tatsache, dass der Mensch, dem er am meisten vertraut hatte, ihn hintergangen und dadurch einen Teil dieser Liebe zerstört hatte, weiter in seinem Leben sein würde. Ihn täglich daran erinnern würde, was er verloren hatte. Denn Denise anzusehen war, wie einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, in dem er klar sehen konnte, wer die wirkliche Schuld an Sues Tod trug. Er selbst war es. Ohne ihn wäre die Kleine noch am Leben. Wenn sie nicht das Pech gehabt hätte, ihn als Bruder zu haben, hätte sie noch Vater und Mutter und würde irgendwo ein ruhiges, friedliches Dasein führen.
Schon einmal hatte er Nächte voller Entscheidungsqualen in einem Krankenhaus verbracht, und damals hatte er sich falsch entschieden, das war ihm heute klar. Er hatte egoistisch gewählt. Vorgegeben, jemand zu sein, der er nicht war. Ein Leben imitiert, das niemals für ihn bestimmt gewesen war. Und er war gescheitert. Mit den Folgen, dass sein waghalsiger Versuch allen Menschen, die ihm jemals etwas bedeutet hatten, das Leben gekostet hatte.
Nur Denise war noch da, doch sie weiterhin zu lieben, würde den größten Verrat an seinem Herzen bedeuten. Also musste er sie hassen, auch wenn jede Faser seines Körpers nach ihr verlangte. Es war klar, dass es Salvatore nicht darum ging, ob Denise hier oder woanders leben würde. Die Frage lautete, ob sie überhaupt leben würde. Die Kinder, die sie in sich trug, schützten sie, aber nur jetzt. Danach war sie auf Tommasos Schutz angewiesen, und im Grunde war ihm bewusst, dass er nichts anderes tun konnte, als ihn ihr zu gewähren. Denn auch wenn er im Moment das Gefühl hatte, sie nicht mehr lieben zu können – sie war sein. Für immer.
›Du bist die Liebe meines Lebens, Tom. Mein Herz wird immer dir gehören, egal was passiert‹, hörte er noch einmal ihren Schwur. Es war lange her, und doch – so wie er ihr damals geglaubt hatte, tat er es auch heute. Und da wurde es ihm klar. Denise war seine Frau, die Liebe seines Lebens. Gleichzeitig bedeutete sie aber seine Buße für all die Sünden, die er begangen, vielleicht bereut, doch niemals dafür gebüßt hatte. Plötzlich erfüllte ihn beinahe so etwas wie Erleichterung und Ruhe. Sein Tod hätte ihn befreit, Denise und Sue jedoch ein Leben ohne ihn, ähnlich dem, das jetzt vor ihm lag, aufgezwungen.
Leider verflog die seltsame Leichtigkeit, die ihn zusammen mit diesem Gedankengang erfüllt hatte, genauso schnell, wie sie gekommen war. Stattdessen manifestierte sich ein Bild vor seinem inneren Auge. Ein Abbild des grauenhaftesten Moments. Sue, leblos und schlaff in Davids Armen. Der Mann, der ihm mehr Vater gewesen war, als Salvatore es je werden würde. Auch er hatte ihn verraten. Er hatte Salvatore angerufen! Gegen seinen Willen!
Ein zartes Klopfen rief sein Denken zurück ins Hier und Jetzt, doch es dauerte fast eine Minute, bis er die Kraft fand, ein leises »Herein« herauszubringen.
Die Tür glitt auf und Denise lugte ins Zimmer, ihr Blick so ängstlich und verunsichert, dass er es einfach nicht übers Herz brachte, sie sofort wieder hinauszuwerfen.
»Kann ich bitte reinkommen?« Sie klang unterwürfig, und das Zittern ihrer Stimme setzte sich in Tommasos Händen fort. Nur ein winziges Nicken schaffte er, doch Denise nahm es erleichtert zur Kenntnis und trat näher, bevor er es sich vielleicht noch anders überlegte.
»Geht es dir besser?«, wisperte sie, während ihr Blick zwischen dem Stuhl neben seinem Bett und ihm hin und her huschte.
»Wir sollten reden«, sagte Tommaso leise, doch sie erschrak, als hätte er sie angebrüllt.
»Ja. Natürlich.« Wieder fixierte sie erst den Stuhl, dann das schmale Stückchen Platz, das am Rand seiner Matratze frei war.
»Wie lange bin ich schon hier?«, fragte er und nickte gleichzeitig in Richtung Stuhl, was ihr eindeutig zeigte, wo er sie haben wollte.
Seufzend ließ sie sich nieder. »Vierundzwanzig Tage. Die erste Woche warst du ohne Bewusstsein. Die Ärzte mussten dich in ein künstliches Koma versetzen, damit dein Körper in Ruhe gegen das Gift kämpfen konnte.«
»Ich dachte, sie hätten ein Gegengift gehabt.«
Ihr Kopf ging rauf und runter. »Hatten sie auch. Aber irgendwie hat es anfangs nicht so gewirkt, wie gedacht.«
Er konnte sie nicht ansehen, zumindest nicht direkt. Trotzdem musste er hinüberblinzeln, um ihre Silhouette einzufangen. »Ist dir nicht einmal die Idee gekommen, dass ich es nicht verdient habe, weiterzuleben? Dass es mir vorherbestimmt war, zu sterben?« In jedem Wort war zu hören, wie sehr er selbst von diesem Gedanken besessen war.
Denise seufzte erneut. »Natürlich sollst du leben. Zweifle nicht daran.«
Ein heiseres Lachen kroch in seiner Brust nach oben. »Und Sue? Sie sollte nicht leben?«
Schluckgeräusche erklangen, als sie versuchte, die aufkommende Panik hinunterzuschlucken. »Natürlich hat sie es verdient zu leben. Ich wusste doch nicht …«
»Hör auf!« Nun brüllte er wirklich, auch wenn die Kraft seiner Stimme zu wünschen übrig ließ – seine Stimmbänder waren von den letzten stummen Wochen einfach zu erschöpft. Danach brannte sein Hals, also hob er seine rechte Hand und umschloss ihn damit.
Denises Augen waren angstvoll geweitet und musterten ihn so verzweifelt, dass sein Herz sich schmerzvoll zusammenzog.
»Er …« Tommaso brach sofort wieder ab. Seine Hand rieb seine Kehle auf und ab, dann streckte er die Linke zur Seite, um nach dem Glas Wasser zu greifen, das auf dem Nachttisch stand. Gleich darauf war ein klirrendes Bersten zu hören, als es auf dem Fliesenboden zerschellte.
Beide erstarrten, doch während Denise ein bisschen verlegen den Blick senkte, fixierte er nur ungläubig seine linke Hand. Er hatte das Glas nicht gespürt, als er es berührt hatte.
Die nächste Frage stellte er vollkommen ruhig. »Hast du mit den Ärzten gesprochen?«
Die Überraschung über seine Worte war ihr anzusehen. »Ja. Natürlich.«
Seine rechte Hand legte sich auf die linke und rieb sie gedankenverloren. »Warum spüre ich nichts?« Er hielt die Hand hoch und wackelte mit seinen Fingern. Die Bewegungen waren etwas ungelenk, aber deutlich sichtbar.
»Der Doc sagt, dass die Funktion der Hand wieder vollständig hergestellt ist, die Nerven aber teilweise tot sind«, erklärte Denise fast schon schüchtern.
»Toll«, stellte er nur ironisch fest.
»Spürst du denn gar nichts?« Sie beugte sich interessiert vor.
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, während er immer noch seine vor und zurück schwankenden Finger beobachtete. »Schon, aber die Berührung spüre ich nicht. Fast so, als könnte das Gefühl nicht von außen nach innen dringen.«
Denise musterte ihn unglücklich. »Soll ich eine Schwester holen?«
Mit einem Mal verschloss sich sein Gesicht wieder gänzlich und er ließ sogar seine Hand Hand sein. »Nein.«
»Aber …«, begann sie, doch sein vernichtender Blick zwang sie sofort, erneut zu verstummen. »Wusstest du schon vorher, dass David ihn angerufen hat?«
»Nein«, hauchte sie unglücklich. »Aber du darfst ihm deswegen nicht böse sein. Er liebt dich, er wollte dich nur …«
»Warum zur Hölle habt ihr meine Entscheidung nicht akzeptiert, wenn ihr mich doch so liebt?«
Sie sah ihn nicht an – konnte es nicht.
Er seufzte. »Ist doch auch egal jetzt«, fuhr er fort. »Mein Vater hat von mir eine Entscheidung verlangt.«
Nun ruckte ihr Kopf nach oben. »Welche Entscheidung?«
Ein ungläubiges Lachen kam über seine Lippen. »Welche Entscheidung? Ist das dein Ernst?«
Denise sog hilflos Luft in ihre Lungen. Irgendwie fühlte es sich an, als müsste sie ersticken. »Sag es mir doch einfach«, bat sie verzweifelt. Trotz unendlicher Vertrautheit war ihr der Mann im Bett so fremd, wie jemand einem nur sein kann. Die Angst vor dieser Situation beherrschte sie seit dem Moment, als sie Salvatore ihre Unterstützung zugesagt hatte. Als sie die endgültige Trennung von Tom und Sue akzeptiert hatte, nur damit sie ihn und somit ihr Leben nicht verlor.
»Er verlangt seinen Preis, was sonst?«, presste er angestrengt hervor.
Das ›Aber den hat er doch schon bekommen‹verbiss sie sich vorsichtshalber – es war wohl kaum nötig, ihn an den katastrophalen Deal zu erinnern.
Anscheinend erwartete Tommaso auch keine Antwort, denn er sprach fast unverzüglich weiter. »Ich muss als sein Sohn zurückkehren. In sein Haus und in die Firma – die Familie –, und ich muss es überzeugend tun.«
»Denkst du, dass du das kannst?«
Ihre sachlich ausgesprochene Frage überraschte ihn. »Ich werde es können müssen, Denise. Da du uns hierher zurückgebracht hast, bleibt mir keine andere Wahl.«
Ihre Wimpern sanken nach unten. »Wenn du wieder gesund bist, …« Ihr Blick hob sich und huschte in die rechte obere Ecke, wo ein kleines summendes Auge ihrer Unterhaltung folgte. Dann sah sie ihn wieder an und fuhr fort: »… hast du jede Möglichkeit …«
»Habe ich nicht«, unterbrach er sie barsch. »Das weißt du. Und sicher ahnst du auch, dass eine weitere Entscheidung auf dem Programm steht. Und diese betrifft dich.«
Ihr Mund klaffte auf. Ihr Blick versuchte, sich mit dem seinen zu verhaken, doch er sah sofort von ihr weg. Seine offensichtliche Ablehnung drückte ihre Kehle zusammen. Eiskalt war ihr plötzlich geworden, und sie fröstelte, während sie sich an das Gespräch mit Alex erinnerte. Ihre eigene schlimmste Angst, in seine Worte gefasst: ›Das wird er dir nie verzeihen!‹
»Ich weiß, dass du es nur getan hast, weil du mich nicht verlieren wolltest, und ich versuche wirklich, dir zu glauben, dass du nicht wusstest, dass Sue dadurch ihr Leben verlieren wird.« Sie nahm den Unterschied der beiden Aussagen überdeutlich wahr. Seine Zweifel aber nun laut zu hören, jagte ihr einen weiteren eiskalten Schauer über den Rücken.
Ihre Angst vor der Antwort ignorierend, stellte Denise schließlich jene Frage, die unnachgiebig aus ihrem Herzen drängte. »Was hat er dir erzählt?«
Tommasos Kopf ruckte hoch, und sie erkannte, dass das strahlende Grün seiner Augen verschwunden war. Geblieben war ein schlammiges Oliv, gleich einer vom Regen überschwemmten Wiese.
»Ich meine, was hat er dir erzählt, wie sie …« Sie konnte es nicht aussprechen und flehte stumm um seine Gnade, es auch nicht tun zu müssen.
Ein paar Atemzüge lang gewährte er ihr seinen Blickkontakt, dann unterbrach er ihn mit einem vagen Ächzen. »Er sagte, dass jeder Zaubertrick irgendwann endet. Und dass ein Leben das andere aufwiegt. In dem Moment, als ich sein Leben opfern wollte, um Sue zu schützen, hätte ich ihr endgültiges Todesurteil unterschrieben. Und dass es das Gleiche gewesen wäre, wenn ich Sue damals bei der Zaubershow hätte sterben lassen.«
Ihre Lippen bildeten einen dünnen Strich, der Schmerz in seiner Stimme war übermächtig.
»Er hat mir versichert, dass sie nicht leiden musste …« Seine Augen flogen auf der Suche nach Bestätigung zu ihr, und als sie rasch ihren Blick niederschlug, entkam ihm ein Keuchen. »Denise«, hauchte er, aber nun war sie es, die ihn nicht ansehen konnte. »Hat er gelogen?«
Das Einzige, was sie ihm geben konnte, war ein deutliches Kopfschütteln, doch das genügte zumindest so weit, als dass es ihm ein bisschen Entspannung zurückgab. Sie hingegen fühlte stechende Übelkeit in sich aufsteigen. Ihn anzulügen war fast schwerer als die eigentliche Tat selbst.
»Wie konntest du das zulassen?«, fragte er kraftlos.
»Ich wollte nicht, dass wir Sue verlieren, aber ich konnte dich doch nicht einfach sterben lassen.« Ihre gehauchte Erklärung verscheuchte das letzte bisschen Wärme aus seiner Mimik.
»Ich wäre lieber gestorben, als hierher zurückzukehren.« Seine Stimme war kalt, gefühllos und gleichzeitig gebrochen.
Denise wich zurück, Tränen brannten wie Salzsäure in ihren vor Unglauben geweiteten Augen. »Du wärst lieber gestorben, als bei mir zu sein? Bei mir und deinen Kindern?«
Sein Adamsapfel hüpfte auf und ab. »Wir wären frei gewesen. Alle.«
»Du wärst tot gewesen«, hauchte sie kraftlos.
»Besser als das.«
Ihre Lider sanken nach unten. »Das meinst du nicht so.«
Sein Blick war ohne Leben, während er mit der rechten Hand durch seine Haare strich. »Ich wäre lieber gestorben, als zu ertragen, dass meine Kinder hier aufwachsen. Als zu sehen, wie mein Vater gewinnt. Als wieder seinem Willen unterworfen zu sein.«
»Ich hätte nicht ohne dich weiterleben können.« Denises Stimme brach. Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann hemmungslos zu weinen.
»Warum nicht?«, hörte sie ihn fragen. Er klang emotionslos, einfach nur ein bisschen neugierig.
Ungläubig sah sie auf, fixierte seine gebrochene Miene. Vor Erstaunen waren sogar ihre Tränen wieder versiegt. Da war keine Wärme in seinem Blick. Das wunderschöne Grün seiner Augen hatte jeden Glanz verloren und einem stechenden gewittrigen Dunkel Platz gemacht. Die Lippen schmal, die Haltung seines Kopfes unwirklich starr, so als müsste er alle Kraft aufwenden, um ihn oben zu halten. In ihm schienen keine Gefühle mehr für sie zu existieren, keine Anzeichen, dass irgendwo in ihm noch ihr Tom steckte. »Weil ich dich liebe«, wisperte sie.
Und da lachte er. Böse, laut, und gleichzeitig so voller Schmerz, dass ihr Innerstes in einer eiskalten Flamme verbrannte. »Wenn du mich lieben würdest, hättest du gewusst, dass ich diese Entscheidung niemals getroffen hätte.« Er bedachte sie mit einem letzten vernichtenden Blick, bevor er sich wegdrehte.
Die Stille danach dröhnte wie eine brüllende Explosion. Denise hielt sich selbst krampfhaft ruhig, wenn auch mit deutlich wahrnehmbarer Mühe. Ein paar Schluckversuche waren nötig, dann gelang es ihr, die Frage zu formulieren, die sie sich immer wieder stellte, seit dieser Albtraum begonnen hatte: »Nicht einmal für mich? Hättest du mich sterben lassen?«
Sofort sah er sie wieder an, entsetzt und ein bisschen unentschlossen. Den Hauch Unsicherheit nutzte sie aus – sie musste es einfach tun. »Für deine Kinder?«, setzte sie also nach.
»Das ist nicht fair«, flüsterte er.
»Nein!« Energisch wanderte ihr Kopf hin und her. »Das sind solche Fragen nie.«
Er wischte mit einer Hand über sein Gesicht. »Es warst aber nicht du, die im Sterben lag.« Seine Worte schafften es nur gedämpft hinter seiner Handfläche hervor, die er nun auf seinen Mund presste.
»Nein. Aber ich hätte es sein sollen. Der Anschlag hat mir gegolten, nicht dir.«
»Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, indem das Schicksal einfach die Weichen gestellt hat«, deklarierte er so übertrieben, dass Denise für eine Sekunde sogar grinsen musste. Als Reaktion darauf wanderte seine rechte Augenbraue nach oben. »Findest du das witzig?«
»Nein.« Nun war zu hören, dass sie wirklich alles andere als amüsiert war. Sie klang schon beinahe wütend. »Ich finde gar nichts witzig, Tom.«
»Tommaso«, verbesserte er sie automatisch, erschrak aber, als sie ein giftiges »Nein!« zurückzischte.
»Was?«
»Nein. Mir ist egal, wie dein Name war, bevor wir uns getroffen haben. Ich habe dich als Tom kennen und lieben gelernt. Und ich habe dich geheiratet. Dich, Tom Miller, und nicht Tommaso Salvatore Cosolino. Ihn kenne ich nicht und ganz ehrlich – wenn er dem Mann, der mich gerade ansieht, als wäre ich verrückt, auch nur im Entferntesten ähnelt, dann will ich ihn auch nicht kennenlernen.« Sie hatte sich in Rage geredet, ihre Wangen leuchteten rot und ihre Augen funkelten wie sprühende Sterne.
Für einen winzigen Augenblick waren sie wieder Tom und Denise. Zwei junge, furchtbar verliebte Teenager, die einander mehr liebten und brauchten, als es Worte jemals hätten ausdrücken können. Doch auch jetzt war es eine klitzekleine Erinnerung, die das Bild in tausend Scherben zerbersten ließ. Zwei leuchtend grüne Augen, riesig, in einem zartgebräunten Kindergesicht, die nach einem weißen Lichtblitz zu stumpfen, schwarzen Knöpfen in einem bleichen, toten Antlitz wurden.
Mehr bedurfte es nicht, um das bisschen Wärme wieder aus Tommasos Herzen zu vertreiben. »Wenn du ihn nicht kennenlernen willst, wirst du gehen müssen. Denn hier, in Chicago, im Haus meines Vaters, werde ich genau der sein.« Es war sein Ernst, was er da gesagt hatte, das war ihr augenblicklich klar, und das ließ sie gequält aufstöhnen.
Er nickte, so als hätte sie etwas gesagt. »Also müssen wir uns eigentlich nur eine Frage stellen.« Sein Lächeln wirkte aufgesetzt und gezwungen. »Wollen wir noch miteinander leben?«
Aufgeschreckt sah sie ihm nun direkt in die Augen. »Natürlich will ich mit dir leben. Warum sonst hätte ich das alles gemacht?«
»Und will, oder besser – kann ich noch mit dir leben?«
Er wusste nicht, woraus sie diese Kraft schöpfte, aber sie war da und zauberte eine Selbstsicherheit in ihre Haltung, die er insgeheim einfach bewundern musste.
Mit gespreizten Fingern legte sie beide Hände auf ihren prallen Bauch. »Ich bin deine Frau und die Mutter deiner Kinder, also wirst du wohl einen Weg finden müssen, um mit mir zu leben.«
Sie stand auf, ohne seine Antwort abzuwarten, und eilte zur Tür. Mit der Hand an der Klinke hielt sie noch einmal inne und flüsterte: »Gute Nacht. Bis morgen.« Dann war sie verschwunden.
Sobald sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, sank Denise gegen die Wand, glitt mit dem Rücken daran hinunter und floss zu Boden wie ein spannungsloses Stück Stoff. Obwohl bereits Tränen über ihre Wangen strömten, hatte sie keine Kraft, um richtig zu weinen. Ihr Herz schien zu implodieren, so stark pochte es, so sehr schmerzte es unter dem Druck, mit dem ihre Angst sie niederstreckte.
»Gib ihm Zeit, mia cara.« Salvatores Stimme voller zärtlichem Mitgefühl umschmeichelte ihren von der Trauer geschüttelten Körper.
Obwohl sie seine Nähe kaum ertragen konnte, beruhigte es sie gleichzeitig irgendwie, dass er hier auf sie gewartet hatte. Sie lugte erschöpft zu ihm hoch. »Er hasst mich.«
Salvatores Lächeln gewann an Tiefe. »Nein. Er liebt dich. Aber er verliert eben nicht gern. Er ist ein Cosolino.«
»Er ist davon überzeugt, dass ich Sue geopfert habe«, presste sie verzweifelt hervor.
»Er wird drüber hinwegkommen.«
»Warum kann ich ihm nicht sagen, dass sie lebt?«
Sein Lächeln verschwand, während er neben ihr in die Hocke ging und seine Handfläche auf ihre tränennasse Wange legte. »Du kennst den Deal. Ich habe meinen Teil gehalten. Nun bist du dran.«
Kapitel 3
Zehn Tage nachdem er aufgewacht war, kam der Tag von Tommasos Entlassung. Er fiel auf einen Dienstag, der ein helles, freundliches Licht auf den Herbst warf. Doch auch das konnte nicht das Entsetzen in Toms Innerem schmälern, welches ihn bei dem Gedanken erfasste, heute endgültig wieder in sein altes Leben zurückkehren zu müssen.
Sein Vater erschien gegen elf Uhr vormittags in seinem Zimmer, stattlich in Anzug und Mantel gehüllt, beides in Dunkelgrau. Nur einen Moment später trat auch Denise ein. Ihr weitschwingendes, winterweißes Cape wirkte elegant, obwohl dessen Farbe ihre Blässe sogar noch unterstrich. Das marineblaue, weitgeschnittene Chiffonkleid darunter bestand aus zwei Lagen. Die zweite davon war transparent und ließ das Muster des darunterliegenden Stoffes zart durchscheinen. Ihre Haare waren zu einem lockeren Dutt hochgewunden und unter einem kleinen, blauen Hütchen versteckt, das an einer Seite ein Stück in ihr Gesicht ragte. Ihr Make-up war stärker als früher, trotzdem konnte es kaum ihre Augenringe und die eingefallenen Wangen kaschieren. Genauso wenig, wie ihr aufgesetztes Lächeln darüber hinwegtäuschen konnte, wie verloren und verzweifelt sie sich fühlte.
»Bereit für deine Heimkehr?« Salvatores Grinsen war triumphierend und gleichzeitig arrogant, und Tommaso wurde von einer Welle des Hasses erfasst, der ihm beinahe die Luft nahm.
»Natürlich«, antwortete er nur schwach, trat den beiden entgegen und nickte seinem Vater zu. Danach wandte er sich an Denise, konzentrierte seine gesamte Kraft darauf, sich nicht anmerken zu lassen, wie groß sein Zorn auf sie noch war, und hauchte ihr einen sanften Kuss auf die Wange. Ihr folgender tiefer Atemzug war nur für ihn zu hören, und weil er ihr gleichzeitig die Hand an den rechten Oberarm gelegt hatte, spürte er zusätzlich, wie sie erschauerte und ansetzte, ihn zu umarmen. »Nicht«, bat er leise, und ihre Arme, die sich eben gehoben hatten, um ihn zu umschlingen, fielen wieder hinab. Für einen Moment sahen sie sich in die Augen, und es war Denise, die als Erste wegsah – einfach, weil da so viel Kälte in seinem Blick war.
Das blieb von Salvatore natürlich nicht unbemerkt, weshalb er seinen Sohn strafend musterte. Also beschwor Tommaso ein falsches Lächeln herauf und nahm seine Tasche, die gepackt neben dem Bett stand.
»Nicht doch!«, wies ihn sein Vater zurecht und rief, wenn auch verhältnismäßig leise, über seine Schulter: »Marco!«
Augenblicklich öffnete sich die Tür und ein etwa zwanzigjähriger junger Mann trat ein. »Yep, Boss?«
Salvatore verdrehte genervt die Augen. »Tasche«, knurrte er danach.
»Wow, Dad!«, merkte Tom zynisch an. »Die neuen Leute präsentieren sich sehr interessant.« Wenn er daran dachte, wie die alte Riege praktisch vor dem Capo strammgestanden hatte, entkam ihm tatsächlich fast ein Lachen.
»Es ist dein Verdienst, dass der Großteil unserer Jungs weg ist, mio figlio«, wandte Salvatore grimmig dreinblickend ein, worauf Denises Blick sofort zu ihrem Mann huschte.
Der sah mittlerweile jedoch betont gelangweilt zu Boden, seine rechte Schulter zuckte. »Viele sind doch zurückgekommen, du hättest sie ja leben lassen können.«
»Habe ich auch, aber eben nur die, deren Reue echt war.«
Tommasos rechte Augenbraue wanderte hoch. »Waren wohl nicht viele. Die letzten Tage habe ich jede Menge neue Gesichter gesehen.«
Salvatores Miene verschloss sich blitzartig, dann funkelte pure Wut in seinen Augen. »Ich habe den falschen Männern vertraut – so wie du auch!«, sagte er, und obwohl er nicht gebrüllt, ja nicht einmal laut gesprochen hatte, war es, als würde der Raum unter seiner Stimme vibrieren.
Marco, der mittlerweile abmarschbereit mit der Reisetasche an der Tür stand, senkte den Blick, Denise hielt ängstlich die Luft an. Tommaso aber blieb vollkommen ruhig, starrte seinem Vater nur ungerührt ins Gesicht. »Dann ist es ja gut, dass ich wieder hier bin, wo jeder nur mein Bestes will.« Seine sarkastische Bemerkung schien Auswirkungen auf die Atmosphäre des Raums zu haben. So wie die Höhe eines Berges die Atemluft dünner machte.
Panisch blickte Denise zwischen ihm und ihrem Schwiegervater hin und her und fixierte schließlich den Älteren. Dessen Miene war ähnlich ausdruckslos wie die seines Sohnes. Nur der verräterisch hektische Atem verriet das Offensichtliche – nämlich sein Ringen damit, die Beherrschung nicht zu verlieren. Es war nicht schwer zu erraten, in wessen Richtung sich sein Groll bei einem etwaigen Misserfolg dieses Vorhabens entladen würde, denn seine Augen ruhten ausschließlich auf Tommaso. Denises Magen zog sich zusammen, gleichzeitig legte sie die rechte Hand haltsuchend auf ihren prallen Bauch. Sie verfluchte sich selbst dafür, mitgekommen zu sein. Am Morgen war ihr kurz der Gedanke gekommen, Schwangerschaftsbeschwerden vorzutäuschen, um dem hier zu entgehen, doch die Sehnsucht nach Tom war größer gewesen als die Angst vor ihm.
»Ich hol schon mal den Wagen.« Der junge Typ schlüpfte aus dem Raum, bevor noch irgendjemand etwas dagegen sagen konnte.
Sobald die Tür hinter ihm zugegangen war, straffte sich Salvatore, nach wie vor das Gesicht seines Sohnes fixierend. »Zweifelst du daran? Dass ich dein Bestes will?« Die Entschlossenheit in Tommasos Augen rang ihm Stolz ab, genauso wie die ruhige Kraft, mit der er antwortete.
»Du wirst verstehen, dass deine Vorgehensweisen oft schwer zu verdauen sind. Gib mir Zeit, damit ich wieder meinen Platz in diesem Leben finden kann.«
»Natürlich.« Salvatores Erwiderung war an Großzügigkeit kaum zu übertreffen. »Aber vielleicht ist für deine Heimkehr mehr notwendig als nur meine Geduld. Ich meine …« Ein bitteres Lachen folgte. »… vielleicht sollte man die Dinge von dir fernhalten, die dich an deine alten, falschen Entscheidungen erinnern könnten.«
Tommasos Schock über diese Äußerung war ihm deutlich anzusehen. Ruckartig bewegte er sich auf Denise zu, packte fast grob ihre Hand. Salvatore lachte böse. »Nicht doch, mio figlio.«
Denise kämpfte mit unterschiedlichen Empfindungen, die Toms Berührung in ihr ausgelöst hatte. Sehnsucht und gleichzeitig Panik, denn ihr war klar, dass das gerade nur ein Reflex gewesen war, um ihr Leben zu schützen.
»Bleib ruhig.« Salvatore lächelte falsch. »Fürs Erste fahren wir nach Hause. Alle zusammen.«
»Und dann?« Tommaso klang unendlich müde.
»Dann sehen wir weiter«, lautete die betont gleichgültige Erklärung, die einen so eisigen Unterton hatte, dass Denise alle Kraft aufwenden musste, um nicht in Tränen auszubrechen.
Eine halbe Stunde später trafen sie bei der Villa ein. Trotz strömenden Regens stand das Personal Spalier. Einige Gesichter kamen Tommaso bekannt vor, nur das wichtigste fehlte, wie er wehmütig, aber ohne es sich anmerken zu lassen, feststellte. David war verschwunden, gemeinsam mit Alex und Melina. Spurlos – zumindest soweit es ihn betraf. Natürlich weigerte sich sein Vater, ihm zu sagen, was aus ihnen geworden war. Und irgendwie hatte Tommaso keine Kraft, über die Optionen nachzudenken.
Als sie ausstiegen, nahm Tommaso erneut Denises Hand. Um sie nicht merken zu lassen, wie sehr ihm diese Berührung widerstrebte, setzte er sein bestes Pokerface auf. Trotzdem unterließ er es, das Ergebnis seiner Täuschung zu prüfen – so gefühllos, dass es ihn kalt gelassen hätte, ihre Enttäuschung zu sehen, war er dann auch wieder nicht.
In der Vorhalle hielt er kurz inne, sein Blick flog die Treppe hinauf. Dort oben hätte sich sein Schicksal entscheiden sollen. Damals, an diesem schicksalsträchtigen Abend. Leider war ihm seine eigene Entscheidungsschwäche in die Quere gekommen.
›Wenn du willst, dass es gut erledigt wird, dann mach es selbst und unverzüglich‹. Das war einer von Anthonys Leitsprüchen gewesen. Jetzt zu bereuen, sich nicht daran gehalten zu haben, war gleichbedeutend mit der Dummheit, die ihn hatte glauben lassen, dass er es jemals schaffen würde, aus seinem eigenen Leben auszusteigen.
»Lunch wird um zwei Uhr serviert. Wenn ihr euch vorher zurückziehen möchtet, ist das okay für mich.« Sein Vater nickte großzügig in Richtung Säulengang, durch den es zum Trakt ging, in dem ihre Wohnung lag.
»Gut. Also, bis später.« Bevor Denise ebenfalls etwas dazu sagen konnte, hatte Tommaso sich in Bewegung gesetzt. Marco, der junge Typ aus dem Krankenhaus, folgte ihnen, die Reisetasche wieder in seiner Hand.
Ihre Absätze trommelten ein bizarres Konzert, während sie schweigend durch den Gang und endlich die Treppe nach oben eilten. An der Wohnungstür angekommen, ließ Tommaso Denise los, schnappte sich die Tasche mit seiner Rechten und entließ Marco mit einem knappen »Danke«.
»Jederzeit!« Das breite Lächeln schien wie festgewachsen auf dem jugendlichen Gesicht. Bevor Tommaso sich jedoch darüber ärgern konnte, drehte der junge Mann ab und verschwand über die Treppe.
Er selbst legte seine linke Hand an den Türknauf, doch das Zugreifen wollte nicht so recht klappen. Mit einem resignierten Schnaufen ließ er wieder los. »Könntest du?« Als Reaktion auf seine, von einem Nicken Richtung Tür begleitete Frage zog Denise verwirrt die Brauen hoch.
Ihr Unverständnis reizte seine ohnehin stets präsente Wut. Gleichzeitig wusste er natürlich, wie unfair das war, hatte er sie doch absichtlich die letzten Tage seine nicht vorhandenen Fortschritte betreffend im Dunkeln gelassen. »Der Doc testet ein neues Mittel, daher habe ich zurzeit nur eine funktionierende Hand«, erklärte er eher unwillig. »Eine Nebenwirkung. Die Taubheit ist erst einmal schlimmer geworden.« Seine immer noch gehandicapte Linke demonstrativ spannungslos hin und her schwingend, zuckte er mit den Schultern, worauf sie ein kurzes Seufzen ausstieß.
»Das tut mir sehr leid«, hauchte sie, wobei es klang, als fehle ihr der Atem für eine lautere Antwort.
»Die Tür, Denise«, forderte er nur ungeduldig, und kaum hatte sie diese geöffnet, schob er sich an ihr vorbei. Die Tasche fiel im Vorzimmer zu Boden, während er weiter zum Wohnraum eilte, ohne darauf zu achten, ob sie ihm nachkam oder nicht.
Denise seufzte erneut und schloss die Tür. Ihre ohnehin verschwindend kleine Hoffnung, Tom würde sich hier, außerhalb von Salvatores Einfluss, zumindest zu einem winzigen Teil als der Alte entpuppen, schwand erschreckend schnell dahin. Ihre Schuhe abstreifend sah sie mit müdem, etwas unschlüssigem Blick hinter Tommaso her. Seine Schritte waren bereits verklungen, also musste er gleich bis ins Schlafzimmer gegangen sein. Ein tiefer Atemzug hob und senkte ihre Brust, dann legte sie ihr Cape ab, hängte es an einen der freien Haken, zog die Haarnadel, die ihren Hut festhielt, heraus und platzierte beides auf der Kommode. Noch einmal lauschte sie in den Wohnraum, und wieder war nichts zu hören. Nach einem weiteren kräftigen Einatmen setzte sie sich in Bewegung und betrat nur wenig später das Schlafzimmer.
Doch Tom war nicht hier. Während sie mit einer Hand ihre Augen bedeckte und darüber rieb, ging ein wellenförmiger Druck durch ihren Bauch. Einer der Zwillinge war wach. Versonnen strich sie über die Stelle, und für einen Moment erschien ein zärtliches Lächeln auf ihrem Gesicht. »Daddy ist hier«, wisperte sie leise. Ihre Handfläche streichelte sanft auf und ab, und erneut pochte von drinnen eine kleine Faust dagegen. »Das wird schon. Ich verspreche es euch. Irgendwie bekomme ich das wieder hin.« Ehe sie es sich versah, liefen Tränen über ihre Wangen, wischten ihr Lächeln weg. Diese verräterischen Dinger. Wie schnell sie hervorkamen in den letzten Tagen. Ganz so, als würden die Babys ihre Verzweiflung fühlen, spürte sie ein weiteres Mal eine deutliche Bewegung. Ihr Blick fiel auf das breite Bett. Noch nie hatten Tom und sie hier zusammen geschlafen, und irgendwie befürchtete sie gerade, dass das auch jetzt nicht passieren würden.
Sie horchte auf Geräusche, irgendeinen Anhaltspunkt, in welchen der Räume Tom verschwunden war, doch es herrschte nur vollkommene Stille, bis auf ihr Herz, das, zumindest für sie, lautstark pochte. Trotzdem wusste sie, wo er war, stieß hart den Atem aus, ging los und steuerte zielsicher Sues Zimmer an. Schon während sie die Türklinke nach unten drückte, war ihr klar, dass er sie jetzt nicht bei sich haben wollte. Also hielt sie mitten in der Bewegung inne, entschloss sich aber schließlich, gegen ihr Wissen zu handeln und öffnete lautlos die Tür.
Er lag auf dem rosa Himmelbett, den Blick zum Fenster gerichtet. »Verschwinde«, murmelte er nur, aber obwohl sie zusammenzuckte, trat sie langsam näher.
»Warum können wir nicht gemeinsam trauern? Wir haben sie doch beide verloren.« Die Tränen waren wieder da und deutlich zu hören.
»Denise. Bitte geh. Ich kann jetzt nicht in deiner Nähe sein.« Seine Worte, so ruhig sie auch gesprochen waren, hatten dennoch die Wucht von Speerspitzen, die ihren Brustkorb durchbohrten.
»Es tut mir so leid, Tom«, schluchzte sie.
Mit einem verzweifelten Stöhnen vergrub er sein Gesicht in der weichen, flauschigen Tagesdecke, die über das Bett gespannt war. »Versteh doch! Ich ertrag dich jetzt nicht. Bitte geh!« Es glich fast einem Flehen, war mit so viel Schmerz behaftet, dass Denise nichts anderes mehr blieb, als entsetzt zu fliehen.
Wie benommen stürzte sie zurück ins Schlafzimmer, warf sich auf das Bett und rollte sich, soweit mit ihrem ausladenden Bauch möglich, zu einer Kugel zusammen. Minutenlang wurde ihr Körper von stoßartigen Schluchzern erschüttert, während ihre Tränen den Kissenbezug durchnässten. Immer mehr krümmte sie sich zusammen, versuchte, durch den Druck ihrer um sich selbst geschlungenen Arme Halt zu finden, der sie davor bewahren sollte, in den Abgrund zu stürzen. Toms Trauer, seine Verzweiflung, die mit nur einem, oder besser zwei Worten weggewischt werden könnte, zwang ihre, in den letzten Tagen mühsam aufrecht erhaltene Fassung gnadenlos in die Knie. Niemals würde sie das hier durchstehen – ohne ihn. Also lag sie da, ergab sich ihrem eigenen Schmerz, hervorgerufen durch die Endgültigkeit der Tragweite einer Entscheidung, die sie aus Liebe getroffen hatte, und die ihr nun die Liebe nahm.
Irgendwann wurde ihr Weinen schwächer, leiser, und die eintretende Stille brachte auch innere Ruhe mit. Ein Blick auf ihre zarte goldene Uhr – ein Geschenk von Salvatore – ließ sie seufzen. Es blieben ihnen nur noch Minuten, bis sie nach unten mussten, um mit dem Mann zu essen, der sein persönliches Vergnügen darin sah, ihr Leben und ihre Liebe zu zerstören.
»Er erwartet sicher, dass wir uns zum Lunch umziehen.« Sie schrak auf, als Tommasos emotionslose Stimme erklang und fuhr herum. Er stand in der Zimmertür, den Blick zu Boden gesenkt, die Schultern spannungslos.
»Okay«, erwiderte sie nur, rappelte sich etwas ungelenk auf und kletterte aus dem Bett.
»Ich …« Er unterbrach sich selbst, indem er kurz die Lippen aufeinanderpresste. Denise meinte, er würde nach Worten ringen, bis ihr klar wurde, dass dies sein persönlicher Kampf um einen freundlichen Umgang mit ihr war. Innerlich vor Kälte erzitternd wartete sie, bis er endlich leise weitersprach. »Kann ich zuerst?«
Ratlosigkeit legte sich auf ihre Züge, gleich darauf wurde sein ausdrucksloser Blick von einem Augenrollen abgelöst. Sichtlich genervt nickte er in Richtung Ankleideraum. »Ich nehme an, meine Kleidung ist auch da drin. Kann ich mich also zuerst umziehen?«
Nun verstand sie – und zwar nur zu gut. Er wollte nicht länger als unbedingt nötig im selben Raum sein wie sie. Diese neuerliche Zurückweisung brannte wie heiße Glut in ihr, daher bejahte sie nur mit einem stummen Nicken.
»Ich mach auch schnell«, murmelte er, während er eilig an ihr vorbeischlüpfte, um im angrenzenden Zimmer zu verschwinden.
Denise drückte ihre Augen zu, beschwor weitere Tränen, drinnen zu bleiben. Sie konnte jetzt wirklich keinen neuerlichen Weinanfall gebrauchen. Mit pochendem Herzen saß sie da, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass, wenn sie nicht um diese Ehe kämpfte, es niemand tun würde. Also straffte sie sich, nahm einen tiefen Atemzug und trat ebenfalls in den anschließenden Raum.
Tommaso, lediglich in engen schwarzen Boxershorts und offenem Hemd, drehte sich sofort zu ihr um. Seine Augenbrauen zuckten nach oben, doch sie hielt seinem abweisenden Blick tapfer stand. »Ich denke, die Zeit ist zu knapp, um auf getrenntes Ankleiden zu bestehen«, merkte sie nur leise an und wandte sich dem Schrank mit ihren Abendkleidern zu.
Während sie im Augenwinkel einfing, wie ihr Mann sich kopfschüttelnd abwandte, um nach seiner Hose zu greifen, strich sie über die erlesenen Stoffe ihrer neuen Garderobe. Ein Stück schöner als das andere reihte sich hier aneinander. Natürlich konnte sie den Großteil davon im Moment nicht tragen, da ihre Schwangerschaft bereits zu weit fortgeschritten war.
Ihre Hand stoppte an einem im Stil einer römischen Toga geschnittenen Kleid. Es war weiß, mit golden abgesteppten Applikationen – eine zarte, sich um einen filigranen Ast windende Blumenranke.
Sie zog es heraus, legte es auf einen Hocker und begann sich auszuziehen. Wieder erhaschte sie die kurze, aber deutlich wahrnehmbare Drehung von Tommasos Kopf in ihre Richtung. Nun trug sie lediglich ihre Unterwäsche, die genauso blau war wie das Kleid vom Vormittag und somit unter dem weißen Stoff ihrer Abendgarderobe zu sehen wäre. Vorsichtig lugte sie zur Seite, während sie ein hautfarbenes Set aus dem Wäscheschrank nahm. Und wirklich war nicht nur sein Blick auf sie gerichtet – nein, auch sein Kehlkopf hüpfte auf und ab, als er heftig schluckte. Ihr Lächeln kam von selbst, hervorgelockt von der Freude darüber, dass er sie zumindest immer noch begehrte. Doch wie so oft in diesen Tagen wandelte sich ihr Hochgefühl recht rasch in eine rasante Talfahrt, denn er schnappte sich kurzentschlossen seine restlichen Klamotten und eilte hinaus.
Ein Seufzen ausstoßend sackte sie zusammen, spürte, wie sie erneut von Kälte erfüllt wurde. Mechanisch schlüpfte sie erst in die Unterwäsche, dann in das Kleid und schließlich in zwei hochhackige goldene Sandalen. Danach ging sie hinüber zu ihrem, von Salvatore großzügig aufgefülltem Schmuckschränkchen, legte ein goldenes Collier mit weißem Stein und passende Ohrring an und betrat schlussendlich das Schlafzimmer.
»Bist du fertig?«, wurde sie augenblicklich von Tommaso begrüßt. Er trug einen dunkelgrauen Anzug mit hellgrauem, allerdings noch aufgeknöpftem Hemd und eine schwarze Krawatte. Düster, dachte sie, als sie ihn ansah. Und das galt vor allem für seinen Gesichtsausdruck.
Sie zwang ihren Blick wieder nach unten, um dem seinen nicht zu begegnen. Das Eis in seiner Stimme war erschreckend genug. »Gleich. Ich muss mir noch die Haare machen«, murmelte sie nur, und noch ehe sein verärgertes Schnauben verklungen war, hatte sich die Badezimmertür hinter ihr geschlossen.
Drinnen trat sie vor den breiten Spiegel, unter dem die zwei nebeneinanderliegenden Waschbecken montiert waren. Marmor. Was sonst? Geschickt löste sie einen Teil ihres Haarknotens und flocht die Strähnen zu einem dicken Zopf, den sie über ihre Schulter nach unten hängen ließ. Dann steckte sie den Rest wieder fest, tupfte sich etwas Farbe auf die blasse Haut und betonte ihre Wimpern mit Mascara. Ein Seufzer folgte dem obligatorischen Abschlussblick auf ihr Spiegelbild.
Ein trauriges, ein bisschen zu mageres Gesicht sah ihr entgegen. Die Augen riesengroß und mit einem geheimnisvollen Schimmer versehen, der Aufregung und Zufriedenheit suggerierte, aber in Wirklichkeit den ungeweinten Tränen ihrer unendlichen Verzweiflung geschuldet war. Wie so oft holte sie sich Kraft, indem sie mit beiden Händen über ihren prallen Bauch strich. Ihre Kinder – Toms Kinder. Sie schliefen im Moment oder verhielten sich einfach ruhig.
»Denise. Wir müssen los!«, drängte Toms Stimme vom Nebenzimmer aus. Nein, das stimmte nicht. Toms Stimme war warm gewesen, von der Liebe zu ihr erfüllt. Der Mann, der jetzt im Raum nebenan stand, liebte sie nicht. Vielleicht mochte er sie nicht einmal mehr. Ein Schluchzen krallte sich in ihrer Kehle fest, drängte mit aller Kraft nach draußen, doch sie kämpfte und gewann. »Ich bin fertig«, rief sie also, legte Lippenstift auf, eilte hinaus und hielt überrascht inne.
Er hatte sich noch einmal umgezogen, trug nun statt dem dunkelgrauen Anzug, den er ursprünglich gewählt hatte, eine beige Hose und ein gleichfarbiges Sakko mit goldenem Einstecktuch. Das weiße Hemd, das er darunter anhatte, war wieder offen.
Erstaunt sah sie ihm nun doch ins Gesicht, wo ein klitzekleines, fast verlegenes Grinsen in seinem Mundwinkel hing. »Passt besser«, bemerkte er nur knapp, worauf sie nickte und ebenfalls ein zartes Lächeln zustande brachte.
»Könntest du mir beim Zuknöpfen des Hemdes helfen? Das schaffe ich leider einhändig nicht.« Wie zum Beweis wackelte er mit seiner gehandicapten Hand.
»Natürlich.« Jeder Zentimeter, den sie ihm näherkam, ließ ihr Herz schneller schlagen. »Fast wie früher in London«, hauchte sie unsicher, während sie die ersten beiden Knöpfe schloss. »Da haben wir auch immer zusammenpassende Kleidung getragen.« Ihre Finger zitterten, was sich noch verstärkte, als sie beim Schließen des letzten Hemdknopfes mit den Fingerspitzen die Haut seiner Brust berührte.
»Es ist wichtig, dass die da unten uns abnehmen, dass alles in Ordnung ist.« Seine nüchterne Feststellung holte sie schlagartig in die Wirklichkeit zurück.
»Alles nur Show«, stellte sie ironisch fest. Gleichzeitig ärgerte sie sich darüber, dass ihre Enttäuschung über diese Tatsache nur allzu deutlich zu hören war.
Tommasos Stirn zog sich in Falten. »Ja. Es muss ungefähr so ablaufen wie in London. Ich werde dich ein bisschen links liegen lassen, das gehört quasi zu der Rolle, in die mich Salvatore wieder pressen möchte. Aber ein paar Blicke oder hin und wieder eine kurze Berührung sollten wir wohl austauschen. Das haben wir schließlich damals auch gemacht.«
Denise versuchte verzweifelt, nicht die Contenance zu verlieren. Sein Vorschlag klang, als würde er Unmögliches erbitten. Nicht einmal ein tiefer Atemzug schaffte es, ihren aufkommenden Ärger zu verscheuchen. Dementsprechend bissig waren ihre folgenden Worte gefärbt: »Na, dann hoffe ich mal, dass es für dich nicht zu schwer wird, mich anzusehen oder zu berühren.«
Sofort verschwand selbst das angedeutete Lächeln von seiner Miene. »Ist das wirklich so schwer nachvollziehbar?«, fragte er kaum hörbar. »Ich meine, was hast du denn erwartet? Dass ich einfach weitermache, als wäre nichts geschehen? Dass ich mir denke: ›Schwamm drüber‹, und mit dir und ihm auf heile Familie mache?«
Seine Fassungslosigkeit schockierte sie und endete als fester Knoten in ihrem Magen. Wie auf Befehl schlug einer der Zwillinge aus, fast so, als wollte er ebenfalls seinen Unglauben zum Ausdruck bringen. »Nein. Natürlich nicht. Aber ich wünschte mir …« Sie brach ab und presste fest die Lippen zusammen, um nur ja kein verbotenes Wort auszusprechen.
»Was?«, seufzte er. »Was wünschst du dir?« Er musterte sie mäßig interessiert.
In der Hoffnung, weder von Kameras beobachtet noch von versteckten Mikrofonen belauscht zu werden, wagte sie einen winzigen Vorstoß: »Ich wünschte mir, du würdest mich besser kennen.«
Unendliche Traurigkeit dominierte mit einem Mal seine Züge. »Ich habe gedacht, dass ich dich kenne«, wisperte er, drehte ab und ging los.
Alles in ihr schrie danach, ihm die Wahrheit hinterherzubrüllen. Ihn zu befreien, und damit auch sich selbst, ihnen beiden den Frieden zurückzugeben. Doch diese Wahrheit hatte eben zwei Seiten, und die Rückseite dieser Medaille barg die allgegenwärtige Gefahr, die Sue drohte, falls Salvatore herausbekommen sollte, dass Denise ihren Schwur gebrochen hatte. Das wusste sie. Also schwieg sie weiter. Und Tom hasste sie weiter. Tiefe Atemzüge bewegten ihre Brust, bis sie irgendwie die Kraft fand, ihre Tränen zurückzudrängen. Dennoch – als sie Tommaso schließlich folgte, glitzerten ihre Augen, als würden romantische Glücksgefühle darin tanzen. Dabei explodierte ihr Herz gerade in einem Inferno der Hoffnungslosigkeit.
Kapitel 4
Entgegen Tommasos Annahme, dieser Lunch würde in einem pompösen Willkommensfest enden, war der Tisch zwar festlich, aber lediglich für drei Personen gedeckt. An einer Seite des Raumes befand sich ein Stehtisch, darauf eine Flasche Champagner, ein Krug Orangensaft und Gläser. »Ich nehme an, wir sollen hier warten«, murmelte Tom. Er hielt Denises Hand und zog sie mit sich. Sie sprachen nicht, warteten nur, bis Salvatore ein paar Minuten später zu ihnen stieß. Sein schwarzer Anzug passte wie angegossen und er wirkte erholt, als läge ihre Ankunft nicht eineinhalb Stunden, sondern eine ganze erholsame Nacht zurück.
»Denise. Du siehst wunderschön aus«, begrüßte er seine Schwiegertochter, ging mit ausgestreckten Armen auf sie zu und umarmte sie. »Tommaso«, hieß er danach, begleitet von einem Nicken, seinen Sohn willkommen, der den Gruß mit einem kurzen »Hi« erwiderte.
»Lasst uns anstoßen.« Salvatore griff sich ein Glas Champagner und eines mit Orangensaft, die ein herbeigeeilter junger Mann inzwischen eingeschenkt hatte, und hielt sie Tommaso hin.
Der nahm folgsam beide entgegen und reichte den alkoholfreien Drink galant an seine Frau weiter. Diese strenge Hierarchie, selbst beim Verteilen von Aperitifs, kotzte ihn an, was ihm aber keineswegs anzusehen war.
Denise bedankte sich lächelnd, während Salvatore sein eigenes Glas schnappte. »Beviamo alla famiglia. Spero che, …«, begann er beschwingt, wurde jedoch von einem lauten »Salute« unterbrochen.
Sein tadelnder Blick traf Tommaso, der aber lediglich ein ironisches Lächeln aufsetzte. »Oder, der Muttersprache der Mehrheit hier geschuldet: Cheers!« Er hob seinen Champagner, prostete den beiden zu und trank anschließend, ohne eine Erwiderung ihrerseits abzuwarten.
»Es wäre höflich gewesen, mich aussprechen zu lassen«, beschwerte sich Salvatore streng.